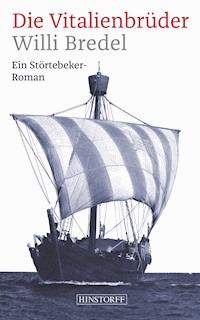8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Verwandte und Bekannte
- Sprache: Deutsch
Mit „Die Enkel“ erschien 1953 der abschließende Band von Willi Bredels herausragender Trilogie „Verwandte und Bekannte“, der Geschichte einer Hamburger Arbeiterfamilie, die gleichzeitig Spiegel des Weges der deutschen Arbeiterbewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist. Im Zentrum der Geschehnisse steht die Enkelgeneration um Walter Brenten, Herbert Hardekopf und Viktor Brenten während des „Dritten Reichs“. Die Nationalsozialisten übernehmen die Macht und wenige Jahre später beginnt der Zweite Weltkrieg. Die Hauptfigur Walter Brenten verkörpert hier den Idealtyp des deutschen Antifaschisten und Kommunisten und so erzählt der Roman eindringlich vom kommunistischen und sowjetischen Kampf und Widerstand gegen den Faschismus. Auf seine eigene Lebenserfahrung bauend, versteht Bredel es dabei meisterhaft, die Menschen des Volkes zu charakterisieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Willi Bredel
Willi Bredel, geboren 1901, war ein deutscher Schriftsteller und gehörte zu den Pionieren der sozialistisch-realistischen Literatur. Als Sohn eines Hamburger Zigarrenmachers lernte er zunächst Dreher und engagierte sich außerdem in der Sozialistischen Arbeiterjugend sowie im Spartakusbund. 1919 trat er in die KPD ein. Während der Weimarer Republik wurde er politisch verfolgt und mehrfach verurteilt. 1933 ging er ins Exil u. a. nach Paris und Moskau und diente von 1937 bis 1939 als Kommissar in einer »Internationalen Brigade« im Spanischen Bürgerkrieg. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil engagierte er sich als Kulturpolitiker beim Aufbau der DDR und wurde später Präsident der Akademie der Künste der DDR. Bredel verstarb 1964 an einem Herzinfarkt in Ost-Berlin. Bei Aufbau Digital ist seine herausragende Romantrilogie »Verwandte und Bekannte« mit den Bänden »Die Väter« (1941), »Die Söhne« (1949) und »Die Enkel« (1953) verfügbar.
Informationen zum Buch
Mit »Die Enkel« erschien 1953 der abschließende Band von Willi Bredels herausragender Trilogie »Verwandte und Bekannte«, der Geschichte einer Hamburger Arbeiterfamilie, die gleichzeitig Spiegel des Weges der deutschen Arbeiterbewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist.
Im Zentrum der Geschehnisse steht die Enkelgeneration um Walter Brenten, Herbert Hardekopf und Viktor Brenten während des »Dritten Reichs«. Die Nationalsozialisten übernehmen die Macht und wenige Jahre später beginnt der Zweite Weltkrieg. Die Hauptfigur Walter Brenten verkörpert hier den Idealtyp des deutschen Antifaschisten und Kommunisten und so erzählt der Roman eindringlich vom kommunistischen und sowjetischen Kampf und Widerstand gegen den Faschismus. Auf seine eigene Lebenserfahrung bauend, versteht Bredel es dabei meisterhaft, die Menschen des Volkes zu charakterisieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Willi Bredel
Die Enkel
Roman
Inhaltsübersicht
Über Willi Bredel
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster TeilDie Niederlage
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Zweiter TeilDer Sieg
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Impressum
Erster TeilDie Niederlage
Erstes Kapitel
I
Es läutete.
Theodor Sinder, Klassenlehrer der 5 B, zog wie gewöhnlich, wenn die Schulglocke ertönte, seine Taschenuhr hervor, schüttelte den Kopf, als komme ihm dieses Läuten völlig unerwartet, und las weiter: »… fassen wir zusammen: Die Vorgeschichte der Germanen, also die Zeit, aus der uns keine schriftliche Überlieferung vorliegt, war früher in tiefes, undurchdringliches Dunkel gehüllt. Vielfach herrschte die Vorstellung, als habe diese Zeit in einem dumpfen, fast tierischen Hindämmern ohne geistige Regungen und ohne höhere Ansprüche an das Leben bestanden …«
Stimmenlärm drang vom Korridor herein. Die Schüler horchten auf. Natürlich wieder die 5 A, die macht immer als erste Schluss. Ein prima Lehrer, der dicke Rochwitz. Geflüster und Gekicher flatterte von Schulbank zu Schulbank. Deutlich hörte man: »Alter Sündenknochen, hör auf!«
Sinder hob erstaunt, unwirsch sein dürres Gesicht über dem hohen Kragen, der den strunkartigen Hals schamhaft verdeckte. Er presste die schmalen, blutleeren Lippen aufeinander, und die knochigen Finger seiner Rechten zitterten, das Zeichen, dass Ärger ihn ankam.
Die Schüler beobachteten mit Luchsaugen jede Bewegung ihres Lehrers. Zufrieden stellten sie den üblichen Ablauf aller ihnen bekannten Symptome fest: Mit dem überraschten Blick auf die goldene Sprungdeckeluhr ging es los, und nach dem nervösen Zurechtrücken der Brille setzten die Spinnenfinger der rechten Hand ihr unruhiges Spiel fort. Die Linke lag, der Klasse selten sichtbar, gewöhnlich unterm Pult. Hastige und strenge Blicke folgten, die das Scharren und Murren in der Klasse ersticken sollten. Und schließlich kam dann der von den Jungen ungeduldig erwartete Ausruf: »Schluss also … Heil Hitler!«
Soweit war es aber noch nicht. Theodor Sinder, dessen Spezialfächer Geschichte und Deutsch waren, musste nach den neuen Bestimmungen (für den Geschichtsunterricht) die vorgeschriebene Zusammenfassung vornehmen, die Nutzanwendung sozusagen.
»Welche Lehre ergibt sich nun aus dem Gesamtbild der Vorgeschichte unserer Ahnen für unsere Zeit?«
»Das Schulschluss ist!« Die ganze Klasse kicherte. Etliche drehten sich um; sie hatten wohl gehört, dass es Fritz gewesen war, der Frechste, aber neben Berni auch der Begabteste der Klasse.
»Sinde, Sinde! Nichts als Sinde!« grollte es aus der gleichen Ecke. Sinder hob wieder das Gesicht. Aber sein zorniger Blick vermochte die Unruhe nicht zu dämpfen.
Resigniert fügte er sich drein und las aus dem Geschichtsbuch, um der Vorschrift zu genügen, vor: »… am Ende der Eiszeit, als das heutige Deutschland bis zu den Mittelgebirgen von hohen Gletschern überzogen war, kam, nachdem die Eismassen langsam wichen, in der norddeutschen Ebene der sogenannte Renntierjäger auf. Er ist der Urahne der nordischen Rasse.«
Fritz Elzner trat aus der Bankreihe und ans Fenster. Neidvoll blickte er hinunter. Die Jungen strömten aus dem Schulhaus auf die Straße, und nicht nur er, alle hörten die Rufe, das Gelächter, das ausgelassene, hundertstimmige Geschnatter. Nur für die Klasse 5 B war noch nicht Schulschluss, weil der »Sündenknochen« sein Stundenpensum wieder einmal nicht geschafft hatte.
»Diese nordische Rasse begann mit der Zeit die ausschlaggebende Rolle für die Entwicklung der ganzen Menschheit zu spielen …«
Mit der anschwellenden Unruhe in der Klasse nahm das Beben von Sinders rechter Hand zu. Aber er blickte nicht mehr auf; er las und las: »… diese nordische Rasse wurde zur Urquelle der großen Völkergruppe der Indogermanen, zu der Perser, Inder, Griechen, Lateiner, Germanen, Kelten und Slawen gehören. Und die Küste der Ost- und der Nordsee war die Wiege der Völker, der Ursitz der Menschheit geworden.«
Das Scharren, Schimpfen, Höhnen war so stark geworden, dass niemand mehr die letzten Sätze verstand. Da schlug Sinder mit der flachen Hand aufs Pult, und augenblicklich herrschte Stille. Ruhig, korrekt, leise fast sagte Sinder das lange erwartete, erlösende Wort: »Schluss also! Heil Hitler!«
Laute Verwünschungen gegen ihren Klassenlehrer ausstoßend, drängten die Schüler aus den Bänken und aus dem Klassenzimmer hinaus. Die Schultaschen hatten sie schon längst, während des Unterrichts, gepackt.
II
Jörgen, der Sohn eines Steuerbeamten, ein dunkelblonder Krauskopf mit Stupsnase und vorstehender Mundpartie, saß noch als einziger auf der Bank und kramte in seiner Schultasche. Sinder hatte seine Mappen und Hefte bereits zusammengesucht und unter den Arm geklemmt, als der Junge langsam, wie zögernd, auf ihn zutrat.
»Herr Sinder! Ich … ich möchte Ihnen … Ihnen was mitteilen.«
Theodor Sinder legte dem Jungen die immer noch zitternde Rechte auf die schmale Schulter und fragte: »Wer war der Ärgste?«
Der Junge zuckte zurück und antwortete: »Das weiß ich nicht, Herr Sinder!« Leise, wie gekränkt, setzte er hinzu: »Ich bin doch kein Angeber.«
»Aber du willst mir doch was mitteilen, nüch?«
Der Junge blickte auf, nickte und sagte: »Die halten immer noch zusammen, Herr Sinder. Sie flüstern heimlich und – und sprechen schlecht vom Führer. Sie sind be …«
»Wer?« unterbrach Sinder den Schüler. »Was wird gesprochen?«
»Na, der Berni Frese …« Der Junge schluckte vor Aufregung … »Auch Viktor Brenten und Hans Stierling … die waren doch bei den Pionieren, und die … die ketzern immer noch.«
Sinder schob mit der fahrigen Rechten die Brille zurecht. Er fixierte den Jungen und fragte: »Was haben sie denn geketzert?«
»Das war so, Herr Sinder. Wir haben da in der Klasse eine Rundfrage gemacht. Das ist ein Beschluss, alle Pimpfe sollen es so machen. Die Rundfrage heißt: Warum bin ich für den Führer? In unserer Klasse sind alle für den Führer, bis auf drei.«
Der Junge hatte die anfängliche Hemmung überwunden; er berichtete, ohne zu stocken und ohne nach Worten zu suchen: »Berni Frese hat gesagt: ›Ich kenne den Führer gar nicht.‹ Hans Stierling nannte die Rundfrage einen Quatsch. Und Viktor Brenten sagte: ›Ich bin für meinen Vater …‹ Sein Vater ist Kommunist, Herr Sinder. Die Polizei sucht ihn.«
Sinder betrachtete schweigend den vor Eifer und Erregung rot gewordenen Jungen. Er spürte, dass diese Mitteilung ihm einen Haufen Ärger und Unannehmlichkeiten bringen konnte, denen er gern aus dem Wege gegangen wäre. Er war ein geschworener Gegner des Sozialismus, war es immer gewesen. Seine Lebensmaxime fasste er gelegentlich in die Worte »National«, »Liberal« und »Christlich« zusammen. Allem Neuen gegenüber verhielt er sich von Natur aus misstrauisch und ablehnend. Den Nationalsozialismus fand er nur deshalb erträglich, weil er versprach, das Althergebrachte zu erhalten und zu pflegen. Entscheidungen aber, ganz gleich welcher Art und von welcher Schwere, wich er gern aus. Auch was er eben vernommen hatte, war ihm lästig. Und er sagte: »Gut, Jörgen, wir beide wissen ja nun Bescheid, woran wir sind, nüch? Und nun geh!«
Der Junge verließ langsam das Klassenzimmer. Sinder sah ihm mit schrägem Blick nach. Dann nahm er die Brille ab, vergaß aber, die Gläser zu reiben, sann vielmehr vor sich hin … Um nichts in der Welt wollte der Junge ein Angeber sein … Nein, Angeber und Anschmierer hatte Sinder in seiner Klasse nicht, und das hatte ihn immer gefreut … Er wusste, sie nannten ihn »Sündenknochen«. Gott mochte wissen, aus welchem Grunde. Gern wüsste er, wer diesen seltsamen Spitznamen aufgebracht hatte. Auch, wer ihn am häufigsten gebrauchte. Er hatte es nie erfahren können … »Sündenknochen« – ein scheußliches Wort … Aber er musste doch schmunzeln.
Als hätte er ihm aufgelauert, lief Kollege Hugo Rochwitz auf der Treppe Sinder in den Weg. »Ausgerechnet!« brummte Sinder in sich hinein. Er konnte diesen feisten Bajazzo, wie er seinen Klassennachbar insgeheim nannte, nicht ausstehn. Ein Aufschneider, wie alle Nichtskönner, ein Poseur war der in seinen Augen und ein Schwätzer, wie die meisten Dummköpfe.
»Lass wohlbeleibte Männer um dich sein, Sinderchen!« Rochwitz legte jovial den Arm um den dürren Sinder. »Freust dich wohl auch, wieder ein Tagwerk hinter dich gebracht zu haben, was? Nunu, sieh doch nicht so giftig drein! Nimm 's Leben von der heiteren Seite. Warst du eigentlich immer so – so gallig?« Rochwitz blieb mitten auf der Treppe stehen, packte ungeniert Sinder am Paletotärmel und sagte, den Blick forschend auf den sich abwendenden Kollegen gerichtet: »Weißt du, Sinder, manchmal hab ich das Gefühl, du wärst nicht einverstanden mit der neuen Zeit … Hab ich recht? Gefällt dir dieser Frühling nicht, der das alte Gerümpel wegfegt? Ist er dir zu stürmisch, alter – Sündenknochen? Hahaha!«
Einige Schüler liefen, ihre Mützen ziehend, an den beiden Lehrern vorbei die Treppe hinunter, und Sinder zischte empört: »Was fällt dir ein! Die Bengels hören alles!« Auf dem fleischigen Gesicht des andern breitete sich ein zufriedenes Grinsen aus. »Antworte doch auf meine Frage!« Sinder riss sich los und strich seinen Rockärmel glatt. Im Weitergehen sagte er: »Fällt mir im Traum nicht ein!« Der schwere, massige Rochwitz watschelte hinter ihm her und rief dem Davoneilenden nach: »Genügt mir … Genügt mir!«
Sinder hastete mit steifen Schritten die letzten Stufen hinab und bog am Schultor mit scharfer Wendung in die Straße ein. Wut sprühte in ihm; das Zittern seiner Hand übertrug sich auf den Knotenstock, so dass es aussah, als drohe er damit. »Lümmel!« presste er zwischen den Lippen hervor.
Rochwitz stand auf der letzten Stufe der Schultreppe, lachte und rieb sich die Hände. Dann zog er mit großer Geste seinen Hut, denn der Rektor Friedrich Hagemeister kam die Treppe herunter. Rochwitz hatte immer noch ein Lachen im Gesicht. »Herr Rektor, gestatten Sie, dass ich Sie ein Stück begleite?«
Hagemeister rückte seinen Hut zurecht und strich die langen grauen Haare hinter die Ohren. »Aber lieber Kollege, ich bitte darum.«
Sie gingen nebeneinander die Straße entlang. Hagemeister schien keine Lust zu einer Unterhaltung zu haben; er blickte im Vorübergehen in die Auslage eines Zigarrengeschäfts, sah hinüber zur Asbestfabrik am Kanal, wo Kräne Säckebündel in Schuten verluden, und hinauf zu den Wolkengebirgen, die an diesem trüben Frühlingstag über die Stadt zogen. Rochwitz dagegen gierte nach einem Gespräch, setzte mehrere Male an, fand aber den Absprung nicht. Schließlich sagte er: »Ich hatte soeben eine Unterhaltung mit Herrn Sinder.«
»Soso!« erwiderte Hagemeister.
»Und wie mir schien, ein für Sinder wenig erfreuliches Gespräch.«
»A–ach!« Hagemeister ging gemessenen Schrittes weiter.
»Frischweg von der Leber, Herr Rektor, so wie das nun einmal meine Art ist. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dieser Sinder ist ein Gegner unseres Staates. Ich bin …«
Hagemeister unterbrach ihn. »Aber, aber, lieber Kollege! Der alte Theodor Sinder? Diese stockkonservative und grundehrliche Haut?«
»Jawohl, Herr Rektor! Jawohl! Und stockkonservativ, das haben Sie sehr richtig gesagt. Das ist ja gerade die Ursache … Jaja, Herr Rektor, ich sage Ihnen, Sinder ist ein Hitlergegner und Judenfreund. Wissen Sie, wie er die Abwehrmaßnahmen der Regierung gegen die jüdische Wucherwirtschaft genannt hat? Judenboykott. Wohlgemerkt: Judenboykott. Hellauf hat er gelacht, als ein Schüler seiner Klasse berichtete, seine Mutter kaufe keine jüdischen Eier. Ich sage Ihnen, der Sinder hält es mit den Juden … Wissen Sie übrigens, wie Sinder jede Klassenstunde schließt? ›Schluss also mit Heil Hitler!‹ – Sagen Sie selbst, ist das nicht der Gipfel der Unverfrorenheit? Und wissen Sie, wie seine Klasse ihn bezeichnenderweise nennt? Sündenknochen! Überlegen Sie bitte: Sün-den-kno-chen!«
Hagemeister erwiderte peinlich berührt: »Was soll das alles, Herr Kollege?«
»Herr Rektor, ich habe mir nur erlaubt, Ihnen meine vorläufig noch ganz private Meinung über Herrn Theodor Sinder mitzuteilen.«
III
Vom Fenster des oberen Stockwerks der Schule am Wiesendamm in Hamburg geht der Blick weit hinein in den kilometertiefen Stadtpark mit seinen Wäldchen, Wiesen, Sportplätzen, Wasserläufen und dem herrlichen Parksee. Auf den Sportplätzen tummelt sich nach Schulschluss die Jugend. Sonntags tragen die Sportvereine dort Hand- und Fußballwettspiele aus. An schönen Abenden spazieren Familien nach den Liegewiesen oder sitzen im Restaurant am Parksee. Liebespärchen schlendern auf den Heckenwegen und durch die Birken- und Buchenwäldchen hinter dem Wasserturm. – Birkenhain und Liegewiese am Wasserturm, das waren auch die beliebtesten Plätze der jungen Barmbecker Pioniere gewesen. Hier hatten sie in fröhlicher Gemeinschaft getanzt und gespielt, auch manchmal im Halbkreis um Fred Stahmer, ihren Pionierleiter, gesessen und Vorträge angehört, oder jemand hatte aus guten Büchern vorgelesen. Damit war es nun vorbei, denn die Hitlerregierung hatte den Verband aufgelöst. Indes, viele Pioniere trafen sich heimlich und hielten zueinander. Nicht mehr in großen Gruppen kamen sie zusammen, sondern nur noch in kleinen Kreisen. Eine solche Freundschaft bildeten Berni Frese, Viktor Brenten und Hans Stierling.
An diesem Nachmittag warteten auf einer der großen Steinbänke am Wasserturm Viktor und Berni auf ihren Freund Hans. Sie waren verwundert, dass er sich so verspätete, denn Hans war gewöhnlich der Pünktlichste. Beide trugen noch ihre Wintermäntel und Berni sogar einen Wollschal. Sie saßen auf der Bank und ließen die Beine baumeln.
»Hast du nichts von deinem Vater gehört?« fragte Berni.
»Nichts!« Viktor ließ die Schirmmütze um seinen Zeigefinger kreisen. »Meine Oma meint, solange wir nichts von ihm hören, ist alles gut.«
»Von deinem Großvater hört ihr?«
»Ja, aber nichts Gutes. Er ist immer noch im Stadthaus. Oma darf ihn nicht mal besuchen.«
»Vielleicht ist dein Vater gar nicht mehr in Hamburg.«
»Wer weiß … Sie sind mächtig hinter ihm her.«
Die Blicke der beiden Jungen wanderten über die Spiel- und Liegewiesen, deren junges Grün auch an diesem unfreundlichen Apriltag den Augen wohltat.
»Im Haus nebenan bei uns hat ein Maurer gewohnt, Drews heißt er, Arthur Drews. Ein Arbeitersportler, Athlet. Sie haben ihn im Stadthaus totgeprügelt.«
Viktor blickte dem Freund voll ins Gesicht. »Woher weißt du das?«
»Seine Frau hat's meiner Mutter erzählt, und ich hab an der Tür gehorcht.«
»Wenn sie Fred Stahmer erwischen, kann's ihm genauso gehen.«
»Deinem Vater auch.«
»Was sagst du?« Viktor sah erschrocken auf. Dann aber meinte er: »Hoffentlich kriegen sie ihn nicht.«
Da rückte Berni noch näher an den Freund heran und entwickelte ihm flüsternd seinen Plan.
»Wir müssen auch fliehen. Vielleicht nach Lübeck oder Kiel … Du, einige Wochen halten wir bestimmt durch, und in einigen Wochen, sagt mein Onkel Emil, der ist schon viele Jahre Sozi, in einigen Wochen, sagt er, haben die Nazis ausgespielt … Ich weiß in Lübeck die Adresse von einem Pionier, der mal bei uns übernachtet hat. Zu dem gehen wir; der wird uns schon irgendwo unterbringen … Und dann schreiben wir an die Häuserwände Losungen, überall. Führen die SA an der Nase rum. Na, was meinst du? Ich frag mich nur, sollen wir allein gehen oder zu dritt, mit Hans? Mein Onkel sagt nämlich: ›Zwei – und alle! Drei – schon eine Falle‹.«
»Warst du mal in Berlin?« fragte Viktor.
»Nee; warum fragst du?«
»Da müssten wir hingehn. Berlin ist groß, da findet uns keiner.«
»Lübeck ist auch ganz schön groß«, bemerkte Berni. »Wenn wir Fred mal treffen – das könnte doch rein zufällig sein? –, der würde bestimmt unsern Plan unterstützen und uns helfen. Wir könnten dann vielleicht sogar unter …«
»Da kommt Hans!« flüsterte Viktor und zeigte auf das Birkenwäldchen.
Hans, obgleich auch er erst neun Jahre alt wurde wie Berni und Viktor, wirkte durch seinen kräftigen Wuchs, und weil er fast einen Kopf größer war als seine beiden Freunde, älter. Er zählte zu den besten Sportlern der Klasse und war im Nehmen wie im Geben der härteste Boxkämpfer. Ihn in schlimmen Zeiten als Freund zu haben, war gut; er wusste sich und seinen Freunden Respekt zu verschaffen. Das hatte Dieter Ahlersmeyer zu spüren bekommen, als er niederträchtige Verleumdungen über die Pioniere verbreitet hatte. Hans hatte ihn eines Tages angerempelt und zum Faustkampf gefordert. Um vor der Klasse nicht als Feigling zu erscheinen, musste Dieter annehmen. Hinter der Planke an der Gasanstalt hatte Hans mit kunstgerechten, zielsicheren Geraden und Uppercuts die Pionierehre gerächt.
Berni und Viktor sahen, wie Hans sich immer wieder umblickte. Es schien ihnen, als zögerte er, das Wäldchen zu verlassen und herüberzukommen. Jetzt winkte er ihnen.
Viktor flüsterte: »Was hat er nur? Komm!«
Beide rutschten von der Bank und liefen Hans entgegen. Der aber winkte lebhafter und rief – endlich verstanden sie ihn –: »Hinterm Turm!«
Hinter dem Wasserturm, einem aus Klinkern errichteten Bauwerk, standen als Abschluss der Blumenbeete dichte Rotdornhecken und Hagedornbüsche – bei Spielen ein herrliches Versteck. In dem noch struppigen Gewirr dieses Strauchwerks hockten sie nun mit Hans, der, nach Luft japsend, hervorstieß: »Ich – werde – verfolgt!«
Verfolgt? Berni und Viktor tauschten einen kurzen Blick. Von wem verfolgt? Spürte man ihnen nach?
Hans nickte mit dem Kopf. »Von den … von den Pimpfen! … Jörgen ist dabei … Auch der dicke Kurt.«
»Wieviel sind es denn?« fragte Berni.
»Sechs oder sieben.«
»Na, wir sind auch drei.« Und in Bernis Blick lag: Du allein zählst schon für drei.
Hans verstand und winkte verächtlich mit der Hand. »Die Feiglinge! Spionieren wollen sie! Uns verpetzen … Wir müssen uns woanders treffen. Wir müssen einen neuen Platz ausmachen.«
Dabei kroch er schon vorsichtig voraus durch die Büsche in Richtung auf das Schrebergartengelände, von wo ein schmaler, wenig benutzter Heckenweg an der Lichtwark-Schule vorbei nach Winterhude führte.
IV
Am Fenster seines Amtszimmers stand Rektor Hagemeister, die Hände auf dem Rücken verschränkt, und blickte durch die Gardine auf die Straße. Fuhrwerke ratterten vorbei, und Passanten gingen auf der anderen Straßenseite am Kanal entlang. An der Kanalbrücke saßen, wie jeden Tag, die angelnden Erwerbslosen, geduldiger noch als die Fische, denen sie nachstellten. Man konnte glauben, warf man einen flüchtigen Blick in den Alltag, alles sei wie eh und je. Was aber hatte sich nicht alles verändert! Diese Unruhe und Angst und Furcht, die in das Leben eines jeden eingedrungen war! Keiner blieb davon verschont. Lähmende Ungewissheit beherrschte den Tag wie die Nacht. Da hielten Minister Reden, wie man sie vordem nur in Ringvereinen gehört hatte. Hochgestellte Persönlichkeiten riefen offen auf zu Mord und Totschlag. Ein rüder Frühling – dieser Hitlerfrühling mit seinen Nächten der langen Messer!
Hagemeister war traurig, ja entsetzt, denn er betrachtete das, was über die Nation hereingebrochen war, als ein Unglück, aber er verspürte nicht die geringste Neigung, sich aufzulehnen. Er verabscheute jedweden Fanatismus, auch den seiner Meinung nach fanatischen Antifaschismus. Vernunft, Menschlichkeit und Toleranz waren seine Grundsätze, waren es immer gewesen. Nun waren Zeiten angebrochen, in denen diese Tugenden, die er für unantastbar gehalten hatte, Entartungen genannt wurden, wo Begriffe wie Recht und Gerechtigkeit jeden Sinn und Wert verloren hatten und von Staat und Justiz nach Gutdünken und Nutzen ausgelegt oder beiseite gelegt wurden. Konnte das ein gutes Ende nehmen? Nein, es musste furchtbar enden. Aber sollte er gegen den Strom schwimmen? Widerstand leisten, wenn auch nur im Beharren? Er fühlte dazu weder die Fähigkeit noch die Kraft in sich.
Hagemeister hatte den Gedanken erwogen, aus dem Schuldienst auszuscheiden, sich pensionieren zu lassen. Alter und Dienstjahre würden es ihm erlauben. Seine Frau hatte nur gefragt, ob er sicher sei, dass er auch Pension erhalten werde? Hagemeister hatte bitter aufgelacht: Ob er sicher sei? Wessen konnte man heute noch sicher sein? Ihre simple Frage hatte jedoch gewirkt. Er gab sein Vorhaben auf. Er redete sich sogar ein, Männer wie er müssten auf ihrem Posten bleiben, um das Schlimmste zu verhüten. Jawohl, es ist Ehrensache, redete Hagemeister sich ein, feiges Kapitulieren darf es nicht geben, es wäre meiner unwürdig. Er wollte in dieser Schreckenszeit durchhalten, wollte an ihrem Ende, wie weiland Abbé Sieyès, auf die Frage: »Wo waren Sie? Was haben Sie getan?« antworten: »Ich habe gelebt!«
Hagemeister hörte Schritte auf dem Korridor und wandte sich vom Fenster ab. Die Schritte entfernten sich. Sein Blick fiel auf den Schreibtisch. Da lag noch dies ominöse Blatt. »Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen«. Er trat heran, nahm es auf und las noch einmal die Präambel, dieses in Stil und Inhalt haarsträubende Machwerk: »Gemäß dem Grundsatz, dass Fremdrassiges von der politischen Führung, von der Rechtsprechung und von den öffentlichen Ämtern ausgeschlossen sein soll im Interesse der arischen Staatsangehörigen und zwecks Beseitigung des jüdischen Einflusses und kommunistischer Elemente, wird Artikel 109 der Weimarer Verfassung durch nachfolgendes Gesetz eingeschränkt: –«
Eingeschränkt, das große Modewort. Hagemeister warf voller Ekel das Blatt wieder auf den Tisch. Eingeschränkt, das war sozusagen der verfassungsmäßige Terminus technicus geworden für: außer Kraft gesetzt.
Das Gesetzblatt lag quer über einem mit großen, steilen Buchstaben beschriebenen Papier, der Eingabe des Lehrers Rochwitz, die auf der heutigen Lehrerzusammenkunft behandelt werden sollte. Hagemeister legte sie zuoberst. Infame Angriffe, üble Verdächtigungen enthielt diese Eingabe, die wahrscheinlich einen Rattenkönig von Untersuchungen und Vernehmungen nach sich ziehen würde. Ein dreckiger Patron, dieser Rochwitz, ein Intrigant und Postenjäger, Pg. seit dem Jahre 1927, wie sich nun herausgestellt hatte … Was will dieser Mensch eigentlich? überlegte Hagemeister. Nicht einmal ein halbwegs brauchbarer Pädagoge war er, dieser schwadronierende Halbgebildete. Hagemeister ging mit kleinen Schritten, den Kopf nachdenklich gesenkt, durchs Zimmer … Es soll Menschen geben, die aus angeborener Bosheit intrigieren, sich nur in einer Stinkatmosphäre von Tratsch und Klatsch wohl fühlen. Er machte sich Vorwürfe, dass er diesen Schuft, diesen stupiden Biertrinker und banalen Spaßmacher nicht schon früher durchschaut hatte. All die Jahre hatte er ihn aus kollegialem Anstand mit durchgeschleppt und ihm vieles nachgesehen. Nun entpuppte sich dieses Subjekt als SA-Mann und Eisenfresser, als ein in diesem gewitterreichen Frühling aufwucherndes, giftiges, schwammiges Gewächs.
Es klopfte.
»Herein, bitte!«
Die Lehrer traten ein; Hugo Rochwitz als erster. Er riss den Arm hoch. »Heil Hitler!«
Hagemeister hob die Rechte, während sein Blick suchend über den Schreibtisch glitt. »Heil Hitler! Nehmen Sie Platz, Kollegen!«
Grinsend, mit schlenkernden Armen watschelte Rochwitz durchs Zimmer. Ihm folgte das altmodische Fräulein Schotte, seit achtundzwanzig Jahren Lehrerin der Abc-Schützen. Dann nacheinander die übrigen vierzehn Lehrer der Schule. Die meisten schwenkten flüchtig den rechten Arm durch die Luft.
V
Es hatte in der Schule am Wiesendamm einmal Lehrerkonferenzen gegeben, die geistig anregende und pädagogisch bereichernde Zusammenkünfte gewesen waren. Es hatte Auseinandersetzungen gegeben, heftige, erbitterte sogar. Da es bei solchen Diskussionen nicht darum ging, einen Sieg davonzutragen, sondern um Gewinn für jeden einzelnen, blieb der Ton bei aller sachlichen Schärfe kollegial. An solche Lehrerkonferenzen erinnerte sich Hagemeister, als Rochwitz seine Eingabe begründete. Dieser hatte es offensichtlich darauf abgesehen, einen Skandal zu entfesseln. Zynisch, frech und flegelhaft griff er die Schulleitung, die Lehrer, den Geist und das System der Schule an. Er hatte sich von seinem Platz erhoben, was bisher für einen Sprecher in Lehrerkonferenzen dieser Schule nicht üblich war, und rief mit gesteigerter Stimme: »… Jawohl, es muss einmal gesagt werden: So wie bisher geht es nicht weiter. Die nationale Erhebung, dies aufwühlende epochale Werk Adolf Hitlers, hat nicht nur für die deutsche Welt außerhalb dieser Schule Geltung, sondern auch für die Schule selbst. Gerade und besonders für die deutschen Schulen, zu denen wohl auch, wie ich annehme, die unsrige gehört. Aber, Kolleginnen und Kollegen, was muss man erstaunt feststellen? Der alte Trott geht weiter. Nicht nur das, es werden offen die Maßnahmen unserer nationalsozialistischen Regierung verhöhnt, und zwar von Lehrern. Es werden …«
»Bringen Sie Beweise, Kollege Rochwitz!«
Der grauhaarige, schmalgesichtige Rudolf Fielscher war der Zwischenrufer, ein langjähriger Anhänger des Kyffhäuser-Bundes und Ehrenvorsitzender eines Kriegervereins.
»Werde ich, verlassen Sie sich darauf«, erwiderte Rochwitz. Man merkte ihm aber das Erstaunen an, dass aus dieser Ecke ein Zwischenruf kam. »Bevor ich jedoch zu den einzelnen Vorfällen komme, möchte ich unmissverständlich und deutlich erklären: In der Schule hat man den neuen Geist, der heute in Deutschland das Leben unseres Volkes bestimmt, noch nicht begriffen. Ich sage Ihnen klipp und klar, ich bin nicht nur gewillt, hier rücksichtslos einzugreifen, ich bin auch dazu aufgerufen. In Zukunft wird, was krank ist, ausgemerzt.«
»Warum nicht geheilt?« fragte Fielscher.
»Weil wir dazu keine Zeit haben«, entgegnete Rochwitz. »Weil nämlich die, die von dieser judäisch-materialistisch-marxistischen Krankheit verseucht sind – und davon spreche ich –, widerspenstige Kranke sind und zum größten Teil unheilbar.«
Hagemeister hatte den Kopf tief gesenkt. Er schämte sich vor seinen Mitarbeitern und wagte nicht, ihnen ins Gesicht zu sehen. Als er den Blick wieder hob, richtete er ihn auf den alten Fielscher. Dessen trotzig-zornige Haltung gab auch ihm Kraft. Und er unterbrach Rochwitz, was er auf alle Fälle hatte vermeiden wollen, unterbrach ihn sogar scharf und zurechtweisend.
»Kollege Rochwitz, Sie befinden sich hier auf einer Lehrerkonferenz, nicht in einer Volksversammlung. Politische Vorträge halten Sie bitte woanders. Bringen Sie jetzt Ihre bestimmten, unsere Schule betreffenden Klagen vor, oder ich muss Ihnen das Wort entziehen.«
»Sehr richtig!« unterstützte ihn Fielscher. Einige Lehrer nickten zustimmend. Sinder sagte nichts, nickte nicht; er saß starr, wie leblos da, die schmalen Lippen fest verschlossen.
»Also gut«, fuhr Rochwitz gereizt fort. »Politische Aufklärung haben Sie nicht nötig. Schön, ich werde deutlicher sein. Es gibt einen Lehrer unter uns, der weiß, dass ein Teil seiner Schüler an verbotenen, staatsfeindlichen Organisationen festhält, also Geheimbündelei betreibt, der sie aber – deckt.«
»Unerhört!« rief Heitebrecht, Klassenlehrer der 1 A. Er blickte sich im Kreise der Kollegen um und wandte sich dann an Rochwitz. »Nennen Sie den Namen?«
»Kollege Sinder!«
Alle Augen richteten sich auf Sinder, der regungslos und steif dasaß, als habe er nichts gehört.
Rochwitz fuhr fort: »Herr Sinder wurde auf die staatsgefährliche Geheimbündelei seiner Schüler aufmerksam gemacht, ohne auch nur das geringste zu veranlassen, um diesen Treibereien Einhalt zu gebieten. Herr Sinder lacht über gemeine jüdische Witze, die in seiner Klasse gemacht werden, Herr Sinder …«
»Kann er überhaupt lachen?« fragte Fräulein Schotte. Aber niemand beachtete diese Bemerkung.
»Herr Sinder besitzt die Stirn, jede Stunde mit den Worten: ›Schluss also mit Heil Hitler!‹ zu beenden. Herr Sinder weigert sich, auf offene, ehrliche Fragen nach seiner Einstellung zum nationalsozialistischen Staat auch nur eine Antwort zu geben. Ich frage Sie, Herr Rektor, und Sie, Kolleginnen und Kollegen, die Sie das verantwortungsvolle Amt eines Lehrers und Bildners deutscher Seelen ausüben, wie lange wollen Sie das noch dulden?«
Hagemeister unterbrach den Sprecher abermals. Langsam, betont ruhig formte er seine Worte. »Herr Kollege Rochwitz, Sie haben sehr ernste Vorwürfe gegen den Kollegen Sinder erhoben. Ich glaube, ich handle richtig, wenn ich Kollegen Sinder Gelegenheit gebe, darauf zu erwidern … Bitte, Kollege Sinder!«
Wieder waren alle Augen auf den hageren Mann mit dem kantigen, zerknitterten Gesicht gerichtet. Sinder erhob sich von seinem Sitz, sprach aber nicht gleich, sondern starrte, immer noch wie abwesend, vor sich hin. Leise und tonlos sagte er: »Herr Rektor, eins stimmt, ich erhielt von einem Schüler eine Anzeige gegen drei seiner Mitschüler. Das hab ich Ihnen mitgeteilt. Alles andere …«
»Interessant!« bemerkte Rochwitz.
»Alles andere sind gemeine Lügen.«
»Zügeln Sie Ihre Worte, ich rate es Ihnen«, fauchte Rochwitz.
»Sind – gemeine – Lügen!« wiederholte Sinder mit lauter Stimme und setzte sich.
Hagemeister wandte sich an Rochwitz. »Kollege Rochwitz, Sie haben als Gewährsmann, wenn ich so sagen darf, den Schüler Jörgen Kuhnert aus der Klasse 5 B angegeben?«
»Jawohl!«
»Dann wollen wir ihn mal hören.«
»Das erübrigt sich wohl, Herr Rektor, wenn Sinder Ihnen von der Geheimbündelei in seiner Klasse Mitteilung gemacht hat.«
»Das hat er wohl.«
»Dürfte ich erfahren, was Sie darauf veranlasst haben?«
»Nein, Kollege Rochwitz. Das müssen Sie mir überlassen. Sie haben aber auch noch andere Beschuldigungen vorgebracht, die wir klären müssen. Befragen wir also Ihren – Gewährsmann. Kollege Pinnerk, haben Sie doch bitte die Güte, den Schüler Kuhnert hereinzuholen; er wartet im Klassenzimmer nebenan.« Sich wieder an Rochwitz wendend, erklärte der Rektor: »Rundfragen in der Schule, ohne Wissen und Erlaubnis der Schulleitung, sind, wie gewiss auch Ihnen bekannt ist, unstatthaft. In diesem Fall freilich mag eine Ausnahme am Platze sein.«
Lehrer Pinnerk und der Schüler Kuhnert traten ins Zimmer. Hagemeister winkte den Jungen zu sich. »Komm, Junge … Nein, stell dich hierher … Ja, so, und nun erzähle mal!«
»Es war ein Vorschlag unseres Pimpfleiters Hartwig, wir sollten …«
Hagemeister unterbrach ihn. »Du sprichst von der Rundfrage, die ihr in der Klasse durchgeführt habt, nicht wahr?«
»Jawohl, Herr Rektor!«
»Das wollen wir heute nicht weiter wissen. Davon ein andermal. Ich habe einige Fragen an dich, Jörgen. Hör mal! Wurden bei euch in der Klasse jüdische Witze gemacht?«
»Nein, Herr Rektor!«
»Nun, denk einmal gut nach.«
»Bestimmt nicht, Herr Rektor! Jüdische Witze? Nein!«
»Haben Sie, Kollege Rochwitz, Fragen an Ihren – an den Schüler?«
»Für diesen Fall habe ich einen anderen Zeugen.«
»Auch aus der Klasse 5 B?«
»Jawohl!«
»So? Soso! Noch eine zweite Frage, Jörgen. Wie schließt Herr Sinder seinen Unterricht? Ich meine, was sagt er ganz zum Schluss?«
»Heil Hitler!«
»Ja … aber er sagt doch nicht nur ›Heil Hitler‹, er sagt doch auch, dass Schluss ist, nicht wahr?«
»Jawohl, Herr Rektor.«
»Wiederhole mal ganz genau, was er sagt.«
Der Junge dachte nach. Er begriff nicht recht, was gemeint war.
Schließlich sagte er: »Wenn Herr Sinder zu Ende gekommen ist, sagt er: ›Schluss also!‹ und dann ›Heil Hitler!‹«
Ein Raunen und Tuscheln ging durch das Konferenzzimmer. Nur Theodor Sinder rührte sich nicht; er schien nicht einmal zu atmen.
»Hat jemand noch Fragen an den Schüler? Niemand? Dann bist du erlöst, Jörgen. Du kannst gehen.«
Nachdem der Junge das Zimmer verlassen hatte, sagte Hagemeister zu Rochwitz, der, unberührt von dem Ergebnis dieser Vernehmung, emsig schrieb: »Kollege Rochwitz, ich vermute, Sie haben das Bedürfnis, einige Worte an uns zu richten.«
Rochwitz blickte auf und verzog das Gesicht zu einem Grinsen. »Sie irren, das einzig wesentliche Faktum, eben diese Geheimbündelei, ist ungeklärt geblieben. Darüber werde ich bestimmt noch sprechen, aber an anderer Stelle.« Er raffte seine Notizen zusammen, schob ungestüm den Stuhl weg und ging.
Hagemeister fragte: »Sie gehen, Herr Kollege?«
»Ja, ich gehe!« rief Rochwitz an der Tür, und in seinem feisten Gesicht waren Hass und Wut.
Zweites Kapitel
I
»Hier ist Geld, Mutter! Ich will doch nicht, dass du es umsonst machst … Nimm schon, ich weiß, was der Junge wegfuttert und was er für Arbeit macht … Umschulen würde ich ihn nicht, sondern in der Schule Wiesendamm lassen.«
Frieda Brenten senkte den Blick von Cat zu ihrem dreijährigen Enkelkind Peter, dem kleinen Jungen ihrer Tochter, der auf dem Fußboden hockte und mit Puppen spielte. Immer hatte sie Kinder zu versorgen gehabt, nicht nur ihre eigenen, auch die ihrer Brüder, ihrer Tochter, ihrer Nachbarn, und nun war Cat mit ihrem großen Jungen gekommen. Frieda Brenten aber war kindermüde geworden, wollte endlich »ihr Reich«, wie sie sagte, für sich allein haben. Sie hatte Carl hoch und heilig versprechen müssen, Kindergeschrei künftig nicht mehr um sich zu dulden.
Arg zerrupft waren die Puppen, die der Kleine da hatte, die Gesichtchen abgestoßen und zerkratzt; aber der Knirps liebte sie und hob, als er den Blick seiner Oma auf sich ruhen fühlte, die aus Stoffresten gewickelte Puppe auf und sagte: »Oma, die Knusperliese … Knusperliese!« Frieda Brenten nickte und lächelte ihm zu. »Und das«, er streckte ihr eine zweite Puppe entgegen, die einmal mit den Augen klappern konnte, »Kulleraugenliese, Oma … Und dies ist die Bauernliese, Oma.« Er strich der Bauernliese über den Rest ihres strohblonden Haarschopfes.
Ein allerliebstes Kerlchen ist er, dachte Frieda Brenten, aber nun soll ich auch noch den Großen von Walter und Cat nehmen? Nein und nochmals nein, ich will nicht mehr … Welche Not hatte sie mit dem Kind ihres Bruders damals gehabt! Der »Graf«, wie der kleine Edmond genannt worden war, ewig kränkelnd, hatte ihr Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. Mehr als zwanzig Jahre lag das zurück, aber sie erinnerte sich daran, als wäre es gestern gewesen, sah sich zu Ärzten, in die Poliklinik, in die Apotheke laufen, die Nächte am Bett des Kleinen wachen, tags ihn auf dem Arm herumschleppen. Der Junge hatte eiternde Ausschläge gehabt, die sich über den ganzen Körper ausbreiteten. Verbände mussten gewechselt werden, es musste aufgepasst werden, dass der Junge sie in seinen Schmerzen nicht abriss und sich dadurch neu infizierte. Waren das aufregende Tage und Wochen gewesen … Und die Eltern? Ihr Bruder? Seine Frau Anita? Die hatten in Krach miteinander gelebt, waren damals beide ihre eigenen Wege gegangen. Ihr Gör aber hatte sie am Halse … Und heute? Der »schöne Edmond« wurde er von seinen Eltern stolz genannt. Am Großen Burstah war er in einem Textilwarenladen angestellt. Einmal war sie den Burstah entlanggegangen und hatte vorsichtig in das Geschäft hineingesehen. Ein großer Mann, elegant gekleidet, mit breitem, offenem Gesicht, aber unschwer als der kleine Edmond wiederzuerkennen, hatte mit einer Kundin gesprochen. Ein wirklich schöner Mann war er geworden, kräftig und stattlich. Sie hatte sich nicht hineingetraut, da er sie seit zehn Jahren wohl nicht mehr besucht hatte. Zehn Jahre … Ihm machte sie nicht einmal Vorwürfe, wohl aber ihrem Bruder, den der Stolz auf seinen Sohn aufgeblasen und eingebildet gemacht hatte. Nein, sie wollte nicht mehr, nie wieder … War nicht Cat gekommen, als gäbe es für sie, die Oma, überhaupt keine Wahl, als wäre alles selbstverständlich? »Der Große, der ist doch eigentlich schon eine Hilfe«, hatte Cat gemeint. Warum hatten die beiden sich nicht längst zusammengetan? Wenn ein Kind da war, trug man doch die Verantwortung dafür … Sie machte auch ihrem Sohn Vorwürfe, der sich – wie sie fand – seiner Vaterpflichten nicht bewusst war. Aber schließlich: wer außer Cat und ihm konnte wissen, wie sie zueinander standen … Dennoch, mochte sein, was wollte, wo nun der Junge da war, hätten die beiden längst heiraten sollen. Das war doch so kein Leben …
Was für schreckliche, für unbegreiflich schreckliche Zeiten angebrochen waren. Carl, ihr Mann, war nun schon seit zwei Monaten verhaftet, ohne dass sie irgendeine Nachricht von ihm hatte. Der Gedanke allein, dass ihr Carl im Gefängnis saß, war für sie unfassbar und unerträglich. In ihr lebte trotz allem, was in Deutschland geschah, immer noch die Vorstellung, man war entehrt, wenn man erst einmal ins Gefängnis kam. Sie wusste zwar – jaja, sie wusste –, dass ihr Mann kein Verbrecher war, aber – er saß im Gefängnis! Sie wusste, dass auch ihr Sohn kein Verbrecher war, aber – die Polizei suchte ihn! Es war für des redlichen Johann Hardekopfs Tochter schwer zu begreifen, dass in solcher Zeit die Verfolgten die Anständigen und Rechtschaffenen, ihre Verfolger aber die Schurken und Verbrecher waren.
Im Februar – oder war es schon März gewesen? – hatte sie Walter das letztemal gesehen. Einer dieser neuen Machthaber sprach gerade über den Rundfunk und rief mit heiserer Hassstimme die Polizei auf durchzugreifen, zu verhaften, zu schießen, die Kommunisten auszurotten. Walter hatte die Mutter beim Abschied umarmt. Da hatte sie gespürt, dass es ein Abschied für lange war. Umarmungen gehörten in ihrer Familie nicht zu den Alltäglichkeiten. »Junge, alle sind gegen euch!« Die Tränen waren ihr übers Gesicht gelaufen. Er hatte sie an sich gedrückt. »Alle? Mutter, wir sind nicht wenige. Und du? Gehörst du nicht auch zu uns?« Er lächelte sogar. Sie aber hatte Angst gehabt, namenlose Angst. »Mein Junge, ich seh dich vielleicht nie wieder! Vater ist ein alter Mann, den werden sie eines Tages wieder laufen lassen. Wenn sie aber dich fassen, dann …« Er hatte ihr die Tränen aus dem Gesicht gewischt und gesagt: »Ich werd mir Mühe geben, dass sie mich nicht kriegen, Mutter.«
Cat saß schweigend der Großmutter ihres Sohnes gegenüber, sah ihren abwesenden Blick und hätte gern gewusst, woran sie dachte.
Frieda Brenten dachte daran, dass ihr Sohn illegal lebte, irgendwo. Als er ihr gesagt hatte, dass er künftig illegal leben würde, hatte sie nicht gewusst, was das bedeutete, sich aber geniert, ihn zu fragen. Anderntags aber hatte sie den Kolonialwarenhändler gefragt. Der hatte ihr den Sinn dieses Wortes erklärt. Seitdem war sie noch mehr verängstigt. Ungesetzlich also lebte er, unterirdisch, jede Stunde tags und nachts auf der Flucht, ständig verfolgt, nirgends sicher, fried- und schutzlos. Armer, armer Junge!
Ja, und nun war Cat gekommen. In dieser ganzen Wirrnis und Verworrenheit benahm sie sich erstaunlich ruhig und überlegen. Frieda bewunderte sie geradezu. Aber es hielt Cat nie zu Hause, dauernd war sie unterwegs und der Junge den lieben langen Tag auf sich selbst angewiesen.
Cat erhob sich, unwillig, aber noch unschlüssig. Sie verstand nicht, dass unter diesen besonderen Umständen die Großmutter ihres Kindes, das doch auch Walters Kind war, zögern konnte, es aufzunehmen. Sie verstand es um so weniger, als sie wusste, wie bitter wenig ihre Schwiegermutter besaß, um das Notwendigste kaufen zu können. Sie brachte ihr doch nicht nur den Jungen, sondern auch Geld. Wenn sie wüsste, dachte Cat, wie schwer es aufzutreiben war! Sie konnte doch nicht sagen, dass sie Zeit und Bewegungsfreiheit für ihre illegale politische Arbeit brauchte.
Frieda Brenten sah aus ihrer Sofaecke auf. Sei nur ungehalten, meine Tochter! Hättest du meine Erfahrungen, du würdest mich verstehen.
Der Kleine zu ihren Füßen unterhielt sich mit der Kulleraugenliese, weil sie nicht schlafen wollte. Er schüttelte sie, gab ihr einen Klaps. Frieda Brenten betrachtete ihn und hatte plötzlich das Verlangen, den Knirps in die Arme zu nehmen, ihn an sich zu drücken.
»Peterchen, komm zu Oma!«
Der Kleine ließ sogleich von den Puppen, kletterte aufs Sofa und schmiegte sein Gesicht an das ihre. Liebebedürftig war das kleine Wesen.
Sie fragte: »Willst du, dass auch Viktor zu Oma kommt?«
Da nickte der Kleine lebhaft und schlang seine Ärmchen um sie.
Cat atmete erleichtert auf.
II
Ein paar Tage später saß Frieda Brenten abends in ihrer Wohnstube und stopfte die arg zerlöcherten Strümpfe, die Cat ihrem Großen mitgegeben hatte. Viktor war mit seinen Schularbeiten beschäftigt. Da klingelte es, und ein ungewöhnlicher Besucher trat ein: Herbert, ihres Bruders Ludwig ältester Sohn.
»Du? Ist was passiert bei euch?«
»Nein, Tante Frieda. Ich wollte dich nur mal besuchen.« Er gab auch Viktor die Hand.
Frieda Brenten aber war noch misstrauisch. »Schickt Papa dich?« – »Nein! Und Mama weiß auch nichts davon … Eigentlich, Tante Frieda, bin ich hauptsächlich wegen Viktor gekommen.« – »So, wegen Viktor?« – »Ja, in Schulsachen … Wir sind doch beide in der Wiesendamm-Schule.«
Viktor kannte Herbert Hardekopf nur flüchtig. Irgendwann hatte er einmal davon gehört, dass er mit ihm verwandt sei. Und nun war er seinetwegen gekommen? Er ließ keinen Blick von ihm, musterte ihn, und – Herbert gefiel ihm. Lange Beine hatte Herbert und kurze, viel zu enge Hosen. Der Mantel, den er ablegte, war auch zu kurz.
Prüfend betrachtete Frieda Brenten den Neffen. Er war lange nicht bei ihr gewesen und in der Zwischenzeit mächtig in die Höhe geschossen. Aber, er war nicht gut genährt. Na ja, bei der Mutter … Sie fand in seinem Gesicht auch nicht eine Spur von Ähnlichkeit mit Hermine und dachte: Man ein Glück! Um so mehr glich er seinem Vater. Akkurat so hatte Ludwig mit vierzehn Jahren ausgesehen. War sein Sohn auch aus dem weichen, leicht zu knetenden Material? Sie hatte damals, nur knapp zwei Jahre älter, nicht schlecht mit ihrem Bruder herumkommandiert.
Herbert sah seine Tante an, etwas verlegen.
Frieda Brenten fragte: »Sind alle gesund? Auch … deine Schwester und dein Bruder?« Sie konnte sich nicht auf die Namen der beiden anderen Kinder ihres Bruders besinnen … Wie fremd man sich geworden war.
»Habt ihr was Geheimes zu bereden?«
»Das gerade nicht, Tante.«
»Also doch! Na, sprecht euch aus, ich mach dir unterdessen ein kleines Abendbrot. Hast doch Hunger, was?«
»Den hätte ich schon, Tante Frieda!«
Sie ging in die Küche.
Viktor überlegte die ganze Zeit, was Herbert Hardekopf ihm zu sagen haben mochte. Schulsachen? Herbert beugte sich zu ihm hin und sagte hastig: »Schnell, Tante Frieda braucht nicht alles zu wissen … Eine Untersuchung kommt gegen alle, die bei den Pionieren waren. Besonders euch in der 5 B hat man auf dem Kieker. Du sollst gesagt haben, du bist gegen Hitler und für die Kommunisten wie dein Vater. Rochwitz hat in der 5 A die Pimpfe aufgefordert, euch, ich meine die Pioniere in eurer Klasse, zu verprügeln. Verdammt dicke Luft in der Schule.«
Morgen flitz ich mit Berni nach Lübeck, entschied Viktor sofort. Unter allen Umständen. Die sollen uns nicht weiter triezen. – »Bist du auch bei den Pionieren?« fragte er Herbert und wusste im selben Augenblick, wie dumm seine Frage war. Wäre Herbert Pionier, würde er ihn, obwohl er einige Jahre älter war, kennen. Eigentlich hatte er fragen wollen, ob er zu den Pionieren halte.
»Nein!« antwortete Herbert. »Ich war bei den Falken.«
»O-och so!« Es klang enttäuscht.
»Was willst du nun tun?«
Viktor zuckte mit der Schulter.
»Sie wollen, dass alle Pimpfe werden.«
»Das werde ich nie!« rief Viktor voller Protest.
»Ich auch nicht«, stimmte ihm Herbert zu. »Wenn es meine Mutter auch gern möchte.«
»Na, habt ihr euch ausgesprochen?« Frieda Brenten trug einen Teller mit belegten Broten herein.
»Ja, Tante.«
»Hast du was ausgefressen, Viktor?«
»Nein, Oma! Aber die Hitlerpimpfe sind gegen uns, gegen uns Pioniere.«
»Du lieber Gott!« rief Frieda Brenten entsetzt. »Treibt ihr auch schon Politik? Ihr Bengels seid wohl von allen guten Geistern verlassen!«
Die beiden Jungen lachten hellauf, und Herbert sagte: »Tante Frieda, Papa meinte gestern, die Nazis sind von allen guten Geistern verlassen.«
»Nun aber Schluss mit dem Gequatsche!« befahl Frieda Brenten. »Ich kann so was schon gar nicht mehr hören. Setz dich hin und iss!«
III
Viktor sieht sich und Berni vor der SA davonlaufen. Die SA-Leute schießen. Ihre schweren Stiefel dröhnen auf dem Straßenpflaster. Wie sie rennen! Berni und er aber sind flinker. Hui! – gleich Wieseln flitzen sie in der engen Twiete an den alten Häusern entlang. Schon sehen sie die breite, belebte Hauptstraße … Da … Da kommen auch von dort her die braunen Banditen … Eine Falle? Verloren? Nein, Berni rennt geistesgegenwärtig in einen niedrigen Torweg. Aufgang an Aufgang gibt es hier, mit Treppen, die unmittelbar vom Torweg ins Hausinnere führen. Da hinein? Nicht doch, Berni ist ein Pfiffikus, dort ist keine Rettung. Am Ende des langen Ganges stehen Ascheimer. Ehe noch der erste SA-Mann den Torweg erreicht hat, ist Berni, auf dem Bauch kriechend, dahinter verschwunden und nach ihm Viktor. Da kommen sie herangetrappt. Wie sie fluchen, drohen! Wie sie treppauf, treppab laufen! Von Haus zu Haus. Einer kommt ganz nahe an den Ascheimern vorbei. Viktor sieht, es ist Rochwitz in SA-Uniform, einen Revolver in der Hand. Der dicke Rochwitz als Anführer der SA …
Viktor ist aufgewacht. Er atmet gequält und hastig. Angst steigt in ihm hoch. Fangen will er mich, aber das darf ihm nicht gelingen … Fort muss ich. Fliehen. Berni und ich müssen fort. Und Hans? Hans ist stark, ja, aber Berni ist klug und findig.
»Junge, was hast du nur?« fragt Frieda Brenten. »Du atmest so schwer.«
»Ach, nichts, Omi! Nur … Nur der Rochwitz, der will mich fangen.«
»Wer ist denn das nun wieder?«
»Ein Lehrer bei uns in der Schule, der ist SA-Führer.«
»Du hast doch bestimmt was ausgefressen, Junge?«
»Nee, Omi, der hasst uns Pioniere und verfolgt uns!«
»Dann würd ich an deiner Stelle sehr vorsichtig sein. Hörst du?«
»Ja, Omi.«
»Und nun schlaf!«
Viktor kann nicht schlafen. Wie könnte er auch, morgen schon wird er weit weg sein, für Wochen wahrscheinlich … Und Oma würde warten, ihn suchen, sich sorgen … Er muss ihr einen Brief hinterlassen, damit sie alles weiß und ihn nicht sucht … Wenn aber die SA den Brief findet … Er muss ihr schreiben, dass sie den Brief verbrennt, wenn sie ihn gelesen hat. Hoffentlich tut sie's auch? Sie kennt aber doch die illegalen Regeln nicht … Besser ist, nicht zu schreiben …
»Schläfst du immer noch nicht?«
»Omi, ich werde morgen – aber du darfst dich nicht ängstigen –, ich werde morgen weggehen. Du darfst mich aber nicht verraten, Omi?«
Frieda Brenten richtet sich langsam in ihrem Bett auf. Kalt durchrieselt es sie. »Was red'st du da? Wo willst du denn hin?«
»Omi, darf ich zu dir ins Bett kommen?«
»Ja, Junge, komm schon!«
Und er erzählt ihr, nachdem sie ihm hoch und heilig versprochen hat, nichts weiterzuerzählen. Viel hat er ihr zu sagen, sie soll doch verstehen, dass er fliehen und illegal sein muss.
Frieda Brenten wird es bald heiß, bald kalt. Sie überlegt, sucht nach einem Mittel, um den Jungen von diesem Unsinn abzubringen. Was soll sie nur tun?
»Wir haben in einer fremden Stadt eine gute Adresse, Omi, auch von einem Pionier, der wird uns helfen. Du brauchst dich also gar nicht zu ängstigen.«
»Ich ängstige mich auch gar nicht«, erwidert Frieda Brenten, und die Zähne schlagen ihr aufeinander. »Ich weiß doch, wie tüchtig du bist.« Unausgesetzt überlegt sie, was sie bloß sagen könnte … Mein Gott, was sage ich nur, um ihn zurückzuhalten? Ihr fällt nichts, aber auch gar nichts ein. Sie ist ganz ratlos und verzweifelt. Was kann auf den Jungen Eindruck machen? Nur jetzt kein törichtes Wort … Doch sie kommt auf keinen rettenden Einfall und bricht plötzlich in hemmungsloses Weinen aus.
Viktor ist verwundert und bestürzt. Auf alles war er vorbereitet, nur darauf nicht. »Warum weinst du, Omi? Ich – ich kann doch nicht anders. Und – ich komme doch wieder.«
»Denkst du denn gar nicht an mich?« schluchzt Frieda Brenten … »Opa hat man mir schon genommen. Papa ist weg. Ich hab doch nur noch dich … Gehst du auch, bin ich ganz allein, ganz allein.«
Viktor legt es sich schwer auf die Brust. Er seufzt tief. »Wein nicht, Omi. Du hast doch Peter!«
»Der? Der ist doch noch 'n Baby! Du aber, du bist schon ein großer Junge! Bist meine einzige Stütze … Was soll ich anfangen ohne dich?«
Viktor fühlt ihren Kummer und ihre Angst. Er liebt seine Oma und kann es nicht ertragen, wenn sie unglücklich ist. Er umarmt sie, umarmt sie immer wieder, küsst sie, küsst sie immer wieder. Dann steigen auch ihm die Tränen hoch, und er gelobt, sie nie und nimmer zu verlassen und, möge kommen, was wolle, alles zu ertragen, die Pimpfe, Rochwitz, die SA, alles … alles.
IV
Eine Aufregung jagte die andere.
Frieda Brenten hastete vom Wohnzimmer in die Küche und von der Küche zurück ins Wohnzimmer. Sie schloss Geschirr ein, stellte die Blumentöpfe von der Fensterbank auf den Küchenschrank, hing vor das große Fenster nach der Straßenseite eine Wolldecke, damit, wenn sie Licht machen musste, kein Lichtschein nach außen drang. Die Wohnungstür hatte sie längst abgeschlossen, die Sperrkette vorgelegt, und sie gelobte sich, niemanden hereinzulassen, unter keinen Umständen.
Viktor war mit ihren Maßnahmen durchaus nicht einverstanden. Er saß in der Sofaecke und maulte.
»Oma, wir werden nichts sehen und gar nicht wissen, was da vorgeht.«
»Dummer Junge, was willst du denn sehen?«
»Wir sitzen wie in einer Mausefalle.«
»So … Du würdest wohl am liebsten mittenmang gehn, nüch?«
Er war überzeugt, dass Berni und Hans unten auf der Straße waren. Wenn er morgen erzählte, dass er in der verdunkelten Wohnung gesessen hatte, hielten sie ihn womöglich für einen Feigling.
»Nee, nee«, sagte Frieda Brenten beim Abräumen des Abendbrottisches, »das ist kein Leben mehr. Die Menschen sind ja rein verbiestert.«
Sie hatte beim Einholen sofort gespürt, dass heute etwas in der Luft lag. Die Menschen in der Straße hatten nicht nur verdrossene Gesichter gemacht, wie in der ganzen letzten Zeit, sondern Hass und Wut hatte in ihren Mienen gestanden. In Torwegen sah sie Gruppen, sie hörte Geflüster und Tuscheln. Als ihr dann auch noch Repsold geraten hatte – es war gerade außer ihr niemand im Laden –, sie solle abends nicht auf die Straße gehen, es werde sicherlich bösen Krawall geben, da war ihr alles klargeworden. Darum diese Unruhe unter den Leuten. Darum diese verbissenen Gesichter. Die Nazis hatten einen Fackelzug durch Barmbeck und Uhlenhorst vor, und die Arbeiter wollten es nicht zulassen. Nein, Frieda Brenten hielt es für Wahnsinn, sich noch gegen die Nazis zu stellen, nachdem sie die Regierung und die Polizei auf ihrer Seite hatten. Was wollten die Arbeiter dagegen machen. Niederschießen würde man sie, in die Gefängnisse werfen – als ob nicht schon genug saßen –, jagen und hetzen würde man sie. Womöglich war auch Walter unklug genug, dazwischenzugehn. Ebenso Cat! Die ließ sich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr sehen … Frieda Brenten wäre weniger unruhig gewesen, hätte sie die Kinder nicht bei sich gehabt. Traf die Kinder ein Unglück, trug sie die Schuld. Nur ein Glück, dass der Große nach Hause gekommen war. Und sie sagte: »Wärst du heute abend nicht rechtzeitig gekommen, Viktor, ich hätte mich zu Tode geängstigt.«
»Du tust immer so, als wär ich noch ganz klein!«
»Schon gut! Schon gut!«
»Bernis Mutter ist viel vernünftiger. Die hat überhaupt keine Angst.«
Blechmusik war zu hören, noch sehr weit weg. Viktor horchte auf. »Oma, sie kommen!«
Schon war er am Fenster.
»Geh vom Fenster weg, verflixter Bengel!« Frieda Brenten riss ihn zurück. Dann knipste sie das Licht aus. Nur aus der Küche drang ein matter Schein ins Zimmer.
»Wie du dich bloß hast!« Viktor kroch zurück in die Sofaecke. »Die sind doch erst in der Zimmerstraße.«
»Untersteh dich, ans Fenster zu gehn!« Frieda Brenten ging zu Peter, der im Dunkeln vor Opas Lehnstuhl kniete und seine Kulleraugenliese in die Stuhlecke drückte. »Du bist artig, mein Kleiner, nüch?«
»Kulleraugenliese will Licht haben, Oma!«
»Gleich gibt's wieder Licht, mien lüttjen Butt. Du darfst nich quäsen, sonst wird Oma ganz traurig.«
Die Blechmusik wurde lauter. Aber unten auf der Straße war es vollkommen still. Frieda Brenten machte sich an der Wolldecke vor dem Fenster zu schaffen, zupfte und zerrte daran, als hinge sie nicht gut. In Wirklichkeit wollte sie einen verstohlenen Blick auf die Straße werfen. Kein Mensch war zu sehen. In allen Fenstern und Geschäften war es dunkel. Nur die Straßenlampen brannten. Viktor hatte sich auch wieder ans Fenster geschlichen.
»Da kommen sie, Oma, in unsere Straße!«
Ja, sie sah die Flammen von vielen Fackeln in der Arndtstraße auftauchen. Angst kroch in ihr hoch.
»Nun aber weg vom Fenster!«
Sie umfasste Viktor. »Gott, Junge, ich bin froh, dass du da bist.«
»Was bist du bloß für 'ne Bangbüx, Oma!«
Sie setzte sich aufs Sofa und zog Viktor an sich. »Peter auch!« rief der Kleine, kam im Dunkeln angelaufen und ließ sich von seiner Oma aufs Sofa heben.
»Warum marschieren die Kerle nur am Abend, wenn die Leute schlafen wollen?«
»Weil sie am Tage Angst haben«, erwiderte Viktor.
»Die haben auch Angst?« fragte Oma Brenten ungläubig.
»Und wie!« bekräftigte der Junge.
Im selben Augenblick ertönten schrille Trillerpfeifen. Unmittelbar darauf brach ein tosender Spektakel aus, in dem sogar die Blechmusik versank. Aufschreie und Gebrüll drangen von unten herauf. Es krachte und klirrte. Steine und Fensterglas fielen aufs Pflaster. Es johlte und heulte. Ein ungeheures Menschenknäuel wälzte sich prügelnd durch die Straße.
Frieda Brenten hatte beide Kinder an sich gepresst; sie zitterte und bebte und stammelte: »Siehst du … Siehst du?« Aber sie sahen nichts, nicht das geringste, sie hörten nur den Lärm, der immer stärker wurde. Schüsse fielen. Peitschenhieben gleich fetzten sie durch das Getöse. Und wieder Schreie. Wieder dumpf krachende Aufschläge.
Viktor horchte mit aufgerissenen Augen in das Dunkel. Er hörte einige Schreie, verstand: »Nieder! Nieder … Arbeitermörder … Straße frei … Straße frei …«
Sirenen jaulten, und ihr Geheul schwoll an zu schrillem Rasseln. Dazwischen abermals peitschende Schüsse. Geschrei, hetzendes Getrampel vieler Hunderte rennender Menschen. Grelle Befehle. »Straße frei … Straße frei!« und wieder dumpfe Aufschläge und Klirren von Glas.
»Mein Gott! Mein Gott!« stöhnte Frieda Brenten und wunderte sich zugleich, dass die Kinder bei dem Toben auf der Straße und in der Dunkelheit ruhig blieben.
Es klopfte an der Wohnungstür. Frieda Brenten horchte auf. Tatsächlich, es klopfte, es klopfte wieder.
»Oma, da ist jemand!«
»Sei ruhig, Junge!« zischelte sie und stieß Viktor mit dem Ellbogen an.
Es klopfte noch einmal, nicht sehr laut, aber hastig, gleichsam bittend.
»Das ist bestimmt keine SA«, flüsterte Viktor.
»Soll'n wir aufmachen?«
»Ja, Oma!«
Schon flitzte der Junge durchs Wohnzimmer an die Tür.
Frieda Brenten sah einen jungen Menschen in die Küche wanken, das Gesicht blutverschmiert, das Jackett beschmutzt und zerrissen.
»Verstecken Sie mich, man sucht mich!«
»Hier?« fragte Frieda Brenten fassungslos. »Hier bei uns?«
»Auf 'm Boden, Oma!«
Viktor nahm flink den Bodenschlüssel vom Nagel an der Küchenschrankseite und lief die halbe Treppe zum Boden voraus. Der verwundete Flüchtling folgte ihm. Frieda Brenten blieb wartend an der Tür.
Fast lautlos huschte Viktor die Treppe wieder herunter und in die Wohnung.
»Hast du abgeschlossen?«
»Ja, Oma!«
»So – und nun machen wir Licht!« Sie drehte in der Küche und im Wohnzimmer das Licht an. Sie benahm sich mit einemmal, als wäre alles in Ordnung, als hätte sie nicht vor wenigen Minuten noch vor Angst geschlottert. Viktor sah sie ganz verwundert an, denn immer noch brüllte es unten auf der Straße, wenn auch nicht mehr so toll wie vorher.
»Oma«, flüsterte er, »du hast ja gar keine Angst mehr?«
»Sei still, Dummkopf! Weshalb sollte ich denn Angst haben?«
Da wusste nun der Junge wirklich nicht mehr, was er sagen sollte.
Es klopfte, hart, fordernd. Frieda Brenten bedeutete Viktor mit dem Finger auf dem Mund, zu schweigen, und ging öffnen. Zwei Polizisten und drei SA-Leute standen vor der Tür.
»Gott sei Dank!« begrüßte sie Frieda Brenten. »Bitte treten Sie ein!«
»Warum Gott sei Dank?« fragte ein Polizist.
»Nun, dass Sie da sind. Jetzt wird wohl der abscheuliche Lärm auf der Straße aufhören!«
»Hier ist doch jemand hereingelaufen!« Der Polizist fixierte unter seinem Tschako Frieda Brenten durchdringend.
»Zu mir?« Sie blickte treuherzig zu ihm auf. »Na, das hätte gerade noch gefehlt!«
Plötzlich würgte sie Schlucken. Jemand kam die Bodentreppe herunter. Dann sah sie, dass es so ein Braununiformierter war.
»Die Tür zum Boden ist verschlossen«, sagte er.
»War die immer verschlossen?« fragte der Polizist Frieda Brenten.
»Selbstverständlich«, erwiderte sie. »Woll'n Sie den Schlüssel haben?«
Viktor blickte sie entsetzt an. Frieda Brenten nahm den Schlüssel vom Nagel.
Der Polizist sagte zu den andern: »Wenn die Tür verschlossen war, konnte auch keiner rein. Der muss woanders sein.«
Ein SA-Mann beteuerte erregt: »Ich hab genau gesehen, dass er in dies Haus gelaufen ist!«
Einen Augenblick zögerten die Männer noch, dann gingen sie. Frieda Brenten schloss die Tür, blieb aber davor stehen und horchte. Sie hörte, dass sich die Männer stritten, hörte, dass sie die Treppe hinuntergingen, hörte sie das Haus verlassen.
Nun erst drehte sie sich um und blickte Viktor an. »Sie sind weg.«
Der Junge fiel ihr um den Hals. »Das hast du großartig gemacht, Oma … Wunderbar!«
Frieda Brenten aber fühlte ihre Kräfte schwinden; sie wankte zum Sofa. »Allmächtiger, hab ich eine Angst gehabt!«
Der Kleine war in Opas Lehnstuhl eingeschlafen. Während Frieda Brenten ihn ins Bett brachte, lief Viktor hinunter auf die Straße, wo es wieder ruhig geworden war. Auf dem Pflaster lagen Holzstücke von zerbrochenem Hausgerät, verbeulte Eimer, Glassplitter und Tonscherben von Blumentöpfen, doch keine Menschenseele war zu sehen. In Abständen von wenigen Minuten zogen Polizeistreifen durch die Straße. Viktor sah einige Polizisten kurz vor der Zimmerstraße. Er beobachtete genau die gegenüberliegenden Hauseingänge, ob sich nicht irgendwelche Aufpasser dort verbargen. Nichts war zu bemerken. Er wollte die Haustür schließen und dann den Flüchtling vom Boden holen. Sollte der sich erst mal verbinden und in Ordnung bringen. Fein, dachte er, dass wir ihn gerettet haben …
»Oma, ich hab die Haustür abgeschlossen. Jetzt hol ich ihn.«
»Setz erst Wasser auf, damit er sich waschen kann.«
Viktor stellte einen Kessel Wasser auf den Gaskocher und rannte auf den Boden.
Der Flüchtling war noch keine achtzehn Jahre alt, ein frischer Junge mit einem guten Gesicht. Er drückte Frieda Brenten und Viktor dankend die Hand, lachte übers ganze Gesicht, weil die Nazis ihn nicht erwischt hatten.
»Mich hätten sie liebend gern!«
»Es wär Ihnen doch dann bestimmt sehr bös ergangen, nüch?« meinte Frieda Brenten.
»Das kann ich Ihnen sagen. Krumm und lahm hätten sie mich geprügelt und dann ins KZ geworfen.«
»Da haben Sie doch sicher große Angst gehabt?«
»Na, und ob«, erwiderte er und trocknete sich das Gesicht ab. »Oh, etwas Blut ist ins Handtuch gekommen.«
»Schad't nichts. Aber lassen Sie mal sehen? Ist es schlimm? Das Loch im Kopf müssen wir verbinden. Ich glaub, ich hab noch Pflaster.« Aber bevor sie ging, es zu holen, sagte sie: »Sie wissen nun, was Ihnen blüht, wenn man Sie erwischt, und trotzdem gehn Sie mittenmang?«
»Klar!« antwortete der Jungkommunist. »Das muss man doch als ehrlicher Arbeiter! Wenn man diesen Lumpen nicht das Handwerk legt, machen sie mit unsereinem, was sie wollen.«
Frieda Brenten ging, um Leukoplast und Verbandmull zu holen.
Viktor sagte schnell: »Sie redet ganz anders, als sie es meint. Mein Großvater ist auch Kommunist und im KZ …«
»Ihr Mann?«
»Ja«, erwiderte Viktor, stolz darauf. »Mein Vater ist auch Kommunist und jetzt illegal. Den suchen sie.«
Der junge Arbeiter lachte fröhlich auf. »Dann hab ich es ja gut getroffen … Aber, liebe Frau«, sagte er zu Frieda Brenten, die mit dem Verbandzeug kam, »wo Ihr Mann im KZ sitzt, dürfen Sie doch keinen Arbeiter davon abhalten, gegen die Nazis zu kämpfen! Das sind doch seine Kerkermeister! Ihr Mann kommt sonst sein Lebtag nicht mehr raus!«
»Halten Sie mal Ihren Kopf her!« befahl Frieda Brenten.
Und ihr Schützling, auf dem Küchenstuhl sitzend, musste sich noch vorbeugen, damit die kleine Frau ihn verbinden konnte.
Drittes Kapitel
I
Unter uralten Buchen und Linden, am Uferhang entlang, in gleicher Richtung mit dem gemächlich dahinfließenden Elbstrom, auf dem breitbäuchige Kutter und Vergnügungsdampfer vorbeifuhren, gingen auf gepflegten Wegen Walter Brenten und Ernst Timm.
»Das gibt es noch!? Kätzchen und Knospen an allen Zweigen!« flüsterte Walter. Und diese Luft! Sie schmeckte anders als in der Stadt. So hoch und klarblau glaubte er den Himmel noch nie gesehen zu haben. »Ernst, ein wunderbarer Gedanke, den Treff hierher zu verlegen.«
»Nicht wahr?« bestätigte Timm. »Dann und wann muss man mal Gras und Laubwerk schnuppern und 'n Käfer über seine Hand laufen lassen. Doch hör zu: … Du bestätigst also, dass die Arbeiter diskutieren, ob die Hitlerdiktatur von langer oder nur von kurzer Dauer ist. Wenn die meisten nun glauben, sie ist von kurzer Dauer, so müssen wir ihnen sagen, dass das von uns abhängt. Nur wir Arbeiter können die Lebensdauer des Faschismus abkürzen. Viele jedoch sagen allen Ernstes: ist die faschistische Diktatur nur von kurzer Dauer, weshalb sich dann unnötig in Gefahr begeben? Damit wären wir bei der sozialdemokratischen Parole: Abwirtschaften lassen. Das aber heißt – darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten – kapitulieren, ist also gerade das, was die Hitlerbande wünscht. Ich denke, diese Gefahr musst du in dem Leitartikel klar herausarbeiten.«
Walter hörte zu, doch gleichzeitig waren alle seine Sinne diesem Frühlingstag geöffnet. Entzückt blickte er immer wieder durch die Zweige der Bäume auf den Strom. Dort im Schatten standen wahrhaftig schon Schneeglöckchen. Und diese köstliche herbe Luft. »A–ach!« Er seufzte.
»Was hast du?« fragte Timm.