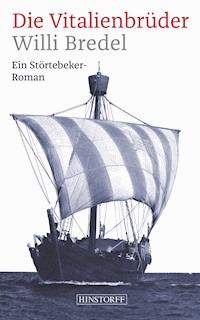
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hinstorff Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Störtebeker – legendärer Pirat, Beschützer der Armen und Entrechteten, tollkühner Kapitän und Anführer der Flotte der Vitalienbrüder. Willi Bredel erzählt, wie der junge Klaus auf der Sancta Genoveva anheuert, schon bald den Kampf mit dem verbrecherischen Reeder Wulflam aufnimmt, entschlossen eine Meuterei organisiert, Kapitän des Schiffes wird und im Geschwader einer Piratenflotte ein freies, wildes Seeräuberleben beginnt. Die Schauplätze des Geschehens reichen dabei von Wismar und Stralsund bis nach Schweden und Norwegen, von der schottischen Küste bis Friesland und Hamburg. Der Roman um die Piraterie in den deutschen Großgewässern, zählt seit seinem Erscheinen im Jahre 1950 zu den beliebtesten Werken der Abenteuerliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Vitalienbrüder
Willi Bredel
Ein Störtebeker-Roman
Zeichnungen von Herbert Bartholomäus
Inhalt
ERSTER TEIL DER KLEINE ABENTEUERER
DER SCHWARZE TOD
AN DER SCHONENKÜSTE
DIE HERREN VON STRALSUND
AUF DEM MEERE
VERBRECHEN UND MEUTEREI
ZWEITER TEIL DER GROSSE SEEPIRAT
DIE VITALIENBRÜDER
STURM ÜBER GOTLAND
DIE LIKEDEELER
DIE SEEBRÜDERSCHAFT
DER KRIEG DER PATRIZIER
NACHSPIEL
Ein Brief des Autors an seinen Verleger
ERSTER TEIL
DER KLEINE ABENTEUERER
Indes zerfiel das Reich in Anarchie,
Wo groß und klein sich kreuz und quer befehdeten
Und Brüder sich vertrieben, töteten,
Burg gegen Burg, Stadt gegen Stadt,
Zunft gegen Adel Fehde hat,
Der Bischof mit Kapitel und Gemeinde,
Was sich nur ansah, waren Feinde.
In Kirchen Mord und Totschlag, vor den Toren
Ist jeder Kauf- und Wandersmann verloren.
Und allen wuchs die Kühnheit nicht gering;
Denn leben hieß: sich wehren! — Nun, es ging.
[Goethe, Faust, Zweiter Teil]
DER SCHWARZE TOD
Gier, Falschheit und Grausamkeit regierten. Der Papst in Rom war das Oberhaupt der abendländischen Welt. Mit Feuer und Schwert suchte er die Weltherrschaft der Kirche zu erhalten. Das „Heilige Offiz“ verbrannte, räderte, köpfte in allen Ländern Europas Zweifler, Abtrünnige, Ketzer, rottete Völker aus, die an der Unfehlbarkeit des Papstes zu zweifeln wagten. Die unwissende und fanatische Menge wurde auf „Hexen“ und „Juden“ gehetzt, die auf die Scheiterhaufen geworfen und deren Vermögen zu Nutz und Frommen der Kirchenfürsten eingezogen wurden. Die Mönche, die einstmals ihren Stolz darein gesetzt, arm und bedürfnislos zu sein, waren reich und anmaßend geworden. Die besten Ländereien gehörten ihnen. Ihre Klöster glichen Schlössern an Pracht und Reichtum, die hohen kirchlichen Würdenträger wetteiferten an Aufwand und Verschwendung mit weltlichen Fürsten. Und das Volk, die Bauern, die Bürger, mußten den Zehnten und Tribute zahlen und der Kirche Macht und Reichtum mehren.
Der Adel wollte nicht zurückstehen. Fürsten und Ritter drangen brandschatzend in die Dörfer und raubten. Sie überfielen die Kaufleute auf den Landstraßen, brachen in die aufblühenden Städte, sengten und mordeten; ihr einziger Beweggrund hieß: Beute machen. Adlige Nichtstuer scheuten in ihrer Geldgier nicht davor zurück, ihre nächsten Anverwandten um bares Geld zu verschachern, wie der „wackere Ritter Konrad von Urach“, von dem uns die Chronik berichtet, daß er seine Schwestern Agnes und Mahlit um drei Pfund Heller an den Abt von Lorch verkaufte. Und um ihre Räuberrechte zu schützen, schufen die adligen Herren ein geheimes Gericht; wer sich gegen ihre Willkür auflehnte, verfiel der Feme, die nur Freispruch oder Tod durch das Schwert kannte.
In jener düsteren Zeit, vor nunmehr fast sechshundert Jahren, im Frühjahr 1369, zogen auf der Landstraße von Schwerin nach Wismar seltsame, sehr unterschiedliche Gestalten dahin: ein hoch aufgeschossener, sich gebeugt haltender alter Jude, der auf dem Rücken einen großen Holzkasten schleppte, und ein schlanker, junger Bursche, über der Schulter einen Knotenstock mit einem kleinen Bündelchen, in dem seine Habseligkeiten waren. Aus des Juden kleinem, hagerem Gesicht sprang das Kinn, an dem ein struppiger Bart wucherte, auffallend hervor. Das Haar, das man damals lang herab über die Ohren trug, etwa in Kinnhöhe gestutzt, hing ihm wirr gekräuselt bis auf die Schultern; es sah aus, als wüchsen zahllose kleine, dunkle Schlangen aus seinem Schädel. Er hielt einen armdicken Knotenstock in der Hand, auf den er sich bei jedem Schritt stützte, der aber auch zugleich als Waffe gedacht war. Die Kleider auf seinem Leibe mochten ihm Bauern überlassen haben, der grobleinene Kittel war bäuerlicher Herkunft, desgleichen die geflickte Strumpfhose, die an seinen hageren Gliedern Falten schlug; ihr einstmaliger Besitzer mußte dikkere Beine gehabt haben. An den Füßen saßen derbe, gutgeflochtene Bastschuhe. Seines jungen Begleiters schmuckloses Wams, die graue Strumpfhose und die niedrigen Bastschuhe wie auch das breite, kräftige Gesicht verrieten einen Bauersmann. Jedoch sein Blick, offen und frei, hatte nichts von der schüchternen, demütigen, Drangsalierungen fürchtenden Art der Bauern. Hellblondes Haar hing ihm glatt in den Nacken und bis in Augenhöhe in die Stirn.
Der Hausierer Josephus hatte bereits nach der ersten Stunde ihrer Bekanntschaft erfahren, daß sein Begleiter weder Eltern noch Bekannte besaß, bald hier, bald dort bei Bauern gearbeitet hatte und jetzt in die Hafenstadt wollte, um Schiffsmann zu werden.
Klaus hatte sich anfangs in der Gesellschaft des alten, allzu gesprächigen Juden recht unbehaglich gefühlt, als er jedoch sah, wie freudig die Bauern den alten Hausierer begrüßten und wie Josephus für jeden ein gutes Wort hatte und einen wohlgemeinten Rat, auch beobachtet hatte, daß der Alte nicht nur auf seinen Gewinn bedacht war, sondern uneigennützig half, wenn es ihm notwendig schien, war sein Unbehagen allmählich geschwunden.
Josephus war eine lebendige Zeitung; von Dorf zu Dorf, von Mensch zu Mensch trug er die neuesten Nachrichten. Er wußte von allem, was in der weiten Welt vorging. Und wo es ihm an Neuigkeiten fehlte, erfand er wohl auch welche; seine wißbegierigen Zuhörer kamen gar nicht auf den Gedanken, an seinen Worten zu zweifeln. Josephus wußte, wenn unten an den Alpen oder sonstwo ein neuer Krieg ausgebrochen; er berichtete von der Neuwahl eines Papstes in Rom, als wäre er zugegen gewesen; erkannte in allen Einzelheiten die ehrgeizigen Pläne des Dänenkönigs, dem die Städte zu groß und zu mächtig wurden. Aber auch die kleinen Neuigkeiten aus der unmittelbaren Nähe brachte er. Saß er unter den aufmerksam lauschenden Bauern, blieb er auf keine Frage eine Antwort schuldig. Von Mißernten wußte er, vom Schwarzen Tod und von Hochzeiten, von Raubüberfällen, Fehden, Heerzügen, aufständischen Zunftgesellen, belagerten Raubritterburgen, geräderten Missetätern, von der neuesten Bannbulle des Papstes und den letzten Gerüchten über den „falschen Markgrafen Waldemar“, der, obwohl nun längst begraben, immer noch in den Köpfen der Leute spukte. Als allerneueste Sensation konnte er über eine kürzlich in Schwerin erfolgte Blendung von sieben gefangenen Wegelagerern berichten, die nun als Bettler, von einem Armlosen und einem Einbeinigen geführt, durch das Land zogen.
Der alte Jude brachte den Bauern nicht nur Neuigkeiten, sondern auch mancherlei Wunder- und Heilmittel. In seinem Holzkasten befanden sich geheimnisvolle Salben; wenn man damit die Euter der Kühe und Ziegen einrieb, gaben sie doppelte Milch. Staubfeines, schwarzes Pulver hatte er, das, in Wasser aufgelöst und eingenommen, alsobald gegen die Pest gefeit machen sollte. Gesundheitsstäbchen holte er hervor, glattpoliertes Wunderholz, das gewisse Krankheiten in sich aufsog, wenn man dem alten Hausierer glauben wollte. Wer Schmerzen in seinen Gliedern hatte, brauchte nur mit diesen Stäbchen die kranken Stellen tüchtig zu reiben, und Josephus versicherte, daß Schmerzen und Krankheiten schwanden. Auch allerlei überseeische Spezereien führte er bei sich, wie Pfeffer, Ingwer, Safran, Muskat.
Josephus, der so gastfreundlich aufgenommen und dem sogar Ehrfurcht entgegengebracht wurde, hatte keine gute Meinung von den Menschen, von den weltlichen Herren und der herrschenden allmächtigen Kirche besonders nicht. Wo er glaubte, gefahrlos ein abfälliges Wort wagen zu können, zeterte er über die Habsucht der Pfaffen und die Verderbtheit in den Klöstern. Die großen Herren, so flüsterte er, seien eine arge Plage, eine weit schlimmere aber noch die Priester.
Und er erzählte von ihrer Gier und Grausamkeit und ihrem unchristlichen Lebenswandel in den Klöstern.
Klaus hatte viel von der großen Zeit der Kreuzzüge erzählen hören, und er bewunderte die kühnen Kreuzfahrer, die, in seiner Vorstellung allen Gefahren und Leiden trotzend, durch viele Länder gezogen waren und in harten Kämpfen mit den Ungläubigen das Heilige Grab befreit hatten. Auf der Landstraße sprach Klaus begeistert über Einzelheiten dieser Heldentaten und Wunder. Josephus hörte schweigend, aber innerlich lächelnd zu. Als Klaus ihn fragte, ob er von dieser großen Zeit nichts wisse, strich er über seinen struppigen Fuchsbart. „Oh, sehr viel sogar, mein Junge.“ Er zeigte jedoch keine sonderliche Neigung, davon zu reden. – „Mir scheint’s nicht“, erwiderte Klaus, „denn von diesen Heldentaten sprecht Ihr nie.“ –
Josephus überlegte, wie er dem Jungen seinen Aberwitz austreiben könne. Offenbar glaubte der an die christlichen Märchen vom Edelmut der Kreuzfahrer und wußte nicht, daß diese Kreuzzüge ein politisches Ränkespiel der Päpste gewesen waren, um die Kaiser, Könige und Fürsten mit ihren ständig wachsenden Heeren zu beschäftigen und so die päpstliche Weltherrschaft zu sichern. Auch wußte der Junge anscheinend nicht, daß diese Kreuzzüge nicht nur für die Päpste ein politisches, sondern für die Kaufleute auch ein Handelsgeschäft waren. Josephus wollte durch einen Vergleich die Sache klarmachen, und er antwortete mit einer Frage: „Kennst du den größten aller Kreuzfahrer?“ – „Wen meint Ihr?“ fragte Klaus eifrig, „Gottfried von Bouillon oder Balduin von Flandern?“ – „Weder den einen noch den andern“, erwiderte Josephus. „Und auch Ludwig von Plois und Gottfried von Perche nicht, sondern den kühnen Venezianer Marco Polo.“ – „Nein“, gestand Klaus kleinlaut, „von dem habe ich nie gehört. Wann hat er Jerusalem erobert?“ – „Jerusalem?“ Josephus schmunzelte in sich hinein. Ihn freute sein gelungener, scherzhafter Vergleich. Marco Polo, der Reisende, Forscher und Entdecker, ein Kreuzfahrer? Natürlich war auch dieser Patrizier in die Welt hinausgezogen, weil ihm die bekannte zu eng geworden war und er sich mit Recht große Erfolge von neuentdeckten Handelsmöglichkeiten versprochen hatte; denn Patrizier blieb Patrizier. Josephus antwortete: „Der ist viel weiter gekommen als nur bis nach Jerusalem. Er war bei den Arabern und Indern, bei den Tataren und Chinesen. Und was hat er alles mitgebracht! Atlasstoffe und Damast, Silber und Goldbrokat, viele seltsame Instrumente und viele unbekannte Früchte, Gewürze, Drogen und Heilmittel, wunderbare und schnellheilende. Außerdem Edelmetalle und seltene Perlen, die in Muscheln leben und vom eigenen Licht leuchten. Und noch so vieles; eins wunderbarer als das andere.“ – „Und das Heilige Grab?“ fragte Klaus. – „Na, da hat er sich klugerweise nicht lange aufgehalten. Da ist nämlich heute nicht mehr viel zu holen; die Kreuzfahrer hatten vor ihm bereits alles weggeräubert.“ Klaus war sprachlos. Wie Josephus von den heiligen Dingen sprach! Jedes Wort eine Lästerung. „Die Kreuzfahrer sollen geräubert haben?“ fragte er beklommenen Herzens. Schon die Frage schien ihm eine schreckliche Sünde. – „Tüchtig, mein Junge“, antwortete gleichmütig der Hausierer. „Darum sind die meisten von ihnen ja hingezogen.“ – „Das ist nicht wahr!“ rief Klaus empört. „Sie wollten die Ungläubigen vertreiben!“ – „Ja, ja, ganz recht, um das Land dann ausplündern zu können. Das sogenannte Heilige Grab befreien, das, mein Guter, war der Vorwand“, entgegnete unbeirrt der Alte. „So sagten sie. In Wahrheit wollten die reichen Kaufleute neue Handelswege finden und die mächtigen Herren neue Länder erobern.“ – „Das kann nicht wahr sein“, würgte Klaus hervor. – „Und sie räuberten nur für sich und ihre mächtigen Schützer“, fuhr der alte Hausierer fort. „Das Volk ging leer aus, dem wurde die fromme Mär vom heiligen Kreuzzug erzählt. Du mußt wissen, mein Junge, die Riesenstadt Venedig, die wohl an die dreimalhunderttausend Menschen in ihren Mauern hat, beherrscht den ganzen Handel der südlichen Welt. Die Kaufleute dieser Stadt haben den Kreuzfahrern, wie sie genannt werden, ihre Schiffe zur Überfahrt nach dem fernen Heiligen Land und außerdem viel Geld gegeben, damit sie sich mit Waffen versehen konnten. Und die kämpften dann gegen die Ungläubigen, das heißt: gegen die dort lebenden Völker – eroberten das große Konstantinopel und plünderten es ratzekahl. Die Kaufleute von Venedig erhielten vereinbarungsgemäß von dieser Beute die Hälfte. Alsdann sind die Kreuzfahrer ins „Heilige Land“ gezogen, und alles, was sie eroberten, bekamen die reichen Kaufleute. Möglich, daß es auch gutgläubige Naturen gab, die am Heiligen Gab beteten.“
Klaus glaubte dem alten Schwätzer nicht. Nein, das konnte so nicht gewesen sein. Was in so wundervollen Farben in ihm lebte, all die kühnen Taten, von denen er so oft und so begeistert hatte erzählen hören, konnten keine Lügen sein. „Sagt, was Ihr wollt“, rief er erbost, „aber es waren doch Christen?“ – „Ja, genau solche Christen wie unsere Herren Raubritter und alle die Mächtigen im Land, die nur an ihre Bereicherung und an die Erweiterung ihrer Macht denken und die das arme Volk belügen und ausplündern. Christen nennen sich alle, die ärgsten Bösewichte am lautesten.“
Josephus blieb stehen, zupfte den Jungen am Kittel und sagte ernst, eindringlich, seinem jungen Begleiter fest in die Augen blickend: „Christen? Christen ! … Ja, Ja, die sich so nennen, müssen wohl unbesehen gute Menschen sein? Und nur sie, he? … Richard, König von England, nannte sich auch Christ, mein Junge. Seine Ritter nannten ihn Löwenherz. Er war aber ein Tigerherz. Auch er zog ins Heilige Land und ließ an einem Tag dreitausend sarazenische Gefangene hinmetzeln … Sein Gegner, ein Heide, der Sultan Saladin, war eine tausendmal edlere Seele als dieser Löwenherz und sämtliche fürstlichen Kreuzritter … Nicht was einer zu sein vorgibt, kennzeichnet ihn, sondern was einer tatsächlich ist.“
Wie aber staunte Klaus erst, als Josephus erzählte, er sei vor vielen Jahren Bettelmönch gewesen, denn er sei – so fügte er lächelnd hinzu – ein Getaufter. Josephus wurde dem Jungen immer rätselhafter. Klaus erfuhr von den Apostelbrüdern, die Bequemlichkeit und Behaglichkeit verschmähten, keine Häuser und keine Vermögen hatten, durch die Lande zogen, die christliche Wahrheit verkündeten und von den Almosen der Gerechten lebten. Das waren, wie Josephus erzählte, erbitterte Feinde des Papstes, den sie einen der echten christlichen Lehre Abtrünnigen nannten. Und es waren größtenteils arme, rechtlose, geschundene Leute, die ihnen anhingen, wenn viele ihrer Lehrmeister einst auch begüterte Leute waren. Klaus hörte von dem wahrhaft gottesfürchtigen und bekenntnismutigen Arnold von Brescia, der als Fanatiker der Wahrheit und Gerechtigkeit auf dem Scheiterhaufen endete. Er bewunderte den reichen Permasener Händler Gerado Segarelli, der sein Vermögen unter die Armen aufteilte und wie der Ärmsten einer in strenger Armut lebte. Und auch ihn verbrannten die Verfluchten, die sich Christen nannten, aber nur nach Macht und Reichtum gierten. Und immer neue, edle Menschen wandten sich gegen den unchristlichen Reichtum und die unmenschlichen Quälereien, denen die Armen ausgeliefert waren. Sie predigten offen gegen die Mißbräuche der Kirche und die Verbrechen der Fürsten und Patrizier und erklärten, nur den armen, besitzlosen Bruder für einen wahren Christen. Sie meinten es ernst mit den Tugenden, die Christus lehrte, mit Menschen- und Nächstenliebe, Friedfertigkeit und Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft und Barmherzigkeit und einer allumfassenden Liebe. Aber die Herrschenden, allen voran der Papst, verteidigten mit Klauen und Zähnen ihre Macht. Wer nicht für sie war, den nannten sie Ketzer, und die Verfolgung und Vernichtung der Ketzer nannten sie eine gottgefällige Tat.
Ja, von Ketzern hatte Klaus früher schon gehört. Alle hatten Angst vor Ketzern, und jeder fürchtete, selbst ein Ketzer genannt zu werden. Und er blickte verstohlen von der Seite auf den alten Josephus, den Getauften, der ihm gegenüber so gar kein Hehl daraus machte, ein Ketzer zu sein. Mit welcher Liebe und Bewunderung er von Fra Dolcino, dem Sohn eines Priesters und der Nonne Margaritha von Trenk, sprach, die einen Aufstand gegen den Heiligen Stuhl entfesselten und einen unvergleichlich heldenhaften Kampf in der fernen Stadt Carcassone und auf dem Monte Zebello führten. So groß auch ihr Heldenmut und ihre Opferbereitschaft waren, wieder hatten das Unrecht, die Niedertracht, die Lüge gesiegt. In Erinnerung daran stieß Josephus in heiserem Haß die Worte aus: „Verflucht sei der Antichrist in Rom und die ganze Hierokratie!“
Klaus wußte nicht, daß Hierokratie Priesterherrschaft bedeutet, wohl aber, wer mit dem Antichristen in Rom gemeint war, und er fragte, was denn nun eigentlich die Ketzer erringen wollten?
„Du fragst noch?“ rief Josephus verwundert. Doch dann bedachte er, daß Klaus, sein Wandergefährte, ein noch junger, unerfahrener Bursche war, und er antwortete: „Den reinen, den unverfälschten Glauben! Den Kommunismus der unchristlichen Gemeinden, der ersten, der wahren Christen! Frieden und Liebe allen Menschenbrüdern!“
„Ja, Josephus“, pflichtete Klaus bei, „das ist ein herrliches und edles Vorhaben!“
Der Alte sagte lange nichts. Sie gingen nebeneinander und schweigend ihren Weg. Unvermittelt stieß Josephus hervor, und es klang zornig und verbittert: „Aber die Menschen sind dumm! Gott sei’s geklagt, wie dumm sie sind!“
„Nicht alle!“ widersprach Klaus.
„Alle!“ zischte der Alte.
Wie er nur so reden könne, ereiferte sich Klaus. Ob er denn nicht an Arnold von Brescia, an Petrus Waldus, an Segarelli, Fra Dolcino und Margaritha von Trenk und an die Apostelbrüder und alle die mutigen Christenstreiter denke, die man Ketzer nenne?
„Ja, die!“ Der Alte schmunzelte vor Freude, daß der Junge sich die Namen so gut gemerkt hatte.
Klaus schwieg verdrossen. Auch Josephus schwieg.
Die Sonne stand schon lange in ihrem Rücken. Sie schritten schneller aus, denn vor ihnen lag ein Wald, den sie vor Einbruch der Dunkelheit noch durchwandern wollten. Dahinter kam, wie Josephus wußte, das Dorf Windisch.
Plötzlich platzte Klaus mit der Frage heraus: „Sind die Menschen gut oder böse, Josephus?“
Der alte Hausierer antwortete nicht gleich, blickte eine Weile sinnend vor sich hin und dann, wie um die Wirkung seiner Antwort vom Gesicht seines Begleiters abzulesen, schräg auf diesen. „Die einen sind bösartig, die andern dumm. Schlecht? Ja, schlecht sind sie alle.“
„Das ist nicht wahr!“ rief der Junge wütend.
„Doch ist es so. Tiere sind sie, bösartige oder dumme Tiere. Wenn du es mir nicht glauben willst, nun gut, du wirst es noch früh genug erfahren.“ – „Und Ihr? Seid Ihr etwa auch schlecht?“ fragte Klaus herausfordernd.
„Ja, auch“, erwiderte der Alte sofort. Und er bekräftigte es, indem er wiederholte: „Auch … auch!“
Klaus wich in Zorn und Erstaunen zurück und betrachtete seinen Begleiter entsetzt. Der achtete nicht weiter auf den Jungen, sondern blickte starr in verbissenem Trotz vor sich hin und schritt, den Kopf vorgestreckt, unter der Last seines Kramkastens gebeugt, hastig voraus.
Als sie die Stadt erreichten, trennten sie sich, und Klaus war dessen froh, denn der Alte war ihm unheimlich geworden. In Wismar war Markttag; Klaus schritt staunend durch die vielen Gassen und bewunderte die festen, dicht an dicht stehenden schmucken Häuser, die mächtigen Kirchen, vor allem aber die großen Schiffe im Hafen. Überall emsiges Hasten und Arbeiten. Auf eine mächtige Kogge, an deren Hauptmast eine bunte Fahne wehte, trugen Sackträger schwere Säcke. Klaus sah eine Weile zu, sprachlos vor Bewunderung darüber, wieviel solcher Säcke der Bauch dieses Schiffes aufnahm. Und immer neue Säcke wurden hineingetragen. Durch die krummen Gassen fuhren zahlreiche Fahrzeuge. Bauern und Bäuerinnen mit großen Kiepen und Körben auf den Rücken gingen vorüber. Ein hochmütiger Ratsdiener mit einem breiten Schwert im Gürtel ritt vorbei und musterte ihn argwöhnisch. Klaus fiel ein Lied ein, das in Dorteen an der Elbe, wo er bei Bauersleuten gelebt hatte, gesungen wurde: „Die liute von dem lande varn / gen die stat in grözen scharn / mit karren gezuogen, / die gen der veste truogen / von koufe manege richeit …“
Den Platz vor einer Kirche, die mit ihren festen Mauern, ihrem viereckigen, fensterlosen, aus Backstein errichtetem Turm einer Burg glich, füllten zahlreiche kleine Verkaufsstände mit rotem, blauem, grünem und weißem Anstrich. Rundherum standen Bauernwagen, auch Vieh: Ochsen, Kühe, Schafe. In aufgestapelten kleinen Käfigen sah er Hühner, Enten, Tauben. Und in anderen Ziegen und Ferkel. Klaus ging durch die Budenreihen; seine Augen tranken sich voll, und er sog die verschiedensten Gerüche ein, die der Wind ihm zutrug. Wie das roch! Was es alles zu sehen und zu kaufen gab! Die verschiedensten Feldfrüchte und große dunkle und helle, runde und längliche Brote. Geschlachtete Hühner und Gänse, abgezogene zartrosa Hasenleiber baumelten in langen Reihen an Stricken. Gleich daneben gab es Lebkuchen, dazu Herzen mit Inschriften aus Zucker. Aus der Pfanne eines Kastanienrösters roch es lieblich; für ein halbes Kupferstück bekam Klaus seine Rocktasche voll von der warmen rotbraunen Schalenfrucht. Buden waren da, in denen Leinenzeug, Stickereien, Bänder, bunte Knöpfe feilgeboten wurden. Dann solche, auf deren Tischen kleine Figuren aus Ton und Holz standen, die Gottesmutter mit dem Jesuskindlein im Arm, Christus am Kreuze, Christus das Kreuz tragend, Christus predigend. Aber auch lustige Bauerngestalten, musizierend, tanzend, und ein dürrer, fuchsähnlicher, eilig dahinschreitender Mann mit krummem Rücken, einen großen Stock in der Hand, dem Hausierer Josephus verblüffend ähnlich. Klaus war ganz benommen von all dem, was er erblickte.
Eine besondere Reihe war von den Fischhändlern besetzt. In flachen Bottichen lagen Heringe, Weißfische und Rotfische, Flundern, Dorsche, Makrelen, Zander, auch Fische, die Klaus nicht kannte, lange grünlichgraue, mit spitzen, gefährlich aussehenden Köpfen, und kleinere dicke, mit großen Schuppen und auffallend großen Glotzaugen. Sie machten verzweifelte Anstrengungen, dem Tode zu entkommen, schlugen mit ihren Schwänzen, krümmten sich, streckten die Köpfe hoch. Plötzlich blieb Klaus wie festgenagelt stehen. In einem Holzbottich ringelten sich lange, dunkle Schlangen, von denen einige dick waren wie ein Kinderarm, mit grauschillernden Leibern und kleinen Köpfen. „Das sind keine Schlangen“, belehrte ihn der Händler. „Das sind Aale.“ Klaus sah zweifelnd zu ihm hoch. Wenn das keine Schlangen sein sollten? „Ißt man die auch?“ fragte er. „Natürlich“, lautete die Antwort. Aber Klaus schien es gar nicht natürlich.
Das Schönste aber von allem war ein Sänger, der neben einer aufgestellten hohen Holzwand stand, auf der eine Anzahl grellbunter Bilder zu sehen waren, die einen gruseln machten. Um ihn herum standen Männer und Frauen und ganz vorn Kinder. Der Sänger, klein und dicklich, trug das Haar geschoren; es fiel in die Stirn und ging dann knapp über den Ohren rund um den SchädeL Es schien, als habe er eine flache Pelzmütze auf dem Kopfe. Er hatte eine mit Gips künstlich verlängerte, spitz nach oben weisende Nase und sah überaus lustig aus. Mit heller, lauter, monoton in gleichem Takt und Tonfall bleibender Stimme sang er eine traurige Geschichte, von der auch die Bilder auf der Tafel berichteten … „Der Vater im Blute, / die Tochter entehrt, / der Mörder-Verführer entflohn. / Oh, Väter! Oh, Mütter! Oh, junge Mägdelein, / wo wird der Verruchte jetzt sein? / Vielleicht ereilt schon heut’ / euch gleiches Herzeleid! …“ Einige Mädchen schrien auf vor Entsetzen. Auch Klaus lief ein Schauer über den Rücken.
Das war nicht der einzige Sänger auf dem Marktplatz, wenn auch der aufregendste; Klaus begegnete noch vielen. Einer mit einem Saiteninstrument, das harte, schrille Klänge gab, ein Alter mit vollem, schlohweißem Haar sang mit nicht unschöner, tiefer Stimme von dem Reichtum dieser Welt. Klaus blieb stehen und lauschte: „Nach Zentnern wiegen die Goten das Gold, / zum Spiel dienen edelste Steine. / Die Frauen spinnen mit Spindeln von Gold, / Aus silbernen Trögen fressen die Schweine …“ Wie schön, dachte Klaus ergriffen.
„Dort kommen die Geblendeten!“ rief jemand, und auch Klaus drehte sich um. Es waren gewiß die sieben in Schwerin bestraften Wegelagerer; Josephus hatte also nicht gelogen. In einer langen Kette, einer hielt den andern am Rock gefaßt, zogen die Blinden daher, geführt von einem Krüppel, dessen linkes Bein unterhalb des Knies in einem Holzstumpf endete. An ihren Leibern hingen Lumpen, und ihre augenlosen Gesichter waren grau und grünlich. Alle sieben hielten ihre Mützen vorgestreckt; einer rief unausgesetzt: „Barmherzigkeit, Leute, Barmherzigkeit! Laßt uns nicht verhungern! … Barmherzigkeit, Leute, Barmherzigkeit! Laßt uns nicht verhungern! …“
„Na, ihr Räuber“, schrie ihnen ein Viehtreiber zu, „jetzt ist es vorbei mit dem Raubhandwerk, was?“
„Wieviel Leute habt ihr umgebracht, als ihr noch sehen konntet?“ fragte ein anderer. „Habt ihr da Barmherzigkeit gekannt?“
„Die Leute sind grausam“, sagte Klaus zu einem Nebenmann.
„Ach was, es waren böse Menschen“, erwiderte der. „Sie haben den Bauern auf den Landstraßen aufgelauert, sie ermordet und beraubt.“
„Aber jetzt sind sie blind und unglücklich!“
„Ja, man hat sie hart gestraft.“
Eine dralle Bäuerin, nicht mehr jung, ein buntes Tuch um den Kopf, trat dem Elendszug entgegen und rief: „Haltet mal!“ Sie stellte sich dem Einbeinigen in den Weg. Dieser mußte wohl oder übel halten. Ein Blinder stieß gegen den andern, alle blieben stehen und streckten ihre Gesichter, die doch nichts sahen, neugierig vor. „Drei Jahre ist es jetzt her“, begann die Bäuerin, „da wurde mein Mann, der Andreas, auf dem Wege von Brüel nach Bützow ermordet. Vielleicht habt ihr Schweinekerle ihn umgebracht.“ Die Blinden murmelten verlegen und schüttelten ihre Köpfe. Um die schimpfende Bäuerin und die Blinden, die wie ertappte Sünder dastanden, hatte sich schnell ein Kreis von Bauern und Stadtleuten gebildet. „Habt ihr Schandkerle euch denn nie überlegt, was das heißt, einen Menschen umbringen?“ fuhr die Bäuerin fort. „Drei Kinder hatten wir, und das vierte war unterwegs. Fleißig und brav war der Andreas, und so hatten wir bei harter Arbeit unser Auskommen. Aber als er tot war, da haben wir gehungert, und die Jüngste, die Liese, ist gestorben, vor Hunger gestorben. Oh, ihr Schandkerle, was habt ihr für ein Unheil angerichtet!“
„Richtig, richtig!“ rief es aus der Menge.
„Totschlagen!“ schrie einer.
„Aber jetzt seid ihr elend dran“, setzte die Bäuerin in verändertem, mitleidigem Tonfall ihre Ansprache fort. „Jetzt hungert ihr und lebt von der Barmherzigkeit. Da habt ihr Brot, eßt und zieht eures Weges!“ Sie drückte jedem der sieben Blinden ein Stück Brot in die Hand.
Die Leute waren verblüfft. Eine Weile schwiegen alle. Dann rief einer: „Brav gemacht, Bäuerin!“ Rundherum hob ein zustimmendes Gemurmel an. Nun traten auch andere an die Blinden heran und warfen ihnen viertel und und auch halbe Pfennige hin.
Klaus zerrte seinen Nachbarn am Arm und sagte, ohne aufzublicken: „Das ist wahre Barmherzigkeit, nicht wahr?“
„Na ja, na ja!“ erwiderte der, ebenfalls gerührt von dem soeben Erlebten. „Seht nur, die Blinden weinen!“
Langsam setzte sich der Blindenzug wieder in Bewegung, mitten hinein in das Gewimmel der Marktbesucher. Niemand mehr rief ihnen Beleidigungen und Schmähungen nach.
In Wismar war die Pest ausgebrochen. Alle Vorsichtsmaßnahmen waren vergeblich gewesen, alle Gebete wirkungslos; – wie in den vergangenen zwanzig Jahren schon zweimal, war der Schwarze Tod zum drittenmal in die schwergeprüfte Stadt gekommen. Die Gassen lagen verödet da, wie ausgestorben; die Bürger hockten jammernd und betend in ihren vier Wänden und wagten sich keinen Schritt hinaus. Der Rat der Stadt und die Vornehmen waren gleich in den ersten Tagen geflohen. Alle Schiffe hatten den Hafen verlassen. Die Tore der Stadt waren verschlossen. Durch die leeren Gassen ritten vermummte Bewaffnete. Leichenkarren fuhren herum, und die Leichenknechte schrien in die verschlossenen Häuser, man solle die Leichen herausgeben. Auf den Plätzen brannten große Feuer, um die Luft zu reinigen. Anfangs hatten tags und nachts die Glocken geläutet; man hatte es jedoch abgestellt, da einige Bürger von diesem unaufhörlichen Sterbegeläut den Verstand verloren hatten.
In der Stadt lebte ein hochberühmter Arzt, der sich Doktor Angelicus nannte, und von dem man sagte, er habe in der großen Stadt Paris studiert. Die Bürger von Wismar priesen sich in ihrem Unglück glücklich, diesen weisen Mann in ihren Mauern zu haben. Doktor Angelicus hatte aber ein ausgesprochenes Pech mit seinen Gehilfen. Einer war ihm am ersten Pesttag gestorben. Ein anderer davongelaufen und nirgends aufzufinden. Ein altes Weib, das sich kaum selbst auf den Beinen halten konnte, ging ihm zur Hand, wenn der gelehrte Mann an den Kranken herumdokterte.
Klaus erklärte sich bereit, ihn bei seinem menschenfreundlichen Werk zu unterstützen. Doktor Angelicus wies auf die damit verbundenen Gefahren hin und fragte Klaus, ob er schon einmal Krankenhilfe geleistet habe. Der verneinte kleinlaut. Doktor Angelicus jedoch quittierte diese Antwort mit einer nichtssagenden Handbewegung und meinte: „Tut nichts. Wenn Er nur keine Angst und guten Willen hat.“
Doktor Angelicus, der kurz und beleibt war, hatte, was seinem Aussehen erst Würde verlieh, einen langen, beinahe bis auf den Bauch wallenden, pechschwarzen Bart, dazu seltsam starke, buschige Augenbrauen von der gleichen schwarzen Farbe. Jeden Tag, von der frühesten Morgenstunde bis in den späten Abend hinein, balgten sich die Kranken vor seinem Haus um den Vortritt. Bei solchem Tumult war vor geraumer Zeit einmal eine sieche Frau von rabiaten Kranken erschlagen worden.
Klaus hatte den Doktor in der Mittagsstunde angetroffen; die einzige Entspannung, die dieser sich nicht rauben ließ. Als er wieder hinunter an die Arbeit ging, nahm er Klaus gleich mit.
Der Doktor reichte dem Jungen einen langen, blut- und schmutzbefleckten, einstmals wohl weiß gewesenen Leinenkittel. Außerdem mußte er eine kapuzenähnliche Kappe über den Kopf ziehen, in der nur kleine Löcher für die Augen und ein schmaler Spalt für den Mund waren. Der Arzt zog zum Schutz gegen Ansteckung Lederhandschuhe an. Klaus erhielt keine, ein zweites Paar war nicht vorhanden; der geflüchtete Gehilfe hatte es mitgenommen.
Im Erdgeschoß hatte der Doktor seine Krankenstube. Nebenan in einem kleinen, dunklen Zimmer lagen die Operierten, bis sie wieder so weit bei Kräften waren, daß sie nach Hause gehen konnten.
Klaus sah sich in der Krankenstube um. In einem schmalen, offenen Schrank an der Wand stand eine Anzahl Flaschen und Dosen. Auf einem hochbeinigen Tisch lagen etliche Messer von verschiedener Größe, auch eine Zange und mehrere runde Eisenstäbchen, deren Zweck Klaus noch nicht kannte. Das war alles. Auf einen Holzbock ohne Lehne, der in der Mitte des Raumes stand, mußten sich die Kranken setzen.
„Laß den ersten herein!“ befahl der Doktor. Klaus ging an die Türe. Viele Leute, Männer und Frauen, alte und junge, aber meistens ältere, standen davor. Als sie den Gehilfen des Doktors sahen, riefen sie alle durcheinander, reckten flehend die Hände, drängten sich, stießen sich; jeder wollte der erste sein. Ein großer, knochiger Mann schob sich mit Gewalt vor und drängte an Klaus vorbei ins Haus.





























