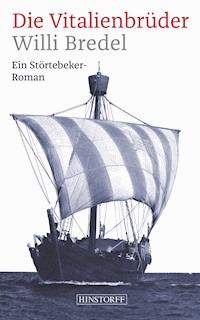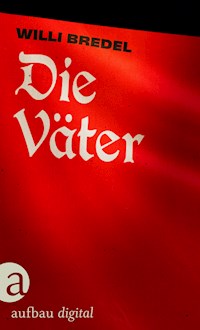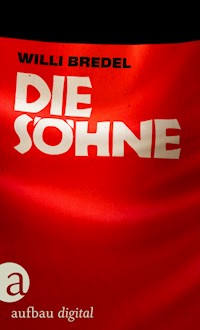
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den zweiten Band seiner herausragenden Romantrilogie „Verwandte und Bekannte“, um die Geschicke einer Hamburger Arbeiterfamilie über drei Generationen, schrieb Willi Bredel 1943. Fünf Jahre später wurde er schließlich veröffentlicht. Während in Europa der Erste Weltkrieg tobt, sucht Carl Brentens Sohn Walter, wie viele seiner Generation, nach Wegen, in dieser Zeit größter Inhumanität seine humanistische und fortschrittliche Sicht auf die Welt nicht gänzlich zu verlieren. Walter ist Auszubildender zum Metalldreher und engagiert sich in der sozialistischen Arbeiterjugend. Bald schon wird er zu einem ihrer führenden Köpfe und vertritt die Sache der Arbeiter in der Revolution von 1918/19 auch kämpferisch. Revolutionen schaffen Gewinner und Verlierer und die Familie Brenten scheint zunächst zu Ersteren zu gehören. Doch schon bald zeigt sich, dass Arbeiter auch in der neuen Weimarer Republik kaum Vorteile haben. Auch Walter und seine Familie verarmen zunehmend. Bei einer Aktion zur Demokratisierung der Hamburger Polizei wird er verhaftet und verurteilt und erfährt 1924, noch im Gefängnis, von der Geburt seines Sohns Viktor …
In Walter Brenten lassen sich starke autobiographische Züge des Autors finden. Zugleich wird an seinem Lebensweg die frühe Entwicklung der KPD aufgezeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Willi Bredel
Willi Bredel, geboren 1901, war ein deutscher Schriftsteller und gehörte zu den Pionieren der sozialistisch-realistischen Literatur. Als Sohn eines Hamburger Zigarrenmachers lernte er zunächst Dreher und engagierte sich außerdem in der Sozialistischen Arbeiterjugend sowie im Spartakusbund. 1919 trat er in die KPD ein. Während der Weimarer Republik wurde er politisch verfolgt und mehrfach verurteilt. 1933 ging er ins Exil u. a. nach Paris und Moskau und diente von 1937 bis 1939 als Kommissar in einer »Internationalen Brigade« im Spanischen Bürgerkrieg. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil engagierte er sich als Kulturpolitiker beim Aufbau der DDR und wurde später Präsident der Akademie der Künste der DDR. Bredel verstarb 1964 an einem Herzinfarkt in Ost-Berlin. Bei Aufbau Digital ist seine herausragende Romantrilogie »Verwandte und Bekannte« mit den Bänden »Die Väter« (1941), »Die Söhne« (1949) und »Die Enkel« (1953) verfügbar.
Informationen zum Buch
Den zweiten Band seiner herausragenden Romantrilogie »Verwandte und Bekannte«, um die Geschicke einer Hamburger Arbeiterfamilie über drei Generationen, schrieb Willi Bredel 1943. Fünf Jahre später wurde er schließlich veröffentlicht.
Während in Europa der Erste Weltkrieg tobt, sucht Carl Brentens Sohn Walter, wie viele seiner Generation, nach Wegen, in dieser Zeit größter Inhumanität seine humanistische und fortschrittliche Sicht auf die Welt nicht gänzlich zu verlieren. Walter ist Auszubildender zum Metalldreher und engagiert sich in der sozialistischen Arbeiterjugend. Bald schon wird er zu einem ihrer führenden Köpfe und vertritt die Sache der Arbeiter in der Revolution von 1918/19 auch kämpferisch. Revolutionen schaffen Gewinner und Verlierer und die Familie Brenten scheint zunächst zu Ersteren zu gehören. Doch schon bald zeigt sich, dass Arbeiter auch in der neuen Weimarer Republik kaum Vorteile haben. Auch Walter und seine Familie verarmen zunehmend. Bei einer Aktion zur Demokratisierung der Hamburger Polizei wird er verhaftet und verurteilt und erfährt 1924, noch im Gefängnis, von der Geburt seines Sohns Viktor …
In Walter Brenten lassen sich starke autobiographische Züge des Autors finden. Zugleich wird an seinem Lebensweg die frühe Entwicklung der KPD aufgezeigt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Willi Bredel
Die Söhne
Roman
Inhaltsübersicht
Über Willi Bredel
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil: Ein deutsches Lied
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Zweiter Teil: Unter den gleichen Sternen
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Dritter Teil: … und zu leicht befunden
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Vierter Teil: Das Ende vom Lied
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Fünfter Teil: Nur ein Übergang …
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Impressum
Erster TeilEin deutsches Lied
Erstes Kapitel
I
Der erste Tag im Mai, ein Sonntag obendrein, hatte urplötzlich die von grauer Schwermut umhüllte Elbestadt zauberhaft verklärt; alles strahlte und glitzerte und flimmerte unter der so lange entbehrten, nun überraschend aufgekommenen Sonnenpracht. Wolkenlos war der Himmel und dermaßen lichtüberflutet, als wäre die junge Frühlingssonne über das ganze Firmament geflossen. Trostlos war in seiner einförmigen, regenvollen Düsterkeit der April gewesen, nachdem der Winter, diesmal nicht nur empfindlich streng, sondern auch hartnäckig sesshaft, sich endlich doch verzogen hatte. In den Lüften, gestern noch von pfeifenden Stürmen durchzogen, war es nun hauchstill, so still, als hielte die Natur, wie selbst überrascht von diesem jähen Wechsel, den Atem an. Kräftige Düfte entströmten Bäumen und Strauchwerk, und in der schwülen Luft knisterte es geradezu von aufbrechenden Trieben.
Und dies Menschengewoge in den Straßen an der Alster! Wer irgend konnte, hatte seine vier Wände verlassen, um den neuerstandenen Frühling zu begrüßen. Auch die Vergrämtesten bekamen hellere Gesichter, und die Mutlosesten fassten neue Zuversicht.
Ein jeder entdeckte längst Vertrautes neu, hatte Freude an den schmucken, schwanenweißen Fährdampfern und den vielen Ruderbooten auf dem Wasser, an den jungen Mädchen, die mit umherschweifenden Blicken ihre Frühlingskleider spazierenführten, und gewiss auch an dem hohen, stolzen Petriturm, der wacker allen Winterstürmen standgehalten hatte und nun in seiner patinagrünen Pracht leuchtete.
Besonders staute sich das Menschengewimmel vor dem blendendweißen, von hohen Platanen umgebenen Alsterpavillon, der wie eine Wasserburg in den See ragte. Bis nahe an den Fahrdamm hatte der geschäftstüchtige Wirt Tische und Stühle gestellt. Und seine Rechnung stimmte, denn Pavillon und Vorgarten konnten längst nicht alle fassen, die hier eine Sonntagsstunde verplaudern und die Musik genießen wollten. Die Posaunentöne aus »Siegfrieds Rheinfahrt« dröhnten von der Veranda über das bunte Volksgewimmel hin, vermischten sich mit dem tausendstimmigen Gemurmel und gingen schließlich im Straßenlärm unter.
Ein Feldgrauer mit kaum verharschter, frischroter Narbe über Ohr und Wange, das Hanseatenkreuz am Rock, warf plötzlich, ungeachtet des Gewühles, seine Beine nabelhoch und marschierte in strammer Haltung an einigen gold- und silberdurchwirkten Achselstücken vorüber. Die hohen Offiziere am Gartentisch grüßten blasiert herablassend.
Eine besondere Sehenswürdigkeit für die Menge auf dem Jungfernstieg war ein unweit des Alsterpavillons inmitten eines Blumenrondells aufgestellter baumhoher Eiserner Michael. Dies mächtige hölzerne Standbild war über und über mit Nägeln beschlagen, und der so Benagelte trug die Züge des weithin vergötterten Feldmarschalls. Ästhetische Gesichtspunkte waren bei der Benagelung nicht maßgebend gewesen, wohl aber kriegswirtschaftliche. Es hatte eiserne Nägel gegeben, erschwinglich für das weniger bemittelte Volk, silberne für den gehobenen Mittelstand und goldene für die Begüterten. Der einfache Mann durfte den Leib bepanzern, der Kleinbürger Schild und Helm, und wer es dazu hatte, das Schwert. Der Erlös, mehr als fünf Millionen Mark, war in die große Kriegskasse geflossen. Längst hatten die eisernen Nägel Rost angesetzt – es war also eigentlich ein rostbrauner Michael –, aber Schild und Helm blitzten noch silbern, und das Schwert funkelte golden in der Frühlingssonne.
II
Zwei blutjunge Menschenkinder, die weder der nagelgepanzerten Kolossalgestalt noch dem ganzen Treiben die geringste Aufmerksamkeit bezeigten, bahnten sich einen Weg durch die Menge. Sie gingen Hand in Hand, und schon äußerlich unterschieden sie sich von allen übrigen. Der Junge trug kurze Hosen, an den bloßen Füßen Sandalen, dazu ein Jackett mit Schillerkragen darüber – auch das Mädchen war leicht beschuht, und ihr kornblumenblauer Miederrock unterhalb des Busenansatzes gerafft und mit einer Stickerei verziert.
»Biber!« rief das Mädchen laut und winkte ihrem Begleiter, von dem sie im Gedränge durch eine vielköpfige Familie getrennt worden war. »Biber!« wiederholte sie und zeigte ungeniert auf einen würdig dahinschreitenden Herrn im Gehrock, Besitzer eines graumelierten Knebelbartes. »Hast du gesehn? Ich hab jetzt fünfundachtzig!«
Der Junge warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu und entgegnete ärgerlich: »Wie kannst du jetzt solchen Unsinn im Kopf haben!«
»Pah! Das sagst du nur, weil du ihn nicht entdeckt hast! Ich hab jedenfalls fünfundachtzig!«
»Meinetwegen! Aber mir – mir steht der Kopf woanders. Wenn wir uns nur nicht verspäten. Womöglich ist die Beratung schon zu Ende. Na – und dann? Ist dir egal, was?«
»Red doch nicht so. Wie kann es mir egal sein?«
»Na, dann komm! Laufen wir!«
Damit rannte der Junge auch schon los, kreuz und quer den Spaziergängern ausweichend, vom Alten Jungfernstieg in den Neuen und dann an den dicken Stämmen der Kastanien entlang. Erst in der Großen Theaterstraße blieb er stehen und blickte sich um. Er glaubte, die Freundin sei weit zurückgeblieben. Sie kam jedoch unmittelbar hinter ihm angekeucht. »U–uh, wie du – wie du gerannt bist!«
Auf einer Bank in einem halbdunklen Korridor saßen sie dann und warteten. Hinter der großen Tür, deren reiche Schnitzereien verschiedene handwerkliche Berufe symbolisch darstellten, tagten Partei- und Gewerkschaftsvertreter. Walter hatte an der Tür gehorcht und deutlich Schönhusens rauhe, gurgelnde Stimme erkannt, die, wenn er erregt war, sich zu so merkwürdig schrillen Lauten steigerte.
»Gut, dass sie noch beisammen sind.«
Schweigen.
»Ob er wohl ja sagt? Davon hängt alles ab. Guck mal, ich drücke beide Daumen.« Sie zeigte ihm ihre winzigen, zu Fäusten geballten Hände.
»Nun ja, das ist auch schon was«, sagte er großartig.
Und sie saßen und warteten …
Immerfort die Daumen halten ist langweilig. So begann sie, ihr Haar, das beim Laufen in Unordnung geraten war, zu kämmen. Spielerisch, geziert holte sie die Zöpfe nach vorn, löste die Flechten und legte sie wieder zusammen. Plötzlich sagte sie: »Außerdem: kostenlos muss es sein, vergiss es nicht.«
Der Junge, vor sich hin grübelnd, fuhr sie hastig, fast grob an: »Die ganze Sache hätte überhaupt Gertrud regeln müssen. Es wäre ihre Pflicht gewesen.«
Sie strich mit den Händen über ihre Zöpfe und erwiderte gelassen: »Du hast doch gehört, was Gertrud gesagt hat: ›Das ist nicht mehr so einfach. Wenn überhaupt, dann hat es nur Erfolg, wenn ihr es selber versucht.‹«
Er war sichtlich anderer Meinung und machte eine entsprechende Handbewegung, schwieg aber und starrte auf die schwere, hellgetönte Eichentür mit den vielen drolligen Figuren: Bäcker mit hohen Konditormützen, Zimmerleute, die in einem Hausgerüst werken, Schiffbauer, an Booten beschäftigt, Eisengießer, die große Gusspfannen tragen, Schriftsetzer, die vor Setzkästen stehen …
»Und überhaupt«, begann sie wieder, »wirst du anfangen oder – oder ich?«
»Du natürlich! Du bist Gruppenobmann.«
»Natürlich ist es gerade nicht, du bist schließlich Literaturobmann. Eigentlich wäre es deine Aufgabe.«
»Na, schön!«
Beiderseitiges langes Schweigen.
Sie dann wieder, bedeutend versöhnlicher: »Junge Mädchen soll er gern haben, sagt Gertrud. Vielleicht gefall ich ihm.«
»Von mir aus viel Glück.«
Sie blickte schräg von unten herauf. »Ob ich einen Knicks mache?«
»Einen … – was?« Der Junge reckte seinen Hals und drehte ihr sein Gesicht zu. Ganz kugelrund wurden seine Augen. »Bist du übergeschnappt? Willst … willst du dich derart erniedrigen? – Ich sage dir, als Obmann hättest du dann ausgespielt. Todsicher! Unter Garantie!«
Sie lächelte und schwieg.
Er, immer noch kopfschüttelnd: »Einen Knicks? Du!«
Zu Hilfe kam ihnen, ohne dass sie es ahnten, ein Sprecher der Opposition. Schönhusen hatte die Beratung unterbrochen, er wollte sich noch vor Sitzungsschluss mit den abwesenden Vorstandsmitgliedern telefonisch verständigen. An der Tür verstellte ihm der Vertreter der Buchdruckergewerkschaft, Jan Overdieck, den Weg.
»Louis, draußen warten zwei von der Jugend, ein Junge und ein Mädel, die wollen mit dir reden.«
»Hab nicht eine Minute Zeit. Verflucht unerfreuliche Angelegenheit, die Sitzung heute. Findest du nicht auch?«
Schon wollte er sich davonmachen.
So leicht entwischte er Overdieck nicht, der selber eine Tochter in der Jugendorganisation hatte und von Walters und Gretas Anliegen wusste. »Louis, hör dir doch wenigstens an, was sie wollen. Zwei nette junge Menschen. Sitzen da und warten den halben Sonntag. Komm schon!« Damit zog er den noch Widerstrebenden mit sich.
»Nun, Kinder, sagt, was ihr auf dem Herzen habt. Hier ist Genosse Schönhusen, den ihr so dringend sprechen wolltet.« Jan Overdieck schob das Mädel vor.
Schönhusen stand da und überlegte, ob man nicht der Opposition den Wind aus den Segeln nahm, wenn man sofort eine neue Pressekommission zusammenstellte.
Die kleine Greta machte tatsächlich aus lauter Befangenheit einen tiefen Knicks, stieß ein paar Worte heraus, setzte abermals an, fand aber keinen Anfang. Mit einemmal jedoch gingen ihr die Worte durch.
»Genosse Schönhusen, wir wollen Sie bitten, meine Schwester Gertrud schickt uns, wir haben nämlich einen Elternabend, an dem wir schon viele Wochen arbeiten, und jetzt brauchen wir einen Raum, und zwar für nächsten Sonntag, Sonntagnachmittag, und meine Schwester sagt …«
Walter gab der Freundin ungeniert einen ziemlich derben Stoß, schob sie beiseite und blickte dem einflussreichen, über ihn hinwegsehenden Mann voll ins Gesicht. Ohne jede bittende Freundlichkeit sagte er: »Wir haben kommenden Sonntagnachmittag einen Elternabend. Ich bin Literaturobmann. Gruppe Neustadt sind wir. Uns fehlt ein geeigneter Raum. Gestatten Sie, dass wir den großen Festsaal benutzen dürfen? Wir werden bestimmt nichts in Unordnung bringen und nach Schluss der Veranstaltung alles aufräumen und säubern. Sie brauchen also gar keine Befürchtungen zu haben.«
Jan Overdieck lächelte gerührt. Elternabend? Louis Schönhusen war aufmerksam geworden und bekam ein strenges und misstrauisches Gesicht. Veranstaltung der Jugend? Es war Krieg. Sowenig Zusammenkünfte wie möglich war sein Prinzip. Ungehalten fragte er: »Was ist das nun wieder für eine Veranstaltung?«
»Ein Elternabend, das Programm haben wir selbst zusammengestellt.«
»Und worüber soll da geredet werden?«
»Über … über das deutsche Lied, Genosse Schönhusen«, rief Greta ängstlich.
»Jaja«, bestätigte Walter. »Ich werde sprechen. Dann singen wir einige Lieder. Ist alles schon geprobt.«
Schönhusen war mit seinen Gedanken bereits wieder bei seinen Angelegenheiten. Ob er nicht, falls er Stolten nicht antraf, gleich selber handeln sollte? Könnten sie es ihm übelnehmen, wenn er ihnen vorgriffe? Nun, was noch? Ach ja–a! Hm! Deutsches Lied … Hm! Dagegen war eigentlich nichts einzuwenden … Deutsches Lied …
»Na, Louis, sag ein Wort. Sag ja – und die Sache ist erledigt.«
Schönhusen nickte ungeduldig.
Overdieck strich Greta über das Haar. »Gut, gut! Genehmigt!«
»Aber wir haben kein Geld! Miete können wir nicht bezahlen!« rief Walter. »Wir nehmen nämlich auch keinen Eintritt.«
Schönhusen war schon weitergegangen. Was? Miete? Er winkte ab. War Otto Stolten telefonisch nicht zu erreichen, wollte er auf der Stelle das Generalkommando anrufen. Es war gewiss nicht falsch, wenn er der heutigen Affäre größere Bedeutung beimaß, als ihr vielleicht zukam …
»Ihr seht, Kinder, Genosse Schönhusen ist einverstanden. Nehmt also den Festsaal und bringt einen schönen Elternabend zuwege. Aber 'n klein büschen Eintritt würde ich an eurer Stelle doch fordern. Oder ist eure Gruppenkasse so reich?«
»Na, das gerade nicht«, antwortete Greta, die ihren Mut wiedergefunden hatte.
Jan Overdieck zupfte sie neckisch am Zopf. »Ich glaube, es wird eine hübsche Veranstaltung.«
»Bestimmt!« rief Walter. »Kommen Sie doch bitte auch.«
»Will sehen! Will sehen! Wenn ich Zeit habe!« Und er reichte Greta die rechte, Walter die linke Hand, als er sich von ihnen verabschiedete.
III
Unterdessen waren die Sitzungsteilnehmer aus dem Beratungsraum gekommen und hatten sich auf dem Korridor verteilt, durchweg ältere, schwerfällige Männer mit stattlichen Bärten. Greta und Walter, klein, jung, bunt, einem Märchenpaare gleich, das sich unter Trolle verirrte, flohen Hand in Hand dem Treppenaufgang zu und rannten ausgelassen und laut lachend hinunter.
»Gesichert!« jubelte sie. »Unser Abend ist gesichert.«
Der Junge lief immer einen halben Schritt voraus.
»Außerdem ging alles leichter, als wir dachten.«
Sie liefen bis an die Alster, dann gingen sie, wieder Hand in Hand, mit schlenkernden Armen, unter den in der späten Nachmittagsstunde schon spärlicher werdenden Spaziergängern am Ufer entlang.
»Greta, woll'n wir einmal rund um die Alster?«
»Warum denn?«
»Weil's heute so schön ist … Außerdem, weil Erster Mai ist. Wir müssen doch – doch demonstrieren.«
»Das ist verboten, wie du weißt … Du, hätt er's abgelehnt, dann – ich hätt ihm zugesetzt, das sage ich dir. Ich hatte mir alles schon zurechtgelegt … Bestimmt hätt ich das.«
»Na, was hättest du wohl groß sagen können?«
»Ich … Ich? Du kennst mich wohl, nicht wahr? Was ich gesagt hätte? Ich hätte gesagt: Sie Ungeheuer, hätte ich gesagt! Sie finsterer Wüterich! Sie widerlicher Dickhäuter, hätte ich gesagt! Sie haben ja nicht einen Funken Liebe für die Jugend. Wissen Sie eigentlich, wie Sie aussehen? hätte ich ihn gefragt. Nein? Nun, Sie sehen aus, wie gerade aus dem Urwald entsprungen, Sie … Sie Scheusal! Du, das hätte ich gesagt, bestimmt, todsicher!«
Der Junge erwiderte nichts; er sah nachdenklich aus. Von seinem Vater wusste er genau, was für einer dieser Schönhusen war. Schon häufiger war Walter Gewerkschaftsführern begegnet, und heute hatte er wieder dieses Gefühl von Ablehnung. Bislang hatte er in dem Glauben gelebt, Menschen mit einem Ideal in der Brust, wie es der Sozialismus war, müssten gute Menschen sein. Nicht zuletzt darum war er Sozialist geworden; denn ihm schien das Wesentliche an einem Sozialisten zu sein, dass er gerecht, ehrlich, anständig war.
Aber – genau wie heute hatte er stets Widerwillen empfunden, wenn er den meisten dieser allmächtigen Gewerkschaftsführer gegenüberstand. Schönhusen ein Sozialist? Ja, sogar ein Führer der Sozialisten? Dieser unwirsche, misstrauische Mensch ein Sozialist?
»Was hast du, Walter? Du bist so still? Ist nicht alles prächtig ausgegangen?«
Der Junge nickte …
War etwa nur Schönhusen so? Waren Bohnsack, Priemel, Ladebrecht, Halsing anders? Wo war bei ihnen Frische, wo Kühnheit, Wagemut, der Mut zu Neuem, zum Sozialismus? Das Allerwichtigste schien ihnen zu fehlen: Liebe zu den Menschen. Die und sich für andere aufopfern, ach je! Walter jedenfalls zweifelte daran. Eher musste man glauben, wenn man sie sah und hörte, dass sie die Menschen hassten und verachteten und dass einer dem andern nicht traute …
Es waren schon ernste Überlegungen, die dem Jungen an diesem sonnigen Maitag zu schaffen machten.
»Du denkst gewiss an unseren Elternabend? Hast du etwa Lampenfieber?«
Nun blickte Walter die Freundin voll an. »Nee, das nicht. Das kommt wohl erst, wenn es soweit ist.« Und um sich von seinen trüben Gedanken loszureißen, fuhr er fort: »Sieh nur, nicht ein einziger Stuhl im Alsterpavillon ist frei.«
»Wolltest du rein?«
»Da würden du und ich wohl nicht hineinpassen.«
Er stieß sie unauffällig an, deutete mit verschmitztem Lächeln auf einen stattlichen Herrn mit majestätischem Vollbart und sagte fast flüsternd: »Biber!«
»O–oh!« Sie war ganz hingerissen von diesem Prachtexemplar.
»Du – ein richtiger Bettvorleger –, der zählt mindestens zehn. Einverstanden?«
Der Vollbärtige, seinem Habitus nach Oberlehrer, blickte von unerreichbarer Höhe auf das ihn anstarrende Freundespaar.
»Au, der ist wirklich fein!« gestand sie neidlos. »Du hast jetzt hundertfünf, nicht?«
Sie überlegte und fragte: »Was zählt es eigentlich, wenn man … einen Vollbart – anfasst?«
Der Junge lachte laut. »Untersteh dich! Das würde dir schlecht bekommen.«
»Aber was zählt's?«
»Nun, bei solch einem Wunderbart mindestens fünfundzwanzig. Bei einem weniger gepflegten fünfzehn, vielleicht auch zwanzig. Natürlich darf der Bart nicht einem aus der Verwandtschaft gehören.«
Ihre Taktik war, ihn mit Fragen abzulenken, während sie flink nach Bärten Ausschau hielt. Anfangs hatte sie wenig Glück. Männer waren rar, und die wenigen, die auf der Straße zu sehen waren, waren größtenteils glatt ums Kinn, und einfache Schnurrbärte zählten nicht.
Ecke Alsterdamm jedoch kreischte sie plötzlich laut auf: »Biber! Biber!« Sie hüpfte vor Entdeckerfreude und zeigte auf einen untersetzten älteren Mann, der am Ufergeländer stand und auf das Wasser sah. Einen großartigen, einen geradezu phänomenalen Backenbart hatte der, rundgeschnitten, an den Wangen gekräuselt.
»Teufel auch, ist das ein Bartgeflecht!« anerkannte Walter. »Scheint 'n Seebär zu sein. Dafür geb ich dir fünfzehn. Der ist noch besser als meiner vorhin.«
»Pass mal gut auf!« sagte sie todernst, ließ seine Hand los und ging forsch auf den bärtigen Biedermann zu.
Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, stellte sie sich vor ihn hin und blickte ihm frei ins Gesicht. Als der Bewunderte sie bemerkte und ihr freundlich zulächelte, fragte sie: »Entschuldigen Sie, Herr Kapitän, kennen Sie zufällig das Biberspiel?«
»Nee, min Deern, dat kenn ich nich!«
»Ooch, wie schade. Das ist nämlich so: Wer zuerst einen Bart entdeckt, bekommt Plus, verstehn Sie? Mein Freund und ich spielen es. Er hat schon über hundert, ich habe erst fünfundachtzig. Aber Ihren Bart, Herr Kapitän, den hab ich entdeckt, und jetzt hab ich hundert. Ich könnte meinen Freund glatt schlagen, wenn Sie mir gestatten, einmal Ihren Bart anzufassen, denn dann bekomm ich mindestens fünfundzwanzig Plus … Ob ich wohl mal darf?«
Lotse Asmussen aus Blankenese hatte aufmerksam der langen Erklärung zugehört und lachte nun in sich hinein, dass sein ganzer Körper bibberte. »Wat du nich seggst, min Deern, min Bort teilt fofftein, un fiefuntwintig, wenn du or angripen kannst? Dat is jo en smartes Speel. Kann ick nich mitspeelen?« Die Augen wurden ihm feucht vor Lachen. »Aber wo is denn din Fründ?«
»Da am Baum steht er und sieht her!« Die kleine Greta lachte herzhaft mit.
Lotse Asmussen trocknete sich umständlich die Augen und sagte ernst und feierlich: »Dann foot man mol ordentlich rin in den Bort!« Er hielt seinen Kopf sogar ein wenig schräg, damit sie besser hinreichen konnte.
Greta gab Walter, der hinter einer Kastanie Deckung gesucht hatte und mit weitaufgerissenen Augen ihr sündhaftes Vorhaben beobachtete, ein Zeichen und streichelte und zupfte sanft den Bart des stillhaltenden Lotsen.
»Recht vielen Dank auch, Herr Kapitän!«
Der so mit Dank Bedachte zwinkerte ihr mit feuchten Augen schelmisch zu und meinte: »Foot man noch mol rin, dann teilt dat fofftig!«
Das übermütige Geschöpf griff ein zweites Mal in die dichte Bartwolle. Dann machte sie einen Knicks, biss sich, um das Lachen zu verdrängen, auf die Lippen und rannte zu Walter, der sich ganz hinter dem Stamm der Kastanie verkrochen hatte.
»Bitte, was sagst du nun? Hundertfünfzig!«
»Du bist verrückt!« fauchte er.
»Hundertfünfzig!«
»Das ist ja schamlos … unmöglich!«
»Hundert-und-fünfzig!«
»Die Leute. Hast du gesehen, wie sie sich über dich lustig machten?«
»Was mich schon die Leute angehn! Ich gönn ihnen ihr Vergnügen. Der Käppen ist ein feiner Mann. Du, der war sofort einverstanden. Ich hätte bestimmt noch ein dutzendmal zupfen können.«
»Lass uns bloß machen, dass wir von hier wegkommen! Los!«
Und schon rannten beide den Alsterdamm entlang.
IV
Hinterher lachte auch Walter, ja, er war begeistert von ihrer Courage. Das hätte er ihr nie und nimmer zugetraut. Aber er zeigte ihr das natürlich nicht, tat weiter entrüstet und kehrte den Sittenstrengen heraus. »Ich spiel nicht mehr Biber.«
»Und warum nicht?« fragte sie herausfordernd.
»Da kann ich nicht mit. Was du tust, ist … ist unlauterer Wettbewerb.«
»Du kannst eben nicht vertragen, besiegt zu sein.«
»Als Mädchen kannst du jeden Mann am Bart zupfen, und er lässt es sich gefallen. Ich kann es nicht. Wie soll ich bei einem so ungleichen Verhältnis siegen?«
»Na – dann – dann spielen wir eben ohne Bartzupfen«, lenkte sie ein. Nach einer kleinen Weile wollte sie wissen: »Sollen die fünfzig nun gelten oder nicht?«
»Hm! Die mögen noch mal gelten. Ausnahmsweise.«
»Übrigens, Walter, mir fällt ein, bei den Gewerkschaftsmännern vorhin gab's eine Unmenge Bärte. Dass keiner von uns daran gedacht hat. Es waren zwar, wenn ich mich recht erinnere, größtenteils Spitzbärte. Aber Kleinvieh gibt auch Mist. Wir haben mindestens dreißig Plus fahrenlassen.«
Walters Gesicht verfinsterte sich sogleich. Das Bild dieser Gewerkschaftsführer stand wieder vor ihm, und damit auch das kantige, kurzstirnige Gesicht Schönhusens. Plötzlich blieb er ruckartig stehen, zog die Freundin an sich und sagte – und es klang beinahe drohend: »Wollen wir uns versprechen, dass wir nie so werden? Nie?«
»Was meinst du?« Sie war verwundert über seinen ernsten Ausdruck.
»Was ich meine? Wir wollen uns geloben, nie so zu werden wie … wie diese – diese Alten. Verstehst du mich?«
»Du bist aber komisch. Wie könnten wir so werden? Haben wir nicht oft genug davon gesprochen?« Sie suchte in den forschend auf sie gerichteten Augen eine Erklärung für seine Worte. »Ich denke mir, die können gar nicht anders sein, als sie nun mal sind. Wir aber, du und ich, wir können gar nicht so werden. Meinst du nicht auch? Wir wollen es ja auch gar nicht.«
»Das ist es!« stimmte er zu. »Wir wollen nicht so werden. Lass uns das fest versprechen.«
»Aber Walter, das ist doch selbstverständlich.«
»Ich hab Angst! Richtige Angst! Schwör's! Versprich mir's auf der Stelle!«
»Mein Gott, bist du seltsam! Was hast du nur? Was gehen uns die Alten an? Diese … also, da kann ich nur lachen, weißt du. Ich ginge nicht einen einzigen Schritt mehr mit dir, wenn du jemals werden könntest so wie die … Ist ja Unsinn!«
»Und du? Du wirst niemals so ein Modepüppchen, das Tanzlokale besucht und den Männern Blicke zuwirft? So hoch die Stöckelschuh und so breit der Hutrand, mit dem Getue und Geziere, und das …«
»Nie, nie, nie!« Sie lachte hell auf. Dann sagte sie ernsthaft: »Du beleidigst mich. Was denkst du eigentlich von mir?«
Darauf gingen sie wieder – einig und versöhnt – am Ufer des Alstersees entlang, vorbei an den breitausladenden Akazien.
Er jedoch konnte nicht so schnell vergessen wie sie. Das Gesicht des Gewerkschaftsführers verwandelte sich plötzlich in das Gesicht seines Vaters, das auch voll und rund und schnurrbartgewaltig war, wenn auch nicht so stur und leer. An den letzten Brief aus Neustrelitz musste er denken, an seines Vaters klagende Bitte um Goldstücke und Zigarren. Goldstücke waren Urlaub, Zigarren ein erträglicheres Dasein. Hätte er genügend Zigarren, so hieß es im Brief, dann brauchte er sich nicht mehr so schinden und triezen zu lassen, sondern könnte sogar das Glück haben, selber Rekruten auszubilden. Klang das nicht, als sei er auch bereit, zu schinden und zu triezen, nur um selber nicht mehr geschunden zu werden? Walter erinnerte sich auch an einen anderen Brief, Mutter solle zu Schönhusen gehen, der könne ihn möglicherweise reklamieren. Früher hatte er kein gutes Wort für diesen Menschen gehabt. Wie feige und charakterlos doch alle geworden waren. Selbst Vater. Mit diesen Alten war eben nichts mehr anzufangen, sie hatten Grind und Schinn angesetzt, waren fett und feige geworden.
»Nun fängst du schon wieder zu grübeln an.«
»I wo! Was meinst du, Greta, woll'n wir noch 'ne Stunde rudern? Bei der Bootsvermietung dort werden gewiss Boote frei sein.«
»Ja, fein! Hast du denn Geld?«
»Soviel schon. Was aber können wir als Pfand hinterlegen?«
»Da kommt Gertrud!«
V
Gertrud Boomgaarden, Gretas ältere Schwester, war Leiterin der Jugendgruppe Neustadt, die sie vor fast zehn Jahren mitgegründet hatte. Noch nicht fünfundzwanzig, hatte sie bereits, trotz Schneckenfrisur, Reformkleidung und flachen Absätzen, in ihrem Gehabe etwas Altjüngferliches, was ihr jedoch von der Gruppe nachgesehen wurde, denn sie war beliebt und meinte es auch herzensgut.
»Trudel, alles hat prima geklappt!« rief Greta ihr zu. »Wir haben ihn. Dazu ohne Miete. War alles denkbar einfach, nüch, Walter?«
»Das ist schön. Das freut mich.« Gertrud Boomgaarden begrüßte beide mit Handschlag.
»Außerdem habe ich runde fünfzig Punkte mehr als er. Ich hab auf dem Jungfernstieg vorhin einem famosen Seebären zweimal im Bart gekrault. Schade, dass du es nicht gesehen hast.«
»Du flunkerst!«
»Nee, nee, stimmt«, bestätigte Walter. »Die Leute haben nicht schlecht gefeixt.«
»Das hast du wirklich getan?« Die Schwester machte ein hilfloses und erschrockenes Gesicht.
»Wenn's nach dem Käppen gegangen wäre, könnt ich jetzt noch an ihm zupfen.«
»Aber, Greta, schämst du dich nicht? Erzähl es bloß niemand. Was soll man von dir denken?«
»Pah! Hat mir gar nichts ausgemacht. Was andere von mir denken, ist mir piepe. Walter aber soll sich anstrengen, mich einzuholen.«
»Und was habt ihr jetzt vor?« fragte Gertrud.
»Rudern wollen wir«, antwortete Walter. »Komm mit! Nur eine Stunde.«
»Nee, nee! Man ja nich, aufs Wasser geh ich nicht. Rudert nur alleine … Aber, was ich noch sagen wollte, Walter! Ja … Der Elternabend kann also steigen. Schön. Ich habe mir deine Vortragsdisposition angesehen. Weißt du, ich finde sie etwas … etwas einseitig. Ich fürchte, deine Rede könnte Anstoß erregen.«
»Wieso?«
»Ich meine … weißt du, das Thema heißt doch ›Das deutsche Lied‹, nicht wahr? Aber du zeigst nur eine Seite des deutschen Liedes, die kriegsfeindliche, kriegsablehnende Seite. Das ist nicht objektiv. Im deutschen Lied, im Volks- und Kunstlied, sind doch beide Seiten vertreten.«
Der Junge stand da, hörte aufmerksam zu. Langsam stieg leichte Röte in sein Gesicht. Er erwiderte ironisch: »Soll ich etwa für Kriegslieder werben? Vielleicht für ›Es braust ein Ruf wie Donnerhall‹? Oder ›Heil dir im Siegerkranz‹?«
»Nein, das sollst du nicht, aber erwähnen musst du sie, erwähnen, dass es auch solche deutschen Lieder gibt, sonst hast du das Thema nicht erschöpft.«
»Oh, erwähnen werd ich sie schon, verlass dich drauf. Gerade den Kriegsliedern stelle ich ja das kriegsfeindliche Lied gegenüber.«
»Alles schön und gut, Walter, vergiss aber nicht, wir befinden uns im Kriege. Aus einer zu einseitigen Stellungnahme könnten Unannehmlichkeiten erwachsen. Du verstehst doch?«
»Nein«, erwiderte er schroff. »Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nur, dass Angst hinter dem steckt, was du Objektivität nennst!«
»So begreif doch, die Partei könnte Unannehmlichkeiten haben.«
Ruhig, mütterlich, eindringlich versuchte die Jugendleiterin ihn zu überzeugen, ihn wenigstens zu bereden, ihren Standpunkt zu verstehen. Doch er ließ sich nicht bereden, noch weniger überzeugen. Trotzig wehrte er sich.
»Schönhusen könnten Unannehmlichkeiten entstehen?«
»Natürlich, ihm besonders!«
»Soso!« Verächtlich lachte der Junge vor sich hin. Er überlegte, er kämpfte mit sich, als hinge vom Inhalt seines Vortrages unendlich viel ab. Einen Moment schwankte er, aber … nein, er wollte nicht die geringste Konzession machen.
Greta, die bisher schweigend der Unterhaltung gefolgt war, nahm seine Hand und sagte beschwichtigend und vermittelnd: »Überleg gründlich, Walter, ob Trudel nicht doch recht hat.«
»Nein!« Er riss sich von ihr los. Dann noch heftiger: »Nein! Entweder sage ich, was ich für richtig halte – oder gar nichts!«
Die Jugendleiterin blickte ihn halb traurig, halb lächelnd an, legte ihre Hand auf seine Schulter und sagte: »Warum gleich aufbrausen, Walter? Es war doch nur ein Vorschlag und – eine Bitte. Ich will dir keine Vorschriften machen. Was ich möchte, ist einzig und allein, dass unser Elternabend gut gelingt. Gerade heute, wo alle Menschen soviel Sorgen und sowenig schöne Stunden haben … Und nun – geht rudern, ihr beide. Seid aber vorsichtig und bleibt auch nicht zu lange auf dem Wasser. Es ist der erste warme Tag, der Abend wird gewiss noch recht kühl werden.«
Gertrud Boomgaarden war weitergegangen. Der Junge aber stand noch immer auf derselben Stelle.
Greta suchte wieder seine Hand. »So komm doch, Walter! Gehn wir!«
Ruhig, als fällte er ein Urteil, an dem es nichts zu deuteln gab, sagte er: »Sie gehört auch schon zu den Alten.«
Greta widersprach empört: »Wie du redest. Sie meint es nur gut. Sie gehört doch zu uns.«
»So–o? Na, dann geh doch mit ihr! Lauf doch! Wirst sie noch einholen.«
»Ich denk, wir wollen rudern?«
»Ich mag nicht mehr!« Und noch heftiger: »Ich mag überhaupt nichts mehr hören und sehen. Weder von Gertrud noch von dir. Geh schon zu deiner Schwester! Geh schon!«
Damit drehte er ihr auch schon den Rücken und jagte davon.
Zweites Kapitel
I
Walter hatte das peinigende Gefühl, ein Unrecht, eine große Dummheit begangen zu haben. Ihn quälte die Vorstellung, Greta stehe noch immer dort, wo er sie verlassen hatte, und könne nicht begreifen, warum er davongelaufen war. Es pochte in ihm: Kehr um! Kehr um! Gegen seinen Willen rannte er dennoch weiter. Ich habe auch meinen Stolz, redete er sich ein. Sie ist dumm und versteht mich nicht. Hatte Trudel sich nicht wie eine richtige Tunte benommen? Irgendeine seiner Tanten hätte nicht anders gesprochen. Greta aber hielt zu ihrer Schwester. Während er so die in ihm glimmende Empörung immer aufs neue schürte, raunte ihm eine andere Stimme unausgesetzt mit quälender Beharrlichkeit zu: Immer schäumst du gleich über, vergießt und vergeudest das Beste …
Am Dammtor zögerte er: entweder die Ringstraße hinauf und geradewegs nach Haus oder – oder durch den Valentinskamp. Er bog nach dem Valentinskamp ab. Doch erneut und tückischer als zuvor rumorten in ihm Reue und Trotz. Willst du etwa nachgeben, wo du doch im Recht bist? Vor einem Mädchen willst du dich klein machen? Womöglich ist Gertrud oben und beginnt wieder zu schulmeistern. Nee, die wollte er heute nicht mehr vor Augen haben, die nicht. Das gab schließlich den Ausschlag; er ging an der Schuhmacherwerkstatt von Wilhelm Boomgaarden vorbei, ohne auch nur einen Seitenblick hineinzuwerfen. Höhnisch wiederholte er im Vorbeigehen: »Der Partei keine Unannehmlichkeiten bereiten! Ach, du meine Güte! Das war offenbar gleichbedeutend mit Majestätsbeleidigung! Nur keine Unannehmlichkeiten! Man bloß nicht! Der Schutzmann muss zu allem, was man tat, ja sagen und ein freundliches Gesicht machen. Sozialisten sind das! Allmächtiger!«
Es tat wohl, unter solchen Spottreden dahinzuschreiten. Die Brust weitete sich, dass man Kraft verspürte, auf alles zu pfeifen, sich allem entgegenzustellen. Man bekam sogar so etwas wie Hochachtung vor sich selber.
Am Ende der Straße, kurz vor dem Holstenplatz, gewannen indessen die Geister des heulenden Elends wieder die Oberhand. Sein schlechtes Gewissen zwickte und zerrte ihn. Was sollte er eigentlich zu Hause? Wie – wenn er in die Wexstraße, ins Kino ginge? Dort gab's einen neuen Film mit Buffalo Bill. Zwar war so etwas anzusehen genauso verwerflich wie das Lesen von Nick-Carter- oder Lord-Percy-Stuart-Heften, aber egal, der Sonntag war sowieso verdorben. Noch besser freilich wäre, mit der Ringbahn nach der Reeperbahn zu fahren und dort zu bummeln. Glatt mal aus den gewohnten Pantinen kippen. Was lag schon dran? Und besonders heute?
Dann kam stumme Resignation über ihn, mit kniefreien Strümpfen, Jesuslatschen und kurzen Hosen konnte man schlecht einen Reeperbahnbummel machen. Auch in der Wexstraße konnte einem blühen, dass der Portier sagte: »Für Kinder Zutritt verboten!«
Dann also doch nach Hause …
II
Und zu Hause – Tantenbesuch. Auch das noch. Dieser vermaledeite Sonntag brachte nur Pech. Tante Cäcilie, die muntere, redselige, und Tante Hermine, die despotische mit dem dicken Hintern waren gekommen, mit ihnen Onkel Ludwig, still, bleich und so dürr wie eine lebendig gewordene Rippe seiner Ehehälfte.
Schon der Empfang der Mutter an der Tür. »Mein Gott, wo stromerst du denn den lieben langen Sonntag umher?«
»Fang du auch noch an, bin gerade in der richtigen Stimmung.«
»Hu–uch, der Herr hat schon Stimmungen! So was! Ist dir 'ne Laus über die Leber gelaufen? Setz mal 'n Sonntagsgesicht auf und sag drinnen guten Tag.«
Walter fand seine Mutter ungewöhnlich gut aufgelegt.
»Freust dich wohl über den Besuch, was? Schade, dass Vater nicht hier ist.«
»Halt den Mund, Bengel!« zischelte Mutter Frieda. »Geh rein und benimm dich manierlich.«
Ja, so sind Frauen! Kein Gedächtnis, keinen Sinn für Würde! Was hat diese Hermine ihr nicht alles angetan? Wie hat die sie getriezt. Und nicht nur das, sogar öffentlich gekränkt und geschmäht. Aber nun hocken sie wieder beisammen und tun schön. Als wenn's keine anderen Menschen gäbe als dergleichen Verwandtschaften. Herrgott, sind die Alten sonderbar, was für Narren sie sind … Sich das Leben selber so zu verleiden und zu erschweren …
»Na also, da ist er ja!« tönte es Walter entgegen, als hätten beide Tanten nur auf ihn gewartet. Groll im Innern, Groll im Gesicht, gab er rundum die Hand, sagte »Guten Tag«, »Nee, nee« und »Ja, ja«.
»Groß ist er geworden«, fand Tante Cäcilie, die fast einen halben Kopf kleiner und zart und zierlich war wie ein Porzellanfigürchen.
»Sind die Hosen nüch 'n büschen kurz?« ließ sich nach kritischer Würdigung Tante Hermine vernehmen.
»Jaja«, beeilte sich Onkel Ludwig, ihr beizustimmen, »bis an die Knie müssten sie mindestens reichen.«
»Mindestens! Mindestens!« ereiferte sich Hermine. »Und die Haare, wirklich, Frieda, die Haare sind viel zu lang.«
»Sprichst du von meinen Haaren?« fragte Walter.
»Ja, natürlich!«
»Hochverehrte Tante Hermine, würde dich vielleicht interessieren zu hören, was mir an dir missfällt?«
Hermine Hardekopf verstummte und sah mit hilflosen Kuhaugen von dem Jungen zu dessen Mutter, dann auf ihren Mann, als erwarte sie, dass jemand von ihnen rettend eingreifen werde.
Frieda, verlegen: »Ich hab ja gesagt, schlecht gelaunt ist der Herr heute.« Und zu Walter: »Schäm dich!«
»Man soll mich gefälligst in Ruh lassen«, brummte der Junge, erhob sich und verließ das Zimmer.
»Findest du nicht auch, Frieda, dass sein Betragen recht rüpelhaft ist?«
»Jaja, Hermine. Außerdem – auch darin hast du recht –, ich finde kurze Hosen abscheulich!«
»Überall ist es so. Der Vater fehlt. Das wird nach dem Krieg ein ernstes Problem werden, die Erziehung der Verwahrlosten.«
Frieda wandte sich verzweifelt an Cäcilie. »Meinst du nicht auch, sehen lange Hosen nicht viel männlicher aus? Aber er lässt sich ja nichts sagen!«
»Lass ihn nur«, meinte Onkel Ludwig nachsichtig, »lass ihm die kurzen, solange er daran Gefallen findet; die langen zieht er noch früh genug an.«
Als das Interesse an Walter erloschen war, drehte sich das Gespräch wieder um Gustav Stürcks Nierenleiden und Rudolf Haberlands, Hermines Schwager, schwere Kriegsverletzung. Beide Beine waren ihm amputiert worden. Hermine betonte mit Nachdruck: »Aber das Eiserne Kreuz erster Klasse hat er bekommen. Immerhin!« Dann wurde das Gespräch gedämpft fortgeführt, mit Rücksicht auf den Jungen, der womöglich nebenan horchte, denn Anni Bockelmann, die Nachbarstochter, wurde durchgehechelt, die, obwohl noch nicht mal verlobt, demnächst etwas erwartete. Tante Hermine sagte: »Es wird nach dem Krieg eins der schwersten Probleme sein, den Menschen wieder Moral beizubringen.«
Gegen zehn Uhr ging der Besuch. Die Freude bei Mutter und Sohn war gleich groß.
»Warum ladest du sie immer wieder ein?«
»Ich kann sie doch nicht rausschmeißen!«
»Warum nicht? Einfach ehrlich sagen, sie soll'n dich nicht wieder mit ihrem Besuch beehren.«
»Red nicht solchen Unsinn. Ludwig ist mein Bruder.«
»Onkel Ludwig, ja. Tante Cäcilie meinetwegen auch. Aber die Dicke doch nicht, die dich früher so gepiesackt hat.«
»Ach, das verstehst du nicht. Nun Schluss damit. Sie sind fort, und so bald werden sie hoffentlich nicht wiederkommen.«
Frieda Brenten war heute so lebhaft und so gut gelaunt, wie ihr Sohn sie schon lange nicht mehr gesehen hatte. Sie scherzte und lachte, machte ausgelassene Bemerkungen über das »Wollknäuel Hermine« und den »Wollfaden Ludwig«. Die beiden waren erst zu Cäcilie gegangen und hatten sich einfach angehängt, allein hatten sie sich nicht zu Frieda getraut.
»Weißt du was, Junge, morgen machst du einfach blau. Ist schließlich dein Geburtstag. Irgendeine Ausrede werden wir schon finden.«
»Prima! Machen wir, Mutter!«
Walter war begeistert von diesem Vorschlag. »Weißt du, ich hätt sonst noch eine halbe Stunde früher aufstehen müssen, denn ich hab eine Anzeige zur ›Echo‹-Druckerei zu tragen, die morgen nachmittag in der Zeitung stehen muss. Nun, dann kann ich ja in Ruhe ausschlafen. Einfach prima!«
III
Am Morgen stand, wie insgeheim zuversichtlich erwartet, ein Geburtstagskuchen mit sechzehn brennenden Kerzen an Walters Bett. Daneben lagen ein Paar Socken und ein Sporthemd mit Schillerkragen; ein Strauß Maiglöckchen duftete lieblich in einer kleinen Vase.
Aber auf dem großen Tisch lagen weitere Herrlichkeiten: ein wunderschönes Schachspiel neben einem Strauß Flieder. Ein Kärtchen steckte darin, von – Greta. Der Junge bekam brennende Wangen, teils vor freudiger Überraschung, teils aus Verlegenheit. Sie schrieb: »Ich drücke Dir kräftig die Hand, Du Wüterich. Greta.« … Das Geschenk hatte sie also noch gestern spätabends gebracht … Wüterich? Nein, Greta, das bin ich nicht, gewiss nicht, verteidigte er sich kleinlaut. Und da? Drei herrliche Bände mit Lederrücken: August Bebel »Aus meinem Leben«. »Glückwünsche zum sechzehnten Geburtstag. Gruppe Neustadt.« stand im ersten Band, und alle hatten ihren Namen hineingeschrieben. Na, das nenn ich mir ein Geschenk. Da stand noch ein Strauß Feldblumen – von Gertrud Boomgaarden. Alle hatten an ihn gedacht. Wie schön, viele gute Menschen zu Freunden zu haben.
»Guten Morgen, mein Junge! Herzlichen Glückwunsch! Freust du dich ein bisschen?« Mutter Frieda umarmte ihren großen Jungen. Die kleine Elfriede kam hinterhergetrippelt, rappelte ihren Glückwunsch herunter und überreichte, widerstrebend zwar, dem heute so reich beschenkten großen Bruder eine Tafel Schokolade.
»Oh, wie fein! Wo hast du die noch aufgetrieben? Die wollen wir man gleich vermöbeln!« Schon war die Tafel in drei Stücke zerbrochen, und auch die Kleine erhielt ihren ersehnten Anteil.
»Vater schickt zehn Mark und diesen Brief … Steh man auf, ich mach den Kaffee fertig.«
Walter stand nicht gleich auf, sondern las, Schokolade kauend, Vaters Brief aus Neustrelitz. Er schrieb, wie zu erwarten, nichts Besonderes. Nach den Glückwünschen kam die Frage, wie ihm die Arbeit gefalle. Dann folgten längst bekannte Klagen. Als ob er, gerade sechzehn geworden, seinem Vater helfen könnte, vom Kommiss loszukommen.
Der Junge legte den Brief beiseite. Er weiß überhaupt nichts von mir. Nach der Fabrikarbeit fragt er, als ob das das Wichtigste sei. Er denkt im Grunde nur an sich, selbst in diesem Glückwunschbrief. Goldstücke beschaffen … Wie und woher nehmen? Zu Schönhusen werde ich bestimmt nicht gehen, unter keinen Umständen … Wie unglücklich aber musste Vater sein, dass er sich sogar vor diesem Menschen klein machte …
Am festlichen Frühstückstisch, bei Geburtstagskuchen aus grauem Kriegsmehl, sprachen Mutter und Sohn über Zigarren und Goldstücke. Zigarren gingen bereits seit geraumer Zeit kistenweise nach Neustrelitz; alle, die nur zu entbehren waren. Woher aber Goldstücke zaubern?
Walter lachte ausgelassen über eine Stelle in Vaters Brief, in der er seinem Sohn versicherte, dass er selber kaum noch Zigarren rauche, dass vielmehr alle Glimmstengel draufgingen, um das Leben einigermaßen erträglich zu machen. Seine Vorgesetzten kniffen, so schrieb er, beide Augen zu, wenn er ihnen dann und wann eine Handvoll Havannas in die Hand drücke. So manche Zigarre habe ihn schon vom Exerzieren befreit und ihm die Möglichkeit verschafft, statt dessen zum Stubenreinigen abkommandiert zu werden … Der kleine, penible, immer noch ansehnlich dicke Carl Brenten beim Schrubben und Scheuern – Mutter und Sohn prusteten vor Lachen. Immerhin, es konnte ernster werden, man konnte den Vater an die Front schicken, es hieß also schon sich anstrengen und Mittel und Wege suchen, das zu verhindern. Bisher genügten Zigarren, jetzt schienen nur noch Goldstücke zu helfen.
Heute noch wollte Frieda, sobald Großmutter gekommen war und auf die Kleine aufpassen konnte, die Verwandtschaft nach Goldstücken ablaufen. Übertriebene Hoffnungen hatte sie nicht, aber möglicherweise gaben sich Willmers einen Stoß und griffen ihrem jüngsten und, wie sie immer sagten, Lieblingsbruder zuliebe in die Reservetruhe. Es war ja eigentlich kein finanzieller Verlust für sie, sondern nur ein Umtausch: Papiergeld gegen Goldgeld. Carl wollte schließlich nichts geschenkt haben.
IV
Und Frieda fuhr nach Eilbeck zu ihres Mannes Schwester Mimi. Mit lauten Ausrufen des Erstaunens wurde sie an der Tür überschwenglich begrüßt und in die Wohnung komplimentiert.
»Nein, so was, du kommst also wirklich mal zu uns. Und so überraschend. Wie ich mich freue. Wie Hinrich sich erst freuen wird … Leg doch ab. Ich werde gleich Marie sagen, dass sie Tee bringt. Komm, mach dir's bequem.«
»Ein Mädchen habt ihr?« fragte Frieda erstaunt.
»Ja, zur Aushilfe nur. Ich kann einfach nicht mehr alles allein schaffen. Du wirst nun gewiss sagen, was ich groß zu tun habe, keine Kinder und so, aber, mein Gott, eine große Wohnung macht Plackerei genug. Schon allein das Einkaufen. Ist ja alles so umständlich geworden. Und Hinrich will natürlich pünktlich sein Essen und seine Aufwartung. Da haben wir eine Hilfe ins Haus genommen … Aber setz dich doch! Wart, ich will nur in der Küche Bescheid sagen.«
Frieda sah sich in der Stube um. Grüne Plüschmöbel: Sofa, Stühle, am Fenster ein Sessel; eine mächtige Standuhr, groß wie ein Schrank. Dazu die Bilder, die so wertvoll sein sollten. Schön vielleicht, aber nicht gemütlich, fand sie.
Die beiden Schwägerinnen tranken Tee, echten Ceylon-Tee, wie beiläufig erwähnt wurde. Ein Teller mit Gebäck wurde auch auf den Tisch gestellt. Mimi war die Freigebigkeit selbst.
Dann kam Frieda auf den Zweck ihres heutigen Besuches zu sprechen.
»Was du nicht sagst, so getriezt wird er? Ist ja eine Schande. Ach, der arme, arme Carl, dass es ausgerechnet ihn, diese Seele von einem Menschen, treffen muss. Wird sich Hinrich grämen, wenn er das hört. Doch was du von Goldgeld sagst, wie denkst du dir das, meine Liebe? Hätten wir noch etwas, wäre Carl der erste, der es bekäme, der erste. Zumal in seiner jetzigen Lage. Aber, lieber Gott, Hinrich hat längst alles Goldgeld auf der Bank eingewechselt. Damals gleich, als in den Zeitungen dazu aufgefordert wurde. Du erinnerst dich doch? Da ist unser Schwiegersohn viel zu gewissenhaft. Ein Patriot wie er würde nie verzeihen, wenn wir heutzutage noch irgendwo Goldgeld hätten. Ach, wir hätten Carl ja so schrecklich gern geholfen. Und dazu hast du dir nun den weiten Weg gemacht.«
»Ich habe mir gedacht, gerade weil euer Schwiegersohn Bankmann ist, könnte er vielleicht …«
»Wie denkst du dir das? Unredliches würde …«
»Nichts Unredliches, ich dachte nur …«
»Nein, nein, ausgeschlossen, völlig ausgeschlossen! Oh, du kennst Heinz nicht, die Gewissenhaftigkeit in Person. Lieber ließe er sich eine Hand abhacken, als der kleinsten Schiebung schuldig zu werden.«
»Wieso Schiebung? Du verstehst mich immer noch nicht …«
»Ob ich dich verstehe. Aber die Zumutung allein würde ihn schon kränken. Ich werde Carl schreiben. Er wird es verstehn. Er muss es verstehen, denn er ist … er war ja auch ein Geschäftsmann.«
Frieda erhob sich.
»Willst du schon gehen? Willst du nicht auf Hinrich warten?«
»Ich hab noch einiges zu erledigen.«
»Glaub ich. Glaub ich. Wir sind ja alle so gehetzt. Tolle Zeiten … Aber, was ich noch sagen wollte, könnte Hinrich nicht von euch ein paar Kisten Zigarren kaufen? Er würde ja gewiss auch einen kleinen Zuschlag zahlen, denn man kriegt ja kaum noch welche.«
»Unsere Vorräte sind leider zu Ende.«
»Na–a, ihr werdet doch noch ein kleines Notlager haben. Hinrich gehört doch schließlich zu euren Stammkunden.«
»Wir hatten kaum nennenswerte Vorräte. Und die Zuteilungen sind gering. Aber ich will sehen, was sich machen lässt.«
»Nett von dir, Frieda. Hinrich wird sich freuen. Bitte grüß Carl von uns allen. Ach, der Ärmste! Will ich gerne glauben, dass ihm das Kasernenleben nicht gefällt. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Zeiten sind das, schrecklich, ganz schrecklich …«
V
Frieda Brenten stieg in die Elektrische und fuhr nach Eppendorf. Dort wohnte neuerdings Paul Papke, der – wie sie unlängst erfahren hatte – jetzt verheiratet war. Ein dickliches, schlampiges Frauenzimmer öffnete ihr.
»Zu wem woll'n Sie? Zu Papke? Zu meinem Mann also. Der ist nicht da.«
»Wissen Sie, wo Ihr Mann ist, Frau Papke?«
»Natürlich weiß ich das: im Theater.«
»Danke vielmals.«
Frieda fuhr nach der Dammtorstraße.
Der Pförtner am Bühneneingang des Stadttheaters wollte sie nicht durchlassen. Erst nach längerem Hin und Her war er bereit, Inspektor Papke herunterzubitten. Frieda wartete.
Endlich kam Papke. Er staunte nicht wenig, die Frau seines einstigen Freundes anzutreffen.
»Ist was passiert?« rief er und rollte die Augen. Dann erst reichte er ihr zögernd, mit kaum ausgestrecktem Arm, die Hand zur Begrüßung.
»Ja – und nein, Herr Papke. Carl lässt Sie grüßen.«
»Gott sei Dank!« entrang es sich dem Inspektor. Er bedeckte mit seinem Handrücken pathetisch die Stirn. »Ich dachte schon, ihm sei etwas passiert.«
Frieda lächelte. »Nein, Herr Papke, so schlimm ist es nicht, aber es geht ihm recht elend …« Sie begann von seinen Briefen, seinen Leiden zu erzählen und brachte dann ihr Anliegen vor.
»Goldgeld?« rief Papke, wie aus allen Himmeln gefallen. »Meine liebe, beste Frau Brenten, woher soll unsereins heute noch Goldgeld haben? Man hat ja nicht einmal Papiergeld. Sosehr ich auch wünschte, Carl helfen zu können, aber …« Er strich sich über den Spitzbart, rollte erneut die Augen und rief dröhnend: »Mein Seelenheil würd ich meinem Freunde opfern, wenn es ihm helfen würde. Ja, mein Leben! Sie kennen meine Selbstlosigkeit, Frau Brenten – aber Goldgeld?«
»Ja, gewiss. Entschuldigen Sie, dass ich Sie bemüht habe. Carl aber bat mich, Sie aufzusuchen.«
»Man kann nur geben, was man hat. Gold habe ich nicht … Aber grüßen Sie Carl tausendmal. Es hat zwischen uns – Sie wissen wohl? – bei Kriegsausbruch eine kleine Verstimmung gegeben. Sie kennen mich, beste Frau Brenten, ich bin nicht nachtragend. Von mir aus: Schwamm darüber. Also grüßen Sie ihn. Ich würde mich riesig freuen, wenn er mir mal einen kleinen Gruß schickte.«
VI
Frieda schleppte sich zu Stürcks. Ihr Schwager würde sie nicht mit leeren Worten wegschicken, das wusste sie. Aber gerade zu ihm hatte sie nicht gehen wollen, seine Gutmütigkeit wurde zu oft ausgenutzt. Sie wusste sich jedoch keinen anderen Rat mehr.
Wie alt er geworden ist! Das war ihr Eindruck, als sie die kleine Tischlerwerkstatt betrat, in der Gustav Stürck zwischen seinen Vogelbauern am Hobeltisch hantierte. Wie alt war er eigentlich? Doch noch nicht einmal sechzig.
»Tag, Frieda, welch guter Geist führt dich zu mir?«
»Kein guter, eher ein böser.« Sie lächelte den Schwager unsicher an.
»Setz dich und erzähl!« Er schob ihr einen Schemel hin. »Warst du schon bei Sophie oben?«
»Nein!«
»Na, wo brennt's, wo tut's weh?«
»Weißt du, Gustav, du ahnst nicht, wie schwer es mir fällt, gerade damit zu dir zu kommen, aber überall bin ich abgewiesen worden, und ich möchte doch Carl so schrecklich gern helfen.«
Sie erzählte ihm von Carls Klagen, seinen Wünschen und ihren ergebnislosen Bittgängen zu Willmers und Papke.
Gustav Stürck, auf die Hobelbank gelehnt, hörte zu und betrachtete sie. Als sie von Papke sprach, huschte ein mattes Lächeln über seine Augenrunzeln. Wie ein kleines Mädchen saß Frieda vor ihm und wagte kaum, die Augen zu ihm aufzuheben.
Und dann schwieg sie.
Auch er schwieg.
Nur das muntere Vogelgezwitscher erfüllte die Werkstatt.
Langsam richtete Stürck sich auf, legte seine große Hand auf ihren Arm. »Es gibt heutzutage weit größeres Unglück«, sagte er. Darauf ging er an einen kleinen Werkzeugschrank und holte eine Holzschachtel heraus. Zwei blitzblanke Zwanzigmarkstücke legte er auf die Kante der Hobelbank. »Es sind meine letzten, Frieda. Ich gebe sie dir und Carl gerne.«
Frieda Brenten wurden die Augen feucht. Sie schämte sich. O ja, es gab größeres Unglück, das konnte Stürck schon sagen. Von drei Söhnen, die im Felde waren, hatte er zwei schon verloren, gleich in den ersten Kriegstagen seinen Ältesten, den er am meisten geliebt hatte und der einmal seine Werkstatt übernehmen sollte. Ja, sie schämte sich und sagte es auch.
»Dummheiten«, erwiderte er und redete ihr zu, das Goldgeld anzunehmen. »Ich seh doch, was für eine Sorge dir damit von der Seele genommen wird.« Er musste ihr die Goldstücke in die Hand drücken. »Und jetzt geh zu Sophie. Vielleicht hat sie noch ein paar Kaffeebohnen. Stärk dich erst mal.« Damit schob er die Schwägerin sacht aus der Werkstatt.
Im Vorderhaus, in der dritten Etage, wohnten Stürcks, und Sophie nahm, nachdem sie die Schwägerin begrüßt hatte, sofort die Kaffeemühle aus dem Küchenschrank und begann zu mahlen, wobei sie nach tausend Dingen fragte. »Was schreibt Carl? Was treibt der Junge? Wie geht's der kleinen Göre, der Elfriede? Ist die alte Hardekopf noch gesund und munter? Mein Gott, man sieht sich jetzt so schrecklich selten!«
Dem konnte Frieda nur zustimmen. Unberufen, es gehe allen noch ganz gut. Der Junge lerne fleißig. Die Kleine sei gesund. Gottlob, Mutter Hardekopf auch. Dann erzählte sie von Carl, und was er über die urlaubbringenden Goldstücke geschrieben hatte.
»Richtig! Richtig!« fiel ihr die mundfertige Schwägerin ins Wort. »Gustav sagte mir neulich dasselbe. Wir haben auch zwei Goldstücke auftreiben können, die wir Adolf schicken wollen, damit der arme Bengel auch mal einige Urlaubstage bekommt. Zuletzt schrieb er aus Mazedonien. Aber er soll an die Westfront, und nun meinte er, wenn sie in Fahrt gesetzt würden, könnten ein paar Urlaubstage dabei rauskommen, das heißt, wenn wir ihm dies Goldgeld rechtzeitig schickten. Sieben Monate ist er …«
Frieda Brenten erhob sich. Regungslos stand sie da und starrte vor sich hin.
»Was hast du? Fühlst du dich nicht wohl? So red doch?«
Schon war die kleine Sophie bei ihrer Schwägerin, die geistesabwesend, schweigend dastand.
»Nichts! Es ist gar nichts!« flüsterte sie und verließ Küche und Wohnung.
»Aber wo willst du hin?«
Frieda ging schon die Treppe hinunter.
Sophie Stürck war ratlos und bestürzt. Schnell der Schwägerin nach. Vorher aber den Kessel vom Herd nehmen. So was war ihr denn doch noch nicht vorgekommen. Da entdeckte sie zwei Goldstücke auf dem Küchentisch, genau dort, wo Frieda gesessen hatte.
Und nun dämmerte es ihr.
Mit den Goldstücken lief sie in die Werkstatt.
Frieda Brenten schrieb ihrem Mann einen langen Brief, einen bitteren Brief. Einen Brief voller Vorwürfe und scharfer Bemerkungen. Sie schloss: »… Und zu Deinem Bruder Matthias werde ich nicht gehen, so tief erniedrige ich mich nicht. Ich kenne ihn ja kaum, und bei dem Verhältnis, das während all der Jahre zwischen Euch bestand, weiß ich nicht einmal, ob er mich überhaupt in die Wohnung lässt.«
Drittes Kapitel
I
Frieda tat gut daran, den Bruder ihres Mannes nicht aufzusuchen. Sie wäre schlecht angekommen, besonders in dieser Maiwoche, in der Zollinspektor Brenten dumpf zu ahnen begann, dass der Boden, auf dem er stand, der bislang granithart und für alle Zeiten fest schien, ihm unter den Füßen wegbröckelte. Die Zersetzung war bis in seine eigene Familie gedrungen, und daran war nur die ihm auf den Tod verhasste Sozialdemokratie schuld.
Nun wollte es der Zufall, dass durch den Elternabend der Jugendgruppe Neustadt der Zersetzungswurm in der Familie des Zollinspektors neue Nahrung fand und Carl Brenten – ohne zu ahnen, woher sie kamen – aus dem geheimen Vorrat seines ihm feindlichen Bruders einige der so sehr begehrten Goldstücke erhielt.
Zollinspektor Matthias Brenten stellte den abgeschnallten Säbel in den Regenschirmständer, zog seinen Mantel aus und hängte ihn sorgfältig über einen Kleiderbügel. Dann trat er vor den Spiegel über dem Waschbecken, strich mit einer Bartbürste die Brauen und dann seinen struppigen Bismarckbart – fleißiges Bürsten fördert den Wuchs! –, wobei er forschend in sein fleischiges Gesicht blickte.
Diese morgendliche Gewohnheit nannte er »sich guten Morgen sagen«.
Noch immer hatte es nicht neun geschlagen. Er wunderte sich. Erstaunlich schnell hatte er heute den Weg von der Hochbahnstation zurückgelegt. Das kam von der Morgenkälte, dieser nassen, ekligen Nebelluft. Tagsüber kam seit einigen Tagen die Sonne heraus, aber die Nacht- und Morgenstunden waren noch recht ungemütlich. Er rieb seine klammen Hände.
Bevor sein Tagewerk begann, galt es noch, eine zur Tradition gewordene Zeremonie zu verrichten. Die Arme auf dem Rücken verschränkt, durchschritt er den anschließenden, geräumigen Amtsraum und blieb vor einer fast die ganze Mittelwand bedeckenden Europakarte stehen. Auf dieser Karte lief vom Englischen Kanal bis zur westlichen Schweizer Grenze und dann quer durch die österreichischen Alpen, den Balkan, Rumänien und Russland bis hinauf an die Ostsee eine wellige Linie kleiner schwarzweißroter Fähnchen: die Front.
Jeden Morgen hielt der Zollinspektor vor dieser Karte seine Morgenandacht. Minutenlang konnte er mit verschränkten Armen davorstehen, ganz seinen Betrachtungen, Erwägungen, Einfällen hingegeben. War eine Frontveränderung gemeldet worden, so waltete er andächtig seines Amtes und steckte die Fähnchen an ihre neuen Plätze. In diesen Tagen ging die Riesenschlacht um Verdun ihrem Höhepunkt entgegen. Sämtliche die Festung beherrschenden Forts waren bereits erstürmt und ihr Fall nur noch eine Frage von Tagen. Damit war dann, so fand der Inspektor, denn so stand es in den Zeitungen, der stärkste Eckpfeiler der feindlichen Verteidigung niedergerissen und die gesamte Front der Franzosen und Engländer erschüttert.
Zollinspektor Brenten schob sein Gesicht nah an die Karte und betrachtete genauer das gebirgige Gelände der Argonnen. Er fand Namen, die ihm aus der Zeitungslektüre bekannt waren. Fähnchen umstecken lohnte jedoch nicht, auf der Karte waren die Erfolge zu geringfügig. Ein stolzer, herrischer Blick überflog die gesamte Frontlinie. Dort unten am Isonzo kämpften die pflaumenweichen Österreicher nicht übel gegen die Katzelmacher, weit besser als gegen die Russen, fand er. Natürlich waren auch dort einige deutsche Divisionen der Front als Korsettstangen eingefügt, natürlich. Die Russen waren, den Berichten nach, zur Offensive übergegangen. Eine Entlastungsoffensive. Aber es war ein hoffnungsloses Unternehmen … Matthias Brentens Blick ruhte auf den Strichelchen, die das Gebiet der Pripjetsümpfe markierten. – Husch – lag sein Blick auf dem Balkan, dort hatten die deutschen Truppen fast ganz Albanien besetzt. Und noch weiter südöstlich, hinten in Kleinasien, kriegten die Engländer von den Türken Keile, erfreuliche, wohlverdiente Keile.
Das bedeutungsvollste Ereignis jedoch, an kriegsentscheidendem Wert unmittelbar hinter Verdun zu rangieren, wenn nicht ihm voranzustellen, war zweifellos der verschärfte U-Boot-Krieg. Der Gegner wurde mit entschlossenem Griff direkt an der Gurgel gepackt. Der Zollinspektor ließ einen äußerst zufriedenen Blick über die blaue Fläche des Ozeans und der Nordsee schweifen.
Danach drehte er sich ruckartig auf dem Absatz um und schritt steif und feierlich auf eine an der gegenüberliegenden Wand befestigte Karte zu: eine große Weltkarte, von den vereinigten Reedereien Deutschlands herausgegeben. Zahllose bunte Linien führten über die Weltmeere nach allen Erdteilen; Ausgangspunkte waren Hamburg und Bremen, besonders Hamburg. Der Karte nach ging überhaupt der ganze Welthandel von der Elbestadt aus und von ihrer Schwesterstadt an der Weser. Längs den Routen der verschiedenen Schiffahrtslinien waren winzige Schiffsmodelle eingezeichnet; die stärksten dieser Strahlenbündel bunter Fäden führten nach Nord- und Südamerika, weniger starke Bündel nach Asien und um Afrika herum.
Vor seinem Auge erstand der Hafen, wie er ihn kannte, mit seinen ein- und auslaufenden Schiffen jeder Gattung und aus allen Ländern, seinem Gedröhne und Getöse, dem sirenentönenden Treiben von Dampfern, Passagierbooten, Schleppern, Kähnen, Barkassen, mit seinen Helgen, Kränen, Kaimauern.
Der Zollinspektor war beileibe kein blasser Träumer oder romantischer Schwärmer; er wusste, dieser Krieg war ein gigantischer Konkurrenzkampf zwischen England und Deutschland, mit einem Millioneneinsatz auf beiden Seiten – und nicht nur an Gold. Für den Zollinspektor war er das Ergebnis eines natürlichen Gesetzes. Deutschland schickte sich an, Beherrscher der ganzen Welt zu werden.
Beherrscher der Welt. Welch Ziel! Da lohnte schon der Einsatz, lohnten sich alle Mühen und Opfer. Und sah es nicht aus, als würde es noch in diesem Jahre Wirklichkeit? Auf deutsche Art die Welt neu aufteilen und einrichten. Hamburg als Mittelpunkt des Welthandels. Er – Matthias Brenten – alsdann vermutlich Zolldirektor, und zehn Jahre später pensioniert, mit einem hübschen Häuschen in Blankenese …
Dergleichen Zukunftsbetrachtungen hoben Lebensgefühl und Selbstbewusstsein, und der Zollinspektor reckte sich und drückte die Brust heraus. Treue im Geist, Tapferkeit im Kampf, Pflichtbewusstsein im Dienst waren die Voraussetzungen des Sieges. Auch dem letzten Deutschen musste soldatisches Denken beigebracht werden. Durch den kommenden Sieg würden sodann alle destruktiven und oppositionellen Kräfte, die es hier und dort noch geben mochte, elendig umkommen.
Zollinspektor Brenten machte abermals eine forsche Kehrtwendung und hatte nun wieder Europa vor Augen. Mit einem Blick umriss er die neuen Grenzen. Im Westen gliederte er Holland, Belgien, Luxemburg ein; ob auch noch der deutschsprachige Teil der Schweiz einbezogen werden sollte, darüber war er sich noch nicht ganz schlüssig. Im Süden aber legte er die Hand auf die norditalienische Industrie und den Hafen Genua. Die Lombardei – altes deutsches Schutzgebiet. Der Balkan, da mochte Österreich seine Ansprüche anmelden. Desgleichen in Rumänien. Die Ukraine machte er zu einem deutschen Protektorat, die baltischen Staaten schloss er dem Reich an, Russisch-Polen und Finnland selbstverständlich auch. Damit hätte das Reich Öl, Getreide, Eisen, Kohle, Holz in ausreichenden Mengen, genug, um die übrige Welt zu beherrschen.
Ein außerordentliches Wohlbehagen überkam ihn, er benetzte mit der Zungenspitze die Lippen, als habe er etwas ausnehmend Gutes gekostet. Dann tat er an diesem Morgen etwas Ungewöhnliches, er trat ein zweites Mal vor den Spiegel und betrachtete sich. Er fand, er durfte zufrieden sein. Behutsam strich er noch einmal mit der kleinen Bürste über seine starken Brauen und die Bartenden. Peinlich nur, dass seine Zähne so schadhaft waren und der Reihe nach wegfaulten. Zahnärzte aber hatte er von jeher noch mehr gefürchtet als Vorgesetzte. Sein kahles Haupt jedoch, glänzend, wie poliert, und schon oft mit dem Bismarcks verglichen, fand er imponierend und karriereversprechend.
Ein Blick auf die alte Schwarzwälder Uhr bestätigte ihm, wozu es ihn innerlich trieb: Es war Zeit zum Rundgang.
Er zog seinen Uniformmantel an, setzte die dazu passende, von seiner Frau mit Watte ausgefütterte grüne Schirmmütze auf, ließ sich noch die Zeit, in aller Ruhe die grauen, ihm von seiner Tochter Agnes geschenkten Wildlederhandschuhe überzuziehen, und verließ nach einem letzten Blick in den kahlen Amtsraum steif und würdevoll, scharf nach rechts und links Ausschau haltend, das Zollhaus.
II
Regte sich da nicht etwas zwischen den Schuppen?
Der Zollinspektor blieb stehen und äugte. Es hatte sich nichts zu regen, weder bei den Schuppen noch an den Kaimauern oder gar auf den an den Pfählen vertäuten Schiffen. Es regte sich auch nichts. Nicht einmal ein Hund strich um die Lagerhäuser. Die schwarzen Eisenkräne lagen wie erstorben da. Gespenstisch hoch ragten die Ozeandampfer aus dem Wasser, einer neben dem andern. Kein Rad drehte sich, kein Laut war zu hören, keine Menschenseele auf den Decks zu sehen. Die an den Laderampen entlanglaufenden Eisenbahnschienen, zwischen denen Gräser wucherten, waren dick mit Rost überzogen; seit Jahr und Tag war kein Zug mehr über sie gefahren.
Wie von einem bösen Zauberer in Todesschlaf versetzt, lag erstarrt der Riesenhafen da.
Das war Zollinspektor Brentens Revier. Durch diese gespenstische Welt stolzierte er jeden Morgen und gab acht, dass alles blieb, wie es war. In seiner Uniform, mit dem scheppernden Säbel, glich er in dieser Umwelt einer alt und fett gewordenen, verstaubten Panoptikumsfigur.
Sein langsamer, fester Schritt hallte von den Wänden der Lagerschuppen zurück. Zuweilen war das gleichmäßige Plätschern und gurgelnde Ablaufen des Hafenwassers zu hören. Die linke Hand am Säbelknauf, die rechte in den Mantelspalt geschoben, inspizierte er einhundertachtundsechzig Speicher und Schuppen, einunddreißig Überseedampfer, acht Segelschiffe, vierundsechzig Kräne und Hebebäume – auf einem Marsch von dreieinhalb Kilometern.
Erst am Ende seines Zollreviers, am Brooktorkai, stieß er auf Menschen. Acht Arbeiter waren dort in einem Staatsschuppen beschäftigt. Zweimal wöchentlich lief ein Oberländerkahn mit Staatsgütern aus Sachsen oder aus dem Magdeburgischen ein, der gelöscht und mit neuem Frachtgut wieder auf die Reise ins Innere Deutschlands geschickt wurde.