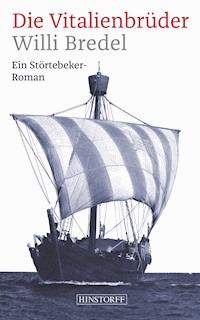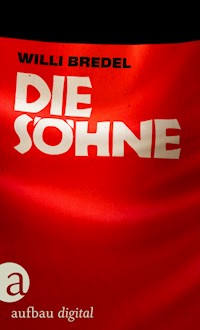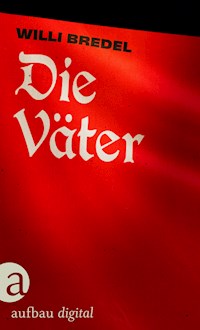
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Verwandte und Bekannte
- Sprache: Deutsch
Im Moskauer Exil veröffentlichte Willi Bredel 1941 mit „Die Väter“ den ersten Band seiner Romantrilogie „Verwandte und Bekannte“, um den Alltag und die Umwelt einer sozialdemokratischen Hamburger Arbeiterfamilie über drei Generationen hinweg, vom Kaiserreich bis hin zum Ende des Nationalsozialismus. „Die Väter“ erzählt von der Zeit zwischen der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, bis hin zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Im Zentrum stehen dabei die Geschicke des Hamburger Metallarbeiter Johann Hardekopf und seiner Familie. Gemeinsam mit seinem aus gehobenem bürgerlichem Milieu stammenden Schwiegersohn Carl Brenten engagiert sich Hardekopf begeistert für die neue sozialistische Bewegung. Sein Kampf gilt kleinbürgerlichem Denken ebenso, wie der führenden Partei- und Gewerkschaftsbürokratie. Mit Unterstützung seiner Frau Pauline steht er unerschüttert zu seiner sozialistischen Überzeugung, während seine Söhne Otto, Ludwig und Emil sich mehr und mehr von der politischen Lebenswelt des Vaters entfernen. Erst kurz vor seinem Tod gerät Hardekopfs unerschütterlicher Glaube an die sozialistische Bewegung ins Wanken: Begleitet von nationalistischer Euphorie beginnt der Krieg und die internationale Solidarität der Sozialisten zerbricht … "Alle in ihrer Weise typisch, sind Bredels "Verwandte und Bekannte" nicht bloß als Typen gezeichnet, sondern (mit einem Wort Heinrich Manns) "aus der Tiefe des wirklichen Lebens" hervorgehoben." Max Schroeder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Willi Bredel
Willi Bredel, geboren 1901, war ein deutscher Schriftsteller und gehörte zu den Pionieren der sozialistisch-realistischen Literatur. Als Sohn eines Hamburger Zigarrenmachers lernte er zunächst Dreher und engagierte sich außerdem in der Sozialistischen Arbeiterjugend sowie im Spartakusbund. 1919 trat er in die KPD ein. Während der Weimarer Republik wurde er politisch verfolgt und mehrfach verurteilt. 1933 ging er ins Exil u. a. nach Paris und Moskau und diente von 1937 bis 1939 als Kommissar in einer »Internationalen Brigade« im Spanischen Bürgerkrieg. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil engagierte er sich als Kulturpolitiker beim Aufbau der DDR und wurde später Präsident der Akademie der Künste der DDR. Bredel verstarb 1964 an einem Herzinfarkt in Ost-Berlin. Bei Aufbau Digital ist seine herausragende Romantrilogie »Verwandte und Bekannte« mit den Bänden »Die Väter« (1941), »Die Söhne« (1949) und »Die Enkel« (1953) verfügbar.
Informationen zum Buch
Im Moskauer Exil veröffentlichte Willi Bredel 1941 mit »Die Väter« den ersten Band seiner Romantrilogie »Verwandte und Bekannte«, um den Alltag und die Umwelt einer sozialdemokratischen Hamburger Arbeiterfamilie über drei Generationen hinweg, vom Kaiserreich bis hin zum Ende des Nationalsozialismus.
»Die Väter« erzählt von der Zeit zwischen der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, bis hin zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Im Zentrum stehen dabei die Geschicke des Hamburger Metallarbeiter Johann Hardekopf und seiner Familie. Gemeinsam mit seinem aus gehobenem bürgerlichem Milieu stammenden Schwiegersohn Carl Brenten engagiert sich Hardekopf begeistert für die neue sozialistische Bewegung. Sein Kampf gilt kleinbürgerlichem Denken ebenso, wie der führenden Partei- und Gewerkschaftsbürokratie. Mit Unterstützung seiner Frau Pauline steht er unerschüttert zu seiner sozialistischen Überzeugung, während seine Söhne Otto, Ludwig und Emil sich mehr und mehr von der politischen Lebenswelt des Vaters entfernen. Erst kurz vor seinem Tod gerät Hardekopfs unerschütterlicher Glaube an die sozialistische Bewegung ins Wanken: Begleitet von nationalistischer Euphorie beginnt der Krieg und die internationale Solidarität der Sozialisten zerbricht …
»Alle in ihrer Weise typisch, sind Bredels »Verwandte und Bekannte« nicht bloß als Typen gezeichnet, sondern (mit einem Wort Heinrich Manns) »aus der Tiefe des wirklichen Lebens« hervorgehoben.« Max Schroeder.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Willi Bredel
Die Väter
Roman
Inhaltsübersicht
Über Willi Bredel
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil: Neuer Anfang
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Zweiter Teil: Die Geschichte eines Vereins
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Dritter Teil: Träume und Wirklichkeit
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Vierter Teil: Das Ende
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Impressum
Erster Teil:Neuer Anfang
Erstes Kapitel
I
»Nun aber raus! R–raus! Ist ja nicht auszuhalten!«
Die drei Frauen am Bett der Kreißenden drängen so eilig zur Tür, als erwarteten sie im nächsten Augenblick Prügel. Auch die krumme Frau Rüscher will hinaus.
»Rüscher! A–also Rüscher, du bleibst natürlich hier!« sagt Frau Hardekopf, schon wieder ruhiger. Eine schnelle Sekunde wundert sie sich über ihr »Du«. »Rüscher, du wartest hier bei Frieda; ich hol die Hebamme. Lass niemand rein!« Und schon ist Frau Hardekopf draußen.
Noch nie ist sie die steile Treppe so schnell hinuntergekommen. Mit langen Schritten eilt sie die Steinstraße entlang. Hat man so was schon erlebt: stehn händeringend herum und jammern! Die Rüscher ist auch so ein Trampeltier!
Zehn Häuser weiter wohnt die Hebamme Niehus, Henriette Niehus, staatlich geschulte und geprüfte Hebamme, die auch Frau Hardekopf bei ihrem Letzten Geburtshilfe geleistet hatte und deren Rat vor Geburten ebenfalls etwas wert war.
Frau Hardekopf reißt an der Klingelschnur. Es hallt wie Kuhglockengebimmel in der Wohnung, aber niemand kommt, um zu öffnen. Abermals wird von ihr die Klingel in Bewegung gesetzt. Niemand meldet sich. »Ist doch ein Skandal!« knurrt sie vor sich hin. »Bei Hebammen hat ständig jemand zu Hause zu sein. Na a–also, der werd ich ja einen Tanz machen.«
Was nun? Wieder auf die Straße eilend, überlegt sie, was zu tun ist. Schon befreundet sie sich mit dem Gedanken, es schließlich selber zu versuchen. So ganz unerfahren ist sie nicht. Aber wie leicht konnte eine Komplikation eintreten, vor der man dann ratlos dastand. Nein, eine Hilfe musste aufgetrieben werden. Natürlich wohnten in der Nähe noch andere Hebammen; sie erinnert sich unklar an Schilder mit der Aufschrift »Geburtshilfe«, aber sie kann sich im Augenblick nicht besinnen, wo sie die gesehen hat. Sie hatte sich nicht sonderlich darum gekümmert. Sie würde hoffentlich keine mehr brauchen. Da gewahrt sie einen Schutzmann. Der müsste es doch wissen!
Schutzmann Christian Martens, in der Steinstraße, seinem Revier, allgemein der »dicke Krischon« genannt, galt den einen als eine »Seele von Mensch«, den anderen war er ein »brutaler Wüterich«. Er konnte gemütlich an der Straßenecke plaudern und scherzen, auch in bester Laune ein Glas Bier bei Sternberg trinken und im nächsten Augenblick, sofern er glaubte, seine Pflicht erfordere es, wütend dazwischenschlagen, arretieren und seine Opfer auf die Polizeiwache schleppen. Er besaß zupackende Fäuste; wo sie indes nicht ausreichten, zögerte er durchaus nicht, seine Plempe zu ziehen. So flößte er mehr Angst als Vertrauen ein. Sah man, dass er gut gelaunt war, nickte man ihm zu, grüßte ihn. Blickte er jedoch verdrossen vor sich hin, ging man ihm gern aus dem Wege oder schlich eiligst vorüber.
Frau Hardekopf kümmert sich den Teufel um seinen Gemütszustand; als des Schutzmanns markante Erscheinung vor ihr auftaucht, steuert sie kurz entschlossen auf ihn zu und bestürmt ihn mit Fragen.
»Wie? Was? Was wollen Sie?«
»Eine Hebamme brauche ich!« wiederholt Frau Hardekopf ärgerlich. »Wo wohnen hier in der Nähe Hebammen?«
Der dicke Krischon funkelt sie halb verblüfft, halb unwillig an, erwidert aber kein Wort mehr; er macht nur eine abwehrende Handbewegung und will an ihr vorübergehen. So leicht gibt ihn Frau Hardekopf nicht frei; sie hält ihn am Ärmel seines Uniformrocks zurück und ruft aufgebracht: »Mein Gott, Sie müssen doch wissen, wo Hebammen wohnen?«
Die Steinstraße war damals eine der bevölkertsten Straßen Hamburgs; insbesondere an der Kreuzung Mohlenhofstraße bewegte sich der Hauptverkehr vom Hafen herauf ins Innere der Stadt. In den Abendstunden, vor allem an nebligen Tagen, trieb sich in dieser Gegend allerlei lichtscheues Volk herum: Bummler, Taschendiebe, Zuhälter, Strichmädchen, denn in der Mohlenhofstraße und in der Springeltwiete befanden sich mehrere Bordelle und recht fragwürdige Kellerwirtschaften. Frau Hardekopfs lautes, erregtes Sprechen, das verblüffte Schweigen des Polizisten – das alles war so ungewöhnlich, dass die Leute zusammenliefen. Im Nu hatten einige Dutzend Menschen Frau Hardekopf und den dicken Krischon umringt. Der ganze Verkehr geriet ins Stocken.
»Was sagt sie?« – »Er will sie verhaften?« – »Warum will er sie verhaften?« – »Hebamme? Was hat 'ne Hebamme damit zu tun?« – »Gib's ihm ordentlich, er hat wohl wieder seinen sauren Tag!« – »Er soll die Frau in Ruhe lassen!« – »Passt auf, dass er nicht den Sabul zieht!«
Die Volksstimmung, anfangs scherzend, neckend, wird zusehends bedrohlicher für den dicken Krischon, und das lässt ihn schnell die Sprache wiederfinden. Mit weithin schallender Stimme ruft er: »Wer weiß, wo eine Hebamme wohnt? Eine Hebamme wird dringend gesucht!«
Lautes Gelächter der Umstehenden antwortet ihm. Scherzhafte Zurufe fliegen von einer Straßenseite zur andern. Einige Halbwüchsige johlen: »Immer rut mit datt Gör in de Freujorsluft …«
Ein Strichmädel drängt sich durch die Menge. »Die Erna ist mal Hebamme gewesen«, ruft sie. Ein zweites Mädel versucht, sie zurückzuhalten. »Das kannst du doch nicht machen.« – »Warum denn nicht, wenn es doch eilig ist.«
»Und es ist sehr eilig, Fräulein«, wirft Frau Hardekopf ein, die sonst niemals eine Prostituierte angeredet, geschweige denn »Fräulein« genannt hätte. Sie geht mit den beiden in die Springeltwiete, gefolgt von einem Haufen sensationslüsterner Nichtstuer.
»Mein Gott, eine Aufregung«, stöhnt Frau Hardekopf, ist aber doch froh, dass sie eine Hilfe gefunden hat. Na – a–also, an diesen Abend werde ich noch lange denken, sagt sie sich im stillen.
Vor kaum einer halben Stunde noch hatte sie am Herd ihrer kleinen Küche gestanden, unschlüssig und beunruhigt. Sie hatte die Nachbarin zu ihrer Tochter geschickt. Verlass aber war auf die unselbständige Rüscher nicht. Frau Hardekopf hatte immer wieder auf die Uhr geblickt. Längst hätten ihre »Männer« dasein müssen. Die hatte sie noch abfüttern wollen. Und wiederum, sie wusste wohl, wartete sie noch – in einer halben Stunde konnte viel geschehen. Sie hatte so gestanden und überlegt, und schließlich sich an Fritz, ihren Jüngsten, gewandt: »A–also höre, Junge, ich gehe! Vielleicht bin ich in einer Stunde zurück, vielleicht auch schon früher. Vadder soll euch die Suppe auffüllen. Für ihn zwei Knackwürste, für Ludwig, Otto und dich je eine. Hörst du?« – Fritz hatte zustimmend geprustet. Bis zum Gürtel nackt, seifte er sich vor einer Holzkumme dampfenden Wassers ab. »Und erst essen, wenn Vadder kommt. Hörst du? Und nicht naschen.« – »Nee, nee! Bring mir den Groschen mit!« – »Was für 'n Groschen?« hatte seine Mutter gefragt. – »Den Frieda mir versprochen hat.« – »Frieda ist sehr krank!« – »Krank?« Der Junge hatte verwundert seinen eingeseiften Kopf aus der Kumme gehoben. »Ich denk, sie kriegt 'n Kind?« – »Lausejunge!« Frau Hardekopf hatte die Tür hinter sich zugeschlagen.
Auf der Treppe aber hatte sie doch schmunzeln müssen. Diese Buttjes! Ja, die Kinder wuchsen heran, eh man sich's versah. Und nun sollte sie gar schon Großmutter werden. Das kam früh, ihr viel zu früh. Und dann: Ja, dieser unmögliche Schwiegersohn, dieser »Grünschnabel« und »Liederjan«, passte ganz und gar nicht in die Hardekopf-Familie; der war ein großer Missgriff, mehr noch: ein Skandal, eine Schande …
Dachte sie an den Schwiegersohn, dann geriet sie in Zorn und wurde feindlich. Sie malte sich tollkühne Szenen aus, in denen sie den Ungeratenen demütigte, duckte, zerschmetterte. Bei solchen Vorstellungen konnte sie ihre Umwelt völlig vergessen; hatte sie ihren Schwiegersohn vor sich, da ward jedes Wort besonders gewählt und von schwerstem Kaliber.
Rasch, energiegeladen war sie über den Hinterhof auf die Steinstraße hinausgegangen, unternehmungslustig wie eine Dreißigerin. Nicht groß von Wuchs, hielt sie sich dennoch so kerzengerade, trug den Kopf so aufrecht und so selbstbewusst, dass sie größer schien, als sie tatsächlich war. Arbeiterfrauen, die viele Kinder geboren und womöglich noch mehr abgetrieben haben, werden mit den Jahren gewöhnlich unförmig. Ihr ruheloses Naturell, ihr rastloses Herumwirtschaften mochten dazu beigetragen haben, überflüssiges Fett fernzuhalten. Auch hielt sie trotz ihrer vierzig Jahre auf Kleidung. Gemeinsam mit der Rüscher, ihrer Nachbarin, schnitt sie ihre Kleidungsstücke nach Schnittmusterbeilagen der »Hamburger Hausfrau« zu und nähte sie auf einer gegen Monatsraten gekauften »Singer«-Nähmaschine. So konnte sie etwas mit der Mode gehen. An diesem Frühlingstag trug sie ein Kleid aus billigem, dunkelgeblümtem Stoff mit Schulterbüffchen, weißer Plisseerüsche am Halsausschnitt und an den Ärmeln, fest an der korsettierten Taille anliegend, in den Hüften ein wenig gerafft und dann weit bis auf die Füße fallend. Dazu um die Schultern, des nebligen Regenwetters wegen, ein wollenes Umschlagetuch. Auch ihre Frisur war modern; die vordere toupierte Partie hatte sie mit einem Hornkamm vorgeschoben, und dahinter thronte ein kunstvoll aufgesteckter dunkelblonder Dutt.
Auf dem Wege zu ihrer Tochter war Frau Hardekopf wiederholt von Bekannten gegrüßt worden, was sie indessen nicht bemerkt hatte, denn in ihrem Kopf hatten sich kleine Giftblasen gebildet. Ihre Gedanken hatten ausschließlich dem Herrn Schwiegersohn, diesem »Luftikus«, diesem »Scheusal« gegolten, der ihre Tochter bestimmt noch ins Unglück treiben würde, der selbst ihr Trotz zu bieten gewagt hatte. Je mehr sie an die vielen empörenden Begebenheiten dieser erst kurzen Ehe dachte, um so größer und unbändiger wurden ihre Wut und ihr Hass gegen den »Bruder Liederlich«, der am Gängelband seiner sich vornehm dünkenden Verwandtschaft durch die Hamburger Lokalitäten geschleppt wurde und oft – ach, wie oft! – erst gegen Morgengrauen – und in welchem Zustand! – nach Hause kam. Was musste das Gör auch diesem Menschen in die Quere laufen. Und kaum achtzehn Jahre alt! (Für Frau Hardekopf war ihre Tochter, obwohl verheiratet und gerade in den Wochen, immer noch ein »Gör«.) Ach, einmal dich unter der Fuchtel haben, überlegte sie, mit ihren Gedanken schon wieder bei dem Schwiegersohn. A–also, dann gnade dir Gott, du Leichtfuß, du Bummler, dich würde ich umkrempeln, um und um, bis du so bist, wie du sein sollst! War er jetzt oben bei Frieda, so wollte sie sagen: Geh Bier trinken, amüsier dich! Am besten, du kommst erst gegen Morgen nach Hause, dann ist nämlich alles vorüber, und du bist Vater geworden, weißt zwar selbst nicht wie! Ja, das wollte sie sagen, und wenn er vor Wut aus der Haut fahren sollte.
Unter solcherlei wohltuenden Selbstgesprächen hatte Frau Hardekopf die kurze Wegstrecke zurückgelegt, denn in derselben Straße, in der sie wohnte, hatte auch ihre Tochter in einem Vorderhaus eine kleine Wohnung. Entschlossen, zielsicher, von ihrer gerechten Sache restlos durchdrungen, war sie die schmale, steil hinaufführende Sahltreppe hochgestiegen.
Bei ihrem Eintritt hatte die Tochter einen Seufzer der Erleichterung ausgestoßen. Jetzt war alles nicht mehr so arg. Jetzt konnte vor allem nichts mehr fehlgehen; die Mutter war gekommen, die Mutter wusste immer Rat. Unendlich groß war das Vertrauen der Tochter zur Mutter. Sie war beruhigt, fühlte sich gerettet; ein Lächeln glitt über ihre schmerzverzerrten Züge.
Frau Hardekopf hatte die bucklige Nachbarin, Frau Bollers, die ihr nicht schnell genug Platz machte, beiseite geschoben. »A–also, wie geht es dir, meine Tochter?« Das sollte absichtlich unzart, sogar schroff klingen. – »Ach, ganz gut, Mutter!« Die Tochter wusste, vor der Mutter musste man sich zusammennehmen, die konnte »Anstellerei« nicht leiden. »Wird wohl bald soweit sein. Wenn nur die Schmerzen … nicht noch … stärker werden.«
Die Bucklige und die dicke Jüdin, Frau Klingenthal, die das Bett der Kreißenden umlagerten, wimmerten und stöhnten bei jeder Wehe, als seien sie es, die gebären sollten. Frau Hardekopf fuhr herum und befahl barsch: »A–also lassen Sie gefälligst das Flennen. Was wollen Sie überhaupt hier? Helfen Sie lieber, anstatt die Bude vollzuheulen!«
»Die Hebamme ist doch nicht da«, flüsterte die Rüscher zaghaft.
»Die Hebamme war noch nicht hier?« Frau Hardekopf blickte verwundert auf.
»Sie ist nicht zu Hause, Mutter. Niemand weiß, wo sie steckt.« Im selben Augenblick hatte Frieda sich das Bettuch bis an den Mund gezogen, die Augen verrollt und gewimmert. Dann war ein grässlicher Schrei gefolgt, den sie hatte zurückdrängen wollen.
Keine Hebamme. Jeden Augenblick konnte das Kind kommen. Und die verfluchten Weiber heulten und rangen die Hände. Frau Hardekopf hatte steil aufgerichtet eine halbe Minute reglos und überlegend dagestanden. Aber eine halbe Minute nur, dann hatte sie die Weiber aus dem Zimmer gejagt, war zur Hebamme Niehus gerannt, hatte den Schutzmann angesprochen – und jetzt war sie, gefolgt von einer neugierigen Menge, auf dem Weg nach einer Aushilfshebamme.
In der Springeltwiete, einer Nebengasse der Steinstraße, steht Frau Hardekopf vor einem Haus, das Holzjalousien vor den Fenstern hat. In dem engen Aufgang wirft eine Lampe trübrotes Licht auf die von einem Läufer bedeckten Treppen. Warmer, süßlicher Parfümgeruch schlägt ihr entgegen. Von einer schrecklichen Ahnung erfasst, wendet sie sich an die beiden Mädchen, denen sie gefolgt war. »A–also, sagen Sie mal, Fräulein, ist die Frau eine – ein Kontrollmädchen?«
»Ach was!« lautet die ausweichende Antwort.
»Soso! Na a–also, denn ist ja man gut!«
Eine dicke, vollbusige Person mit feuerroten Haaren macht Einwände, als sie hört, was man von ihr verlangt, fragt mehrere Male, ob es denn wirklich unbedingt nötig sei. Schließlich geht sie aber doch mit.
Die Neugierigen, die vor dem Bordell warteten, begrüßen die Heraustretenden mit lautem Hallo, besonders die fette Bordellwirtin, die also auch die Hebammenkunst beherrschte. Einem Triumphzug gleich geht es durch die schmale Twiete und dann die Steinstraße entlang. Immer mehr Menschen schließen sich an. Alle möglichen Gerüchte schwirren durch die Luft. Der dicke Krischon sieht die Frauen zurückkommen, und eitel Freude liegt auf seinem Gesicht. Endlich hat man das Haus erreicht, in dem Frieda Brenten auf Hilfe wartet. Etliche laufen den Frauen nach, bleiben im Treppenaufgang und beobachten, wie hoch sie steigen. »Dritte Etage!« schreit einer. Auf der Straße blicken die Menschen zum dritten Stockwerk hinauf, wo ein neuer Erdenbürger ans Licht der Welt will.
Frau Rüscher kommt den Frauen entgegen, bleich und an allen Gliedern schlotternd. Die rote Erna sieht sofort, dass sie auch nicht fünf Minuten zu früh gekommen ist. Frau Hardekopf reicht ihr eine Schürze. Die fremde Nothelferin bindet sie um und bestimmt laut und ein wenig fahrig: »Hierher die Tücher und die Watte! Ja, das Wasser stellen Sie dorthin!« Ihr starker Busen wogt. Sie beugt sich über die Kreißende, will gerade die Bettdecke fortnehmen, als Frau Hardekopf mit Donnerstimme dazwischenfährt: »A–also, wollen Sie sich vorher nicht gefälligst die Hände waschen?«
Gründlich und nachdenklich trocknet sich die rote Erna in der Küche die Hände ab, jetzt erst überlegend, in was für ein Abenteuer sie sich eingelassen. Ein furchtbarer Schrei. Die Tür wird aufgerissen, und Frau Hardekopf ruft wütend: »Nun also, kommen Sie endlich – oder Sie sind überflüssig!«
Die Aushilfshebamme hebt ein winziges violettfarbenes Geschöpf mit dünnem Körper und großem Kopf in die Höhe und beklopft mit ihrer fleischigen Hand seinen Hintern, denn es will absolut nicht ja sagen zu diesem Leben; es weigert sich, zu atmen. Die wackere Frau, in den letzten Minuten übereifrig und freudig erhitzt vor Glück, dass alles glatt abgelaufen ist, entfärbt sich mehr und mehr. Ihre Schläge auf Hintern und Rücken des leblos in ihren Händen liegenden Wesens werden zusehends nervöser. Sie beginnt zu zittern, wirft erschrockene Blicke auf die Großmutter und hebt ratlos, wie bedauernd, die Schultern.
Frau Hardekopf hat schon eine ganze Weile mit verkniffenen Lippen stumm den Bemühungen der Hebamme zugesehen. Sie steht noch unter dem ersten Schreckenseindruck, den der Anblick des Neugeborenen ihr eingeflößt hat. Ein Riesenkopf mit affenhaft faltigem Gesicht auf dünnem Hals und leblose, unnatürlich kurze Arme und Beine. Sie selbst hat fünf Kinder geboren, jedoch keins scheint ihr so hässlich gewesen zu sein wie dieser Enkel – wahrscheinlich ein Krüppel. Na a–also, kein Wunder, bei solchem kurzbeinigen, kurzhalsigen und verluderten Vater! Dennoch tritt sie, da die angstvollen Bemühungen der Hebamme nicht fruchten wollen, hinzu, nimmt ihr das Neugeborene, dem noch der Lebensodem fehlt, aus den Händen und setzt es resolut mit dem Hintern in die Schüssel kalten Wassers. Ein konvulsivisches Zucken fährt durch den kleinen Körper, die Beinchen und Ärmchen bewegen sich, zugleich öffnen sich erschrocken die Augen, und ein mörderischer Schrei folgt.
II
In diesem Augenblick zersprang im »Hansakeller« am Steindamm der große Spiegel am Büfett in tausend Scherben; ein Bierseidel war klirrend in das glitzernde Glas geflogen. Der Täter – untersetzt, dicklich, mit fröhlichem Jungengesicht – blickte stolz und überaus zufrieden mit seiner Leistung umher und stimmte in das schallende Gelächter seines Trinkkumpans ein.
»Großartig, Carlchen!« rief der, prustend vor Lachen. »Hätt ich dir doch wahrhaftig nicht zugetraut. Du bist doch ein Kerl, gottverfluchtnochmal!« Und beide stimmten erneut ein helles, unbeschwertes Lachen an. Sie beachteten die Verstörtheit der übrigen Gäste kaum, sahen und hörten nicht den aufgeregten Wirt. »Verdammich, du hast mit einer Wut getroffen … Mit einer Wut …« Er konnte nicht weitersprechen vor Lachen.
Ja. Carl Brenten hatte mit wilder Entschlossenheit das Bierseidel in die Scheibe geworfen, in einer Sauwut auf die ganze Welt, auf sich und sein Missgeschick im besonderen. Denn wie ein quälender Stachel saß ihm im Blut, was die Schwestern ihm bei jeder Gelegenheit in die Ohren zischelten: Unmögliche Heirat … Kein Glück in dieser Ehe … Zu nichts wirst du es bringen, wirst tiefer und immer tiefer sinken … Hättest doch eine bessere Partie machen können, anstatt dich an eine Kistenkleberin zu ketten, eine aus 'ner Werftarbeiterfamilie … Die passt nun einmal nicht zu uns, hieß es, das musst du doch zugeben … Du wirst uns immer angenehm sein und auch bleiben, gewiss, aber diese Frau, also ein Wort für immer, diese Frau bringe nicht in unsere Gesellschaft, das gäbe nur unliebsame Auftritte …
Mit wem der kaum ein Jahr verheiratete Ehemann, der Jüngste unter zahlreichen Geschwistern, auch sprach, ob mit seiner Schwester Mimi oder mit Liesbeth, mit seinem Schwager Hinrich oder mit Felix – er hatte alle gegen sich. Natürlich gehörten auch sein Bruder, der Zollsekretär Matthias Brenten, und dessen Frau dazu, eben die ganze Sippschaft. Und da sollte man nicht ein Bierseidel in eine Spiegelscheibe pfeffern?! Jeden Tag konnte er, das wusste der kaum warm gewordene Ehemann, Vater werden. Das wussten die Geschwister jedoch nicht. Die Hände würden sie über dem Kopf zusammenschlagen. Und da hatte dieser hasenherzige Felix geglaubt, er würde nicht mit Wonne die Spiegelscheibe zertrümmern, die einem das eigene Konterfei äffisch zurückwarf.
»Mein Herr, haben Sie den Spiegel zertrümmert?«
Der nach seiner Tat sich stark fühlende, alles andere denn nüchterne Gast Carl Brenten wandte sich verachtungsvoll um und erkannte einen Blauen, einen Schutzmann.
»Jawohl, hab ich«, bekannte er mannhaft.
»Warum?« wollte der Ordnungshüter wissen.
»Aus Wut!« antwortete der Täter und warf sich in die Brust.
»Aus Wut?« wiederholte der Schutzmann verständnislos. »Wieso denn aus Wut?«
Das war zuviel für Carl Brenten. Das war geradezu eine Unverschämtheit. Musste er sich von aller Welt ausfragen und Vorhaltungen machen lassen? Wieder stieg ihm das Blut zu Kopf. Er schrie dem lästigen Frager ins Gesicht: »Mein Herr, antworten Sie mir: Sind Sie für die Buren oder für die Engländer?«
»Unterlassen Sie Ihr dummes Gelächter«, herrschte der Polizist Brentens Begleiter an. Der ward auch sofort ruhig, schnitt aber den herumstehenden neugierigen Gästen Grimassen. »Sie werden dem Wirt den Schaden ersetzen müssen!«
»Selbstverständlich«, erwiderte der Täter großartig. »Hab ich mich etwa geweigert? Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet.«
»Der Spiegel kostet mindestens achtzig Mark«, ließ sich der Wirt vernehmen.
»Felix«, rief der leicht schwankende Spiegelzertrümmerer, »pump mir 'nen blauen Lappen!«
Der Angeredete brach wieder in prustendes Gelächter aus und tat, als suche er in seinen Taschen. Er kehrte eine nach der anderen um, und als er alle durchstöbert und keinen blanken Pfennig gefunden hatte, war das für ihn ein Anlass, ein neues Gelächter anzustimmen.
Der Schutzmann war durch den gelassen geforderten Hunderter stutzig geworden. Kein Zweifel, diese beiden Betrunkenen hatten Geld. Er beugte sich über den Schanktisch und flüsterte mit dem Wirt. Der verlangte laut Garantien.
»Können Sie sich ausweisen?« fragte der Schutzmann die Ordnungsstörer.
»Aber selbstverständlich«, riefen beide wie aus einem Munde.
»Ihr Beruf?« wollte der Schutzmann wissen.
»Prokurist!« spreizte sich Felix.
»Zigarrenhersteller«, antwortete sein Trinkkumpan, nicht minder großspurig. Dieser Bescheid reizte den anderen zu einem abermaligen Heiterkeitsausbruch.
Beide hatten polizeilich gestempelte Meldescheine; Felix außerdem einen Militärpass. Der Schutzmann studierte dies Papier besonders genau und gab es mit achtungsvollem Blick auf den Besitzer zurück, dabei die Hand flüchtig an die Pickelhaube legend. Felix Striemel hatte, so stand in dem Papier, als Vizefeldwebel seine aktive Dienstzeit beendet. Nun ging alles schnell und glatt vonstatten. Sie wurden notiert und mussten dem Wirt versichern, innerhalb von acht Tagen Schadenersatz zu leisten.
»Und – und meine Frage?« Brenten pflanzte sich herausfordernd vor dem Schutzmann auf.
»Was für eine Frage?«
»Sehn Sie, das Wichtigste haben Sie vergessen!« rief er und blitzte vorwurfsvoll den Blauen an. »Ich habe Sie gefragt, ob – ob Sie für die Buren oder für die Engländer sind.«
»War das hier etwa ein politischer Streit?« fragte der Schutzmann und zog die Brauen hoch.
»Ich sehe, Sie sind für die Engländer«, sagte Brenten, »denn Sie machen Ausflüchte. Schämen Sie sich! Ihr Kaiser, der Sie besoldet, ist für die Buren. Oder kennen Sie sein Telegramm an den Präsidenten Ohm Krüger nicht? Nein? Mann, schämen Sie sich!«
Stolzen Siegern gleich verließen die beiden das Lokal. Felix, der Größere und Elegantere, hakte seinen Schwager unter, und so zogen sie, sich gegenseitig stützend, herausfordernd um sich blickend, den Steindamm hinunter. Plötzlich blieb Felix stehen, zwirbelte die Spitzen seines schneidigen Schnurrbarts, sah seinem Kumpan fest in die Augen und sagte: »Das mit den Buren hast du großartig gemacht. Der arme Udel war ganz verdattert. Aber jetzt eine ernste Gewissensfrage: Wohin gehen wir, Carlchen?«
Brenten war um fast einen Kopf kleiner als sein Begleiter. Unter dem steifen schwarzen Hut, von dem Vizefeldwebel a. D. Felix Striemel Zivilhelm genannt, sahen die in die Stirn gekämmten Haare hervor. Zu einem Schnurrbart langte es noch nicht, denn »Carlchen« war noch keine einundzwanzig Jahre alt; immerhin bedeckte ein unregelmäßig gewachsenes dünnes Barthaar die Oberlippe, liebevoll mit »Fixolin« gepflegt. Carlchen überlegte scharf. Felix rief: »Fahren wir zu Mutter Grün. Mit der Pferdebahn bis Jüthorn.« Carlchen schüttelte sich. »Brr! Brr! Ins Grüne! Nee, in die ›Fledermaus‹!« – »Großartig«, stimmte Felix sofort zu, hakte den Freund wieder unter und begann, zum Gaudium der Passanten, mit lauter, keineswegs schöner Stimme: »Ein fahrender Sä–änger, bei allen bekannt … als Rattenfänger zieh ich durchs Land …« Carlchen, in Erinnerung an das Spiegelglas und an seine Schwestern Mimi und Liesbeth, sang: »Glücklich i–ist, wer verfri–isst, wa–as nicht zu versaufen ist.« Und so, jeder beharrlich sein Lied singend, zogen sie ins Trinklokal »Fledermaus«.
III
Spätabends näherte sich Carl Brenten widerstrebend seiner Wohnung. Ein übermächtig gewordenes Bedürfnis nach Schlaf trieb ihn. Zwei Nächte und zwei Tage hatte er durchzecht; nach der Geburtstagsfeier am Sonnabend bei Mimi waren sie zu viert losgezogen, von einem Lokal ins andere. Die letzten zehn Stunden nur noch er und Felix Striemel, denn die beiden andern, Gustav und Hinrich, dressierte Eheknochen, wie er sie verächtlich nannte, waren wie gehorsame Pudel nach Hause zu ihren Weibern gekrochen. Carl Brenten pfiff auf alle Weibsbilder, insbesondere auf das eigene. Eine schwache Stunde – und eine Ewigkeit lang die Hölle. Wer hatte das noch gesagt? Hm – Felix natürlich. Ein Witzbold, dieser Felix. Aber recht hatte er.
Als er, vor seinem Haus angelangt, ins Treppenhaus wollte, schoss aus einer dunklen Ecke die Nachbarin Boilers hervor. Er fuhr erschrocken zurück.
»Oh, Herr Brenten, gehn Sie man so nicht rauf. Ihre Frau hat 'n Jungen gekriegt.«
»Und darum soll ich nicht rauf?« entrüstete sich Brenten. »Das wäre ja noch schöner!«
»Lieber Herr Brenten«, stammelte die Nachbarin. »Es war erst vor wenigen Stunden. Ihre Frau ist doch sehr angegriffen. Das müssen Sie bedenken. Und dann ist Ihre Schwiegermutter oben. Sie hat schon wiederholt nach Ihnen gefragt.«
Bei dem Wort »Schwiegermutter« war Carl Brenten zum zweitenmal zusammengezuckt. Kleinlaut starrte er die Nachbarin an. Jetzt erst schienen ihm ihre Worte ins Bewusstsein zu dringen. »Jaja, dann wird es wohl … ich … Hm! Hm! Und was sagen Sie, Frau Bollers, ein Junge? Mein Gott, ich hab einen Sohn! Jaja, dann will ich … will ich man lieber …« Er hielt sich am Türpfosten fest, machte eine schroffe Wendung und taumelte auf die Straße. Sofort aber kehrte er wieder um und rief Frau Bollers, die schon die Treppe hochgestiegen war, zurück.
»Frau Bollers, Sie … Sie täten mir einen großen Gefallen … Ich wäre Ihnen sehr dankbar … Sie sehen wohl, ich habe … Sie müssen nämlich wissen, meine Schwester hatte Geburtstag … Ich meine, würden Sie aufpassen, bis die Alte weggeht?«
»Ja, gerne, Herr Brenten!«
»Die kann doch nicht ewig oben sitzen bleiben, nicht wahr? Und ich meine … Ja … Würden Sie mir einen Wink geben … Ich meine, wenn die Luft rein ist … Wissen Sie was, machen Sie hier mit Kreide ein Kreuz an die Tür, wenn die Luft rein ist … Wollen Sie das tun? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, sehr dankbar!«
»Ja, wenn Frau Hardekopf weg ist, mach ich ein Kreuz hierher. Sie wissen dann Bescheid.«
»Sehr gut! Sehr gut, Frau Boilers!«
Man sagt, fällt ein Betrunkener ins Wasser, wird er auf der Stelle nüchtern. Carl Brenten kam sich wie in eiskaltes Wasser gefallen vor. In seinem schweren Kopf hämmerte unerbittlich der Gedanke: Vater geworden … Ich hab einen Sohn! Natürlich hatte er gewusst, dass es bald soweit sein würde, aber eine richtige Vorstellung davon hatte er nicht gehabt. Und jetzt war es geschehen: Er war Vater geworden.
Carl Brenten bog in die Springeltwiete ein und mischte sich unter das Menschengewimmel der schmalen Niedernstraße. Wohin wollte er eigentlich? Er wusste nur, dass er noch nicht nach Hause konnte. Und dann immer wieder das eine: Er war Vater geworden. Die Schwestern würden die Augen aufreißen. Bisher hatten sie ihn noch retten wollen; nun würden sie ihn verloren geben, hoffnungslos … Ach, der Teufel hole sie, hole die ganze noble Sippschaft. Denken wunder was sie darstellen. Nichts als sticheln und höhnen können sie. Geholfen hatte ihm noch niemand … Auch den Felix hole der Satan. Der nur war schuld, dass er den heutigen Tag verbummelt hatte. Auch den Anlass zum Spiegelzertrümmern hatte er gegeben; er hatte ihn gereizt, bis das Seidel flog. Nicht ausgeschlossen aber, dass er sich drückte, wenn's tatsächlich bezahlen hieß. Wahrscheinlich sogar, Andeutungen hatte er schon gemacht … Alle spielen mit mir, glauben, mich bemuttern zu müssen. Verflucht noch mal, wen geht's was an, wann und wen ich heirate? Und wen geht's was an, ob ich Vater bin? Eine seltsame Schwäche überkam ihn. Er hatte einen Sohn – und hatte den Tag der Geburt verbummelt, hatte herumgesoffen …
Vergiss doch nicht, du bist ein Brenten! Ein Brenten, das ist auch schon was … Haha! Jetzt tun alle wunder wie besorgt. Hatten sie sich früher um ihn, ihren »jüngsten Bruder«, wie sie dauernd sagten, gekümmert? Sie hatten ihn zum Proletarier werden lassen. Nun aber zischelten sie: Carlchen, du bist doch kein Proletarier. Vergiss doch nicht, unser Vater ist ein geachteter Kunstschlossermeister gewesen, hat in der Bürgerschaft gesessen. Wie konntest du dich so vergessen? Die Pest sollten sie kriegen; sie hatten ihn um sein Erbteil betrogen und zum Proletarier werden lassen. Eine reelle Abrechnung hatte er nie zu sehen bekommen … Nie gesehen! Er war eben mit Pech besudelt von oben bis unten. Sein dünkelhafter älterer Bruder, der Herr Zollsekretär, hatte ihn, den Sozi, aus seiner Wohnung gewiesen. Arbeit schändet nicht, aber mit einem Sozi will ich nichts zu tun haben. – – Lüge! Lüge! In ihren Augen war es unverzeihlich und schandbar, ein simpler Arbeiter zu sein, in die Fabrik zu gehen, ein Sozi zu sein, ein Roter! Kunstschlossermeister – jawohl! Zollsekretär – jawohl! – – – Aber ein Zigarrenmacher, ein Sozi, ein Roter, ein Knallroter sogar … puh! Ich werde das künftig noch lauter betonen. Ich werde es ihnen in die Ohren brüllen. Angst sollen sie bekommen … Feige Sippschaft, elende!
Carl Brentens Irrweg durch die zu dieser Abendstunde diesigen Gassen war mit Selbstvorwürfen und wilden Anklagen gepflastert. Erstaunlich schnell war die Ernüchterung gekommen und die Müdigkeit verflogen. Nun war ihm, als läge seines Lebens schönster Teil hinter ihm, als hieße es jetzt Abschied nehmen von den Freuden dieser Welt, die er so gern und ausgiebig genossen. »Ach, noch nicht einundzwanzig Jahre alt«, seufzte er, »und schon liegt alles, was das Leben wert und schön macht, hinter mir. Nun heißt es fronen, für eine Familie sorgen und allen Genüssen entsagen.« Hinter ihm lagen – unwiederbringlich – die frohen Wandertage den Rhein entlang. Er hätte die schöne Zeit gewiss nie erlebt, wäre er nicht nach eineinhalb Jahren Lehrzeit durchgebrannt. Gelernt hätte er doch nichts mehr, sondern nur den Gewinn des Krauters vermehrt. Zigarrenmacher war er dennoch geworden, und sogar einer, der es mit jedem anderen aufnehmen konnte … Brüssel! Immer, wenn er der schönen Tage gedachte, begann eine nicht verheilte Wunde zu bluten. Sein Traum war Paris gewesen. Paris! Aber das Geld war ihm ausgegangen. Schwester Mimi verwaltete den Restteil seines Erbes. Er hatte gebeten und gebettelt, sie hatte nichts geschickt. Schließlich war eine Fahrkarte Brüssel–Hamburg gekommen. Nichts weiter. Uhr und Anzug hatte er verkaufen müssen, um die Hotelschulden begleichen zu können. Dabei gehörten ihm noch fast zweitausend Mark …
Diese Erinnerung kam gerade recht, um seine Wut gegen die »Sippschaft« zu schüren und den Entschluss zu bekräftigen, den er insgeheim bereits erwogen hatte, nämlich den Verkehr mit ihnen künftig zu meiden … Überhaupt – die lausige Restsumme von tausendachthundert Mark. Und dreißigtausend hatte der Vater hinterlassen! Sein ganzes Erbe war durch ihre Finger gegangen und – zerronnen. »Betrogen haben sie mich!« rief er laut vor sich hin. »Mit meinem Gelde haben sie ihre Geschäfte gemacht, womöglich« – er übertrieb in seiner Gereiztheit – »ihr Haus gekauft …«
Bei früheren Anlässen schon war Groll ob dieser Ungerechtigkeit in ihm aufgestiegen, jedoch niemals so heftig und nachhaltig wie in dieser Stunde, wo er, wie aus einem langen Rausch erwachend, nunmehr Vater und Familienoberhaupt, sich besonders übel mitgespielt vorkam. Er war Vater geworden, und – Allmächtiger! – von seinem letzten Wochenlohn hatte er keine drei Mark mehr in der Tasche. Weder Hinrich Willmers, der Hausbesitzer, noch Felix, der Prokurist, hatten ihm zwanzig Mark pumpen wollen. Elende Bande, erst räuberten sie einen aus und zum Schluss verabreichten sie einem noch Tritte. Das wird unvergessen bleiben, gelobte Carl Brenten. Dann sprangen seine Gedanken wieder zurück. Einen Jungen hatte er. Bald würde der laufen können und Fragen stellen. Er konnte mit ihm spazierengehen, auf der Elbchaussee oder an der Alster. Und dieser Sohn sollte dereinst kein simpler Zigarrenmacher werden. Vielleicht studieren. Nur kein Zigarrenarbeiter.
So phantasierte der besorgte Vater, der seine Vaterschaft im Suff verpasst und seinen Stammhalter noch gar nicht gesehen hatte, weil er die vorwurfsvollen Blicke seiner Ehehälfte fürchtete, mehr aber noch die Schwiegermutter, den »dräuenden Drachen«, der am Bett seiner Frau wachte.
Großmutter Hardekopf saß jedoch schon längst nicht mehr bei ihrer Tochter. Um die junge Mutter nicht zu erregen, hatte sie es sich verkniffen, weiter nach dem Vater zu fragen. Leicht war es ihr nicht geworden, denn sie glaubte nie und nimmer das Märchen, das die Tochter ihr aufgetischt hatte. Danach musste ihr Mann Überstunden machen. Ungefähr eine Stunde nach der Geburt war die Hebamme Niehus angerast gekommen. Großmutter Hardekopf hatte ihr nur einen vernichtenden Blick zugeworfen und ihren Gruß nicht erwidert, überhaupt kein Wort mit ihr gesprochen. Die Hebamme hatte alles in bester Ordnung gefunden, sich entschuldigt, einige Ratschläge gegeben und sich schnell wieder verzogen. Der Ehegatte jedoch war nicht gekommen. Frau Hardekopf konnte nicht ahnen, dass er aus Furcht vor ihr mit dickem Kopf in den Straßen umherirrte.
»Frau Bollers«, hatte Großmutter Hardekopf zu der Nachbarin gesagt, »wollen Sie bei meiner Tochter wachen, bis der Mann kommt? Einmal muss er doch wohl an 'n Laden kommen. Ich muss nach meinen Männern sehen.«
Kaum war Frau Hardekopf aus der Tür, hatte die kleine Bucklige Frieda Brenten zugeflüstert, ihr Mann sei längst gekommen, getraue sich aber nicht herauf. »Wo ist er?« wollte die Wöchnerin wissen. – »Nun, er läuft wohl durch die Straßen und wartet, bis die Luft rein ist. Ich habe ihm versprochen, ein weißes Kreuz an die Haustür zu machen, wenn die Frau Hardekopf gegangen ist.«
»Ein weißes Kreuz?« Die junge Mutter lächelte. »Dann gehn Sie man schnell, Frau Bollers, und machen Sie das Kreuz, damit er nicht länger als nötig wartet.«
IV
Frau Hardekopfs »Männer« warteten ungeduldig. Vater Hardekopf wanderte unruhig in der Stube auf und ab und zupfte immer wieder an seinem prächtigen gestutzten Vollbart. Am liebsten wäre er seiner Frau nachgeeilt, um bei der Geburt dabeizusein. Die Jungens verulkten ihren Vater als Großvater; der vierzehnjährige Otto und der neunjährige Fritz fanden es ungeheuer komisch, dass sie fortan Onkel spielen konnten. Der ältere, Ludwig, lächelte überlegen und kam sich schon so recht als »Onkel Ludwig« vor. Als nun die Mutter endlich in die Tür trat, schallte ihr ein mehrstimmiges »Und was ist?« entgegen.
Sie winkte ab und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl nieder. Dann erst antwortete sie, zu ihrem Mann hingewandt: »Alles gut abgelaufen. Ein Junge!«
Ein »Ah!« kam aus aller Munde, und auf die Gesichter legte sich vergnügtes Schmunzeln. Hardekopf strich unablässig seinen Bart. Natürlich ein Junge! Aber nun legte Großmutter Hardekopf los: keine Hebamme sei aufzutreiben gewesen, ein Schutzmann habe helfen müssen. Und dann wollte der Wurm nicht leben, einen regelrechten Arschvoll habe er bekommen, aber erst eine Kaltwasserdusche habe seine Lebensgeister in Bewegung gesetzt. Und natürlich sei dies Scheusal von Vater immer noch nicht an 'n Laden gekommen. Der Satan mochte wissen, wo er sich herumtrieb.
»Wie sieht denn der Kleine aus, Mama?« fragte Ludwig.
»Abgrundhässlich!« antwortete seine Mutter geradeheraus. »In meinem ganzen Leben hab ich noch kein so hässliches Kind gesehen.«
Ihre »Männer« starrten sie bestürzt an.
»Erst hab ich gedacht, sämtliche Gliedmaßen seien zu kurz geraten und dass er 'n Wasserkopf hätte. Doch die Hebamme behauptet, alles habe seine Richtigkeit. Aber hässlich im Gesicht … unbeschreiblich!«
Das war eine große Ernüchterung. Man sah sich gegenseitig an. So hässlich? Warum und wieso? Großvater Hardekopf sagte gelassen: »Mutter, du wirst übertreiben! So hässlich sind die Eltern doch nicht.«
»Wirst dich ja bald selbst überzeugen können«, erwiderte seine Frau. »Habt ihr mir etwas Suppe übriggelassen?«
»Bleib man sitzen«, rief der alte Hardekopf. »Bist ja noch außer Atem!« Er nahm den Topf vom Herd, wo er warmgestellt war, füllte einen Teller Suppe auf und bediente seine Frau, die es sich heute gern gefallen ließ.
Den Löffel schon in der Hand, wiederholte sie, bevor sie zu essen begann: »Möchte doch verdammt wissen, wo dieser Schubbejack sich herumtreibt.«
Der Schubbejack schleicht gerade die Treppe nach seiner Wohnung hoch. Jetzt, nachdem er unten an der Tür das verabredete Signal für freie Fahrt erblickt hat, ist ihm noch beklommener zumute. Es half ja aber alles nichts. Langsam klettert er nach oben und überlegt angestrengt, was er sagen könnte. Es sind liebevolle, ach – ergreifende, zu Herzen gehende Worte. Danach will er sie umarmen und küssen. Ja, dieser Kuss sollte alles wiederholen und bekräftigen: Reue, Freude, Glück, Besserungsgelöbnis. Unter den einen Arm hat er ein riesiges Bukett stark duftender Syringen geklemmt, unter den andern einen armdicken Räucheraal, den sie so gern isst.
Als er in die Tür tritt, den Fliederstrauß schämig vor dem Gesicht, verschwindet sofort die Nachbarin Bollers. Er geht langsam in die Schlafstube, legt die Blumen auf das Bett und den Räucheraal daneben. Den jedoch hebt er wieder auf, zeigt ihn stolz und sagt strahlend: »Sieh mal, wie dick, und ganz frisch!«
Sie erwidert leise: »Ich danke dir!«
Er tritt an den Waschkorb heran, in dem der Sohn schläft.
»Hast du alles gut überstanden?«
»Ja! Du auch?«
»Ich?« Und er lacht. »Ich auch, ja, Gott sei Dank!«
»Na, dann ist ja alles gut!«
Zweites Kapitel
I
Während der übermüdete Carl Brenten mit hochgezogenen Beinen auf dem kleinen Sofa lag und schnarchte, hatte seine Schwiegermutter bei sich zu Hause im breiten Ehebett mit ihrem Mann ein längeres Gespräch. Das Wort »Gespräch« gibt die Sachlage eigentlich nicht präzise wieder, denn wie fast immer, sprach auch jetzt nur sie; er hörte zu und brummelte dann und wann, was sowohl Zustimmung wie Ablehnung bedeuten konnte, von seiner Frau indessen immer als Zustimmung aufgefasst wurde. Erklärlicherweise betrafen ihre vielen und erregten Worte die Tochter, deren Kind und Mann.
»A–also, so geht es nicht weiter, unter keinen Umständen. Oder es endet mit einer Katastrophe. Das Kind hat eine völlig neue Lage geschaffen. Verstehst du?«
»Hm! Hm!«
»A–also – an eine Trennung dieser Ehe ist kaum noch zu glauben. Selbstverständlich denkt Frieda nicht daran, ihre Arbeit aufzugeben. Den Balg hab natürlich ich auf dem Hals. Alles hängt von diesem Rabenvater ab. A–also, meine ich, wir müssen was tun. Wir müssen ihn aus seiner jetzigen Umgebung reißen. Müssen ihn unter unseren Einfluss bringen, näher an uns heranziehen. Hast du verstanden?«
Großvater Hardekopf vergaß vor Staunen zu brummeln.
»Mein Gott, schläfst du etwa?« rief seine Frau.
»Nee, nee«, beeilte er sich zu versichern.
»Also, so antworte doch!«
»Hm! Hm!«
»A–also, das wird vor allem deine Aufgabe sein. Wir werden versöhnlicher mit ihm sein müssen. Vielleicht ist er noch zu retten. Es handelt sich nämlich um unsere Tochter, und jetzt auch noch um das Kind. Er ist doch auch Sozialdemokrat. Kannst du ihn nicht öfter auf deine Bezirksabende mitnehmen? Vielleicht machst du den Bezirksleiter auf ihn aufmerksam. Almer ist doch ein gescheiter Mensch. Der soll sich mal um ihn kümmern. Was meinst du?«
Lautes, nachhaltiges Gebrumm, unverkennbarer Unwille.
»Und dann muss er Mitglied des Sparvereins werden. Das Sparen wird gut für ihn sein. Gut wäre auch, wenn du versuchtest, eine Skatgesellschaft zustande zu bringen. Einmal wöchentlich vielleicht, es könnte ja bei uns sein. Also – ich denke, man muss alles versuchen. So geht es nicht weiter. Wir stoßen unsere Tochter ins Unglück. Nun, du sagst ja gar nichts?«
Der alte Hardekopf rekelte sich. Auf was s–o eine Frau alles kam. Wie radikal sie den Kurs ändern konnte! Gestern wollte sie den Tochtermann noch erwürgen, da hieß es »Subjekt«, »Scheusal«, »Liederjan« und. heute: Sozialdemokrat, Sparverein, Skatpartie. Das ging verteufelt fix. So schnell konnte Hardekopf das alles nicht fassen.
»Mein Gott, hast du überhaupt zugehört?«
Deutliches Brummen.
»Na a–also, dann sind wir uns ja einig. Also dreh dich man um und schlaf. Gute Nacht!«
»Hm! Hm!«
II
Das Familienleben bei Hardekopfs durfte als ein geordnetes gelten; es gab fast nie Streit, es herrschte Eintracht – denn es bestimmte nur ein Wille, nämlich der Frau Paulinens. Die »Männer«, Hardekopf und seine Söhne, fügten sich aus freien Stücken, und sie schnitten nicht schlecht dabei ab; Frau Hardekopf lebte, strebte und schuftete nur für sie. Mit unerschöpflicher Energie und in rastloser Arbeitslust widmete sie sich den häuslichen und familiären Aufgaben. Sie versorgte ihre Männer mit allem, was sie benötigten. Das Essen stand zu jeder Mahlzeit pünktlich auf dem Tisch. Die Kleidung war stets in Ordnung. Die Schuhe besohlt. Vereins-, Partei- und Gewerkschaftsbeiträge pünktlich bezahlt, auch die Beiträge für die Sterbekasse »Harmonie«, der sie, ohne Wissen ihres Mannes, angehörte. Wenn am Wochenende der Lohn an sie abgeführt war, alle ihr Taschengeld und Fahrgeld erhalten hatten, so wusste jeder: für alles in der kommenden Woche war gesorgt.
Und was die Familie an Nahrungsmitteln benötigte, das wurde in der ersten Verkaufsstelle der »Produktion«, die in der Steinstraße eröffnet worden war, eingekauft. Das hieß nun aber keineswegs, dass Frau Pauline nicht auch zuweilen heimlich einige Kleinigkeiten beim Krämer Pinnländer kaufte, da dieser ja Rabattmarken gab, die man gegen ein schönes Kaffeeservice oder eine Butterdose eintauschen konnte.
Frühmorgens fünfeinhalb Uhr mussten die Hardekopfs aufstehen und eine halbe Stunde später aus dem Hause gehen, wollten sie rechtzeitig auf ihrer Arbeitsstelle sein, drüben am anderen Flussufer, auf der Werft Blohm & Voß. Frau Hardekopf war eine halbe Stunde vor ihren Männern hoch, kochte Kaffee, schmierte Butterbrote, füllte die blechernen Kaffeetanks und auch die Tabakschachtel ihres Mannes. Pfeiferauchen war der einzige Luxus, den er sich erlaubte.
War der Alte mit seinen Söhnen Ludwig und Otto gegangen, hätte Frau Hardekopf wieder ins Bett kriechen können; doch sie dachte nicht daran. Ihre Männer standen arbeitend in der Fabrik – und sie sollte faul im Bett liegen? Ein unmöglicher Gedanke. Frau Wittenbrink, ihre Nachbarin, jawohl, die bekam es fertig, die schlief bis in die Puppen. Die Rüscher hingegen – das arme, geplagte Luder! –, die ebenfalls auf demselben Flur wohnte, musste sogar noch eine Stunde früher hoch; sie trug frische Rundstücke aus, um danach in der Norddeutschen Kreditbank rein zu machen. Nun, das hatte Frau Hardekopf nicht nötig, aber um sechs Uhr morgens, nachdem ihre Männer fort waren, begann sie zu schrubben und zu scheuern, Töpfe zu säubern, Geschirr zu waschen, die Messingstange am Ofen und die schwere metallne Petroleumlampe zu putzen, ein Prunkstück, das der alte Hardekopf und sein Sohn Ludwig heimlich auf der Werft gepfuscht hatten.
Ja, Frau Pauline hatte von früh bis spät zu tun; ihr Tag lief wie ein Uhrwerk ab. Pünktlich um sieben Uhr weckte sie ihren Jüngsten, den Fritz, einen schmalen, blassen Burschen, der nichts von seiner robusten, handfesten Mutter, dafür aber das Versonnene, Verträumte und Stille seines Vaters geerbt hatte. Brav und selbständig wie ein Mädchen war der Junge, und wenn Mutter Hardekopf ihn auch lobte und sein Betragen angenehm fand, so vollkommen recht war ihr diese Bravheit auch nicht. Sie liebte nun doch Jungen ein wenig wilder und eigenwilliger, wenngleich das Wünsche waren, die bei ihr unbewusst in irgendeinem Herzenswinkel kauerten. Wo nämlich Eigenwilligkeit vorhanden war, gar zu Eigensinn und Schlimmerem ausartete, da schritt sie erbarmungslos ein, ohne ihr eigen Blut zu schonen. Das hatte ihr Ältester, der Emil, zu spüren bekommen, der aus der Familie entfernt worden war und bei einem Schneidermeister auf dem Lande in der Lehre war.
In den langen Stunden des Tages stand der kleine Otto todunglücklich am Schraubstock, feilte Sandstellen von Gussstücken, trieb Dorne durch Metallscheiben und träumte oftmals dabei so lebhaft von nicht mehr möglichem Marmel- und Versteckspielen, von Tauspringen und Immergrün-Raten, dass ihm die Augen nass wurden und der Hammer den Daumen und nicht den Eisendorn traf.
Sein älterer Bruder Ludwig, ein anhänglicher Mensch von stiller, leidenschaftsloser und furchtsamer Gemütsart, arbeitete bereits an der Drehbank. Er hatte sich damit abgefunden, in dem Platz an der Maschine seine Welt zu erblicken. Und obwohl ihm die Arbeit nicht leicht wurde, denn sie erforderte Geschicklichkeit, vertiefte er sich so völlig in sie, dass er sie beinahe liebgewann. Er arbeitete mit seinem Bruder in einer Maschinenhalle, aber im Gegensatz zu Otto, der zu Feierabend davonrannte, als könnte er dadurch für immer der verhassten Arbeit entrinnen, wartete Ludwig stets auf den Vater, der einen weiteren Weg nach dem Ausgang hatte, denn die Gießerei lag auf dem hinteren Werftgelände. Noch ungewaschen, den Schmutz der Arbeit im Gesicht und an den Händen, den leeren Kaffeetank über die Schulter gehängt, die ölverschmierte Schirmmütze ein wenig dem linken Ohr zu geschoben, schritt er stolz, ein Lehrling im dritten Lehrjahr, neben seinem von den Kollegen hochgeachteten Vater einher.
III
Obwohl sein Kopf entsetzlich brummte und abscheulich schwer war, stieg Carl Brenten am Morgen schneller als gewöhnlich in die Kleider. Seine Frau beobachtete ihn. »Hast du einigermaßen geschlafen, Carl?« – »Einigermaßen?« rief er. »Sehr gut sogar! Ausgezeichnet!« Er zerrte seine Hose hoch und die Hosenträger über die Schulter. Sie zweifelte nicht, dass er gut geschlafen habe. Sein lautes Schnarchen hatte sie nicht einschlafen lassen. »Wärm dir den Kaffee auf«, sagte sie. »Die Kanne steht auf dem Herd.« – Er schüttelte den Kopf. »Ach wo, wozu!«
Sie bemerkte seine Unruhe, konnte sich aber die Ursache nicht erklären. Sie dachte bei sich: Er will sich heute nicht verspäten. Und sie lächelte leicht. »Gib mir doch den Kleinen ins Bett, Carl!«
Brenten stürzte an den Waschkorb und hob das kleine Wesen heraus. Ein bisher nicht gekanntes Gefühl durchrieselte ihn, als er das Kind seiner Frau hinüberreichte. Aus dem Steckkissen ragte nur der kleine Kopf mit den runden dunkelbraunen Augen und der winzigen Nase hervor; es war, als stecke der Körper verpuppt in einer weißen Kapsel. Seine Frau legte es an die Brust, und gierig schmatzend suchte der kleine Mund die Brustwarze, fand sie jedoch nicht; die Mutter musste sie ihm reichen. Das war alles so seltsam. Müsste er nicht endlich um Verzeihung bitten? Aber es gelang ihm einfach nicht; kein Laut wollte über seine Lippen. Eine Weile blickte er auf Mutter und Kind wie auf ein unfassbares Wunder, dann fiel ihm mit Schrecken die Alte wieder ein. Er wusste, sie war eine Frühaufsteherin, konnte jeden Augenblick in die Tür treten. Um Himmels willen, fort! Nur fort! Er war schon an der Tür, als er wieder umkehrte, seiner Frau die Hand hinstreckte und »Adschüs, Frieda!« hervorwürgte. – Sie reichte ihm ihre weiche, weiße Hand. »'dschüs, Carl!« – Er war tiefbeglückt. Noch niemals hatten sie sich die Hände gegeben, wenn er des Morgens zur Arbeit ging. Ja, das war die Versöhnung. Sie hatte ihm verziehen. Alles war gut und wieder in Ordnung. Und er hastete mit hochrotem Kopf hinaus und die Treppen hinunter und atmete erst freier, als er ohne die befürchtete Begegnung die Straße erreicht hatte.
IV
Zwei Tage blaugemacht. Was würde Schaper sagen? Was für Ausreden konnte man anbringen, überlegte Brenten. Mein Gott, war das ein dumpfer, unerträglicher Druck im Schädel. Und die Glieder schmerzten, als hätte er eine Riesenstrapaze hinter sich. Hoffentlich brauchte er die kommende Nacht nicht wieder auf dem kurzen Sofa zu kampieren. Jetzt hieß es aufholen. Doch er würde es schaffen. Es war immerhin nicht das erstemal, dass er, Carl Brenten, auf eigene Faust gefeiert hatte. Eben, weil es nicht das erstemal war, war ihm ein wenig schummrig. Aber wennschon … Schaper war auch einer, der sich gern vergnügte Tage gönnte. Und Carl Brenten konnte von sich behaupten, dass er ein guter Arbeiter war; die teuersten und penibelsten Zigarren waren seine Spezialität: »Hamburger Handarbeit«, Marke »Kaiserkrone«, Sumatradeckblatt, aber nicht leicht, obgleich Sandblatt, sondern würzig und stark, mit viel Brasileinlage. Schaper würde ihn nicht so leicht hinaussetzen, und er, er würde aufholen und versuchen, am Wochenende annähernd auf den normalen Lohn zu kommen.
Der Zigarrenfabrikant Richard Schaper besaß nicht nur eine Fabrikation, sondern auch einige große Zigarrengeschäfte in Hamburg, Bremen und Berlin. Sein Hauptgeschäft befand sich in der Hermannstraße, und im gleichen Haus, in drei Stockwerken darüber, die Zigarrenmacherei, Sortiererei und Kistenbekleberei. So war er Hauptabnehmer und Detailverkäufer seiner eigenen Produktion. Schaper-Zigarren waren Qualitätszigarren; ihre Käufer durchweg wohlhabende Bürger. Richard Schaper war im Hamburger Bürgertum eine bekannte Persönlichkeit; er gehörte zur Grundbesitzerpartei und war in früheren Jahren einmal Mitglied der Bürgerschaft, des hamburgischen Stadt- und Landparlaments, gewesen, er hatte sich indessen die letzten Jahre von der Politik zurückgezogen und widmete sich nun ausschließlich sportlichen Vergnügungen. Auf der Trabrennbahn »Mühlenkamp« hatte er einige Pferde laufen. Leidenschaftlicher noch war er dem Segelsport ergeben. Mit seiner Jacht hatte er verschiedene Medaillen geholt, und auch bei der letztjährigen großen Regatta der Kieler Woche hatte er ehrenvoll abgeschnitten und den dritten Preis bekommen. Ein Sportsmann, groß und schlank, von gepflegtem, elegantem Äußeren und selbst in den Wintermonaten braungebrannt. Und doch konnte man ihm nicht nachsagen, dass er der Sportleidenschaft wegen sein Unternehmen vernachlässigte. Jeden Morgen Punkt sieben Uhr, wenn die Arbeitszeit begann und das Geschäft geöffnet wurde, betrat er sein Büro, blieb regelmäßig bis zwölf und ging, nachdem die Post erledigt war, durch die Abteilungen seines Betriebes. In den Nachmittagsstunden vertrat den Chef der Erste Prokurist, Herr Rattig, von den Arbeitern das »Ekel« genannt.
Schlag sieben Uhr klopfte Carl Brenten beim Prinzipal Schaper an die Bürotür, noch nicht ganz einig mit sich, was für einen Schwindel er ihm auftischen sollte. Eingedenk der leichten, genussfreudigen Lebenshaltung des Prinzipals wollte er sich mit einem Witz aus der Affäre ziehen, wollte sagen, Johann Strauß habe ihn verführt, der Walzer und der Wein hätten es ihm angetan. Alsdann wollte er wahrheitsgemäß sagen, dass er bei seiner Schwester Geburtstag gefeiert habe, etwas zu gründlich und anhaltend, das gäbe er zu. Aber mein Gott, wenn man jung sei … So etwa wollte er reden. Schaper würde Humor genug besitzen und die Sache mit einem Verweis abtun.
»Nun, und wo haben Sie wieder gesteckt?« wurde Carl Brenten angeherrscht, kaum dass er die Bürozimmertür hinter sich geschlossen hatte.
»Ich … ich«, stotterte Brenten, langsam auf den mächtigen Schreibtisch des Prinzipals zutretend. »Ich … ich bin Vater geworden!«
»Aber nein! Wirklich?« Herr Schaper erhob sich, streckte seine Rechte aus. »Da gratuliere ich … Junge oder Mädchen?«
»Ein Junge«, antwortete der Vater stolz.
»Meine herzlichsten Glückwünsche.«
Carl Brenten schüttelte die Hand seines Prinzipals.
»Und die glückliche Mutter wohlauf?«
»Ja, danke! Alles gut verlaufen!«
»Nun, das freut mich. Da spendier ich zur Feier des Tages für Ihre Stube einen Halben pro Mann.«
»Vielen Dank, Herr Schaper!«
In der Tür fiel Carl Brenten ein, dass er, wo alles wider Erwarten so günstig ausgegangen war, einen Vorteil herausschlagen konnte. Kurz entschlossen machte er kehrt.
»Nun, was noch?« fragte der Prinzipal.
»Herr Schaper … anlässlich dieses frohen Ereignisses … ich meine … da … könnte ich einen … einen Vorschuss?«
»Wieviel?«
»Oh, ich dachte so … so fünfzig Mark.«
»Gut, bin einverstanden. Herr Rattig soll sie Ihnen auszahlen. Bei wöchentlicher Rückzahlung von fünf Mark. Ist es Ihnen recht?«
»Ja, gewiss. Vielen Dank auch.«
V
Wie in allen Zigarrenfabriken saßen auch in der Schaperschen gewöhnlich fünfzehn Arbeiter auf einer Stube an einem langen Tisch einander gegenüber. Jeder hatte seinen festen Platz mit Tabak, Wickel, Napf mit Klebstoff, Messer und Rollbrett. Herrschte auf so einer Stube guter kollegialer Geist, war es ein angenehmes Arbeiten. Man kannte sich gegenseitig genau, jeder nahm an Freude und Missgeschick des anderen Anteil, und gegen den Prinzipal hielten alle fest zusammen. Einer wurde zum Stubenältesten gemacht, der verschiedene Sonderaufgaben hatte. Er musste achtgeben, dass der notwendige Tabak pünktlich vom Lageristen geliefert wurde, dass Wickel und Klebzeug und dergleichen immer zur Stelle waren, und am Ende des Arbeitstages hatte er die Leistungen zu verbuchen, denn gearbeitet wurde im Stücklohn.
Dann hatte jede »Bude« ihren Vorleser. Das war nicht immer ein und derselbe, vielmehr bald dieser, bald jener der Kollegen, alle, die sich dafür eigneten. Derjenige, der vorlas, bekam den Durchschnitt eines Arbeitstages berechnet. So arbeiteten also die übrigen Zigarrenmacher ständig für diesen einen vorlesenden Kollegen mit.
Gelesen wurde nach Übereinkunft. Dort, wo unter der Belegschaft das politische Interesse vorherrschte, wurde jeden Morgen alles Wichtige und Interessante aus dem »Hamburger Echo«, der sozialdemokratischen Tageszeitung, und dem bürgerlichen »General-Anzeiger« vorgelesen und hinterher vorwiegend politische Schriften. Das größte Interesse erregten Reichstags- und Bürgerschaftsberichte, Reden, Informationen und dergleichen mehr. Auf Stuben mit weniger starkem politischem Interesse wurde nach der Zeitungslektüre zumeist unterhaltende, schöngeistige Literatur bevorzugt: Gedichte und Novellen von Liliencron und Otto Ernst, wohl auch ein Theaterstück von Gerhart Hauptmann oder Max Halbe, wenn es gerade über Hamburger Bühnen lief.
Auf Carl Brentens Arbeitsstube überwog die politische Note, sämtliche Kollegen waren Mitglieder der Sozialdemokratie, und auf dieser Bude war auch Carl Brenten ein Sozialdemokrat geworden. Am heutigen Tage freilich kam die politische Literatur schlecht weg, denn Brentens junge Vaterschaft wurde gefeiert. Nach der Lage, die der Chef spendiert hatte, zeigte sich Carl Brenten nicht knausrig, da er ja fünfzig Mark Vorschuss in der Tasche hatte; er ließ eine zweite Lage holen. Aus den Nebenstuben stellten sich die Gratulanten ein, die sich nicht lange nötigen ließen, das freudige Ereignis zu begießen. Die Kleberinnen kamen gelaufen, dem jungen Vater ihre Gratulation darzubringen. Die kleine Frieda, ihre frühere Kollegin, war bei allen beliebt gewesen. Bei den üblichen, nicht immer ganz harmlosen Neckereien war sie stets rot und verlegen geworden, was allen Männern ungeheuer gefallen hatte. Als man glaubte, Carl Brenten habe ein Auge auf sie geworfen, hatte das Hänseln und Gerede nicht mehr aufhören wollen. Eines Tages hatte es geheißen: Carl, bei der hast du ein'n Stein im Brett!, oder: Menschenskind, Carl, sei doch nicht so verboten schüchtern! Schnell war es eine ausgemachte Sache gewesen, dass die beiden was miteinander hätten. Sie hatten aber gar nichts. Sie waren umeinander herumgeschlichen, waren rot geworden und hatten Herzklopfen bekommen, wenn sie zusammentrafen. Carl hatte Frieda wiederholt zu einem Abendausgang einladen wollen, sich aber lange nicht getraut. Sie gefiel ihm, das war wahr; sie gefiel ihm sogar täglich mehr. Und dann war ein Tag gekommen, an dem er so richtig in Verlobung und Heirat hineingeschlittert war. Er war Frieda im Gang bei den aufgestapelten Zigarrenkisten begegnet, hatte ihre Hand ergriffen, sie angeredet und zu einem Besuch des Thaliatheaters eingeladen. Die Bekleberin Henny Reuter, die das Paar unbemerkt beobachtet hatte, brachte diese interessante Neuigkeit flugs auf die Bude, wo die Kollegen sofort energisch auf ihr »Recht« gepocht hatten, nämlich, dass Verlobung gefeiert würde und Carl einen Siphon Bier spendiere. So war Carl Brenten, ehe er sich's versah, verlobt. Ein halbes Jahr darauf hatten die beiden geheiratet, und auf der Bude war abermals ein Siphon Bier ausgetrunken worden. Das Ganze war wie ein angenehmes, fröhliches Gesellschaftsspiel gewesen. Na ja, und nun war Brenten Vater, kaum über die Zwanzig, und die eben achtzehnjährige Frieda Mutter.
Die Neckereien rissen nicht ab. Mancherlei derbe Anspielungen und Scherze schwirrten durch die Stube. Mehr als einmal rannten Kleberinnen unter lautem Gejuche davon. Schließlich wurde es so arg, dass das »Ekel« hereingestelzt kam, sein Pincenez abnahm und im Tone milden Vorwurfs sagte: »Aber meine Herrschaften, ich verstehe ja. Alles schön und gut. Aber es muss doch mal ein Ende finden, nicht wahr?«
Wenn daraufhin auch wieder gearbeitet wurde – Carl Brenten blieb für diesen Tag Mittelpunkt des allgemeinen Interesses, und er fühlte sich wohl dabei, nicht wenig geschmeichelt. Die Vaterschaft empfand er gar nicht mehr als Martyrium, als das sie ihm anfangs erschienen war. Wenn er der Reihe nach seine durchweg älteren Kollegen ansah, ärgerte ihn heute nur eines: sein spärlicher Bartwuchs. Ausnahmslos alle hatten Schnurrbärte, die meisten sogar sehr volle, unternehmungslustig und sehr männlich aussehende, mit nach oben gezwirbelten Ausläufern – sogenannte Kaiserbärte. Der dicke Anton, auf seinen Bart besonders stolz, trug gewöhnlich sogar während der Arbeitszeit eine Bartbinde und streifte alle naselang die Bartspitzen mit Pomade. Pah! Lächerlich! Ich bin doch auch ein Kerl! tröstete sich Brenten. Jawohl, wer konnte etwa wie er, auf einem Stuhl sitzend, links- und rechtshändig zugleich je eine Fünfzigpfundkugel stemmen? (Mit diesen Gewichten wurden die Zigarren in den Kisten gepresst.) Niemand von allen Kollegen konnte das. Es war eine Kraftleistung, für die der kurzstämmige Brenten den Ehrentitel »Abgehackter Riese« bekommen hatte. Dennoch: Seine Bartlosigkeit empfand er am heutigen Tag besonders schmerzlich, weil seiner Vaterschaft widersprechend.
VI
Am Abend dieses Tages machte sich die Familie Hardekopf bereit, der jungen Mutter ihren Gratulationsbesuch abzustatten. Nach dem Essen war eine besonders gründliche Reinigung vorgenommen worden. Johann Hardekopf hatte ein neues Normalhemd angezogen und das Sonntagschemisett mit dem abwaschbaren Kragen umgelegt, die beiden Ältesten hatten ihre gesteiften Vorhemdlätze vorgebunden, die, Oberhemden vortäuschend, den Ausschnitt ihrer Westen füllten. Während sie einen Streifen von einem alten Leinenhemd riss, schimpfte Frau Hardekopf.
»Ich versteh nicht, dass du dir immer auf die Pfoten kloppen musst!« Otto stand mit betrübtem Gesicht da, am Daumen und Zeigefinger der linken Hand dicke, dunkle Blutquesen. »Mach doch 'nen Kreidestrich auf den Dorn«, riet Ludwig. – »Idiot«, brummte Otto, dessen Finger gerade von Mutter Hardekopf verbunden wurden. – »Habt ihr denn keine Hammer mit Gummistielen?« fing auch noch Fritz an. – »Dir hau ich gleich eine runter!« schrie Otto. – »Ruhe! Ruhe!« erwiderte seine Mutter. »Haun tu nur ich! Du solltest lieber mit dem Hammer richtig haun.« Der Junge stöhnte und schwieg zerknirscht.
Ottos Finger waren verbunden, Fritz angezogen und gekämmt; die Familie machte sich auf den Weg. Vater und Mutter Hardekopf eingehakt voran, die drei Söhne hinterdrein, so zogen sie die Steinstraße hinunter. »Jetzt kommen die Großeltern und die Onkels«, meinte Fritz und erzielte bei seinen Brüdern einen lauten Heiterkeitserfolg. Auch die beiden Alten konnten ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Als die Hardekopfs in die Tür traten, stand Carl Brenten über den Waschkorb gebeugt und fummelte mit seinem Zeigefinger dem Söhnchen vor dem Gesicht herum. Frieda saß aufrecht im Bett, bereits bedeutend munterer als am Vortage.
Großvater Hardekopf warf, als er die beiden jungen Eheleute erblickte, seiner Frau einen erstaunten Blick zu, der wohl besagen sollte: Was willst du, ist doch alles in bester Ordnung. Carl Brenten richtete sich, als die Besucher eintraten, steil auf, entschlossen, jeden Angriff zu parieren. Großmutter Hardekopf trat als erste auf ihn zu. »'n Tag, Carl! Also, ich gratuliere!« – »Danke!« Carl Brenten war verwirrt. Seltsam – sollte gar alles anders kommen, als er gefürchtet hatte? – »Schade, dass du gestern Überstunden machen musstest.« Diese Bemerkung konnte Frau Hardekopf sich doch nicht verkneifen. Nun war die Reihe an Großvater Hardekopf. Er legte seine Linke unter den Vollbart, wie um seine Großvaterwürde zu betonen; die Rechte reichte er dem Schwiegersohn. »Meine herzlichsten Glückwünsche, Carl! Ich freue mich sehr!« – »Danke, Schwiegervater, danke sehr.« Die jungen Hardekopfs traten dem Alter nach zur Gratulation an. Carl Brenten schüttelte jedem die Hand. Dann wiederholte sich die Zeremonie am Bett der Mutter. Als letzter erst kam der Stammhalter an die Reihe, der die Begrüßungen mit lautem Schreien beantwortete. Großmutter hob das Enkelkind aus den Kissen, damit alle es sehen sollten. Jeder fand den laut brüllenden Wurm niedlich, obgleich das im Schreien verzerrte Gesicht durchaus nicht niedlich anzusehen war. Großvater nannte das Organ vielversprechend, kräftig und volltönend. »Du denkst wohl an den Gerber-Gesangverein?« sagte seine Frau. Und die ganze Gesellschaft lachte.
»Wir gehen ins Nebenzimmer, Frieda, wenn dich der Rummel zu sehr aufregen sollte«, schlug Frau Hardekopf vor. »Übrigens verschwinden wir bald wieder.« – »Aber wieso?« widersprach, anscheinend ganz entsetzt von dieser Aussicht, der Schwiegersohn. »Ich denke, wir trinken zur Feier des Tages eine schöne Tasse Kaffee und essen ein Stück Kuchen dazu.«
»Hast du soviel Kuchengeld?« fragte die Schwiegermutter lauernd.
»Na, soviel werde ich doch wohl haben.«
Sollte bei den vielen Überstunden wohl anzunehmen sein, dachte Frau Hardekopf. »A–also, dann aber mit dem Schreihals ins Nebenzimmer!« befahl sie.
Die Tochter widersprach. Sie wollte ihr Kind bei sich haben. Es würde sich bestimmt nebenan einsam fühlen.