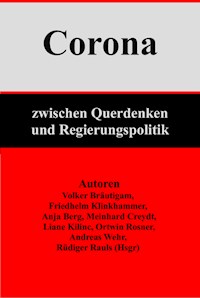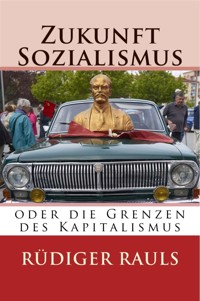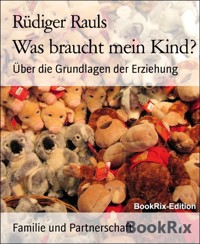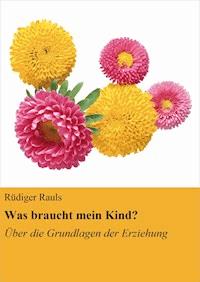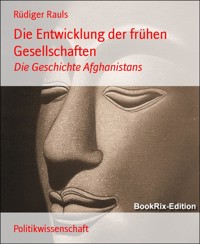
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was treibt im Untergrund der Gesellschaften? Was treibt sie in den Untergang? Eroberer unterwerfen Weltreiche. Sie ersetzen die alte Herrschaft durch ihre neue Herrschaft. Dadurch ändert sich aber an den gesellschaftlichen Verhältnissen meistens sehr wenig. Diese bleiben weitgehend intakt und unberührt. Aber die Veränderungen, die langsam und kaum merklich im Flussbett der Gesellschaften vor sich gehen, unterspülen deren Fundament und bringen die ehemaligen Festungen gegen die Veränderung zum Einsturz. Die Revolutionen und Befreihungskriege sind dann nur die Hammerschläge, die ein morsch gewordenes Gebäude zum Einsturz bringen. Ihre innere Stabilität und Festigkeit hatten sie schon lange verloren. Am Beispiel der Geschichte Afghanistans soll dieser Wandel der gesellschaftlichen Prinzipien verdeutlicht werden. Sie schufen neue Gesellschaften, die auf neuen Grundsätzen beruhten, Rein äußerlich hatte sich kaum etwas verändert hat, weil die Länder und die Völker doch dieselben blieben. Nur das Zusammenleben hatte sich neu geordnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Entwicklung der frühen Gesellschaften
Die Geschichte Afghanistans
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorbemerkung
Der Kapitalismus ist das derzeit beherrschende und vorherrschende Gesellschaftssystem. Wenn er auch unterschiedliche politische Systeme oder Regierungsformen hervorbringt, so ist die wirtschaftliche Basis all dieser Gesellschaften trotz ihrer Unterschiedlichkeit die kapitalistische Produktionsweise. Der Kapitalismus steckt in seiner schwersten Krise seit der Weltwirtschaftkrise von 1929 und der anschließenden Großen Depression der 1930er Jahre. Es ist nicht seine erste Krise. Aber die aktuelle scheint ihn an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gebracht zu haben. Ob er sich daraus noch einmal wird befreien können, ist noch nicht ausgemacht. Der großen Gründerkrise der 1870er Jahre folgten etwa zwei Jahrzehnte eines wirtschaftlichen wie auch politischen Gärungsprozesses. An dessen Ende stand der Imperialismus mit seinem neuen Aufschwung wirtschaftlicher Entwicklung durch die Herausbildung der Konzerne. Weltwirtschaftskrise und Depression fanden ihr Ende und ihre Überwindung durch die staatlichen Ausgabenprogramme, z.B dem "New Deal" in den USA. Das Ausgabenprogramm zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in Deutschland bestand in der militärischen Aufrüstung durch den Faschismus mit dem Ziel der Ausdehnung des deutschen Wirtschaftsraumes. Wenn auch ganz verschiedene Modelle der Krisenüberwindung vorlagen, so beruhten sie doch beide auf der Basis der kapitalistischen Produktionsweise mit derselben gesellschaftlichen Grundordnung, nämlich dem privaten Besitz an den Produktionsmitteln. Dieser wesentliche Grundsatz bleibt in allen kapitalistischen Gesellschaftsmodellen unberührt. Änderte er sich, würde sich somit auch das ureigene Wesen der betreffenden Gesellschaft ändern. Es wäre dann keine kapitalistische mehr sondern eine vom Wesen her andere, wie immer sie auch heißen würde. Dieses wesentliche Unterscheidungsmerkmal besteht in der Art und Weise, wie eine Gesell-schaft ihren Lebensunterhalt und Reichtum erwirtschaftet. In welchem Produktionsverhältnis stehen die Besitzer der Produktionsmittel und die direkten Produzenten zueinander? Nach welchen Grundsätzen erfolgt die Verteilung des erwirtschafteten Reichtums? In den urkommunistischen Stammesgesellschaften auf der unteren Ebene der menschlichen Gesellschaftsbildung waren alle Stammesangehörigen auch gleichzeitig Besitzer des gemeinsamen Stammeslandes. Die niedrige Produktivität der Arbeitskraft auf diesem gesellschaftlichen Niveau ließ kaum überschüssigen Reichtum entstehen. Die Verteilung bestand in der Verwaltung des Mangels und der Armut. Im Laufe der Entwicklung geht das gemeinsame Stammesland über in Privatland. Es entstehen Freie und Unfreie, die erste gesellschaftliche Spaltung. Die Freien eignen sich einen Teil dessen an, was die Unfreien erarbeiten. In der Sklavenhaltergesellschaft der Antike hatte die Arbeitskraft bereits eine so hohe Produktivität erreicht, dass sich die Versklavung des Menschen wirtschaftlich lohnte. Freie Arbeitskraft war rar, weshalb man übergeht zur Aneignung fremder Arbeitskraft durch Menschenraub. Der Produzent muss nicht mehr einen Teil seines Arbeitsergebnisses abgeben sondern wird als Träger der Arbeitskraft insgesamt in Besitz genommen von einem anderen Menschen, der gleichzeitig auch Besitzers des Arbeitsergebnisses dieser Arbeitskraft wird. Der Feudalismus beruhte auf der teilweisen Freiheit des Produzenten, der schon nicht mehr Eigentum des Feudalherrn ist sondern tributpflichtig und eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit. Aber er ist insofern wirtschaftlich selbständig als ein festgelegtes Verhältnis besteht zwischen seinen Abgaben an den Feudalherrn und dem Ergebnis seiner Tätigkeit, wenn sich auch diese Verhältnisse immer wieder ändern entsprechend den Kräfteverhältnissen zwischen Feudalherrn und Hörigen. Der Kapitalismus hingegen beruht auf der vollkommenen Freiheit des Lohnarbeiters, dem der Unternehmer nur so lange verpflichtet ist, wie er seine Arbeitskraft braucht. Für diese Arbeitszeit erhält er seinen Lohn. Das Produkt seiner Arbeit eignet sich der Unternehmer an. Beim Betrachten geschichtlicher und gesellschaftlicher Prozesse kommen neben den oben beschriebenen Schwierigkeiten im Erkennen der unterschiedlichen Sachverhalte persönliche Einstellungen des Betrachters hinzu. Die Vorgänge in Afghanistan zu verstehen, ist nicht einfach, wenn man das auf der Ebene der Erscheinungsformen versucht. Das gilt nicht nur für Afghanistan sondern für alle gesellschaftlichen Vorgänge. Was wir sehen, versuchen wir zu erklären mit den Erklärungsmustern, die uns bisher bekannt sind, wir projizieren. D.h. wie der Dia-Projektor das in ihm eingelegte Bild auf die Leinwand wirft, so werfen auch wir unsere inneren Bilder, hier unsere Vorstellung über eine Situation, auf eine Projektionsfläche, hier die neue Situation, die wir untersuchen möchten. Wir vergleichen das Neue mit dem uns Bekannten und stellen entweder fest, dass Neues und Altes identisch sind, dass es also nichts Neues gibt, oder aber wir erkennen Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen. Dann ist das Neue mit den alten Erklärungsmustern nicht ausreichend zu fassen. Altes und Neues weichen voneinander ab. Es sind neue Aspekte hinzugekommen, die gedeutet und eingeordnet werden müssen Diese Wahrnehmung bedarf zu allererst der Ehrlichkeit, der sachlichen Feststellung, dass da Neues vorliegt. Um das Neue zu heben, bedarf es der Gründlichkeit, des ernsthaften Willens, dem Neuen auf den Grund zu gehen, es zu ergründen. Leichter ist das Alltägliche: Es ist doch alles Gleich, es ist immer wieder dasselbe. Erkenntnis wird dem schnell geschriebenen Buch geopfert, das auf den Markt muss, noch ehe das Interesse am Thema verbraucht ist. Alter Wein kommt dann in neuen Schläuchen daher. Schnelle Erklärungen bringen keine Erkenntnis außer der, dass es nichts Neues gibt. In Bezug gesetzt zu Afghanistan bedeutet dies: Wer z.B. für das Verhalten der untergegangenen UdSSR im Afghanistankonflikt nur Erklärungsversuche findet, die aus der Politik der Zarenzeit abgeleitet sind, also aus der Situation des 19. Jahrhunderts, und diese überträgt auf die Welt des Kalten Krieges, verläuft sich in historische Sackgassen. Solche Verfahren beweisen nur, dass die Triebkräfte von Geschichte und Entwicklung nicht verstanden werden. Die Konflikte in der Zeit des Imperialismus zwischen Russland und England als Rivalen im Kampf um Einfluss in Afghanistan waren andere als die der Systemkonkurrenz zwischen der sozialistischen Führungsmacht Sowjetunion und der kapitalistischen Führungsmacht USA. Wer diesen Unterschied nicht sieht, nicht sehen will oder gar verschleiern will (auch das kommt vor), wird nicht das Wesentliche erkennen im Konflikt um Afghanistan in den 1980er Jahren. Deshalb ist es wichtig, um historische Prozesse zu verstehen, die Triebkräfte und Interessen offenzulegen, die in diesen Vorgängen wirken und zur Verwirklichung streben. Ohne Verständnis dessen, das da treibt und Gestalt annehmen möchte, bleibt die Betrachtung geschichtlicher Abläufe Kaffeesatzleserei. Deshalb will vorliegende Auseinandersetzung mit dem Thema Afghanistan aufzeigen, welche Grundzüge die afghanische Geschichte geprägt haben. Sie beschränkt sich dabei bewusst auf die Zeit bis 1973, dem Ende des Königtums in Afghanistan. Mit dem Putsch der mittleren Militärränge und dem Ende des Königtums beginnt eine neue Phase der afghanischen Politik, die aber nicht zwangsläufig auch ein Außerkraftsetzen der bisher wirksam gewesenen Kräfte bedeutet. Das aber wäre noch genauer zu untersuchen. Dieser Putsch war Ausdruck der bis dahin stattgefundenen Entwicklung und sein Auslöser ist bis heute nicht überwunden. Vielmehr sind die Ursachen durch die Intervention der NATO-Staaten verdeckt worden und an seiner organischen Lösung behindert worden. Drei soziale Kräfte innerhalb der afghanischen Gesellschaft hatten sich zu den beherrschenden Faktoren der politischen Situation entwickelt. Ihr Heranwachsen zu einem Kräftegleichgewicht führte zu einem Zustand gesellschaftlichen Stillstands und Erstarrung des politischen Fortschritts. Keine dieser Kräfte Königtum, Stammesaristokratie und das städtische Bürgertum mit ihren jeweils entgegengesetzten Interessen konnte alleine gegen die beiden anderen herrschen. Und keine dieser sozialen Kräfte stellte die Mehrheit des afghanischen Volkes dar. Sie waren jede für sich und alle zusammen die Minderheit gegenüber der großen Masse der in feudaler Abhängigkeit lebenden Bauern, Tagelöhner und Landlosen. Aber diese Masse der Verarmten und politisch Entrechteten hatte keine Ansätze einer eigenen ökonomisch-politischen Bewegung entwickelt, die die Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen zum Ziel gehabt hätte, wie es beispielsweise bei den deutschen Bauern in ihren Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts gegen die Feudalherren zum Ausdruck gekommen war. Diese Mehrheit der Landlosen und Abhängigen bildete keine politische Formation heraus, die versucht, diesen eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen Geltung zu verschaffen. Sie findet sich nicht als eine eigene, dem Feudaladel entgegengesetzte Klasse, deren wirtschaftliches und politisches Interesse sich in einer Forderung nach Landreform und der Aufhebung der wirtschaftlichen Abhängigkeit zum Ausdruck bringt. Und weil sie sich nicht als eine eigene Klasse mit eigenen Interessen versteht, die denen der Großgrundbesitzer und Feudalaristokratie entgegengesetzt ist, bleibt diese Bevölkerungsmehrheit deshalb immer der Spielball anderer gesellschaftlicher Kräfte, die sie für die eigenen Interessen einzusetzen versuchen. Besonders in den Auseinandersetzung zwischen dem afghanischen Königtum und der Stammesaristokratie hing der Erfolg beider Seiten immer davon ab, inwieweit es gelang, Teile dieser politisch wankelmütigen Bevölkerungsmehrheit für die eigenen und gegen die Interessen des politischen Widersachers zu mobilisieren. Einzig das sich in den Städten entwickelnde Bürgertum schuf erste Ansätze einer an den eigenen Interessen orientierten politischen Organisierung. Aber es gelang dieser sich formierenden Klasse nicht wie dem Bürgertum der französischen Revolution eine Interessenidentität mit der vom Feudalismus in Abhängigkeit gehaltenen bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit herzustellen. Sehr früh erkannte die Feudalklasse Afghanistans die Gefahr, die ihr aus einem nicht nur ökonomisch sondern auch politisch starken Bürgertum in den Städten entstehen konnte. Rigoros wurden erste Ansätze von Parteienbildung zerschlagen. Damit war das Bürgertum fürs erste seiner politischen Kraft beraubt. Aber die Weiterentwicklung des Kapitalismus in Afghanistan führte unweigerlich zu einem weiteren Anwachsen der ökonomischen Macht des Bürgertums. Damit nahm auch der politische Druck zu, der aus dieser sozialen Klasse auf die Feudalklasse ausgeübt wurde. Der Militärputsch war der Versuch, den Gordischen Knoten der gesellschaftlichen und politischen Erstarrung zu zerschlagen. Durch einen Gewaltakt, einen Überraschungscoup sollte eine gesellschaftlich festgefahrene Situation aufgelöst werden, in der keine der beteiligten gesellschaftlichen Kräfte stark genug war, aus eigener Kraft einen Ausweg aus der Stagnation anbieten und erringen zu können. Dieser Gordische Knoten war geknüpft aus den Strängen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen, die aus der Geschichte der afghanischen Gesellschaft hineinreichten in die Gegenwart des Jahres 1973. Es sind nach außen hin - dem Anschein nach - die Politik und die Entscheidungen der verschiedenen afghanischen Könige oder der Ministerpräsidenten oder Volkshelden und Stammesführer, die die Geschichte des Landes bestimmten. Aber all diese Akteure der Macht sind neben ihren eigenen Interessen gleichzeitig auch Ausführende von Strömungen, Interessen und Entwicklungen, die stärker sind als sie selbst. Diesen sind sie gezwungen, sich zu beugen, wollen sie nicht zerbrechen an dem Maß aller Dinge, das die gesellschaftliche Entwicklungen bestimmt, der Wirklichkeit. In diese hinein wurde der Mensch geboren und wird es immer noch. In diesen Wirklichkeiten musste und muss er versuchen, zu überleben oder - in den moderneren und nicht so lebensfeindlichen Gesellschaften unserer Zeit – sich zurechtzufinden. Die Wirklichkeit als Summe aller Kräfte, die in einer geschichtlichen Situation wirken, bestimmt die Entwicklung, nicht Modelle und Theorien. Deren Aufgabe vielmehr ist es, die maßgeblichen Kräfte zu benennen und ihre Unterschiedlichkeit und Verschiedenartigkeit in Kraft und Erscheinen aufzuzeigen. Das soll Thema der vorliegenden Arbeit sein. Aber Wirklichkeit ist nicht neutral und unstrittig. Sie ist nur so lange objektiv, solange sie unabhängig ist von der Betrachtung und Einschätzung durch den Menschen. Wenn der Mensch Wirklichkeit betrachtet, betrachtet er sie mit seiner Vorstellung von Wirklichkeit. Und diese Vorstellungen sind nicht unabhängig von Interessen und Erfahrungen. Dennoch bleibt die Aufgabenstellung davon unberührt. Ein Ignorieren der Wirklichkeit um der Interessen willen ist immer möglich, wirft aber die Frage trotzdem immer wieder auf, wenn auch später und immer mehr verzerrt: Was ist Wirklichkeit, was wirkt in der Wirklichkeit, was will da werden, was dringt da von innen nach außen, aus dem Dunkel des Nochnicht in die Offensichtlichkeit? Daten, Fakten, ungewertet, neutral, aber zusammenhangslos scheinen zwar objektiv, unanfechtbar und ideologiefrei, sind als solche aber wertlos für Erkenntnis. Diese entsteht über das Verbinden der Daten und Fakten untereinander zu Vorgängen und Erklärungen, zu einer Ordnung. Daten und Fakten, wenn sie gewissenhaft und ehrlich erhoben sind, dienen als stabiles verlässliches Gerüst, sind Pfeiler, über die die Brücke der Erkenntnis gelegt wird in Unbekanntes, in unerschlossenes Gebiet. Pfeiler allein sind nutzlos, solange sie keine Brücke tragen. Deshalb müssen Fakten und Daten gedeutet werden, müssen in einen Zusammenhang gestellt werden, der zu einem sinnvollen, erklärenden und erhellenden Bild über die Wirklichkeit zusammenwächst. Deutung der Wirklichkeit führt aber nur dann zu Annäherung an die Wirklichkeit, wenn die Erscheinungen der Wirklichkeit zu einem sinnvollen, erklärenden, erhellenden und in ihren Wirkungen aufeinander nachvollziehbarem Ganzen zusammengeführt werden können. Das stößt Fenster auf und gibt den Blick frei in bisher nicht Gesehenes.
Die Entwicklung der gesellschaftlichen Strukturen
Die Ausgangslage
Geschichtliche Ereignisse spielen sich ab auf dem Boden ganz bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese gilt es zu ermitteln als Grundlage für die Abläufe der afghanischen Geschichte, zu dem Zeitpunkt als der Raum des heutigen Afghanistan und die dort lebenden Völker zum Gegenstand von Geschichtsschreibung wurden. Die meisten geschichtlichen Ereignisse lassen sich erklären als die Ausflüsse von Kräften, die in einer bestimmten historischen Situation wirken. Sie drängen und führen in den Gesellschaften zu Veränderungen, die die Gesellschaften zerreißen können und damit zum Aufbau neuer Gesellschaften mit neuen Klassen, neuen Besitzverhältnissen zwingen. Die äußeren, sichtbaren Ereignisse sind das Ergebnis von Veränderungen und Verschiebungen in den Gesellschaften oder aber der Verhinderung von Veränderung. Diese Vorgänge sind getrieben von langsam wirkenden, nur schwer wahrnehmbaren Prozessen auf dem Grunde der Gesellschaften. Die Lebensbedingungen der Menschen ändern sich, manchmal langsam, manchmal schnell, beeinflusst durch äußere Kräfte, über die sie selbst keine Macht haben. Aber diesen Veränderungen müssen sie sich anpassen, wollen sie nicht untergehen. Sie führen zu neuen Notwenigkeiten der gesellschaftlichen Organisation, die das bisher Gewohnte als überholt erscheinen lassen, das bisher Richtige wird falsch. Auf dieser materialistischen Grundlage sollen die Veränderungen in der afghanischen Geschichte betrachtet und gedeutet werden. Allein die Benennung der Fakten reicht nicht aus, sie müssen auch gedeutet werden. Sie müssen in einen Zusammenhang gestellt werden, die die gesellschaftliche Wirklichkeit beschreiben und die Prozesse der Veränderung erklären. Ein Bild aus der Unmenge der bunten Mosaiksteine geschichtlicher Ereignisse entsteht nur, wenn eine Ordnung dargestellt werden kann. Ohne diese Ordnung bleiben die Mosaikteile ein großer, unbedeutender Haufen bunter Steine ohne Erkenntniswert. Wenn die im Untergrund der Gesellschaften waltenden und wirkenden Kräfte erkannt werden und in eine Ordnung umgesetzt werden, dann kann Geschichte auch als das dargestellt werden, was sie ist, die Entwicklung des Menschen aus dem Zustand des Tiers hin zu dem sich selbst bestimmenden und immer wieder neu erschaffenden Wesen, das auf dem Weg ist zur Menschwerdung des Menschen. Dann ist Geschichte nicht mehr die Auflistung, Anhäufung und Beschreibung von scheinbar zufälligen Ereignissen, die beziehungslos nebeneinanderstehen, sondern Darstellung eines Zuges, der ein Ziel hat. Die Geschichte Afghanistans beginnt nicht mit der Geschichtsschreibung über das Land. Geschichte hat es schon vorher gegeben. Nur mit der Dokumentation der geschichtlichen Ereignisse fällt es uns leichter einzuordnen, an welchem Punkt der Entwicklung man angekommen ist. Dazu muss man aber über ein Handwerkszeug verfügen, das die Einordnung der aktuellen Situation im Voranschreiten der gesellschaftlichen Entwicklung ermöglicht. Hier soll sich des materialistischen Geschichtsbildes bedient werden, das die Entwicklung menschlicher Gesellschaften auf der Grundlage der Eigentumsverhältnisse und der sich daraus ergebenden Klassen und Gesellschaften vornimmt. Als Grundlage dafür dient das Standardwerk von Engels „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“. Auf welchem Entwicklungsniveau standen die afghanischen Völker zu Beginn ihrer Geschichtsschreibung? Welche Entwicklungsschritte sind seitdem gemacht worden, wie hat sich ihre Geschichte dargestellt auf der Basis dieser Schritte, welche deuten sich an? Und wie sind diese Völker Afghanistans und ihre Gesellschaften verschieden im Vergleich mit der gesellschaftliche Entwicklung und dem Zustand anderer Gesellschaften, hier besonders der westlichen? Bis zum afghanischen Bürgerkrieg und der sowjetischen Intervention hatten in Afghanistan kaum Zerfallserscheinungen der über Jahrhunderte vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen festgestellt werden können. (Über die Situation nach dem Abzug der sowjetischen Truppen können an dieser Stelle noch keine Aussagen gemacht werden.) Trotz der Verschiedenartigkeit der in Afghanistan lebenden Volksgruppen glichen sie sich sehr stark in ihren Lebensformen. Selbst in den Städten, die schon eher westlich orientiert waren, hatten sich die traditionellen Lebensstile und Werte noch weitgehend erhalten. Einzig bei den Vollnomaden und einigen Völkern in den abgelegenen Tälern des Hindukusch wurden stark vom allgemeinen Leben Afghanistans abweichende Lebensformen vorgefunden. Diese Gleichförmigkeit ist umso erstaunlicher, als sich in der afghanischen Gesellschaft unterschiedliche Entwicklungsstufen mit ihren unterschiedlichen gesellschaftllichen Darstellungsformen herausgebildet hatten. So lassen sich bei den Paschtunen sowohl Gesellschaften mit urkommunistischen Besitzverhältnissen vorfinden als auch solche mit feudalistischer Gesellschaftsstruktur. Am häufigsten vertreten ist aber der Zustand der urkommunistischen Besitzverhältnisse, die sich aber bereits in Auflösung befinden, im Übergang vom gemeinsamen Besitz des Gesamtstammes an Grund und Boden hin zum Privatbesitz an Ackerland. Diese Unterschiedlichkeit in ihrer Bedeutung und Auswirkung zu erkennen, wird erschwert durch die Tatsache, dass es sich bei all diesen in ihrem Wesen vollkommen verschiedenen Gesellschaften immer um Paschtunen handelt, die unter diesen verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen leben. Sie sind von ihrer Abstammung her eine ethnische Einheit mit gleicher Sprache, Religion und Sitten, sind aber andererseits untereinander politisch so stark zersplittert, dass sie keine organisatorische Einheit als ein gemeinsames Paschtunentum bilden, ein Volk, aber in drei verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungszuständen. Aus unseren heutigen europäischen Nationalstaaten ist uns nur die umgekehrte Situation vertraut: in den einzelnen Staaten leben verschiedene Völker, aber alle unter demselben gesellschaftlichen System des Kapitalismus. Der Nationalstaat ist mittlerweile weltweit vorherrschend. Aber trotz ihrer Verteilung über die ganze Welt, trotz all ihrer verschiedenen regionalen Bedingungen, nationalen, religiösen, rassischen und ethnischen Eigenheiten ruhen sie fast alle auf der Grundlage desselben kapitalistischen Gesellschaftssystems. Ganz anders ist nun die Situation bei den Paschtunen, und als zusätzliche Verwirrung kommt hinzu im Falle Afghanistans, dass bei den anderen, nicht-paschtunischen Völkern ähnliche gesellschaftliche Verhältnisse herrschen, die eigentlich als typische Eigenart der Paschtunen angesehen werden. Es ist also nicht eine bestimmte ethnische Besonderheit, quasi eine genetische Disposition, die sich in dieser Organisation der Gesellschaft ausdrückt, wie man vermuten könnte. Elphingstone hat beispielsweise die unterschiedlichen Verfahren der Entscheidungsfindung bei den Paschtunen als Anlass der Unterscheidung in „demokratische“ und „feudalistische“ Stämme genommen. Dabei gibt es ähnliche Verfahren auch bei nicht-paschtunischen Stämmen. Und neben diesen urkommunistischen, feudalistischen und Übergangsstrukturen finden wir zudem in den Städten bereits erste Ansätze eines Bürgertums, entstanden aus einfachen handwerklich-kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Diese Gesellschaftsstruktur der Städte stellt sich dann auch äußerlich bereits ganz anders dar. Zwar sind die Werte von Abstammung und Familie auch hier immer noch bestimmend, werden aber immer mehr verdrängt durch das Interesse und dessen Ausdrucksversuch in Interessensorganisationen wie Parteien. Dieser Ausdruck politischer Aktivität spielt in der Stammesgesellschaft noch keine Rolle, hier gilt noch größtenteils das Konsensprinzip. All diese unterschiedlichen, in ihrem Wesen zum Teil entgegengesetzten Gesellschaftsformen finden wir in einem einzigen Staat. Unvorstellbar für den Mitteleuropäer in einem Land wie Deutschland Kapitalismus in einer Region des Landes vorzufinden, in anderen Feudalgesellschaften oder gar Stammesgesellschaften, alle mit eigenen Werten, Gesetzen, Regeln und Wirtschaftsgrundlagen. Und das macht das eigentlich Verwirrende aus an der afghanischen Situation, dass das Gebilde Afghanistan etwas vorgibt, was es nicht ist, ein Staat im herkömmlichen Sinne eines gewachsenen Nationalstaates. Ähnlich den Staaten, die als Gebilde willkürlicher Grenzziehungen der ehemaligen Kolonialmächte in Afrika das Licht der Welt erblickten, ist Afghanistan der unbrauchbare Rest am Hindukusch, den nach den ganzen kolonialen Auseinandersetzungen zwischen dem russischen und englischen Imperium keiner von beiden haben, weil verwalten, wollte. Die Unterschiedlichkeit der gesellschaftlichen Entwicklungen im afghanischen Raum hatte sich entwickelt in Abhängigkeit von der Verschiedenartigkeit der natürlichen Umgebung. Auf diese Vorgaben der Natur hatten die Völker reagieren müssen, die im Verlauf der Geschichte diesen Raum besiedelt hatten. Diese Unterschiedlichkeit in der Entwicklungsstufe wird repräsentiert durch die beiden großen paschtunischen Stammesföderationen der Durrani (früher Abdali) im Westen und Süden Afghanistans und der Ghilzai im Osten des Landes. Ähnliche Strukturen wie die der Ostpaschtunen (Ghilzai) finden sich auch bei den turkmenischen und usbekischen Stämmen. Eine Ausnahmeerscheinung im afghanischen Stammesspektrum bilden die Tadschiken. Sie haben keine Stammesstrukturen (mehr). Sie waren ursprünglich im frühen Afghanistan die vorherrschende Bevölkerungsgruppe, wurden aber mehr und mehr von den Paschtunen in feudale Abhängigkeit gebracht. Sie hatten schon früh Städte gegründet (Kabul). Ihr nicht (mehr) vorhandenes Stammes- und Volksbewusstsein hat den Mitgliedern anderer Volksgruppen, die durch den Wandel innerhalb der Stämme in den Status von Unfreien abgesunken waren, später die Ansiedlung in den Städten ermöglicht. So hatten unter anderem die natürlichen Gegebenheiten der weiten Ebenen des Südens und Westen die Entwicklung von Großgrundbesitz begünstigt, während in den engen Tälern des Hindukusch diese Voraussetzungen nur beschränkt gegebenen waren. Dennoch hatte auch hier, besonders in den Becken (Kabul) und den Flussebenen, sich im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen der Großgrundbesitz entfaltet, auch wenn die natürlichen Voraussetzungen dafür andere waren als in den weiten Ebenen. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war dort, wo sich der Grundbesitz als privater Besitz einzelner noch nicht durchgesetzt hatte, der gesamte Stamm noch immer Besitzer des Landes. Die Nutzungsrechte für das Land wurden nur auf Zeit vergeben und danach wieder neu unter den Familien verteilt, sodass alle Mitgliedsfamilien in den Genuss des besseren Landes kommen. So berichtet Wald, dass zur Zeit seiner Untersuchung in den 1960er Jahren noch ein solches System der gemeinsamen Nutzung im Becken von Khost geherrscht hatte. In diesem System wurde das Land des Stammes nach einem festgelegten Umverteilungssystem nach einer gewissen Zeit auf alle Nutzungsberechtigten neu verteilt. Der Stammesbesitz war also noch der Besitz aller gemeinsam und wurde auch von allen als gemeinsamer Besitz gesehen, nur dass er schon nicht mehr von allen gemeinsam, sondern von einzelnen Gliederungen des Stammes getrennt bestellt wurde. Auf Grund dieser Form der gleichberechtigten Landverwaltung und der gesellschaftlichen Organisation der Stammesmitglieder bezeichnete Elphingstone diese Stämme als „demokratisch“. Die gemeinsame Nutzung des Bodens, der noch nicht in Privatbesitz übergegangen ist, hatte auch noch nicht zur Herausbildung und Verfestigung von Verwaltungsinstitutionen geführt, so dass die Verwaltung der Stammesangelegenheiten immer noch Anliegen, Recht und Aufgabe aller Stammesmitglieder war. Findet Elphinstones Bezeichnung „demokratisch“ seinen Ursprung in der Darstellungsform dieser Gesellschaft als einer sich selbst verwaltenden, so geht Engels aus von den Besitzverhältnissen als Grundlage jeder Gesellschaft. Er bezeichnet diese Stammesgesellschaften deshalb als „urkommunistisch“, weil die Lebensgrundlage, der Grund und Boden, noch immer in der Hand aller Stammesangehörigen ist, also noch keine Aufteilung in Privatbesitz stattgefunden hatte. Das Verständnis der Entwicklung der Stämme Afghanistans – und nicht nur deren Verständnis - wird erschwert durch die Unterschiedlichkeit des Entwicklungsstandes, der bei den einzelnen Stämmen vorherrschte bei ihrem Auftauchen in der wahrnehmenden und dokumentierenden Geschichte. Bis zum einsetzten der Geschichtsschreibung über Afghanistan sind frühere Stufen menschlicher Entwicklung, die Engels in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit feststellt hatte wie z.B. der Übergang von der Horde zur Familie, bereits abgeschlossen. So fällt es einigen Autoren offensichtlich schwer, diesen Stand beim Zeitpunkt ihrer Betrachtung als Ergebnis eines Prozesses zu verstehen, der nicht abgeschlossen sondern immer noch im Fortschreiten begriffen ist. Aber weil sie in nicht als Abschnitt in einem Prozess verstehen, erklären sie ihn als Besonderheit oder Volkscharakter dieser Stämme oder Völker, die sie untersuchen und über die sie berichten. Deshalb verstehen sie die unterschiedlichen gesellschaftlichen Zustände der Stämme und Bevölkerungsgruppen als eine willkürliche Vielfalt ohne inneren Zusammenhang untereinander und nicht als das, was sie sind, unterschiedlich weit vorangeschrittene Stationen des Menschen auf seinem Weg zur Menschwerdung. So ist der auch heutige Zustand der Menschheit nicht der gesellschaftliche Endzustand, den viele Politiker und Wissenschaftler wollen glauben machen, dem keine andere, höher entwickelte Gesellschaftsform mehr folgen können soll, weil sie es sich nicht vorstellen können oder wollen. Eine andere Erschwernis bei der Betrachtung der Vorgänge in Afghanistan wie auch in jedem andern Land oder jeder anderen Gesellschaftsform ist die Betrachtungsweise des Betrachters selbst. Wird eine Darstellung geliefert auf der Ebene der Erscheinungsformen, wie es bei Elphinstone der Fall ist, oder wird ein Vorgang betrachtet auf der Ebene der Triebkräfte, die unter den Erscheinungen wirken und diese Erscheinungen hervorbringen. Die äußeren Erscheinungen werden dann verstanden als Symptome der treibenden Kräfte und diese Symptome lassen dann Rückschlüsse zu auf die Kräfte, die da am Werke sind. So ist Gesellschaftsanalyse bei Engels zu finden. Schnupfen, Husten, Heiserkeit sind demnach nicht nur zu betrachten als isolierte Phänomene und als solche nicht untereinander verbundene Erscheinungen in ihrer Verschiedenartigkeit und Unterschiedlichkeit zu beschreiben und festzustellen, sondern sie sind trotz ihrer Verschiedenheit gemeinsam zu sehen und zu verstehen als verschiedene Symptome desselben grippalen Infektes. Auch in vorliegender Auseinandersetzung mit dem Thema Gesellschaftsbildung soll ausgegangen werden von der Entwicklung der Eigentumsverhältnisse als grundlegendem Aspekt, aus der die Entwicklung des gesellschaftlichen Aufbaus abgeleitet und als zwangsläufig dargelegt werden soll.
Die urkommunistische Gesellschaft