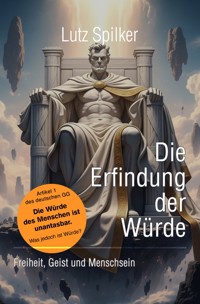
0,99 €
Mehr erfahren.
Stellen Sie sich zwei Männer in einer Kneipe vor. Sie suchen nach einer Idee, wie man viele Menschen für sich gewinnen kann, ohne einen Cent zu investieren. »Verschenken wir Hoffnung«, schlägt der eine vor, »die kostet nichts und jeder kann sie nach eigenem Geschmack ausmalen: nach Kirsche, nach Waldmeister – ganz nach Belieben.« Der andere wiegt den Kopf. »Nicht edel genug. Es muss etwas sein, das wie ein Orden wirkt, das Brust und Seele schwellen lässt.« – »Würde!«, ruft der Erste und strahlt, als hätte er das Geschäft seines Lebens entdeckt. So, könnte man sagen, begann die Erfindung der Würde: ein Begriff ohne Substanz, aber mit ungeheurer Wirkung. Niemand hat sie je gesehen, niemand konnte sie je anfassen – und doch gilt sie heute als das höchste Gut des Menschen. Dieses Buch geht der Frage nach, wie aus einem Wort eine moralische Supermacht wurde. Es erzählt von der Geschichte der Würde, von ihren Versprechungen und von ihrer Rolle als Mogelpackung. Und es fragt, ob wir mit ihr wirklich beschenkt wurden – oder ob wir uns seit Jahrhunderten von einem glänzenden Nichts beeindrucken lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 43
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Erfindung
der Würde
•
Freiheit, Geist und Menschsein
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DER WÜRDE – FREIHEIT, GEIST UND MENSCHSEIN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Lutz Spilker
Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker
Verlag:
Lutz Spilker
Römerstraße 54
56130 Bad Ems
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der
Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Die Mogelpackung der Begriffe
Ein Wort wie ein Mantel
Die Ökonomie des ›Nichts‹
Der doppelte Boden
Zwischen Illusion und Notwendigkeit
Ein glänzendes ›Nichts‹
Würde – eine Geburt aus dem Nichts
Sprachgeschichte, philosophische Aufladung, politische Instrumentalisierung
Der leere Raum vor der Würde
Ein Wort taucht auf
Die Stunde der Philosophen
Die Geburt aus dem Nichts
Ein Zwischenton der Geschichte
Ein paradoxer Triumph
Hoffnung als Ersatzwährung
Warum Menschen bereit sind, sich mit immateriellen Versprechungen abspeisen zu lassen
Der unsichtbare Lohn
Die Kunst der Vertröstung
Hoffnung als Herrschaftstechnik
Die süße Last der Selbsttäuschung
Hoffnung als Droge
Die Händler des Erhabenen
Religionen, Ideologien und Machtapparate als Verwalter des Unsichtbaren
Der unsichtbare Vorrat
Sakrale Macht
Ideologien als säkulare Priesterschaften
Die Würde als Pfand
Zwischen Verheißung und Kontrolle
Der Preis des Glaubens
Wie man Würde vergibt, entzieht, verhandelt – und was das über ihre Substanz verrät
Würde als Gnade
Der Entzug als Waffe
Würde im Tauschgeschäft
Die stille Selbstverhandlung
Würde und Macht
Der Preis des Glaubens
Das Geschäft mit der Selbsttäuschung
Von Orden und Ehrenzeichen bis hin zu Menschenrechten: Verpackungen einer leeren Formel
Von Glanz und Metall
Verpackung und Inhalt
Menschenrechte als höchste Form der Formel
Zwischen Zynismus und Glaube
Das paradoxe Erbe
Und was bleibt?
Die Frage nach echter Freiheit jenseits der Mogelpackungen
Die stille Freiheit
Würde und Freiheit – eine heimliche Verwandtschaft
Die Zumutung der Eigenverantwortung
Und was bleibt?
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Der Spazierstock steht für die Würde des Menschen,
der Schnurrbart für die Eitelkeit,
und die ausgelatschten Schuhe für die Sorgen.
Charlie Chaplin
Sir Charles Spencer ›Charlie‹ Chaplin Jr., KBE, (* 16. April 1889 in London, Ver-einigtes Königreich Großbritannien und Irland; † 25. Dezember 1977 in Corsier-sur-Vevey, Schweiz) war ein britischer Komiker, Schauspieler, Regisseur, Drehbuch-autor, Filmeditor, Komponist und Filmproduzent. Er gilt als erster Weltstar des Kinos und zählt zu den einflussreichsten Filmemachern der Geschichte.
Das Prinzip der Erfindung
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.
Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.
Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.
Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Eine Erfindung ist keine Entdeckung.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.





























