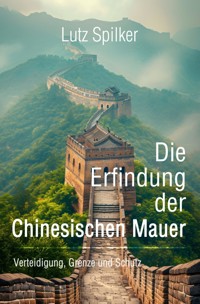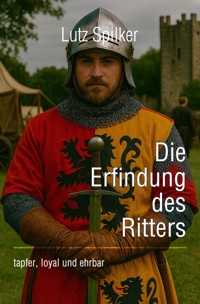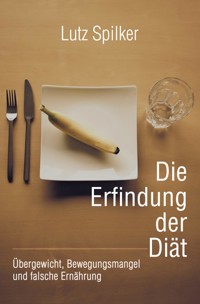
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Warum braucht der Mensch eine Diät – und seit wann? Über Jahrtausende war Nahrung ein knappes Gut, heute ist sie im Übermaß verfügbar. Mit diesem Wandel trat eine neue Frage auf: Wie viel ist genug? Dieses Buch erzählt die Geschichte der Diät als kulturelle Erfindung. Es geht nicht um Rezepte oder Anleitungen, sondern um die Entwicklung einer Praxis, die zwischen Notwendigkeit und Inszenierung schwankt. Von antiken Heilkundigen über klösterliche Speiseordnungen bis zu modernen ›Crash-Kuren‹ zeigt sich ein Grundmuster: der Versuch, Körper und Maß zu disziplinieren – und zugleich das fortwährende Scheitern daran. Diäten offenbaren mehr als bloße Ernährungsgewohnheiten. Sie spiegeln gesellschaftliche Normen, ökonomische Interessen und individuelle Hoffnungen. Wer eine Diät beginnt, bewegt sich in einem Feld aus Selbstkontrolle, sozialem Druck und industrieller Verheißung. Die berühmte Formel »Friss die Hälfte« klingt simpel, doch hinter ihr verbergen sich komplexe Fragen nach Freiheit, Zwang und Identität. ›Die Erfindung der Diät‹ beleuchtet diesen vielschichtigen Zusammenhang: Warum ist das Versprechen der Gewichtsreduktion so wirkungsmächtig? Wieso hält sich der Jo-Jo-Effekt als stille Gegenmacht? Und was verrät uns die Diät über den Menschen, der mehr zu essen hat, als er braucht? Ein kluges Buch über ein alltägliches Phänomen – und über die Kultur, die es hervorgebracht hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erfindung
der Diät
•
Übergewicht, Bewegungsmangel
und falsche Ernährung
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG Der DIÄT
ÜBERGEWICHT, BEWEGUNGSMANGEL UND FALSCHE ERNÄHRUNG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Lutz Spilker
Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker
Verlag:
Lutz Spilker
Römerstraße 54
56130 Bad Ems
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der
Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Nahrung im Überfluss?
Die Jäger und Sammler und ihre natürliche Balance
Sesshaftwerdung und Vorratshaltung
Der Beginn der Ernährungslenkung
Von der Jagd zur Ernte
Nahrung als Machtfaktor
Disziplin am Vorrat
Kulturtechniken der Lagerung
Beginn der Knappheit durch Planung
Zwischen Fülle und Sorge
Antike Heilkunst
Diätetik als medizinisches Ordnungsprinzip
Das Gleichgewicht der Säfte
Hippokrates und die Schule von Kos
Die Diät als ärztliche Autorität
Galen und die Ausweitung der Diätetik
Die Diät als Kulturtechnik
Maß und Mitte
Erbe und Nachwirkung
Griechische Philosophien
Maßhalten als Tugend
Das Ideal der Mitte
Pythagoreer und die Ordnung des Lebens
Maß und Ethik bei Sokrates und Plato
Aristoteles und die Tugend der Mitte
Epikur und die Kunst des Genusses
Stoa und die Ordnung des Selbst
Maßhalten als kulturelles Leitbild
Das bleibende Echo
Römische Tafelkultur
Überfluss und Gegenreaktionen
Überfluss im Detail
Der kulinarische Überdruss
Gegenbewegungen: Philosophische Stimmen
Gesellschaftliche Regulierung
Einfachheit als Ideal
Tafelkultur und Diät
Askese im frühen Christentum
Fasten als spirituelle Diät
Fasten als Sprache des Glaubens
Fasten und innere Reinigung
Askese als Abgrenzung
Die Wüste als Lehrmeisterin
Fasten und Gemeinschaft
Körper und Geist im Widerstreit
Fasten als Vorläufer der Diät
Das Erbe der Askese
Klösterliche Speiseordnungen
Disziplin auf dem Teller
Maß und Mäßigung
Rhythmus und Regelmäßigkeit
Beschränkung und Auswahl
Die Bedeutung der Fastenzeiten
Ordnung als Ausdruck von Gemeinschaft
Zucht des Körpers – Pflege der Seele
Ein Spiegel der Zeit
Wirkung über die Klostermauern hinaus
Stimmen der Kirchenväter
Theologische Deutungen des Fastens
Mittelalterliche Klöster
Regeln, Rituale und Ernährungslenkung
Regelwerke als Grundlage der Ernährung
Rituale der Mahlzeiten
Heilkundige Dimension der Ernährung
Arbeit und Ernährung
Maßhalten und Gemeinschaft
Die Klöster als Labore der Ernährungsordnung
Renaissance der Ernährungslehre
Wissenschaftliche Ansätze und kulinarische Experimente
Wiederentdeckung antiker Quellen
Erste systematische Diäten
Kulinarische Experimente und Genuss
Diätetik als Verbindung von Wissenschaft und Alltag
Medizinische Beobachtung und Prävention
Soziale Dimension und Status
Renaissance als Brücke
Aufklärung und Vernunft
Die Geburt der modernen Diät
Vernunft und Ordnung
Frühzeitige Diätliteratur
Physiologie und chemisches Verständnis
Moralische Dimension der Diät
Gesellschaftliche Perspektive
Praktische Folgen
Rationalisierung als Fundament
Medizin im Mittelalter
Nahrungsregeln als Heilverfahren
Heilkunst zwischen Theorie und Praxis
Klösterliche Heilpraxis
Die Diät des Kranken
Geschmack, Lust und Abneigung
Nahrung als Spiegel der Gesellschaft
Heilkunst in den Städten
Die Grenzen des Wissens
Renaissance und Humanismus
Erste individuelle Lebensratgeber
Vom kollektiven zum individuellen Maßstab
Luigi Cornaro und die Kunst, lange zu leben
Der Körper als Projekt der Selbstgestaltung
Bücher für den Einzelnen – ein neuer Tonfall
Humanistische Bildung und körperliche Selbstsorge
Zwischen Heilkunst und Lebenskunst
›The Art of Living Long‹ (1594)
Frühe Kodifizierung einer Diätliteratur
Von der Erfahrung zur Regel
Der Ton einer neuen Literatur
Der Druck als Verstärker
Kodifizierung statt bloßer Empfehlung
Zwischen Askese und Weltlust
Wirkung und Nachhall
Eine Literaturgattung entsteht
Aufklärung und Vernunft
Ernährung zwischen Rationalität und Moral
Der Körper als vernünftig zu ordnendes System
Mäßigung als Tugend
Vernunft und Empfindsamkeit
Die Politisierung der Nahrung
Medizinische Ratgeber und philosophische Entwürfe
Diätetik als Lebenskunst
Genuss unter Beobachtung
Ernährung als Spiegel der Aufklärung
Industrialisierung und Ernährung
Essen zwischen Technik, Arbeit und Massenproduktion
Die Fabrik als neuer Taktgeber
Konservierung und Standardisierung
Arbeiterkost und bürgerliche Tafeln
Ernährung und Gesundheit – eine neue Problemstellung
Die Lebensreformbewegungen
Moralische Dimensionen der Industriekost
Die Geburt der modernen Diätdebatte
Ein Zwischenergebnis
Bürgerliche Esskultur
Maß und Ordnung im 18. Jahrhundert
Von der Üppigkeit zur Kontrolle
Tischkultur als Spiegel bürgerlicher Tugenden
Essen als Ausdruck von Vernunft
Die Bedeutung der Diätetik
Zwischen Einfachheit und Repräsentation
Moralische Dimensionen der Essgewohnheiten
Die Entstehung einer bürgerlichen Identität
Industrialisierung
Neue Kalorienfülle und erste Sorgen um das Gewicht
Die Abkehr von der Mangelwirtschaft
Zucker, Weißmehl und die süße Versuchung
Fleisch als Zeichen des Aufstiegs
Ein neuer Blick auf den Körper
Erste medizinische Warnungen
Bürgerliche Selbstdisziplin und Esskultur
Arbeiterklasse zwischen Hunger und Überfluss
Die ersten Diätvorschriften für das Gewicht
Ein neuer Lebensstil
Das 19. Jahrhundert
Schlankheit als Zeichen bürgerlicher Disziplin
Die Disziplin des Körpers als Spiegel der Gesellschaft
Von der Fülle zur Zucht
Die Geburt der ›bürgerlichen Tugendfigur‹
Medizin und Moral Hand in Hand
Gesellschaftliche Abgrenzung
Schlankheit als Kulturideal
Ein bleibendes Erbe
Frühe Diätbewegungen
Banting und die Popularisierung der Abmagerungskur
Der Handwerker als Diätpionier
Der Verzicht auf Brot, Bier und Kartoffeln
Ein Brief an die Öffentlichkeit
Die Geburt der Abmagerungskur
Reaktionen und Kritik
Banting als unfreiwilliger Prophet
Die tiefere Bedeutung
Ein Vermächtnis, das blieb
Medizinischer Blick
Kalorienberechnung und Stoffwechseltheorien
Der Körper als Brennofen
Die Geburt der Kalorie
Stoffwechsel als Schlüssel
Die Idee des Energiehaushalts
Zwischen Wissenschaft und Alltag
Kritik und Grenzen
Vom Labor zur Kultur
Die 1920er Jahre
Mode, Körperkult und Diät als Lifestyle
Schlankheit als Symbol der Moderne
Der männliche Körper im neuen Licht
Diät als Teil des Alltags
Kino, Glamour und öffentliche Vorbilder
Zwischen Befreiung und Zwang
Wissenschaft im Dienst der Mode
Tanz und Bewegung als Diät
Konsum und Kommerzialisierung
Ein Jahrzehnt der Vorbilder
Kriegszeiten
Mangelernährung und unfreiwillige Diäten
Der erste Einschnitt – Der Große Krieg
Der Alltag im Zweiten Weltkrieg
Ersatzprodukte und kreative Rezepte
Hunger als stille Waffe
Körperliche Folgen des Mangels
Schwarzmärkte und soziale Unterschiede
Psychologische Dimension
Nachwirkungen
Ein bitteres Erbe
Wohlstandskonflikte
Die Geburtsstunde der modernen Diät
Vom Hunger zum Zuviel
Schlankheit als Gegenentwurf
Die Diät als Produkt
Zwischen Lust und Disziplin
Die Erfindung der Lebensstil-Diät
Ein kulturelles Paradox
Nachkriegswohlstand
Kalorienüberfluss und erste Diätwellen
Der Triumph der Fülle
Kalorien als neue Währung
Erste Diätwellen
Der Widerspruch des Überflusses
Psychologie des Abnehmens
Erste Ratgeber und ihre Botschaften
Vom Überfluss zur Kontrolle
Die 1960er Jahre
Schlankheitsideal und mediale Verbreitung
Die Mode diktiert den Körper
Zeitschriften und das wachsende Diätbewusstsein
Film und Fernsehen als Verstärker
Diätprodukte und neue Geschäftsfelder
Körperkult und erste Fitnessbewegungen
Kritik und Gegenstimmen
Kommerzialisierung
Diätclubs, Programme und Abonnements
Die Geburt der Diätclubs
Programme als Lebenshilfe
Die Logik des Abonnements
Werbung und Öffentlichkeit
Von Amerika nach Europa
Kritik und Schattenseiten
Ein neues Selbstverständnis
Namen und Marken
Diäten im Gewand des Erfolges
Die Entdeckung der Abhängigkeit vom System
Konkurrenz belebt das Geschäft
Das Geschäft mit der Dauer
Produkte, die den Namen tragen
Die digitale Wende
Psychologische Raffinesse
Kritik und Widerspruch
Ein Geschäft mit der Hoffnung
Die 1980er Jahre
Light-Produkte und Fitnessbewegung
Der Siegeszug der Light-Produkte
Die Fitnesswelle rollt
Die Allianz von Industrie und Bewegung
Medien und Ikonen
Kritik und Ernüchterung
Das Vermächtnis der 1980er Jahre
Die süße Verheißung - Süßstoffe in den 1980er Jahren
Die 1990er Jahre
Low-Fat, Low-Carb und experimentelle Ansätze
Low-Fat – das Mantra der Leichtigkeit
Low-Carb – eine Gegenbewegung formiert sich
Die Experimentierfreude eines Jahrzehnts
Ein Spiegel gesellschaftlicher Spannungen
Übergang in eine neue Zeit
Digitales Zeitalter
Influencer, Online-Pläne und globale Trends
Die Geburt der Influencer
Von der Küche ins Studio
Zwischen Hoffnung und Kritik
Das neue Paradigma
Zukunft der Diät
Wohin sich die digitale Bühne entwickelt
Die neue Rolle der Influencer
Digitale Pläne – von der App zur künstlichen Intelligenz
Globale Trends – eine Welt der Gleichzeitigkeit
Zwischen Inspiration und Belastung
Die Diät als Kulturtechnik
Epilog
Stilblüten aus der Diät-Welt
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Das Erste, was man bei einer Abmagerungskur verliert,
ist die gute Laune.
Gert Fröbe
Karl Gerhart ›Gert‹ Fröbe (* 25. Februar 1913 in Oberplanitz bei Zwickau; † 5.
September 1988 in München) war ein deutscher Schauspieler. Fröbe gilt als einer der
bedeutendsten deutschen Charakterdarsteller des 20. Jahrhunderts. Er wirkte auch in vielen internationalen Produktionen mit. Berühmtheit erlangte der Schauspieler in der Rolle des Kindermörders in dem Krimiklassiker ›Es geschah am hellichten Tag‹ von 1958 und als Schurke Auric Goldfinger im Film James Bond 007 – ›Goldfinger‹ von 1964.
Das Prinzip der Erfindung
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.
Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.
Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.
Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Eine Erfindung ist keine Entdeckung.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Diäten gehören zu den Phänomenen, die uns auf den ersten Blick schlicht und alltäglich erscheinen – ein Menüplan, ein Verzicht, ein zeitlich begrenztes Ritual. Doch schon die scheinbare Selbstverständlichkeit weckt Fragen: Seit wann bedarf der Mensch einer Diät? Warum scheint er, der über Millionen Jahre hinweg mit dem auszukommen wusste, was ihm die Natur gerade bot, heute ganze Systeme entwickeln zu müssen, um das richtige Maß zu finden?
Der Begriff ›Diät‹ verweist sprachlich auf eine Lebensweise, nicht bloß auf Einschränkung. In seiner ursprünglichen Bedeutung schwingt eine Haltung mit, die weit mehr umfasst als Kalorien und Tabellen. Es geht um Ordnung, um Maß, um eine Art kultureller Grammatik des Essens. Gerade darin zeigt sich die eigentliche Spannung: Diäten versprechen Kontrolle und Balance, doch sie offenbaren zugleich die Unfähigkeit, beides selbstverständlich zu leben.
Die Geschichte der Diät ist eine Geschichte der Sesshaftwerdung, des Überflusses und der wachsenden Distanz zwischen Bedarf und Begehren. Sie reicht von medizinischen Vorschriften antiker Heilkundiger bis zu den Schlagzeilen moderner Illustrierten, die im Monatsrhythmus eine neue ›Formel‹ anbieten. Immer wieder tritt dabei ein Grundmuster hervor: Hoffnung, Disziplin, Scheitern, Wiederholung. Wer eine Diät beginnt, tritt nicht selten in einen Kreislauf ein, der ebenso psychologisch wie physiologisch wirkt – ein Kreislauf, der zur Kulturtechnik geworden ist.
Dieses Buch versteht sich nicht als Ratgeber. Es will nicht den zehnten Tipp geben, wie man schneller, gesünder oder nachhaltiger Gewicht verliert. Vielmehr geht es darum, den Blick zu schärfen: Welche Bedürfnisse, Ängste und Ideale haben die Diät hervorgebracht? Welche sozialen Rollen schreibt sie vor, und welche Versprechen hält sie bereit? Worin liegt die eigentliche Faszination, sich selbst zu zügeln – und warum ist der Rückfall beinahe ebenso zuverlässig wie der Aufbruch?
Die folgenden Kapitel laden dazu ein, der ›Erfindung der Diät‹ nachzuspüren – einer Erfindung, die ebenso von Notwendigkeit wie von Inszenierung lebt. Nicht alles, was wir essen, ist Nahrung. Nicht alles, was wir weglassen, ist Verzicht. Und nicht alles, was wir Diät nennen, ist tatsächlich eine.
Nahrung im Überfluss?
Die Jäger und Sammler und ihre natürliche Balance
Die Vorstellung von Diäten, wie wir sie heute kennen, wäre für den frühen Menschen ein befremdliches Gedankenspiel gewesen. In der Welt der Jäger und Sammler war Nahrung kein Problem der Wahl, sondern des Augenblicks, kein Überfluss, sondern ein stetiger Kreislauf von Finden, Erbeuten, Verarbeiten und Verzehren. Der Gedanke, man könne sich freiwillig einschränken, um Gewicht zu verlieren oder aus gesundheitlichen Gründen bestimmte Speisen meiden, war schlicht unvorstellbar. Stattdessen lebte der Mensch in einer natürlichen Balance, die aus den Bedingungen seiner Umwelt erwuchs und die über Jahrtausende hinweg erstaunlich stabil blieb.
Überfluss, im modernen Sinn verstanden, existierte nicht. Nahrung war vorhanden – oft reichlich in bestimmten Jahreszeiten, karg in anderen –, doch nie so allgegenwärtig, dass sie gedankenlos konsumiert werden konnte. Diese Rhythmik des Mangels und der Fülle bestimmte den Stoffwechsel ebenso wie die sozialen Gewohnheiten. Wer im Sommer Früchte im Übermaß fand, wusste, dass die Zeit der Knappheit folgen würde. Wer im Herbst jagdbares Wild erlegte, war sich bewusst, dass nicht jede Jagd gelingen würde. Der Körper selbst wurde zu einem Speicher, der solche Zyklen überbrücken konnte.
Interessant ist dabei, dass archäologische Funde kaum Anzeichen für Fettleibigkeit in prähistorischen Gesellschaften zeigen. Die berühmte Venusfiguren – kleine Statuetten mit ausgeprägten Körperformen – sind weniger als Abbildungen des Alltäglichen zu deuten, sondern vielmehr als Symbole für Fruchtbarkeit, Überleben und den Wunsch nach Fülle in einer Welt der Ungewissheit. Sie spiegeln nicht den Standardkörper der damaligen Menschen, sondern eine Projektion des Mangels, eine Hoffnung auf das, was selten war: Nahrung im Überfluss.
Die Ernährungsweise jener Zeit war vielfältig, wenn auch von äußeren Faktoren bestimmt. In den Savannen Afrikas bestand sie aus Wurzeln, Samen, Beeren, kleineren Tieren und gelegentlich erlegtem Großwild. An Küsten lebte der Mensch von Fischen, Muscheln und Meeresalgen. In nördlicheren Regionen dominierten saisonale Pflanzen und Jagdbeute. Diese Anpassungsfähigkeit war ein entscheidender Vorteil: Der Homo sapiens konnte sich in unterschiedlichsten Landschaften behaupten, weil er nicht festgelegt war, sondern stets das nahm, was die Umgebung bot.
Dabei war Bewegung nicht Mittel zum Zweck, sondern Lebensnotwendigkeit. Wer Nahrung suchte, musste weite Strecken zurücklegen, klettern, graben, jagen, sammeln. Der Energieverbrauch lag weit über dem, was der moderne Mensch in seinem Alltag benötigt. Körpergewicht war also nicht das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, sondern das Resultat von Angebot, Aufwand und Erfolg. So regelte sich die Balance von selbst: Kalorienaufnahme und -verbrauch standen in einem Verhältnis, das den Körper auf natürliche Weise in Form hielt.
Das Fehlen eines ständigen Überflusses hatte noch eine weitere Folge. Essen war selten mit Schuld oder Scham verbunden. Es war ein Akt des Überlebens, des Teilens, des Feierns, wenn es die Umstände erlaubten. Wer Beeren fand, brachte sie in den Kreis der Gruppe. Wer ein Tier erlegte, teilte es mit allen. Die soziale Dimension des Essens stand über der individuellen. Nahrung war Gemeinschaftsstoff, nicht Privileg oder Konsumgut.
Dass der Mensch im Gleichgewicht mit seiner Ernährung lebte, darf allerdings nicht idealisiert werden. Mangelperioden führten zu Unterernährung, Krankheiten und manchmal zu Hungersnöten. Der Körper reagierte auf solche Engpässe mit Anpassungen, die bis heute nachwirken: der Fähigkeit, Fettreserven anzulegen, die Speicherung von Energie, die hormonelle Regulierung des Hungergefühls. Diese Überlebensmechanismen, die einst das Dasein sicherten, stehen in einer modernen Welt, in der Nahrung jederzeit verfügbar ist, im Widerspruch zu ihrer ursprünglichen Funktion. Was einst nützlich war, wird nun zum Problem.
Gerade dieser Kontrast macht die Ursprünge interessant. Die prähistorische Balance beruhte nicht auf Regeln, sondern auf Notwendigkeit. Sie war keine bewusste Entscheidung, sondern ein Zustand, der sich aus der Umwelt ergab. Der frühe Mensch musste keine Kalorien zählen, keine Zutatenlisten lesen, keine Programme befolgen. Sein Körper war eingebunden in den Rhythmus der Natur, und diese bestimmte das Maß.
Die Frage, ob es Nahrung im Überfluss gab, lässt sich also zweischichtig beantworten. Kurzfristig ja – etwa bei einer erfolgreichen Jagd oder in Zeiten reicher Ernte von Wildpflanzen. Doch dieser Überfluss war immer begrenzt, ein Höhepunkt in einem Zyklus, kein Dauerzustand. Der Vorrat hielt nicht ewig, und Kühlmöglichkeiten oder Konservierungsverfahren standen nur in sehr einfacher Form zur Verfügung. Trocknen, Räuchern oder Lagern in kühlen Höhlen verlängerte zwar die Haltbarkeit, doch das Prinzip der Allzeitverfügbarkeit, das den modernen Überfluss kennzeichnet, war fremd.
Wenn man diese Lebensweise mit den heutigen Essgewohnheiten vergleicht, offenbart sich eine paradoxe Umkehrung: Früher musste der Mensch Energie investieren, um Nahrung zu bekommen. Heute muss er Energie investieren, um überschüssige Kalorien wieder loszuwerden. Das Laufen, Sammeln, Jagen wurde ersetzt durch Fitnessprogramme, Diätpläne und Ernährungsratgeber. Wo einst die Natur die Regeln setzte, herrscht nun der Mensch über sich selbst – und scheitert nicht selten an diesem Anspruch.
Die Balance der Jäger und Sammler bestand nicht nur im Gleichgewicht zwischen Kalorienaufnahme und -verbrauch, sondern auch im Verhältnis zur Umwelt. Nahrung war kein abstraktes Gut, sondern Teil einer ökologischen Ordnung. Beeren wurden nicht wahllos gepflückt, sondern dort, wo sie wuchsen. Tiere wurden gejagt, aber nicht im Übermaß, da übermäßige Jagd das Überleben der Gruppe gefährdet hätte. Dieses implizite Maßhalten war weniger moralisch begründet als schlicht überlebensnotwendig.
Heute, da Diäten als Disziplinierungsprogramme dienen, wirkt der Blick zurück fast wie eine stille Mahnung: Balance entsteht nicht durch Vorschriften, sondern durch Eingebundenheit. Wer die Umwelt in ihrem Rhythmus achtet, erhält eine Art natürliche Diät, ohne dass sie als solche benannt werden müsste.
Die Jäger und Sammler lebten in einer Welt ohne Diäten, aber nicht ohne Regeln. Diese Regeln waren ungeschrieben, sie lagen in den Jahreszeiten, in den Landschaften, in den Erfolgen und Misserfolgen der Suche nach Nahrung. Wer sie missachtete, riskierte das Überleben. Wer sie befolgte, konnte bestehen. In diesem Sinn ist ihre Geschichte der Ursprung eines Gleichgewichts, das wir in unserer modernen Welt neu zu erfinden suchen.
Sesshaftwerdung und Vorratshaltung
Der Beginn der Ernährungslenkung
Die Geschichte der Ernährung ist eng verknüpft mit dem größten Umbruch der Menschheitsgeschichte: der Sesshaftwerdung. Während die Jahrtausende zuvor von einem ständigen Unterwegssein geprägt waren, von der Suche nach Wild, Beeren, Nüssen oder Knollen, veränderte sich mit der Entscheidung, an einem Ort zu bleiben, nicht nur der Alltag – auch das Verhältnis zur Nahrung nahm eine völlig neue Gestalt an. Aus dem spontanen Ernten und Jagen wurde ein Planen, Verwalten und zunehmend auch Regulieren. Nahrung war nicht mehr bloß das, was die Natur gerade bereithielt. Nahrung wurde zum Gegenstand menschlicher Organisation.
Mit der Sesshaftwerdung begann die Vorratshaltung, und diese schuf zugleich den Keim für etwas, das man mit Recht als die erste Ernährungslenkung bezeichnen kann. Wer Vorräte besaß, musste entscheiden, wie sie aufgeteilt, wann sie verbraucht und wie sie gesichert wurden. Zum ersten Mal trat damit eine Form von Kontrolle auf, die nicht aus der Natur, sondern aus der menschlichen Gemeinschaft selbst erwuchs. Nahrung war nicht länger ein vergängliches Geschenk, sondern eine Ressource, die bewahrt und verteilt werden konnte.
Von der Jagd zur Ernte
Die nomadischen Gruppen kannten keine Vorräte, die über wenige Tage hinausgingen. Trocknen, Räuchern oder Fermentieren waren frühe Techniken, die eine gewisse Haltbarkeit schufen, doch sie blieben in der Regel begrenzt. Mit dem Ackerbau änderte sich die Perspektive radikal: Körner konnten gelagert, in Tonkrügen oder Gruben verstaut werden, um Wochen, Monate und sogar Jahre überdauern zu können. Damit wuchs nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Verantwortung.
Die Jäger und Sammler kannten keinen Wintervorrat im heutigen Sinn, denn sie folgten den Jahreszeiten. Wer sesshaft wurde, musste dagegen antizipieren: Was wird im Winter fehlen? Welche Pflanzen tragen verlässlich? Wie schützt man die Körner vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Dieben? Fragen dieser Art waren völlig neu. Mit ihnen begann das Nachdenken über Nahrung nicht nur im Hier und Jetzt, sondern über die Zeit hinweg.
Nahrung als Machtfaktor
Wo Vorräte entstanden, da entstand auch Ungleichheit. Während eine Beerenhandvoll im Wald sofort zwischen allen geteilt wurde, konnte ein Speicher voller Getreide von wenigen kontrolliert werden. Nahrung bekam Gewicht als soziales Instrument. Sie wurde verknüpft mit Rechten, Pflichten und Hierarchien. Wer Vorräte verwaltete, hatte Macht – über das Überleben der anderen, über das Gleichgewicht einer Gemeinschaft.
In dieser neuen Ordnung begann die Ernährungslenkung: Man aß nicht mehr einfach das, was gerade vor Augen war. Man musste sich beschränken, um die Zukunft nicht zu gefährden. Ein Vorrat stellte die Gemeinschaft vor die Aufgabe, Regeln zu finden – und damit auch vor die Notwendigkeit, Verzicht einzuüben. Die erste Diät, wenn man so will, bestand darin, weniger zu essen, als man vielleicht wollte, um für Notzeiten gerüstet zu sein.
Disziplin am Vorrat
Die Kontrolle über Vorräte führte zu neuen Tugenden und Zwängen zugleich. Disziplin wurde zum Schlüssel. Nicht nur für das Bewahren der Nahrung, sondern auch für das eigene Verhalten. Der Überfluss, so selten er war, konnte gefährlich werden. Denn wer zu viel aß, minderte den Vorrat für die Gemeinschaft. Damit begann eine neue Form der Verantwortung, die über das eigene Maß hinausreichte.
Während nomadische Gruppen ihren Energiehaushalt durch Bewegung, Jagd und Suche regulierten, entstand in den Siedlungen eine andere Art der Regulierung: das Gebot, sich an Absprachen und Regeln zu halten. Nahrung wurde vergesellschaftet, und aus der Gemeinschaft heraus wurde gelenkt, was man aß und was nicht.
Kulturtechniken der Lagerung