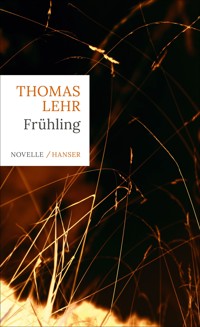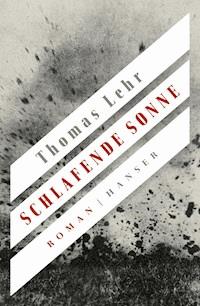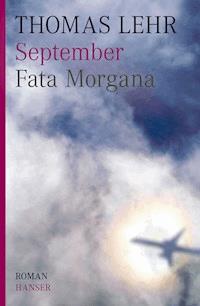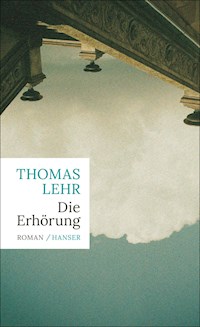
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anton Mühsal, 68er, Spezialist für die frühe Geschichte der Weimarer Republik, brütet im West-Berlin der achtziger Jahre über seiner Promotion. Der junge Historiker schwankt zwischen zwei sehr unterschiedlichen Geliebten und wird plötzlich von Visionen heimgesucht. Ein leibhaftiger Engel reißt ihn aus seiner Moabiter Studierstube, traktiert ihn mit historischen Szenen aus der Novemberrevolution, mit rätselhaften und surrealen Botschaften. In Sequenzen, die im Berlin des Jahres 1919 und 1968, im Barcelona des Spanischen Bürgerkriegs, im deutschen Faschismus und in der Nachkriegszeit spielen, ist „Die Erhörung“ ein realistischer und phantastischer Roman zugleich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Anton Mühsal, 68er, Spezialist für die frühe Geschichte der Weimarer Republik, brütet im West-Berlin der achtziger Jahre über seiner Promotion. Der junge Historiker schwankt zwischen zwei sehr unterschiedlichen Geliebten und wird plötzlich von Visionen heimgesucht.Ein leibhaftiger Engel reißt ihn aus seiner Moabiter Studierstube, traktiert ihn mit historischen Szenen aus der Novemberrevolution, mit rätselhaften und surrealen Botschaften. In Sequenzen, die im Berlin des Jahres 1919 und 1968, im Barcelona des Spanischen Bürgerkriegs, im deutschen Faschismus und in der Nachkriegszeit spielen, ist »Die Erhörung« ein realistischer und phantastischer Roman zugleich.
Thomas Lehr
Die Erhörung
Roman
Carl Hanser Verlag
… Wer seid ihr?
Frühe Geglückte, ihr Verwöhnten der Schöpfung,
Höhenzüge, morgenrötliche Grate
aller Erschaffung, — Pollen der blühenden Gottheit,
Gelenke des Lichtes, Gänge, Treppen, Throne,
Räume aus Wesen, Schilde aus Wonne, Tumulte
stürmisch entzückten Gefühls …
Ein jeder Engel ist schrecklich.
Aus den Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke
Erster Teil
In dem nichts Deutliches geschieht
1
Vom Berühren des Mondes
Morgens, um acht. Im Hochmoor.
»Gemini und Woschod I!« rief mein Großvater begeistert. »Bald werden sie auf dem Mond landen.«
Es war im Oktober 1965; die frühe Sonne kroch nur mühsam durch das neblige Gespinst, das den Himmel und weite Teile der ruhig gewellten Ebene bedeckte.
»Welche Farbe hat der Mond?« fragte ich.
»Das muß erst noch herausgefunden werden.« Mein Großvater ging über nasse, den Weg sichernde Planken voran. Unscharf begrenzt, an den Rändern so dicht, daß sich der Wasserdampf gazeartig um die kümmerlichen Birken wickelte, schien eine Halbkugel klarer Luft mit unseren Schritten ins Moor zu ziehen. »Auf den Kratern könnte es gelb sein, eine Art mehlfeiner Staub«, überlegte er. Ein trockener Husten nahm ihm die Luft. »Ja«, begann er aufs neue, »sie werden darauf herumspazieren. Ihre Körper sind viel leichter als auf der Erde. Sie müssen sich aneinander festbinden, damit sie zusammenbleiben. Sie tragen Anzüge, die mit Sauerstoff aufgepumpt sind. Es ist totenstill.«
Ergriffen von einem flachen Taumel, sah ich zurück nach Süden. Heidekraut, Gräser und Flechten breiteten sich aus wie die dick eingestaubten Webfasern eines Bildteppichs. Starres Zinn füllte einige Lachen und Tümpel. Dahinter versank der Blick in schmutziger Watte. Nichts ist in Ordnung! dachte ich.
Aber ein Schritt meines Großvaters folgte dem anderen in einem so gleichmäßigen Rhythmus, daß ich meine Sorge und das Gefühl für Entfernungen und körperliche Anwesenheit minutenlang verlor.
Wir stapften durch eine Zone schlammverkrusteter Pfützen, als der alte Mann unvermittelt anhielt. Fast wäre ich gegen seine Schulter geprallt. »In der letzten Zeit, da überlege ich allerdings, ob das nicht zu einfach wird. Ich meine, zum Mond zu fliegen. Das ist womöglich die falsche Methode, wenn man die Erde betrachten will.«
»Ja, Großvater.«
»Weißt du, daß man im Inneren einer Kugel mehr von der Oberfläche sieht als von außen? Rein theoretisch zumindest. Das heißt, wenn du klein genug bist.«
Als könnte dies seine Gedankensprünge verdeutlichen, zeigte er auf einen von grauen Drahtlinien und morschen Holzpflöcken eingesäumten Pfad. Wir umrundeten den größten der Moorteiche. Aus schwammig aufgepolsterten Ufern quoll das Wasser, sickerte, wie mit öligen Schlieren versetzt, in unsere Trittspuren nach.
Und wenn ich mich geweigert hätte zu gehen? Seine Beine wirkten versteift. Er zündete die kurzstielige Pfeife, die er auf unseren Wanderungen zu rauchen pflegte, nicht an, sondern hielt sie abwesend in der Linken. Später besann er sich darauf und zog eine Schachtel Streichhölzer hervor. Seine Hände zitterten — so sehr, daß er zahlreiche Hölzchen auf den Boden schüttete. Ich spürte seinen lähmenden stummen Befehl, kein Wort über das Mißgeschick zu verlieren.
»Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt«, erklärte er laut, Pfeife und Streichhölzer wieder in eine Anoraktasche stopfend. »Es ist bei dieser Sichtweise völlig egal, wo sie sind, ob sie gewissermaßen vom Kern aus emporstarren und nichts als dicke Kruste sehen oder von oben. Sie wollen Wettrennen veranstalten. Sie wollen den Planeten im Griff haben, statt alles auf der Erde zu sehen. Begreifst du diesen Unterschied?«
Ich nickte beklommen.
»Aber es ist ein Kunstwerk, wie sie die Umlaufbahnen berechnen. Gemini V wird versuchen, eine Radarkapsel abzusprengen und sie anschließend wieder einzufangen. Glaubst du, du könntest Astronomie studieren oder Physik?«
»Vielleicht, ich weiß nicht.« Ich verlangsamte meine Schritte in der Hoffnung, ihm das gleiche Tempo aufzunötigen.
Er kam auf die Bombardierung Nordvietnams zu sprechen, weiterhin zu rasch ausschreitend. Aus Protest blieb ich einen knappen Meter hinter ihm zurück und fixierte seine Stiefelabsätze. Ich verstand nicht mehr, was er sagte, und hoffte nur, daß das Schweigen, das nach einer Weile eintrat, doch noch in das eigentümliche, fast kinderhafte Gefühl übergehen würde, das uns oft am Ende unserer Spaziergänge und Dispute umfing. Die Worte und Gesten mußten uns ausgegangen sein. Pfeifentabakrauch war vonnöten, vielleicht auch ein ganz bestimmter Neigungswinkel unseres Gemüts gegen die Ekliptik der Sonne. Und dann kam dieses Gefühl, das die Farben, Gerüche und Töne der Landschaft um einen jähen Sprung eindringlicher machte — so als hätte jemand, während wir im Dunst der Spekulationen wandelten, inzwischen die Welt neu gestrichen und tapeziert. »Sieh, Anton«, konnte mein Großvater nun sagen, meine Aufmerksamkeit auf eine seiner Beobachtungen lenkend. »Sieh« — dieser merkwürdige biblische Imperativ, in dem sich die Lust an der Schöpfung sogleich mit der am Beweis und einem milden Triumph überkreuzt. Seine brüchige Stimme ließ die Worte leicht werden.
»Sieh, Anton, Zindelkraut, Bitterling, Sonnentau …« In einer pendelnden, unregelmäßigen Art erschienen die Namen. Sie zeichneten dünne fasrige Stiele vor meine Füße, wachsüberzogene Blätter, glitzernd unter Tauperlen, Blüten einer tiefen, sehr präzisen Färbung, die mir gerade noch irdisch vorkamen.
»Wir hätten daheim bleiben sollen!« rief ich. Es würde diese einfachen und wundersichtigen Momente nicht mehr geben. Ich spürte es seinem Schritt an, der, begleitet von angestrengt gebändigten Atemgeräuschen, immer mechanischer wurde.
»Wir sollten umkehren, Großvater!«
»Du erinnerst dich an Anselm? Anselm Kempner?«
»Sicher. Aber wir —«
»Hör doch zu!« Er ballte die Hände in den Taschen seines Anoraks und richtete sich vor mir auf. »Wenn du in Berlin studieren willst, könntest du Anselm gebrauchen. Anselm Kempner … Begreifst du, daß es für einen Menschen nicht gut ist, wenn ihm zu früh ein festes Haus gehört?«
Erschrocken gab ich ihm recht, stammelte irgend etwas, schwieg trotzig.
»Studieren«, sagte er, »man hätte schon immer auf dem Mond studieren müssen, um ruhig zu bleiben. Es passiert zu vieles. Und ist es nicht auffällig, daß gerade jetzt der Mond immer näher rückt? Wer, Anton, fliegt denn da hinauf? Ganze Länder sind das, nicht etwa nur eine Handvoll Astronauten. Millionen von Köpfen sehen die Erde auf die Art, die mir zu einfach vorkommt. Jetzt haben sie diesen Erhard wiedergewählt; man könnte glauben, weil sein Pfannkuchengesicht so leer und glatt aussieht wie die gelbe Scheibe da oben am Himmel. Früher —«, er hustete und wischte sich hart über die bläulich verfärbten Lippen, »früher haben sie irgendwelche Fabelwesen da oben vermutet. Jetzt, wo sie drauf und dran sind, da hinaufzufliegen, schleichen sich die Mondkälber vorsoglich herunter. Sie rauchen Zigarren und übernehmen die Regierung. Du wirst studieren, Anton —«
Er wankte, seine Beine gaben nach. Ich hatte Mühe, ihn zu stützen, obwohl ich mit meinen siebzehn Jahren wesentlich kräftiger und schwerer war als er.
»Großvater!« sagte ich beschwörend.
Er lehnte sich so gegen mich, daß wir gemeinsam einige Schritte vorantaumelten. »Geh, Anton. Damit man dich nicht umsonst jeden Tag schwimmen geschickt hat. Halt mich fest. Geradeaus, es wird gleich besser«, keuchte er. »Was alles geschieht! Im Kongo schlachten sie die Mulélé- und Simbarebellen ab. Dieser Tschombé, dieser blutige Spaßmacher, ist entlassen worden. Aber was hilft’s? Weißt du noch, wie er hier in München war, beim Kardinal Döpfner? Mehr Handel mit Bayern hat er gewollt, ha! … Studieren, Anton. Die Studenten haben ihn mit Stinkbomben und Tomaten beworfen. Auch das sind Flugbahnen, die berechnet sein wollen.«
Ich mochte nichts mehr hören!
»Wenn man in mein Alter kommt«, rief er fast wütend, mich noch immer vorandrängend, »dann wünscht man sich ein paar einfache Sätze. Nun, man kriegt sie eben nicht.« Ungeschickt fuhr er sich über die Stirn und wischte die blaue Schirmmütze von seinem Kopf. Er wollte nicht, daß ich sie aufhob. Plötzlich wurde der Dunstkreis um uns geweitet. Die Erde glühte auf: etwas wie flammender Rost, ein Grün in Sprengseln aus Jade und Smaragd, sich auf breiten Moosbuckeln wellend, überall zerschnitten von der nun silbrigen Härte der Pfützen.
»Großvater«, mahnte ich ihn leise.
Er riß sich von mir los, schwankte über ein Stück leuchtend gegen den Morgenhimmel aufsteigende Erde. Es war der Stumpfsinn einer Exekution. Schon knickten ihm die Beine ein. Ich eilte ihm nach und hielt ihn an den Schultern fest. Sein Haar, gelblich weiß und mit einer schwach parfümierten Salbe am Kopf gehalten, klebte jetzt auch auf seiner Stirn. Langsam hob er den rechten Arm, seine Lippen berührten mein Ohr. »Sieh!« sagte er angestrengt. »Blüten, Anton. Überall … diese … Blüten, violette Blüten!« Seine Finger streckten sich gegen den Wald: Dort, im dunklen Filz zwischen den Stämmen! »Sieh!« flüsterte er. Das Kinn und die linke Schulter wurden ihm heftig zur Seite gerissen.
Ich erschrak, für eine Sekunde wich die Kraft aus meinen Armen.
Wortlos fiel der alte Mann vornüber in den Schlick.
Fast eine dreiviertel Stunde brauchte ich, um ihn zum Waldrand zu schaffen. Zuerst hob er noch ab und zu den Kopf. Dicht hinter der rauchgrauen Iris zersplitterte, was er hatte sagen wollen. Sieh, Anton! Wieder mußte ich ihn auf den Boden setzen, ihn erneut unter den Achseln fassen. Tannenzapfen rollten unter meinen Füßen. Trockene Äste verfingen sich zwischen meinen Beinen, das weiche Nadelpolster gab plötzlich nach, so daß ich ausrutschte, fiel, mir abermals diesen wie hölzernen, nur noch leise seufzenden Leib auf die Oberschenkel laden mußte. Nirgendwo ein Spaziergänger. Etwas traumhaft Wäßriges spann sich über die Farnkräuter und die hypnotisch zäh wippenden Äste der Tannen.
Endlich zerrte ich ihn über die letzte Hügelkuppe. Das Dorf lag staubig rot und weiß im Morgenlicht.
»Er stirbt!« schrie ich. »Hilfe, er stirbt!« Ich winkte, ich schrie und schrie.
Nur die Kühe sahen mich an, vier oder fünf in unmittelbarer Nachbarschaft, schlugen mit den Schwänzen, senkten zeitlupenartig die schweren Mäuler über das Gras, ihre pralle feuchte Lebenswärme ausströmend, durch die in wahnsinnigen Spiralen die Fliegen schossen.
Einige Bauern hörten mich schließlich. Ein Mopedfahrer stieß zu ihnen und Kinder, die vor dem nahegelegenen Schulgebäude gespielt hatten.
Ich zog meinen Großvater ein Stück weiter auf eine Aussichtsbank am Waldrand, bettete seinen Kopf in meinen Schoß, wischte Tannennadeln und Erdkrümel von seinen Wangen.
»Wenn der Anton ihn bis hierher geschafft hat, dann wird er den Rest auch noch vertragen«, sagte einer der Bauern.
Als sie sich herabbeugten, um den Sterbenden auf ihre Schultern zu laden, huschten die Kinder beiseite. In der gleichen wiegenden Manier, die die Last und das steile Gefälle den Bauern aufzwangen, schritten sie und der Mopedfahrer dann durch das Gras nach unten. Ich stützte den Kopf meines Großvaters.
»Vielleicht ein kleiner Herzinfarkt? Eine vorübergehende Ohnmacht, ein kleiner Gehirnschlag?« prustete mir der Mopedfahrer ins Ohr.
»Ja«, sagte ich, »bestimmt.«
Froh, daß ihm jemand zuhörte, plapperte er weiter. Ich wünschte ihn so weit weg als möglich — und vielleicht dachte ich nur deshalb an die fremden Länder, von denen mein Großvater in seinen letzten wachen Minuten gesprochen hatte. Da erst erfaßte mich die schwindelerregende Ahnung, wie ungeheuer weit diese eine Sekunde reichte, in der ich vorsichtig meinen Schritt zwischen die Füße der Bauern setzte. Alles auf der Erde!
Mit einem Gefühl von unermeßlicher Weite und Nähe zugleich hob ich den Kopf meines Großvaters an. Er war so schwer, daß ich nicht mehr begriff, wie ich den ganzen Mann hatte tragen können.
Als sie das Gartentor zu unserem Haus aufstießen, packte mich eine schreckliche Müdigkeit. Totsein, dachte ich, das ist, den gleichen Abstand zu allen Dingen zu haben. Ich sank auf die Steintreppe vorm Eingang und legte den Kopf auf die Knie. Zwischen meinen Schuhen krabbelten Ameisen durch eine Pflasterritze. Die ganze Erde! Anselm — das Haus! Tschombé, ein blutiger Spaßmacher! Ich mußte jedes Wort behalten. Und irgendwann, dessen war ich mir absolut sicher, würde ich etwas sehen, das wie die violetten Blüten meines Großvaters war.
2
Abschiede
Achtzehn Jahre später, 1983, Dezemberanfang, die letzten Stunden in meiner alten Berliner Wohnung. Kurz nach dreiundzwanzig Uhr würde mein Zug fahren. Schon konnte ich die hölzern seufzende Stille im Haus meiner Großeltern hören, sah den Garten vor mir, den Balkon zur Isar, den Schreibtisch unter der ausgestopften Eule, an dem ich diese Aufzeichnungen beenden werde.
Ich stand auf und ging durch die halbdunklen Zimmer, schwach, glücklich, haltlos, aber getröstet von dem Gedanken an die Flucht, an den neuen Beginn. Es war gut, schon während der vergangenen Wochen auf Fehmarn mit der Verwandlung meines Lebens in eine Geschichte begonnen zu haben. Ich würde Dialoge setzen, Überschriften. Ich mußte diesen Schrei, der in mir gellte, mit einem Netz von Buchstaben an die Wände meiner Erinnerung kleben, bis er starr geworden war wie die Toten und ihre Zeit im Gehirn alter Menschen.
Gestatten, Anton Mühsal, sechsunddreißig, mäßig praktizierender Historiker, blond, kräftig, vertan und wieder gerettet, Bote vom Zerfallspunkt der Welt, Ex-68er Reisender, Flüchtender, Schizoider — ach was, ich bin auch ein ordentlicher Mensch gewesen, fünf Jahre lang im öffentlichen Dienst, unerwartet scheidend, vom Ruf ereilt wie der biblische Zöllner. Und ich werde gleich sagen, daß ich weder religiös noch nichtreligiös bin. Ich glaube an Gott als die letzte Synthese der Industrie.
Mein Großvater. Nach seinem Anfall im Moor erlangte er das Bewußtsein nicht wieder. Er starb eine Woche lang, in der er immer durchsichtiger zu werden schien, während die Möbel in seiner Umgebung sich mit dunklem Leben füllten. Mir kam es vor, als hätte der Tod ihn auf ein unsichtbares Floß gebettet, das im Takt der Wanduhr und unter den Geräuschen der Besucher leicht und unwillig erzitterte. Schließlich hörte er auf zu atmen. Die Haut in seinem Gesicht glänzte hart wie eine Keramik. Wirklich schlimm aber war diese eine Sekunde im Moor gewesen, in der er sah und ich nicht folgen konnte.
Hanna rief an. Auf Fehmarn hatte ich ihr einen kurzen Brief geschrieben.
»Was tust du?«
»Ich packe.«
»Das ist nicht viel Arbeit.«
»Ja. Es tut mir leid —«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Anton. Es ist dein Entschluß.«
»Auch wegen meiner Großmutter«, sagte ich. »Ich werde bei ihr wohnen, nicht in München.«
»Ich habe dir keinen Vorwurf gemacht, oder?«
»Du glaubst nicht, daß es gut ist.«
»Das erste Mal, anno fünfundsiebzig —«
»Da mußtest du mich aus der Klapsmühle holen«, unterbrach ich sie.
»Entschuldige.«
»Nein, ich habe dir auch keinen Vorwuf gemacht.«
»Ach Anton, ich bin es nicht mehr gewohnt, dich nicht zu begreifen. Früher hatte ich mehr Übung. Meine Güte, du warst fast neun Jahre von Berlin weg, ohne dich bei irgend jemandem zu melden. Dann kommst du wieder, aus heiterem Himmel —«
»Und ihr schlachtet ein Lamm für mich, organisiert eine Wiedersehensfete, du hast meine alte Wohnung aufgehoben, acht Jahre lang.«
»Das war nicht schwer.«
»Aber sehr lieb.«
»Danke.«
»Also: Ich komme wieder, bleibe für eine Woche, in der ich ziemlich viel wirres Zeug rede, verschwinde für beinahe zwei Monate auf einer Ostseeinsel, komme für zwei Tage zurück und will gleich weiter, nach Bayern, für ein Jahr.«
Sie lachte. »So ungefähr hat es sich abgespielt. Was willst du da jetzt machen? Da unten bei den Jodlern?«
»Ich gehe zurück auf den Mondstrahl.«
»Mondstrahl?«
Das sei ein Begriff, den sie selbst vor Jahren auf mich gemünzt habe, erinnerte ich sie. »Du lagst in der Badewanne und hast mir mein Leben erklärt.«
»An die Badewanne erinnere ich mich natürlich. Aber: Mondstrahl? Die Mondlandung, Anton, das war —?«
»Am 20. Juli 1969.«
»So genau wollte ich’s wissen! Neunzehnhundertneunundsechzig. Meine Güte, das haben wir schon erleben dürfen … Was war da? Die Russen standen schon ein Jahr lang in der ČSSR, und die Amis hatten noch immer 500.000 Mann in Vietnam. Dann gab es ständig irgendwelche Oberschlaumeier im Fernsehen. Die spielten an Pappmodellen der Mondlandefähre herum, weil ihnen die NASA zu wenig Filmmaterial schickte.«
»Richtig«, sagte ich. »Und ich —«
»Du hattest dieses Gesicht! Jedesmal wenn Irmchen oder Walter die Kiste einschalteten, um in den Mond zu gucken, hast du sie ihnen vor der Nase wieder abgedreht. Es war Dogmatismus. Niemand hat begriffen, warum du dich so aufgeregt hast, du, dich aufregen! Du wolltest uns den Mond nicht gönnen. Keinen einzigen Krater. Nicht einmal den großen Schritt für die Menschheit am Sonntag.«
»Sie haben ihn ja dann doch noch gesehen.«
»Oh, aber nur, weil ich mich aufgeopfert habe! Wir beide hockten in der Küche, während im Gemeinschaftszimmer Apollo im Sternenstaub niederging, und diskutierten über den Mond und Marcuse. Du hast von einem dunklen Alternativprojekt zum Mondflug fantasiert. Irgendwie klang es nach Jules Verne. Es ging um das Innere der Weltenkugel, um die Eroberung des Erdkerns.«
»Es war eine Idee meines Großvaters«, sagte ich ernst.
Im Hintergrund war ein kreischendes Geräusch zu hören, der Nadeldrucker in dem Anwaltsbüro, das sie zusammen mit zwei Kollegen betrieb.
»Anton?«
»Vielleicht besuchst du mich, oder ich komme nach Berlin«, schlug ich vor.
»Sicher, bestimmt viel schneller, als du denkst.«
Bevor ich fragen konnte, was sie damit meinte, hatte sie den Hörer aufgelegt.
Ich mußte noch zwei weitere Abschiede hinter mich bringen, von Therese und von Anselm, der mich zu einem Spaziergang durch das Viertel aufgefordert hatte. Vor meinem Fenster sah ich die blattrigen, moos- und nässedurchsetzten Mauern des Hinterhofs. Die Hauswände bildeten im Grundriß ein schmales Dreieck, und sie hoben sich wie die zusammenstoßenden Buge zweier verrotteter Ozeankähne. Dezember. Grauer Schnee fiel, das Gefühl eines unerbittlichen steinernen Wachsens in entgegengesetzter Richtung drängte sich auf. Ein Fallschacht für Selbstmörder, drei Stockwerke tief. Hätte ich es hier versucht, es wäre leichter gewesen als sieben Wochen zuvor in der Ostsee. Gestatten, Anton Mühsal, Dilettant in Sachen Freitod, Überlebender, knapp Davongekommener, gerettet durch einen einzigen Gedanken. Jeder Atemzug ist Bedeutung. So, Hanna, lautet die Antwort auf die vierte Frage.
»Kommen Sie jetzt?« rief Therese vom gegenüberliegenden Hoffenster. »Der Kaffee ist fertig.« Sie zögerte einen Moment, rieb sich die Wange mit einem roten wassergeschwollenen Händchen. »Daß Sie schon wieder gehen! Wo Sie doch so lange weg waren.«
»In einem Jahr komme ich wieder.«
»Ach, in einem Jahr, wer weiß …« Umständlich schloß sie die Flügel ihres Doppelfensters. Der Hof übersteigerte alle Geräusche. Man glaubte, der Husten der alten Frau quäle die Brust einer Riesin und einen Stock weiter unten würden meterlange Gabeln und Messer auf eine Spüle geworfen. Eine Stunde lang saß ich bei ihr, trank ihren handgefilterten Kaffee, hörte zu, bewunderte ihre Medikamentenschachtel. Berufliche Gründe, erklärte ich verlegen, zwängen mich, für ein Jahr nach Bayern zu gehen.
»So ist das, sie nehmen keine Rücksicht«, stellte sie mitfühlend fest.
Wieder in meiner Wohnung, berauschte ich mich an den Zeichen des Aufbruchs, packte umständlich die letzten Bücher und Socken in den Rucksack, mit dem ich zwei Monate zuvor in Berlin angekommen war. Nicht viel Arbeit, wie Hanna sagte. Ich brauchte Abstand, weil ich besser wußte, daß es keinen gab, mein Gott, die Stadt, jetzt, wo dieser erbärmliche, literarisch gewordene Ekel vor der Menge fehlte! Die U-Bahnen, Stadien, Hallen, Kaufhäuser, Bäder! Ruhig bleiben.
»Du erinnerst dich an Anselm Kempner? Begreifst du, daß es für einen Menschen nicht gut ist, wenn ihm zu früh ein festes Haus gehört?«
Der letzte Spaziergang durch Moabit mit Anselm, dem nie ein festes Haus gehörte. Ich hatte es nie gewagt, ihm das Testament meines Großvaters anzutragen, diese zwei Sätze im Hochmoor die bedeuten, daß im Falle des Todes meiner Großmutter nicht ich, sondern Anselm sich in einem bayrischen Dorf niederlassen soll. Anselm war Student, Drucker, anarchistischer Milizionär, Journalist, Kellner und Privatdozent. Mein Großvater muß, in der Todessekunde der violetten Blüten, an ihre gemeinsame Zeit im Spanischen Bürgerkrieg gedacht haben. Aber die Vorstellung, diesen immer noch energischen Siebzigjährigen, der an den finster aus Buchdeckeln hervorlugenden alten Schopenhauer erinnerte, unter einem Maibaum zu begraben, war absurd.
»Was grübelst du nur?« fragte er, nachdem ich ihm meinen Entschluß, nach Bayern zu gehen, mitgeteilt hatte. »Du siehst schlecht aus! Willst du an deinen Essays arbeiten?«
»Sicher.«
»Das ist gut, man muß mitnehmen, was zu einem gehört.«
Alles! Aber was hieß das? Wer konnte dem standhalten? Anselms eisblaue Augen, die federnde Aufmerksamkeit, mit der er mich schon als Kind begeistert und erschreckt hatte, wenn er in Bayern zu Besuch war. Ich hielt stand, lenkte das Gespräch auf seinen Freund Jakob, mit dem er eine Wohnung teilte, seit dessen Frau gestorben war. Was konnte ich Anselm denn erzählen? Sie hatten seine Mutter in Auschwitz und seinen Vater im Theresienstadt ermordet. Die Erinnerungen, die Anflutungen von Geschichte, die mich in der Moabiter Szenerie heimsuchten — dies sei mir im Augenblick einfach zuviel, erklärte ich, als er noch einmal auf meine Flucht zu sprechen kam.
»Man muß sich erinnern, ohne schwach zu werden«, sagte er ruhig. »Die Vergangenheit ist kein Pantheon. Du bist Historiker, du darfst nicht zu ehrfürchtig sein.«
»Aber auch nicht gleichgültig!« rief ich. »Novalis sagt: Die Geschichte ist ein Verbrennen. Man sollte das wörtlich nehmen. Jede Epoche steht noch in ihrem Brand! Ich will eine Erinnerung, die die Zeit im Feuer aufsucht und brennend zurückkehrt! Man muß in jeden Winkel gehen, auf den Grund, zu allen. Staunend wie ein Kind, aber auch pedantisch und knochenkalt wie ein Beamter des Jüngsten Gerichts!«
»Und finster wie der Engel der Rache«, ergänzte Anselm, halb ergriffen, halb belustigt. Er deutete in Richtung der U-Bahnstation Turmstraße. »Aber sieh bitte auch, wo du jetzt bist. Einkaufszone, ausgehendes 20. Jahrhundert. Sparkassen, Benzinzapfsäulen, Bäkkereien. Zeugen Jehovas neben dem Popcornstand. Arbeite in Ruhe, mein Lieber. Im Frühjahr komm ich dich besuchen. — Und noch eines«, er zog mich mit der knabenhaft groben Zärtlichkeit alter Männer am Jackenärmel. »Für den Irrsinn der Welt ist noch keine Klinik erfunden worden.«
3
Weißblaue Raster
München. Ich bewegte mich vorsichtig wie auf einem anderen Planeten. Wie jedesmal, wenn ich meine Großmutter besuchte, kam ich mit dem Zug frühmorgens an. Ich durchquerte die Haupthalle, um dann auf langen Rolltreppen hinabzugleiten in das glattgefegte, hart arbeitende Gedärm des Bahnhofs, in dem sich die Schienenstränge der S-Bahn bündeln. Meine übernächtigten Augen brannten. »Das letzte Mal mußte ich dich aus der Klapsmühle holen.« Hannas Stimme, traumhaft nah. Sie verstand nicht, das nicht, ich hatte ihr keine Chance gegeben. Daniel: »Mein Herr, bei der Erscheinung sind Krämpfe über mich gekommen.« Johannes: »Ich kam in eine Entrückung des Geistes und fiel wie tot zu seinen Füßen.« Auf dem Boden meiner kahlgeräumten Moabiter Wohnung zusammengekrümmt, hechelnd unter einem Körper aus irrer Luft.
Ich spürte die rauhe Oberfläche meines Rucksacks unter den Händen wie eine Mahnung, präzise zu sein. Die Wintersonne taute die Landschaft vor den Fenstern auf. Nadelwald, halbversunkene Häuser im traditionellen Stil. Der blauweiße Zuckerguß von Maibaumspitzen und flach ins Gelände geschmiegte moderne Fabrikgebäude, in denen Gamsbarthüte, Panzerabwehrgeschütze, Krachlederne, Jagdbomberelektronik und Stacheldraht gefertigt wurden.
Vor dem Ausbau des S-Bahnnetzes war man mit einem rumpelnden Vorortzug nach München gelangt. Mein Großvater. In all den Jahren, die er in unmittelbarer Nähe der Stadt verlebte, ist er höchstens ein dutzendmal in diesen heute längst ausgeweideten und zur Fertigung von Gewehrläufen zerstampften Schienenbummler gestiegen. Für ihn blieb München der Ort, an dem man Kurt Eisner umbrachte, der einen Hitler an seinem Busen großzog und gegen die Republik intrigierte, die Hauptstadt der Bewegung. Ich erinnere mich, wie er fast im Laufschritt auf den Bahnhof zustrebte. Vielleicht hielt er es für möglich, mitten in den Münchner Straßen von einer grauen Hand gepackt und in den nächstgelegenen Folterkeller gezerrt zu werden — wo man ihm bayrische Gesittung und völkisches Empfinden ins Fleisch zu brennen gedachte. Fantastische Übersteigerungen? Gerade das mußte ich unter der Oberfläche seines humorigen Zorns und seiner Altmännerruhe sehen lernen, eine tiefere, bohrende Nervosität, seine Überempfindlichkeit, den Künstler in ihm.
Nach der vierten Bahnstation war ich in meine Erinnerungen und in die Müdigkeit wie in einen großen Kokon verstrickt. Die Umrisse der anderen Fahrgäste verschwammen, als betrachtete ich sie durch eine staubige Brille. Ihre Körper schienen leichter zu werden, sich von den Sitzen zu heben. Wie in einer Probe für ihren letzten Aufenthalt. Noch glaubten sie, selbst ihr Ende wäre bayrisch. Aber es war absolut, gesichtslos, ohne Provinz.
In meinem letzten bayrischen Jahr hatte ich ganz ähnlich empfunden, in die Leere starrend, die der Tod meines Großvaters hinterlassen hatte.
Die Zeit vorm Abitur. Man konnte fühlen, daß etwas gänzlich Neues zum Aufbruch drängte. Es nahm Formen an, Musik, Gestalten, die sich untergehakt auf die Straßen setzten. Eine seismische Erschütterung der Gehirne griff von Berkeley und New York aus 4000 Kilometer über den Atlantik und rüttelte an der Maibaumspitze des Dorfes G., anscheinend nur von mir bemerkt. Ich strich durch die gebohnerten Flure des Gymnasiums und wartete darauf, daß die Rehbockgehörne und Porträts der Ministerpräsidenten, die dort in streng wechselnder Reihenfolge die Wände zierten, herabfielen. Sie taten es nicht. Ich hatte einen Traum von einem anarchistischen Kommando, das den Zwiebelturm in die Luft jagte. Nirgendwo gab es Sprengstoff. Alles hätte ein Traum sein können, was in den Zeitungen zu lesen oder auf den Bildschirmen zu verfolgen war. Die leicht angerosteten und verstaubten Nägel, die sich durch die graugelben Schädelplatten der Rehböcke bohrten und die Bildhalter für die graugelbgesichtigen Ministerpräsidenten trugen, sie schienen willens, die nächsten tausend Jahre zu überdauern.
Ich begann, alleine nach München zu fahren.
Hier, in der Stadt, mußte doch der Atem der Revolte spürbar sein. Gut, es gab Plakate, Wandaufschriften, les murs ont la parole, wie es groß auf der Rauhfasertapete über meinem Bett stand. Studenten verteilten Flugblätter vor dem Maximilianeum. Ich wagte nicht, sie anzusprechen. Wen schon interessierte ein Schüler? Die Nacht kam. Hinter den Münchner Schaufenstern krampften sich lautlos die Elektronenschmetterlinge ins Dunkle, um beim Näherkommen durch das herangelockte Gehirn einen Strom fremder, ungeheuerlicher Bilder zu pumpen: zerrissene Leiber aus Vietnam; fahle Gespensterreisen durch den Dschungel; die Bombenschauer, die sich, von oben betrachtet, ausnahmen wie lebendig gewordene Radierungen, niedergehend auf dem geduldigen graugrünen Glas der Bildröhren.
In der Hoffnung, Sinnesgenossen würden mich daran erkennen und das Gespräch mit mir suchen, wendete ich einen Band Marcuse in den Händen, sobald ich die Straßenbahn oder ein Café betrat.
Im Dorf verkleideten sich die Mädchen mit Jeans und Batikblusen. Aber ich war ihnen unheimlich, weil mein Großvater ihren Eltern unheimlich gewesen war, weil ich nicht ihren kehligen Dialekt sprach, weil ich die Revolution ausrufen und nicht skifahren wollte. Love-ins! Man hörte davon, 4000 Kilometer über den Atlantik.
Wieder kamen die Bilder aus Indochina. Ich verstand nichts. NPD-Plakate schossen aus dem Boden. Nichts-Sein, Noch-nichts-Sein, ein Fluch über dieser blau-weiß rautierten Misthaufenwelt mit den barocken Himmeln. Ich liebte das Annerl, das so fremd und schön aussah, daß es unmöglich die Tochter des Bauern Weiniger sein konnte. — »Du bist kein Mensch«, hatte sie mir einmal in der Grundschule gesagt. Sie verfiel auf diese Idee, weil ich keine Eltern vorweisen konnte und weil mein Großvater nicht zur Kirche ging. Daß ich nun, als Siebzehnjähriger, jeden Tag schwimmen ging, verzweifelt große Strecken bewältigend, die mich nahezu olympiareif machten, ließ mich ihr eine Zeitlang menschlich erscheinen. Sie trug einen glänzenden blauen Bikini, einen heiligen Stoff made in Italy, der nach Sonnenöl und Erlösung roch. Das vertrackte Schloß daran durfte ich ein einziges Mal lösen, im Netz der Isarstauseen, auf einer Kiesbank, zwischen schillerndem, im Wind pulsierendem Weidengebüsch. Ihre Brüste, unsagbar weich, wie aufgeplusterte Vögel mit rosinenfarbenen Schnäbeln an der Wandung ihrer Rippen kauernd, gehörten der Welt und wurden doch, kaum hatte ich sie berührt, bayrisch wie unter einem Fluch. Es dürfe nicht mehr sein, erklärte das Annerl am Ende eines Zwei-Minuten-Glücks, denn es sei nur wegen dem Sepp gewesen, um sich wegen der Christel zu rächen. Da log ich ihr etwas von einer Münchner Studentin vor, die die Pille nahm, Marcuse auswendig kannte und Querflöte spielte — nackt, im Lotussitz. Mit einer sanften Übung brachte sie mich dafür auf ihren dünnen Oberschenkeln zum Erguß und kannte mich nicht mehr, als ich, im Glauben, nun ein Bayer geworden zu sein, die Lüge eingestand.
Also beschloß ich, einen Schlußstrich unter zehn Jahre verzweifelter Liebe zu setzen und mich in der Scheune ihres Vaters zu erhängen. In der Brusttasche meines Hemdes befand sich ein acht Seiten langer Abschiedsbrief, der ihr das Herz brechen mußte. Eine Reepschnur um den Hals geknotet, hockte ich fünf Meter über einer warmen, dampfenden Leere in der Mitte eines Scheunenbalkens, an dem ich das andere Ende der Schnur befestigt hatte — und sah plötzlich den letzten Blick meines Großvaters vor mir. Vorsichtig legte ich mich auf den breiten Balken nieder. Ich begann zu weinen, jetzt erst konnte ich es, ein Jahr nach seinem Tod. Eine leichte Drehung meines Körpers nur, und ich würde bei ihm sein. Das rauhe Holz verschob sich bereits an meiner Wange im Zuge eines zärtlichen Hinabgleitens. Die violetten Blüten mußten jetzt erscheinen wie eine Explosion. Eine halbe Stunde lag ich mit geschlossenen Augen in der nach frisch gemähtem Heu duftenden, tödlichen Höhe. Ich sah nicht die violetten Blüten, sondern nur ein grünes Leuchten, wie ein dünnes Band, das die Grenze einer immer weiter ausrückenden dunklen Ebene bildete, einer Wölbung, die dem Sphäroid der Erde folgte. Ich vergaß das Annerl, das Dorf mit der Zwiebelturmkirche, das bevorstehende Abitur. Man mußte ALLES begreifen. Den Druck des Balkens gegen meine Brust und mein Geschlecht empfand ich wie eine Lust aus einer anderen Welt. Es war kein bestimmbares Erlebnis, keine Vision. Nur die vollkommene Empfindung von Weite und unermeßlichem Raum.
Als ich die Schnur von meinem Hals löste, glaubte ich fest, daß mein Großvater ganz in der Nähe war.
Vor der Scheune traf ich das Annerl, das eigentlich meine baumelnde Leiche hätte finden sollen. Schweigend ging ich an ihr vorbei, so kalten Blicks, daß sie erschrak und mir anbot, sie zu küssen.
Ich stieg aus der S-Bahn Richtung Wolfratshausen. Ende der siebziger Jahre hatte man den Bahnsteig von G. untertunnelt. Die mit Graffitis besprühten Betonwände der Fußgängerunterführung und ein mit roter Menninge bepinseltes Geländer hoben sich beim Aufsteigen diagonal gegen den schneeverkrusteten Hügel, auf dem die Zwiebelturmkirche stand. Vor einiger Zeit waren die Außenmauern des Gymnasiums mit blauen mannshohen Zahnrädern, vielfarbigen Röhren, Kolben und anderen Maschinenteilen bemalt worden; aber zweifelsohne hingen die Ministerpräsidenten noch grau und gelb im Flur.
Vier Wochen nach meinem Scheunenbalken-Erlebnis und dem Entschluß, in Bayern kein Mensch mehr sein zu wollen, war das Abitur bestanden. Mein Zeugnis reihte ohne Ausnahme die Note »gut« zu zwei schlanken Säulen. Es sah wie eine Fälschung aus, — »Wia obg’schleckt!« befand das Annerl gnadenlos. Es paßte zu mir; unmenschlich war auch meine einzige wirkliche Stärke: ein nahezu fotografisches Gedächtnis, ein innerer Aktenschrank, der fast ohne mein Zutun alles Gelesene und Gehörte sicher aufbewahrte, als wäre mein Gehirn von Geburt an in Hunderte genau archivierender Fächer unterteilt gewesen.
»Das Abitur bestanden? Jeder normale Mensch verdingt sich dann bei einem der ortsüblichen Sklaventreiber. Vier Wochen Schufterei, und er stopft sich die mühsam erstandenen Hunderter lose in die Brusttasche, und ab geht’s nach Süden!« rief Hanna, als ich ihr einmal beschrieb, wie ich die Zeit zwischen Abitur und Studium verbracht hatte.
Ich lag im Garten und starrte die Apfelbäume an, die unter metallisch flirrenden, wirbelnden Blättern den Sommer atmeten. Winzige Mücken durchschnitten die Luft über meinem wie gelähmten Körper. Manchmal schoß in die hinter den Nachbarhäusern aufragende Tannenreihe ein Vogel und hinterließ ein Zittern in den Ästen, das nicht mehr enden wollte. Es kam mir sinnlos vor, weiter nach München zu fahren. Ich wartete auf die Antworten der zahlreichen Universitäten, bei denen ich mich für beinahe ebenso zahlreiche Fächer beworben hatte. Alles Nicht-Bayrische interessierte mich. Ich erstickte unter den Möglichkeiten. Wem sollte man antworten, wenn die Welt rief? Die Freiheit lastete auf mir, die Luft über den Beeten und Sträuchern stand bis über die Häusergiebel wie ein gläserner Keil, unendlich klar, unendlich schwer.
»Geh nach Berlin, hörst du?« Meine Großmutter, die mich längere Zeit beobachtet hatte, setzte sich auf einen Gartenstuhl. »Geh nach Berlin. Er würde es sicher gewollt haben.«
Ich senkte den Kopf. Aus den anderen Gärten hörte ich Wassergeplätscher von den Bassins, Gläser auf einem wackeligen Tablett. Plötzlich trat eine Stille ein, die etwas Gebogenes und drohend Einsames hatte, wie die mit Sonnenlicht bestäubten Flügel eines Raubvogels.
»Ja«, sagte ich erschrocken. »Ich gehe nach Berlin. Ich werde Geschichte studieren. In der Geschichte kommt alles vor, und ich habe ein unmenschliches Gedächtnis. Und dich werde ich jeden Monat besuchen.«
»Anton Mühsal, nimm den Mund nicht so voll. Ruf Anselm an, er wird dir helfen.«
Auch dieses Mal empfing sie mich auf dem mit Waschbetonplatten ausgelegten Weg, der das Haus von einem ringsum führenden Blumen- und Sträucherbeet trennt.
»Ach — der Anton«, rief sie, als wäre ich ganz unerwartet gekommen. »Mager siehst du aus!«
Während sie mir ein Frühstück zurechtmachte, betrachtete ich ihre Hände, die gekrümmt und alterssteif über der blankpolierten Fläche des Ofenherdes schwebten. »Daß du so lange bleibst, diesmal«, sagte sie, anscheinend noch nicht überzeugt.
»Ich werde oft in München sein. An den Wochenenden zumindest.«
»Ach.«
Sie spürte, daß ich ihr etwas vorenthielt. Zwar versank ich auch diesmal in eine von der Wärme und dem gleichmäßigen Bullern des Herds wolkig aufgelöste Stimmung. Aber ich sah die eisige Steinglätte der Ostsee vor mir und das Haus auf Fehmarn — gläsern, hell, weiß —, die Stationen meiner zweiten Geburt.
»Ist er zu stark?«
»Was, bitte?«
»Der Kaffee, Anton Mühsal«, sagte meine Großmutter erheitert.
Auch sie hatte immer für unbayrisch gegolten. Sie war im Ruhrgebiet der zwanziger Jahre aufgewachsen. Nach dem Krieg fand sie einen Bürojob bei der britischen Militärverwaltung. Dort lernte sie meinen Großvater kennen. Fünf Jahre lang schlugen sich die beiden mehr schlecht als recht durch, bis eine völlig unerwartete Erbschaft ihnen die materiellen Sorgen abnahm. Sie kauften das Haus in Bayern; meine Großmutter entwickelte eine späte Leidenschaft fürs Lesen und eine noch größere für den einstmals verwilderten, rings um das Haus ansteigenden Garten.
»Sein Arbeitszimmer«, sagte ich zögernd, bevor ich in das obere Stockwerk ging, um etwas Schlaf nachzuholen.
Sie hob aufmerksam den Kopf. Jedesmal wenn ich bei ihr zu Besuch war und arbeiten wollte, hatte ich das Arbeitszimmer des Großvaters benutzt. Beinahe zwanzig Jahre lang war nichts darin verändert worden.
»Ich will es renovieren. Die Wände sind gelb. Wenn du einverstanden bist, werde ich auch andere Möbel hineinstellen.«
Sie lehnte am Ofenherd, eine Hand auf der Metallstange, an der sie ihre Geschirrhandtücher trocknete, und sah mich prüfend und nervös an. »Tu das. Es ist Zeit. Das heißt — wenn du dieses Mal so lange bleibst, für ein Jahr …«
4
Aus der unheiligen Familie
Seit drei Tagen bin ich in G. Abgesehen von einem kurzen Spaziergang und dem obligatorischen Besuch bei Luise und Wilhelm habe ich mich nicht vom Fleck gerührt. Morgen werde ich nach München fahren! Ich spüre ihre Hände auf meiner Haut, ihr Haar, die Wärme in ihren glatten Achselhöhlen, unseren Geruch, es ist, als habe man sie vor meinen Augen in der Luft verborgen, ich könnte schreien vor Begierde und still liegen, mit dem Kopf auf ihrer Hüfte, endlos reden, endlos zuhören.
Die Großmutter kam ins Zimmer, als ich mich am Telefon verabschiedete. »Wirst du sie mitbringen, deine Freundin?«
»Bald«, versprach ich. »Aber du mußt uns noch etwas Zeit lassen. Sie ist gestern erst angekommen.«
Vom Balkon aus sehe ich links unten die zerwühlte Dezemberlandschaft, hier die stumpfen Umbrafarben der aufgeweichten Erde, dort wirkt alles poliert, leuchtend in kaltem Regenglanz. Die Isar ist nicht zu erkennen. Der Wald, der ihren Lauf begleitet, scheint mit seinem filzigen Gewirr ganz über das Wasser gesunken. Vom Dorf gewahrt man nur ein Segment, die Obstgärten, einige nasse Dächer. In versumpften Grasdecken liegt fremd und unberührt die Straße wie ein Band aus Titan. Das verwitterte Holz des Balkons ächzt unter meinen Schritten. Wenn ich zwei Schritte nach rechts mache, kann ich um die Hausecke auf das Grundstück der »Oberen« und auf die Mauer sehen. Der humorige Jähzorn meines Großvaters, seine Streitlust … Seit er Luise, der ältesten Nichte meiner Großmutter, für einen mehr symbolischen Preis das zum Waldrand hin gelegene Grundstück vermacht hatte, schwelte zwischen ihm und ihrem Mann Wilhelm ein tiefer, im Vier-Wochen-Turnus auflodernder Konflikt. »Du alter verbohrter Spartakist!« — »Du Quisling des Kapitals!« — »Du Salon-Sozi.« — »Stalinist!« — So und ähnlich hießen ihre Lieblingsbeleidigungen.
»Warum hast du ihnen das Grundstück verkauft?« fragte ich gerne.
»Na ja«, antwortete mein Großvater, »es ist wegen deiner Großmutter. Weißt du, wenn sie niemanden mehr hätte, der sie an Zuhause erinnert, dann würde sie sich in Bayern total verloren vorkommen.« Hier ließ er eine Pause, um dann schmunzelnd, mit gespielter Verzweiflung fortzufahren: »Und ich hab ihn halt nicht, diesen verfluchten Ruhrpott-Dialekt!«
Das war mein Stichwort, und ich rief: »Aber dat üß doch nüch schwär!«
Heute ist die Mauer mit Efeu überwachsen, die das schiefgedrückte, um die Jahrhundertwende von einem Handwerksmeister erbaute Häuschen gegen das höher gelegene Gebäude abschirmt.
»Spätes Wirtschaftswunder! Bollwerkcharakter! Typischer Adenauer-Palast!« brummte mein Großvater, als er mit ansehen mußte, wie unter Wilhelms Direktive am Ende des Gartens eine strahlend weiße Klippe aufsprang, durchsetzt von bunten Glasbausteinen.
»Das ist eben sein beruflicher Ehrgeiz, den mußt du ihm lassen«, erklärte ihm Luise. In ihrem milchigen hübschen Gesicht sollte der Stolz, mit einem leibhaftigen Architekten verheiratet zu sein, niemals untergehen.
Die bajuwarische Mauer verdankt ihre Existenz einer ihrer Freundinnen. Auf einem Sommerfest im oberen Garten hatte diese sich plötzlich hoch aufgerichtet und mit ausgestrecktem Arm auf meinen Großvater gezeigt. Der alte Mann strebte auf seine Lesebank unter dem Birnbaum zu. Seine Pfeife hüllte ihn in eine träge Wolke. In der Rechten hielt er einen Rotweinkrug, und ein Band seines Lieblingsautors, Jonathan Swift, klemmte unter der Achsel des anderen Arms.
»Schaut!« gellte es ihm da in die Ohren. »Schaut, dort geht der alte Kommunist, genau so einer wie die hinter der Mauer!«
Fassungslos drehte sich mein Großvater zu ihr hin. Seine Augen verengten sich.
Wilhelm trat peinlich berührt einen Schritt von »Nimm sie nicht ernst«, sagte er halblaut, »sie ist betrunken.«
Seine Bemerkung kam zu spät. In dem sonnenverbrannten Gesicht meines Großvaters mischte sich die Wut mit einem plötzlichen Einfall. Ungeschickt, da ihn das Buch unter dem Arm behinderte, nahm er die Pfeife aus dem Mund. Dann wackelte er auf eine so gekonnt senile Weise mit dem Kopf, daß mir die Tränen in die Augen stiegen und eine Welle aus Scham und Rührung sich durch die Gäste bewegte, die um zwei rotgestreifte Gartenschaukeln und einen Grill versammelt waren. Und endlich, mir noch rasch zublinzelnd, legte er los. »Ha!« brüllte er »Betrunken? Mauer? — Jawohl, ich will eine Mauer, wie meine Brüder im Osten! Ich will Stacheldraht, ich will Minenfelder! Bluthunde und Kalaschnikows will ich, Scheinwerfer jede Nacht! — Hörst du mich, du revanchistischer Hornochse, der den Vornamen von noch größeren Hornochsen trägt? Wilhelm: Ich-will-eine-Mauer!«
Fast zwanzig Meter lang dehnt sich das Produkt symbiotischer Zwietracht nun aus. Der wilde Wein, den mein Großvater an ihren Fuß pflanzte, hat das Klima nicht überstanden. Efeu und Winden jedoch verwandelten die Mauer in kurzer Zeit in eine große Hecke, die während der warmen Monate grün aufleuchtet, im Wind zittert und rauscht, als befände sie sich im Flug. Jetzt, im Dezember, tritt das Backsteinrot wieder mehr in den Vordergrund, und sie steht still, wie von dem kahlen Flechtwerk an die Erde gebunden.
Im Arbeitszimmer schlägt mir jetzt der Geruch von Dispersionsfarbe entgegen. Das frische Weiß hebt sich zu stark von dem Holz der alten Bücherschränke ab. Ich habe einen hellen Teppich gekauft und ausgelegt. Mit einiger Mühe konnte ich das morsche Sofa auf dem Dachboden unterbringen. Schräg zum Fenster gestellt, wirkt der Schreibtisch weniger klobig. Die Sperre ist plötzlich nicht mehr zu begreifen, die zwanzig Jahre lang aus diesem kleinen Raum ein Museum machte. Ich spüre förmlich das Schulterklopfen des gelben Psychiaters. Man gewinnt den Eindruck, der Patient ziehe innerlich unentwegt wertdiskriminierende Vergleiche zwischen den Stationen seines Lebens und denen des älteren Mühsal, wobei ihm die Identität der Vornamen Anreiz zu überzogenen Parallelen bietet. Ein Impuls, den Großvater entweder durch magisch-mystische Umdeutung oder durch ein diffus empfundenes Stellvertretertum wieder zum Leben zu erwecken, ist unverkennbar … Nimmt man es mit der sterilisierten Sprache der Gemütsingenieure, dann kann einem in dieser langen Geschichte nichts zustoßen. Aber auch auf meiner Seite läßt die Luft sich atmen, zunächst mit der Not eines Erstickenden, nach Tagen und Wochen dann schon etwas leichter; am Ende wird es die einzige sein, in der Menschen leben können. Ich erzähle von meinem Großvater, weil mir die Klapsmühlentheorie nichts mehr anhaben kann. Ich bemühe mich sogar, sie zu stützen, und suche das letzte Indiz. Sämtliche Schubladen des Schreibtisches habe ich auf dem neuen Teppich ausgeleert, alle Kartons auf dem Speicher, auch die Mappe mit den Zeichnungen und Aquarellen durchwühlt, selbst die alten Briefe, die ich früher kaum anzufassen wagte, geöffnet und einen nach dem anderen gelesen.
Zwei Funde. Der erste ist ein Farbspritzer auf dem Rand eines Malblocks. Ich bin nicht sicher, kalkuliere ein Ausblassen, die jahrzehntelange Oxidation mit ein. Das Grün aus den anderen Räumen! — Oder doch ein Zufall? Ich bin mir nicht sicher. Dürfte ich so erschrecken, wäre mir die Klapsmühlentheorie tatsächlich ganz gleichgültig?
Dann der Brief Elisabeths, meiner eigentlichen, das heißt leiblichen Großmutter:
Nürnberg, 7. Oktober 1951
…
Geliebter!
Das ärgert Dich, wie ich diesen Brief anfange. Aber noch mal: Geliebter!! Jetzt darf ich das sagen. Wie mir alles gleichgültig geworden ist! Vor dem Spiegel — ich bin todkrank, Geliebter —, meine Haut ist fleckig, die Augen sind [unleserliche Stelle; A. M.]. Ich tu mir so weh, wenn ich mich anschau. Mit 59 zu sterben ist nicht leicht, glaub mir. Erinnere Dich, wir waren ein Liebespaar. Ein Jahr lang. 1914. Scheiße. Du hattest keine Schuld. Oder doch?! Weil Du so stolz warst!
Ich hab Dich ausfindig machen lassen, von einer Detektei.
Du hast was Einfaches geheiratet. Ein Arbeitermädchen, comme il faut. Amen. Scheiße! Erinnere Dich: der Sommer 1913. Die Expressionistenausstellung am Stachus. Wie heiß es war, schwül. Ein Gewitter war angekündigt, seit Tagen, man wurde verrückt wie von einer viel zu lang gestauten Lust. Es roch nach Bier und Staub und nach Pritschenleder von den Kutschen. Wie albern ich war! In einem weißen Tüllkleid. Ich hatte ein sanftes Gesicht, nur etwas zu groß, mit breiten Backenknochen. Es ist zerstört, dieses Gesicht! Wachsgelb und stumpf. Ach, Geliebter. Ein Himmel wie Lapislazuli, habe ich vor einem Gemälde gesagt. Natürlich, es war Zirkonblau. Ich habe Dich sofort gemocht, geliebt, haben wollen. So anders warst Du. Und Dein Zimmer, in dem nichts drinstand. Nur die Plakate an den Wänden. Und ein einziges kleines Waschbecken. Wie in einem Hurenhaus.
Daß ich nie die Arme um Dich gelegt habe »dabei«! Ich weiß, ich war fürchterlich, lag da wie zu einer Kreuzigung. Ich mußte mir die Kleider von unserem Dienstmädchen borgen, um mich in Deinem Viertel nicht zu schämen. Um nicht erkannt zu werden, sagtest Du. Ja, auch deshalb. Jetzt würde ich Dich festhalten. Daß aus Jürgen — unserem Sohn! — nichts geworden ist … Weil ich Dich nicht festgehalten habe, so dachte ich immer. Ich hab Sehnsucht nach Dir. Zwischen den Beinen. Mein Gott, ich bin ein Skelett. War ich schön? Wir hätten mehr miteinander reden sollen. Im Frühjahr 1913 war ich in Italien gewesen, meine glatte braune Haut … Zu spät. Meine Brüste sind noch schön. Was für ein Unsinn. Ich möchte sie einem armen Mädchen schenken. Morgen schneiden sie mich auf. Es ist vergeblich, sie tun es nur, um nicht nichts zu tun.
Aber zum Schluß: Ich habe Dir 300.000 Mark überwiesen, ein Drittel von dem, was mein zweiter Mann zusammengerafft hat. Eigentum ist Diebstahl, oder? Alles ist abgesichert, habe mit einem Rechtsanwalt gesprochen und es schriftlich festgelegt. Falls die Familien-Mafia Dich angreift. Behalt es, ja? Wenn ich Dir etwas bedeutet habe. Weißt Du, ich glaube nicht, daß man völlig tot sein kann. Wir haben doch auch nicht völlig gelebt. Du warst sehr arrogant. Sei jetzt einmal bescheiden und freu Dich. Geliebter!!
Elisabeth
Ich frage mich, mit welchen Gefühlen mein Großvater diesen Brief gelesen hat. Er nahm jedenfalls das Geld — bescheiden geworden? Konnte er es ohne das Eingeständnis, Elisabeth geliebt zu haben, annehmen? Die Heftigkeit des Briefs muß ihm gefallen haben. Das ist sein Vermächtnis an mich, die Abneigung gegen das Gemäßigte, Vorsichtige, ein instinktives Zurückschrecken vor der Norm, ein Haß. Er floh viel später als ich und nicht ohne Berechtigung. »Fluchtimpuls« — damit überschreibt der Pat. die Biographie der männlichen Mitglieder seiner Familie. Der 1890 geborene Großvater habe diesen Weg vorgeschrieben. Nahezu ehrfürchtig schildert der Pat. dessen Leben. Anton Mühsal sen. sei der Sproß einer kleinbürgerlichen Familie gewesen, habe am Vorabend des 1. Weltkrieges Medizin studiert, das Studium aber abbrechen müssen, da ihm nach seinem Eintritt in die SPD die Familie jegliche materielle Unterstützung entzog. Mit einer Nürnberger Kaufmannstochter habe er 1913 ein uneheliches Kind, Jürgen C., den Vater des Pat. gezeugt. Als Sanitäter im 1. Weltkrieg, als Mitkämpfer der KPD in der bayrischen Räterepublik, als Brigadist im Spanischen Bürgerkrieg, schließlich als Emigrant in Frankreich und in England, von wo aus er 1945 mit der britischen Rheinarmee nach Deutschland zurückkehrte, bewundert der Pat. seinen Großvater, merkt indes kritisch an, jener habe sich nie auf das alltägliche, bürgerliche Leben verstanden. Mühsal sen. habe sich nie entscheiden können, ob er Grafiker, anatomischer Zeichner, Buchillustrator oder wirklich Maler sei, und es beruflich zu nichts gebracht. Die Begabung sei beachtlich, aber ungeformt gewesen, wohl nicht groß und drängend genug, um den Großvater wirklich und ganz Künstler werden zu lassen. Das Künstlerische sei in einem gewissen Sinne auch auf ihn, den Pat., überkommen, als Tendenz, Lösungen im dunkeln zu suchen und Widersprüche zu Visionen zu verdichten. Das fehlende Talent habe ihn jedoch auf die Leinwand seines Gehirns zurückgeworfen, ihm nur die »Kreiden des Wahns« gelassen. Die Erbschaft durch die leibliche Großmutter des Pat. habe es A. M. senior schließlich in den fünfziger Jahren ermöglicht, »aus dem Leben zu fliehen« und ein sich selbst gegebenes Versprechen einzulösen. Dieses Versprechen nannte er »inneres Jüngstes Gericht« und meinte damit die Aufgabe, die zeitgeschichtlichen und persönlichen Umstände zu bilanzieren und vollständig zu begreifen, die sein Leben bestimmt hatten. Es ist nur schwer möglich, den Pat. zu Angaben über die Biographie der Eltern zu bewegen. Diese Auskünfte, erklärt er, könnten doch anamnestisch nur dann interessant sein, wenn der ihn behandelnde Arzt sich einer biologistischen Richtung verschrieben habe.
Was an meinem Vater soll auch anamnestisch oder sonstwie interessant sein, mit Ausnahme der Flucht, die er mit neunzehn oder zwanzig antrat, um der teppichgedämpften und porzellanreichen, flüsternden Welt zu entkommen, in der er aufwuchs und in der Elisabeth, nie wieder entgleitend, ihren Traum vom mutigen Leben versteckte. Die Wirklichkeit griff nach ihm. Was er ihr entgegensetzte, war nur eine schäbigere und lautstarke Version der merkantilen Praktiken, die das gotisch zugespitzte Bürgerhaus seiner Kindheit errichtet hatten. Im Todesjahr der Republik stellte er einen windigen Kleinspekulanten und Warenvertreter vor. Während der Naziherrschaft kroch er als Sportreporter bei einer fränkischen Provinzzeitung unter, den Widrigkeiten von Einberufung und Front auf ungeklärte Weise entgehend. Nach dem Krieg schließlich erreichte er den Gipfelpunkt seiner Karriere: als Schieber und Schwarzmarkthändler.
Anfang 1946 muß ihm Margarethe in die Hände gefallen sein. Sie war mit entfernten Verwandten aus Ostpreußen geflüchtet. Ihre Eltern sollten erst in einigen Monaten folgen. Auf dem einzigen Foto, das ich von der Frau, die mich geboren hat, besitze, lehnt sie in einem blumenbedruckten Sommerkleid gegen den Stamm einer Pappel. Ihr Gesicht, in dem sich die wäßrige Blässe der schwarz-weiß fotografierten Baumrinde wiederfindet, hat wie ihre Arme und Brüste eine Art klassischer Enttäuschtheit. Die Lippen sind zu schmal und der Hals, der ein wenig verdreht aussieht, zu mager, um ein Wort wie Melancholie anzuwenden, das doch eine gewisse Sinnlichkeit voraussetzt. Da bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme für meinen Vater eine Frau ein Stück Fleisch war, das man für ein Paar Seidenstrümpfe und fünfzehn amerikanische Zigaretten zum kurzfristigen Gebrauch erstand, ist es entweder sehr bezeichnend oder völlig schleierhaft, weshalb er auf den Gedanken kam, ausgerechnet mit Margarethe eine Familie zu gründen. Er führte Margarethe dem Nürnberger Clan vor, um sich von der Mischung aus Genugtuung, Indigniertheit und naserümpfender Dankbarkeit für die Lebensmittelpakete, die er mit ins Spiel brachte, abgestoßen zu fühlen. Mein Großvater, den er bislang gerade zweimal aufgesucht hatte, empfing die junge Frau mit scharf beobachtender Freundlichkeit. Aber als Jürgen ihn mit seinem Gütersegen zu beglücken gedachte, schlug er ihm die Tür vor der Nase zu und verfluchte den Augenblick, in dem er sich »mit der Bourgeoisie im Bett gewälzt« habe (schon bei Lassalle hätte man ja sehen können, was dabei herauskäme).
Eineinhalb Jahre später tauchte Margarethe wieder bei ihm auf. Ihr Blick war stumpf und seltsam erdhaft. »Ich weiß nicht mehr weiter«, flüsterte sie atemlos. Sie hob die wie erstorbenen Arme — und alles wäre ganz im Sinne herzergreifender Dramaturgie verlaufen, hätte mein sechs Monate altes Gesicht nicht im Zuge nässender Erleichterung eine ausgesprochen blödglückliche, bis zu den rosa Ohrläppchen grinsende Fröhlichkeit überzogen. Trotz dieser Rücksichtslosigkeit gelang es Margarethe, meinem Großvater den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Sie besaß keinen Rückhalt mehr. Von ihren Eltern, die bald in der Westzone eintreffen sollten, gab es für den Sündenfall keine Gnade zu erwarten. — Und Jürgen? — Nach gut einem Jahr bürgerlichen Eifers hatte er sie sitzenlassen. Kurz danach war er im Verlauf einer zwielichtigen Aktion ums Leben gekommen.
»Wie soll man daraus einen anständigen Menschen machen?« sagte mein Großvater, sich über meine improvisierte Wiege beugend, zu Eva-Maria.
Vor einem Vierteljahr erst hatten sie geheiratet. Margarethe unterdessen war nach einigen Tagen, die sie zunächst mit hysterischen Selbstvorwürfen, dann, ihrer tieferen Natur folgend, mit dem heiligen Trübsinn eines verletzten Tieres verbracht hatte, wieder hinaus in den Frühling der englischen Besatzungszone geflohen. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. Von seiner Mutter spricht der Pat. stets als »Frau, die mich geboren hat« und rationalisiert dies mit dem Hinweis auf die Präzision des Ausdrucks in seinem Falle. Sie nie kennengelernt zu haben, bedaure er nicht. So sei ihm der Augenblick erspart geblieben, in dem man zu dem seines Erachtens größten Satz der Bibel genötigt ist: »Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?« Viele Christen hätten nie verstanden, was das bedeute.
Als Margarethe mich zu meinem Großvater brachte, im zweiten Frühjahr nach dem zweiten Krieg, arbeitete er wieder als Illustrator, lustlos und wie sein Freund Anselm ohne Chance, jemals genügend Rente zu beziehen. Lerchen flatterten in einen blausamtenen Himmel ohne Gedächtnis. Junge Birken glänzten neben zerbrochenen Gleisanlagen. Immer noch füllten sich die Straßen mit Leiterwagen und ausgemergelten Gestalten. Aber es galt schon als peinlich, aus einem Konzentrationslager befreit worden zu sein. Unter der erwachenden, Maikätzchen und Gräser austreibenden Erde wuchsen die neuen Dummheiten heran, die neue Unverschämtheit. Es war ihm nun beinahe gleichgültig. Mit fast sechzig Jahren wurde er frischgebackener Adoptivvater. Vielleicht nahm er meinetwegen die Erbschaft an.
Meine frühesten Erinnerungen datieren schon in die Phase des Jüngsten Gerichts, der Einlösung jenes jahrelang gehegten Versprechens, in die Tiefe der Zeit einzudringen, die ihn auf dem Kontinent umhergeworfen hatte. War ich ihm im Weg? Oder tröstete ich ihn? Die Jahre bis zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstag verzeichnen jedenfalls noch angestrengte Bemühungen, das Versprechen einzulösen. Er wühlte sich durch Berge von Literatur. Die Kontakte zu alten Freunden wurden wieder geknüpft. Wenn ich den hinterlassenen Briefen folge, dann muß in dieser Zeit auch eine größere Serie von Radierungen, Ölbildern und Tuschezeichnungen entstanden sein. In fast allen Mitteilungen aus dieser Zeit scheint er diese letzte künstlerische Anstrengung erwähnt zu haben — als die wichtigste seines Lebens. Die Antworten der Briefpartner sind, sofern sie darauf eingehen, neugierig und irritiert; man spürt ihre Verwunderung darüber, daß sich ein Sechzigjähriger ein solches Projekt vornehme. Nicht eine der Zeichnungen ist erhalten, während er doch selbst Arbeiten aus den frühen Weimarer Tagen sorgfältig in Mappen verwahrte. Mit einem Schlag mußte er aufgegeben haben. In den Briefen finden sich Nachfragen, was denn aus seinem kühnen Vorhaben geworden sei. Sie sind zum Teil von einer gewissen Häme, zum Teil ebenso irritiert wie die ersten Reaktionen auf seine Ankündigung. Nichts wird deutlich, auch das für mich Entscheidende nicht: nämlich der Verdacht, daß mit mir, dem damals gerade Fünfjährigen, der jähe Abbruch zusammenhing.
Hier nähere ich mich der dunklen Stelle. Es gibt Anzeichen. Etwa den leuchtend grünen Fleck auf dem Rand des Malblocks. Etwa das Erschrecken und Ausweichen der Großmutter. Sie drängt mich in die Deutung zurück, die ich bis vor wenigen Tagen noch selbst geglaubt habe. Die gestalterische Kraft und Objektivität sei dem alten Mann abhanden gekommen. Das Erlebte, das Elende und Hoffnungslose, mit dem er sich unweigerlich wieder konfrontieren mußte, preßte ihm das Herz zusammen. Nach einer depressiven Phase von einigen Wochen unternahm er eine Reise nach Südfrankreich. Zurückgekehrt, sei er zu der Einsicht gelangt, daß er seine letzten Jahre genießen und nicht mit schwierigen Projekten belasten solle.
Er wurde Großvater mit ganzer Seele, las nur noch englische Romane, philosophische Abhandlungen und naturwissenschaftliche Zeitschriften. Der Zauber unserer späteren Gespräche kam aus diesem Entrücktsein, als redeten wir vom Mond herab, auf den er sich wünschte, ohne es rechtfertigen zu können.
»Du hast wirklich keine Idee, was aus den Arbeiten geworden ist, die er in den fünfziger Jahren gemacht hat?« frage ich meine Großmutter.
Sie schüttelt den Kopf, schweigt.
»Was waren die Motive, mit denen er sich beschäftigte?«
Bilder vom Krieg, erklärt sie, es sei zu lange her, um mir noch Genaueres zu sagen.
Soll ich ihr die Briefe zeigen? Ich hasse es, ihr wehzutun. Seit ich die Geschichte mit Elisabeth besser kenne, bin ich noch befangener als zuvor. Ich könnte ihr eine Stelle vorlesen aus einem Brief Anselms: Dein Paket ist angekommen. Klar, ich hebe die Sachen für Dich auf. Aber weshalb machst Du nicht weiter? Nur wegen des Zwischenfalls? So etwas läßt sich doch in Zukunft leicht vermeiden. Ich bin jedenfalls beeindruckt! Alles kommt wieder nah und brennt auf der Haut. Es ist Dir schrecklich gut gelungen, mein Lieber. Ich sehe den Plakatmaler vor mir, wie er in dem Tulpenbeet herumtrampelt, die Straßenbahn, seinen Kopf … Denk darüber nach. So lange Dein sorglicher Archivar …
Nun, Anselm wird mich im April besuchen. Bis dahin kann ich warten. Und gleich, wie die Antwort ausfällt — sie mag dem gelben Psychiater gefallen, an das Große und Endgültige rührt sie nicht.
Ich lese und arbeite. Draußen windzerfegte Nacht. Im aschfahlen Himmel steckt der Mond wie eine blendende Diskusscheibe. Das Teleskop meines Großvaters liegt, in ein Lederfutteral gebettet, auf dem Speicher. Daneben, an einen Balken gelehnt und mit den Krallen den Ast umfassend, auf dem sie festgeklebt ist, die verstaubte Eule mit den Glasaugen. Man muß an die Astronomie glauben. Sie hat bewiesen, daß der Glanz des Mondes nur der Widerschein des atomaren Feuers in der Sonne ist. Wer möchte dort noch hin? … Der Flug in die Dämmerung. Jede Stunde setzen wir dazu an, Tausende, Zehntausende, schließlich ein jeder, überall. Vielleicht durch ein Meer violetter Blüten stoßend, durch einen Vorhang aus Schmerz und Licht.
Ich muß mir klarmachen, was ich hier schreibe, was ich vorhabe. Alles so erzählen, daß auch die Klapsmühlentheorie zu ihrem Recht kommen kann, Hanna. Einblicke lassen für den Fall, daß meine Sensationen nur dem Raum entsprungen sind, den der Wahn und die Träume öffnen.
Was jetzt? Vielleicht sagen, daß ich mir niemals so unwichtig vorgekommen bin.
Es gibt keine Grenze mehr. Keinen Vorgarten, kein Nest. Ich. Nur eine Trübung im farblosen Kristall des Rätsels.
Und trotzdem werde ich frei sein.
Ruhe.
Nein, ein Ausfall noch: ICH HABE EINEN ENGEL GESEHEN!
Zweiter Teil
Etwas nähert sich
1
Das Leuchten zu Marseille
Ich bin versucht zu sagen, in Südfrankreich habe alles erst angefangen. Aber der Anfang könnte ebensogut der Tod meines Großvaters gewesen sein. Oder die erste Nacht mit Patrizia. Wo fängt etwas an? Wir graben ja noch hinter Gott.
Ich lebte seit acht Jahren in Berlin, hatte Geschichte studiert und schrieb an meiner Doktorarbeit. Plötzlich versagte mein wunderbares automatisches Gedächtnis. Ich mußte länger und länger arbeiten, strukturieren, sortieren, Exzerpte anfertigen. Aber nicht nur mein Erinnerungsvermögen war gefährdet. Wenn ich einen Tag weniger als acht Stunden am Schreibtisch saß, fühlte ich ein kaum erträgliches, augenblicklich eintretendes Dümmer-Werden.
Man schlug mir vor, für eine Woche zum Ausspannen an die Nordsee zu fahren. Ich wehrte mich, behauptete — nur halb im Scherz —, daß die mehrtägige Abwesenheit der Bücher meinen Verstand schädigen würde. Allein Lukas hielt zu mir. Er hätte aber auch noch in einem tobenden Fußballstadion seine Philosophen zergliedern können. Die anderen in der Wohngemeinschaft — Hanna, Mansfeld, Irmchen, Walter, Helga — bespöttelten meinen Eifer oder bedauerten mich wie einen Kranken. Mit einem Mal wußte ich, weshalb die Leichtigkeit, mit der ich als Schüler gelernt hatte, verflogen war: ich brauchte überdurchschnittlich viel Ruhe, vielleicht sogar Einsamkeit. In irgendeiner Form mußte ich wohl auf dem Dorf leben. Jahrelang hatte ich mich bemüht, meine bürgerlichen Neurosen auszumerzen. Jetzt, in der Anspannung, schien es mir eher legitim, sie in Kauf zu nehmen, als meine Tage damit zu vergeuden, sie analysieren und hintergehen zu wollen. Es gab kein richtiges Leben im falschen. Wen kümmerte es schon, welche Verklemmung mich zur Arbeit trieb, wenn diese Arbeit brauchbar war? Meine Gefühle waren heftig und egoistisch. Ich kam nicht damit zurecht, daß Hanna mal mit mir, mal mit Mansfeld schlief, mal mit einer Frau und dann — das Schlimmste — wochenlang mit gar keinem. So gesund würde ich nie werden können. Ihr stand ein schwarzer Gürtel für Psychohygiene zu oder eine Wilhelm-Reich-Medaille.
»Du solltest vielleicht eine Therapie machen«, empfahl mir Irmchen. »Ich glaube, du kannst nicht leben.«
»Ich sollte vielleicht ausziehen«, gab ich zurück — und tat es dann auch, schied, Wochen später und nach etlichen Diskussionen, in Frieden. José, ein chilenischer Freund, hatte mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Er wollte in einem halben Jahr zurück nach Valparaíso; so lange könne man es gut zu zweit bei ihm aushalten. Danach würde ich allein über die Wohnung verfügen.
Schon in der ersten Woche nach dem Umzug atmete ich leichter. José arbeitete unter Hochdruck an seiner Doktorarbeit. Allendes Traum brauchte ihn. Er hatte Volkswirtschaft studiert und sollte eines der neu entstandenen Agrarreform-Komitees leiten. Wenn er sich sehr wohl fühlte, blies er auf einer kleinen Tonpfeife Motive von Villa-Lobos vor sich hin.
Endlich kam ich mit meiner Dissertation über die Frühphase der Weimarer Republik voran. Die Wohnung in Moabit lag ideal. Hier waren 1918 die Arbeiter des Nordens durch die Straßen zum Reichstag gezogen. Die Reste der tradierten Gefängnisse standen noch, die Liebknecht und Luxemburg, Mehring und Jogiches festgehalten hatten. Eichmann hatte um die eine Ecke gewohnt, Tucholsky um die andere.
Ein knappes dreiviertel Jahr nach meinem Umzug ging José nach Chile. Einige Wochen lang fehlte er mir sehr.
Dann versank ich. Die Kastanie vor meinem Arbeitszimmer in dem Dahlemer Institut und die Hinterhofmauer vor meinem Moabiter Fenster unterschieden sich für mich nur in der Art von Tapeten. Ich war glücklich — solange ich arbeitete. Ein beschriebener Bogen kam zum anderen, gleichmäßige, weiße Atemzüge. Die Monate zogen ohne Trennung vorbei, und die Wechsel der Jahreszeiten verblüfften mich wie unnötige Grimassen. Verständnislos prallte ich manchmal gegen den harten, präzisen Rhythmus der Stadt, kam zu spät zu Verabredungen oder stand abends mit einer blödsinnigen Wut, als handelte es sich um einen persönlichen Angriff, vor verschlossenen Ladentüren. Aber im Grunde hatte ich nur ein Problem: die Zäsuren. Das Ende eines schwierigen Kapitels in meiner Arbeit, ein erledigter Auftrag für Oberstetter (meinen Doktorvater und Gönner), eine gelungene aufwendige Recherche in den Archiven! Am besten war, sich lange auf die in einem solchen Fall anstehende Pause zu freuen und sie dann einfach zu übergehen, als hätte man die Gelegenheit zum Nichtstun nur durch irgendeinen Betrug herbeigeführt. Das »Leben« — was auch immer das sein mochte — verschob ich auf einen Zeitpunkt nach Erlangung des Doktortitels.
Hin und wieder besuchte ich die Wohngemeinschaft. Sie zerfiel etwa ein Jahr nach Josés Abreise. Lukas ging nach Frankfurt zu den Kopfakrobaten, Helga nach Indien in einen Ashram. Irmchen heiratete Walter. Es gab Tage, an denen ich glaubte, Hanna verliebe sich wieder in mich. Ich liebte sie grundsätzlich und konnte mir auch gar nichts anderes vorstellen, als daß wir irgendwann einmal zusammenkommen würden. Nur im Augenblick schien es nie möglich. So beschäftigte ich mich mit der Liebe wie mit dem Tod.
Im Oktober 1974 — nach der letzten Prüfung — entdeckte ich, daß ich Hanna schon ein Vierteljahr nicht mehr gesehen hatte. Von Walter erfuhr ich, sie sei mit Mansfeld und zwei anderen, mir unbekannten Leuten zu einer längeren USA-Reise aufgebrochen.