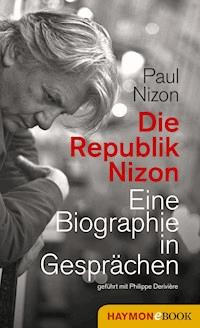35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
1961. Ein junger Mann Anfang 30. Sein erstes Buch, ein Erzählband, hatte Aufsehen erregt, die Kritik bescheinigte ihm Talent. Nun schreibt er an einem Rom-Buch. Es wird mit viel Vorschußlorbeeren bedacht, und ein bedeutender Literaturverlag will es herausbringen. Der Autor, der Beruf und Familie hinter sich läßt, um ganz im Schreiben aufzugehen, wähnt sich auf dem Olymp der deutschsprachigen Literatur. Als jedoch sein Buch 1963 erscheint, stößt es auf völliges Unverständnis. Den Autor, Paul Nizon, stürzt die Ablehnung seines furiosen Sprachkunstwerks Canto in eine Krise. Wie er sich daraus langsam wieder herauskämpft und in die deutsche Literatur zurückschreibt, davon handelt dieser Journalband.
Das Tagebuch aus den Jahren 1961 bis 1972 – der erste einer auf vier Bände angelegten Journalreihe – erzählt von den Versuchen Paul Nizons, sich gegen alle Widerstände seiner Identität als Schriftsteller zu vergewissern und diese Identität in der eigenen Existenz zu begründen. Vor dem Hintergrund der sechziger Jahre entfaltet es zudem die Stoffwelten und Formideen seiner Bücher von Canto bis Untertauchen. Aus diesem »Rohmaterial« seines gelebten Lebens, aus diesem »Stoff- und Gedankenspeicher«, der Werkstattbericht und Alltagsprotokoll in sich vereint, hat Paul Nizon nichts weniger erschaffen als einen Roman: den Roman seiner künstlerischen Heraufkunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Ähnliche
Paul Nizon
Die Erstausgaben der Gefühle
Journal 1961-1972
Herausgegeben von Wend Kässens
Suhrkamp Verlag
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2023.
© 2002, Suhrkamp Verlag AG, Berlin
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung nach Entwürfen von hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-518-77114-3
www.suhrkamp.de
Inhaltsverzeichnis
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
Nachwort
Personenregister
Chronologie zur Biographie
»Anderntags könnt ihr ihn ausrufen hören: ›O die Erstausgaben meiner Gefühle sind vergriffen.«
Canto
1961
24. März 1961, Zürich
Auf der Straße Max Frisch getroffen. Schock des Wiedersehens! Rom-Realität, unverhofft da; die schwierige persönliche Lage und die spezifische Bedeutung, die Frisch dabei hatte. Etc.
Er bestellt uns in die Kronenhalle. 22 Uhr, langer Tisch. Frisch und Dürrenmatt sitzen sich wie zwei Gewerkschaftsführer gegenüber, es wird Literaturpolitik betrieben. Jeder hat seine Gefolgschaft imaginär hinter sich. Anwesend sind Ingeborg Bachmann, der Studioleiter von Radio Zürich Samuel Bächli und seine Frau, etwas später kommt Kurt Hirschfeld, der Direktor des Schauspielhauses Zürich, hinzu. Es geht um Hirschfelds Projekt: Dürrenmatt und Frisch sollen bei Vorlesungsabenden im Schauspielhaus deutsche Dichter einführen, Frisch die ältere Generation (Rudolf Alexander Schröder, Böll etc.), Dürrenmatt die jüngere (Bachmann, Enzensberger, Grass). Bei beiden ist Herablassung, Spott dabei, latente Rivalität. Sie sehen sich ihrer letztlich nicht einschätzbaren Bedeutung: dem Ruhm, komischer Größe konfrontiert. Einer Ich-Repräsentation in öffentlicher Valuta. Durch die Währung gehören sie dem Publikum. Im Ruhmgewand, in der Rolle des Prominenten, zappelt und wehrt sich das Individuum. Dichter vorstellen. Gutmütig lästernde Witzeleien.
Frisch spielt auf alte Vertrautheit, Freundschaft an, nimmt von da das Recht zu vertraulichen Anzüglichkeiten, mokiert sich über das Rivalenverhältnis etc., wirft sich selber dem Gespräch als Beute vor. Selbstpersiflage? Dürrenmatt ist kälter, rücksichtsloser. Der Rahmen ist nicht ganz wahr, Theater? Im Grunde macht Dürrenmatt eine halbe Konzession, während Frisch den Weg einer Ecce-homo-Offenheit spaßig beschreitet, sich dabei viel mehr entblößt. Die Vertraulichkeit, Vorrecht der »Großen«, mit Institutionen wie Radio und Theater (bzw. deren Vertretern) in wegwerfenden Diminutiven wie Hirschi zu verkehren, sie schnell für etwas zu engagieren wie Frisch, der sich die Geste erlaubt, einen Kleinen, mich nämlich, an den Hof zu ziehen; er hat, wie er sagt und ich sofort merke, hemmungslos Propaganda für mich gemacht: irrsinnig gute Mischung zwischen Bern und Rußland (mein breites Lachen, »Seht ihr jetzt? So ist er ...«). Er setzt mich dem anderen Halbrussen, Bächli, gegenüber, der sofort »zum Geschäftlichen« kommt und mich bittet, ihm meine Sachen einzusenden (»Bitte: Vergessen Sie mich nicht!«), und Frisch: Bächli ist bereit, Großhonorare zu zahlen ...
Komisch, peinlich dieser Eintritt ins fremde Milieu.
Frisch rettet sich vor der Fragwürdigkeit des Berühmtseins in die Klausur der Arbeit in Rom. Sein Problem: uneingesehen zu leben.
1962
Sommer 1962, Zürich
Die Wirklichkeit, die ich meine, ist nicht ein für alle mal abzuziehen oder abzufüllen und in Tüte, Schachtel oder Wort mitzunehmen. Sie ereignet sich. Sie will verdeutlichend mitgemacht werden und eigentlich mehr als das: Sie muß hergestellt werden, zum Beispiel im Medium der Sprache. Deshalb schreibe ich. Die in der Sprache zustandekommende Wirklichkeit ist die einzige, die ich kenne und anerkenne. Sie gibt mir das Gefühl, vorhanden und einigermaßen in Übereinstimmung zu sein mit dem, was sich insgeheim wirklich tut. Mein Leben, von dem ich annehme, es sei einmal und einmalig, läuft auf diese Weise weniger Gefahr, in blind übernommenen Konventions- oder in irgendwelchen Idealkanälen dahinzufahren oder auf Lebzeit in Untermiete eingelagert zu bleiben. Es setzt sich nicht auf Dienstwegen mit der treibenden Instanz auseinander, sondern empfängt seine Impulse direkt.
Ich schreibe aus einem Lebendigkeits- und Wirklichkeitsanspruch heraus. Große Themen habe ich nicht an den Mann zu bringen oder in die Welt zu setzen. Ich möchte keinerlei Einfluß nehmen mit Geschriebenem, nicht belehren, nicht bekehren, nicht moralisieren, nicht aufrichten, nicht aufbauen, nicht verändern. Herstellen und vielleicht mich bekennen.
Aus dem mag hervorgehen, daß mein persönliches Leben für meine Arbeit von beträchtlichem Belang ist. Es ist der einzige Komplex, an den heranzukommen ich mir zutraue, es ist mein »Fall«, und ich bin weitgehend der Fall meiner Recherchen, der strapaziert werden muß. Was ich schreibe, wird demnach wohl unter autobiographistischer Prosa rubrizieren. Hoffen möchte ich, es erscheine auch unliterarisch, erweise sich als nicht erfinderisch, höchstens findend zustandegebracht, was schon abenteuerlich genug ist. Die Fronten von Leben und Arbeit kann ich mir nicht getrennt vorstellen, getrennt im Sinne eines Doppellebens, da natürlich die in der Sprachfindung hervorbrechende Gangart oder Figur mich mitverändert, mitnimmt in den Lebensraum, den sie aufsprengt. Ich möchte hoffen, die Ebene, auf der ich mich lebensbewußt und schreibend bewege, werde immer mehr mit dem »Schlachthausboden« identisch, den mein Kritiker-Freund Armin Kesser – unbestechlich, wortmächtig – für die Handlungsebene von Louis-Ferdinand Célines Reise ans Ende der Nacht namhaft macht. Den Begriff übernehme ich, um den Unterschied zur epischen Bühne herauszustellen. Vor der Frage, ob der Schriftsteller wem fromme, stelle ich mich auf den Standpunkt, die Ausübung dieses Berufs sei eine private Veranstaltung. Tatsächlich aber halte ich dafür, es sei ein Hauptgeschäft, unteilbar, und keine Nebenbeschäftigung.
Das einzige Kriterium für Qualität, Schönheit, Rang ist für mich das der Intensität, einer Intensität, die im Sprachzentimeter vibrieren muß. Ich kann mir nicht vorstellen, wo das Leben sonst zum Ausschlag kommen sollte, wo es in irgendwelche Fabelkonstruktionen, Weltanschauungssysteme, Sinnbilder nicht oder nicht mehr zu pressen ist.
11. August 1962, Zürich
Lieber Herr Max Frisch, es hat lange gedauert, bis ich mich zu irgendeiner Tätigkeit und dem mir immer drängender erscheinenden Brief an Sie aufraffen konnte. Ich bin nach meiner Rückkehr hierher so richtig verkommen, in Lethargie, in Traum- und Trauer- und Hilflosigkeits- und Unratswucherung versunken. Ließ mich dem Nullpunkt entgegentreiben, den ich als Rettungsmittel kenne und brauche in ähnlichen Momenten. Nun geht’s wieder, und das erste soll mein Dank an Sie sein.
Ich bin sehr dankbar für die Art, wie Sie mich in Ihr Leben, in Ihre Künstlerexistenz einblicken und mehr: eintreten lassen. Ich empfinde das durchaus nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als unverdiente Auszeichnung. Und wenn ich Ihnen auch nichts dagegen zu bieten habe, so sollen Sie immerhin wissen, daß meine Eintritte nicht mit arroganten Gefühlen einer anfängerischen Selbstherrlichkeit geschehen (die man mir vielleicht zuschreiben mag); was ich so von Ihnen zu sehen, fühlen und wissen bekomme, nehme ich zu den treu gewahrten und bedachten Dingen, die mir viel bedeuten, wenn ich mich auch noch nicht darüber zu äußern verstehe. Haben Sie denn Dank auch für diese neuerliche römische Begegnung.
Ich hoffe, daß ich dem Haus, das Sie uns aufschlossen, nicht ungebührlich zu nahe getreten bin.
Mich werfen ähnliche Ausbrüche aus endlich aufgebauten Arbeitskonstruktionen leicht um. Die Konfrontation mit nicht bewältigten Lebensorten, wie Rom einer ist, aktualisiert sofort ein Grundproblem meines Daseins und Arbeitens: das Problem der Berührungsmöglichkeit oder -Unmöglichkeit schlechthin, das wiederum alle Fragenkomplexe einer Existenz bis zu den Ebenen von Schuld oder nicht, Sein oder nicht und die Dinge, die mit dem Tod Zusammenhängen, aufsprengt. Und da ich alldem nur schreibenderweise mühsam gewachsen bin, so nämlich, daß ich das Zusammenschlagen der Wellen über mir abwehren kann, werde ich vorläufig noch leicht zum ausgesetzten Opfer. Aber vielleicht wird das mit kommenden Büchern erträglicher, vielleicht werde ich lernen, mir einen Erwachsenenlebensraum von einiger Unerschütterlichkeit zu sichern. Das werdende Buch hat jedenfalls meine zentralen, lebendigsten, eigensten, schwierigsten Dinge zum Stoffe, soweit ich sie eben erreichen kann, es ist mein Grundlagenbuch, mein leidenschaftlicher Kreuzzug, und niemand soll nachher meinen, ich hätte leichtfertig experimentiert oder gespielt; die Form könnte nämlich leicht zu solchen Mißverständnissen verleiten. Es ist einzig das Gefühl, daß ich an meinem wichtigsten Knochen nage und daß dieser Knochen auch außerhalb meiner Existenz einige Bedeutung beanspruchen dürfte, was mich manchmal Haltungen einnehmen läßt, die als Verblendung etc. wirken könnten.
Betrachten Sie bitte diese ungenauen Konfessionen nicht als Belästigung, sondern vielmehr als Erklärungsversuch für vielleicht anstoßerregende Erscheinungszüge meiner Person bei Ihnen in Rom.
Allen Dank nochmals. Mit herzlichem Händedruck
1963
April 1963, Zürich
Brief an Karl Markus Michel
Lieber Herr Michel, endlich bekommen Sie das Manuskript, ich weiß nicht, ob ich verschlimmbessert oder verbessert habe, wirklich nicht, denn Distanz ist das keineswegs, mein jetziger Standort. Ich hoffe darauf, dass das andere Bild im Fahnenabzug mir eine letzte richtige Einstellung und Einschätzung vermittle.
Einige Überlegungen selbsttheoretischer Natur, die mir zwischenzeitlich durch den Kopf gingen, möchte ich Ihnen schnell unterbreiten. Nicht, daß ich auf deren Verwendung in einem Ankündigungstext aus wäre: Ich liefere Ihnen eigene Splitter als Diskussionspunkte, weiter nichts. Also:
Meine Sprache ist nicht eine sachbezeichnende. Sie bedient sich vielmehr irgendwelcher Stoffe, irgendwelchen Materials (Beschreibungs-/Einbildungsmaterial), um das ANDERE zu sagen. Sie armiert sich geradezu mit Realitätssplittern (Reisedingen, Straßeninventar etc.), aber es geht nicht ums Reisen, um die Straße, um Rom, um ein objektives Erfassen angeschlagener Motive. Vielmehr darum: mit diesen Gegebenheiten meine Melodie zu klimpern, mein Geheimnis zu pfeifen. Das Andere. Das Eigenste. Das Unfixierbare. Das Unbeantwortbare. Das Abstrakte als Thema?
Da ich keine Fabeln habe und kein Interesse daran, aber Besessenheit, mich auszudrücken, nehme ich irgendeine Situation oder Fiktion und tauche mich wie einen Reagenzstoff da hinein, beobachte mein Strampeln und Fortbewegen und dies in der Hoffnung, es lasse sich in Worten, Sätzen, Phrasen die Gestik und Gestikulation eines Individuums gewinnen. Die Parodie, meinetwegen, einer Individuumsgangart.
Ein alter Wunsch von mir: die Wortparade. Wortgestikulation. Den Stummfilm mit Worten.
In solchem stummfilmhaften Wortgebrauch müßte sich doch auch eine Individuumshaltung und eine Weltoptik evozieren lassen.
Denn es stimmt, daß ich mir eigentlich keiner Überzeugungen bewußt bin. Daß keine Zentralhaltung (einer Figur) zustande kommt, daß ich pluralistisch denke, fühle, einsetze. Daß äußerlich thesenartig höchstens eine Unzufriedenheitsdeklaration aus dem Buch resultiert. Aber im Spannungsverhältnis der stummen Gesten, der Ichs, der Rollen siedelt vielleicht doch ein vom Leser reproduzierbarer Mensch.
Ich bin mir bewußt, als Stilmittel das Leiern und Verseln, die Wiederholung, den Parallelismus zu gebrauchen. Das sind lauter Vorschiebungen halbwacher Phrasen, vorhandener populärer Tonarten, da ein Direktgefühlsausdruck nicht möglich ist. Das ist ein Kaschieren, ein Verschlüpfen, um dennoch mich äußern zu können.
Mit Robert Walser fühle ich mich tatsächlich in einzelnem sehr verwandt. Ich sagte Ihnen schon, daß ich völlig unliterarisch heranwuchs, aber sehr früh den ganzen erhältlichen Walser las und sehr liebte.
Ich bin froh, das Buch bei Ihnen in sehr guten Händen zu wissen. Schreiben Sie doch auch wieder. Auch von Ihrem jetzigen Eindruck.
Herzlich
29. April 1963, Zürich
Nachtrag zum Brief an Karl Markus Michel
Ich bin ernsthaft unterwegs. Das ist sicher. Ich bin ein Schiff, das nicht nur Takelage putzt und pflegt: das wirklich alles hißt und ausläuft, Wasser zu durchpflügen, unterwegs zu sein, vielleicht ein falsches Westindien zu sichten, jedenfalls aber etwas zu entdecken. Das abstößt, alle Segel setzt, alles setzt, fährt. Alles mitnimmt. Das sich wendet, bäumt, zerschlissen und gehoben sein will und auch das Fallen nicht fürchtet. Anders wiederzukommen.
Hatte keinen Plan, keine Kuppel, keinen Hut. Also blieb ich immer in der grotesken Situation, Lehmkügelchen zu kneten, Fäden in Maschen zu knüpfen und nicht zu wissen wozu. Wozu dies, wenn man beim besten Willen keine erzählenswerte Story, kein vertretenswertes Manifest, keine lebenswerte Idee hat und finden kann? Tausendmal sagte ich mir, ich sei kein Schriftsteller und die Passion, die mich vor Einzelnem, Kleinstem wie vor einem Weltwunder erstarren ließ, neugierig, anbetend, es wiedermurmelnd, es drehend, knetend, spitzend, zungenschlagend, kostend, erprobend, ergreifend, die Passion an Einzelheiten, nach denen ich griff wie ein Ertrinkender, aber auch wie ein Lüstling, Genießer, der das Wunder des Klangs erfährt, den verheißenden Zupflaut einer Geigensaite ... diese Passion sei der Schabernack eines Schöpfers, der sich den Spaß leistete, einen armen einzelnen ungenügend ausgerüstet, aber hochalarmiert loszuschicken.
Diese Passion blieb. Und dazwischen blieben die klaffenden
Fragen, die Ratlosigkeit. Blieben die Löcher. Ich hatte eigentlich nie Zeit zu was Rechtem, war immer präokkupiert oder nachhängend. Wie das alles erschwert hat! Das Studium, die Werkstudentenjobs, die erste Berufstätigkeit als Familienvater.
Kam nicht zum Zug im Brotberuf und kam nicht vom Fleck mit meiner Passion. Zwischen zwei Stühlen, selber bloß eine Rauchringefolge.
Wenn ich zwischendurch eine Stille hatte, ausfiel aus dem Betrieb, überkam mich die Ahnung, mein Beruf könnte sein, so taugenichtisch vor der Arena der Erscheinungen zu sitzen, den Schienensträngen zum Beispiel, dem rostbetäubten Schotter mit den Funken, den Rauchstößen und -schwänzen der Lokomotiven, vor diesem zuckenden Vielgeflecht, am Rand der Fußgängerstraße, ihren Stoßzeiten, selber geschützt durch eine Hecke, die vielleicht den halbprivaten Park zu Füßen des Gerichtsgebäudes einfaßt, die aber auch Blicke erlaubt zu Balkonen von Häusern, die unten city wärts sich wolkenkratzerartig in den Himmel stemmen, Balkonen, hinter denen man Ehezwistgezische im Zigarettenrauch mitzubekommen wähnt, während das Fuhrwerk der Güterzustellung wie ein Nomadengefährt den Berg hinanächzt, Erscheinungen, Nebeneinander, das in Atem hält, das ein angespanntes Beobachterauge am Leben erhält, den Taugenichts in den Zeugenstand und Beruf des Zeugen hebt, wer hat sonst Zeit? Wer ist ebenso unparteiisch wie er? Wer läßt die Hauptsachen, in denen die einzelnen wie in Gummizellen rasen ... wer sonst kann diese Hauptsachen entschärfen, diese scharf ragenden Wichtigkeiten niederstoßen in die Teppichebene des Vielgeflechts, kann den Teppich weben? Wenn nicht er. Ein Beruf. Dies. Diese Ahnung. Damals.
Ging folgerichtig vielerlei Berufen nach, als Gymnasiast schon, nach dem Abitur, als Werkstudent später. Nicht unbedingt aus Geldnot, diese empfand ich nie als echtes Problem, mehr aus Neugierde. Die Welt des Bauplatzes, die Welt als Verwaltergehülfe des Baumaterialienlagers, als Nachtarbeiter auf dem Bahnhof, Bahnpostgehülfe, als Eilbote und Zeitungsausträger, die Stadt immer aus anderer Perspektive, zu ungewohnten Zeiten, die gleiche Stadt in immer anderen Aspekten. Hunger nach Tuchfühlung. Genugtuung damals, knapp nach Absolvierung des Gymnasiums, wenn ich die ehemaligen Kameraden neu ausstaffiert, linkisch in der Paraderolle des frischgebackenen Studenten passieren sah, und ich: als Bauhandlanger unterwegs. Wollte nicht an die Universität, erarbeitete ein Sümmchen, um nach Kalabrien auszureisen, Schriftsteller-Initiation, aber auch Werker unter Landleuten, so was schwebte mir vor, und es sollte weitab sein, am Meer, anderen Kontinenten gegenüber, gleichviel, man würde weitersehen, auf Wanderschaft gehen. Mißglückte kläglich, also kehrte ich heim. Zwei Jahre später nahm ich ein Studium auf, ein geschichtliches sollte es sein, das mir ein Koordinatensystem liefern würde, das allernötigste Wissen. Hatte bis dahin keine Augen, sah nichts, hörte nur Klänge, Lauschen in eigenen Mauern, im Sodbrunnen des Selbst. Und nun Kunstgeschichte. Ich lernte schauen, entwikkelte den Augensinn. Wurde gar Kunstkritiker, zuerst nebenamtlich, neben einer Assistentenstelle, die ich an einem historischen Museum innehatte. Aber der Nebenberuf kräftigte die Eigenperson im Beamten, und das Formulieren war befriedigend, jedesmal ein Sieg, wenn etwas zusammen- und zustandekam, ein sprachlich geschlossenes Stück. Ja, und dann ging das eigene Schreiben los. An einem größeren Plan, der »Bericht aus einer Stadt« heißen sollte, scheiterte ich. Griff deshalb auf meine Einzelheiten zurück, griff einige heraus, sah zu, wohin das führte, wie so ein Kuchen aufging. So entstanden Die Gleitenden Plätze, der Erstling.
Nachtrag zum Brief: Zwei Skizzen aus dem Rom-Jahr
Venedig
Bin abwesend und auch in Venedig gewesen. Nach laubbimmelnden Ebenen, verstaubt, setzt sich immer stärker Gleißen durch in der Luft, saugt die Weite des Landes auf, und jetzt das Meer. Metallreflexe schaukeln auf Wellentellern, golden funkelndes Wasser. Die Stege zum Vaporetto am Canal, die über Wasser schaukelnden Koffer, das Schaukeln, Wiegen jeglichen festen Dings auf immerbewegten Wasserschalen, auf die die Lichtspeere stechen. Geschmeidegefunkel, dazu das Tönedurcheinander. Und dann auf dem Markusplatz, auf der königlichen Rampe, die dich die paar Bühnenschritte tun läßt. Über das Wasser fährt ein Eisenbahnzug, fährt ein Lastwagenzug, drüben die Kuppeln, ihre Lichtfängerei. Die Müdigkeit des Angekommenen, in Bann Geschlagenen. Seine Ergebung. Es rieseln Goldtand und Kettengeschmeide durch die Stille, alle Brücken springen krumm, die Palazzi dichten Bogen und Fassaden und fabeln bröcklig bizarr. Alles wasserunterspült, kein Baum, kein knurrendes Auto, nur Trittegeflüster, Echolabyrinth für konsonantische Laute.
Ein Begräbnis zu Wasser. Totenpomp der schwarzen silberbeschlagenen Barken, die Witwe sitzt vor dem Sarggehäuse. Alle Namen totentraurig, San Bárnaba, San Zaccaria, von Vaporetti angeschnauft. Alles Leben kürzeste Bühnentat, der Fischmarkt gleißt, die Sprache gleißt, das Licht zehrt aus, die Schar der Leidtragenden bleibt, vom Priester bewacht, als schwarzer Klumpen an der Rampe des Seitenkanals, von wo die Boote abstießen, zurück. Ich möchte als Hund den Mond von Venedig anheulen in diesem ausgehöhlten Narrenhaus, Kunstsiechenhaus.
Nachts im Záttere. Die dunklen blinden Kanäle, verworfen daliegende Boote in einem Aschenfluß von Vergessenswasser, das die Seele angiftet. Der Wind flattert in Tüchern, treibt Blätter auf und durch ein Gäßchen, macht Hände daraus, die sich an ein Tor klammern. Abends auf dem Markusplatz peinigend schöne Geigerei aus vergangener Zeit, um süßes Traurigsein zu nähren, Todeseinverstandensein. Süchtiges Bleiben. Wieder weg, die traurigen Namen anfahren: San Barnaba, San Zaccaria. Nehmt die Sonne weg. Äschert die Stadt ein in eine traurige Tulpe, schwarze Rose.
Fahrt auf die Insel Giglio
Zuerst das Meer von Erde, gehäufter Erde. Entlangrollen an Schollen, offenliegender Dunkelheit, Ruhig-Rauhem, von seltenen Piniengruppen überdacht ... Latium. Dann das andere Meer. Das Meer vorerst nur Gischtlinien, vielfach anrollend. Der Begriff Kamm, das Aufgesteckte, Aufgesetzte, auf wogende Wasser gesetzte Kronenkämme. Barackenartige Strandbars, das Gestreute, Obdach für trällernde, sofort verebbende Musik und lustiges Lungern. Die Küste zu Linien zusammengezogene Sehnsucht. Strandgut. Das Vorläufige ergibt sich aus dem Gegenüber von ewigkeitsdonnernder Monotonie.
Das Schiff schlingerte bei der Überfahrt, hob und senkte sich.
Tief stach der Bug in die Tiefen, ließ Wellen einschlagen und überfallen, dann hob er sich wieder steil empor. Das Fallen. Sichbäumen und wieder Fallen; und das Gefühl des Ungeheuren, bodenloser Wassermassen, grollender Tiefen, bereit uns zu verschlingen.
Am Horizont, gefleckt von verschiedenen Helligkeiten, ein Hochseeschiff. Die zierliche Silhouette, nichts als zarte Zakkenandeutung, länglich sich verlierend, zweckloses Ornament. Und der Rauch fährt mit, malt Kringel und Schornsteinbläserei, malt Illusion von Rauch über Dächern, Herd und Abend und Häuslichkeit da hinein. Nichts als ein kleiner fahrender Boden, ausgesetzt den abgründigen Wassern, drohenden Tiefen, und die Tapferkeit des Dagegenwollens, Mut und Vertrauen solch einer alles wagenden Plattform, die ja nur ein winziger Strich ist zwischen Unendlichkeiten und einen Namen, auf dem Bug zu lesen, voranträgt und mit Rauchfahnen über Horizonte kriecht. Illusion verteidigend mit Flaggenstolz.
Und blond ist die Insel. Vom Meer aus nichts als ein kraus ragender Felsenkopf, karg überwachsen von Büschen, Kakteen, Ölbäumen, Thymian, Rosmarin, Reben. Dem Unartikulierten der Meereseinsamkeit antwortet die vielfältigste pflanzliche Formphantasie. Der Feigenkaktus. Die stachligen Teller. Verschleifen sich unten zum Tragkörper Stamm. Und entfalten sich oben närrisch aus Warzenadditionen, und auf den fleischigen Tellern liegen die länglichen Früchte auf, rot und stachlig auch sie.
Ich bin wie eine Ziehharmonika, die immer von neuem die Vortakte, die Auftakte keucht. Hochgemut zuversichtlich – und dann nicht weiterkommt. Es wächst die Erwartung (und dann der Unmut), aber zur Melodie kommt es nie.
Nie zur erlösenden Melodienfigur, die schmeichelnd ausschönt mit allem, die in offene Arme, in Drehungen, Kreise, in die Schwingungen, in die Schwingen nimmt: Nie.
30. April 1963, Zürich
Was ich nicht leiden kann: in einem Buch zu lesen: »Camillo zündete sich eine Zigarette an, tat einen tiefen Zug« etc.
Vertrage nicht den Schwindel einer so simplen durchsichtigen Arroganz. Schon die Vergangenheitsform ärgert und reizt mich.
Die Verkleidung (in Name, Drittperson und Vergangenheitsdistanz) ist mir dubios. Ich merke, daß ich unbedingt die saubere Klarstellung der Schreib-Situation fordere. Die Gegenwart. Daß einer zugibt: Ich schreibe, ich will schreiben aus dem und dem Grund, muß schreiben, werde schreiben, scheint mir nötig. Hier steckt die Realitätsverankerung heute, da man über Geschichten nicht so einfach verfügt. Die Dinge nicht so einfach erzählen kann.
August 1963, Zürich
Skizze eines Werkbeleihungsgesuchs
Das Buch, für das ich als Arbeitstitel die Wendung »Haus und Schiff« benütze, setzt stofflich da an, wo im Canto der Film der frühen Jahre ab- oder die Ebene der Vaterstadterinnerungen verläuft. Haus und Schiff haben konträre Bedeutungen, in die das Roman-Ich verspannt ist. Der Schreibende hat sie als Fotos bei der Arbeit vor Augen.
Das Haus ist ein Koloß der Jahrhundertwende, schattig, sauer, mit vielen Stockwerken, Kammern, Gemächern, Gängen, mit riesenhaften Dachboden- und Kellerbereichen, mit Vorgärten und Hinterhöfen. Zwanzig Jahre des Lebens der Ich-Figur und wechselnder Bewohner sind da untergebracht. Entsprechend viel Zeit wird da verstaut, in die Fächer des Dings gestopft und stillgelegt.
Das Schiff ist die Gegenwelt, die ständig gegenwärtige Ausbruchsvision des Hausgefangenen. Ein Verwandter von ihm ist auf diesem Schiff von Rußland nach Amerika ausgelaufen. Das Schiff ist das dynamische Motiv, Transportmittel der Phantasie und des Revolutionsgedankens. Beide Bereiche gehören der Hauptfigur als eigene Stoffwelten zu. Sie sind als Motive darüber hinaus gegnerische Lebensgesichtspunkte. Ihrem ständigen Vergleich, ihrer Vergegenwärtigung untersteht das Leben der Hauptfigur.
Das Haus vertritt die Kategorie der Lebensverkleidung, der verscherzten Freiheitsrechte; des autonom gewordenen und gegen seinen Schöpfer und Sinn sich wendenden Gebrauchsdings. Des dämonischen Objekts. Das Schiff steht für die Illusion der freien Wahl, der Selbstbestimmung, des »Anderen Landes«.
Beide Motive sind unversöhnliche Bewußtseinspositionen, die dazu dienen, die Realität des Heranwachsenden und seiner Welt heraufzusteigern.
Der Prolog ist eine Evokation dieser gegensätzlichen Motive aus der Perspektive des Erzählers, der die beiden Fotos vor sich hat und sie in langen emotionalen Zitierungen einem monotonen Vergleich unterzieht. (In der Art: »Während das Haus ... so und so ... dasteht,... plätschern die Wellen, raucht der Schornstein...) Unmerklich wechselt die Distanz, und das Bild des Hauses auf dem Foto geht in die Gegenwart des Hauses an der Straße über, in dem als Foto das gerahmte Schiff des Ahnen hängt.
Nun ist das Gesagte keineswegs ein zwingendes Programm. Ich gehe nämlich nicht von einem Plan aus, ich taste mich an Stoffkomplexe heran.
Ich gehe von Dingen aus: Materialien, Gegenständen, Möbeln, Balkonen, Gärten; und von ihren Figuren und Statisten. So wie ein Maler damit anfängt, daß er die Leinwand mit Farben einer bestimmten Tonart und Skala nährt und anreichert, beginne ich mit einzelnen losgelösten Passagen, Szenen, Eruptionen, Monologen, Beschreibungen, Erinnerungen, Gesprächsfetzen... den Erfahrungskomplex, den ich anvisiere, zu umreißen und einzukreisen. Dies vorläufig ohne Sorge um Zusammenhang, ohne solche Absicht. Das ist die Phase der Materialbereitung. Ich schreibe mich kreuz und quer an meine Welt heran und in meine Welt hinein. Im Moment unter dem Hilfsbegriff des Themas »Haus und Schiff«.
Nach einem bestimmten Sättigungsgrad (den ich beim Schreiben des Canto erst im vergangenen Sommer erreichte – wenn das zur Klärung beitragen kann) ordne ich lesend meine Stücke nach ersten Formvorstellungen zu einer Rohfassung an. Nach dieser Rohfassung lege ich im Ab schreibeverfahren, jedoch dauernd korrigierend, neu konzipierend, eine erste richtige Fassung an. Dabei splittern dauernd neue Teile ab, die vielleicht ihren Auftritt erst an einer viel späteren Stelle des werdenden Buches haben werden, andererseits gewinne ich bei diesem Herstellungsgang meine kompositorischen Einfälle für die endgültige Bucharchitektur. Etwa in der Sichtung der Haupt- und der Nebenmotive, der Auftakte, der Kapitelteilung etc. Diese »Abfälle«, die ich an Leinen vor mich hinhänge, so daß ich sie jederzeit vor Augen habe, werden später eingesetzt oder sonstwie fruchtbar. Beim Canto habe ich diese Fassung sodann auf Band gesprochen und beim Abhören nochmals auf Umstellungen, Schwächen hin mit Vermerken versehen. Es folgen die teilweisen Neufassungen.
Entschuldigen Sie die langwierige Beschreibung meiner Vorgehensweise, die ja für andere nie eine Wichtigkeit haben kann, von mir aber angeführt werden mußte, um Ihnen vor Augen zu führen, weshalb ich keine Kapitel einsendereif habe. Seit Anfang diesen Jahres befinde ich mich im Stadium des beschriebenen »Anreicherns«. Diesen Arbeitsgang werde ich vielleicht Ende des Jahres abgeschlossen haben. Aber auch die Rohfassung, die ich dann in Händen halte, könnte ich fremden Augen noch nicht ausliefern.
Wenn ich hoffen darf, Sie gewännen aus meinen Darlegungen den Eindruck, daß ich mitten in einem neuen Buch bin: Wenn ich ferner annehmen dürfte, Sie könnten aus dem Geschriebenen unter Berufung auf den beigelegten Canto das Vertrauen fassen, mir eine Förderung zu bewilligen, dann wäre mir sehr geholfen. In diesem Sinne bitte ich Sie, mein Gesuch einer wohlwollenden Prüfung zu unterziehen.
28. Dezember 1963, Zürich
Gestern Frisch getroffen: Hatte den Eindruck, daß er zu meinem Begräbnis gekommen war. Er hatte sich einige Tage in Zürich über den »Fall Nizon« informieren lassen, hatte festgestellt, daß ich es fertiggebracht habe, sehr viel Mißgunst, Hohn, Unwillen auf mich zu ziehen. Ich fragte ihn, wie er die jetzige Situation des Canto beurteile. Er meinte, das Buch sei nicht untergegangen, nicht begraben, aber sehr mit Fragezeichen belastet, mit Infragestellung. Mit dieser schweren Belastung sei es vorläufig noch »da«. Warum die Großen unter den Berufskritikern nicht an das Buch herangingen, fragte ich, was seine Meinung sei. Lustlosigkeit, wenig Anreiz, kein Interesse vielleicht, meinte er. Aber das bleibt merkwürdig. Und bisher unerklärt. Keiner der das wirklich Experimentelle darin erkennt, keiner der auf die Sprache, die Sprachexpedition eingeht. Aufs Instrumentarium. Ob sie’s nicht sehen? Martin Walser meinte, es sei in dem Buch ein Widerspruch zwischen dem Aufbau, der »spinnend«, unter Verzicht auf Anfang und Ende und jeden Ideal-Zusammenhang und jede Ideal-Rundung, ohne Handlung, ohne solche »Kunst« auskomme und eine äußerste Position der Innovation bezeichne und der Sprache, die gefräßig, schwelgerisch, reich, ungewohnt verspielt sei. Hätte ich ein klar erkennbares Rezept als Aufhänger mitbeigegeben, dann würde es das Buch leichter gehabt haben.
Frisch: An manchen Stellen sei für die meisten Leser einfach kein »Problem« zu erkennen, es bleibe bei einem Privatproblem – überall da, wo kein »Stoff«, keine Anleitung, kein Unterbau mitgeliefert werde. Da, wo das Material für die Problematik, das epische Material dabei sei, aus dem der Canto gewonnen werde, sei’s gut. Vielerorts bleibe es in der Privatluft hängen. Vielleicht. Aber ein Sprachbuch. Man nehme mir übel: Arroganz, das durch und durch Unsolidarische, das bis zum Verleumderischen gehe.
1964
Januar 1964, Zürich
An Gerhard Hoehme
Es sind tatsächlich schwierige Zeiten eben jetzt, ich könnte sie als »Prüfung« bezeichnen. Denn weit über den finanziellen und prestigemäßigen Mißerfolg hinaus hat mir das Buch etwas eingebracht, das man als Animosität empfinden muß. Eine Animosität, die durch den Vorwurf Canto hindurch auf meine Person abzielt. Ich habe vielleicht einiges von der hochgespannten Verlagsstimmung unbewußt assimiliert und also auch manifestiert – wie hätte das anders sein können, wo man mich unter Bedingungen, wie man sie sonst nicht kennt, zum Verlag geholt, beim Verlag behandelt hat und wo man mein Manuskript in einer Weise quittierte, die schöner nicht zu wünschen gewesen wäre: als ein »ganz wichtiges Suhrkamp-Buch«, als »bedeutende Arbeit«, als »echte Dichtung«? Wenn ich mich zurückdenkend befrage, dann scheint’s mir schon möglich, daß mir so der »Kamm schwoll«, mehr als er es ohne diese Behandlung getan hätte, und daß ich mich schon selbstverständlich in die Prominenz einreihte (ich wurde ja auch von der Prominenz selbstredend aufgenommen). Ich erwähne das, weil Du mir einen Vorwurf in dieser Richtung machst, wenn Du schreibst, ich habe nur allzu deutlich mein Talent zur Schau getragen. Das war mir allerdings nicht bewußt. Wenn ja, bin ich ganz einfach dem Literaturbetrieb nicht gewachsen gewesen. Aber Du tust ja geradezu so, als sei durch das Buch das Gegenteil von Talent erwiesen. Da würde ich mich doch sehr dagegen verwahren. So niedergeschmettert bin ich auch wieder nicht, daß ich an meinen Realien zweifelte. Ich empfand das Buch bei Abschluß des Manuskripts als Äußerstes, das mir möglich war, als gelungen, wenn ich auch an manchen Stellen vielleicht ein ungutes Gefühl hatte, aber überall da war mir Besseres nicht möglich gewesen.
Ich hatte im großen Ganzen den Eindruck, auf Grund und in meinem Revier angekommen zu sein und auch etwas Exemplarisches unternommen zu haben. Ich habe nämlich wirklich mit meiner Ohnmacht der Themenlosigkeit ernst gemacht und konsequent aus Banalität Sprache, das heißt Wirklichkeit gezimmert. Andererseits habe ich da und dort Privates als Füllsel eingesetzt, einer Kunstvorstellung zuliebe. Das sehe ich erst jetzt. Aber was an Sprachgestik, an einer »action«-Prosa realisiert ist, das wird man erst später einmal würdigen, da bin ich mir sicher. Du hast Dich ausführlich mit dem Buch abgegeben, man spürt’s, und ich danke Dir für diesen Ernst und Einsatz. Du sagst viel Richtiges dazu. Du gehst aber auch zu weit: dann nämlich, wenn Du vorschlägst, wie das Buch hätte aussehen sollen. Mit der Vaterfigur als einziger Figur zum Beispiel. Ich gebe zu, daß das Anläufe-Machen mein Prinzip ist, daß das Nichtankommen dazugehört und eben die Möglichkeiten für Stein und Ding, für ein Kommunizieren in dieser Richtung und ein Realisieren der lebendigen Stilleben, mitbringt. Aber meine Intention ging ebenso auf die »lächerliche« strampelnde Figur. Der »Hurenhirt« hat Stellen, die ich zum Besten im Buch zähle. Die Maria-Story, aus lauter Einkreisung und Aussparung gemacht, ist ein Experiment, das ich noch auszubauen haben werde. Die Figuren brauchte ich, wenn sie zugegebenermaßen auch nicht die gleiche Ebene halten wie das Übrige. Nein, da geht Deine Vorstellung an meiner Intention vorbei. Ich wollte den Autor mit seiner Plag und Müh mitgeben. Ich glaube auch nicht, daß er für alle so peinlich bleibt, wie Du es empfindest.
Ich habe mir Unmut, Zorn, ja Verfemung vieler Leute zugezogen durch etwas, das auch mit zum Buch gehört, aber weniger das Buch ausmacht als die Person des Schreibenden charakterisiert. Das sind Züge der Anmaßung, eines prinzipiellen Unsolidarischgehens, des Lästerns, der Überheblichkeit etc. Ich bereue das nicht, schließlich wollte ich mit diesem Buch so viel wie möglich über mich, meine Standorte, meine Schwächen auch, erfahren. Und die meisten, die ich verletzte, ohne daran zu denken, sehe ich auch nur allzu gern endgültig von mir entfernt. Ich sehe ein, diese Züge des Buches sind vielleicht überflüssig, sie ziehen die Aufmerksamkeit und den Zorn nur zu sehr auf sich und verdecken die Qualitäten oder trüben das Auge für sie.
1965
1965, Zürich, Delphinstraße
Skizze eines Ärgernisses
Wie er da draußen steht unter dem lächerlichen Vordach unseres windigen Abbruchhauses, dieser Ratten-Arche: halb Hausierer, halb Clown im immergleichen Anzug (notdürftig instand gehalten), aber rasiert, mit geputzten Schuhen und Fingernägeln, den weißen Polenschädel mit den goldbraunen Augen glänzend unter dem fahlen Haar, das sich lichtet: der geborene Schnorrer, der Andreher, wie er leibt und lebt: immer beschäftigt mit seinen obskuren Besuchen in Ateliers, bei Freunden, Waschweib und Kretinfresser: halb unterwürfig, halb anmaßend. Verräterisch und treuherzig, ein Widerspruchsbündel; wie er dahererzählt: Neuigkeiten anderer, deren Schwächen, Schicksalsmotive. Er verkauft sie mir zur Deckung irgendeiner Schuld.
Was für ein Hausierer-Schnorrer.
Mit seinen festen Stationen in der Stadt und im Tageslauf, dieser Unbehauste: Zahnbürste dort deponiert, wo er zurzeit nächtigt, Kleider anderswo... Rasierzeug bei einem »Kunden«, wo er an sich einige Zimmer anstreichen müßte, in Wirklichkeit aber bloß Bad und Eisschrank und noch Kochherd benutzt. Geht jeden Morgen als erstes dahin, um sich zu baden, zu rasieren, einige Eier zu kochen. Dann kommt er beispielsweise zu mir – je nachdem: um Geld aufzutreiben oder irgend etwas zu besprechen. Danach – ich kenne längst nicht alle Stationen dieses beschäftigten Nichtstuers, gefährlichen Menschen, Romanschreibers (wie alle wissen seit einiger Zeit) und Rasenden Rolands.