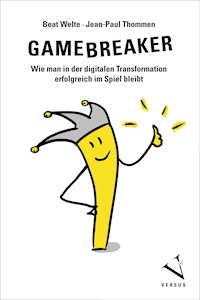Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Friedrich Reinhardt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es beginnt ganz harmlos: Li Rösti führt die Tochter eines Erlenbacher Kunsttycoons aus, um seiner Stiefmutter einen Gefallen zu tun. Doch plötzlich wird er in eine haarsträubende rasante Mordserie verstrickt. Als diskreter Ermittler im Familyoffice seines Vaters ist Rösti zwar verzwickte Fälle gewohnt, aber hier tappt er im Dunkeln. Und mit jedem weiteren Anschlag wird die Sache noch rätselhafter, denn der Täter schreibt über jede Leiche die Worte «Die erste Blüte». Bald ist klar, dass der junge Ermittler dem Mörder erst dann auf die Spur kommt, wenn er die rätselhafte Bedeutung der Worttrias versteht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Projektleitung: Alfred Rüdisühli
Korrektorat: Daniel Lüthi
Gestaltung: Siri Dettwiler
eISBN 978-3-7245-2801-2
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-2754-1
Verlag: Friedrich Reinhardt AG, Rheinsprung 1, 4051 Basel, Schweiz, [email protected]
Produktverantwortliche: Friedrich Reinhardt GmbH, Wallbrunnstr. 24, 79539 Lörrach, Deutschland, [email protected]
Der Friedrich Reinhardt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
www.reinhardt.ch
Inhalt
Cover
Title
Inhalt
Für Maxime, Mika und Tom Hiro
Die Figuren und Ereignisse in diesem Buch sind rein fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig.
«Die sind alle ein bisschen nervös in Bern. Hast du es?» Mein Vater sah mich eindringlich an.
«Kein Problem, alles paletti», antwortete ich salopp und überreichte ihm das Dokument, auf dem in fetten Buchstaben das Wort «GEHEIM» stand.
«Hast du es gelesen?», fragte er mich.
«Nein, wozu – ich bin Pazifist!», erwiderte ich keck, was mir einen missbilligenden Blick einbrachte. Unser Gespräch war ihm sichtlich unangenehm.
«Hat sie es gelesen?», wollte er wissen.
«Sie kann nicht lesen. Ihre Fähigkeiten liegen eher auf dem Gebiet rhythmischer Bewegungen.» Das Knurren meines Vaters sagte mir, dass er nicht zum Scherzen aufgelegt war.
«Sie hat mir versichert, sie habe es nicht gelesen. Sie hat auch keine Kopie davon angefertigt oder Seiten fotografiert. Keine Sorge», versicherte ich ihm. «Ich habe ihr klargemacht, dass sie den Vorhang des Schweigens über die Ereignisse legen muss, um nicht plötzlich arbeitslos zu werden oder gar noch schlimmer: einen plötzlichen Unfall …»
«Genug, das will ich nicht hören», stoppte er die Ausführungen. Als Jurist war ihm nur allzu klar, dass es manchmal besser ist, gewisse Dinge nicht zu wissen. Nötigung kann in der Schweiz mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Als Chef einer auf Diskretion bedachten Organisation wollte er Resultate – aber nicht unbedingt Kenntnis der Methoden, die zu den gewünschten Ergebnissen führten.
«Und das Geld?»
«Das behält sie!»
«Was?», entfuhr es ihm. «Fünfzehntausend Franken?! Das ist unverschämt.»
«Na ja, wir wissen ja nicht, welche Dienstleistungen sie genau dafür erbracht hat. Je nachdem ist es viel oder auch angemessen», meinte ich scheinheilig. «Wenn du willst, kann ich bei ihr nachforschen, was genau …»
«Nein. Schon gut!» Er lehnte sich zurück und bedeutete mir damit, das Treffen sei zu Ende. Das Gespräch war ihm peinlich. Wir bewegten uns auf einem schlüpfrigen Gebiet. Und auch in einer rechtlichen Grauzone. Aber nur bei sehr wohlwollender Betrachtung. Bei näherer Betrachtung galt es alle möglichen Gesetze des Schweizer Strafgesetzbuches im Auge zu behalten, die den Verrat von nationalen Geheimnissen ahnden. Ich trank meinen Macallan-Whisky aus, erhob mich aus dem bequemen Chesterfield-Ledersessel und steuerte wortlos die schwere Türe der gediegenen Bibliothek in unserer Villa am Zürichberg an, um mich in mein unprätentiöses Gärtnerhäuschen im weitläufigen Anwesen zu verziehen.
«Du vergisst die Affäre sofort!», rief er mir nach.
«Welche Affäre?»
Wahrscheinlich werden Sie sich nun fragen, um welche kriminellen Ereignisse es hier geht und wie Ihr Held, nämlich ich, der beste, klügste und – vielleicht die wichtigste Eigenschaft – verschwiegenste Ermittler auf diesem Planeten wieder einmal die Welt, oder zumindest die Schweiz, gerettet hat. Easy, kann ich Ihnen sagen, es war in diesem Fall nicht mehr als eine einfache Fingerübung für mich. Und das ging so: Die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Schweizer Parlamentes weilte vor zwei Tagen auf einer Reise in Taiwan. Diese Abwesenheit nutzte ihr Mann, selbst ein prominenter Autor und Professor an der Universität St. Gallen, um sein asketisch-akademisches Leben durch fleischliche Freuden mit einer Escortdame aufzulockern. Das war nichts Aussergewöhnliches, und böse Zungen behaupteten sogar, er tue dies mit der expliziten oder zumindest impliziten Duldung seiner politisch ambitionierten Gattin. Weil diese in sicherer Distanz im fernen Taiwan weilte, kam der gute Professor auf die unselige Idee, sich von der eskortierenden Dame in das Pied-à-terre seiner Ehefrau in Bern begleiten zu lassen. Was dort genau vorgefallen ist, wissen wir zwar nicht. Aber was wir wissen: Am nächsten Morgen stellte der gute Professor mit brummendem Schädel fest, dass das Pult seiner Gattin deutlich leerer war als zu Beginn der fleischlichen Ausschweifungen am Vorabend. Ein Kontrollanruf bei der Taiwan-Reisenden ergab: Es fehlten tatsächlich ein Umschlag mit fünfzehntausend Franken und ein als «GEHEIM» eingestufter Bericht des Generalstabs der Schweizer Armee. Zwar war der gute Professor klug genug, das Fehlen besagter Dinge auf einen Einbruch zu schieben und die Damenbegleitung tunlichst zu verschweigen. Nur war seine Frau leider auch Mitglied der Geschäftsprüfungskommission des Parlamentes. Als solche war sie dermassen geübt darin, plumpe Lügner zu entlarven, dass sie den wahren Sachverhalt nach einer hochnotpeinlichen Befragung des Ungetreuen innerhalb von wenigen Minuten herausfand.
Die Politikerin geriet in Panik. Nun wissen wir nicht, was der Auslöser dieser Panik war: die Tatsache, dass die Vorsitzende der Sicherheitspolitischen Kommission einen Umschlag mit einer derart hohen Geldsumme einfach so auf ihrem Pult liegen hatte – justament zu einem Zeitpunkt, zu dem die Schweiz beschloss, das Verteidigungsbudget massiv aufzustocken. Oder ob es das Abhandenkommen des als «GEHEIM» eingestuften Dokumentes war, das die grosse Vorsitzende in ihrer Hast nicht, wie es eigentlich vorgeschrieben war, weggeschlossen hatte.
Wie gesagt: Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen: Die Schweizer Armee und alles, was daran hängt, hatte nach dem Ukraine-Krieg viel an Prestige und Aufmerksamkeit gewonnen. Jahrzehntelang war die Milizarmee Vorlage für schlechte Witze gewesen: Sie sind grün angezogen, irren im Wald herum und wissen nicht, was sie tun – das ist noch einer der harmloseren Witze über die Armeeangehörigen. Einige politisch Verwirrte – für die ich durchaus Verständnis habe – wollten diese Witzarmee sogar schon ganz abschaffen.
Der russische Angriffskrieg hatte das alles verändert, was die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission eigentlich freuen sollte. Aber sie wusste nur zu genau, dass das geweckte öffentliche Interesse einherging mit einem deutlich erhöhten politischen Preis bei Unglücksfällen und Verbrechen, wie etwa dem vorliegenden. Und deshalb beschloss sie, nicht zu tun, was sie eigentlich hätte tun müssen: nämlich das Bundesamt der Polizei, den Nachrichtendienst des Bundes sowie den Militärischen Nachrichtendienst über den Vorfall zu informieren. Oder zumindest einen der drei Dienste. Die Politikerin entschied anders: Sie wählte die Nummer ihres Parteikollegen und Obersts a. D., meines Erzeugers.
Den brachte sie mit dem Anruf mächtig in die Bredouille, was seine humorlose und verknorzte Art in unserem Gespräch erklären mag. Denn einerseits wusste er als Jurist nur zu genau, dass er sich strafbar machte beim Versuch, das Ganze unter den Teppich zu kehren. Aber andererseits: Wer könnte einer so mächtigen Frau einen Gefallen abschlagen? Zumal mein Vater in einer Branche arbeitet, die nicht selten auf Gefallen aus Bern angewiesen ist. Dr. Adrian Rösti ist nämlich der Gründer und Chief Executive Officer der Swiss Rennweg Capital Preservation Alliance. Zu Deutsch: die «Rennwegkapitalerhaltungsallianz». Hinter dem dämlichen Namen verbirgt sich unser Multi-Client Family Office. Angesiedelt an bester Lage am Zürcher Rennweg, schützen unsere mittlerweile siebzehn Schlaumeier einige ausgesuchte Reiche dieser Welt vor finanziellem Ruin und dem Zugriff von Steuervögten. Durch kluge Finanzanlagen und steueroptimierende Trusts und ähnliche finanzielle Konstrukte erhalten sie das Kapital nicht nur, sie mehren das Vermögen der Klientel sogar, womit sich unser Unternehmen mittlerweile einen Namen gemacht hat. Ganz nebenbei hat sich die «Rennwegkapitalerhaltungsallianz» indes auch einen anderen Ruf erworben: nämlich hinsichtlich der Fähigkeit, unappetitliche Geschichten ihrer illustren Klientel diskret zum Verschwinden zu bringen. Dieser Ruf ist bis zur einflussreichen Politikerin nach Bern gelangt.
Und damit kommen wir zum vielleicht wichtigsten, mit Sicherheit aber völlig unterschätzten Mitarbeiter des Family Office: nämlich zu mir, Li Rösti, Sohn des Oberkommandierenden. Trotz meiner familiären Nähe zum Machtzentrum des Unternehmens bin ich eindeutig ganz unten in der Hackordnung anzusiedeln, was sich an zwei Äusserlichkeiten ablesen lässt: Mein Büro ist eine Besenkammer, und mein Parkplatz liegt am weitesten weg vom Aufzug. Ohne Namensschild.
Wahrscheinlich werden Sie sich nun fragen, wieso ein so brillanter, geistreicher Mann wie ich sich das gefallen lässt, zumal mir mit noch nicht ganz dreissig Jahren die Welt offensteht. Die Antwort ist: Ich weiss es auch nicht. Eine frühere Freundin, die Psychologie studierte, führte meine Leidensbereitschaft in der Allianz auf einen Minderwertigkeitskomplex als Folge meiner kulturellen Entwurzelung zurück. Denn ich hatte die ersten zehn Jahre bei meinen Eltern in der Schweiz, die nächsten sechs bei meiner aus China stammenden, mittlerweile geschiedenen Mutter in Hongkong verbracht. Da die Hongkonger Immobilienmogulin sich lieber auf ihre Geschäfte als auf den pubertierenden Sohn konzentrieren wollte, wurde ich mit sechzehn nach einem bestimmten Vorfall in die Schweiz zurückgeschoben, damit mir mein militärisch geschulter Vater Zucht und Ordnung beibringen konnte. Das war zunächst gut und dann gar nicht gut gelungen. Zu seiner grossen Enttäuschung hatte meine akademische Laufbahn früh und abrupt geendet.
Falls Sie es wissen wollen: Die Beziehung zu besagter Freundin währte nicht lange, aber mein Enthusiasmus für Psychologie-Studentinnen blieb, und auch junge Damen anderer Studienrichtungen habe ich durchaus nicht diskriminiert. Der Enthusiasmus für das schöne Geschlecht und die Notwendigkeit, mich tagsüber von nächtlichen Ausschweifungen zu erholen, wurden indes zunehmend zum Problem. Nachdem sich meine Erzeuger geweigert hatten, mein schönes Dasein im Nachtleben von Zürich und anderswo zu finanzieren, war ich gezwungen, mich als Lohnabhängiger zu verdingen, und voilà: So kam die Rennwegkapitalerhaltungsallianz zum besten diskreten Ermittler dieser Welt.
Wenn Sie sich nun wundern, dass ein Family Office einen solchen Ermittler beschäftigt, dann muss ich Ihnen sagen: Sie sind vollkommen naiv. Denn die Reichen dieser Welt bewegen sich oft nicht nur in einer Grauzone des juristisch Zulässigen. Sie sind auch der Meinung, ihr Reichtum autorisiere sie, ungestraft moralisch anrüchige Wege zu beschreiten. Das reicht von Verfolgungsjagden mit italienischen Boliden über sexuelle Eskapaden bis zu Drogenexzessen oder zwanghaftem Pinkeln in der Öffentlichkeit. Mit dem «ungestraft» haben sie insofern recht, als es Menschen gibt, die darauf spezialisiert sind, die Folgen abzumildern. Oberstes Ziel dieser Vernebelungsaktionen: Solcherlei Fehlverhalten darf auf keinen Fall zu den gefürchteten zentimeterhohen Schlagzeilen in der nationalen Presse führen. Genau da komme ich ins Spiel.
Der Fall des seitenspringenden Professors war im Übrigen sowohl einfach zu lösen als auch informationstechnisch höchst einträglich für mich. Es war mir ein Leichtes, die entsprechende Dame zu finden, denn die Vertreterinnen dieser Profession wollen ja grundsätzlich immer gefunden werden. Sie liess sich überzeugen, es wäre besser für sie, das Dokument zurückzugeben und zu vergessen, dass sie es je genommen und – ja, leider – gelesen hatte. Denn es handelte sich dabei um das neueste Abwehrdispositiv der Trp (für alle Nichtmilitaristen: Das bedeutet «Truppe»), die Erneuerung der Infrastruktur und Logistik im Lichte des Angriffskrieges der Russen auf die Ukraine, wodurch sich auch die Bedrohungslage der Schweiz verändert hatte. Im Gegenzug versprach ich ihr, eben in einem Anfall akuter Amnesie vergessen zu haben, dass sie das Dokument gelesen hatte. Und ich erlaubte ihr, besagte fünfzehntausend Franken zu behalten, wenn sie mir im Gegenzug versprach, gelegentlich relevanten «pillow talk» weiterzugeben. Denn Bettgetuschel ist in Bern ganz besonders verbreitet. Wahrscheinlich werden Sie es mir nicht glauben, aber eine einfache Google-Suche wird Ihnen bestätigen: Während der Corona-Krise waren die Bordelle in der Schweiz geschlossen. Alle Bordelle? Nein. Ein einziger Kanton widersetzte sich der Schliessung, und zufälligerweise war es der Kanton, in dem Regierung und Parlament der Schweiz angesiedelt sind. Das nationale Boulevardblatt «Blick» titelte deshalb am 19. Januar 2021: «Corona sorgt für Boom bei Puffs – Viele Männer kommen in Bern». Sehen Sie nach – es stimmt!
Wenn Sie nun denken, es sei unethisch, mir von besagter Kurtisane Geheimnisse unserer schwer arbeitenden Politiker stecken zu lassen, dann muss ich Ihnen sagen: Sie sind sogar noch naiver, als ich gedacht habe. Denn natürlich braucht es bisweilen etwas Ermunterung, wenn man in meinem Geschäft ist. Beispielsweise wenn ein Strassenrennen der ungezogenen reichen Jugend vergessen werden soll. Oder ein demoliertes Hotelzimmer. Oder eine weisse Nase bei einer nächtlichen Strassenkontrolle. Die Franzosen und Westschweizer, die in diesen Dingen viel verständnisvoller sind, nennen das euphemistisch «corriger la fortune». Genau darum geht es: dafür zu sorgen, dass das Leben der Reichen nicht eine Wendung zum Schlechteren nimmt. Dann sind sie zufrieden. Und zufriedene Kunden lassen im Family Office die Kassen klingeln. Vor allem beschweren sie sich erfahrungsgemäss nie mehr über die saftigen Honorare der Alliance. Man ist in einer schwachen Verhandlungsposition, wenn die andere Partei weiss, wo die Leichen versteckt sind.
«Li, ich brauche dich.»
Eben bei meinem Gärtnerhäuschen angekommen, fuhr ich erschrocken herum. Tief in meine weltanschaulichen Reflexionen versunken, hatte ich sie nicht gesehen.
«Keine Angst, ich tue dir nichts», kicherte sie.
«Schade», sagte ich schlagfertig, «ich hatte schon gehofft, du wirst endlich handgreiflich.» Meine Stiefmutter Mirjam, blond, attraktiv und nicht viel älter als ich, errötete, was ich trotz der Dunkelheit sehen konnte.
«Um dem ungezogenen Kind den Hintern zu versohlen?», erwiderte sie, bereits wieder gefasst. «Ich bin hier, weil ich deine Hilfe benötige.»
Mir lag ein anzüglicher Konter auf der Zunge, aber ich beschloss, es gut sein zu lassen, und schwieg.
«Das heisst genau genommen: Nicht ich benötige Hilfe, sondern meine Kollegin Berta.»
«Was hat das mit mir zu tun?»
«Du erinnerst dich doch an Berta, oder?»
Das war nun wirklich eine hinterhältige Frage. Denn jeder Mann, der je ein Auge auf diese Schönheit geworfen hatte, konnte sie nicht vergessen – und musste sich über die Ironie des Schicksals totlachen: Wer den Namen «Berta Schulz» hört, denkt wahrscheinlich eher an eine deutsche Gefängniswärterin als an dieses göttliche Wesen, das ohne Weiteres bei der Wahl der «World’s Sexiest Woman» hätte antreten können. Meine Stiefmutter hatte gelacht, als ich sie auf die Inkongruenz zwischen Namen und Äusserem ihrer Kollegin angesprochen hatte. Sie sei aus Hermannstadt in Rumänien, beschied sie mir schnippisch, wo die Leute überwiegend Deutsch sprächen und nichts dabei fänden, dass schöne Frauen «Schulz» hiessen. Mirjam und Berta pflegten gelegentlich zusammen in den Ausgang zu gehen. Rein zufällig hatte ich sie schon mehrfach bei ihrer Rückkehr in unsere Villa getroffen, wo sie sich oft noch ein Gläschen Champagner genehmigten und den Abend Revue passieren liessen. Dabei war mir, ich schwöre es, bisweilen der Duft von Männerparfüms in die Nase gestochen. Die beiden Damen wirkten oft auch seltsam aufgekratzt, trotz der nächtlichen Stunde.
«Das ist doch diese kleine Hässliche, oder? Der helfe ich natürlich gerne», zwinkerte ich ihr zu.
«Ja, genau», erwiderte sie nüchtern, plötzlich nicht mehr zu Spässchen aufgelegt.
«Wobei soll ich ihr helfen?»
«Sie hat zwei Töchter, Zwillinge, und beide bereiten ihr Kummer. Vor allem die Ältere schlägt über die Stränge.»
«Die Ältere? Ich dachte, es seien Zwillinge.»
«Ein paar Minuten älter, aber das ist egal. Nicht egal ist, dass sie eine feste Hand braucht.»
Ich prustete los. «Ich war schon alles Mögliche im Leben, aber ganz sicher nicht eine ‹feste Hand›. Für die feste Hand gibt es in unseren Breitengraden einen bestimmten Begriff: Vater. Oder Papa. Oder Erzeuger. Oder so was in der Art.»
«Das funktioniert nicht mit ihm. Der ist sehr viel älter als Berta und darüber hinaus intensiv mit seinem Unternehmen beschäftigt. Er hat weder Zeit noch Nerven für seine wilden Töchter.»
«Und da kommt natürlich der gute alte Li Rösti, der Retter aller geschundenen Seelen, gerade recht als Ersatz. Wie alt ist denn die wilde Tochter?»
«Fast neunzehn.»
«Fast neunzehn?! Bitte nicht! Eine Spätpubertierende wahrscheinlich.»
«Ein wenig ungezähmt vielleicht. Genau deshalb sind wir auf dich gekommen.»
«Weil ich auch ungezähmt bin?
«Nein, weil du im Vorstand eines Clubs bist, der sich die ‹Armen Ungezähmten Jungen› nennt.»
Das war allerdings richtig. Der Club mit dem sinnigen Namen «PoorUntamedYouth» war als freigeistiger Gegenentwurf des börsennotierten, elitären Vereins «Rich-RisingYouth» entstanden.
«Sie möchte unserem Club beitreten?»
«Wer weiss? Nimm sie mit. Führe sie ein. Bring sie auf andere Gedanken.»
«Welche Gedanken soll sie denn vergessen?»
«Den Gedanken an einen Freund, der sehr viel älter ist als sie und sich im Milieu bewegt.»
«Na bravo. Genau mein Traumjob: ein babysittender Bodyguard. Weiss mein Vater von diesem Projekt?»
«Nein», erwiderte sie schnell, «und dabei wollen wir es auch belassen. Er hält nicht viel von Berta.»
Das war allerdings wahr. Trotz ihrer offensichtlichen äusseren Vorzüge gehörte mein Vater zu der verschwindend kleinen Gruppe von Männern, die Berta ablehnten – und aus dieser Ablehnung keinen Hehl machten. Ein weiterer Grund, mich nicht vereinnahmen zu lassen.
«Es würde auch deinen Marktwert deutlich steigern», gab sie mir zu bedenken.
«Meinen Marktwert?», fragte ich, obwohl ich genau wusste, was sie meinte.
«Die Jugend und Schönheit von Anna wird auf dich abfärben – und vielleicht Tatjana etwas eifersüchtig machen», lockte sie mich.
Tatjana war eine Freundin, mit der mich eine On-off-Beziehung verband. Momentan allerdings eher «off» als «on», und Tatjana hatte dabei noch die Unverschämtheit, sich mit wechselnder männlicher Begleitung im Club zu zeigen. Das brachte mich nicht nur zum Kochen, ich sah mich auch gehässigen Hänseleien verschiedener Clubmitglieder ausgesetzt, die meine komplizierte Beziehung zur Balletttänzerin kannten. Durch einen Auftritt mit einer jugendlichen Schönheit konnte ich ihr das heimzahlen.
«Du musst nur von Anfang an klarstellen, dass es nicht deine Tochter ist», kicherte sie, nun schon wieder zu kleinen, gänzlich unangebrachten Scherzchen aufgelegt.
«Du bist ziemlich goofy», erwiderte ich schlagfertig.
«Goofy?»
«Bedeutet albern. Sehr verbreitet in meiner Generation. Ältere Menschen wie du kennen das Wort natürlich nicht!»
Autsch. Sie nahm es gelassen, hauchte einen Kuss auf meine Wange und sagte: «Sie meldet sich bei dir.»
«Hallo. Mama sagt, ich soll Sie zu einem Anlass begleiten.»
Ich schüttelte den Kopf, um die Spinnweben zu vertreiben, und setzte mich in meinem Bett auf. Offensichtlich hatte ich vergessen, mein Mobiltelefon auf stumm zu schalten. Es war kurz nach neun Uhr morgens. Ich konnte mir beim besten Willen keinen Reim auf den Anruf machen. Zu dieser unchristlichen Zeit ist auch der weltweit beste Ermittler bisweilen überfordert.
«Sie müssen sich verwählt haben. Ich gehe zu keinem Anlass.»
Ich stellte mir eine junge Dame aus gutbürgerlichem Haus vor, die auf dem Weg zum Debütantinnenball ihren säumigen Begleiter anrufen wollte. Wahrscheinlich war es das förmliche «Sie», das mich zu dieser Annahme verleitete.
«Sie sind doch Herr Rösti?»
«Ja», erwiderte ich vorsichtig, «so stand es jedenfalls in meinem Pass, als ich das letzte Mal nachgesehen habe.»
«Dann bin ich richtig. Mama sagt, ich soll Sie zu einem Anlass begleiten», wiederholte sie.
Ganz langsam dämmerte mir, um wen es sich hier handelte. Seit meinem Gespräch mit meiner Stiefmutter Mirjam waren drei Tage vergangen.
«Sie sind die Tochter von Berta Schulz. Bitte entschuldigen Sie, ich bin gerade in einer sehr wichtigen Sitzung. Mein Kopf ist ganz woanders.»
Sie sagte nichts. Mir dämmerte, dass «Mama» sie mit sanftem Druck dazu gebracht hatte, mich anzurufen. Da ich einem ebenso sanften Druck von meiner «Mama» Mirjam ausgesetzt gewesen war, beschloss ich, die Anruferin zu mögen.
«Du heisst Anna, oder? Also Folgendes: Erstens nenn mich nicht Herr Rösti, sonst komme ich mir wie mein Vater vor. Ich heisse Li. Zweitens: Ich gehe nie an Anlässe, wenn es sich vermeiden lässt. Drittens: Wir könnten uns heute Abend in meinem Club treffen, dem ‹PoorUntamedYouth›. Wir können etwas trinken und einander erzählen, welch schändliche Mütter wir haben, die uns zu diesem hochnotpeinlichen Treffen genötigt haben.»
«OK.» Sie kicherte. «Wo ist denn dieses Poordings?»
Ich gab ihr die Adresse, wir verabredeten eine Zeit, und ich versprach, auf dem Parkplatz auf sie zu warten.
«Ich fahre einen Vintage-Car, einen Alfa Romeo Spider. Denselben, den Dustin Hoffman im Film ‹The Graduate› gefahren hat», verkündete ich enthusiastisch.
«Ihr Alten sprecht voll komisch», meinte sie, «ich check überhaupt nichts. Bis dann!»
Klick.
Zur vereinbarten Zeit wartete ich vor unserem Clubhaus auf dem Zürcher Sonnenberg. Es war nicht sehr weit entfernt von unserer Villa. Ich konnte notfalls zu Fuss nach Hause. Neben all meinen hervorragenden Stärken muss ich hier gestehen, dass ich deutlich weniger trinkfest bin, als Sie es von beinharten Detektiven in all den Netflix-Serien gewohnt sind. In dieser Beziehung hatte sich leider meine asiatische Hälfte durchgesetzt. Denn Asiaten leiden oft unter einer unterdurchschnittlichen Alkoholtoleranz. Trotz dieser gravierenden Schwäche liess ich es mir nicht nehmen, mit meinem roten Flitzer beim Club vorzufahren. Erstens, weil ich es völlig uncool fand, zu Fuss dort aufzukreuzen. Und zweitens, weil man in lauen Sommernächten vom Parkplatz einen fantastischen Blick auf Zürich hat – vorzugsweise zu zweit und mit geöffnetem Verdeck. Allerdings schwebte mir nichts Derartiges vor für heute Abend – strömender Regen und das zarte Alter meiner Begleitung waren unüberwindbare Hindernisse.
Vierzig Minuten nach der vereinbarten Zeit wurde mir die Warterei auf dem Parkplatz zu blöd. Zumal mein Alfa bei Regen ohnehin nicht gut zur Geltung kommt und, ich sage es ungern, das Stoffdach leckte. Ich musste mich enorm verrenken, damit mein rechtes Bein nicht völlig durchnässt wurde. Also machte ich mich auf, den Club allein zu betreten. Eben war ich bei der Eingangstür angekommen, als ein silbergraues Mercedes SL 500-Cabrio auf den Parkplatz schnurrte. Für einen Club der «ungezähmten Armen» passte ein so völlig überteuerter Bonzenschlitten natürlich ganz und gar nicht. Haarscharf schloss ich deshalb, es handle sich um meine Begleitung an diesem Abend, dem ich mittlerweile nur noch halb enthusiastisch entgegensah. Ich winkte ihr zu, aber sie beachtete mich nicht, sondern glotzte aus ihrem feudalen Cabrio hartnäckig in die andere Richtung, obwohl sie mich gesehen haben musste. Schliesslich verlor ich die Geduld und ich rief sie von meinem Mobiltelefon an.
«Anna, hier bin ich!», posaunte ich.
«Nein, hier bin ICH!», gab sie zickig zurück.
«Nicht lustig – ich warte schon seit vierzig Minuten. Ich stehe vor der Tür, und langsam fallen mir die Arme ab vor lauter ignoriertem Winken!»
«Ach, du bist das! Ich dachte, da will mich schon wieder einer anmachen … Sorry, ich hätte mir unter ‹Rösti› etwas Bodenständigeres vorgestellt – eine Röschti mit Ohren halt!» Den lahmen Witz fand sie offensichtlich enorm lustig.
«Ja, ich sehe eher Bruce Lee ähnlich. Das ist ein asiatischer Kampfsportler, den wir Alten vor laaanger Zeit einmal gut fanden. Aber den kennst du natürlich nicht.»
«Den kenne ich natürlich schon. Der wurde im Film ‹Once Upon a Time in Hollywood› von Brad Pitt windelweich geprügelt. Dieser Bruce Lee war offenbar ein aufgeblasener Loser. Es tut mir leid, dass du dem ähnlich siehst.»
Das konnte ja heiter werden. Ich beschloss, sie meine Überlegenheit durch meine reife Gelassenheit spüren zu lassen. «Ok, jetzt steig aus. Lass uns reingehen. Ich muss langsam meine Medikamente gegen hohen Blutdruck, Parkinson und Zipperlein nehmen.»
Sie fand nichts Ungewöhnliches an meinem Medikamenten-Mix, stieg aus, rannte zur mir. Ich kam nicht umhin festzustellen, dass die Tochter von Berta Schulz ohne Weiteres am Nachwuchswettbewerb der «World’s Sexiest Woman» hätte teilnehmen können. Ich verstand plötzlich, weshalb sie nicht auf winkende Männer reagierte. Reiss dich zusammen, ermahnte ich mich selbst. Ein Glas mit ihr, dann steigen wir beide in unsere Autos und melden unseren Müttern «Auftrag erledigt».
Sie musterte mich, schien aber nicht besonders beeindruckt, obwohl ich meinen feinsten Tom-Ford-Zwirn und – trotz des Regens – meine Edeltreter von Cristόbal Balenciaga zum Einsatz gebracht hatte. Sie war wesentlich weniger aufgebrezelt. Destroyed Jeans von DSQUARED2, wie ich als Kenner weiblicher Beinkleider schnell feststellte. Mit ihren Löchern und weissen Flecken sehen sie aus, wie wenn die Trägerin eine Gipserin im ersten Lehrjahr wäre. Diese selbstverständlich höchst begehrenswerte Fiktion ist den reichen Töchterchen der Goldküste rund fünfhundert Franken wert. Dazu trug sie ein weisses Hemd, das tiefe Einblicke ermöglichte, und eine ganz konservative Perlenkette, die einer Neunzigjährigen gut gestanden hätte. Immerhin nicht bauchfrei, dachte ich erleichtert.
«Stehen wir herum oder gehen wir rein?», fragte sie schnippisch.
«Ich bin hier Vorstandsmitglied und mache eine Alters-, Gesichts- und Outfitkontrolle. Wir lassen nicht jeden rein!»
OK, nicht mein bester Return, das konnte ich an ihrem verächtlichen Gesichtsausdruck erkennen.
Wir traten ein.
«Alsooooo, Bruce Leeeeeee, es war gar nicht so schlimm!», lallte Anna.
«Hat es gar nicht wehgetan?», versuchte ich witzig zu sein.
Verschwendete Liebesmüh. «Hääääääää???»
Sie torkelte auf ihr Mercedes-Cabrio zu.
«Stopp!», rief ich. «Du willst doch nicht etwa fahren?»
«Waruuuumennnnnnicht?»
«Weil du sturzbetrunken bist!»
Ich packte sie bei den Schultern und schob sie in Richtung meines roten Flitzers. Zum Glück hatte es aufgehört zu regnen.
«Es wäre doch schade, wenn du Papas Edelflitzer um einen Baum wickeln würdest.»
«Häääääää?», schrie sie mich schon wieder so laut an, dass mir die Ohren schrillten. «Derismeiner!»
Ich ignorierte sie, öffnete die Türe des Alfas und schob sie vorsichtig auf den Beifahrersitz. Dabei legte ich meine Hand schützend auf ihren Kopf, damit sie sich nicht am Stoffdach stiess.
«Heeeeeyyyy, dasisjaplatschnass», protestierte sie. «Schon Proooostataprobleeeeeme in deinem Alter?» Sie lachte hysterisch über ihren eigenen Witz.
Ich beschloss, diese Provokation souverän zu ignorieren. Als sie versuchte, auszusteigen, zog ich sie zurück.
«Nur Regenwasser», beruhigte ich sie.
Das schien sie zu überzeugen. Mit einem Seufzer lehnte sie sich zurück, Kopf im Nacken. Sie glich nicht mehr einer Kandidatin für die Kür zur schönsten Frau der Welt.
«Sag mir aber bitte, wenn du dir die Sache nochmals durch den Kopf gehen lassen musst.»
«Häääääää?» Aller guten Dinge sind drei.
«Sag mir, wenn du kotzen musst», sagte ich grob. «Dann halte ich an.»
Sie schaute mich so verwundert an, als hätte ich Chinesisch gesprochen, erwiderte aber nichts.
Ich legte den ersten Gang ein, und wir fuhren Richtung Erlenbach. Glücklicherweise wusste ich, wo die junge Dame wohnte.
Während der Fahrt dachte ich über den Abend nach.
Der Auftritt mit der jungen Anna war ein Erfolg gewesen. Zunächst jedenfalls. Die männlichen Mitglieder unseres Clubs hatten bei unserem Einmarsch die Hälse gereckt. Die weiblichen «Ungezähmten» hatten betont gelangweilt weggeschaut, einige leicht genervt. Beides hatte mich gleichermassen gefreut. Viele Dinge haben sich in der Geschlechterbeziehung in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Einige Dinge ändern sich nie – jedenfalls nicht in unserem Club der Ungezähmten und politisch völlig Unkorrekten.
Tatjana war mit einer männlichen Begleitung zugegen, Typus Carlos Alcaraz, wenn auch natürlich bei Weitem nicht so gut aussehend. Auch sie ignorierte uns, zumindest am Anfang. Als sie dann doch noch den Weg an unseren Tisch fand, war es viel zu spät gewesen. Anna hatte schon mehrere Cocktails versucht, sich aber geweigert, etwas zu essen. Ein Trinker mit mehr Erfahrung als ich hätte die Gefahr wohl schneller gewittert. Doch in dieser Beziehung war ich definitiv unterentwickelt. Trotz meiner Vorliebe für ein Glas Whisky erahnte ich die verheerende Wirkung schnell geschluckter Cocktails in unterschiedlicher Mischung nicht. Anna erahnte es noch sehr viel weniger.
«Darf sie überhaupt schon trinken?», hatte mich Tatjana provokativ gefragt.
«Klaaaaardarfichtriiiiiiinken!», war die gelallte Antwort gekommen.
Beim Versuch aufzustehen war sie plump auf ihrem Hintern gelandet, was ein frivoles Gejohle bei den männlichen Clubmitgliedern hervorgerufen hatte. Die weiblichen Anwesenden, die sich zuvor in gekonntem Wegsehen geübt hatten, schienen plötzlich ganz fokussiert auf die Szene. Von Häme bis Mitleid mit der Geschlechtsgenossin war alles auszumachen.
«Zeit zu gehen», hatte ich das Heft in die Hand genommen und war mir dabei wie mein Vater vorgekommen.
Ich hatte sie vom Boden gezogen und sie mit Mühe zum Ausgang dirigiert. Die überhaupt nicht witzigen Rufe der anderen Clubmitglieder prallten an mir ab. Das war der Tiefpunkt eines nicht wirklich gelungenen Abends gewesen. Anna hatte sich von Anfang an als ziemlich widerborstige Begleitung erwiesen. Ihre Augen hatten nur einmal aufgeleuchtet, als ich ihr bedeutete, sie könne bestellen, was sie wolle. Das hatte sich als grosser Fehler erwiesen, wie ich mittlerweile wusste.
Als sie noch halbwegs nüchtern gewesen war, hatte ich ein paar Dinge von ihr erfahren. Sie sei in der vierten Klasse der Kantonsschule Küsnacht und werde nächstes Jahr ihre Matura machen. Und nein, sie habe nie eine der berühmt-berüchtigten überteuerten Schweizer Privatschulen besucht, weil Kaminski überzeugt sei, sie und ihre Schwester sollten «normal» aufwachsen. Sie habe eine Zwillingsschwester, die wirklich «fun» sei, und einen Stiefbruder, der «krass NPC» sei, ebenso wie dessen Mutter. Kaminski habe den aus erster Ehe. Das sei halt gelaufen, wie es so laufe: Mit fünfundvierzig habe Kaminski gefunden, es sei Zeit, seine Frau gegen ein viel jüngeres «Modell» einzutauschen, ihre Mutter. Sie, ihre Schwester und Berta hätten viel «fun» zusammen. Hingegen sei die Frau aus erster Ehe ziemlich verbittert, ihr Stiefbruder sogar feindselig, eben: «mega krass NPC». Und Kaminski sei halt, nun: alt. Erst jetzt war mir aufgegangen, dass sie mit «Kaminski» ihren Vater gemeint hatte. Völlig verschlossen blieb mir, was sie mit «mega krass NPC» gemeint hatte. Aber aus dem Kontext konnte ich schliessen, dass es wohl das Gegenteil von «fun» bedeutete.
Mittlerweile waren wir in Erlenbach angekommen, und ich steuerte das Elternhaus von Anna an. Diese Gemeinde an der Goldküste beruft sich auf eine fünftausendjährige Geschichte, was sich wohl im Standortmarketing für vermögende Amerikaner gut einsetzen liess. Allerdings hatte sich das mit dem Standortmarketing schon lange erledigt: Das ehemalige Weinbaudörfchen zog schon längst ganz von allein die Reichen und Schönen dieser Welt an, tiefe Steuern und die Nähe zu Zürich sei Dank. Ein Schlaumeier hatte vor ein paar Jahren herausgefunden, dass es hier die höchste Ferrari-Dichte der Schweiz und vielleicht der ganzen Welt gab: Auf tausend Einwohner kamen damals sieben der italienischen Luxuskarossen, Tendenz steigend.
Wenn Sie jetzt denken, in Erlenbach seien alle gleich – insbesondere gleich reich – dann muss ich Sie korrigieren. Es gibt hier eine Sorte Menschen, die noch etwas «gleicher», pardon: reicher sind, nämlich die Leute, die eine Villa mit direktem Seeanstoss besitzen. Wie zum Beispiel die Kaminskis. Solche Villen heissen dann nicht einfach «Villa», «Residenz» oder «grosses Haus», sondern, wie im vorliegenden Fall: «Seeschloss».
Ich läutete am massiven Tor, aber niemand öffnete. Vorsichtig zog ich das iPhone aus Annas linker Gesässtasche, hielt es ihr vors Gesicht und versuchte das Gerät mittels Gesichtserkennung zu entsperren. Keine Chance – offenbar veränderte Alkohol auch die Gesichtszüge. Vielleicht war es auch die Gesichtsverzerrung, die durch inbrünstiges Schnarchen entsteht. Ich nahm ihren rechten Zeigefinger und versuchte es mit dem Fingerabdruck und tatsächlich, ich war drin. Auf dem Startbildschirm tippte ich auf die App des auf Gebäudesicherheit spezialisierten Unternehmens BBW Security. Die App meldete brav, dass ein sicheres Virtual Private Network aufgebaut wurde, um jegliches Abhören des Datenverkehrs zu verunmöglichen. Nach zwei Sekunden erschien ein kleines Eingabefenster auf dem Bildschirm mit der Überschrift: «Öffnen». Ich quetschte die sechs notwendigen Ziffern aus meiner alkoholisierten Begleitung, tippte sie ein und fuhr meinen roten Flitzer nach dem höchst umständlichen Prozedere möglichst nahe zur Eingangstüre.
Ich stieg aus und läutete, denn ich wollte mir Hilfe beim Verfrachten der ziemlich komatösen Anna sichern. Vor allem gedachte ich, die Gelegenheit zu nutzen, Kaminski, Berta oder wer auch immer öffnete, die Situation zu erklären. Denn ich muss gestehen: Der Abend war suboptimal verlaufen. Mein Auftrag hatte gelautet, die störrische Tochter mit starker Hand auf den richtigen Weg zurückzuführen, was immer das auch heissen mochte. Das war mir offensichtlich ganz und gar nicht gelungen. Weder hatte ich erfahren, inwiefern die schöne Alkoholleiche in meinem Alfa den rechten Weg verlassen hatte. Noch hatte ich sie irgendwohin zurückführen können. Meine einzige Leistung war, sie sicher nach Hause gebracht zu haben – wenn auch in einem völlig betrunkenen, um nicht zu sagen: betäubten Zustand.
Leider kam niemand, um mir die Beichte abzunehmen. Mit ungutem Gefühl versuchte ich die schwere Türe zu öffnen, und tatsächlich: Sie gab nach. Ich trat ein, um im Haus nach Hilfe zu suchen oder doch zumindest zu erforschen, wo sich Annas Zimmer befand. Ich schaute mich um und schrie laut auf: Schräg gegenüber sass Anna zusammengesunken in einem Stuhl, überall war Blut. An den Wänden, auf dem Fussboden, und ich bemerkte, dass ich selbst auf einem Blutspritzer stand, der sich wie von einer Wasserspritzpistole abgeschossen von der Leiche bis hin zur Eingangstür erstreckte. Annas zuvor weisses Hemd war blutüberströmt, der Kopf lag wie zuvor im Auto im Nacken, nur klaffte am Hals eine Wunde, die sich von einem Ohr bis zum anderen zog. In ihrem Schoss lag eine Blume, und auf dem Spiegel über ihr stand etwas mit krakeliger, blutiger Schrift gemalt, das ich nicht lesen konnte. Ein gellender Schrei hinter mir liess mich zusammenzucken.
Die Polizei war innerhalb von sieben Minuten vor Ort. Anna hatte sich neben der Haustüre erbrochen und wimmerte leise vor sich hin. Mit zitternder Stimme und schlotternden Knien wies ich den beiden Uniformierten den Weg zur Leiche. Der eine sah mit gezückter Waffe nach, der andere behielt uns argwöhnisch im Auge. Ich holte eine Flasche Mineralwasser aus meinem Alfa und gab sie Anna.
«Ich habe gedacht, das seist du», krächzte ich mit trockenem Mund. Natürlich wusste ich mittlerweile, dass das unmöglich war.
«Sie trägt doch Dolce & Gabbana-Jeans.» Trotz ihrer desolaten Verfassung sah sie mich vorwurfsvoll an. Sie hatte mich mit ihrem Schrei fast zu Tode erschreckt. Nachdem sie «Vera, Vera!» ausgestossen hatte, wollte sie sich auf die Leiche stürzen. Schlagartig war mir klar geworden, dass es sich bei der Toten um ihre Zwillingsschwester handeln musste, die bis auf die Jeans-Marke wie Anna gekleidet war, inklusive Perlenkette. Ich hatte Anna instinktiv zurückgehalten. Die Wunde am Hals war so tief und die nach oben gerichteten Augen von Vera so tot, dass keine Chance bestand, sie ins Leben zurückzuholen. Ich hatte die Notfallnummer gewählt, danach fielen wir beide in einen Schockzustand.
Mittlerweile war der Uniformierte wieder vor das Haus getreten. Er war leichenblass, was mich schliessen liess, dass auch er nicht jeden Tag eine Leiche fand. Er nickte seinem Kollegen zu.
«Eine Leiche, sonst nix.» Mit «sonst nix» meinte er offensichtlich, er habe niemanden sonst im Haus angetroffen. Er verschwand im Streifenwagen. Rund dreissig Minuten später trafen Beamte des kriminaltechnischen und rechtsmedizinischen Dienstes ein und machten sich an die Arbeit. Als eine der ersten Amtshandlungen nahmen sie mir meine Balenciaga-Sneakers ab, da ich auf einem Blutspritzer gestanden hatte. Glücklicherweise hatte ich kürzlich Schuhe gekauft und im Auto vergessen. Als Letzter traf mein alter Freund aus vergangenen Studienjahren ein. Im Gegensatz zu mir hatte Christoph Oertli das Jus-Studium beendet, promoviert und war einer der jüngsten Inspektoren der Ermittlungsabteilung Gewaltkriminalität der Kantonspolizei Zürich.
Oertli erfasste die Situation blitzschnell. Er ignorierte die wimmernde Anna und winkte mich beiseite. Ich berichtete ihm, was zu berichten war. Danach verschwand er für lange Zeit im Haus. Nach einer gefühlten Ewigkeit fuhr ein grosser Range Rover durch das geöffnete Tor und Berta Schulz stieg aus. Dann wurde alles chaotisch.
Um sechs Uhr morgens wankte ich zu meinem Gärtnerhäuschen. Es war eine der schlimmsten Nächte meines Lebens gewesen. Berta hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten, als sie vom Tod ihrer Tochter erfahren hatte. Sie war in eine Art Raserei geraten und hatte sich dabei eine Kopfverletzung an einer Säule neben dem Hauseingang zugezogen. Eine Ambulanz war gerufen worden, aber die verzweifelte Mutter liess sich nicht versorgen. Mittlerweile war auch der Hausherr eingetroffen, der nach einer ersten Schockstarre allen Anwesenden, vor allem aber Inspektor Oertli, heftige Vorwürfe machte. Dem wuchs die Sache zusehends über den Kopf. Er musste seinen Vorgesetzten Meierhofer aufbieten, der die Kaminskis und mich auf die Polizeiwache an der Güterstrasse verfrachten liess – unter den zuckenden Blitzlichtern der mittlerweile alarmierten Journaille. Unfälle und Verbrechen an der Goldküste haben einen ganz besonderen Reiz für die Medien und ziehen Journalisten schnell an wie eine Lampe die Motten.
Meierhofer liess uns alle in getrennten Verhörzimmern abkühlen, danach wurden wir einzeln vernommen. Ich als Letzter, also mit besonders langer Abkühlzeit. Obwohl es bei mir eigentlich gar nichts zum Abkühlen gab. Gegen drei Uhr konnte ich die Wache verlassen. Ich nutzte die relativ laue Sommernacht, um den langen Weg nach Erlenbach unter die Füsse zu nehmen. Das Adrenalin nach der Entdeckung der Leiche war zwar bereits aus meinem System herausgeschwemmt, aber ich hatte kurz nach meiner Entlassung durch die Polizei eine neue Adrenalinspritze gekriegt. Jan Kaminski hatte auf mich gewartet und mich noch auf der Wache lautstark attackiert und so beschimpft, als ob ich für den Mord verantwortlich wäre. Wahrscheinlich hätte ich die Attacke einfach über mich ergehen lassen sollen, denn meine rationale Seite sagte mir, der traumatisierte Vater benötige in diesem Moment einfach einen Sündenbock. Er wollte sich sogar auf mich stürzen, was ein Polizist verhinderte. Leider hatte ich mich verteidigt und die Vorwürfe zurückgewiesen, weshalb die Situation eskaliert war.
Danach fühlte ich mich schuldig, und der lange Marsch nach Erlenbach erschien mir wie ein Canossagang. Dort angekommen versuchte ich die beiden anwesenden Streifenpolizisten zu bewegen, mir meinen Alfa herauszurücken. Aber sie blieben stur. Das Auto sei noch nicht freigegeben und nein: Sie könnten mir nicht sagen, wann und wo ich es wieder in Besitz nehmen könne. Ich beschloss, es sei gut mit dem Canossagang, bestellte mir mit Mühe ein Taxi und liess mich zu unserer Villa am Zürichberg chauffieren.
Doch die Nacht war noch nicht überstanden. Völlig verblüfft fand ich meine Stiefmutter Mirjam vor meiner bescheidenen Schlafstätte. Normalerweise hatte sie die Schlafgewohnheiten einer Teenagerin: nicht früher aufstehen, als es sein musste. Sie war in einen dicken Mantel gehüllt, denn mittlerweile war die Temperatur stark gesunken.
«Was ist geschehen?», wollte sie mit aufgerissenen Augen wissen.
«Das weisst du schon», gab ich zurück.
«Ich will es von dir hören.»
«Nein, ich will es von dir hören. In was für eine Sache hast du mich da verwickelt?»
«In eine Sache verwickelt? Bist du verrückt? Das mit Anna hat mit dem Mord nicht das Geringste zu tun. Sie hat einen Freund, der deutlich älter ist. Das wäre noch kein Beinbruch, aber Rocco verkehrt jeden Abend im Roxy. Es geht das Gerücht, dass er die Dinge dort mit viel bolivianischem Marschpulver am Laufen hält.»
«Ein Kokaindealer?»
«Ja, sagt man.»
Ich sah sie scharf an. Aber Mirjam hielt sich bedeckt.
«Jetzt du», stiess sie hervor.
Ich erzählte ihr meine Version des Abends. Sie schauderte ein paar Mal und hüllte sich noch ein wenig mehr in ihren Mantel.
Als ich fertig war, schwiegen wir beide lange.
«Belassen wir es dabei», sagte sie, und ich wusste, was sie damit meinte. Kein Wort zu meinem Vater. Das war mir recht.
Kaum war ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf gefallen, wurde ich durch Schüsse geweckt. Ich schrak auf, merkte aber sofort, dass es sich um den Rasenmäher unseres Gärtners handelte. Er hielt an seinem alten, stinkenden Benzingerät fest, das sich durch knatternde Fehlzündungen auszeichnete.
Erst jetzt merkte ich, wie hungrig ich war. Eilig stand ich auf und liess mich im Haupthaus von unserer Haushälterin verpflegen.
«Lange Nacht, Li?», fragte mich Frau Meier. Ich hatte ein Frühstück verlangt, und da es schon nach Mittag war, hatte sie haarscharf geschlossen, ich sei noch später als sonst ins Bett gekommen.
«Könnte man sagen», antwortete ich unbestimmt. Ich wollte es mit ihr nicht verderben, da sie eine hervorragende Köchin war und mich gut verköstigte. Leider war sie auch krankhaft neugierig, vor allem, was mich anbelangte und, so vermutete ich, eine Spionin meines Vaters.
«Sind Sie heute zum Abendessen zu Hause?», fragte sie hoffnungsvoll. Denn sie war auch chronisch unterbeschäftigt. Mein Vater war oft mit Kunden unterwegs – und meine Stiefmutter war oft, nun, unterwegs.
«Leider nein», antwortete ich unverbindlich. «Vielen Dank für das Frühstück.»
Auf dem Weg zurück zum Gärtnerhäuschen schaltete ich mein Mobiltelefon an. Ich hatte mehrere verpasste Anrufe, unter anderem von meinem Vater und meinem Freund, Inspektor Oertli. Ich versuchte meinen Vater zu erreichen, aber er war in einer Sitzung. Ich versuchte es mit Oertli. Mit ihm hatte ich mehr Glück.
«In fünfzehn Minuten beim See?», fragte er mich. Der «See» war unser gemeinsamer Code, dass es sich um ein informelles, um nicht zu sagen: inoffizielles Treffen handeln sollte. Wir hatten uns in der Vergangenheit schon oft gegenseitig geholfen – all die Studentenstreiche verbinden offenbar ein Leben lang.
«Gut.»
Ich fuhr mit dem Tram Richtung See, da ich meinen Alfa noch nicht zurückbekommen hatte. Als ich beim Bellevue ausstieg, winkte mir Oertli schon vom Seeufer zu. Vorbei an flanierenden Touristen schlenderten wir dem See entlang Richtung Zürihorn.
«Warum warst du wirklich da?», wollte er wissen.
«Es war alles so, wie ich es zu Protokoll gegeben habe. Ich habe Anna heimgefahren, weil sie nicht mehr selbst fahren konnte. Dann haben wir die Leiche gefunden. Den Rest weisst du.»
«Wie gut kennst du die Familie?», wollte er wissen.
«Gar nicht. Ich habe Berta Schulz gelegentlich in Begleitung meiner Stiefmutter gesehen, aber wir haben kaum miteinander gesprochen. Den Rest der Familie habe ich nicht gekannt.»
«Was weisst du über die Familie?»
«Nicht viel. Kaminski ist geschieden und hat einen Sohn aus erster Ehe. Berta Schulz ist das ‹jüngere Modell›, das er sich mit fünfundvierzig Jahren zugelegt hat. Das habe ich gestern von Anna erfahren. Soviel ich weiss, ist er Galerist.»
Oertli lachte trocken. «Galerist ist die Untertreibung des Jahres. Das Wirtschaftsmagazin ‹Bilanz› hat ihn schon mal als ‹Diskreten Kunstmogul vom Zürichsee› bezeichnet. Er hat Galerien nicht nur in Zürich, sondern auch in Miami, Los Angeles und Singapur.»
Als ich schwieg, hakte er nach: «Ist er Kunde in eurem Family Office?»
«Nicht, dass ich wüsste.»
«Warum nicht?», fragte er mich.
«Weiss nicht», antwortete ich knapp. «Jetzt bin ich an der Reihe mit Fragen. Habt ihr schon einen Verdächtigen?»
«Nein», sagte er gedehnt, «wir verfolgen verschiedene Spuren.»
«Fehlte denn etwas im Haus?»
«Nein, gar nichts. Wir glauben auch nicht, dass es sich um einen Einbruch handelte, der schiefging. Es ist äusserst selten, dass Einbrecher morden, wenn sie erwischt werden. Sie machen sich schlicht aus dem Staub. Und schon gar nicht würden sie ihr Opfer so zur Schau stellen.»
«Was meinst du?»
«Der Tatort war arrangiert wie in einem Theaterstück. Das Opfer wurde offenbar genau dort ermordet, denn es gab im ganzen Haus keine Blutspuren. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur; wir glauben, es könnte ein Rasiermesser sein. Nach dem Mord wurde sie auf einem Stuhl drapiert mit Blume und blutiger Schrift auf dem Spiegel über ihrem Kopf, auf den ersten Blick sichtbar für jeden, der eintritt. Wie eine Botschaft für denjenigen, der hereinkommt.»
«Vielen Dank, ich habe die Botschaft erhalten», sagte ich fröstelnd. «Sei auf der Hut, es gibt viele gefährliche Verrückte in dieser Stadt.»
«Ein Verrückter?», fragte er. «Das glaube ich nicht.»
«Oder ein verschmähter Liebhaber?»
«Die durchgeschnittene Kehle sagt etwas anderes. Ein verschmähter Liebhaber würde sie wahrscheinlich eher erwürgen. Oder mit unzähligen Dolchstössen durchbohren. Oder er würde das Magazin einer Glock leeren. Aber die Kehle durchschneiden und sie dann ganz kalt so präsentieren – das passt nicht.»
«Habt ihr entziffern können, was der Täter auf den Spiegel geschrieben hat?»
«Auch das ist eine seltsame Geschichte. Die Kollegen vom rechtsmedizinischen Dienst haben festgestellt, dass der Täter tatsächlich das Blut der Ermordeten verwendet hat. Sie können auch mit Sicherheit sagen, dass der Täter keine Handschuhe getragen hat …»
«Was?», entfuhr es mir.
«Ja, seltsam. Trotzdem konnten wir erstaunlicherweise keine brauchbaren Fingerabdrücke finden. Aber es gibt noch etwas Rätselhaftes.»
«Spann mich nicht auf die Folter.»
«Du konntest nicht lesen, was der Mörder geschrieben hat. Wir hatten auch Mühe und haben deshalb einen Grafologen aufgeboten. Natürlich haben wir gedacht, dass der Mörder mit der linken Hand oder, wenn er Linkshänder war, mit der rechten geschrieben hat, damit wir seine Handschrift nicht erkennen. Unser Grafologe hat schon mehrere solcher Fälle untersucht. Aber er versichert uns: Die üblichen Anzeichen, dass die ‹falsche Hand› gebraucht wurde, fehlen gänzlich. Er steht vor einem Rätsel.»
«Konnte er das Gekritzel entziffern?»
«Das konnten wir mit einiger Fantasie selbst. Es heisst: ‹Die erste Blüte›.»
«Die erste Blüte? Das tönt so, als ob …»
«Ja, haben wir auch gedacht. Wir haben Anna Kaminski unter Polizeischutz gestellt. Damit sie nicht die zweite Blüte wird.»
«Wie ist der Mörder ins Haus gekommen – das Tor ist ja so gut gesichert wie in einem Gefängnis?»
«Das ist momentan das Einzige, das wir wirklich wissen. Er ist geschwommen.»
«Wie bitte?»
«Ja, das ist der oft übersehene Nachteil von Villen mit Seeanstoss. Selbstverständlich könnte man das Haus auch Richtung See mit einer hohen Mauer und den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen perfekt schützen. Aber das würde natürlich den herrlichen Blick auf den Zürichsee versperren. Also lässt man das lieber und hält den Zugang offen … Die Alarmanlage war ausgeschaltet, da sich Vera ja im Haus befunden hat. Sie hat auch die Haustüre nicht abgeschlossen – sie wähnte sich durch das gut gesicherte Eingangstor und den hohen Zaun um das Haus bestens geschützt.»
«Der Täter ist also in aller Ruhe zum Grundstück geschwommen, mit einem Rasiermesser in der Badehose, ist gemütlich durch die Eingangstüre geschlendert, hat Vera gezwungen, sich auf den Stuhl im Eingangsbereich zu setzen und hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Dann hat er ihr eine Blume in den Schoss gelegt, den Spiegel bekritzelt und ist gemütlich zum Ausgangsort zurückgeschwommen?»
«So sieht es aus. Wir haben Spuren von Seewasser und Gartenerde im Haus gefunden.»
«Und niemand hat etwas gesehen?»
«Niemand. Es ist wahrscheinlich die sicherste und unauffälligste Art und Weise, in eine Villa mit Seeanstoss zu gelangen. Du kraxelst in der Badehose auf den Steg, von dort gehst du leicht schlotternd möglichst schnell ins Haus, scheinbar um dich umzuziehen. Wer würde dabei etwas Schlechtes denken?»
Ich marschierte vom See zum Rennweg, um mich noch vor Büroschluss an meinem Arbeitsplatz sehen zu lassen. Kaum hatte ich meine Besenkammer betreten, stand auch schon die Assistentin meines Vaters in der Türe. Irgendwann musste ich herausfinden, wer der Spion war und ihr immer meldete, dass ich eingetrudelt war.
«Der Chef möchte Sie umgehend sprechen!», dröhnte Frau Nadig mit dem Charme eines Feldwebels.
«Verstanden!», gab ich zurück und schlug die Hacken zusammen.
Sie verzog das Gesicht und dachte wahrscheinlich dasselbe wie ich: immer dieselben abgestandenen Witze von diesem frechen Kerl.
Wie üblich thronte mein Vater an seinem zweihundert Jahre alten Pult aus Nussbaum, das mit ziemlich geschmacklosen Swiss-Ethno-Schnitzereien verziert war. Viel zu tief, da die Menschen vor zweihundert Jahren deutlich kleiner gewesen waren. Er hingegen überragte die meisten seiner Zeitgenossen. Aber was tut man nicht alles, um die internationale Klientel zu beeindrucken? Die Schweiz hat eine sehr lange Tradition, das Geld der Reichen zu horten und zu mehren – und das will durch die ganze Szenerie und die passende Frau Nadig mit ihrem Trachtenlook unterstrichen werden. Manchmal fragte ich mich, ob er ihr entsprechende Kleidervorschriften machte – und ob er ihr stilles Leiden auch angemessen vergütete.
Mein Vater trug, wie üblich, einen konservativen dunklen Anzug, und sein Gesichtsausdruck sagte mir, dass er noch viel weniger zum Scherzen aufgelegt war als bei unserer letzten Begegnung. Frau Nadig schloss die Türe mit einem höhnischen Gesichtsausdruck.
«Wie kommt es?», fragte er.
«Wie kommt was?»
«Wie kommt es, dass du die Allianz in einen Mord verwickelst?»
Offensichtlich war es mir nicht gelungen, die nächtlichen Geschehnisse vor meinem Vater geheim zu halten.
«Wie kommt es, dass du davon weisst?»
«Ich habe den sensationsgeilen Artikel im ‹Blick› gelesen. Darin war ein ‹älterer Begleiter› von Anna Kaminski erwähnt. Und in der Bildstrecke habe ich dann das Foto mit deiner Rostlaube gesehen.»
Wenn Sie nun denken, es sei verwunderlich, dass der grosse Vorsitzende der Allianz das Boulevardmedium «Blick» konsumiert, muss ich Sie desillusionieren. Die Mächtigen dieser Welt sind genauso sensationshungrig wie alle anderen. Ein älterer Mitarbeiter der Allianz hatte sich an einer feuchtfröhlichen Party einmal über die Wirtschaftsgnomen der Schweiz lustig gemacht. Als es die Boulevardzeitung «Blick» noch nicht online zu lesen gegeben habe, hätten sich Heerscharen konservativ gekleideter Geschäftsmänner am Bahnhofkiosk in Zürich die «NZZ mit» gekauft. Also das konservative Zürcher Weltblatt, mit dem Boulevardblatt «Blick» sorgfältig darin verborgen. Damals gab es noch das heute völlig undenkbare, textilreduzierte Seite-3-Girl. Mittlerweile waren alle «Gnomen» offenbar auf die diskrete online verfügbare Variante ausgewichen – mein Vater war der beste Beweis dafür.
Du bist dumm, Li Rösti, geisselte ich mich innerlich. Ich hatte ja das Blitzlichtgewitter gesehen und hätte vorhersehen müssen, dass ich in den Medien landen würde.