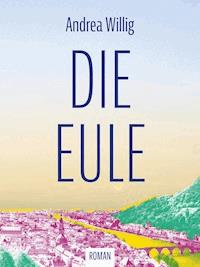
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Edition Essentials
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Toni reißt von zu Hause aus. Sie will Ärztin werden, um die kleine Schwester zu heilen. Als Junge getarnt, landet sie mitten in der Studentenbewegung der Siebzigerjahre. Wird Toni ihr Ziel erreichen? Jahrzehnte später stürzt sie in eine Krise und erlebt noch einmal die Abenteuer ihrer Kindheit und ihrer Liebe. Spannend und sensibel erzählt Andrea Willig in ihrem Erstlingsroman das bewegte Leben ihrer Protagonistin bis in die Gegenwart. DIE EULE spiegelt den Zeitgeist vierer Jahrzehnte in der wunderbaren Stadt Heidelberg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teil 1
Das rote Buch
Mai 2016, Heidelberg, Marktplatz
Es hat mich gerührt und mir ein bisschen geschmeichelt, als Clea am letzten Tag vor ihrer Abreise nach Barcelona das rote Buch ›Mama, erzähl mal‹ hinter dem Rücken hervorzauberte. Eine Fragensammlung mit freien Zeilen für Antworten. ›Was war der schönste Tag deiner Kindheit?‹ ›Wie hast du dich in Papa verliebt?‹ ›Wovon hast du immer geträumt?‹ Solche Sachen, eine Art Erinnerungsbuch. Meine Tochter küsste mir die Stirn, sie ist ein gutes Stück größer als ich. »Und wenn ich in einem Jahr zurück bin, hast du das alles schön für mich ausgefüllt, Mama, okay?«
Gerne hätte ich etwas Tiefes, Bedeutungsvolles getan oder wenigstens gesagt. Dabei wusste ich es besser. Meine Tochter ging nicht für den Rest ihres Lebens nach Timbuktu oder Sibirien, sondern für zwei Semester nach Barcelona. Und das Buch mit den freien Zeilen war nicht die ›Heilige Schrift‹, schon gar nicht ›Das Kapital‹, rot hin oder her. Kein Grund also, gefühlig oder pathetisch zu werden! Trotzdem. Es stand nicht gut um meine Gelassenheit. Und ich spürte, dass Clea das spürte. Ihre Zuwendung hatte fast etwas Mütterliches. Verkehrte Welt.
Später kamen mir Zweifel. Als Cleas Vater vor vier Jahren starb, gab es für mich nichts außer Gegenwart. Ich brauchte meine ganze Kraft, um von Moment zu Moment standzuhalten über dem Abgrund äußerer Anforderungen und innerer Verzweiflung. Irgendwann wurden die Zeiträume länger, heute Abend, morgen, in einer Woche. Doch immer mit Blick nach vorne, immer in Richtung des Kommenden. Ich schwor der Vergangenheit ab, ließ sie hinter mir, die Zeit mit ihm, ohne ihn, mit ihm. Von Knoten zu Knoten, wie an einem Rettungsseil, zog ich mich vorwärts. Hinaus und weiter, bis heute. Und jetzt ein Erinnerungsbuch? Das Seil loslassen, mich umdrehen und zurück in bedrohliche Stromschnellen? Mein Gleichgewicht schien mir noch immer fragil. Noch immer fühlte ich das Nachbeben einer schweren Erschütterung. War es nicht genug, von morgen an und wahrscheinlich den Rest meines Lebens wieder allein zu leben, Single zu sein, nur für mich, nach der sogenannten Familienphase?
Ich öffnete das Fenster. Auf dem Dach gegenüber versuchte eine Krähe der anderen einen Wurm aus dem Schnabel zu zupfen, die Vögel hüpften umeinander. Harmlose Huckebeins. Der Himmel war grau verhangen wie fast schon den ganzen Sommer. In der Dämmerung verschwamm ein trüber Tag in einem trüben Abend. Mit einem Mal flogen die Vögel auf und verschwanden.
Andererseits: Vielleicht passte beides zusammen? Vielleicht könnte aus diesem Leben, das Punkt für Punkt, eins nach dem anderen immer nur vorwärtsging, eine Linie werden, die in beide Richtungen wüchse, in die Zukunft UND in die Vergangenheit? Die Abenteuer von damals aus der Versenkung holen und aufschreiben für Clea – wieso nicht? Vielleicht schaffen die alten Geschichten ein neues Klima für die Lebensphase als Alte? Angeblich entwickelt man sich ab 50 doch sowieso wieder Richtung Kindheit, mental jedenfalls. Die sogenannte ›Arbeit mit dem inneren Kind‹ fand ich immer etwas befremdlich, es muss ja auch nicht in Arbeit ausarten. Aber vielleicht inspiriert und stärkt mich der ein oder andere Ausflug in die frühen Jahre? Und selbst wenn es nur eine Ablenkung wäre, kein schlechtes Projekt! Ja, ich würde es wagen. Plötzlich stand der Entschluss. Ich schob die Papiere auf dem Schreibtisch zur Seite und legte das Buch ›Mama, erzähl mal‹ genau in die Mitte zwischen die Eulenskulptur und den blauen Pappmaché-Stier. Ich würde loslegen, sobald Clea abgereist war. Ich würde den Abschied am Flughafen überstehen und zu Hause sofort mit dem Schreiben beginnen!
Passiert ist dann allerdings nichts. Fünf Wochen ist sie nun fort, die Wohnung still. Nach fast fünfundzwanzig Jahren bin ich zum ersten Mal wieder allein – und kann mich zu nichts aufraffen, nichts, was über die Arbeit und das Notwendigste hinausgeht. Dabei kommen die Erinnerungen an früher ganz spontan. Wann immer mir das rote Buch ins Auge fällt, blitzt etwas auf aus meiner Zeit als kleine Ausreißerin. Bilder, die stark und unmittelbar sind, gleichzeitig fern, fast als seien es nicht meine eigenen, sondern die eines anderen Kindes, eines mutigen, eigensinnigen, das ich gut kannte, doch im Lauf der Jahre vergessen habe. Wenn Clea nun mehr über dieses Kind erfahren will, über das Mädchen, die junge Frau, die ich vor ihrer Geburt war, und wenn dieser Wunsch dazu führt, dass das Mädchen selbst fast wie ein Jack in the Box aus der Schachtel herausspringen will, dann sollte es doch möglich sein, die Lethargie abzuschütteln und endlich anzufangen!
Ich gehe es so an: Bevor ich handschriftlich Frage für Frage in ›Mama, erzähl mal‹ beantworte, mache ich mir erst mal Notizen, und zwar ganz normal am Computer. Als Vorbereitung und ersten Schritt. Ich knipse die Stehlampe an und öffne den Laptop.
Stark zu meiner Zeit
Juli 1972, Heidelberg, Schloss & Altstadt
Ich bin stark, ich bin müde, ich schaffe das. Zum Glück ist heute auch keiner da, der ganze Schlossgarten still, der Mauerbogen frei nur für mich. Heute stinkt es auch kaum nach Pisse und so, trotz der Klopapierknäuel im Gebüsch und der schlappen Dinger, die mein Bruder Elvis mal Pariser genannt und dreckig gelacht hat, ohne sagen zu wollen, was es ist. Gestern Abend musste ich ewig hinter einem Baum lauern. Jugendliche mit Bierflaschen haben rumgelungert und eine Riesenzigarette von einem zum anderen gereicht wie die Friedenspfeife von Bao, dem Fuchs, zu Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre, zu Old Shatterhand. Sie haben Gruselgesichter gemacht, die Backen von innen beleuchtet mit einer Taschenlampe im Mund, haben rumgelacht, bis plötzlich die Batterie leer war und nur noch die Schlossbeleuchtung an.
In der Nacht bin ich aufgewacht, es war stockfinster, alles feucht und kalt, komische Geräusche. Aber ich war stark, habe nur an später gedacht, wenn ich Arzt bin und Kinder wie Romy gesund mache. Ich habe die erste Nacht rumgekriegt, und jetzt schaffe ich die zweite. Die muffige Häkeldecke so um den Bauch wickeln, dass ich die Arme noch reinschieben kann, den Kopf auf den Beutel mit meinen Sachen – autsch, mein Ohr? Ich springe auf. Klar, die Küchenmesserspitze. Hat sich durch den Stoff gebohrt. Elvis ist der Einzige mit einem richtigen Taschenmesser, genau wie mit dem Pelikanfüller, wir Mädchen haben nur Gehas. Wenigstens blutet es nicht, fühlt sich jedenfalls trocken an. Ich schiebe das Messer unter das Heft, drücke den Beutel zurecht, wickele mich wieder ein und lege mich aufs andere Ohr. Ganz schön hart, muss die Blechflasche sein. An die habe ich beim Packen als Erstes gedacht, wegen dem Durst, dann an die Zahnbürste aus dem Becher mit meinem Namen. Sie sollten gleich sehen, dass mir nichts passiert ist, sondern dass ich – auf Achse bin, so wie der Alte, der plötzlich weg war, vor zwei Jahren, abgehauen, und wir nur noch zu siebt waren, ich und Mama und meine Geschwister. Die Strickliesl habe ich gern dagelassen und natürlich das Sonntags-Kirchen-Kleid mit der Schleife.
Morgens liegt ein Mann an der Mauer. Er guckt komisch, nicht wie ein Besoffener oder wie der zurückgebliebene Rudi, den Elvis immer Inzuchti nennt, mehr so wie – keine Ahnung, besser ich packe meinen Krempel und verschwinde, renne durch den Schlosspark, bergab in die Stadt.
Die Türen zum Bergbahnwartesaal sind noch geschlossen, nur Straßenkehrer und Müllwagen unterwegs. Vor einem Polizeiauto verstecke ich mich in einem Hauseingang. In der Hauptstraße waren wir mal mit Mama zum Stadtbummel, auf dem großen Platz vor der Kirche haben wir Eis bekommen. Nicht dran denken jetzt. Ich bewege mich immer so, als wäre ich irgendwohin unterwegs, als würde ich einkaufen gehen oder zum Turnen. Wenn man das lange macht, in der Sonne durch das Gewühl, kann sogar eine Kirche gut sein. Die Kühle, das Dämmerlicht. Auf der hintersten Bank in der Ecke lasse ich die Beine baumeln. Der Raum ist riesig, der Altar kilometerweit weg. Es riecht nach fast nichts, nicht nach Weihrauch, auch nicht nach Kerzenwachs, vielleicht ein bisschen nach Steinen. Die Orgeltöne fliegen ganz leise herum, stoßen nirgendwo an, wie diese weichen, haarigen Pflanzenschnüre im Bach. Nicht so wie bei uns im Dorf, da kracht die Musik schon beim Reinkommen mit voller Wucht gegen die Ohren, die Mauern und die Heiligenbilder. Jetzt bloß nicht an Mama denken, und nicht an meine Schwester Romy mit ihren verdammten Windeln. Am besten gar nichts denken. Vor der Maria auf der anderen Seite stehen zwei alte Frauen mit Kopftüchern und beten. In der ersten Reihe vorne am Gang sitzt ein Mann allein, sonst sehe ich niemanden, alles leer. Ich bete ein Vaterunser. Das geht ratzfatz. Eigentlich glaube ich nicht richtig an Gott. Wie sollen ›sein Stecken und Stab‹ mich trösten, die benutzt der Alte zu Hause für was ganz anderes als zum Trost. Gott ist kein alter Mann mit Bart, hat der Lehrer gesagt, er ist der allmächtige Vater, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und mein Wille? Ich will ja gut sein! Aber die Guten sind eben nur die Erniedrigten. Immer nur: Demütigt euch, damit ER euch erhöhe zu seiner Zeit. Wann soll das sein, zu seiner Zeit? Wo ich doch jetzt ganz bald aufs Gymnasium muss, wenn das alles was werden soll. Ich will gut sein, und stark zu meiner Zeit!
Beim Hinausgehen werfe ich 15 Pfennig in den Kollektenkasten. Jetzt habe ich noch siebzig Pfennig, ich muss das nicht zählen, ich weiß es, ein Fünfziger und zwei Groschen in der linken Hosentasche, da habe ich immer das Wertvolle drin, nur meine Eule ist noch im Beutel. Siebzig Pfennig. Und 39 Tage, bis das neue Schuljahr anfängt. Ohne mich in der Erich-Kästner-Volksschule in Neckarellenbach. Mit mir im Gymnasium hier in Heidelberg! Ich krieg das hin. Für mich, für Mama und Romy und alle, die dasselbe haben wie sie.
Als die Sonne ganz oben steht, bei High Noon, kann ich nicht mehr widerstehen. Im selben Salon wie Mama kaufe ich mir ein großes Eis, drei Bollen, zwei Schoko, ein Zitrone, noch 40 Pfennig. »Na, Kleiner, was darf’s denn sein«, hat die Frau hinterm Tresen gefragt, dabei bin ich schon im März elf geworden! Immerhin hat sie nicht ›Kleine‹ gesagt, das wäre ja noch kleiner. Die Meckifrisur, die ich gerne hätte, schneidet Mama mir nicht, aber doch ziemlich kurz, und ich habe auch noch ein bisschen nachgeschnitten. Mit Elvis’ abgelegten Hosen und Shirts sieht es schon stark aus. Zum Glück finde ich den Trinkwasserbrunnen wieder und kann meine Blechflasche auffüllen. Neben dem Spielplatz wirft ein Kind einen angebissenen Apfel und ein ganz unausgepacktes Wurstbrot in den Abfalleimer, Teewurst, meine Lieblings. Es wird immer voller, ich falle gar nicht mehr auf, überall Leute, in den Gassen, auf der Hauptstraße, Leute, Leute, rein in die Geschäfte und wieder raus, rein in die Straßenbahn, wieder raus. Auf der schmalen ›Unteren Straße‹, komischer Name, ist noch mehr los. Vor den offenen Kneipentüren drängeln sie sich, jede Menge Studenten mit langen Haaren, Amerikaner und ein paar Landstreicher oder so. Als ich wieder zu meinem Schlafplatz hoch will, ist es plötzlich schon dunkel, richtige Nacht. Und das Schloss so weit weg. Dann lieber zurück in die Straße mit den Leuten, zu dem Eingang mit der Treppenstufe, wo mich keiner sieht. Nicht dran denken jetzt, stark sein. Mir fallen fast die Augen zu, da höre ich auf der anderen Seite ein Klirren und bin gleich hellwach. Auf dem Boden ein Schlüssel. Ein langer junger Mann klopft seine Hosentaschen ab, vorne und hinten, guckt auf den Boden, sieht aber nichts. Dann hämmert er gegen die Tür, beim Reingehen muss er den Kopf einziehen, sonst würde der oben anstoßen, ein richtiger Riese. Er ist drin, die Tür zu. Jetzt! Minimax trixitrax, ein Atemzug tief in den Bauch. Die Formel wirkt, gleich fühle ich mich stark, sehe mich um, keiner achtet auf mich. Geschmeidig wie Sicherheitsoffizier Tamara Jagellovsk aus Raumschiff Orion gleite ich hinüber, bücke mich unauffällig. Zwei Schlüssel sind es und ein kleiner Notenschlüssel aus Blech. So leise wie möglich schließe ich auf. Drinnen fast dunkel. Am Ende des Flurs, unter der Treppe, ein großer Holzkasten. Eine Schatztruhe? Abgeschlossen, blöd. Die kriegt auch die Formel nicht auf. Aber wenn es brenzlig wird, so wie eben, dann funktioniert sie 1 a. Zweimal hintereinander bin ich mit der Formel dem Alten entkommen, und als Bingo, der Riesenschnauzer vom Sägewerk, sich wieder um mich klammern und rammeln wollte, Minimax trixitrax, Luft in den Bauch, dazu eine Kopfnuss und zack, weg ist er! Hat mir auch leidgetan, weil ich ihn eigentlich mag, den wolligen Bingo. Aber es hat die Kraft der Formel bewiesen, die magische Kraft. Nur bei der Geheimtruhe, na ja. Immerhin, sie ist fast so groß wie mein Bett. Ich schlafe sofort darauf ein.
Fatigue
Mai 2016, Heidelberg, Marktplatz
Das Blut bemerke ich erst, als ich mit dem Finger hineintippe. Ich drücke Daumen und Zeigefinger gegen die Nasenflügel und versuche den Fleck von der Tastatur zu wischen, ohne dass Blut in die Technik eindringt.
Kürzlich hatte ich das Nasenbluten ausgerechnet bei der Arbeit, direkt vor einer OP. Alles war vorbereitet, der Patient wurde hereingerollt, ich stand schon an meinem Platz am Kopfende, wollte den Tubus legen, die Infusionsparameter prüfen, da tropfte es in meinen Mundschutz. Ich konnte mir gerade noch einen Tampon in jedes Nasenloch stecken. Damit konnte ich dann aber nicht richtig atmen und musste abgelöst werden.
Es ist nicht das Nasenbluten, das mir am meisten zusetzt, es ist die Mattigkeit, dieses Antriebslose. Schon morgens der Kampf aufzustehen, das Nicht-richtig-wach-Werden. Sind das die Wechseljahre? Ein Eisen- oder Vitamin-D-Mangel? Bestimmt nichts Ernstes. Oder könnte es eine neue, heimtückische Trauerphase sein? Ein Rückfall sozusagen?
Der ersten akuten Schockreaktion vor vier Jahren waren quälende Monate des Schmerzes und der inneren Leere gefolgt, Arbeitstage, die ich gewissenhaft, aber teilnahmslos hinter mich brachte. Nächte im Halbschlaf voller Gespenster, Verlassenheit, Sehnsucht und Angst. Das Hadern mit dem Schicksal, das Gefühl, mit schuld zu sein, zu wenig geliebt zu haben. Irgendwann habe ich eingewilligt, ein mildes Psychopharmakon zu nehmen. Nach und nach ging es auch ohne besser. Ich konnte wieder ein bisschen mitspielen, mitfühlen, Anteil nehmen. Ohne Erik, meinen Hausarzt und Freund, aber vor allem ohne Clea hätte ich das nicht geschafft. Clea, unsere Wunderbare. Ein Jahr ist schnell um. Bis dahin muss das Buch ›Mama, erzähl mal‹ fertig ausgefüllt sein. Mit der einen Hand drücke ich die Nase zusammen und mit der anderen tippe ich weiter.
Wer zweimal mit derselben pennt
Juli 1972, Heidelberg, Untere Straße
Ein Poltern über mir, dann schabt eine Tür irgendwo oben, ich schrecke hoch und weiß sofort, wo ich bin und dass ich hier nicht hingehöre. Jemand poltert die Treppe runter. Jetzt müsste er an der Haustür sein, aber ich höre nichts. Dann aber Schritte. Sie kommen in meine Richtung! Es ist der Riese von gestern, dem der Schlüssel gehört! Er bleibt vor mir stehen, beugt sich über mich. Ich rutsche noch weiter zurück, stoße mir den Kopf. Seine Augen sind dunkel, das feuchte Haar bis auf die Schultern, Vollbart. »Was machst du denn hier?« Minimax trixitrax, ein Atemzug tief in den Bauch. Es geht wie von selbst, die Kraft ist da, schon schiebe ich mich mutig nach vorne, lasse die Beine an der Kiste herunter, verheddere mich zwar ein bisschen in der Häkeldecke, bleibe aber ganz ruhig, komme wieder frei, stütze die Hände neben mich auf die Kante, der Riese steht vor mir, ich sehe ihm fest ins Gesicht.
»Ich …« Dann weiß ich nicht weiter. »Na ja, du hast hier geschlafen, blöde Frage auch.« Ich sag’s doch, die Formel ist stark! Er trippelt ein bisschen, steckt die Finger in die Bluejeanstaschen. »Tja, ich wollte gerade Brötchen holen, hast du auch Hunger? Willst du mitkommen?« »Klar!«
Ich will nicht rennen, deshalb mache ich so große Schritte wie möglich, um mit dem Riesen mitzuhalten. Die Kinder, die vor dem ›Kleinen Mohren‹ mit Klickern spielen und streiten, würdige ich keines Blickes. Die Straße ist noch schattig, trotzdem ist es schon warm, zwischen den Häusern wirft die Sonne helle Streifen auf das Kopfsteinpflaster. Die Nachtleute sind verschwunden, die Kneipentüren zu. Dafür Hausfrauen und Studenten, zwei Tippelbrüder hocken auf einer Fensterbank, stieren vor sich hin. Eine Gruppe kräftiger Typen in Shorts und mit Schirmmützen folgt einem Herrn im Anzug, der in der Heiße-Kartoffel-Sprache, amerikanisch, kommandiert und mit einem Spazierstock hierhin und dahin zeigt. Auf einmal müssen sich alle an die Häuserwände drücken, wir auch. Ein Lieferwagen rumpelt heran. Aus dem offenen Fenster schimpft der Fahrer, hupt aber nicht und steuert vorsichtig zickzack bis zur Eisdiele, wo er rausspringt, den hinteren Ladeschlag aufreißt und erst mal eine raucht.
Die Wolljacke kratzt, ist zu dick, aber egal, ich bin trotzdem federleicht. Vielleicht so leicht wie noch nie. Selbst als ich merke, dass ich den Beutel mit allem und die Häkeldecke vergessen habe, beruhige ich mich gleich, wir gehen ja wieder zurück! Dann steigt mir ein heißer Schwall ins Gesicht, ich bin in der Hosentasche auf den Schlüssel gestoßen. Schnell ziehe ich die Hand raus, konzentriere mich auf das Brötchen, das ich hoffentlich gleich bekomme. Ich gebe den Schlüssel zurück, nachher, ich entschuldige mich und erkläre dem Riesen alles, so mache ich das. Als die Brötchen tatsächlich ganz nah vor mir sind, in ihren Holzkästen hinter der Thekenscheibe, der Geruch, die Wärme im Laden, da wird mir so übel, dass ich blinzeln und die Füße gegen den Boden stemmen muss. Minimax trixitrax, Bauchatmen. Alles schwankt, die Brötchen verschwimmen. Immer noch zwei Leute vor uns. »Von jeder Sorte zwei«, bestellt der Riese, als er dran ist. »Willst du eine Schneckennudel oder ein Stück Streusel?« Ich nicke und drücke einen dicken Klumpen Spucke den Hals hinunter. »Man kann auf eine Oder-Frage nicht mit Ja oder Nein antworten.« Ich verstehe nicht. »Was jetzt, Schneckennudel oder …? Na, geben Sie mir mal ein Stück von beiden. Und hier so einen Kakao.« Er gibt mir die Kuchentüte und das Getränkekistchen mit dem angeklebten Knickstrohhalm. Ich traue mich nicht, gleich loszuessen, ich muss erst mit dem Riesen zurückgehen. Vor dem Laden reckt er sich plötzlich noch mehr in die Länge, sein Hemd rutscht hoch, er hat schwarze Haare um den Bauchnabel, die Brötchentüte raschelt in der Luft über seinem Kopf. »He, machen Sie mal Platz da«, schimpft eine Frau mit Kopftuch über den Lockenwicklern und drückt sich an ihm vorbei. »Was diese Gammler sich leisten! Als wären sie allein auf der Welt!« Der Riese macht einen Satz zur Seite. »Wie heißt du eigentlich?« »Toni.« Mein Kopf fühlt sich seltsam an, in meiner Faust ist die Papiertüte schon ganz feucht. Da macht der Riese mitten im Gehen seine Tüte auf und steckt sich ein Brötchen in den Mund! Wenn das so ist! Ich zerre meine klebrige Schnecke heraus – und im Nullkommanix ist sie weggemampft. Ein Glücksgefühl bis zur Haustür, bis der Riese dagegenhämmert. Da fällt es mir wieder ein. Jetzt musst du es ihm sagen, jetzt ist der Moment, Minimax trixi…, da geht sie schon auf. Ein anderer Langhaariger, barfuß, mickrige, weiße Brust, gähnt uns entgegen, glotzt mich an, ruckt mit dem Kopf, als wollte er sagen, was will der hier, dreht sich dann aber gleich wieder um. Ich husche nach hinten, um meine Sachen zu holen. Aber der Riese meint: »Komm ruhig mit hoch, frühstücken.« Schnell die Decke in den Beutel stopfen und umhängen. Ich sag es ihm später. Wenn wir oben sind, sag ich es ihm und gebe ihm den Schlüssel zurück. Erst mal die Holztreppe hoch, er poltert und bemüht sich kein bisschen, leiser zu treten, er poltert bis oben. An der Tür zupfe ich ihn am Ärmel. »Aber bitte niemanden etwas verraten, wegen dem Schlafen da unten, versprochen?« Er grinst. »Versprochen!«
In der Diele schläft ein Pärchen auf einer Matratze neben einem Klavier. Es riecht nach Kaffee. In der Küche sitzen zwei Typen am Tisch und reden gleichzeitig, der Türaufmacher, der jetzt ein Hemd anhat und eine Nickelbrille auf, und einer mit hellroten Haaren, an dem alles irgendwie hell ist, die Augen, die Wimpern, die Augenbrauen. Der eine kneift die Augen zusammen, als er mich sieht, der andere grinst freundlich, dann reden sie weiter. Zwei Mädchen kommen dazu. »Hey, kleiner Mann! Wen hast du denn da mitgebracht, Pablo?« Der Riese strahlt das Mädchen an. »Toni, ein alter Kumpel von mir«, er zwinkert mir zu. Das Mädchen hat ein Stirnband an, zieht schmutzige Tassen und Teller aus einem Berg und hält sie unter den Hahn. Der Helle schaut auf den großen, wippenden Busen der anderen, die jetzt Eier schlägt. Er grinst wie Don Camillo nach einer saftigen Prügelei. Dann lässt sich noch einer auf die Eckbank plumpsen, lange Haare, Unterhemd, bisschen verquollen. Er grüßt mich kurz mit zwei Fingern. Der Helle knufft ihn in die Seite. »Moin, Rollo. Kaffee oder lieber ein Stützbier?« Über dem Herd hängt ein Schild: ›Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!‹ Ich kriege Rührei zum Streuselkuchen. Das Stirnbandmädchen macht mir noch einen Kakao. Sie reden, viel verstehe ich nicht: Sie sind anders als die Leute bei uns, sie lachen und reden mehr. Außer einem haben alle ziemlich lange Haare. Der Riese heißt also Pablo, und ich habe ihm immer noch nichts gesagt.
Ich muss mal. Das Klo ist ganz am Ende von einem langen Schlauch, die Wand auf der einen Seite mit Sprüchen vollgekritzelt. ›Unter dem Pflaster liegt der Strand.‹ Hier am Neckar? Ich dachte, Strand gibt’s nur am Meer. ›Petting statt Pershing‹. Hm, keine Ahnung. ›Lieber Gras rauchen als Heuschnupfen! Lieber niederträchtig als hochschwanger‹. Verstehe ich auch nicht so richtig. ›Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment‹. Hände waschen und Gesicht, mit Seife! Blöd, dass ich den Beutel in der Küche habe, sonst könnte ich mir die Zähne putzen. ›Die Scheibe klirrt, der Sponti kichert, hoffentlich Allianz versichert‹. Mit nassen Händen die Haare nach hinten. ›Nieder mit der Schwerkraft, es lebe der Leichtsinn!‹ Kein Handtuch da, egal. ›Wissen ist Macht, ich weiß nichts, macht nichts.‹ Juhu, ein Spruch für mich!
Als Erstes steht das Stirnbandmädchen, Lilli, auf. »Bis nächste Woche. Oder ihr schaut mal im Laden vorbei.« Wieso das denn, ich dachte, die wohnen alle hier? »Und du kannst mich auch mal besuchen, okay?« Sie wühlt in ihrer Tasche, schenkt mir ein Kaugummi und geht. Dann verabschieden sich der Helle, den sie Heinzi nennen, und der Verquollene, Rollo. Dafür kommen zwei andere und dann noch einer, ist wie in der Kneipe hier, nur dass sie nichts bezahlen. »Ich bin Pablos Kumpel.« »Aha.« Biere werden geköpft, Zigaretten gedreht und viel geredet. Der mit der Nickelbrille steht auf und fängt im anderen Zimmer an, Geige zu üben. Klingt schlimmer als meine Schwester Gitte auf der Blockflöte, wenn sie x-mal dieselbe Stelle spielt. »Nickel quält wieder Amadeus«, meint Pablo und geht an das Klavier nebenan. Sein Gegenangriff, grummelnde tiefe Töne, dann Sprünge rauf und runter, dunkel und hell, ein Donnerton am Ende. Und schon steht er wieder mit eingezogenem Kopf in der Küchentür. Das Geigen von hinten hat aufgehört, der Brillenmann Nickel kommt zurück an den Tisch. Da läuten die Kirchenglocken, Pablo springt auf. »Was, schon zwölf? Ich muss los, die Bahn um 12.03 Uhr erwischen.« Er wirft mir einen Blick zu. »Äh, also, ich gehe dann auch mal, vielen Dank für das Frühstück.« Die Matratze lehnt jetzt an der Wand, das Pärchen ist weg. Pablo sprintet die Treppe hinunter, ich hinterher. An der Haustür klopft er sich ab. »Verdammt, wo ist bloß der Schlüssel? Egal, suche ich später. Bis bald, komm mal wieder vorbei, Kleiner!« Und schon rennt er los mit seinen Riesenschritten. Verdammt, jetzt habe ich es ihm doch nicht gesagt. Das ist blöd. Ich gehe in die andere Richtung. Das schlechte Gewissen. Aber auch so ein Gefühl, als gehörte ich hierher, als wäre ich schon Heidelberger. Ich kenne ja schon Leute hier! Und das Viertel. Haspelgasse, Neckarstaden, Dreikönigstraße, der Platz an der Kirche mit dem Muskelmann auf dem Brunnen, die Untere Straße, wo ich geschlafen habe, am Ende der Heumarkt. Aber dann fängt es wieder an, ich muss an Mama denken und an meine Geschwister Romy, Gina, Gitte und Freddy. Aber ich lasse das nicht zu. Das würde mich schwach machen. Und wenn ich an Elvis denke, das würde mich wütend machen. Die anderen Gedanken sind schlimm genug. Pablo den Schlüssel nicht wiederzugeben, war feige. Und wenn ich ihn einfach irgendwo in der Wohnung hingelegt hätte? Noch feiger!
Differentialblutbild
Mai 2016, Heidelberg, Marktplatz
Ich glaube, Clea hat sich verliebt. Er sieht aus wie der Junge in ›Slumdog Millionär‹ und ›Budapest Hotel‹, Engländer mit indischen Wurzeln. Strahlend und verlegen haben sie mir zugewinkt, per Skype, aus Barcelona.
Ich habe mich entschlossen, meinen Hausarzt zurate zu ziehen, einfach um abzuklären, warum ich so schlapp bin, was fehlt. Wechseljahre, Mangelerscheinung, Trauerphase, bestimmt nichts Ernstes. Seit dem Studium ist Erik mein Vertrauter, in der schweren Zeit war er der Einzige außer Clea, den ich ertragen konnte. Fast jeden freien Abend bin ich neben ihm hergegangen am Neckar entlang zum Wehr. Das schäumende, rauschende Wasser unter dem Steg hat mich beruhigt, für den Moment jedenfalls. Inzwischen treffen wir uns nur noch ab und zu.
Er nimmt die übliche Anamnese vor. Wann hat es angefangen mit der Müdigkeit? Ging ein Infekt voraus? Schlafstörungen? Und so weiter. Immer eigenartig dieser Rollentausch, nicht zu fragen, sondern gefragt zu werden, abgehört, untersucht. Erik ist ganz der Alte. »Jetzt wollen sie doch tatsächlich das Stethoskop abschaffen! Nur noch Ultraschall. Sprechstunde via Video, Telefon, Fragebogen! Diagnose im Online-Portal, bei Doktor Ed! Als wären Zuwendung, Zuhören und Berührung nicht – na ja, nicht dein Thema, deine Patienten sind ja schon schön sediert, du musst nur noch schauen, dass die Mixtur stimmt.« »Höre ich da eine leise Kritik an meiner Berufswahl heraus?« Er lächelt mich im Spiegel an, während er sich die Hände wäscht. »Du kannst dich wieder anziehen. Wir lassen auf jeden Fall ein Differentialblutbild machen und eine Senkung. Ich rufe dich übermorgen an.«
Meine Notizen sind schon mehrere Seiten lang. An ein Ins-Reine-Schreiben ist nicht zu denken. Zwar sehe ich die Bilder klar vor mir, aber die passenden Worte – schwierig. Besonders die Atmosphäre ist kaum zu vermitteln, die Siebziger bei den Studenten, wie ich sie erlebt habe mit elf. Der spontane Umgang, auch unter Wildfremden, das Wir-Gefühl, trotz der vielen unterschiedlichen Gruppen. Erst viel später habe ich das alles zu unterscheiden gelernt, die Friedensbewegung, die Anti-Atomkraft-Bewegung, die Frauenbewegung, die Kommunisten in ihren verfeindeten K-Gruppen, die Gammler, die Spontis und Hippies. Das alles war damals unbegreiflich und faszinierend für mich. Dumpf und dunkel erschien mir mit einem Mal das Dorf, ein Leben hinter Gardinen und Türen. Hier in der Stadt war alles öffentlich, die Kundgebungen, die Diskussionen, die Zärtlichkeiten, das Leben. Ich sehe noch den Samstag vor mir, als die ganze Untere Straße zum Frühstückshappening wurde, mit Tischen, Stühlen und Sofas vor jedem Haus. Keine gepflegte Touristenmeile für den Konsum an Cafétischen. Hier fläzten Langhaarige in Unterhosen und barfüßige Mädchen im Sommerfähnchen in der Sonne zur aufsässigen Musik von Zappa, den Rolling Stones und Jimi Hendrix aus enormen Boxen, die sie in die Fenster gestellt hatten. Eine friedliche Demonstration genussvoller Gegenkultur. Sozialromantik wurde das später, zu angepassteren Zeiten, genannt. Umso mehr liegt mir daran, es Clea in seiner ganzen lebendigen Gegenwärtigkeit zu vermitteln, mit allen Facetten des Erstaunens, die es in mir auslöste. Aber wie formulieren für jemanden, der im selben Alter, mit elf, sein erstes Handy bekommen hat, der mit Google, YouTube und Wikipedia aufgewachsen ist, für den Polizei und Staat nicht der natürliche Feind sind, der seine wahre Bestimmung nicht darin sieht, die Gesellschaft neu zu erfinden? Kein einziger Satz drückt annähernd aus, was ich wirklich erlebt habe in den fünf Wochen vor vierundvierzig Jahren. Alles bleibt irgendwie – blutleer.
Pasta & Politik
Juli 1972, Heidelberg, Untere Straße
Pablo poltert die Treppe hinauf, ich hinterher. Mein Herz klopft wie verrückt. Was soll ich nur sagen. Gerade hat er mich erwischt, als ich wieder reinschleichen wollte in das Haus mit der gemütlichen Truhe unter der Treppe. Die Tür war nicht abgeschlossen, es war auch noch hell, plötzlich stieß eine Hand über mir sie weit auf und Pablo stand hinter mir. »Hey, Kleiner, willst du mit hoch?« Es hat nicht böse geklungen, trotzdem, wer weiß, was jetzt kommt. Das mit dem Essen habe ich seit unserem Frühstück vor zwei Tagen einigermaßen hingekriegt. Auf dem Wochenmarkt gab es Äpfel mit braunen Stellen, Gurken, Orangen und so. Im Mülleimer neben dem Spielplatz und an der Imbissbude habe ich Brötchen- und Wurstreste gefunden. Im Marstallhof bei der Mensa hat mir einer über die Hälfte seiner Portion überlassen und sogar noch eine Essensmarke geschenkt. Aber das mit dem Schlafen, das hat nicht geklappt. An beiden Abenden Gewitter. Angst macht mir das nicht, aber unter der Brücke hat schon eine Schnapsleiche gelegen, und zum Schloss hoch und draußen schlafen, das wollte ich auch nicht mehr. Natürlich alles keine Entschuldigung, ich weiß, die Truhe steht bestimmt nicht für mich da, aber was hätte ich machen sollen? Noch dazu, wo die Haustür nur angelehnt war, den Schlüssel habe ich nicht mal gebraucht! Was sage ich jetzt nur, wenn wir oben sind, Pablo klopft schon. »Hallo, da bist du ja wieder.« Lilli, die Stirnbandfrau, lächelt mich an und geht in die Küche. Der Helle und dieser Nickel vom Frühstück sitzen in der Klavierdiele, trinken Bier und rauchen. Auf der Matratze zupft der Verquollene, Rollo, an einer Gitarre. Pablo stößt fast mit Uschi, dem Busenmädchen zusammen, die das Fenster aufreißt und mir die Haare wuschelt. Es brennt mir in der Hosentasche. Ich sehe zu Pablo hoch. Minimax trixitrax, ein Atemzug tief in den Bauch. Ich zerre den Ring mit den Schlüsseln heraus und strecke ihn ihm auf der offenen Hand unter die Nase, wie dem Pferd die Karotte. Eine Ohrfeige habe ich einkalkuliert. Oder auch Schlimmeres, falls er so richtig ausrastet. »Mein Schlüssel!« Er freut sich! Wie Freddy, wenn Mama den Schnuller versteckt und dann wieder rausholt. »Wo hast du DEN denn her?« Alle schauen zu mir. Lilli ruft. »Die Nudeln sind fertig, los, los, Tisch decken. Ihr könnt auch mal was machen!« Pablo schnappt sich den Schlüssel, schiebt mich am Kopf in die Küche, wo die beiden Mädchen an Herd und Spüle rumwerkeln. »Ich habe ihn gefunden, er ist dir heruntergefallen direkt vor der Tür.« In einem Durcheinander von Armen, Schranktüren und Schubladen werden Geschirr und Bestecke herausgenommen, weitergereicht und gedeckt. Lilli hat heute ein anderes Stirnband an, fast einen Turban, sie häuft Nudeln und dicke Tomatenfleischsoße auf den ersten Teller und stellt ihn direkt vor mich, als wäre ich der Chef. Eine Zweiliter-Rotweinflasche geht rum, nur der Helle trinkt Bier. Pablo neben mir fragt. »Und wann war das? Ich suche den Schlüssel doch mindestens schon – drei Tage?«
Ich verbrenne mir die Zunge. Er dreht die Gabel, das Nudelnest wird immer dicker. »Ich wollte ihn dir nach dem Frühstück geben, hätte ich bestimmt gemacht, aber du warst so schnell weg.« Er sieht mir direkt ins Gesicht. »Du bist ausgerissen, stimmt’s?« In meinem Kopf geht die Hölle los, Polizisten mit Hunden, die mich suchen, Mama, die heult, die Mistheinis vom Jugendamt, sogar der Alte taucht auf mit verzerrtem Gesicht, obwohl der doch schon längst weg ist und mich bestimmt nicht vermisst. Ich kriege kein Wort heraus. »Jetzt lass ihn doch erst mal essen.« Lilli schaufelt noch einen Löffel Soße auf meine Nudeln, aber mein Hals ist zu, ich kann nicht mehr schlucken. Ich tue trotzdem so, als würde ich reinhauen, um ihr den Gefallen zu tun. Mir ist heiß. Als die ersten sich zurücklehnen, fragt sie ganz freundlich. »Wie lange bist du denn schon von zu Hause weg?« »Fünf Tage«, sage ich mit vollem Mund, weil ich alles in den Backen gesammelt habe, damit der Teller leer wird. »Fünf Tage!« Ich würge den Brei herunter. Jawohl, fünf Tage und Nächte habe ich ganz allein geschafft, und ich werde Arzt, das steht fest. Mit einem Mal fühle ich mich stark und kann wieder essen. Da bombardieren sie mich: »Wieso bist du weggelaufen? Wo gehörst du denn hin, deine Eltern? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Wo hast du übernachtet?« Beim Wort ›übernachtet‹ steht Pablo auf, er will sein Versprechen nicht brechen und fängt an, Klavier zu spielen. »Die letzten dreimal habe ich hier geschlafen.« Ich sage das, als wäre es ganz normal. Nur nicht kleinmachen! »Was, hier? Wo denn? Bei Pablo?« Der Riese streckt eine Hand in die Tür und zeigt mit dem Finger nach unten, mit der anderen klimpert er weiter. »Hier auf dem Boden? Das hätten wir doch gemerkt!« Der mit der Nickelbrille blinzelt mich misstrauisch an, ich bleibe ganz locker. »Nein, unten im Hausflur vor der Kellertür, unter der Treppe.« Die Mädchen fangen an abzudecken. »Ganz schön dreist«, brummt der Nickelbrillenmann. »Das ist aber keine Dauerlösung, schon klar, oder?« Er pafft, hebt den Kopf, glubscht durch die Flaschenböden über den Tisch zu mir rüber. Lilli braust auf. »Also, jetzt halt mal die Luft an, Nickel. Wenigstens ist er in Sicherheit hier. So ganz alleine in der Nacht, wo sollte er denn hin?« Sie schüttelt den Kopf. Sie ist die wunderbarste Frau, der ich je begegnet bin, obwohl Mama auch wunderbar ist. Aber jetzt nicht dran denken. Und dann legt sie mir einen Raider-Schokoriegel hin. »Gut, dass dir nichts passiert ist. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.« In Zeitlupe bläst dieser Nickel eine Rauchsäule in die Schirmlampe. »Da gibt’s nicht viel zu schauen, wir müssen ihn auf jeden Fall zurückbringen.« Die Wunderbare knallt einen Teller auf den Stapel und fährt herum. »Wieso das denn?« Blauer Nebel verteilt sich im Raum. »Was sonst? Was stellst du dir denn vor?« Der Brillenmann kickt einen Krümel vom Tisch und schiebt seinen Kopf unter die Lampe wie eine Schildkröte. »Nimm du ihn doch mit nach Hause zu dir! Ich nehme ihn jedenfalls nicht. Aber ich würde jetzt gern einen Kaffee nehmen.« Lilli peitscht mit dem Geschirrtuch. »Dann mach dir gefälligst selbst einen! Was glaubst du eigentlich, wer du bist?« Uschi rührt im Spülwasser rum, es schwappt über den Rand. Sie wirbelt herum: »Du kannst auch mal wieder putzen, du bist nämlich dran diese Woche, falls du es vergessen hast.« Der Helle, Heinzi, holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Das Klavier klingt jetzt wie ein Fohlen, das über die Wiese springt. Ein einzelner Ton hüpft noch mal hoch, und Pablo steht wieder im Türrahmen, mit eingezogenem Kopf. »Wer spricht denn von zu sich nehmen?« Der Nickel steht umständlich auf, macht einen Bogen um Lilli, füllt den Wasserkessel, löffelt Pulver in eine Tasse und sagt. »Na, irgendwas muss ja passieren mit ihm. Der ist doch höchstens acht oder neun.« »Ich bin elf!« Er gießt auf, dann bohren seine Knopfaugen sich wieder in mich. »Du musst doch garantiert in die Schule, oder etwa nicht?« »Es sind Ferien!« »Sonst noch einer Kaffee? Auf jeden Fall muss sich jemand um ihn kümmern. Die Eltern, die Fürsorge, keine Ahnung.« Jetzt ist das starke Gefühl wieder weg. Pablo setzt sich zu mir auf die Eckbank, winkt Lilli zu sich, sie bleibt aber stehen und legt los: »Das soll sie also jetzt sein, eure Selbstbestimmung, für die ihr auf die Straße geht, ja? Der Kampf gegen das Establishment, eure sogenannte Gegenkultur, he! Ist alles nur für euch selbst oder was? Taucht ein kleiner Junge auf und gleich wird die Obrigkeit eingeschaltet, saumäßig autoritär nenne ich das, lieber Nickel.« »Für dich, liebe Lillien, immer noch Nikolaus von Alvensbach oder Onkel Nick.« »Gott, wie witzig!« Der Verquollene taucht auf, jetzt frisch geduscht, er hebt die Hände: »Frieden hienieden! Ich, Graf der bretonischen Mark unter Karl dem Großen, Ritter mit bloßem Schwert, ich frühstücke jetzt.« Heinzi rülpst. Lilli guckt böse zu Nickel. »Fällt dir wirklich nichts Besseres ein! Wie wäre es zum Beispiel mit ein bisschen von der viel beschworenen Solidarität mit den Schwächsten. Wir könnten den Jungen unterstützen auf seinem Weg, bei seiner Selbstverwirklichung. Die Idee kommt dir wohl gar nicht?« Jetzt setzt sie sich doch neben Pablo, den Rücken kerzengerade. Nickel kratzt sich in Zeitlupe hinter dem Ohr und sagt langsam, ganz langsam, als wäre sie dumm. »Sag mal, spinnst du jetzt, Lilli, das ist ein Kind! Ein durchgebranntes Kind von wer weiß wo! Und wir sind hier kein Kindergarten und auch kein Kinderladen, kapierst du das nicht?« Und dann legt er los wie eine Maschine. »Wir werden diesem und allen anderen Kindern eine Zukunft erkämpfen, in der jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen leben kann. Eine Welt der sozialen Gerechtigkeit. Aber noch ist es nicht so weit. Wenn die Macht des Kapitals erst zerschlagen ist, werden die Menschen, auch die Kinder, aus ihrer …« »Amen!«, brüllt Lilli und klatscht auf den Tisch. Schnell bekreuzigen, sicher ist sicher, auch wenn sich das nicht nach Gebet angehört hat. Vielleicht protestantisch. Die anderen gucken ganz komisch. Lilli geht aus der Küche, alle stehen auf. Neben mir murmelt der Helle. »In der Theorie ist er ein Walfisch, in der Praxis eine Sprotte.« Pablo grinst. Sie lassen sich in die Polster fallen. Ich hocke mich auf den Boden. Uschi quetscht sich an diesen Nickel heran und sagt leise: »Aber Lilli, weißt du, wir können ihn doch auch nicht einfach sich selbst überlassen.« Pablo streckt die Beine neben mir aus, gähnt und fragt laut: »Wieso nicht? Bei uns kann er auch nicht bleiben, oder doch?« »Das hatte ich auch gar nicht vor!« Der Nickelmann stößt Rauch aus wie Emma auf Lummerland. »Was du vorhast, Kleiner, ist hier ohne jeden Belang. Hier geht’s erst mal um uns und was wir für richtig halten, verstanden?« Die anderen schütteln die Köpfe, Pablo klopft mir auf die Schulter, Lilli schnaubt. »Soziale Gerechtigkeit, Zerschlagung des Kapitals, hast du es immer noch nicht begriffen? Das ist nichts geworden, Mann! Deine Wortführer sitzen im Knast, Baader, Meinhof und Co. Wir können was ändern, aber bestimmt nicht so. Jeder muss bei sich selbst anfangen, bei sich und seinem direkten Umfeld. Aber du merkst ja nicht mal, was für ein reaktionärer Spießer du bist. Der nichts kann als Reden schwingen über angelesenes Zeug und ein bisschen die Geige kratzen, weil das in deinen privilegierten Kreisen so üblich ist. Du fragst dich nicht mal, warum er es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Wahrscheinlich wegen genau so einem wie dir.« Diese Lilli! Nickel kann nur noch glotzen. Bei uns wird nie so geredet. Früher hat der Alte gesagt, was gemacht wird, und fertig. Bei Tisch Sprechverbot, ›nur Franzosen quatschen beim Essen‹, außer wenn er nach der Schule gefragt hat. Mama redet höchstens in der Küche mit sich selbst oder beim Gute-Nacht-Sagen, wenn sie uns von den Filmen von früher erzählt, als sie siebzehn war, bevor sie Gina gekriegt hat. Nickel drückt Uschi ein Stück von sich weg. »Pass mal auf, Lilli, wir müssen hier mal was ganz grundsätzlich klären. Dein Rückzug ins Private, dein Traum vom Landleben, das ist nichts weiter als der kleinbürgerliche Versuch, den Kopf in den Sand zu stecken und die herrschenden Verhältnisse für alle Ewigkeit zu zementieren. Die RAF ist noch lange nicht fertig. Militante Formen des Klassenkampfes sind nach wie vor das Einzige …« Jetzt knallt der Helle sein Bier auf den Tisch. »Du rechtfertigst die Bombenanschläge vom Mai? Du bist wirklich der Meinung, das soll so weitergehen? Allein hier im Headquarter gab es drei Tote! Das kann nicht dein Ernst sein. Der Kampf geht weiter, aber nicht über Leichen. Das Einzige, was uns wirklich voranbringt, ist der lange Marsch durch die Institutionen. Subversive Integration, schon mal gehört? Das System lässt sich nicht …« Pablo springt auf. »Ich habe noch eine Probe. Ich muss los.« Lilli hält ihn am Arm fest: »Wir besprechen das morgen Abend alle zusammen, okay? Und heute darf der Junge hier unten im Haus schlafen. Er könnte ja bei mir, aber …« Der Riese berührt ihre Hand. »Schon gut, Lilli, morgen Abend. Gib ihm deinen Schlüssel.« Er wirft einen kurzen Blick in die Runde. »Also, dann Tschüss, Genossen.« Ich laufe hinter ihm die Treppe hinunter. An der Haustür dreht er meinen Kopf Richtung Keller. »Na, dann schlaf mal gut, Kleiner.«
Ich muss meine Schwester Gina einweihen. Ich halte das nicht mehr aus, ich muss mit jemandem sprechen, es passiert so viel, ich platze fast. Ich muss erklären, warum ich das alles mache, dass es nicht anders geht, dass ich wegmusste, für Romy. Gina ist die Einzige, die dafür infrage kommt. Die stille, verängstigte, aber auch zähe Gina, die alles versteht und mich und die anderen beschützt, wenn es irgendwie geht. Außerdem muss ich wissen, was los ist zu Hause, wie Mama reagiert hat auf mein Verschwinden, ob sie mich suchen und schon irgendwer hinter mir her ist. Gina verrät mich bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht.
»Jetzt erzählst du mir mal was von dir zu Hause, von deinem Vater, zum Beispiel. Oder traust du dich nicht?« Pablo und ich sitzen auf meiner Truhe, ich unter der niedrigen Seite der Treppe, er unter der hohen. Ich habe keine Lust, über den Alten zu reden, wozu? Außerdem kann jeden Moment dieser Nickel aufkreuzen. Der darf mich auf keinen Fall sehen. Der hat mich gestern vorm Haus erwischt, sich aufgeregt und mich verjagt. Davon muss Pablo aber nichts wissen. »Na ja«, sage ich und tue so, als würde ich nachdenken. Pablo zündet sich eine Selbstgedrehte an. Da geht die Haustür auf, ich ziehe die Beine an, Pablo schaut um die Ecke. »Hallo Heinzi.« Ein Glück! Der Helle poltert die Treppe hoch. Ich sage erst mal nichts mehr, gucke mir meine Schuhspitzen an. »Wir können ja ein Bier trinken gehen, ich spendiere dir eine Limo.«
Durchs Abendgedrängel ein paar Häuser weiter ins Pop. Es ist voll, alle reden, laute Musik. Pablo bestellt an der Theke, und schon werden zwei Plätze frei. Was ist denn das da an der Wand? Marilyn Monroe! Mehrere nebeneinander sogar, nur das Gesicht, in verschiedenen knalligen Farben. Ich gucke weg. Aber da, da über dem langen Tisch, unter der Decke, da hängt ein Auto! Ein dunkelgrüner Sportwagen! Hängt da einfach unter der Decke! Verkehrt herum, mit dem Dach nach unten! Wahrscheinlich damit kein Öl raustropft auf die Spagetti, die Haare oder so. Pablo prostet mir zu und sagt irgendwas. »Was? Wie bitte?« »Dein Vater!« »Ach so, ja.« Erst mal trinken. Pablo beugt sich weit runter mit seinem Ohr zu meinem Mund. »Er ist weg, vor zwei Jahren verschwunden, kurz nach Freddys Geburt.« »So, dann lebst du bei deiner Mutter. Und wie war es früher, als er noch da war?« »Ich musste ihn immer aus der Wirtschaft rausholen, wenn das Essen fertig war. Ohne ihn durften wir nicht anfangen. Zu Hause hat er Mama angebrüllt. Uns auch, außer Elvis. Wir hatten Angst, am meisten meine älteste Schwester Gina. Sie hat das Zimmer ganz allein am anderen Flurende. Als der Alte weg war, wollte Elvis das Zimmer für sich. Aber dann bin ich bei den Kleinen raus und bei ihr eingezogen, Elvis hat die Dachkammer gekriegt. Gina hat furchtbare Angst vor dem Alten gehabt. Er hat … ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, der ist weg.« »Wie viele Geschwister hast du denn?« »Fünf.« »Und du.« »Klar, und ich.« »Bist du der älteste Junge?« »Nein.« »Wie alt sind denn deine Geschwister?« »Gina ist 15, Elvis 13, Gitte 7, Romy 6 und Freddy 2.« »Elvis wie Elvis the Pelvis?« »Ja. Na und?« »Und Gina?« Also, gut, wenn’s sein muss. »Gina wie Gina Lollobrigida aus ›Fanfan der Husar‹, Gitte wie Brigitte Bardot aus ›Mit den Waffen einer Frau‹. Mama durfte nur Romy aussuchen, wie ›Sissi‹, du weißt schon. Und dann gibt’s noch Freddy.« »Wie Quinn?« »Nö.« »Aber nicht wie Chopin, oder?« »Was? Ich geb dir einen Tipp: wie Alfred. Kennst du den etwa nicht? Alfred!« »Hitchcock?« »Treffer, versenkt! Mama hätte ihn lieber Cary genannt wie Cary Grant aus ›Über den Dächern von Nizza‹, aber …« »Hast du die etwa alle gesehen?« Ich nicke. »Nein, war nur Spaß. Aber Mama hat uns erzählt, worum es geht in den Filmen. Nur ›Über den Dächern‹ habe ich gesehen und ›Sissi‹, viermal, im Fernsehen, alle drei Folgen. Mamas Lieblingsfilme. Sind aber uralt, wie die anderen.« »Und Toni?« Das musste ja kommen. »Tony Curtis, wenn du’s genau wissen willst. Der mit der Schmalzlocke. Die ist nämlich gar nicht Elvis’ Erfindung, der hat sie Tony nur nachgemacht.« Ich kippe den Rest der Limo in einem Zug runter. Minimax trixitrax, Bauch.





























