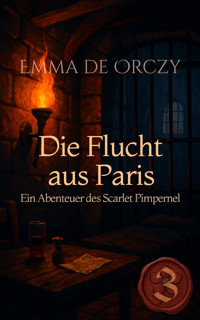4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KI Classics
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Falle in Boulogne – Ein Abenteuer des Scarlet Pimpernel Frankreich, 1793. Die Revolution hat Europa in Angst und Schrecken versetzt. In England genießt Sir Percy Blakeney – nach außen der Inbegriff eines reichen Dandys – das gesellschaftliche Leben an der Seite seiner Frau Marguerite. Doch hinter der Maske des Müßiggängers verbirgt sich der Scarlet Pimpernel, Englands listigster Retter, dessen kühne Taten Frankreichs Schreckensherrschaft herausfordern. Sein alter Feind Chauvelin hat die Niederlage von Calais nicht vergessen. Getrieben von Hass und politischem Ehrgeiz spinnt er einen neuen Plan: Er will den Scarlet Pimpernel nicht nur fangen, sondern ihn öffentlich demütigen und vernichten. Dazu setzt er alles auf eine perfide Falle – und diesmal scheint der Schritt zum Triumph zum Greifen nah. Während Percy und Marguerite sich in England noch in trügerischer Sicherheit wiegen, werden erste Fäden gezogen. Chauvelins Plan berührt nicht nur Percys Mut, sondern seine Ehre. Als Percy herausgefordert wird, sieht er sich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen: Soll er seine Sicherheit wahren oder seinem Ruf folgen – und damit alles riskieren? Marguerite, stolz und leidenschaftlich, spürt die wachsende Bedrohung. Als sie erkennt, was ihrem Mann droht, setzt sie alles daran, an seine Seite zu eilen. Doch in einer Welt, in der Loyalität eine tödliche Gefahr ist, geraten Mut und Liebe schnell an ihre Grenzen. Ohne zu zögern folgt Marguerite Percy auf die gefährlichste Reise ihres Lebens – mitten hinein in die Falle, die sein Untergang sein könnte. Die Falle in Boulogne erzählt von Mut und Verrat, von Ehre und Täuschung – und von einer Liebe, die sich im Feuer der Revolution bewähren muss. Neue Übersetzung dieses Klassikers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Emma De Orczy
Die Falle in Boulogne
Ein Abenteuer des Scarlet Pimpernel
Inhaltsverzeichnis
1. Paris: 1793
2. Ein Rückblick
3. Der ehemalige Botschafter Chauvelin
4. Das Fest in Richmond
5. Sir Percy und seine Lady
6. Für die Armen von Paris
7. Vorahnung
8. Die Einladung
9. Demoiselle Candeille
10. Lady Blakeneys Empfang
11. Die Herausforderung
12. Zeit – Ort – Bedingungen
13. Überlegungen
14. Die herrschende Leidenschaft
15. Abschied
16. Der Passierschein
17. Boulogne
18. Nummer 6
19. Die Kraft der Schwachen
20. Triumph
21. Spannung
22. Nicht der Tod
23. Die Geisel
24. Kollegen
25. Die Überraschung
26. Die Bedingungen des Handels
27. Die Entscheidung
28. Die Mitternachtswache
29. Das Nationalfest
30. Die Prozession
31. Die letzten Anordnungen
32. Der Brief
33. Der englische Spion
34. Das Angelusläuten
35. Marguerite
Impressum
1. Paris: 1793
Es gab keine Atempause.
Weiter! Immer weiter! In diesem wilden, reißenden Strom; gesät wurde der Wind der Anarchie, des Terrors, der Blutgier und des Hasses und geerntet ein Orkan der Zerstörung und des Schreckens.
Weiter! Immer weiter! Frankreich, mit Paris und all seinen Kindern, stürmte weiter, blindlings, wahnsinnig, trotzt der mächtigen Koalition - Österreich, England, Spanien, Preußen, die sich verbündet haben, um den Strom des Gemetzels aufzuhalten - trotzt dem Universum und trotzt Gott!
Paris im September 1793 - oder nennen wir es Vendemiaire, das erste Jahr der Republik - nennen wir es, wie wir wollen! Paris! Eine Stadt des Blutvergießens, der Menschlichkeit in ihrer niedrigsten und entwürdigendsten Form. Frankreich selbst ein gigantisches, sich selbst verschlingendes Ungeheuer, seine schönsten Städte zerstört, Lyon dem Erdboden gleichgemacht, Toulon, Marseille, Massen von geschwärzten Trümmern, seine tapfersten Söhne in lüsterne Bestien verwandelt oder in elende Feiglinge, die Sicherheit um den Preis jeder Erniedrigung suchen.
Das ist dein Lohn, o mächtige und heilige Revolution! Apotheose der Gleichheit und Brüderlichkeit! Großer Rivale des dekadenten Christentums.
Vor fünf Wochen starb Marat, der blutdurstige Freund des Volkes, durch das Messer einer jungfräulichen Patriotin, vor einem Monat schritt seine Mörderin stolz, ja begeistert zur Guillotine! Es gab keine Reaktion - nur einen großen Seufzer! Nicht ein Seufzer der Genugtuung oder des befriedigten Begehrens, sondern ein Seufzer, wie ihn der menschenfressende Tiger nach dem ersten Geschmack des ersehnten Blutes ausstößt.
Ein Seufzer nach mehr!
Ein König auf dem Schafott; eine Königin, gedemütigt und erniedrigt, in Erwartung des Todes, der auf der Schwelle ihres schändlichen Gefängnisses lauert; achthundert Abkömmlinge alter Häuser, die die Geschichte Frankreichs geschrieben haben; tapfere Generäle, Custine, Blanchelande, Houchard, Beauharnais; würdige Patrioten, edle Frauen, fehlgeleitete Enthusiasten, alle zu Hunderten auf den wenigen Holzstufen, die zur Guillotine führen.
Ein Sieg der Wahrheit!
Und immer wieder dieser Seufzer nach mehr!
Aber für einen Augenblick, nur für ein paar Sekunden, schaute Paris sich um und dachte nach! Der menschenfressende Tiger leckte sich seufzend die mächtigen Kiefer und dachte nach! Etwas Neues, etwas Wunderbares! Wir haben eine neue Verfassung, eine neue Justiz, neue Gesetze, einen neuen Kalender! Was nun? Wie kommt es, dass das große, intellektuelle, ästhetische Paris noch nie an etwas so Wunderbares gedacht hat?
Eine neue Religion!
Das Christentum ist alt und veraltet, die Priester sind Aristokraten, reiche Unterdrücker des Volkes, die Kirche ist nur eine andere Form der willkürlichen Tyrannei.
Wir brauchen eine neue Religion.
Es wurde bereits etwas getan, um die alte zu zerstören! Zu zerstören! Immer zu zerstören! Kirchen wurden geplündert, Altäre geschändet, Gräber entweiht, Priester und Pfarrer ermordet; aber das genügt nicht. Es muss eine neue Religion geben, und dazu muss es einen neuen Gott geben. Der Mensch ist ein geborener Götzendiener.
Gut, dann soll das Volk eine neue Religion und einen neuen Gott haben.
Und doch keinen Gott, denn Gott bedeutet Majestät, Macht, Königtum, all das, was die mächtige Hand des französischen Volkes zu zerstören suchte und sucht.
Kein Gott, sondern eine Göttin. Eine Göttin! Ein Idol! Ein Spielzeug! Denn auch der menschenfressende Tiger muss manchmal spielen.
Paris wollte eine neue Religion und ein neues Spielzeug, und ernsthafte Männer, glühende Patrioten, verrückte Enthusiasten, saßen in der Versammlung des Konvents und diskutierten ernsthaft, wie man ihr diese beiden Dinge geben könnte, die es verlangte.
Ich glaube, es war Chaumette, der die Schwierigkeit zuerst löste: der Prokurator Chaumette, Chef der Pariser Stadtverwaltung, der angeordnet hatte, dass der Wagen, der die entthronte Königin in das schäbige Gefängnis der Conciergerie brachte, langsam an ihrem eigenen, erstorbenen Palast in den Tuilerien vorbeifuhr und dort gerade lange genug stehen blieb, damit sie in einer großen geistigen Vision all das sehen und fühlen konnte, was sie gewesen war, als sie dort gelebt hatte, und was sie jetzt durch den Willen des Volkes war.
Chaumette war, wie man sieht, raffiniert, künstlerisch; die Folterung des Herzens der gefallenen Königin bedeutete ihm mehr als der Schlag der Guillotine auf ihren Hals. Kein Wunder also, dass es Procureur Chaumette war, der als erster erkannte, was für eine neue Religion Paris gerade jetzt brauchte.
„Lasst uns eine Göttin der Vernunft haben“, forderte er, „verkörpert durch die schönste Frau von Paris, wenn ihr einverstanden seid. Lasst uns ein Fest zu Ehren der Göttin der Vernunft feiern, lasst uns einen Scheiterhaufen errichten mit all dem Schnickschnack, der seit Jahrhunderten von anmaßenden Priestern vor den Augen der hungernden Massen zur Schau gestellt wird, lasst das Volk jubeln und um diesen Scheiterhaufen tanzen, und über allem soll die neue Göttin lächelnd und triumphierend thronen. Die Göttin der Vernunft! Die einzige Göttin, die unser neues und erneuertes Frankreich in den kommenden Jahrhunderten anerkennen wird!“
Die leidenschaftliche Rede wird mit stürmischem Beifall bedacht.
„Eine neue Göttin!“ riefen die ernsten Herren der Nationalversammlung, „die Göttin der Vernunft!“
Sie alle wollten, dass das Volk dieses Spielzeug bekäme, etwas zum Ablenken und Necken, um das man die verrückte Carmagnole tanzen und das immer wiederkehrende „Ca ira“ singen könnte. Etwas, das die Bevölkerung von den Folgen ihres eigenen Handelns und der Ohnmacht ihrer Gesetzgeber ablenkte.
Procureur Chaumette erweiterte seine ursprüngliche Idee; wie ein echter Künstler, der die große Wirkung eines Bildes auf einen Blick sieht und dann die kleinen Details ausfüllt, war er bereits dabei, seinen Plan auszuarbeiten.
„Die Göttin muss schön sein... nicht zu jung... die Vernunft kann nur mit dem reiferen Alter der zweiten Jugend einhergehen... sie muss in klassische Gewänder gekleidet sein, streng und doch anregend... sie muss klar und geschminckt sein... denn sie ist nur ein Idol... leicht zu besänftigen mit Weihrauch, Musik und Lachen.“
Er ereiferte sich für sein Thema und suchte nach Details, um es immer attraktiver zu machen.
Doch Geduld war nie das Kennzeichen der französischen Revolutionsregierung. Die Nationalversammlung hatte bald genug von Chaumettes dithyrambischen Reden. Oben auf dem Berg gähnte Danton wie ein riesiger Leopard.
Henriot war bald wieder auf den Beinen. Er hatte einen viel besseren Plan als der Procureur, den er seinen Kollegen vorlegen konnte. Ein großes nationales Fest mit halbreligiösem Charakter, aber mit einer neuen Religion, die zerstört und entweiht, aber niemals in Anbetung niederkniet.
Die Göttin der Vernunft des Citoyens Chaumette - Henriot gibt zu, dass die Idee gut war -, aber die Göttin nur als Galionsfigur: um sie herum eine Prozession von ungeweihten und abtrünnigen Priestern, die die Zerstörung der alten Hierarchie symbolisieren, Maultiere, die Lasten von heiligen Gefäßen tragen, die Beute von zehntausend Kirchen Frankreichs, und Ballettmädchen in bacchantischen Gewändern, die um die neue Gottheit herum die Carmagnole tanzen.
Staatsanwalt Foucquier Tinville fand all diese Pläne äußerst zahm. Warum sollte man dem französischen Volk vorgaukeln, das Zeitalter einer neuen Religion sei ein Zeitalter von Milch und Wasser, von Umzügen und Feuerwerken? Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind sollte wissen, dass dies ein Zeitalter des Blutes und noch mehr Blut war.
„Oh!“ rief er mit leidenschaftlichem Klang, „hätten doch alle Verräter Frankreichs einen gemeinsamen Kopf, damit man ihn mit einem Hieb der Guillotine abschlagen könnte!“
Er befürwortete das Nationalfest, aber er wünschte sich eine Apotheose der Guillotine; er wollte zehntausend Verräter finden, die an einem großen und glorreichen Tag enthauptet werden sollten: zehntausend Köpfe, die an einem großen und unvergesslichen Abend den Place de la Révolution schmücken sollten, nachdem die Guillotine dieses Rekordwerk vollbracht hatte.
Aber auch Collot d‘Herbois sollte zu Wort kommen. Collot stammte aus dem Süden und war für seine Grausamkeit bekannt, die in diesem schrecklichen Jahrzehnt ihresgleichen suchte. Er würde sich von Tinvilles blutrünstigen Plänen nicht beeindrucken lassen.
Er war der Erfinder der „Noyades“, die in Lyon und Marseille so erfolgreich gewesen waren. „Warum sollte man den Einwohnern von Paris nicht auch dieses erheiternde Spektakel bieten?“, fragte er mit einem groben, brutalen Lachen.
Dann erklärte er seine Erfindung, auf die er ungemein stolz war. Etwa zwei- oder dreihundert Verräter, Männer, Frauen und Kinder, wurden mit Seilen zu großen, menschlichen Bündeln zusammengebunden und auf einen Kahn in der Mitte des Flusses geworfen: der Kahn mit einem Loch im Boden! Nicht zu groß! Nur so groß, dass er langsam, sehr langsam, vor den Augen der Menge der begeisterten Zuschauer sinken konnte.
Die Schreie der Frauen und Kinder und sogar der Männer, die spürten, wie das Wasser anstieg und sie allmählich einhüllte, wie sie sich selbst für einen erfolglosen Kampf machtlos fühlten, hatten die Herzen der wahren Patrioten von Lyon sehr erheitert, wie Citoyen Collot erklärte.
So ging die Diskussion weiter. Es war die Zeit, in der jeder Mensch nur den einen Wunsch hatte, andere an Grausamkeit und Brutalität zu übertreffen, und nur die eine Sorge, seinen eigenen Kopf zu retten, indem er den seines Nachbarn bedrohte. Das große Duell zwischen den titanischen Anführern dieser turbulenten Parteien, der Konflikt zwischen dem hitzköpfigen Danton auf der einen und dem kaltblütigen Robespierre auf der anderen Seite, hatte gerade erst begonnen; die großen, alles verschlingenden Ungeheuer hatten ihre Krallen ineinander gegraben, aber der Ausgang des Kampfes stand noch auf dem Spiel.
Keiner dieser beiden Giganten hatte an den Beratungen über die neue Religion und die neue Göttin teilgenommen. Danton gab hin und wieder Zeichen größter Ungeduld und murmelte etwas von einer neuen Form der Tyrannei, einer neuen Art der Unterdrückung. Auf der linken Seite polierte Robespierre in seinem makellosen meergrünen Mantel und sorgfältig gaufriertem Leinen in aller Ruhe die Nägel seiner rechten Hand an der Handfläche der linken. Aber nichts entging ihm von dem, was vor sich ging. Sein grimmiger Egoismus, sein grenzenloser Ehrgeiz berechnete schon jetzt, welche Vorteile ihm aus dieser Idee der neuen Religion und des Nationalfestes erwachsen könnten, welche persönliche Vergrößerung er daraus ziehen könnte. Äußerlich schien die Angelegenheit trivial genug zu sein, aber sein scharfer und berechnender Verstand sah bereits verschiedene Nebenaspekte, die ihn – Robespierre – auf einen noch höheren und unangreifbaren Gipfel bringen könnten.
Umgeben von denen, die ihn hassten, die ihn beneideten und die ihn fürchteten, herrschte er über sie alle durch die Kraft seiner eigenen kaltblütigen Wildheit, durch die widerstandslose Macht seiner gnadenlosen Grausamkeit. Er kümmerte sich um niemanden außer um sich selbst, um nichts als um seine eigene Erhöhung: Jede Handlung seiner Karriere, seit er seine kleine Praxis in einer ruhigen Provinzstadt aufgegeben hatte, um sich in den wilden Strudel der revolutionären Politik zu stürzen, jedes Wort, das er je gesprochen hatte, hatte nur ein Ziel – sich selbst. Er sah, wie seine Kollegen und Genossen der alten Jakobinerclubs um ihn herum rücksichtslos vernichtet wurden: Freunde hatte er keine, und alle ließen ihn gleichgültig; und nun hatte er Hunderte von Feinden in jeder Versammlung und jedem Club in Paris, und auch diese wurden einer nach dem anderen in den wilden Strudel mitgerissen, den sie selbst geschaffen hatten.
Robespierre, der ehrgeizigste und selbstsüchtigste Demagoge seiner Zeit, hatte sich den Ruf erworben, unbestechlich und selbstlos zu sein, ein eifriger Diener der Republik. Er war leidenschaftslos, gelassen und hatte immer eine ruhige Antwort parat, wenn die Leidenschaft um ihn herum am stärksten wütete. Der meergrüne Unbestechliche!
Und während andere redeten und stritten, sich über Pläne für Umzüge und Prunk aufregten oder die ganze Angelegenheit lautstark als das Werk eines Verräters anprangerten, saß er, der mit dem meergrünen Mantel, ruhig da und polierte sich die Nägel. Aber er hatte all diese Diskussionen bereits in seinem Kopf abgewogen, sie in den Schmelztiegel seines Ehrgeizes gelegt und sie in etwas verwandelt, das ihm nützen und seine Position stärken würde.
Ja, das Fest sollte glanzvoll genug sein! Fröhlich oder schrecklich, wahnsinnig oder furchterregend, aber durch alles hindurch musste dem französischen Volk das Gefühl vermittelt werden, dass es eine lenkende Hand gab, die die Geschicke aller lenkte, ein Haupt, das die neuen Gesetze entwarf, das die neue Religion festigte und ihre neue Göttin einführte: die Göttin der Vernunft. Robespierre, ihr Prophet!
2. Ein Rückblick
Der Raum war eng, dunkel und vom Rauch eines kaputten Kamins erfüllt. Ein winziges Boudoir, einst das zierliche Heiligtum der herrschsüchtigen Marie Antoinette; ein schwacher, geisterhafter Geruch, wie von Gespenstern, schien noch an den fleckigen Wänden und den zerrissenen Wandteppichen zu hängen. Überall sah man den Stempel einer schweren und zerstörerischen Hand: die der großen und glorreichen Revolution. In den schlammverschmierten Ecken des Zimmers lehnten ein paar Stühle mit zerschlissenen Brokatpolstern zerbrochen und trostlos an den Wänden. Ein kleiner Schemel, einst mit vergoldeten Beinen und Satin bezogen, war umgeworfen und unsanft zur Seite geschleudert worden und lag nun auf dem Rücken, wie ein verwundetes Tier, das seine gebrochenen Glieder in die Höhe streckte, ein jämmerlicher Anblick. Die Silbereinlage des fein gearbeiteten Buhltisches war unsanft aus dem Muschelbett herausgeschlagen worden. Über der von Boucher gemalten Lünette, die eine keusche Diana, umgeben von einer Schar Nymphen, darstellte, hatte eine grobe Hand mit Kohle den Wahlspruch der Revolution gekritzelt: Liberté, Egalité, Fraternité ou la Mort; und wie um dem Zerstörungswerk die Krone aufzusetzen und den Wahlspruch zu unterstreichen, hatte jemand das Porträt Marie Antoinettes mit einer scharlachroten Mütze geschmückt und einen roten, unheilvollen Strich quer über ihren Hals gezogen.
Und an der Tafel saßen zwei Männer, eng und eifrig beieinander. Zwischen ihnen warf ein einsames, rußendes, seltsam flackerndes Talglicht phantastische Schatten an die Wände und beleuchtete die Gesichter der beiden Männer mit einem unsteten, ungewissen Licht.
Wie verschieden waren sie in ihrem Charakter! Der eine mit hohen Wangenknochen, vollen, sinnlichen Lippen und sorgfältig gepudertem Haar, der andere blass und dünnlippig, mit den scharfen Augen eines Frettchens und einer hohen, intellektuellen Stirn, von der das glatte, braune Haar sanft weggebürstet war. Der eine war Robespierre, der erbarmungslose und unbestechliche Demagoge, der andere der Citoyen Chauvelin, ehemaliger Botschafter der Revolutionsregierung am englischen Hof.
Es war schon spät, und die Geräusche der großen, brodelnden Stadt, die sich auf den Schlaf vorbereitete, drangen nur noch wie ein schwaches, fernes Echo in diese kleine, abgelegene Wohnung im jetzt verlassenen Tuilerienpalast. Es war zwei Tage nach den Unruhen von Fructidor. Paul Déroulède und Juliette Marny, beide zum Tode verurteilt, waren buchstäblich aus dem Wagen gezaubert worden, der sie vom Justizpalast in das Gefängnis von Luxembourg brachte, und das Komitee für öffentliche Sicherheit hatte soeben die Nachricht erhalten, dass in Lyon der Abbé du Mesnil zusammen mit dem Chevalier d‘Egremont, seiner Frau und seiner Familie auf wundersame und völlig unbegreifliche Weise aus dem Gefängnis im Norden entkommen war.
Doch damit nicht genug. Als Arras in die Hände der Revolutionsarmee fiel und ein regelrechter Kordon um die Stadt gezogen wurde, um keinen royalistischen Verräter entkommen zu lassen, gelang es etwa drei Dutzend Frauen und Kindern, zwölf Priestern, den alten Aristokraten Chermeuil, Delleville und Galipaux und vielen anderen, die Sperren zu durchbrechen - sie wurden nicht mehr gefasst.
Es wurden Razzien in den verdächtigen Häusern durchgeführt: in Paris vor allem dort, wo die entflohenen Gefangenen Unterschlupf gefunden haben könnten, oder noch besser, wo ihre Helfer und Retter sich noch versteckt halten könnten. Der Staatsanwalt Foucquier Tinville leitete diese Razzien, unterstützt von dem blutrünstigen Vampir Merlin. Sie erfuhren von einem Haus in der Rue de l‘Ancienne Comédie, in dem sich ein Engländer für zwei Tage aufgehalten haben sollte.
Sie baten um Einlass und wurden in die Zimmer geführt, in denen der Engländer gewohnt hatte. Diese waren kahl und schmutzig, wie hunderte andere Zimmer in den Armenvierteln von Paris. Die Vermieterin, zahnlos und schmutzig, hatte das Zimmer, in dem der Engländer geschlafen hatte, noch nicht aufgeräumt: Sie wusste nicht, dass er für immer fort war.
Er habe sein Zimmer für eine Woche im Voraus bezahlt und sei gekommen und gegangen, wie es ihm gefiel, erklärte sie Tinville. Sie habe sich nie um ihn gekümmert, weil er nie bei ihr gegessen habe und nur zwei Tage geblieben sei. Sie wusste nicht, dass ihr Untermieter Engländer war, bis er abreiste. Sie hielt ihn für einen Franzosen aus dem Süden, denn er sprach mit einem seltsamen Akzent.
„Es war der Tag der Unruhen“, fuhr sie fort, „er wollte ausgehen, und ich sagte ihm, dass ich nicht glaube, dass die Straßen für einen Ausländer wie ihn sicher sind, denn er trug immer so schöne Kleider, und ich war sicher, dass die hungernden Männer und Frauen von Paris sie ihm vom Leib reißen würden, wenn sie in Wut gerieten. Aber er lachte nur. Er gab mir einen Zettel und sagte, wenn er nicht zurückkäme, könnte ich daraus schließen, dass er getötet worden sei, und wenn das Komitee für öffentliche Sicherheit Fragen über mich stellen würde, bräuchte ich nur den Zettel zu zeigen, dann gäbe es keine Probleme mehr.“
Sie hatte lebhaft gesprochen, mehr als ein wenig erschrocken über Merlins finsteren Blick und die Haltung des Citoyens Tinville, der dafür bekannt war, sehr streng zu sein, wenn jemand einen Fehler machte.
Aber Citoyenne Brogard - ihr Name war Brogard und der Bruder ihres Mannes betrieb ein Gasthaus in der Nähe von Calais - die Citoyenne Brogard hatte ein reines Gewissen. Sie hatte eine Genehmigung des Komitees für öffentliche Sicherheit für die Vermietung von Wohnungen, und sie hatte das Komitee immer ordnungsgemäß über die Ankunft und Abreise ihrer Mieter informiert. Der einzige Unterschied bestand darin, dass sie, wenn ein Untermieter mehr als das übliche Entgelt für die Unterkunft zahlte und sie darum bat, die Benachrichtigung mit angemessener Verspätung verschickte und die Beschreibung, den Status und die Nationalität ihrer großzügigen Gönner angemessen vage formulierte.
So war es auch bei ihrem letzten Besucher aus England. Aber sie erklärte es weder dem Citoyen Foucquier Tinville noch dem Citoyen Merlin genau so. Sie war jedoch ziemlich erschrocken und legte den Zettel vor, den der Engländer bei ihr gelassen hatte, in der Hoffnung, dass es keine weiteren Schwierigkeiten geben würde, wenn sie ihn vorzeigen würde.
Tinville nahm ihn ihr grob aus der Hand, ohne ihn anzusehen. Er zerknüllte ihn zu einem Knäuel, und Merlin entriss ihn ihm mit einem derben Lachen, strich die Falten auf seinem Knie glatt und betrachtete ihn eine Weile.
Es waren zwei Zeilen, die wie Verse aussahen, geschrieben in einer Sprache, die Merlin nicht verstand. Englisch, ohne Zweifel. Deutlich und für jedermann verständlich war jedoch die kleine Zeichnung in der Ecke, die mit roter Tinte eine kleine sternförmige Blume darstellte.
Dann fluchten Tinville und Merlin laut und heftig, forderten ihre Männer auf, ihnen zu folgen, verließen das Haus in der Rue de l‘Ancienne Comédie und ließen die zahnlose Hausherrin, die immer noch lautstark ihren Patriotismus und ihren Wunsch, der Regierung der Republik zu dienen, beteuerte, auf ihrer eigenen Türschwelle zurück.
Tinville und Merlin aber brachten den Zettel dem Citoyen Robespierre, der grimmig lächelnd das beleidigende Schriftstück in seinen gewaschenen Händen zerdrückte.
Robespierre fluchte nicht. Er vergeudete weder Worte noch Flüche, sondern steckte das Stück Papier in den doppelten Deckel seiner silbernen Schnupftabakdose und schickte einen Sonderboten zu Citoyen Chauvelin in der Rue Corneille, der ihn aufforderte, sich noch am selben Abend nach zehn Uhr im Zimmer Nr. 16 des Ci-Devant-Palastes der Tuilerien einzufinden.
Um halb elf saßen sich Chauvelin und Robespierre im ehemaligen Boudoir der Königin Marie-Antoinette gegenüber, und zwischen ihnen lag auf dem Tisch, direkt unter dem Talglicht, ein stark zerknittertes und äußerst schmutziges Stück Papier. Es war durch mehrere unsaubere Hände gegangen, bevor die blütenweißen Finger des Citoyens Robespierre es geglättet und dem ehemaligen Botschafter Chauvelin vorgelegt hatten.
Doch dieser blickte nicht auf das Papier, nicht einmal in das bleiche, grausame Gesicht vor ihm. Er hatte die Augen geschlossen und für einen Augenblick das kleine dunkle Zimmer, den unbarmherzigen Blick Robespierres, die schlammverschmierten Wände und den schmierigen Boden aus den Augen verloren. Wie in einer hellen, plötzlichen Vision sah er die hell erleuchteten Salons des Londoner Außenministeriums, in denen die schöne Marguerite Blakeney wie eine Königin am Arm des Prinzen von Wales schwebte.
Er hörte das Schlagen der vielen Fächer, das Frou-Frou der Seidenkleider, und über all dem Lärm und den Klängen der Tanzmusik vernahm er ein albernes Lachen und eine affektierte Stimme, die den Reim wiederholte, der noch immer auf dem schmutzigen Zettel stand, den Robespierre ihm gegeben hatte:
„Man sucht ihn hier, man sucht ihn dort,
die Franzen suchen ihn allerort.
Ist er im Himmel? Ist er in Höll'?
Verflixter Scarlet Pimpernel!“
Es war nur ein Blitz! Eine der schnell verblassenden Launen der Erinnerung, wenn sie uns für den Bruchteil einer Sekunde unauslöschliche Bilder aus unserer Vergangenheit zeigt. In derselben Sekunde, in der Chauvelin seine Augen geschlossen hielt und Robespierre sie auf ihn richtete, sah er auch die einsamen Klippen von Calais, hörte dieselbe Stimme „God save the King“ singen, die Salven der Musketen, die verzweifelten Schreie von Marguerite Blakeney, und fühlte noch einmal den scharfen, bitteren Schmerz der totalen Erniedrigung und Niederlage.
3. Der ehemalige Botschafter Chauvelin
Robespierre hatte die ganze Zeit ruhig gewartet. Er hatte es nicht eilig: Als Nachtmensch mit ausgeprägtem Geschmack war er durchaus bereit, bis in die frühen Morgenstunden hier zu sitzen und dem Citoyen Chauvelin dabei zuzusehen, wie er in Gedanken die letzten Monate Revue passieren ließ.
Nichts gefiel dem meergrünen Unbestechlichen so sehr wie der Anblick eines Mannes, der mit einer ausweglosen Situation kämpfte und spürte, wie sich ein Netz von Intrigen immer enger um ihn zog.
Selbst jetzt, als er Chauvelins glatte Stirn in Falten legte und seine schmale Hand nervös auf den Tisch stützte, seufzte Robespierre zufrieden, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sagte mit einem freundlichen Lächeln:
„Du stimmst mir also zu, Citoyen, dass die Situation unhaltbar geworden ist?“
Als Chauvelin nicht antwortete, fuhr er mit schärferen Worten fort: „Und wie furchtbar ärgerlich ist das alles, wo wir den Mann doch längst unter der Guillotine hätten, wenn du dich nicht letztes Jahr so schrecklich geirrt hättest.“
Seine Stimme war hart und scharf geworden wie das Messer, auf das er immer wieder anspielte. Aber Chauvelin schwieg. Er hatte wirklich nichts zu sagen.
„Citoyen Chauvelin, wie musst du diesen Mann hassen“, rief Robespierre schließlich.
Erst jetzt brach Chauvelin das Schweigen, zu dem er sich bis dahin gezwungen zu haben schien.
„Das tue ich“, sagte er mit unüberhörbarer Inbrunst.
„Warum versuchst du dann nicht, die Fehler des letzten Jahres wiedergutzumachen?“, fragte Robespierre mit sanfter Stimme. „Die Republik hat dir, Citoyen Chauvelin, ungewöhnlich viel Geduld und Langmut entgegengebracht. Sie hat deine zahlreichen Verdienste und deinen bekannten Patriotismus berücksichtigt. Aber du weißt“, fügte er bedeutungsvoll hinzu, „dass sie keine Verwendung für wertlose Werkzeuge hat.“
Dann, als Chauvelin in mürrisches Schweigen verfallen zu sein schien, fuhr er mit seiner unangenehmen Fadheit fort:
„Ma foi! Citoyen Chauvelin, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich keine Stunde mehr verlieren, um meine eigene Demütigung zu rächen.“
„Habe ich je eine Chance gehabt?“, platzte Chauvelin mit kaum unterdrückter Heftigkeit heraus. „Was kann ich allein tun? Da der Krieg erklärt ist, kann ich nicht nach England gehen, es sei denn, die Regierung findet einen offiziellen Grund. Hier wird viel gejammert und geschimpft, und wenn diese verdammte Bande des Scarlet Pimpernel am Werk war, wenn eine ganze Reihe wertvoller Köpfe dem Fallbeil entrissen wurden, dann wird viel mit den Zähnen geknirscht und sinnlos geflucht, aber es wird nichts Ernsthaftes oder Entschiedenes unternommen, um diese verfluchten englischen Fliegen, die uns um die Ohren schwirren, zu ersticken.“
„Nein! Du vergisst, Citoyen Chauvelin“, erwiderte Robespierre, „dass wir vom Komitee für öffentliche Sicherheit viel hilfloser sind als du. Du kennst die Sprache dieser Leute, wir nicht. Du kennst die Sitten und Gebräuche, ihre Denkweise, die Methoden, die sie anwenden: wir wissen nichts davon. Du hast in England Männer gesehen und mit ihnen gesprochen, die Mitglieder dieser verdammten Liga sind. Du hast den Mann gesehen, der ihr Anführer ist. Wir nicht.“
Er beugte sich über den Tisch und betrachtete das dünne, bleiche Gesicht vor ihm genauer.
„Wenn du mir jetzt den Namen dieses Anführers nennen würdest, wenn du ihn beschreiben würdest, könnten wir leichter an die Arbeit gehen. Du kannst ihn nennen, und wir würden helfen, Citoyen Chauvelin.“
„Das kann ich nicht“, erwiderte Chauvelin hartnäckig.
„Ah! Aber ich glaube, du könntest es. Aber da! Ich nehme dir dein Schweigen nicht übel. Du würdest den Lohn deines eigenen Sieges ernten wollen, das Werkzeug deiner eigenen Rache sein. Leidenschaften! Ich halte das für natürlich! Aber um deiner eigenen Sicherheit willen, Citoyen, sei nicht zu gierig mit deinem Geheimnis. Wenn du den Mann kennst, finde ihn, finde ihn, locke ihn nach Frankreich! Wir wollen ihn, das Volk will ihn! Und wenn das Volk nicht bekommt, was es will, wird es sich gegen die wenden, die ihm die Beute vorenthalten haben.“
„Ich verstehe, Citoyen, dass Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Regierung bei diesem erneuten Versuch, den Scarlet Pimpernel zu fangen, eine Rolle spielt“, erwiderte Chauvelin trocken.
„Und dein Kopf, Citoyen Chauvelin“, schloss Robespierre.
„Nein! Das weiß ich sehr wohl, und Sie können mir glauben, und Sie werden mir glauben, Citoyen, wenn ich Ihnen sage, dass das mich wenig kümmert. Die Frage ist, wenn ich diesen Mann nach Frankreich locken soll, was werden Sie und Ihre Regierung tun, um mir zu helfen?“
„Alles“, antwortete Robespierre, „vorausgesetzt, du hast einen konkreten Plan und ein konkretes Ziel.“
„Ich habe beides. Aber ich muss nach England, wenigstens in halboffizieller Funktion. Ich kann nichts ausrichten, wenn ich mich getarnt in abgelegenen Winkeln verstecken muss.“
„Das ist leicht möglich. Es gab einige Diskussionen mit den britischen Behörden über die Sicherheit und das Wohlergehen der friedlichen französischen Untertanen in England. Nach einem umfangreichen Schriftwechsel haben sie uns vorgeschlagen, einen halboffiziellen Vertreter dorthin zu entsenden, der sich um die geschäftlichen und finanziellen Interessen unserer Leute dort kümmern soll. Wir können dich ohne weiteres in dieser Eigenschaft dorthin schicken, wenn es recht ist.“
„Großartig. Ich brauche nur eine Tarnung. Diese ist so gut wie jede andere.“
„Ist das alles?“
„Nicht ganz. Ich habe mehrere Pläne im Kopf, und ich muss wissen, dass man mir voll vertraut. Vor allem muss ich Macht haben – entschiedene, absolute, unermessliche Macht.“
Dieser kleine, zobelbekleidete Mann hatte nichts von einem Schwächling an sich, er sah dem gefürchteten Jakobinerführer direkt ins Gesicht und schlug mit einer festen Faust entschlossen auf den Tisch vor ihm. Robespierre hielt eine Weile inne, bevor er antwortete; er musterte den anderen Mann scharf und versuchte zu erkennen, ob sich hinter der ernsten, gerunzelten Stirn nicht ein selbstsüchtiger Hintergedanke verbarg, der mit der Forderung nach absoluter Macht einherging.
Aber Chauvelin zuckte nicht zusammen unter diesem Blick, der jede Wange in Frankreich vor namenlosem Schrecken erbleichen lassen konnte, und nach diesem kurzen Moment des Zögerns sagte Robespierre ruhig:
„Du erhältst die vollständige Macht eines Militärdiktators in jeder Stadt oder Gemeinde Frankreichs, die du besuchen wirst. Die Revolutionsregierung wird dich vor deiner Abreise nach England zum Chef aller Unterausschüsse für die öffentliche Sicherheit ernennen. Das bedeutet, dass im Namen der Sicherheit der Republik jeder von dir erteilte Befehl, welcher Art er auch immer sein mag, bedingungslos befolgt werden muss, unter Androhung einer Anklage wegen Hochverrats.“
Chauvelin stieß einen kurzen, scharfen Seufzer tiefer Zufriedenheit aus, den er vor Robespierre nicht einmal zu verbergen versuchte.
„Ich werde Agenten brauchen“, sagte er, „oder sollten wir sagen Spione? Und natürlich Geld.“
„Du sollst beides haben. Wir haben in England einen sehr effizienten Geheimdienst, der dort sehr viel Gutes tut. Es gibt viel Unzufriedenheit in ihren Midland Counties – erinnerst du dich an die Unruhen in Birmingham? Sie waren vor allem das Werk unserer eigenen Spione. Dann kennst du Candeille, die Schauspielerin? Sie hatte sich in London in einigen Kreisen mit so genannten liberalen Tendenzen etabliert. Ich glaube, man nennt sie Whigs. Ein komischer Name, nicht wahr? Er bedeutet ‚perruque‘, glaube ich. Candeille hat in einem oder zwei dieser Whig-Clubs Wohltätigkeitsvorstellungen zu Gunsten unserer Pariser Armen gegeben, und nebenbei war sie uns sehr nützlich.“
„Eine Frau ist in solchen Fällen immer nützlich. Ich werde die Citoyenne Candeille aufsuchen.“
„Und wenn sie dir nützliche Dienste leistet, kann ich ihr einen verlockenden Preis anbieten. Frauen sind ja so eitel!“, fügte er hinzu und betrachtete mit großer Aufmerksamkeit die Oberfläche seiner Fingernägel. „Es gibt eine freie Stelle im Maison Moliere. Oder – was noch attraktiver sein könnte – im Zusammenhang mit dem geplanten Nationalfest und der neuen Volksreligion haben wir noch keine Göttin der Vernunft gewählt. Das sollte jeden weiblichen Geist ansprechen. Die Verkörperung einer Göttin, mit Prozessionen, Festumzügen und dem Rest... Große Bedeutung und Prominenz für eine Persönlichkeit... Was sagst du, Citoyen? Wenn du wirklich eine Frau für die Förderung deiner Pläne brauchst, hast du das zur Verfügung, wenn das ihren Eifer steigern kann.“
„Ich danke Ihnen, Citoyen“, erwiderte Chauvelin ruhig. „Ich hatte immer die Hoffnung, dass die Revolutionsregierung eines Tages meine Dienste wieder in Anspruch nehmen würde. Ich gebe zu, dass ich letztes Jahr versagt habe. Der Engländer ist einfallsreich. Er hat Verstand und er ist sehr reich. Ich glaube, ohne sein Geld hätte er keinen Erfolg gehabt, und Korruption und Bestechung sind in Paris und an unseren Küsten weit verbreitet. Er ist mir in dem Augenblick durch die Lappen gegangen, als ich dachte, ich hätte ihn am sichersten. Ich gebe das alles zu, aber ich bin bereit, mein Versagen vom letzten Jahr wiedergutzumachen, und... es gibt nichts mehr zu besprechen – ich bin bereit, aufzubrechen.“
Er sah sich nach seinem Mantel und seinem Hut um und richtete in aller Ruhe das Band seiner Krawatte neu. Doch Robespierre hielt ihn noch eine Weile auf: Der geborene Scharlatan, der geborene Schinder der Menschen, hatte sich noch nicht genug an den Seelenqualen dieses Mitmenschen ergötzt.
Chauvelin genoss stets Vertrauen und Respekt. Seine Dienste im Zusammenhang mit den auswärtigen Angelegenheiten der Revolutionsregierung waren von unschätzbarem Wert, sowohl vor als auch seit Beginn des europäischen Krieges. Einst gehörte er zu jenem gnadenlosen Dekemvirat, das – mit Robespierre an der Spitze – Frankreich mit Gesetzen des Blutvergießens und einer beispiellosen Grausamkeit regieren wollte.
Aber der meergrüne Unbestechliche war seiner überdrüssig geworden und hatte sich bemüht, ihn auf die Seite zu schieben, denn Chauvelin war scharfsinnig und klug, und außerdem besaß er all jene Qualitäten des selbstlosen Patriotismus, die Robespierre so auffallend fehlten.
Sein Scheitern bei der Verurteilung Scarlet Pimpernels und dessen leerer Platz unter der Guillotine hatten Chauvelins Untergang besiegelt. Obwohl er nicht anderweitig belästigt worden war, hatte man ihn während des letzten Jahres in der Dunkelheit schmoren lassen. Schon bald würde er völlig vergessen sein.
Nun sollte er nicht nur eine weitere Chance erhalten, die Gunst des Volkes wiederzuerlangen, sondern er hatte auch Vollmachten gefordert, die ihm Robespierre selbst in Anbetracht des angestrebten Ziels nicht verweigern konnte. Aber der Unbestechliche, stets neidisch und eifersüchtig, wollte ihm nicht erlauben, sich zu früh zu freuen.
Mit der für ihn charakteristischen Ruhe schien er sich auf alle Pläne Chauvelins einzulassen, ihm in jeder Hinsicht zu helfen, denn er hatte etwas im Hinterkopf, das er dem ehemaligen Botschafter sagen wollte, bevor dieser sich verabschiedete: etwas, das ihm zeigen würde, dass er nur noch einmal auf dem Prüfstand stand, und das ihm mit aller Deutlichkeit zeigen würde, dass über ihm die allmächtige Hand eines Meisters schwebte.
„Du brauchst nur die Summe zu nennen, die du wünscht, Citoyen Chauvelin“, sagte der Unbestechliche mit einem ermutigenden Lächeln, „die Regierung wird sich nicht zurückhalten, und du sollst weder an mangelnder Autorität noch an fehlenden Mitteln scheitern.“
„Es ist schön zu hören, dass die Regierung über so viel Reichtum verfügt“, bemerkte Chauvelin mit trockenem Sarkasmus.
„Oh, die letzten Wochen waren sehr einträglich“, antwortete Robespierre, „wir haben bei emigrierten Royalisten Geld und Juwelen im Wert von mehreren Millionen Francs beschlagnahmt. Erinnerst du dich an die Verräterin Juliette Marny, die kürzlich nach England geflohen ist? Nun, die Juwelen ihrer Mutter und eine Menge Gold wurden von einem unserer fähigsten Spione in der Obhut eines gewissen Abbé Foucquet entdeckt, einem Calotin aus Boulogne, der, wie es scheint, der Familie treu ergeben ist.“
„Ja?“, fragte Chauvelin gleichgültig.
„Unsere Leute haben die Juwelen und das Gold beschlagnahmt, das ist alles. Was wir mit dem Priester machen, wissen wir noch nicht. Die Fischer von Boulogne mögen ihn, und wir können jederzeit Hand an ihn legen, wenn wir seinen alten Kopf für die Guillotine wollen. Aber der Schmuck war es wert. Es gibt ein historisches Collier, das mindestens eine halbe Million wert ist.“
„Kann ich es haben?“, fragte Chauvelin.
Robespierre lachte und zuckte mit den Achseln.
„Sie sagten, es gehöre der Familie Marny“, fuhr der Ex-Botschafter fort. „Juliette Marny ist in England. Vielleicht treffe ich sie dort. Ich kann nicht sagen, was passieren wird, aber ich habe das Gefühl, dass die historische Halskette nützlich sein könnte. Wie Sie wollen“, fügte er mit erneuter Gleichgültigkeit hinzu. „Es war nur ein Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als Sie sprachen, sonst nichts.“
„Und um dir zu zeigen, wie sehr die Regierung dir vertraut, Citoyen Chauvelin“, erwiderte Robespierre mit perfekter Urbanität, „werde ich persönlich anordnen, dass das Collier de Marny uneingeschränkt zur Verfügung gestellt wird; und eine Summe von fünfzigtausend Francs für Ausgaben in England. Du siehst“, fügte er freundlich hinzu, „wir werden dir keine Entschuldigung für einen zweiten Fehlschlag geben.“
„Ich brauche keine“, erwiderte Chauvelin trocken und erhob sich schließlich mit einem Seufzer der Genugtuung, dass dieses Gespräch endlich beendet war.
Aber auch Robespierre war aufgestanden und hatte seinen Stuhl zur Seite gerückt, um ein, zwei Schritte auf Chauvelin zuzugehen. Er war ein viel größerer Mann als der ehemalige Botschafter. Er war mager und hager, hatte eine sehr aufrechte Haltung, und im unsicheren Licht der Kerze schien er den anderen Mann auf seltsame und unheimliche Weise zu überragen: die blasse Farbe seines Mantels, sein helles Haar, das Weiß seiner Wäsche, alles trug dazu bei, seiner Erscheinung in diesem Augenblick eine seltsam gespenstische Wirkung zu verleihen.
Chauvelin spürte, wie ihm ein unangenehmer Schauer über den Rücken lief, als Robespierre, der in seiner Erscheinung vollkommen weltmännisch und sanft war, ihm eine lange, knochige Hand auf die Schulter legte.
„Citoyen Chauvelin“, sagte der Unbestechliche mit einer gewissen würdevollen Feierlichkeit, „wir scheinen uns heute Abend sehr schnell verstanden zu haben. Das Gewissen hat dir zweifellos eine Ahnung von dem Inhalt meiner Vorladung gegeben. Du sagst, du hättest immer gehofft, dass die Revolutionsregierung dir eine Chance geben würde, den Misserfolg vom letzten Jahr wiedergutzumachen. Ich für meinen Teil hatte immer die Absicht, solche Chancen zu gönnen, denn ich habe vielleicht etwas tiefer in dein Herz geschaut als meine Kollegen. Ich sah nicht nur Begeisterung für die Sache des französischen Volkes, nicht nur Abscheu vor dem Feind Ihres Landes, ich sah einen rein persönlichen und tödlichen Hass auf einen einzigen Mann, den unbekannten und geheimnisvollen Engländer, der sich letztes Jahr als zu schlau für… erwiesen hat. Und weil ich glaube, dass dieser Hass sich als schärfer und weitsichtiger erweisen wird als selbstloser Patriotismus, habe ich das Komitee für öffentliche Sicherheit gedrängt, dir zu erlauben, deine eigene Rache zu nehmen und damit unserem Land wirksamer zu dienen als jeder andere - vielleicht reinere - Patriot. Du gehst nach England, üppig ausgestattet mit allem, was für den Erfolg jeglicher Pläne, für die Verwirklichung deiner persönlichen Rache notwendig ist. Die Revolutionsregierung hilft mit Geld, Pässen, freiem Geleit; sie stellt ihre Spione und Agenten zur Verfügung. Sie gibt dir praktisch unbegrenzte Macht, wohin du auch gehst. Sie fragt weder nach den Motiven noch nach den Mitteln, solange diese zum Erfolg führen. Aber persönliche Rache oder Patriotismus, was auch immer dich antreibt, wir hier in Frankreich verlangen, dass du uns den Mann auslieferst, der in zwei Ländern als der Scarlet Pimpernel bekannt ist! Wir wollen ihn lebendig, wenn möglich, oder tot, wenn es sein muss, und wir wollen so viele seiner Anhänger, wie ihm auf die Guillotine folgen können. Bringe sie nach Frankreich, dann wissen wir, was wir mit ihnen zu tun haben, und ganz Europa soll verdammt sein.“
Er hielt einen Moment inne, seine Hand noch immer auf Chauvelins Schulter, seine blassgrünen Augen wie in Trance auf die des anderen gerichtet. Aber Chauvelin rührte sich nicht, sprach nicht. Sein Triumph hatte ihn ganz still werden lassen, sein fruchtbarer Geist war bereits mit seinen Plänen beschäftigt. In seinem Herzen war kein Platz für Furcht, und er wartete ohne das geringste Zittern auf das Ende von Robespierres Rede.
„Vielleicht, Citoyen Chauvelin“, sagte dieser schließlich, „hast du schon erraten, was ich noch zu sagen habe. Aber damit du auch nicht kleinsten schwachen Schimmer des Zweifels oder der Hoffnung in dir trägst, lass mich Folgendes sagen. Die Revolutionsregierung gibt dir diese Chance, dein Versagen wiedergutzumachen, aber nur diese eine; wenn du wieder versagst, wird dein geschändetes Land weder Vergebung noch Gnade kennen. Ob du nach Frankreich zurückkehrst oder in England bleibst, ob nach Norden, Süden, Osten oder Westen, ob du die Ozeane überquerst oder die Alpen, die Hand eines rachsüchtigen Volkes wird dich finden. Dein zweites Versagen wird mit dem Tode bestraft, wo immer du dich befindest, sei es durch die Guillotine, wenn du in Frankreich bist, sei es durch die Hand eines Mörders, wenn du anderswo Zuflucht suchst.
„Merke es dir, Citoyen Chauvelin, denn diesmal gibt es kein Entkommen, auch wenn der mächtigste Tyrann der Welt versucht, dich zu schützen, auch wenn es dir gelingt, ein Reich zu errichten und dich auf den Thron zu setzen.“
Seine dünne, schrille Stimme hallte unheimlich in dem kleinen, engen Boudoir wider. Chauvelin antwortete nicht. Es gab nichts, was er hätte sagen können. Alles, was Robespierre ihm so eindringlich vor Augen geführt hatte, war ihm völlig klar, selbst während er seine kühnsten Pläne schmiedete.
Diesmal war es ein ‚Entweder-Oder‘, vor das er gestellt wurde. Er dachte wieder an Marguerite Blakeney und an die schreckliche Alternative, die er ihr vor weniger als einem Jahr gestellt hatte.
Nun, er war bereit, das Risiko einzugehen. Er würde nicht wieder scheitern. Diesmal würde er unter besseren Bedingungen nach England gehen. Er wusste, wer der Mann war, den er nach Frankreich und in den Tod locken musste.
Und er erwiderte Robespierres drohenden Blick kühn und unbeirrt, dann machte er sich zum Aufbruch bereit. Er nahm Hut und Mantel, öffnete die Tür, spähte einen Augenblick in den dunklen Korridor, in dem in der Ferne die Schritte eines einsamen Wächters zu hören waren, setzte seinen Hut auf, drehte sich noch einmal um und blickte in das Zimmer, in dem Robespierre ihn ruhig beobachtete, und ging seines Weges.
4. Das Fest in Richmond
Es war vielleicht der strahlendste September, den man je in England erlebt hatte – jenem Land, wo die letzten Tage des sterbenden Sommers fast immer golden und wunderschön sind.
Seltsam nur, dass es in diesem Land, in dem eben dieser Abschnitt des Jahres eine so eigentümliche, ganz eigene Leuchtkraft besitzt, keinen sprachlich genauen Ausdruck dafür gibt. So muss man wohl oder übel von der fin d’été sprechen – dem Ende des Sommers; nicht dem endgültigen Abschied, nicht dem letzten Verschwinden, sondern dem sanften Verweilen eines Freundes, der bald gehen muss, aber sich sehnt, hier und da noch einen Tag, vielleicht gar eine Woche zu stehlen, um bei uns zu bleiben. Der seinen letzten, rührenden Abschied noch ein wenig hinauszögern möchte – und dabei all das in leuchtender Pracht zur Schau stellt, was er an Üppigkeit, Schönheit und kostbarer Sehnsucht zu bieten hat.
Und in diesem Jahr des Herrn 1793 hatte der scheidende Sommer alle Schätze seiner Farbpalette über Wälder und Flussufer ausgegossen; das einst grelle Grün von Lärche und Ulme mit einem sanften Goldton überhaucht, die Eichen in warmes Rotbraun getaucht und die Buchen mit Flecken von Siena und Karmin geschmückt.
In den Gärten blühten noch Rosen – nicht mehr die zarten Blassrosa- oder Zitronenrosen des Juni, auch nicht die bleichen Banksias oder Rankrosen, sondern die vollblütigen, tiefroten Spätrosen des ausgehenden Sommers, Apricotfarbene mit krausen, vom ersten Frosthauch leicht berührten Außenblättern. An geschützten Stellen verweilte noch die violette Clematis, während die Dahlien mit ihrer grellen, überbordenden Pracht förmlich protzten – ihre kräftigen Farben prallten regelrecht gegen das sanfte Grün der Laubbäume oder gegen das dumpfe, moosige Grau alter Mauerranken.
Das Fest wurde stets gegen Ende September gefeiert. Am Flussufer war das Wetter dann meist zuverlässig, es gab immer genug Sonnenschein, um Madam’s neuestes Musselinkleid oder den hellfarbenen, gesteppten Unterrock auszuführen. Der Boden war trocken und fest – gut sowohl zum Spazierengehen als auch zum Aufstellen von Zelten und Buden. Und davon gab es in diesem Jahr eine geradezu prachtvolle Vielfalt: Gauklersleute und Jongleure aus allen Ecken der Welt, so schien es – denn da war ein Mann, dessen Gesicht so schwarz war wie der Dreispitz eines Lords, und ein anderer mit so flachen, gelben Wangen, dass man unweigerlich an Pfannkuchen, Aconitum und Eier denken musste – oder überhaupt an alles Gelbe auf der Welt.
Da gab es ein Zelt, in dem Hunde – große, kleine, schwarze, weiße oder sandfarbene – Dinge vollführten, die kein Christ mit Respekt vor seinem Rückgrat je gewagt hätte, und ein anderes, in dem ein schrulliger alter Mann mit merkwürdigem Gesicht Bohnenstangen, Spazierstöcke, Reichsmünzen und Spitzentaschentücher vor den Augen des Publikums in Luft auflösen ließ.
Und da es schön warm war, konnte man sich draußen auf die Wiese setzen, der Musik der Kapelle lauschen, die süße Weisen spielte, und dabei den jungen Leuten zusehen, wie sie auf dem Rasen tanzten.
Die feine Gesellschaft war noch nicht eingetroffen – das einfache Volk hatte früh gespeist, um möglichst lange etwas vom Fest zu haben, möglichst den ganzen Nachmittag Freude für das Sechspence-Eintrittsgeld, das am Tor verlangt wurde.
Es gab so vieles zu sehen und zu tun: Kegelspiele auf dem Grün, eine wunderschöne Aunt Sally, eine Kegelbahn, zwei Karussells, tanzende Bären und dressierte Affen, eine Frau, so dick, dass drei Männer mit ausgestreckten Armen sie nicht umfassen konnten, und einen Mann so dürr, dass er sich ein Damenarmband um den Hals und ein Strumpfband um die Taille legen konnte.
Die mechanischen Spielzeuge waren ebenfalls ein großer Anziehungspunkt. Man warf ein Penny-Stück in einen kleinen Schlitz, und eine Puppe begann zu tanzen und auf der Geige zu spielen. Und dann war da noch die Zaubermühle, wo für einen weiteren Kupferpenny eine Reihe winziger Figuren – runzlig, alt, in Lumpen gekleidet – müde eine Treppe zur Mühle hinaufstieg, nur um im nächsten Moment an einer Tür dieses wundersamen Bauwerks wieder herauszukommen: jung, fröhlich, prächtig gewandet und in ausgelassener Tanzschrittfolge die Stufen hinuntertrippelnd, ehe sie endgültig aus dem Blickfeld verschwanden.
Doch das Wunderlichste von allem – und das, was die größte Menge Schaulustiger anzog und die meisten Münzen einbrachte – war eine Miniaturdarstellung dessen, was gerade in Frankreich geschah.
Und man konnte gar nicht umhin, an die Echtheit des Ganzen zu glauben, so geschickt war es gemacht. Im Hintergrund waren Häuser zu sehen und ein Himmel, der äußerst rot wirkte. „Zu rot!“, sagten manche, wurden aber sogleich von den Weisen zurechtgewiesen: Der Himmel stelle natürlich einen Sonnenuntergang dar, das könne ja jeder erkennen, der hinschaue.
Dann gab es da eine ganze Reihe kleiner Figuren, kaum größer als eine Hand, mit hölzernen Gesichtern, Armen und Beinen – wunderschön gefertigte Puppen, gekleidet in Kittel und Kniehosen, meist in Lumpen, mit kleinen Mäntelchen und Holzschuhen. Sie waren in Gruppen zusammengepfercht, mit ausgestreckten Armen, alle nach oben gerichtet.
In der Mitte dieser kleinen Bühne stand auf einem erhöhten Podest eine Miniaturkonstruktion aus dicht nebeneinanderstehenden Holzpfosten, mit einer flachen roten Planke zu ihren Füßen, im rechten Winkel angebracht. Am hinteren Ende der Planke stand ein kleiner Korb, und zwischen den Pfosten oben befand sich ein kleines Messer, das in einer Rille auf- und ablief und über eine winzige Seilrolle bewegt wurde. Die Kundigen erklärten, dies sei ein Modell einer Guillotine.
Und siehe da – sobald man ein Penny-Stück in den Schlitz unterhalb der Bühne warf, begannen die kleinen Figuren mit den Armen zu fuchteln, eine andere Puppe stieg auf das Podest hinauf, legte sich auf das rote Brett zu Füßen der Pfosten. Dann streckte eine Figur, in leuchtendes Scharlach gekleidet, den Arm aus – mutmaßlich, um die Rolle zu betätigen – und das kleine Messer sauste klirrend auf den Hals der daliegenden Puppe nieder, deren Kopf dann in den Korb rollte. Daraufhin ertönte ein lautes Surren und Brummen der Mechanik, und alle Puppen erstarrten mit erhobenen Armen, während der geköpfte Körper langsam von der Bühne rutschte und aus dem Blickfeld verschwand – zweifellos, um dieselbe grausige Pantomime von Neuem zu beginnen.
Es war äußerst aufregend – und schrecklich zugleich. Eine gewisse feierliche Beklommenheit lag über der Bude, in der dieses mechanische Wunderwerk vorgeführt wurde.