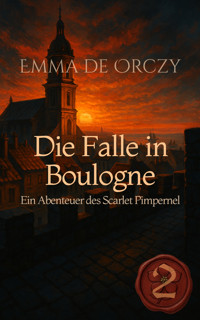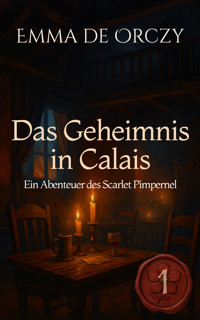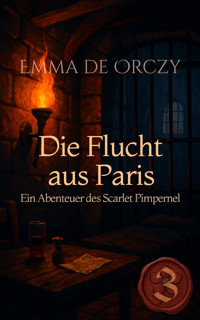
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KI Classics
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Flucht aus Paris – Ein Abenteuer des Scarlet Pimpernel Frankreich, Frühjahr 1794. Der Schrecken der Revolution hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Im Zentrum der Gewalt: ein Gefangener, der mehr bedeutet als jeder andere. Der ci-devant Dauphin – der entmachtete Thronfolger Frankreichs, ein Kind, das gequält und gebrochen werden soll, um das alte Regime endgültig zu vernichten. Bewacht im bestgesicherten Gefängnis der Republik, scheint seine Rettung unmöglich. Scarlet Pimpernel, Englands unerreichter Held, nimmt die Herausforderung an – wohl wissend, dass er nicht allein siegen kann. Mehr denn je ist er auf die Hilfe seiner engsten Vertrauten angewiesen. Doch wo Vertrauen gefordert ist, lauert Verrat. Ein einziger Fehltritt genügt – und die Falle schnappt zu. Denn Chauvelin, sein alter Feind, hat aus seinen Niederlagen gelernt. Er kennt Percys Stolz, seine Prinzipien – und weiß, dass Percy niemals seine Ehre aufgeben würde. Und so spinnt er sein Netz langsam, genussvoll. Er will keinen schnellen Sieg. Er will sehen, wie sein Widersacher zerbricht. Marguerite Blakeney, voller Angst und Liebe, erkennt, was ihrem Mann droht. Doch sie kann nichts tun – nichts, außer ihm zu folgen, bis an den Rand des Todes. Diesmal gibt es keinen Plan, kein rettendes Zeichen, keine letzte List. Der Mythos des Scarlet Pimpernel scheint zu zerbrechen unter dem Gewicht einer Aufgabe, die selbst für ihn zu groß ist. Oder findet er doch noch einen Weg – nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Frau, das des kindlichen Dauphins und sogar die Seele dessen zu retten, der ihn verraten hat? Die Flucht aus Paris ist das düsterste und dramatischste Abenteuer des Scarlet Pimpernel – ein Spiel um Ehre, Liebe und Opfermut in einer Welt, die keine Gnade kennt. Neue Übersetzung dieses Klassikers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Emma De Orczy
Die Flucht aus Paris
Ein Abenteuer des Scarlet Pimpernel
Inhaltsverzeichnis
TEIL I
TEIL II
TEIL III
Impressum
TEIL I
1. Im Théâtre National
Und doch fanden die Menschen Gelegenheit, sich zu vergnügen, zu tanzen und ins Theater zu gehen, Musik zu genießen, die Straßencafés und die Promenaden im Palais Royal zu besuchen.
Neue Moden traten in Erscheinung, Modistinnen präsentierten frische „Kreationen“, und die Juweliere waren nicht untätig. Ein grimmiger Humor, geboren aus der Allgegenwart der Gefahr, hatte den Schnitt gewisser Jacken mit dem Namen „tête tranchée“ bedacht, ein beliebtes Ragout hieß „à la guillotine“.
Nur an drei Abenden während der denkwürdigen letzten viereinhalb Jahre blieben die Theater geschlossen – an den Abenden unmittelbar nach jenem entsetzlichen 2. September, dem Tag des Blutbades vor dem Gefängnis der Abbaye, als Paris selbst vor Entsetzen erstarrte und die Schreie der Ermordeten lauter waren als der Beifall der Zuschauer, deren zum Applaus erhobene Hände noch vom Blut trieften.
An allen anderen Abenden jener viereinhalb Jahre hoben sich die Vorhänge in den Theatern der Rue de Richelieu, im Palais Royal, im Luxembourg und anderswo, und man kassierte Eintritt an den Türen. Dasselbe Publikum, das sich tagsüber mit den immer gleichen Schauspielen auf der Place de la Révolution die Zeit vertrieben hatte, versammelte sich abends in den Theatersälen, füllte Parkett, Logen und Ränge, lachte über Voltaires Satiren oder weinte über die sentimentalen Tragödien verfolgter Romeos und unschuldiger Julias.
Der Tod klopfte in diesen Tagen an viele Türen! Er war ein so beständiger Gast in den Häusern von Verwandten und Freunden, dass diejenigen, denen er nur die Hand gereicht, denen er zugelächelt und die er, immer noch lächelnd, verschont hatte, ihn mit jener subtilen Verachtung betrachteten, die aus Vertrautheit geboren wird. Sie zuckten mit den Schultern bei seinem Anblick und sahen seiner möglichen Rückkehr am nächsten Tag mit leichter Gleichgültigkeit entgegen.
Paris – trotz der Schrecken, die ihre Mauern befleckt hatten – war eine Stadt des Vergnügens geblieben, und das Fallbeil der Guillotine sauste kaum öfter nieder als der Theatervorhang.
An diesem bitterkalten Abend des 27. Nivôse im zweiten Jahr der Republik – oder, wie wir Altmodischen es noch immer nennen, dem 16. Januar 1794 – war der Zuschauerraum des Théâtre National mit einem äußerst glänzenden Publikum gefüllt.
Der Auftritt einer beliebten Schauspielerin in der Rolle einer der launischen Heldinnen Molières hatte das vergnügungssüchtige Paris in Scharen angelockt, um diese Neuinszenierung des Misanthrope mit neuen Kulissen, Kostümen und besagter reizender Darstellerin zu erleben – all dies verlieh dem bissigen Witz des Meisters neue Würze.
Das Moniteur, jenes unparteiische Blatt, das die Ereignisse dieser Tage so gewissenhaft verzeichnet, meldete an diesem Datum, dass der Konvent ein neues Gesetz beschlossen hatte, das den Spionen größere Vollmachten einräumte: Sie durften fortan nach eigenem Ermessen Hausdurchsuchungen vornehmen, ohne vorher die Genehmigung des Comité de Sûreté Générale einholen zu müssen. Sie waren befugt, gegen jeden sogenannten Feind des öffentlichen Glücks vorzugehen, ihn inhaftieren zu lassen – ganz nach eigenem Gutdünken –, und sie erhielten für jedes „Wild“, das sie so für die Guillotine aufscheuchten, fünfunddreißig Livres.
An ebendiesem Tag verzeichnete das Moniteur auch, dass das Théâtre National bis auf den letzten Platz besetzt war bei der Aufführung der Komödie des verstorbenen Citoyen Molière.
Nachdem die Nationalversammlung jenes Gesetz verabschiedet hatte, das das Leben Tausender in die Hände weniger menschlicher Bluthunde legte, vertagte sie ihre Sitzung – und begab sich in die Rue de Richelieu.
Das Haus war bereits voll, als die Väter des Volkes ihre für sie reservierten Plätze einnahmen. Eine ehrfürchtige Stille legte sich über die Menge, als einer nach dem anderen die Männer eintrafen, deren Namen allein Schrecken und Grauen verbreiteten, und die nun durch die engen Gänge des Parketts schritten oder in ihren winzigen Logen Platz nahmen.
Der akkurat frisierte Kopf von Citoyen Robespierre erschien bald in einer dieser Logen; sein Busenfreund St. Just war bei ihm, ebenso seine Schwester Charlotte. Danton, einem zottigen Löwen gleich, drängte sich ins Parkett, während Santerre, der schöne Metzger und Liebling des Pariser Volkes, mit lautem Jubel begrüßt wurde, als sein riesiger, in die Uniform der Nationalgarde gehüllter Leib in einem der oberen Ränge gesichtet wurde.
Im Parterre und auf den Galerien flüsterten die Zuschauer aufgeregt. Die furchteinflößenden Namen flogen von Mund zu Mund durch die stickige Luft. Frauen reckten die Hälse, um die Gesichter jener zu erspähen, deren Köpfe vielleicht schon am nächsten Tag in den grausigen Korb unter der Guillotine rollen würden.
In einer der kleinen Avant-Szene-Logen hatten zwei Männer bereits Platz genommen, lange bevor das Gros des Publikums im Saal erschien. Das Innere der Loge lag völlig im Dunkeln, und die schmale Öffnung, die nur eine mäßige Sicht auf einen Teil der Bühne erlaubte, trug eher dazu bei, die Insassen zu verbergen als sie zu zeigen.
Der Jüngere der beiden schien Paris nicht gut zu kennen, denn als bekannte Persönlichkeiten und Mitglieder der Regierung eintrafen, wandte er sich häufig an seinen Begleiter, um sich über diese berüchtigten Gestalten zu erkundigen.
„Sagen Sie mir, de Batz,“ sagte er und wies auf eine Gruppe neu eingetroffener Männer, „dieses Wesen dort im grünen Rock – der sich jetzt die Hand vors Gesicht hält – wer ist das?“
„Wo? Wen meinen Sie?“
„Dort! Jetzt blickt er in unsere Richtung und hat ein Theaterprogramm in der Hand. Der Mann mit dem vorspringenden Kinn und der gewölbten Stirn – ein Gesicht wie ein Marmosett, Augen wie ein Schakal. Na?“
Der andere beugte sich über den Rand der Loge, und seine kleinen, ruhelosen Augen glitten über den nun dicht gefüllten Zuschauerraum.
„Ah!“ sagte er, als er das Gesicht erkannte, auf das sein Freund gezeigt hatte, „das ist Citoyen Fouquier-Tinville.“
„Der öffentliche Ankläger?“
„Er selbst. Und Heron ist der Mann neben ihm.“
„Heron?“ fragte der Jüngere neugierig.
„Ja. Er ist jetzt Hauptagent des Comité de Sûreté Générale.“
„Was bedeutet das?“
Beide lehnten sich wieder in ihre Stühle zurück, ihre dunkel gekleideten Gestalten verschmolzen erneut mit dem Schatten der engen Loge. Instinktiv, seit der Name des öffentlichen Anklägers gefallen war, hatten sie ihre Stimmen zu einem Flüstern gesenkt.
Der ältere Mann – ein untersetzter, rotgesichtiger Typ mit kleinen, scharfen Augen und den Spuren der Blattern im Gesicht – zuckte auf die Frage seines Freundes gleichgültig mit den Schultern und sagte dann mit einem Ausdruck verächtlicher Indifferenz:
„Es bedeutet, mein lieber St. Just, dass diese beiden Männer da unten, die sich gerade genüsslich das Programm des heutigen Abends zu Gemüte führen und sich auf einen vergnüglichen Abend in Gesellschaft des verstorbenen Monsieur de Molière vorbereiten, zwei Höllenhunde sind – ebenso mächtig wie gerissen.“
„Ja, ja,“ sagte St. Just, und gegen seinen Willen lief ein leichter Schauder durch seine schlanke Gestalt. „Fouquier-Tinville kenne ich – ich kenne seine Gerissenheit und seine Macht – aber der andere?“
„Der andere?“ erwiderte de Batz gelassen. „Heron? Erlauben Sie mir, mein Freund, Ihnen zu sagen, dass selbst die Macht und der Blutdurst jenes verdammten öffentlichen Anklägers gegen den Einfluss Herons verblassen.“
„Aber wie meinen Sie das? Ich verstehe nicht.“
„Ah! Sie haben zu lange in England gelebt, glücklicher Esel – und obwohl Ihnen gewiss der grobe Handlungsverlauf unserer grauenhaften Tragödie bekannt ist, kennen Sie doch nicht die Darsteller, die auf dieser mit Blut getränkten Arena die Hauptrollen spielen. Sie kommen und gehen, diese Schauspieler, mein guter St. Just – sie kommen und gehen. Marat ist bereits der Mann von gestern, Robespierre der von morgen. Heute haben wir noch Danton und Fouquier-Tinville; wir haben Père Duchesne und Ihren Vetter Antoine St. Just, doch Heron und seinesgleichen – die bleiben uns immer erhalten.“
„Spione, selbstverständlich?“
„Spione“, bestätigte der andere ruhig. „Und was für welche! Waren Sie heute bei der Sitzung der Versammlung?“
„Ich war dort. Ich habe das neue Dekret gehört, das ja bereits Gesetz geworden ist.“
„Ach, ich versichere Ihnen, mein Freund, wir lassen in diesen Tagen das Gras nicht unter unseren Füßen wachsen. Robespierre wacht morgens mit einer Laune auf – und am Nachmittag ist diese Laune Gesetz, verabschiedet von einem gefügigen Haufen Männer, die zu verängstigt sind, um seinem Willen zu widersprechen, aus Angst, man könnte sie der Mäßigung oder – schlimmer noch – der Menschlichkeit bezichtigen: den größten Verbrechen, die man heutzutage begehen kann.“
„Aber Danton?“, warf St. Just ein.
„Ach, Danton!“ erwiderte de Batz. „Er möchte die Flut aufhalten, die seine eigenen Leidenschaften losgetreten haben; er möchte die rasenden Bestien zähmen, deren Zähne er selbst geschärft hat. Ich sagte Ihnen bereits, Danton ist noch der Mann des Tages; morgen wird man ihn der Mäßigung bezichtigen. Danton und Mäßigung – beim Himmel! Was? Danton, der die Guillotine für zu langsam hielt und dreißig Soldaten mit Schwertern bewaffnete, damit dreißig Köpfe gleichzeitig rollen konnten. Danton, mein Freund, wird morgen sterben – angeklagt des Verrats an der Revolution, der Mäßigung gegenüber ihren Feinden; und Köter wie Heron werden sich am Blut von Löwen wie Danton und seinesgleichen laben.“
Er hielt einen Moment inne, denn er wagte nicht, seine Stimme zu heben, und seine Flüstertöne gingen unter im Lärm des Zuschauerraums. Der Vorhang, der eigentlich um acht Uhr hochgehen sollte, war noch immer unten, obwohl es bereits halb war, und das Publikum wurde ungeduldig. Lautes Stampfen hallte durch den Saal, und aus der Galerie drangen einige schrille Pfiffe des Unmuts.
„Wenn Heron ungeduldig wird“, sagte de Batz leicht hingeworfen, als der Lärm vorübergehend verebbte, „werden der Direktor dieses Theaters und vielleicht auch sein Hauptdarsteller und seine Primadonna morgen einen unangenehmen Tag erleben.“
„Immer wieder Heron!“, sagte St. Just mit einem verächtlichen Lächeln.
„Ja, mein Freund“, entgegnete der andere ungerührt, „immer wieder Heron. Und er hat sich heute Nachmittag sogar einen längeren Lebensaufschub verschafft.“
„Durch das neue Dekret?“
„Ja. Das neue Dekret. Die Agenten des Comité de Sûreté Générale, dessen Leiter Heron ist, haben ab heute die Befugnis zur Hausdurchsuchung; sie haben die volle Macht, gegen alle Feinde des öffentlichen Wohls vorzugehen. Ist das nicht herrlich vage? Und sie verfügen über absolute Entscheidungsgewalt – jeder kann zum Feind des öffentlichen Wohls werden: indem er zu viel Geld ausgibt oder zu wenig, indem er heute lacht oder morgen weint, indem er um einen toten Verwandten trauert oder sich über die Hinrichtung eines anderen freut. Er kann dem Volk ein schlechtes Vorbild sein durch die Reinlichkeit seiner Person oder durch den Schmutz auf seinen Kleidern; er kann heute zu Fuß gehen und nächste Woche in einer Kutsche fahren – allein die Agenten des Comité entscheiden, was als Feindschaft gegen das öffentliche Wohl gilt. Alle Gefängnisse stehen auf ihr Geheiß offen für jene, die sie zu denunzieren beschließen; sie haben fortan das Recht, Gefangene ohne Zeugen privat zu verhören und ohne weitere Genehmigung dem Tribunal zu überstellen. Ihre Pflicht ist klar – sie müssen „Beute für die Guillotine aufscheuchen“. So steht es im Dekret: Sie müssen dem öffentlichen Ankläger Arbeit verschaffen, den Tribunalen Opfer zum Verurteilen liefern, der Place de la Révolution Todesszenen zur Unterhaltung des Volkes bieten – und für ihre Mühen erhalten sie fünfunddreißig Livres für jeden Kopf, der unter der Guillotine fällt. Ach! Wenn Heron und seinesgleichen und seine Schergen tüchtig arbeiten, können sie ein hübsches Einkommen von vier- bis fünftausend Livres die Woche erzielen. Es geht voran, mein lieber St. Just – es geht voran.“
Er hatte seine Stimme dabei nicht erhoben, und auch beim Schildern solch unmenschlicher Monstrositäten, solch niederträchtiger, blutdürstiger Verschwörung gegen Freiheit, Würde und Leben einer ganzen Nation zeigte er keine Spur von Entrüstung; vielmehr klang in seinem Ton ein Zug von Belustigung, ja sogar von Triumph – und nun lachte er gutmütig, wie ein nachsichtiger Vater, der die grausamen Streiche eines verzogenen Jungen beobachtet.
„Dann also“, rief St. Just erregt, „müssen wir aus dieser Hölle, die sich auf Erden losgetobt hat, jene retten, die sich weigern, auf dieser Blutwelle mitzureiten.“
Seine Wangen glühten, seine Augen funkelten vor Begeisterung. Er wirkte sehr jung und sehr eifrig. Armand St. Just, der Bruder von Lady Blakeney, hatte etwas von der feinen Schönheit seiner anmutigen Schwester, doch die Züge – so männlich sie waren – besaßen nicht die latente Kraft, die jede Linie von Marguerites Gesicht durchzog. Die hohe Stirn deutete eher auf einen Träumer als auf einen Denker, und die blau-grauen Augen gehörten mehr einem Idealisten als einem Mann der Tat.
De Batz’ scharfe, durchdringende Augen hatten dies zweifellos erkannt, auch während er seinen jungen Freund mit demselben gutmütigen Blick betrachtete, der ihm offenbar eigen war.
„Wir müssen an die Zukunft denken, mein lieber St. Just“, sagte er nach einem kurzen Schweigen, langsam und bestimmt sprechend wie ein Vater, der ein hitzköpfiges Kind zurechtweist, „nicht an die Gegenwart. Was zählen ein paar Leben im Vergleich zu den großen Prinzipien, die auf dem Spiel stehen?“
„Die Wiederherstellung der Monarchie – ich weiß“, entgegnete St. Just noch immer aufgebracht, „aber inzwischen –“
„Inzwischen“, erwiderte de Batz eindringlich, „ist jedes Opfer der Gier dieser Männer ein Schritt hin zur Wiederherstellung von Gesetz und Ordnung – das heißt: der Monarchie. Nur durch diese grausamen Ausschreitungen, die im Namen des Volkes verübt werden, wird die Nation begreifen, wie sehr sie von einer Bande von Männern betrogen wird, die einzig an ihre eigene Macht und ihren eigenen Vorteil denken – und glauben, dass der Weg zu dieser Macht über die Leichen derer führt, die ihnen im Weg stehen. Sobald das Volk von diesen Orgien aus Ehrgeiz und Hass angewidert ist, wird es sich gegen diese wilden Bestien wenden und die Rückkehr all dessen begrüßen, was sie zu vernichten trachten. Das ist unsere einzige Hoffnung für die Zukunft – und glauben Sie mir, mein Freund, jeder Kopf, den Ihr romantischer Held, der Scarlet Pimpernel, vor der Guillotine rettet, ist ein Stein, gelegt zum Aufbau dieser ruchlosen Republik.“
„Das glaube ich nicht“, widersprach St. Just entschieden.
De Batz zuckte mit einer Geste, die sowohl Verachtung als auch völlige Selbstzufriedenheit und unerschütterlichen Glauben ausdrückte, mit seinen breiten Schultern. Seine kurzen, dicken Finger, mit Ringen übersät, trommelten ein kleines Solo auf die Brüstung der Loge.
Offenbar war er zu einer Erwiderung bereit. Die Haltung seines jungen Freundes irritierte ihn mehr, als sie ihn amüsierte. Doch er sagte zunächst nichts, sondern wartete, während die traditionellen drei Schläge auf dem Bühnenboden den bevorstehenden Beginn der Vorstellung ankündigten. Die zunehmende Ungeduld des Publikums wich wie durch Zauberhand beim Klang des ersehnten Signals; alle richteten sich wieder bequem in ihren Sitzen ein, wandten sich ab von der Betrachtung der Väter des Volkes – und vollends der Aufmerksamkeit der Schauspieler auf der Bühne zu.
2. Zielkonflikte
Dies war Armand St. Justs erster Besuch in Paris seit jenem denkwürdigen Tag, an dem er beschlossen hatte, sich endgültig von der republikanischen Partei zu lösen – jener Partei, deren edelste und begeisterteste Anhänger einst er und seine schöne Schwester Marguerite gewesen waren. Schon vor anderthalb Jahren hatten ihn die Ausschreitungen dieser Partei mit Entsetzen erfüllt – lange bevor sie sich zu jenen abscheulichen Orgien gesteigert hatten, die nun in Massenhinrichtungen und blutigen Opfern unschuldiger Menschen kulminierten.
Mit dem Tod Mirabeaus hatten die gemäßigten Republikaner, deren einziges und lauteres Ziel die Befreiung des französischen Volkes von der autokratischen Tyrannei der Bourbonen gewesen war, die Macht aus ihren reinen Händen gleiten sehen – hin zu den schmutzigen Klauen gieriger Demagogen, die kein anderes Gesetz kannten als ihre eigenen Leidenschaften, ihren Hass auf alle, die nicht so selbstsüchtig und grausam waren wie sie selbst.
Es ging längst nicht mehr um den Kampf für politische und religiöse Freiheit allein – es war ein Krieg von Klasse gegen Klasse, Mensch gegen Mensch – und der Schwächere möge sich in Acht nehmen. Der Schwächere war zuerst der Besitzende und Wohlhabende gewesen, dann der gesetzestreue Citoyen, zuletzt der Mann der Tat, der dem Volk eben jene Freiheit des Denkens und Glaubens verschafft hatte, die nun auf schreckliche Weise missbraucht wurde.
Armand St. Just, einst ein Botschafter der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, musste erkennen, dass die schlimmsten Auswüchse von Tyrannei im Namen jener Ideale verübt wurden, die er einst verehrt hatte.
Seine Schwester Marguerite, glücklich in England verheiratet, war die letzte Versuchung, die ihn bewog, das Land zu verlassen, dessen Geschicke er nicht länger zu beeinflussen vermochte. Der Funke der Begeisterung, den er und die Anhänger Mirabeaus in den Herzen des unterdrückten Volkes hatten entzünden wollen, hatte sich in rasende, unstillbare Flammen verwandelt. Die Erstürmung der Bastille war das Vorspiel zu den Septembermassakern gewesen, und selbst deren Schrecken waren inzwischen vom Grauen des heutigen Tages übertroffen worden.
Armand, vor der raschen Vergeltung der Revolutionäre durch die Hingabe des Scarlet Pimpernel gerettet, war nach England übergesetzt und hatte sich unter das Banner des heldenhaften Anführers gestellt. Doch war es ihm bisher nicht vergönnt gewesen, als aktives Mitglied der Liga zu wirken. Der Anführer war nicht gewillt, ihn unnötigen Gefahren auszusetzen. Die St. Justs – sowohl Marguerite als auch Armand – waren in Paris noch allzu bekannt. Marguerite war keine Frau, die man leicht vergaß, und ihre Ehe mit einem englischen Aristo war den republikanischen Kreisen, die sie einst als ihre Königin gefeiert hatten, ein Dorn im Auge. Armands Abkehr von der Partei und sein Übertritt in die Reihen der Emigranten hatten ihn zu einem besonders willkommenen Ziel für Vergeltung gemacht – sobald man seiner habhaft werden konnte. Und beide Geschwister hatten in ihrem Vetter Antoine St. Just einen ungewöhnlich erbitterten Feind – einst Bewerber um Marguerites Hand, nun ein unterwürfiger Anhänger und Nachahmer Robespierres, dessen grausame Härte er nachzuahmen suchte, um sich bei dem mächtigsten Mann der Zeit einzuschmeicheln.
Nichts hätte Antoine St. Just mehr gefallen, als die Gelegenheit, seinen Eifer und Patriotismus unter Beweis zu stellen, indem er seine eigenen Verwandten dem Tribunal der Schreckensherrschaft überlieferte. Scarlet Pimpernel, dessen feine Finger stets am Puls dieser hemmungslosen Revolution lagen, hatte keine Absicht, Armands Leben mutwillig zu opfern oder es auch nur unnötig zu gefährden.
So war denn über ein Jahr verstrichen, ehe Armand St. Just – ein begeistertes Mitglied der Liga des Scarlet Pimpernel – etwas zu deren Dienst beitragen konnte. Er hatte unter der Zurückhaltung, die ihm die Vorsicht seines Anführers auferlegte, schwer gelitten – hatte er doch nur den einen Wunsch, sein Leben zu riskieren an der Seite der Kameraden, die er liebte, und unter dem Kommando jenes Mannes, den er verehrte.
Schließlich, zu Beginn des Jahres 1794, hatte er Blakeney überredet, ihn bei der nächsten Unternehmung nach Frankreich mitzunehmen. Was das genaue Ziel dieser Mission war, wusste keines der Mitglieder der Liga bislang – wohl aber wussten sie, dass ihnen diesmal Gefahren begegnen würden, die alle bisherigen übertrafen.
Die Umstände hatten sich stark verändert. Zunächst war das undurchdringliche Geheimnis, das die Person des Anführers umgab, ein vollkommener Schutz gewesen – doch nun war ein kleiner Zipfel dieses Schleiers von zwei rohen Händen gelüftet worden: Chauvelin, ehemaliger Botschafter am englischen Hof, hegte keinen Zweifel mehr an der Identität des Scarlet Pimpernel, und Collot d’Herbois hatte ihn in Boulogne gesehen – und war dort von ihm auf raffinierte Weise hintergangen worden.
Seit jenem Tag waren vier Monate vergangen, und Scarlet Pimpernel war kaum noch außerhalb Frankreichs. Die Massaker in Paris und in den Provinzen hatten sich in erschreckendem Tempo vervielfacht; der selbstlose Einsatz jenes kleinen Häufleins von Helden war mit jedem Tag – ja mit jeder Stunde – dringlicher geworden. Mit grenzenloser Begeisterung sammelten sie sich um ihren Anführer – und man darf wohl sagen, dass der sportliche Instinkt, der diesen englischen Gentlemen innewohnte, ihre Leidenschaft und ihren Eifer umso mehr entfachte, je größer die Gefahr wurde, die ihre Unternehmungen nun begleitete.
Auf ein einziges Wort ihres geliebten Anführers hin verließen diese jungen Männer – die verwöhnten Lieblinge der Gesellschaft – das Vergnügen, die Freuden und den Luxus Londons oder Baths. Sie nahmen ihr Leben in die Hand und stellten es, mitsamt Vermögen und Ruf, in den Dienst der Unschuldigen und Wehrlosen, die unter der erbarmungslosen Tyrannei litten. Die Verheirateten – Ffoulkes, Lord Hastings, Sir Jeremiah Wallescourt – ließen Frau und Kinder zurück, sobald der Ruf des Anführers oder der Hilferuf eines Verzweifelten sie erreichte. Armand – ledig und begeistert – hatte das Recht, nun ebenfalls zu fordern, dass man ihn nicht länger zurückhielt.
Er war nur etwas über fünfzehn Monate fort gewesen, und doch fand Armand Paris als eine andere Stadt wieder als jene, die er unmittelbar nach den entsetzlichen Massakern im September verlassen hatte. Ein düsterer Schleier von Einsamkeit schien über ihr zu liegen, trotz der Menschenmengen, die ihre Straßen füllten; die Männer, die er früher in öffentlichen Orten angetroffen hatte – Freunde und politische Weggefährten – waren nirgends mehr zu sehen. Unbekannte Gesichter umgaben ihn, finster und lauernd, alle mit einem Ausdruck entsetzter Überraschung und diffuser, angsterfüllter Verwirrung, als wäre das Leben ein einziges grauenvolles Rätsel geworden, dessen Lösung man zwischen zwei raschen Toden zu erraten habe.
Armand St. Just hatte seine wenigen Habseligkeiten in jener schäbigen Unterkunft verstaut, die ihm zugewiesen worden war, und war nach Einbruch der Dunkelheit ziellos durch die Straßen gezogen. Instinktiv schien er nach einem vertrauten Gesicht zu suchen – nach jemandem, der aus jener heiteren Vergangenheit zu ihm treten würde, die er mit Marguerite in ihrer hübschen Wohnung in der Rue St. Honoré verbracht hatte.
Eine Stunde lang streifte er umher, ohne jemandem zu begegnen, den er kannte. Hin und wieder schien es ihm, als erkenne er eine Silhouette, ein Gesicht, das im Zwielicht rasch an ihm vorüberglitt – doch noch ehe er sicher sein konnte, war die Gestalt schon verschwunden, huschte flüchtig in eine enge, unbeleuchtete Seitenstraße, ohne sich nach rechts oder links umzusehen, als fürchte sie, erkannt zu werden. Armand fühlte sich wie ein Fremder in seiner eigenen Vaterstadt.
Die schrecklichen Stunden der Hinrichtungen auf der Place de la Révolution waren glücklicherweise vorbei; die Karren ratterten nicht mehr über das unebene Pflaster, und kein Todesschrei der Opfer gellte durch die Straßen. Armand blieb am ersten Tag seiner Ankunft dieser Anblick erspart – doch die Verlassenheit, die allgemeine Erscheinung schamvoller Dürftigkeit und grausamer Abgesondertheit erschütterte ihn tief.
Kein Wunder also, dass er mit sichtlicher Erleichterung auf die freundliche, gut gelaunte Stimme reagierte, die ihn bald darauf ansprach. Die Stimme – glatt, ölig im Klang, als halte ihr Besitzer sie bewusst geschmeidig für Zwecke des angenehmen Gesprächs – war wie ein Echo der Vergangenheit: jener Zeit, in der der lustige, unbekümmerte Baron de Batz, ehemals Offizier der Garde in Diensten des verstorbenen Königs, und seither als unermüdlicher Verschwörer für die Wiederherstellung der Monarchie bekannt, Marguerite stets mit seinen haltlosen, törichten Plänen zur Sturz der jungen Volksmacht amüsierte.
Armand war aufrichtig froh, ihn zu treffen, und als de Batz vorschlug, sich bei einem ausführlichen Gespräch über alte Zeiten zu ergehen, stimmte der Jüngere mit Freuden zu. Obwohl die beiden Männer einander keineswegs misstrauten, schienen sie doch keine Neigung zu verspüren, einander ihren Aufenthaltsort zu verraten. De Batz schlug sogleich die Avant-Szene-Loge eines der Theater vor – als den sichersten Ort, an dem alte Freunde reden konnten, ohne sich vor lauschenden Ohren oder spähenden Augen zu fürchten.
„Es gibt heutzutage keinen Ort, der so sicher oder so privat ist, glaub mir, mein junger Freund“, sagte er. „Ich habe jede erdenkliche Ecke und jedes Schlupfloch dieser verfluchten Stadt ausprobiert – einer Stadt, die inzwischen von Spitzeln durchsetzt ist – und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass eine kleine Avant-Szene-Loge das vollkommenste Versteck bietet, das man in ganz Paris finden kann. Die Stimmen der Schauspieler auf der Bühne und das Gemurmel des Publikums übertönen jedes persönliche Gespräch – für alle Ohren außer dem, für das es bestimmt ist.“
Es ist nicht schwer, einen jungen Mann, der sich einsam und etwas verloren in einer großen Stadt fühlt, zu überreden, den Abend in Gesellschaft eines unterhaltsamen Gesprächspartners zu verbringen – und de Batz war von jeher ein angenehmer Gesellschafter. Seine Luftschlösser waren stets amüsant gewesen, doch Armand rechnete ihm nun einen ernsteren Zweck zu. Und obgleich der Anführer ihn davor gewarnt hatte, in Paris neue Bekanntschaften zu schließen, glaubte der junge Mann, dass diese Einschränkung gewiss nicht für einen wie de Batz gelte, dessen glühende Anhängerschaft für die Royalisten und tollkühne Pläne für deren Rückkehr ihn durchaus mit der Liga des Scarlet Pimpernel in Einklang zu bringen schienen.
Armand nahm die herzliche Einladung an. Auch er empfand, dass er in einem überfüllten Theater sicherer war vor Beobachtung als auf offener Straße. Inmitten einer dicht gedrängten Menge, die nur nach Unterhaltung verlangte, würde seine schlicht gekleidete Gestalt – mit dem Aussehen eines Studenten oder Journalisten – mühelos unbemerkt bleiben.
Doch irgendwie, schon nach den ersten zehn Minuten im düsteren Schutz der kleinen Avant-Szene-Loge, begann Armand den Impuls zu bereuen, der ihn veranlasst hatte, das Theater heute Abend aufzusuchen und die Bekanntschaft mit dem ehemaligen Gardisten des Königs zu erneuern. Obwohl er wusste, dass de Batz ein glühender Royalist und sogar aktiver Monarchist war, spürte er bald ein vages Misstrauen gegenüber diesem selbstgefälligen, pomphaften Mann, dessen jede Äußerung mehr auf eigennützige Ziele als auf aufrichtige Hingabe an eine verlorene Sache schließen ließ.
So wandte sich St. Just, als sich endlich der Vorhang zum ersten Akt von Molières geistreicher Komödie hob, entschlossen der Bühne zu und versuchte, sich für das wortreiche Streitgespräch zwischen Philinte und Alceste zu interessieren.
Doch diese Haltung des Jüngeren schien dem wiedergefundenen Freund nicht zu behagen. Offenkundig hatte de Batz das Thema ihrer Unterhaltung noch längst nicht für erschöpft gehalten – und es war klar, dass es ihm bei der Einladung ins Theater weniger um die Vorstellung der Mademoiselle Lange in der Rolle der Célimène gegangen war als vielmehr um eine vertrauliche Aussprache wie die unterbrochene.
Die Anwesenheit St. Justs in Paris hatte de Batz in der Tat einigermaßen erstaunt und in seinem verschlungenen Geist allerhand Mutmaßungen ausgelöst. Es war sein erklärtes Ziel, diese Vermutungen in Gewissheit zu verwandeln – und daher hatte er das private Gespräch mit dem jungen Mann gesucht.
Nun schwieg er für einen Moment, ließ seine scharfen, kleinen Augen mit merklicher Spannung auf Armands abgewandtem Profil ruhen, während seine Finger ungeduldig weiter auf das samtbezogene Kissen der Loge trommelten. Dann, als St. Just sich ein wenig zu ihm hinwandte, war er augenblicklich bereit, das Gespräch wieder aufzunehmen.
Mit einem raschen Nicken deutete er auf die Männer im Zuschauerraum.
„Ihr guter Vetter Antoine St. Just ist inzwischen eng mit Robespierre verbandelt“, sagte de Batz. „Als Sie Paris vor über einem Jahr verließen, konnten Sie ihn noch als geschwätzigen Dummkopf verachten – jetzt aber, wollen Sie in Frankreich bleiben, müssen Sie ihn fürchten – als Macht und als Bedrohung.“
„Ja, ich wusste, dass er sich unter die Wölfe gemischt hat“, erwiderte Armand leicht. „Er war einmal in meine Schwester verliebt. Ich danke Gott, dass sie seine Neigung nie erwidert hat.“
„Man sagt, er sei unter die Wölfe gegangen aus Enttäuschung deswegen“, meinte de Batz. „Das ganze Rudel besteht aus Männern, die enttäuscht wurden – und die nichts mehr zu verlieren haben. Erst wenn all diese Wölfe einander zerfleischt haben, können wir auf die Wiederherstellung der Monarchie hoffen. Und sie werden einander nicht anfallen, solange ihnen die Beute willig ins Maul läuft. Ihr Freund, der Scarlet Pimpernel, sollte diese blutige Revolution eher nähren als sie aushungern – wenn er sie denn wirklich so sehr hasst, wie es den Anschein hat.“
Seine unruhigen Augen bohrten sich forschend in die des jüngeren Mannes. Er schwieg, als würde er auf eine Antwort warten; dann, da St. Just stumm blieb, wiederholte er langsam, beinahe herausfordernd:
„Wenn er diese blutdürstige Revolution wirklich so hasst, wie er vorgibt.“
In dieser Wiederholung lag ein unausgesprochener Zweifel. Im selben Augenblick regte sich Armand St. Justs Loyalität in heftigem Widerspruch.
„Scarlet Pimpernel“, sagte er, „kümmert sich nicht um Ihre politischen Ziele. Das Werk der Barmherzigkeit, das er tut, geschieht um der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit willen.“
„Und aus Spieltrieb“, warf de Batz mit einem höhnischen Lächeln ein. „So hat man mir erzählt.“
„Er ist Engländer“, entgegnete St. Just, „und als solcher wird er nie zugeben, dass Gefühl sein Antrieb sei. Doch ganz gleich, was das Motiv ist – sehen Sie sich das Ergebnis an!“
„Ja, ein paar Leben, der Guillotine entwendet.“
„Frauen und Kinder – unschuldige Opfer –, die ohne seine Hingabe dem Tod geweiht gewesen wären.“
„Und je unschuldiger sie waren, je hilfloser, je erbarmenswerter – umso lauter hätte ihr Blut nach Rache geschrien gegen jene Bestien, die sie ins Verderben geschickt haben.“
St. Just schwieg. Es war offensichtlich sinnlos, mit diesem Mann zu streiten, dessen politische Ziele ebenso weit entfernt von denen des Scarlet Pimpernel lagen wie der Nordpol vom Südpol.
„Wenn einer von Ihnen Einfluss hat auf Ihren hitzköpfigen Anführer“, fuhr de Batz unbeirrt fort, „so möge er ihn jetzt geltend machen – bei Gott, ich wünschte, Sie würden es tun.“
„Inwiefern?“, fragte St. Just, ein Lächeln nicht unterdrücken könnend bei dem Gedanken, er oder sonst jemand könnte über Blakeney und dessen Pläne gebieten.
Nun war es de Batz, der schwieg. Einen Moment zögerte er, dann fragte er unvermittelt:
„Ihr Scarlet Pimpernel ist doch jetzt in Paris – nicht wahr?“
„Ich kann es Ihnen nicht sagen“, antwortete Armand kühl.
„Bah! Es ist nicht nötig, mit mir die Klingen zu kreuzen, mein Freund. In dem Augenblick, als ich Sie heute Nachmittag sah, wusste ich, dass Sie nicht allein nach Paris gekommen sind.“
„Sie irren sich, mein lieber de Batz“, entgegnete der junge Mann mit Nachdruck. „Ich kam allein nach Paris.“
„Kluge Ausflucht, wahrlich – aber bei mir vergeudet. Habe ich nicht gleich bemerkt, dass Sie heute nicht sonderlich erfreut waren, als ich Sie ansprach?“
„Wieder irren Sie sich. Ich war sehr erfreut, Ihnen zu begegnen – ich hatte mich den ganzen Tag über ungewöhnlich einsam gefühlt und war froh, einem Freund die Hand zu drücken. Was Sie für Unmut hielten, war nur Überraschung.“
„Überraschung? Ach ja! Es wundert mich nicht, dass Sie überrascht waren, mich ungehindert und offen auf den Straßen von Paris wandeln zu sehen – wo Sie doch von mir als gefährlichem Verschwörer gehört hatten, nicht wahr? – als ein Mann, dem die gesamte Polizei seines Landes auf den Fersen ist, auf dessen Kopf ein Preis ausgesetzt ist – was?“
„Ich wusste, dass Sie mehrere edle Versuche unternommen haben, den unglücklichen König und die Königin aus den Händen dieser Ungeheuer zu befreien.“
„Allesamt erfolglos“, gestand de Batz ungerührt ein, „jeder einzelne durch irgendeinen verräterischen Mitverschwörer oder durch einen habgierigen Spitzel verraten. Ja, mein Freund, ich habe versucht, König Ludwig und Königin Marie Antoinette vor dem Schafott zu retten – und jedes Mal wurde ich vereitelt. Und doch – wie Sie sehen – bin ich unversehrt und frei. Ich gehe offen durch die Straßen und spreche mit meinen Bekannten, wie sie mir begegnen.“
„Sie haben Glück“, sagte St. Just, nicht ohne einen Anflug von Sarkasmus.
„Ich war vorsichtig“, entgegnete de Batz. „Ich habe mir dort Freunde gemacht, wo ich sie am nötigsten brauchte – der Mammon der Ungerechtigkeit, Sie verstehen – was?“
Und er lachte laut – ein schwerfälliges, selbstgefälliges Lachen.
„Ja, ich verstehe“, erwiderte St. Just nun deutlich sarkastisch. „Sie verfügen über österreichisches Geld.“
„In Hülle und Fülle“, sagte der andere zufrieden, „und ein guter Teil davon klebt an den schmutzigen Fingern dieser patriotischen Revolutionsmacher. So sichere ich meine eigene Haut – ich erkaufe sie mir mit dem Geld des Kaisers und kann auf diese Weise für die Wiederherstellung der Monarchie in Frankreich wirken.“
Wieder schwieg St. Just. Was sollte er auch sagen? Unwillkürlich schweiften seine Gedanken zurück zu jenem anderen Verschwörer – dem mit den reinen, schlichten Zielen. Dem Mann, dessen schlanke Hände niemals fremdes Gold berührt, der sie aber stets nach den Hilflosen ausgestreckt hatte – dessen Gedanken allein dem galten, was er für andere tun konnte, nie aber seiner eigenen Sicherheit.
De Batz jedoch schien sich solcher ernüchternden Gedanken seines jungen Freundes nicht bewusst – er sprach freundlich weiter, auch wenn sich nun ein leiser Zug von Besorgnis in seiner glatten Stimme bemerkbar machte:
„Wir schreiten langsam voran, mein lieber St. Just“, sagte er. „Ich konnte die Monarchie nicht in der Person des Königs oder der Königin retten – aber vielleicht gelingt es mir noch in der Person des Dauphin.“
„Der Dauphin“, murmelte St. Just unwillkürlich.
Dieses kaum hörbare Murmeln, so leise es war, schien de Batz in gewisser Weise zu genügen – der bohrende Ausdruck in seinem Blick ließ nach, und seine dicken Finger hörten auf, nervös auf der Brüstung der Loge zu trommeln.
„Ja – der Dauphin“, sagte er, mit dem Kopf nickend, als bestätige er eigene Gedanken. „Oder sagen wir besser: der regierende König von Frankreich – Louis XVII, von Gottes Gnaden – das kostbarste Leben auf der ganzen Erde zurzeit.“
„Da haben Sie recht, Freund de Batz“, stimmte Armand mit Inbrunst zu. „Das kostbarste Leben, wie Sie sagen – und eines, das um jeden Preis gerettet werden muss.“
„Ja“, sagte de Batz gelassen, „aber nicht von Ihrem Freund, dem Scarlet Pimpernel.“
„Warum nicht?“
Kaum waren diese beiden Worte Armand über die Lippen gekommen, bereute er sie auch schon. Er biss sich auf die Lippen und wandte sich mit finsterem Blick, beinahe trotzig, seinem Gesprächspartner zu.
Doch de Batz lächelte in unerschütterlicher Selbstzufriedenheit.
„Ach, mein lieber Armand“, sagte er spöttisch, „Sie sind weder für Diplomatie geschaffen noch für Intrige. Also dann“, fügte er in ernsthafterem Ton hinzu, „hegt jener tapfere Held, der Scarlet Pimpernel, tatsächlich die Hoffnung, unseren jungen König aus den Klauen des Schusters Simon und dem Rudel Hyänen zu befreien, das nur auf seinen abgezehrten kleinen Leichnam lauert – wie?“
„Das habe ich nicht gesagt“, entgegnete St. Just mürrisch.
„Nein. Aber ich sage es. Nein, nein – geben Sie sich keine Mühe, mein überloyaler junger Freund. Wer könnte denn auch nur einen Augenblick daran zweifeln, dass Ihr romantischer Held früher oder später seine Aufmerksamkeit auf das rührendste Schauspiel Europas richten würde – auf das kindliche Opfer im Temple-Gefängnis? Es wäre mir ein Wunder, wenn der Scarlet Pimpernel unseren kleinen König gänzlich ignorierte. Nein, nein; glauben Sie ja nicht, dass Sie mir das Geheimnis Ihres Freundes verraten hätten. Als ich Sie heute so glücklicherweise traf, wusste ich sofort, dass Sie unter dem Banner jener rätselhaften kleinen roten Blume hier sind – und daraus leitete ich noch einen Schritt mehr ab. Der Scarlet Pimpernel ist jetzt in Paris und hofft, Louis XVII aus dem Temple-Gefängnis zu befreien.“
„Wenn dem so ist, dann sollten Sie sich nicht nur freuen, sondern auch helfen können.“
„Und doch, mein Freund, tue ich weder das eine noch gedenke ich, das andere zu tun – weder jetzt noch künftig“, sagte de Batz mit der gleichen gelassenen Herablassung. „Ich bin nun einmal Franzose, sehen Sie.“
„Was hat das mit dieser Frage zu tun?“
„Alles – obwohl Sie, Armand, obwohl auch Sie Franzose sind, nicht durch meine Brille blicken. Louis XVII ist König von Frankreich, mein lieber St. Just – er muss seine Freiheit und sein Leben uns Franzosen verdanken und sonst niemandem.“
„Das ist Wahnsinn, Mann!“, rief Armand aus. „Wollen Sie etwa das Kind dem Tod preisgeben, nur um Ihrer eigensüchtigen Vorstellungen willen?“
„Sie mögen es eigensüchtig nennen – jede Vaterlandsliebe ist in gewissem Maße eigensüchtig. Was kümmert es den Rest der Welt, ob wir eine Republik oder eine Monarchie sind, eine Oligarchie oder völlige Anarchie? Wir handeln für uns selbst und um uns selbst zu gefallen – und ich für meinen Teil dulde keine Einmischung von außen.“
„Aber Sie arbeiten mit ausländischem Geld!“
„Das ist etwas anderes. Ich kann in Frankreich kein Geld auftreiben, also beschaffe ich es mir, wo ich kann. Aber die Flucht Louis XVII aus dem Temple-Gefängnis kann ich arrangieren – und uns französischen Royalisten soll die Ehre und der Ruhm zukommen, unseren König gerettet zu haben.“
Zum dritten Mal ließ St. Just das Gespräch versanden; mit geweiteten Augen, fast entsetzt, starrte er auf diese dreiste Zurschaustellung von nahezu wilder Eitelkeit und Selbstsucht. De Batz, lächelnd und selbstzufrieden, lehnte sich bequem in seinem Stuhl zurück, betrachtete seinen jungen Freund mit vollkommener Behaglichkeit, die sich in jeder Linie seines pockennarbigen Gesichts und in der Haltung seines wohlgenährten Körpers spiegelte. Es war nun leicht zu verstehen, weshalb dieser Mann trotz seiner vielen törichten Pläne, die bisher alle gescheitert waren, eine derartige Unversehrtheit genoss.
Ein Aufschneider, ein hohles Großmaul – und doch hatte er auf eines besonders geachtet: auf seine eigene Haut. Anders als die unglücklicheren Royalisten Frankreichs kämpfte er nicht auf dem Land, noch stellte er sich Gefahren in der Stadt. Er wählte den sicheren Weg – überschritt die Grenze und machte sich zum Agenten Österreichs. Er verstand es, das Geld des Kaisers für die Sache der Royalisten zu gewinnen – und vor allem zu seinem eigenen Nutzen.
Selbst ein weniger weltgewandter Mann als Armand St. Just hätte leicht erraten können, dass de Batz’ Wunsch, allein für die Rettung des kleinen Dauphin aus dem Temple verantwortlich zu sein, nicht aus Patriotismus entsprang, sondern allein aus Gier. Offensichtlich wartete in Wien eine hohe Belohnung auf jenen, der Louis XVII heil in österreichisches Gebiet brachte; und diese Belohnung würde ihm entgehen, wenn sich ein lästiger Engländer in die Sache einmischte. Ob dabei das Leben des kleinen Königs aufs Spiel gesetzt wurde oder nicht – das spielte für ihn keine Rolle. Entscheidend war, dass de Batz die Belohnung erhielt – denn sein eigenes Wohlergehen bedeutete ihm mehr als das kostbarste Leben Europas.
3. Der Dämon Zufall
St. Just hätte viel darum gegeben, jetzt in seiner einsamen, ärmlichen Unterkunft zu sein. Zu spät erkannte er, wie weise die Mahnung gewesen war, in Frankreich keine alten Freundschaften zu erneuern und keine neuen zu schließen.
Die Menschen hatten sich mit der Zeit geändert. Wie entsetzlich sie sich geändert hatten! Die eigene Sicherheit war zu einem Kult geworden – zu einem Ziel, so schwer zu erreichen, dass es um jeden Preis angestrebt wurde, selbst auf Kosten der Menschlichkeit und des Selbstrespekts.
Egoismus – das kalte, nüchterne Streben nach dem eigenen Vorteil – herrschte unangefochten. De Batz, übersättigt mit ausländischem Geld, setzte es in erster Linie dazu ein, seine eigene Unversehrtheit zu sichern, indem er es nach rechts und links streute, um den Ehrgeiz des öffentlichen Anklägers zu besänftigen oder die Gier unzähliger Spione zu befriedigen.
Was davon übrig blieb, nutzte er, um die blutgierigen Demagogen gegeneinander auszuspielen und die Nationalversammlung in eine riesige Bärenhöhle zu verwandeln, in der sich die wilden Bestien gegenseitig zerfleischten.
Was scherte es ihn – so sagte er selbst –, ob Hunderte unschuldiger Märtyrer elend und umsonst starben? Sie waren die notwendige Nahrung, mit der die Revolution gesättigt werden musste, damit de Batz’ Pläne reifen konnten. Sogar das kostbarste Leben Europas sollte nur dann gerettet werden, wenn sein Preis de Batz’ Taschen füllte oder seinen künftigen Ambitionen diente.
Die Zeit hatte tatsächlich eine ganze Nation verwandelt. St. Just empfand für diesen eigennützigen Royalisten denselben Ekel wie für die wilden Bestien, die rechts und links zum eigenen Vergnügen zuschlugen. Er spielte mit dem Gedanken, sofort in seine Unterkunft zurückzukehren – in der Hoffnung, dort ein Wort vom Anführer vorzufinden, ein Zeichen dafür, dass es noch Männer gab, deren Ziele nicht nur in ihrem eigenen Fortkommen lagen – Männer mit Idealen, die über die Vergötzung des Ichs hinausgingen.
Der Vorhang war nach dem ersten Akt gefallen, und wie es die Werke des Monsieur de Molière verlangten, ertönten sogleich wieder die traditionellen drei Schläge, ganz ohne Pause. St. Just stand auf, bereit, sich mit einer höflichen Ausrede von seinem Freund zu verabschieden. Der Vorhang hob sich langsam zum zweiten Akt und gab Alceste frei, wie er zornig mit Célimène debattierte.
Alcestes Eröffnungsrede war kurz. Während der Schauspieler sprach, hatte Armand dem Geschehen auf der Bühne den Rücken zugewandt; mit ausgestreckter Hand murmelte er die Worte, die ihm als höflicher Vorwand dienen sollten, um seinen liebenswürdigen Gastgeber gleich zu verlassen, obwohl die Vorstellung kaum begonnen hatte.
De Batz – verärgert und ungeduldig – hatte sich mit dem Fortgehen seines Freundes noch keineswegs abgefunden. Er glaubte, seine wortreichen, überzeugend vorgetragenen Argumente hätten Eindruck auf den jungen Mann gemacht. Diesen Eindruck wollte er vertiefen, und während Armand fieberhaft nach einer plausiblen Entschuldigung suchte, grübelte de Batz darüber, wie er ihn am Gehen hindern könnte.
Da griff der launische Dämon Zufall ein. Wäre St. Just nur zwei Minuten früher aufgestanden, hätte ihm sein reger Geist rechtzeitig die gewünschte Ausrede eingegeben – wer weiß, welch unsagbares Leid, welch herzzerreißende Not, welch bittere Schande ihm und denen, die er liebte, erspart geblieben wäre. Diese zwei Minuten – hätte er es nur gewusst – bestimmten den gesamten Verlauf seines künftigen Lebens. Die Ausrede lag ihm schon auf den Lippen, de Batz bereitete sich widerwillig darauf vor, ihm Lebewohl zu sagen, da ließ Célimène, mit ganz gewöhnlichen Worten im Streit mit ihrem reizbaren Verehrer, ihn die Hand sinken, die er eben noch seinem Freund entgegengestreckt hatte, und veranlasste ihn, sich wieder der Bühne zuzuwenden.
Es war eine bezaubernde Stimme, die da sprach – eine Stimme, warm und voll, mit dunklem Klang, der verborgene Kraft verriet. Die Stimme ließ Armand aufblicken – die Lippen, die sprachen, schmiedeten das erste feine Glied jener Kette, die ihn für immer an die Sprecherin fesselte.
Ob es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick wirklich gibt? Dichter und Romanciers wollen uns davon überzeugen, Idealisten schwören darauf, dass nur sie die wahre, einzige Liebe sei.
Ob das auch für Armand St. Just galt? Mademoiselle Langes bezaubernde Stimme hatte ihn jedenfalls so sehr gefesselt, dass er seine Abneigung gegen de Batz und den Wunsch, zu gehen, ganz vergaß. Fast mechanisch setzte er sich wieder, legte beide Ellbogen auf den Rand der Loge, stützte das Kinn in die Hand und lauschte. Die Worte, die der verstorbene Monsieur de Molière Célimène in den Mund gelegt hatte, waren oberflächlich und kokett genug, doch jedes Mal, wenn Mademoiselle Lange die Lippen bewegte, sah Armand gebannt zu ihr hin.
Hier hätte die Sache wohl geendet – ein junger Mann, bezaubert von einer hübschen Frau auf der Bühne – das ist kein großes Ereignis und selten der Ursprung einer langen, leidvollen Tragödie. Armand, der eine Schwäche für Musik hatte, hätte wohl weiterhin das göttliche Timbre von Mademoiselle Langes Stimme verehrt – bis der letzte Vorhang fiel –, hätte nicht sein Freund de Batz den Zauber bemerkt, den die Schauspielerin auf den jungen Enthusiasten ausübte.
Nun war de Batz ein Mann, der keine Gelegenheit ungenutzt ließ, wenn sie seinen eigenen Zielen dienlich sein konnte. Er wollte Armand nicht so bald aus den Augen verlieren – und da hatte der freundliche Dämon Zufall ihm ein Mittel in die Hand gespielt, wie er seinen Wunsch verwirklichen konnte.
Er wartete geduldig bis zum Fall des Vorhangs nach dem zweiten Akt; dann, als Armand mit einem Seufzer der Verzückung in den Sessel zurücksank und die Augen schloss, als ob er die letzte halbe Stunde innerlich nochmals durchlebte, bemerkte de Batz mit gut gespielter Gleichgültigkeit:
„Mademoiselle Lange ist eine vielversprechende junge Schauspielerin. Finden Sie nicht auch, mein Freund?“
„Sie hat eine vollkommene Stimme – reine Melodie für das Ohr“, antwortete Armand. „Ich war mir kaum etwas anderem bewusst.“
„Und sie ist auch eine schöne Frau“, fuhr de Batz lächelnd fort. „Im nächsten Akt, mein guter St. Just, rate ich Ihnen, nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen zu öffnen.“
Armand tat, wie ihm geheißen. Das ganze Erscheinungsbild Mademoiselle Langes schien mit ihrer Stimme im Einklang zu stehen. Sie war nicht sehr groß, aber von ausgesprochener Grazie, mit einem kleinen ovalen Gesicht und einer schlanken, fast kindlichen Gestalt, die durch die weiten Reifröcke und drapierten Paniers nach Molières Mode noch zierlicher wirkte.
Ob sie schön war oder nicht, hätte der junge Mann kaum zu sagen gewusst. Nach gewissen Maßstäben gemessen war sie es gewiss nicht: der Mund war nicht klein, und die Nase alles andere als klassisch geformt. Doch ihre Augen waren braun und hatten jenen halbverschleierten Blick, überschattet von langen Wimpern, der dem männlichen Herzen stets einen stillen, zärtlichen Reiz zu entlocken vermag; auch die Lippen waren voll und feucht, und die Zähne blendend weiß. Ja – man könnte wohl sagen, dass sie reizend war, selbst wenn man nicht zugeben mochte, dass sie schön war.
Der Maler David hat eine Skizze von ihr gefertigt; wir alle haben sie im Musée Carnavalet gesehen – und uns gefragt, weshalb dieses anmutige, wenn auch unregelmäßige Gesicht einen so unauslöschlichen Eindruck von Traurigkeit hinterließ.
„Der Menschenfeind“ hat fünf Akte, in denen Célimène beinahe ununterbrochen auf der Bühne steht. Gegen Ende des vierten Akts sagte de Batz beiläufig zu seinem Freund:
„Ich habe die Ehre, mit Mademoiselle Lange persönlich bekannt zu sein. Wenn Sie wünschen, stelle ich Sie ihr nach dem Stück im Grünen Salon vor.“
Flüsterte da die Klugheit: „Lass ab“? Murmelte die Loyalität gegenüber dem Anführer: „Gehorche“? Es wäre schwer zu sagen. Armand St. Just war noch keine fünfundzwanzig – und Mademoiselle Langes melodische Stimme sprach lauter als alle Mahnungen der Vorsicht oder der Pflicht.
Er dankte de Batz mit Wärme, und während der letzten halben Stunde, da der misanthropische Liebhaber die reuige Célimène von sich stieß, verspürte er eine seltsame Unruhe, ein Prickeln in den Nerven, eine wilde, fieberhafte Sehnsucht, jene vollen, feuchten Lippen seinen Namen aussprechen zu hören – und jenen großen braunen Augen zu begegnen, in deren halbverhülltem Blick sich vielleicht der seine spiegeln würde.
4. Mademoiselle Lange
Der Grüne Salon war überfüllt, als de Batz und St. Just nach der Vorstellung dort eintrafen. Der ältere Mann warf einen raschen Blick durch die offene Tür. Die Menge entsprach nicht seinem Vorhaben, und er zog seinen Begleiter hastig fort – weg von dem Anblick der Mademoiselle Lange, die in einer entfernten Ecke des Raumes saß, umgeben von einer Schar Bewunderer und unzähligen Blumenspenden, die ihrer Schönheit und ihrem Erfolg galten.
Ohne ein Wort schlug de Batz den Weg zurück zur Bühne ein. Dort, im schwachen Licht von Talgkerzen, die in Wandleuchtern befestigt waren, waren die Bühnenarbeiter damit beschäftigt, Kulissen, Prospekte und Seitenteile zu verschieben, und achteten nicht auf die beiden Männer, die langsam auf und ab gingen, jeder in seine Gedanken versunken.
Armand ging mit in die Taschen seiner Kniehosen vergrabenen Händen, den Kopf auf die Brust gesenkt; doch immer wieder warf er hastige, besorgte Blicke um sich, sobald ein fester Schritt über die leere Bühne hallte oder eine Stimme klar durch das nun verlassene Theater klang.
„Ist es klug, dass wir hier warten?“ fragte er, mehr zu sich selbst als zu seinem Begleiter sprechend.
Um seine eigene Sicherheit war er nicht besorgt; aber die Worte de Batz’ hatten sich ihm eingeprägt: „Heron und seine Spitzel haben wir immer bei uns.“
Vom Grünen Salon führte ein eigener Vorraum mit Ausgang direkt auf die Straße. Allmählich wurden die vielen Stimmen, das laute Lachen und gelegentliche Liedfetzen, die seit einer halben Stunde aus jenem Teil des Hauses gedrungen waren, gedämpfter und seltener. Einer nach dem anderen verließ die Freundesschar der Künstler das Theater, nachdem sie die üblichen nichtssagenden Komplimente verteilt oder die gewohnten Blumengaben an den leuchtendsten Stern des Abends überreicht hatten.
Die Schauspieler zogen sich als Erste zurück, dann die älteren Schauspielerinnen – jene, die keinen Hof von Verehrern mehr um sich scharen konnten. Sie verließen allesamt den Grünen Salon und überquerten die Bühne zu jener Stelle, wo hinten eine schmale, klapprige Holztreppe zu ihren sogenannten Garderoben führte – winzige, dunkle Verschläge, schlecht beleuchtet, ohne Lüftung, wo sich ein halbes Dutzend der kleineren Bühnensterne beim Abnehmen von Perücken und Schminke gegenseitig auf die Füße trat.
Armand und de Batz verfolgten diesen Aufbruch mit gleicher Ungeduld. Mademoiselle Lange war die Letzte, die den Grünen Salon verließ. Seitdem sich die Menge um sie gelichtet hatte, war es Armand gelungen, flüchtige Blicke auf ihre schlanke, elegante Gestalt zu erhaschen. Ein kurzer Gang führte von der Bühne zur Tür des Grünen Salons, die weit offenstand, und an der Ecke dieses Gangs hatte der junge Mann bei seinem Auf-und-ab immer wieder innegehalten, um mit inniger Bewunderung auf den zarten Umriss des Kopfes der jungen Frau zu blicken – auf ihre gepuderte Lockenperücke, die kaum weißer schien als der cremige Glanz ihrer Haut.
De Batz beobachtete Mademoiselle Lange kaum – abgesehen von ungeduldigen Blicken in die Richtung der Menge, die sie noch am Verlassen des Salons hinderte. Sehr wohl beobachtete er aber Armand: bemerkte dessen gespannte Miene, die lebhaften, wachen Bewegungen, die offensichtlichen Blicke der Bewunderung, die er in Richtung der jungen Schauspielerin warf – und das schien ihm ein gewisses Maß an Zufriedenheit zu verschaffen.
Fast eine Stunde war vergangen seit dem Fall des Vorhangs, als Mademoiselle Lange endlich ihre zahlreichen Verehrer entließ – und de Batz hatte die Genugtuung, sie den Gang hinunterlaufen zu sehen, wobei sie sich immer wieder umwandte, um den Verweilenden, die sich nur schwer von ihr trennen wollten, fröhliche „Gute Nacht!“-Rufe zuzurufen. Sie war ein Kind in allen ihren Bewegungen, ganz ohne Selbstbewusstsein oder Eitelkeit, jedoch offen erfreut über ihren Erfolg. Sie trug noch immer das lächerliche Reifrock-Kostüm ihrer Bühnenrolle, und die gepuderte Perücke verbarg den Zauber ihres eigenen Haares; das Kostüm verlieh ihrer ungekünstelten Art eine gewisse Künstlichkeit – was in eben jenem Kontrast ihren eigentlichen Reiz ausmachte.
In den Armen hielt sie einen riesigen Strauß wohlriechender Narzissen, wohl ein Geschenk aus irgendeinem bevorzugten Winkel des Südens. Armand fand, dass er niemals in seinem Leben etwas so Anziehendes und so Liebliches gesehen hatte.
Nachdem sie nun endlich das wirklich allerletzte Adieu gesagt hatte, wandte sich Mademoiselle Lange mit einem glücklichen kleinen Seufzer dem Gang zu.
Sie stand plötzlich Armand gegenüber – und stieß einen kleinen, erschrockenen Laut aus. In diesen Tagen war es gefährlich, einem Unbekannten unversehens zu begegnen.
Doch da war de Batz schon zu ihnen getreten, mit seiner glatten, angenehmen Stimme und der rundlichen, beringten Hand, die er Mademoiselle Lange entgegenstreckte – genug, um sie sogleich zu beruhigen.
„Sie waren im Grünen Salon so sehr umringt, Mademoiselle“, sagte er höflich, „dass ich es nicht wagte, mich unter Ihre Bewunderer zu mischen. Doch ich hegte den starken Wunsch, Ihnen persönlich meine aufrichtige Bewunderung auszusprechen.“
„Ah! c’est ce cher de Batz!“ rief Mademoiselle heiter aus, in jener wunderbar perlenden Stimme, die ihr eigen war. „Und woher in aller Welt kommen Sie denn, mein Freund?“
„Psst!“ wisperte er, ihre kleine, behandschuhte Hand in der seinen haltend und einen Finger bittend auf die Lippen legend, „nicht meinen Namen, ich bitte Sie, schöne Freundin.“
„Bah!“ entgegnete sie unbeschwert, obwohl nun ihre vollen Lippen beim Sprechen leicht zitterten und ihre Worte Lügen straften. „Sie brauchen hier keine Furcht zu haben. Es gilt als unausgesprochenes Gesetz, dass das Comité de Sûreté Générale keine Spione hinter den Vorhang eines Theaters entsendet. Würde man all uns Schauspieler zur Guillotine schicken, gäbe es morgen keine Vorstellung. Artistes lassen sich nicht binnen Stunden ersetzen; man muss die vorhandenen wohl oder übel verschonen – sonst wüssten die Citoyens, die uns regieren, nicht, wohin sie abends gehen sollten.“
Doch obwohl sie so leichtfüßig sprach und mit gewohnter Heiterkeit, war deutlich zu spüren, dass selbst dieses kindliche Gemüt schon von der allgegenwärtigen Gefahr gezeichnet war – von Misstrauen und Vorsicht.
„Kommen Sie mit in meine Garderobe“, sagte sie. „Ich darf hier nicht länger verweilen, sie werden bald das Licht löschen. Aber ich habe ein eigenes Zimmer, dort lässt sich vortrefflich plaudern.“
Sie führte den Weg über die Bühne zu der hölzernen Treppe. Armand, der sich während dieses kurzen Gesprächs zwischen seinem Freund und dem jungen Mädchen diskret im Hintergrund gehalten hatte, wusste nicht recht, was er tun sollte. Doch auf ein unmissverständliches Zeichen von de Batz wandte auch er sich und folgte der heiteren kleinen Dame, die flink die wackligen Stufen hinauflief, dabei Schnipsel beliebter Lieder vor sich hin summend, ohne sich umzudrehen, um zu sehen, ob die beiden Männer ihr auch tatsächlich folgten.
Sie hielt den Strauß Narzissen noch immer im Arm, und da die Tür zu ihrer winzigen Garderobe offenstand, lief sie schnurstracks hinein und warf die Blumen in einem wirren, duftenden Haufen auf den kleinen Tisch am einen Ende des Raumes, der mit Tiegeln und Fläschchen, Briefen, Spiegeln, Puderquasten, Seidenstrümpfen und Batisttaschentüchern überladen war.
Dann wandte sie sich zu den beiden Männern um, ein fröhliches Funkeln unbezwingbarer Heiterkeit in den Augen.
„Machen Sie die Tür zu, mon ami“, sagte sie zu de Batz, „und dann setzen Sie sich irgendwo hin – solange es nicht auf meinen kostbarsten Salbentiegel oder eine Schachtel meines teuersten Puders ist.“
Während de Batz ihrer Aufforderung nachkam, wandte sie sich an Armand und sagte mit einem hübschen, fragenden Ton in ihrer melodischen Stimme: „Monsieur?“
„St. Just, zu Ihren Diensten, Mademoiselle“, sagte Armand und verbeugte sich sehr tief, ganz im gebührenden Stil des englischen Hofes.
„St. Just?“, wiederholte sie, mit einem fragenden Blick in ihren braunen Augen. „Sicherlich …“
„Ein Verwandter von Citoyen St. Just, den Sie gewiss kennen, Mademoiselle“, warf er rasch ein.
„Mein Freund Armand St. Just“, mischte sich de Batz ein, „ist praktisch ein Neuankömmling in Paris. Er lebt gewöhnlich in England.“
„In England?“, rief sie aus. „Oh, erzählen Sie mir alles über England! Ich würde so gerne dorthin reisen. Vielleicht muss ich eines Tages sogar… Ach, setzen Sie sich doch, de Batz“, fuhr sie plaudernd fort, während ein zarter Hauch von Röte ihre Wangen färbte unter dem Blick offensichtlicher Bewunderung, der aus Armand St. Justs ausdrucksstarken Augen sprach.
Sie fegte eine Handvoll feinen Batists und Seide von einem Stuhl, um Platz für de Batz’ beleibte Gestalt zu machen. Dann ließ sie sich auf das Sofa nieder und bedeutete Armand mit einer einladenden Geste und einem Blick, sich neben sie zu setzen. Sie lehnte sich in die Kissen zurück, und da der Tisch in unmittelbarer Nähe stand, streckte sie die Hand aus und nahm erneut den Strauß Narzissen auf. Während sie mit Armand sprach, hielt sie die schneeweißen Blüten ganz nah an ihr Gesicht – so nah, dass er weder Mund noch Kinn sehen konnte, nur ihre dunklen Augen leuchteten über die Blüten hinweg zu ihm herüber.
„Erzählen Sie mir alles über England“, wiederholte sie, während sie sich unter den Kissen niederließ wie ein verzogenes Kind, das sich auf eine oft erzählte Lieblingsgeschichte freut.
Armand ärgerte sich darüber, dass de Batz dort saß. Er hätte dieser reizenden kleinen Dame einiges über England erzählen können, wenn nur sein pompöser, dicker Freund den Anstand gehabt hätte zu gehen.
So jedoch fühlte er sich ungewöhnlich schüchtern und unbeholfen, wusste nicht recht, was er sagen sollte – was Mademoiselle Lange offenbar sehr amüsierte.
„Ich mag England sehr“, sagte er schließlich lahm. „Meine Schwester ist mit einem Engländer verheiratet, und ich selbst habe dort meinen festen Wohnsitz genommen.“
„Unter den Emigranten?“ fragte sie nach.
Als Armand darauf nichts erwiderte, war es wieder de Batz, der rasch einsprang:
„Ach, Sie brauchen das nicht zu leugnen, mein guter Armand; Mademoiselle Lange hat viele Freunde unter den Emigranten – nicht wahr, Mademoiselle?“
„Aber gewiss“, entgegnete sie leicht. „Ich habe überall Freunde. Ihre politischen Ansichten bedeuten mir nichts. Artistes, finde ich, sollten mit Politik nichts zu schaffen haben. Sie sehen, Citoyen St. Just, ich habe Sie nicht nach Ihren Ansichten gefragt. Ihr Name und Ihre Verwandtschaft würden Sie als Anhänger von Citoyen Robespierre ausweisen, und doch finde ich Sie in der Gesellschaft von Monsieur de Batz – und Sie sagen mir, dass Sie in England leben.“
„Er ist kein Anhänger von Citoyen Robespierre“, warf de Batz erneut ein. „In Wahrheit, Mademoiselle, darf ich Ihnen wohl verraten, dass mein Freund nur ein einziges Ideal auf dieser Erde kennt, das er auf einen Altar gestellt hat und das er mit der Inbrunst eines Christen für seinen Gott verehrt.“
„Wie romantisch!“, sagte sie und sah Armand gerade an. „Sagen Sie mir, Monsieur, ist Ihr Ideal ein Mann oder eine Frau?“
Sein Blick antwortete ihr, noch ehe er die zwei Worte mutig aussprach: „Eine Frau.“
Sie sog tief den süßen, berauschenden Duft der Narzissen ein, und sein Blick ließ erneut eine Röte über ihre Wangen steigen. De Batz’ gutmütiges Lachen half ihr, diese ungewohnte Verwirrung zu überspielen.
„Das war gut formuliert, Freund Armand“, sagte de Batz mit leichter Stimme. „Aber ich versichere Ihnen, Mademoiselle, dass sein Ideal, ehe ich ihn heute Abend hierher brachte, ein Mann war.“
„Ein Mann!“, rief sie aus, mit einem verächtlichen kleinen Schmollmund. „Und wer war das?“
„Ich kenne keinen anderen Namen für ihn als den einer kleinen, unscheinbaren Blume – Scarlet Pimpernel“, erwiderte de Batz.
„Scarlet Pimpernel!“ rief sie und ließ die Blumen plötzlich fallen, während sie Armand mit großen, staunenden Augen anstarrte. „Und Sie kennen ihn, Monsieur?“
Er runzelte unwillkürlich die Stirn, obwohl er sich im Innersten darüber freute, so nahe bei dieser reizenden jungen Dame zu sitzen und zu fühlen, dass sie sich offenbar für ihn interessierte. Doch war er verärgert über de Batz und ärgerte sich über das, was er für eine Indiskretion hielt. Für ihn war der Name seines Anführers fast heilig; er war einer jener enthusiastischen Verehrer, die ihr Ideal nur mit gesenkter Stimme benennen und nur im Vertrauen gegenüber jenen, die Verständnis und Mitgefühl aufbrächten.
Wieder fühlte er, dass er ihr, wäre er allein mit ihr gewesen, alles hätte erzählen können über den Scarlet Pimpernel, im Wissen, in ihr ein aufmerksames Ohr, ein mitfühlendes, liebendes Herz zu finden – doch so sagte er nur recht lahm: „Ja, Mademoiselle, ich kenne ihn.“
„Sie haben ihn gesehen?“ fragte sie eifrig. „Mit ihm gesprochen?“
„Ja.“
„Oh, erzählen Sie mir alles über ihn! Wissen Sie, viele von uns hier in Frankreich bewundern Ihren Nationalhelden sehr. Wir wissen natürlich, dass er ein Feind unserer Regierung ist – aber, oh! wir fühlen, dass er deshalb kein Feind Frankreichs ist. Wir sind ebenfalls ein Volk der Helden, Monsieur“, fügte sie mit einem hübschen, stolzen Kopfwurf hinzu, „wir wissen Tapferkeit und Klugheit zu schätzen, und wir lieben das Geheimnis, das die Persönlichkeit Ihres Scarlet Pimpernel umgibt. Aber da Sie ihn kennen, Monsieur – wie sieht er aus?“
Armand lächelte wieder. Er überließ sich ganz dem Zauber, der von dieser jungen Frau ausging – von ihrer Fröhlichkeit und Ungezwungenheit, ihrem Enthusiasmus und jenem offenkundigen Künstlertemperament, das jede Empfindung mit leidenschaftlicher Tiefe und voller Intensität durchlebte.
„Wie sieht er aus?“ drängte sie.
„Das, Mademoiselle“, entgegnete er, „darf ich Ihnen nicht sagen.“
„Dürfen nicht!“ rief sie aus. „Aber, Monsieur – wenn ich es Ihnen befehle –“
„Selbst auf die Gefahr hin, für immer in Ungnade bei Ihnen zu fallen, Mademoiselle, würde ich dennoch darüber schweigen.“
Sie sah ihn sichtlich erstaunt an. Es war für diesen Liebling des begeisterten Publikums höchst ungewöhnlich, in einer Laune der Neugier so unverblümt zurückgewiesen zu werden.
„Wie langweilig und pedantisch!“ sagte sie mit einem Schulterzucken und einem missmutigen Schmollmund. „Und, oh! wie ungalant! Sie haben sich hässliche englische Sitten angewöhnt, Monsieur – denn dort, so hört man, achten die Männer ihre Frauen kaum. Sehen Sie da!“, fügte sie mit gespielter Verzweiflung zu de Batz gewandt hinzu, „bin ich nicht eine wahrhaft unglückliche Frau? Zwei Jahre lang mühe ich mich, einen Blick auf diesen interessanten Scarlet Pimpernel zu erhaschen; nun treffe ich Monsieur, der ihn tatsächlich kennt – so sagt er zumindest – und er ist so ungalant, dass er sich weigert, die erste berechtigte Neugier einer Dame zu stillen.“
„Citoyen St. Just wird Ihnen jetzt nichts verraten, Mademoiselle“, warf de Batz mit einem gutmütigen Lachen ein. „Es ist meine Anwesenheit, versichere ich Ihnen, die ihm das Siegel auf die Lippen legt. Er brennt darauf, sich Ihnen anzuvertrauen, Ihre Begeisterung zu teilen und Ihre schönen Augen leuchten zu sehen, wenn er Ihnen die Taten jenes Fürsten unter den Helden schildert. En tête-à-tête, eines Tages, werden Sie meinem diskreten Freund Armand jedes Geheimnis entreißen.“
Mademoiselle gab darauf keine Antwort – zumindest keine hörbare – sondern vergrub für einige Sekunden ihr ganzes Gesicht in den Blumen, und Armand erhaschte zwischen den Blüten einen Blick auf ein Paar sehr lebhafter brauner Augen, die ihn fragend anstrahlten.
Sie sprach zunächst nicht weiter vom Scarlet Pimpernel oder von England, sondern lenkte das Gespräch bald auf unverfänglichere Themen: das Wetter, die Lebensmittelpreise, die Unannehmlichkeiten ihres Haushalts seit der Gleichstellung der Dienerschaft mit den Herrschaften.
Armand merkte bald, dass die brennenden Fragen der Zeit, die Schrecken der Massenmorde, das wogende Chaos der Politik dieses junge Mädchen noch kaum berührt hatten. Sie hatte sich nicht viele Gedanken gemacht über das soziale und humanitäre Elend der tobenden Revolution. Sie wollte darüber auch nicht nachdenken. Als Künstlerin bis in die Fingerspitzen lebte sie ganz in ihrer Arbeit, strebte nach Vollkommenheit in ihrer Kunst, versenkte sich tagsüber in ihr Studium und lebte abends in der Verwirklichung dessen, was sie gelernt hatte.
Die Schrecken der Guillotine bewegten sie – aber noch nur vage. Sie hatte nicht begriffen, dass auch sie in Gefahr geraten konnte, während sie für das ästhetische Vergnügen des Publikums arbeitete.
Es war nicht so, dass sie nicht verstand, was um sie geschah – vielmehr hielten sie ihr Temperament und ihr Umfeld davon ab, es wirklich an sich heranzulassen. Die Gräuel der Place de la Révolution ließen sie erschauern – doch nur wie die Tragödien Racines oder des Sophokles, die sie studiert hatte. Für die arme Königin Marie Antoinette empfand sie ebenso Mitgefühl wie für Maria Stuart, und für König Louis weinte sie so viele Tränen wie für Polyeucte.
Einmal erwähnte de Batz den Dauphin, doch Mademoiselle hob rasch die Hand und sagte mit bebender Stimme, während sich Tränen in ihren Augen sammelten: