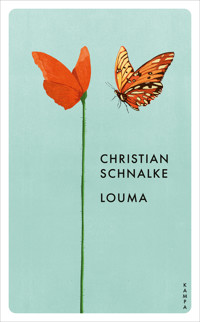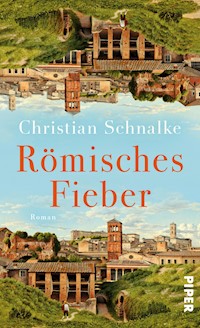9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein unschuldig zum Tode Verurteilter ermittelt gegen bandenmäßige venezianische Kunsträuber und -fälscher Nach dem napoleonischen Kunstraub wurden viele bedeutende Werke nicht zurückerstattet, sondern gestohlen, um in Venedig kopiert und verkauft zu werden. Franz Wercker, vom Vatikan unschuldig zum Tode verurteilt, wird nur begnadigt, wenn er die Kunstfälscher von Venedig fasst. Er gibt sich als Kunsthändler aus und dringt mit Hilfe der jungen Malerin Irma in die einschlägigen Kreise vor, bis ein Attentat auf ihn verübt wird. Kann Irma ihr Geheimnis bewahren und ihm trotzdem beistehen? Ein mitreißender, kluger und empfindsamer Roman über den Zauber der Kunst und die Macht der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnan, Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
Prolog
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
II.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Epilog
Dank
Für Daniela
Die Deutschen thun nicht viel, aber sie schreiben desto mehr. Wenn dereinst ein Bürger der kommenden Jahrhunderte auf den gegenwärtigen Zeitpunkt der deutschen Geschichte zurückblickt, so werden ihm mehr Bücher als Menschen vorkommen. (…) Er wird sagen, wir haben geschlafen und in Büchern geträumt.
Wolfgang Menzel, 1828
»Eiskalt ist er«, flüsterte Olivia.
»Tot ist er! Wo willst du hin mit ihm?«, zischte der Kleine.
»Er ist nicht tot! Er lebt!« Mattia gab nicht auf. »Weiter! Schnell! Bevor sie merken, dass wir ihn haben!«
Sie trugen ihn zu zwölft. Zwölf Kinder. Im Licht des Mondes, wenn sie aus dem tiefschwarzen Schatten eines der verfallenden Palazzi herauskamen, sahen sie aus wie ein wunderliches Fabelwesen: Lang hingestreckt, mit hängendem Kopf der Mann, die leblosen Augen und der Mund offen. Sein Körper schlängelte sich auf zwei Dutzend Beinchen vorwärts. Die verwirrend vielen nackten Füße trippelten nahezu ohne Geräusch.
»Wir müssen ihn zum Geschichtenerzähler bringen«, flüsterte Olivia. »Wenn ihn einer retten kann, dann er.«
»Niemand kann ihn retten. Einen Toten rettet keiner. Nicht einmal der Dottore.« Der kleine Rolando trug den Arm des Deutschen. Er fühlte die eiskalte Haut seiner Hand. Er wusste, wann einer tot ist. Im letzten Winter erst hatte er neben seiner toten Mutter gesessen. Und als sie den Fischer am Strand gefunden hatten, war der genauso kalt gewesen.
»Zu weit!« Mattia stöhnte, weil er die blutende Brust umklammerte und die Hauptlast trug. Er zitterte vor Kälte. Der Nachtwind biss ihm unter die nassen Kleider und die tropfnassen Haare. Mattia war ins Wasser gesprungen, nachdem sie das Aufschlagen des Körpers im Kanal gehört hatten. Er war wieder und wieder in der völligen Dunkelheit getaucht, bis er im weichen Grundschlamm endlich den Körper gefühlt hatte. Beinahe hätte er es nicht geschafft, ihn zur Oberfläche zu ziehen, doch dann hatten sich ihm all die Hände entgegengereckt, die ihn heraushoben, als ob er selber tot wäre und zum Himmel schwebte. Unter Wasser war es nicht so kalt gewesen. Im Wind war es schlimm. »Das schafft er nicht. Wir bringen ihn zu der Malerin. Sie ist seine Freundin, das weiß ich. Sie wird ihn nicht verraten. Rolando, du läufst zum Geschichtenerzähler. Du bist der Schnellste. Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Bring ihn zu ihr. Lauf, bevor es zu spät ist.«
Die letzten Worte hörte der Kleine schon nicht mehr. Er rannte nicht nur schnell, er begriff auch schnell. Und sobald er begriffen hatte, was von ihm verlangt wurde, hatte er die Hand losgelassen und war auf und davon.
Mattia wusste, dass er sich auf Rolando verlassen konnte. Obwohl in der Wirrnis der stockdunklen Gassen kein Licht brannte, von den Kerzen an einem Marienaltar hier und da abgesehen, würde der Kleine an keiner Abzweigung zögern.
Der Körper des Mannes schlängelte sich lautlos weiter. Er blutete aus der Brust, wo sie ihn erdolcht hatten, und er blutete aus dem Kopf, wo er auf dem Boot aufgeschlagen war. Keines der Kinder glaubte, dass es Zweck hatte. Aber sie wollten nicht aufgeben. Jedes einzelne wollte ihm zurückgeben, was er ihnen Gutes getan hatte.
I.
1
In eine andere Zeit
Venetien, 1. Oktober 1818
Franz Wercker wurde durch einen Stoß ins Kreuz aus dem Schlaf gerissen. Die Kutsche war durch ein besonders tiefes der unzähligen Schlaglöcher gepoltert, und nur durch ein Wunder war das Rad nicht gebrochen. Franz sah aus dem Fenster. Die Fahrt ging durch eine ebene Landschaft, die keinerlei Ausblicke bot, ein ermüdendes Einerlei von Weizen und Reis. Das Meer konnte Franz noch nicht sehen, nur überflutete Felder, in denen sich der Sonnenuntergang spiegelte. Und in der Dämmerung einen schmalen Fluss, der reglos im Schatten hoher Akazien lag. Die Brenta – oder, wie die Deutschen sie nannten, die Brandau.
Es war dunkel, als die Kutsche endlich hielt. Die Piazza, auf die Franz trat, war nur spärlich beleuchtet und spiegelte in keiner Weise ihre Bedeutung als Eingangstor Venedigs wider. Es war für die Seefahrerstadt eher die Hintertür. Schlichte Häuser mit geschlossenen Fensterläden umstanden das Ufer der müden Brenta, und die einzige Betriebsamkeit spielte sich am Wasser ab. Mehrere Gondeln warteten, während die Barcarioli auf den Stufen saßen, die zum Fluss hinabführten, Wein tranken und mit fliegenden Händen Morra spielten. Trotz der späten Stunde wurde im Schein einiger Fackeln noch ein Lastensegler beladen. Vernagelte Kisten wurden an Bord geschafft – die kleineren von je zwei Männern getragen, einige größere hob ein hölzerner Kran hinüber. Die Arbeiter, grimmige Gestalten, die für die Dunkelheit geschaffen schienen, verrichteten ihren Dienst schweigend. Ein Vorarbeiter oder Lademeister mit einem runden Hut stand auf der Mole und verfolgte jede Bewegung mit argwöhnischen Blicken aus seltsam grünen Augen. Die Hosenbeine seines Anzuges waren zu kurz und ließen scharfkantige braun gebrannte Knöchel sehen. Er hielt eine Fackel, mit der er ungeduldig gestikulierte.
»Signor di Stargard?«
Franz beachtete die Stimme zunächst nicht. Er hatte sich noch nicht an den Klang seines Namens gewöhnt. Erst als die Anrede wiederholt wurde, begriff Franz, dass er gemeint war, und wandte sich um. Vor ihm stand ein Junge, barfüßig, in eine schmutzige Hose und ein reines weißes Hemd gekleidet. Er drehte schüchtern eine Mütze in der Hand und verbeugte sich. »Gondola!« Er wies auf die Stufen, wo ein schlohweißer Barcariol neben seiner schwarzen Gondel wartete, und fügte hinzu: »Mi prendo il tuo bagaglio.«
Franz wollte gleich selber anpacken, doch ein vornehmer Herr trägt seine Koffer natürlich nicht, und so sah er mitleidig zu, wie der Junge seine drei großen, neuen und mit einem kleinen Wappen der Familie Stargard bemalten Koffer tapfer alleine schleppte. Die Besitztümer seines alten Lebens hätte er sich mit Leichtigkeit über die Schulter werfen können, aber vor der Abreise aus Rom hatte Franz sich bei einem Schneider großzügig eingekleidet, Schuhe anfertigen lassen, Hüte gekauft und dazu eine Unzahl Toilettenartikel, die einer Fürstin zur Ehre gereicht hätten.
Franz wurde von einem lauten Krach aus seinen Gedanken gerissen, als eine große, längliche Holzkiste aus der Schlinge rutschte, an der sie vom Ausleger des Kranes baumelte. Die Arbeiter schrien erschrocken auf. Der Lademeister mit dem runden Hut hörte gar nicht mehr auf, die Männer anzubrüllen. Einige Bretter wurden durch die Wucht des Aufpralls aufgehebelt, und aus der Öffnung quoll Stroh auf das Straßenpflaster. Aus dem Stroh aber ragte deutlich sichtbar eine bleiche Frauenhand hervor.
Franz erstarrte: Die Hand bewegte sich!
Der Lademeister kam herbeigelaufen und leuchtete mit seiner Fackel in die Kiste, wobei er achtgab, das Stroh nicht zu entzünden. Im hellen Feuerschein erkannte Franz schließlich seinen Irrtum: Es war nur eine Statue! Deutlich war das Glitzern des weißen Marmors zu sehen. Die Illusion der Bewegung war durch das flackernde Licht hervorgerufen worden. Der Lademeister blickte sich nach allen Seiten um. Als er sah, dass er beobachtet wurde, musterte er Franz misstrauisch aus seinen grünen Augen, die in eigentümlichem Kontrast zu seiner sonnengebräunten Haut standen. Er legte seine Fackel aufs Pflaster, stopfte das Stroh wieder in die Kiste und befestigte die losen Bretter, aus denen die spitzen Nägel herausragten, mit Fußtritten. Schließlich winkte er einige Arbeiter heran, die die große Kiste mit vereinten Kräften zu den übrigen wuchteten.
Als Franz die schwankende Gondel betrat, begrüßte ihn der weißhaarige Barcariol nicht, sondern blickte ihn nur grimmig an. Dafür nickte das hoch geschwungene silberne Bugeisen zur Begrüßung.
Ein wahrer Charon, dachte Franz, als er sich in die weichen Polster setzte. Ich hoffe, er rudert mich nicht in die Unterwelt … Der Bootsjunge stieß die Barke ab und kletterte vor zum Bug, wo er sich mit einer trübe leuchtenden Laterne hinhockte. Der Nebel über dem offenen Wasser war schwer und dicht geworden, sodass die Mole und die Häuser schnell unsichtbar wurden. Im wolkigen Dunst, der bedrückend leblos über dem Wasser hing, glitten sie durch verwirrende Flüsse, vorbei an Bäumen, die im Wasser wurzelten und die blass im Schimmer der Laterne auftauchten, um sich dann wieder im Dunkel aufzulösen. Geisterhaft zog hartblättriges Gebüsch an ihnen vorbei, dann nur noch mannshohe starre Halme, und schließlich verlor sich alles Sichtbare. Lautlos glitt das Boot über die Lagune, nur das Plätschern des Ruders war zu hören. Bleischwer und schwarz lag das Wasser unter ihnen, und die Laterne des Jungen beleuchtete um sie herum nur milchigen Nebel.
Niemand sprach ein Wort. Der Alte ruderte mit ruhigen Bewegungen, und der Junge spähte voraus. Franz drückte die gespannte Erwartung aufs Gemüt, und er saß reglos in seinen weichen Polstern. Er hatte sich auf den ersten Anblick Venedigs gefreut, auf die sagenhafte Silhouette, die sich mit Dutzenden von Kirchtürmen und Kuppeln aus dem strahlenden Meer erhob. Doch in der Dunkelheit und umhüllt von Nebel war nichts zu sehen. Ob es noch weit zur Stadt war? Ob sie schon fast angekommen waren? Unmöglich zu sagen. Sosehr Franz die Augen auch anstrengte, er erkannte nichts.
Irgendwann sagte der Junge etwas. Ein gedämpft gesprochenes Wort, bei dem er sich umwandte und die Laterne höher hob. Franz folgte seinem Blick, der nach hinten ging, von wo sie gekommen waren und wo die geübten Ohren des Jungen irgendein Geräusch aufgefangen hatten. Ein fahles Licht glomm auf, das langsam klarer wurde. Darunter verdichtete sich das eintönige Grau des Nebels zu einem länglichen Schatten, und eine Gondel nahm Gestalt an. Sie war größer als die ihre, vorne und hinten standen je zwei Ruderer, und in der Mitte war ein Baldachin aufgesetzt, dessen geschwungenes Dach sich zu einer Krone erhob. Das Boot glitt schemenhaft und still an ihnen vorbei, die Ruderer blickten nicht herüber. Unter dem Baldachin saß in würdevoller Gelassenheit eine Dame. Die reichen Falten ihres Mantels und ihres schimmernden Kleides schienen einem Gemälde zu entstammen. Auf ihrem Hut zitterten Fasanenfedern im sanften Fahrtwind, und ihre Hand, die in einem seidenen Handschuh steckte, lag elegant auf dem glänzenden Lack der Reling. Ihr Gesicht war hinter einem Schleier mit feinem Strich angedeutet, als habe der Künstler dieses Gemäldes vermieden, ihre Schönheit direkt darzustellen, und ihre Vollendung der Sehnsucht des Betrachters überlassen.
Während das Boot an ihnen vorbeiglitt, wandte die Dame den Kopf und blickte Franz aus müden Augen an. Sie war auf eine bedrückende Art schön. Eine Schönheit, die aus alter Zeit überliefert schien.
Sie wandte den Blick wieder ab, und Franz sah nur noch ihr edles Profil, bevor ihr Boot im Nebel verschwand. Die Formen lösten sich auf, und sie waren wieder vollkommen allein auf dem Wasser. Der Alte hatte im Rudern innegehalten und brauchte eine Weile, bis er seinen alten Rhythmus wieder aufnahm. Immer noch sprach niemand ein Wort.
Und dann begannen erste gelbe Lichter durch den Nebel zu glimmen, und riesenhaft erschien in ihrer schwarzen Pracht die Serenissima. Kuppeln wölbten sich auf, Türme reckten sich aus dem Dunst, das gewaltige Geisterschiff einer Kirche schob sich heran, und die unzähligen Kanten, Ecken und Winkel der Wohnhäuser drängten sich in ihrem Schutz. Die Gondel näherte sich auf bedrohlichem Kollisionskurs dem Gewirr der Mauern, bis sich vor ihnen eine Schlucht auftat und sich Häuser an ihnen vorbeischoben, deren Fenster sämtlich dunkel waren. Wenn nicht vereinzelt Wäsche vor den Fenstern hing oder Blumen in einem kleinen Kasten wuchsen, war es unmöglich zu sagen, ob überhaupt eine lebende Seele darin wohnte. Plätze und Gärten lagen öde im diffusen Mondlicht.
Sie glitten unter einer Brücke hindurch, wo der Barcariol im Rudern innehielt, sodass nicht einmal mehr sein Plätschern zu hören war. Für einen verstörenden Moment waren Stille und Finsternis vollkommen. Als sie in den großen Kanal einbogen, wies der Bootsjunge mit seinem dünnen Arm nach vorne. »Palazzo Peldrini«, flüsterte er. Eine Ruine erhob sich aus dem kriechenden Nebel. Durch die Fensterhöhlen des verfallenen Baus war der Nachthimmel zu sehen, und ein Balken des eingestürzten Daches ragte hervor. Das reich geschnitzte Eingangstor zum Kanal hin war mit rohen Brettern vernagelt und die Stufen bedeckte Unrat.
All die verlassenen Plätze und Häuser, sein archaisches Fortbewegungsmittel, das völlige Fehlen von Wagen – nicht einmal Licht brannte irgendwo! –, und jetzt sollte er sogar in einem längst verfallenen Palazzo wohnen? Er war in eine andere Zeit geglitten. Vielleicht beim Durchfahren des dichten Nebels in der Lagune?
Doch dann erkannte Franz, dass der Junge den Palazzo nebenan meinte, der nur durch einen schmalen Kanal von der Ruine getrennt war. Auf der Fassade war ein Mosaik angebracht, das eine goldene Sonne und einen silbernen Mond zeigte und im Licht einer Laterne an den Eingangsstufen glitzerte. In einigen der spitzen byzantinischen Fenster schimmerte Licht, und ein Flügel des Tors stand offen.
Als der Barcariol einen fremdartigen Ruf ausstieß und der Junge von der schaukelnden Gondel auf die Stufen sprang, kam eine Frau in weißer Bluse und dunklem Rock heraus. Sie hielt eine Laterne, die ein freundliches Gesicht beleuchtete.
2
Blätter im Winde
Aus dem Vulkan steigt eine feine Rauchfahne in den klaren Himmel empor. Sie erhebt sich ins Blau und treibt erst hoch oben vom Meer weg ins Landesinnere. Franz tritt durch die offen stehende Terrassentür aus dem Haus, wobei er sich die gelbe Weste zuknöpft, und bleibt gerührt stehen: Im Garten, zwischen Palmen, Akazien und violett blühenden Artischocken, sitzt Clara in ihrem hellblauen Kleid, den Strohhut zum Schutz gegen die Sonne auf dem blonden Haar, vor ihrer Staffelei – in der anmutigen Haltung, die er schon so oft bewundert hat. Sie malt die Dächer der bergab stehenden Häuser, die weite Bucht mit der dunstigen Stadt, den Palästen und den übers Land verstreuten Höfen und mit reichem Blau das endlose Meer. Auf einem der Dächer sind junge Frauen damit beschäftigt, Blumen zum Trocknen auszulegen. Ihre weißen Blusen strahlen, und ihre bunten Röcke schwingen so leicht wie ihr Plaudern und Lachen.
Franz findet nicht lange Muße, die Szene zu genießen, denn der alte Grimsel kommt auf ihn zugesprungen, um ihn zu begrüßen. Er hat in Claras Nähe im Schatten gelegen, wie er das jeden Tag zu tun pflegt. Dabei schien er zu schlafen, doch das lebendige Spiel seiner Augenbrauen verriet, dass er jede Bewegung Claras wahrnahm. Franz krault das helle Fell des Hundes und erwehrt sich seines treuherzigen Ansturms. Clara sieht zu ihnen herüber und lächelt. »Franz! Hast du deinen Mittagsschlaf beendet?«
»Mittagsschlaf? Ich habe zwei Stunden geschrieben!«
»Liest du es mir nach dem Abendessen vor?«
»Natürlich! Du wirst staunen, welche Wendung die Geschichte nimmt. Der Geheimbund stellt sich heraus als …«
»Still! Wirst du wohl nichts verraten!«
»Entschuldige, ich bin immer selber so …«
Als Franz mitten im Satz erwachte, versuchte er, noch einmal einzunicken, um weiterzuträumen, doch es gelang ihm nicht. Wie knüpft man an einen Traum an, fragte er sich. Ob man diese Kunst beherrschen kann? Natürlich, er lächelte. Man nennt sie Lesen: Wenn du ein Buch wieder aufschlägst, träumst du genau da weiter, wo du zuvor aufgehört hast …
Die Sonne strahlte hell ins Zimmer. Er versank in der Matratze und fühlte weiche Laken auf der Haut. Zum ersten Mal seit Wochen hatte er tief und fest geschlafen, und zum ersten Mal in seinem Leben erwachte er als ein wohlhabender Mann. Die Kassetten der Zimmerdecke über ihm waren mit goldenen Tieren geschmückt. Das Gold blätterte ab, doch er erkannte einen Falken, einen Löwen, einen Elefanten, Hirsche und einen Pfau. Er lag unter einem Himmel aus Tieren.
Franz stand auf, zog seinen neuen Morgenmantel an und trat ans Fenster, das aus einer Vielzahl bunter Glasscheiben bestand. Als er es öffnete, war die Geisterstadt der vorigen Nacht verschwunden. In der Morgensonne glitzerte ein breiter Kanal, als bestünde er aus flüssigem Silber. Boote und Schiffe glitten aneinander vorbei, beladen mit Obstkörben, Fässern, Kisten und Stoffballen. Franz sah eines mit gestapelten Stühlen und Sesseln, ein anderes mit Heu, in einer der vielen schwarzen Gondeln saß eine Schar junger Frauen, die herzlich lachte, als eine andere Gondel mit drei jungen Männern nah an ihr vorbeifuhr und einer der Männer eine Blume hinüberwarf. Eine andere Gondel transportierte drei Nonnen, die verstohlen hinübersahen, und in einer weiteren standen auf wackeligen Beinen fünf Ziegen, die argwöhnisch übers Wasser blickten und von einer Handvoll Heu fraßen. Als sie von einem Hund angebellt wurden, der steil aufgerichtet im Bug eines Ruderbootes stand, blökten sie frech zurück.
Die Häuser am großen Kanal ragten aus den Wellen, doch in den Seitenflüssen sah Franz steinerne Gehwege und Kais, auf denen reges Treiben herrschte. Von Booten aus wurde Gemüse und Fisch verkauft, Bettler reckten den Vorübergehenden bittende Hände entgegen, eine Frau stillte, auf einem Stuhl sitzend, ihren Säugling, und ein alter Mann schimpfte aus einem Fenster mit einem Jungen, der ein großes Papier mit einer aufgedruckten Bekanntmachung an seine Hauswand klebte. In einem schattigen Winkel sah Franz einen Straßenjungen auf den Schultern zweier Kameraden stehen und sich nach einem Zweig mit Pomeranzen recken, der über die Mauer eines Gärtchens wuchs.
Franz brauchte nicht lange, um sich anzuziehen, und stieg die hölzerne Treppe hinab, wobei er von den strengen Ahnen beäugt wurde, die in langer Folge diesen Palast bewohnt hatten und deren Geist in Öl gemalt die Zeiten überdauerte. Ob ihr Leben so formvollendet und würdig verlaufen war wie die Pose, die sie für den Maler eingenommen hatten? Ob sie im Leben mehr gelacht hatten als auf ihren ernsten Gemälden?
Als er im prächtigen Mittelgeschoss ankam, im Piano Nobile, wie ihm Signora Donati am Vorabend beim Heraufkommen erklärt hatte, trat die Haushälterin gerade aus einer der hohen Türen.
»Buon giorno, Signor von Stargard«, sagte sie mit einem höflichen Knicks und einem freundlichen Lächeln. Das von sprach sie mit einer angenehmen Weichheit aus – won Stargard. »Haben Sie gut geschlafen?«
»Buon giorno, Signora Donati. Wie ein Säugling an der Mutterbrust«, erwiderte Franz.
Die Signora hatte ihm am Abend nach seiner Ankunft in einem Musikzimmer, in dem ein Cembalo, eine Harfe und Notenständer standen und in einem Schrank mit gläsernen Türen mehrere Violinen lagen, ein kaltes Abendessen vorbereitet. Während er aß, war sie bei ihm stehen geblieben und hatte sich nach seiner Reise erkundigt, und anschließend hatte sie ihn gleich in sein Schlafzimmer geführt. Nun zeigte sie ihm den gesamten Palazzo. Das unterste Geschoss, das nur wenige Stufen über der Wasserfläche lag, bestand aus einem breiten Mittelgang, der auf eine marmorne Treppe zuführte. Rechts und links lagen hinter geschlossenen Türen leere Lagerräume und ein Kontor mit Stehpulten, Tischen und Schränken. Über die Treppe stieg man nach oben ins Piano Nobile und gelangte durch eine Halle mit rotem Teppich, Kronleuchter und Ahnengemälden in den Portego.
Der Prunksaal, in dem vor allem ein riesiger Tisch mit einer Unzahl von Stühlen stand, wirkte aufgrund seiner Größe kahl und unbewohnt. Auch hier hingen an den Wänden Ahnen, die Franz aus ihren Gemälden heraus streng anblickten. Durch eine Flügeltür gingen sie ins Musikzimmer, das mit großen Fenstern nach vorne zum Canal Grande hinausblickte. Signora Donati führte Franz hinaus auf eine Loggia, von der aus man einen herrlichen Blick über das Treiben des Kanals hatte. »Dort drüben wohnt Lord Byron«, sagte sie und wies auf einen Palazzo schräg gegenüber.
Durch das Jagdzimmer, dessen Wände mit waidmännischen Szenen und Stillleben voller erlegter Fasane und Hasen dekoriert waren und in dem ein großer Schreibtisch stand, gelangten sie wieder ins Treppenhaus und stiegen die Stufen zum oberen Stockwerk hinauf, wo sich neben mehreren unbenutzten Zimmern auch Franz’ Schlafzimmer befand. Signora Donati schlief noch ein Stockwerk darüber unterm Dach im Mezzanin.
Auch das Frühstück hatte die Signora im Musikzimmer gedeckt. Die weit geöffneten Fenster ließen das Sonnenlicht einströmen. Franz genoss den stark duftenden Kaffee und freute sich über die Höflichkeit der Signora, die ihm zur Begrüßung ein deutsches Frühstück servierte, bestehend aus den Speisen, die sie den Österreichern abgeschaut hatte: Strudel, Schmarren, Würstel, Speck und sogar eingelegte Zwetschgen. Außer den hohen Fenstern, die auf den Kanal hinausblickten, gab es noch ein weiteres zur Seite hin. Dort stand, nur getrennt durch einen schmalen Nebenkanal, die Ruine, die Franz am Vorabend gesehen hatte. Einige wenige Fensteröffnungen ohne Holzrahmen und Glas gaben eine Ahnung vom Inneren des verlassenen Palazzos. Das Dach fehlte gänzlich, und die Zwischenböden waren – wohl infolge eines Brandes – teilweise eingestürzt. Verwitterte Balken ragten kreuz und quer in die Höhe. Gestrüpp wuchs durch die Fensteröffnungen heraus, und die Loggia zum Canal Grande hin war von allerlei zähem Grün überwuchert. Als Franz am Fenster stand, sah er, wie ein Falke in die Schlucht zwischen den beiden Häusern schwebte, an einem Mauervorsprung gegenüber landete und in einer Öffnung zwischen den verrotteten Ziegeln verschwand.
»Guten Morgen!« Franz grüßte mit seiner Tasse hinauf. »Ich bin dein neuer Nachbar!«
Für einen kurzen Moment sah er den gebogenen Schnabel mit dem kleinen Falkenzahn auftauchen. Doch der Vogel missachtete Franz mit ernstem Blick und verschwand wieder.
»Trotzdem auf gute Nachbarschaft …«, sagte Franz, und nachdem er den Kaffee bis auf den bitteren Satz ausgetrunken hatte, öffnete er eine Reisekiste, die er nicht in sein Schlafzimmer, sondern hier in den Salon zu bringen angewiesen hatte. Er nahm einige Bücher heraus, die er zunächst auf den Tisch legte, und eine kleine Schachtel. Darin lag, eingeschlagen in Seidenpapier, ein Stapel Besuchskarten. In sauberer, klarer Schrift war darauf gedruckt: Robert von Stargard. Und in der Zeile darunter: Kunsthändler.
Den Namen anzunehmen war nicht schwer. Man musste es nur behaupten. Und sich daran gewöhnen. Aber Kunsthändler? Wie wird man ein vorgetäuschter Kunsthändler? Das Geld allein, das ihm zur Verfügung stand, machte ihn noch lange nicht dazu. Und das wenige, das er über Kunst wusste, erst recht nicht.
Franz sah in der Reisekiste eine Zeichenmappe aus marmorierter Pappe und nahm auch sie heraus. Er löste die Schleife und klappte die Mappe auf. Auf einigen Blättern lag als oberstes das Porträt einer jungen Frau, die den Betrachter ruhig und freundlich ansah. Mit feinen Bleistiftlinien gezeichnet und unterschrieben von Carl Fohr.
Clara.
Wie schön sie war! Franz unterdrückte den Drang, mit den Fingerspitzen über ihr gezeichnetes blondes Haar zu streichen, um die Bleistiftlinien nicht zu verwischen.
Sie schaute so zuversichtlich. Fohr hatte sogar den Glanz ihrer Augen wiedergegeben. Franz meinte, jeden Moment würde sie lächeln.
In der Mappe lagen noch gut zwei Dutzend weitere Zeichnungen. Franz nahm sie vorsichtig heraus und schaute sie langsam durch. Römische Motive, gegenseitige Porträts junger Künstler, Landschaften mit Bergdörfern wie Olevano, Frascati oder Perugia, der Nemisee, die Wasserfälle von Tivoli. Franz erinnerte sich an die Wanderungen und ruhigen Nachmittage mit Georg, mit Wilhelm Müller, mit Philipp Veit – mit Clara.
Franz beschloss, dieses fremde Haus, in dem er von nun an bis Karneval leben sollte, in sein eigenes zu verwandeln, indem er diese Zeichnungen mit den schönen Erinnerungen aufhängte. Er würde sich von Signora Donati Oblaten besorgen lassen, um sie an die Wand zu heften. Das Bildnis von Clara aber wollte er rahmen lassen. Das erste Geld von seinem neuen Wohlstand würde er für den Rahmen ausgeben.
Signora Donati wollte Franz gleich eine Gondel rufen, doch er bestand darauf, den Palazzo durch den gassenseitigen Eingang zu verlassen und zu Fuß zu gehen. Die Signora warnte ihn zwar, dass er sich als Fremder unweigerlich im Gewirr der Gassen verlaufen müsse, aber das war ihm gleichgültig. Und als sie ihn aus der Tür ließ und Franz, die Mappe mit Claras Porträtzeichnung unter dem Arm, den Fuß zum ersten Mal auf venezianisches Pflaster setzte, genoss er schon das.
Signora Donati sah ihm nach, während er die menschenleere Gasse entlangging und links abbog. Sie seufzte, denn sie wusste, dass dies eine Sackgasse war, die am Kanal endete. Und richtig, einen Moment später tauchte er wieder auf und wandte sich in die andere Richtung. Signora Donati überlegte, ob sie einen Jungen herbeirufen sollte, der ihrem neuen Herrn für eine kleine Belohnung folgte und auf ihn achtgab. Doch sie entschied sich, lieber später, wenn sie einkaufen ging, in Santa Maria dei Miracoli eine Kerze für ihn anzuzünden. Bei den Jungen wusste man nie, ob sie ihre Belohnung in der nächsten Bäckerei ausgaben und ihren Auftrag vergaßen. Auf die Jungfrau war Verlass.
Franz war überrascht, wie viel Deutsches ihm begegnete. Man konnte kaum zweimal abbiegen, ohne eine österreichische Uniform zu sehen, immer wieder hörte er im Vorbeigehen deutsche Worte oder sah an Geschäften und Werkstätten deutsche Namen. Allein drei deutsch geführte Buchläden fielen ihm auf. Und so dauerte es auch nicht lange, bis er auf das Schaufenster mit goldenen und hölzernen Bilderrahmen stieß. Über der Tür hing ein Schild mit der Aufschrift: Heinrich Zwirner, Rahmenmacher.
Als Franz den Laden betrat, roch es angenehm nach Holz und Leim. In Regalen lagen Leisten und Gipsdekorationen und auf dem Arbeitstisch unzählige Scheren, Messer, Pinsel, Stifte, Flaschen und Gläser. Heinrich Zwirner brachte gerade ein Blättchen Gold, an einem Pinsel haftend, auf einen Rahmen auf. Er war ein älterer Mann mit einer Nickelbrille, und hinter seinem Ohr klemmte ein spitzer Bleistift. »Einen Moment, bitte. Ich muss das hier nur kurz …« Den Rest des Satzes vergaß er, während er das hauchdünne Gold glatt pinselte. »So«, sagte er und stand auf. »Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Sind Sie Maler?«
Offenbar erkannte der Rahmenmacher in Franz den Deutschen. »Nein«, erwiderte Franz. »Ich bin Kunsthändler.« Er hatte sich vorgenommen, das bei jeder sich bietenden Gelegenheit fallen zu lassen, damit sich sein Ruf als Kunsthändler bis in die Kreise verbreitete, auf die er es abgesehen hatte.
»So! Ein Kunsthändler! Das wird nicht jeden freuen …«
»Nein?«
»Nein. Venedig ist bald leer gekauft. Jedenfalls was die alten Meister anbelangt. Und die Jungen verhungern, weil sie angeblich unverkäuflich sind.«
»Dann wird es Sie sicher freuen, wenn ich Ihnen eine Zeichnung eines jungen Künstlers zum Rahmen bringe.« Er nahm das Porträt aus der Mappe und legte es behutsam auf den Arbeitstisch.
Zwirner betrachtete es und nickte anerkennend. »Ein schönes Blatt«, urteilte er. »Ein sehr begabter Mann, ich bin sicher, aus dem wird etwas werden.«
»Leider nein«, entgegnete Franz. »Er ist verstorben.«
»Das tut mir leid zu hören. Gegen Napoleon gefallen?«
»Nein, ein Unfall.«
Nachdem Franz schlichte Rahmenleisten ausgesucht hatte, die zum Charakter der Zeichnung passten, versprach Zwirner, das gerahmte Bild am nächsten Tag zu liefern.
»Und verzeihen Sie, was ich über die Kunsthändler gesagt habe. Es ist nur, was ich gelegentlich höre.«
»Schon gut«, erwiderte Franz. »Ich verspreche, mich auch um die Jungen zu kümmern.«
Franz trat aus der schmalen Gasse heraus. Zwischen den Häusern war es schattig und still gewesen. Auf der Ufermole dagegen wehte ihm ein freundlicher Wind entgegen, und er musste die Augen gegen das blendende Sonnenlicht mit der Hand beschirmen. Sein Blick ging frei über die offene Lagune. Er sah die weite Wasserfläche und den endlosen Himmel, der an diesem Tag hell und blass war. Nur am Horizont, in unbestimmter Ferne, türmten sich weiße Wolken. Das Wasser war dunkel und schwer, und die Segelboote zogen ruhig darüber hinweg. Auf der Ufermole herrschte einiges Leben. Es waren fast nur Frauen, die hier unterwegs waren. Sie trugen Körbe mit Früchten, in Tücher eingeschlagene Brote oder Eimer aus Blech voller Wasser, das sie aus einer Zisterne geholt hatten. Franz beobachtete eine junge Frau, die ihren leinenen weißen Überrock, der den Venezianerinnen als Schürze diente und ebenso als Schutz vor Regen oder Wind, mit beiden Armen spielerisch über ihren Kopf hob, sodass er sich einem Segel gleich mit Wind füllte. Auf dem Pflaster lag hier und da eine Decke ausgebreitet, auf der ein nacktes Kind mit einem Spielzeug saß. Gleich neben Franz saß ein Knabe, der ihm vertrauensvoll ein Stück Stoff hinhielt, das zu einer Art Puppe geknotet war. Vor einigen der Häuser, deren Türen und Fenster zum offenen Wasser hinausgingen, saßen Frauen, die Gemüse putzten oder mit Näharbeiten beschäftigt waren.
Plötzlich wurde die friedliche Szenerie durch einen spitzen Schrei gestört. Alles schaute auf, sogar die Kleinkinder, Franz fuhr herum und sah eine Wolke aus weißen Papieren über die Mole wehen. Sie stoben in einem Windwirbel, der sich im Winkel einer Kirche gebildet hatte, hoch auf, tanzten in der Luft herum und über die Kante der Mole hinaus übers Wasser. Inmitten der umherwehenden Papiere jagte eine junge Frau – eine aufgeklappte Zeichenmappe in der Hand – den Blättern nach. Zwei oder drei hatte sie bereits wieder eingefangen, doch wann immer sie ein weiteres greifen wollte, schlüpfte es ihr, auf einem Windstoß reitend, durch die Finger. Sie blitzten hell auf, wenn sie in die Sonne wirbelten, zeigten ihren dunkleren Bauch, und sobald eines dem Boden näherkam, fand es einen neuen Luftstrom, schwang sich darauf und stob wieder empor.
Die junge Frau war keine Venezianerin. Sie hatte zwar dunkle Haare und eher helle Haut wie die meisten Hiesigen, aber ihr dunkles Kleid mit den eng anliegenden Ärmeln stammte aus dem Norden. Offenbar war sie eine Künstlerin, deren Mappe mit Zeichnungen sich geöffnet hatte. Der Tanz der Blätter brachte augenblicklich Bewegung in das ruhige Treiben auf der Mole. Einige der Frauen ließen alles stehen und liegen und halfen bei der Jagd. Vor allem aber eine Schar Straßenjungen, aus dem Nichts aufgetaucht, sprang mit lautem Geschrei herum, um zu retten, was zu retten war. Ihr Einsatz schien allerdings den Zeichnungen nicht gutzutun, denn ihre Finger krallten sich in die Blätter, und mit ihren schmutzigen Füßen traten sie beherzt darauf, ohne zu bedenken, dass sie dadurch einen Abdruck des Pflasters in das Papier prägten. Auch Franz, dem eines der Blätter geradewegs vor die Füße segelte, half bei der Jagd mit. Als auf der Mole endlich alles eingefangen war, standen sie am Ufer und blickten auf ein halbes Dutzend Blätter hinab, die unten im Wasser trieben. Eine der Frauen kam mit einem Besen, um sie herauszufischen, doch die Straßenjungen zögerten nicht lange, entledigten sich ihrer Hosen und sprangen allesamt ins Wasser. Sie ruderten mit ihren dünnen Beinen geschickt wie Frösche, und bald lagen die Blätter zum Trocknen auf dem warmen Stein in der Sonne. Die junge Frau gab den Jungen, nachdem sie ihre Hosen wieder angezogen hatten, ein paar Münzen und freudig zogen sie ab. Nur einer der Jungen, der älteste, blieb zurück und betrachtete die Blätter. Es waren keine Zeichnungen nach der Natur, sondern Bleistiftskizzen verschiedener Gemälde. Während das Papier wellig und faltig geworden war, hatte das Wasser dem Bleistift nichts anhaben können. Der Junge glättete hier und da ein Blatt, wo es ihm nicht sorgfältig genug ausgelegt war.
»Che bello!«, murmelte er andächtig und strich den Rand einer kleinen Kreuzabnahme Jesu glatt, wobei er darauf achtete, den Bleistift nicht zu verwischen. Schließlich zögerte er und sah sich nach der jungen Künstlerin um, die den Frauen für ihre Hilfe dankte. Er löste das feuchte Blatt vorsichtig vom Stein, stand auf, hob sein zu großes gelbes Hemd und klebte sich das feuchte Papier auf den dürren Bauch.
In diesem Moment traf sein misstrauischer Blick den von Franz. Beide schauten sich an. Was wollte der Junge mit der flüchtigen Skizze anfangen? Franz zögerte, ob er den kleinen Diebstahl verraten sollte. Da wandte sich der Junge ab, rannte los und verschwand in einer schmalen Gasse.
Während die junge Künstlerin sich auf den steinernen Boden kniete und den Wust ihrer Zeichnungen ordentlich in ihre Mappe legte, fand Franz Gelegenheit, sie in Ruhe zu betrachten.
Ihr dunkles Haar war eng am Kopf zu einem Zopf geflochten und wurde mit einigen silbernen Nadeln gehalten. An ihrer hellen Schläfe hatte sie ein Muttermal, und ihre Augenbrauen zeugten von einem starken Willen.
Ihre Finger waren kurz und wirkten beinahe jungenhaft. Obwohl sie sehr reinlich waren, konnte Franz unter den Nägeln Farbreste erkennen. Auch das Lächeln, mit dem sie zu Franz aufsah, hatte einen jungenhaften Charme.
»Vielen Dank für Ihre Hilfe«, sagte sie.
»Ihre armen Zeichnungen«, erwiderte Franz. »Einige sind ziemlich ramponiert.«
»Ja, leider.« Sie seufzte. »Die Schleife hat sich gelöst. Manchmal passiert mir so was …« Sie lächelte tapfer. »Es sind nur Kopien.«
»Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Robert von Stargard.«
»Irma Fuchs.«
Sie hielt ihm ihre Hand entgegen, und er schlug ein.
3
Ein richtiger Kunsthändler
Als Clara sich Weimar näherte, war ihr alles vertraut und zugleich fremd. Die altbekannten Hügel und Wiesen, die üppig tragenden Obstbäume und die Felder, auf denen sich Weizen und Hafer im Winde wiegten, kamen ihr vor, als sähe sie sie zum ersten Mal. Vor der Stadt war jeder Weg, jeder Hain und jedes Landgasthaus mit Erinnerungen verbunden, weil sie schon als junges Mädchen überall umhergestrichen war, doch sie erschienen ihr wie die Erinnerung einer anderen.
Auch auf dem Weg durch die Stadt, vorbei am Theater, am Stadtpalais Anna Amalias, am alten Haus der Familie Schiller, als der Wagen links abbog zum Markt und sie einen kurzen Blick hinauf zum Haus am Frauenplan werfen konnte, erkannte sie alles und nichts wieder.
Die Kutsche hielt vor dem Gasthaus Elephant, und Clara zögerte auszusteigen. Obwohl die Herren unter den Mitreisenden ihr den Vortritt gewähren wollten, blieb sie sitzen. Und als sie schließlich über die eiserne Stufe hinausstieg und ihren Fuß auf das Straßenpflaster setzte, schossen ihr die Tränen in die Augen.
Zurück zu Hause.
Nicht mehr in Rom.
Sie hatte Fanny ihre Ankunft geschrieben. Während das Gepäck abgeladen wurde, blieb sie am Fleck stehen. Die Reisenden verliefen sich, die Kutsche rollte ums Haus zu den Ställen, doch Clara stand immer noch da. Allein neben ihrem Reisekoffer, an den sie ihre Staffelei gebunden hatte.
Nicht mehr zu Hause!
Zurück in der Fremde!
Es waren nicht viele Leute unterwegs, es war kein Markttag und Mittagessenszeit. Wie immer, wenn die Postkutsche ankam, hatten sich einige zerlumpte Männer eingefunden, um ein Handgeld durch die Versorgung des Gepäcks zu verdienen. Sie drückten sich an der Wand des Gasthauses herum und sahen erwartungsvoll herüber. Doch Clara mied ihre Blicke, sie wollte noch nicht gehen.
Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen. Zum ersten Mal fühlte Clara die tiefe Bedeutung der Zeile aus den Wahlverwandtschaften. Wer in die Fremde geht, gewinnt unendlich. Aber er zahlt auch einen Preis.
»Clara!« Ein heller Schrei hallte über den weiten Platz. Clara sah eine schmale Frau in einem weißen Kleid auf sich zurennen. »Clara! Du bist zurück!« Fanny rannte mit ausgebreiteten Armen quer über den Platz, ohne Rücksicht auf jegliche Etikette, sie verlor sogar ihren Hut. Sie rannte und schrie und fiel Clara in die Arme und drückte sie, dass ihr die Luft wegblieb.
»Fanny! Du erdrückst mich ja!«
»Dann fährst du wenigstens nicht mehr davon! Erst willst du ein Jahr nach Rom, und dann bleibst du fast zwei! Ich lass dich nie wieder los!«
Sie lachten und weinten zugleich, und plötzlich war Clara wieder ganz da. Die warme Umarmung der alten Freundin mit dem Duft ihrer gemeinsamen Jugend ging ihr ans Herz. Nachdem Fanny lange Claras Hals nass geweint und immer wieder beteuert hatte: »Du darfst nie wieder weggehen! Du darfst nie wieder weggehen!«, bemerkten sie einen der zerlumpten Männer in höflichem Abstand. Er hatte Fannys Hut aufgehoben und hielt ihn ihr hin. Fanny setzte den Hut wieder auf und band die Schleife unterm Kinn zu. Sie dankte dem Mann, und als er den Koffer nahm, nannte sie ihm die Adresse von Claras Elternhaus, hakte sich bei Clara unter und zog sie mit sich.
»Wie geht es meinem Vater?«, fragte Clara.
»Heute geht es ihm gut«, erwiderte Fanny, doch sie wurde mit einem Mal ernst, blieb stehen und blickte Clara an. »Aber du darfst nicht erschrecken, wenn du ihn siehst. Die Bettruhe hat ihn furchtbar blass werden lassen. Und schmal … Es ist gut, dass du wieder da bist. Wenn du ihn pflegst, wird das besser für ihn sein als jeder Arzt!«
»Sag mir die Wahrheit. Wie steht es um ihn?«
Fanny zögerte. »Um ehrlich zu sein, hatten wir die Befürchtung, dass er den September nicht überlebt. Aber jetzt geht es ihm wirklich viel besser. Allein durch die Vorfreude auf deine Rückkehr!«
»Ich bin sofort aus Rom abgereist, als ich deinen Brief bekommen habe. Fast sofort …«
»Jetzt wird alles wieder gut!«, lachte Fanny und zog sie weiter. »Es gibt so viel zu erzählen! Was du nicht alles verpasst hast! Alle freuen sich auf deine Rückkehr. Madame von Stein lässt ausrichten, sie erwartet so bald wie möglich deinen Besuch, Frau von Kalb gibt morgen einen Tee, zu dem wir eingeladen sind, im Theater geben sie am Samstag Kotzebue, ich habe uns schon Karten besorgt. Wir gehen gemeinsam mit der Schillerin und Emilie. Erinnerst du dich an die kleine Emilie? Du wirst sie nicht wiedererkennen! Sie ist vor zwei Monaten vierzehn geworden und über Nacht eine junge Dame! Sie wird sich vor Bewerbern nicht retten können! Du, stell dir vor, Ottilie von Goethe hat eine neue Literaturzeitschrift gegründet! Sie hat schon drei Ausgaben herausgebracht! Ich habe von jeder ein Exemplar für dich. Und die Schopenhauer hat einen neuen Roman geschrieben. Er soll im nächsten Jahr erscheinen. Ich habe schon eine Abschrift gelesen. Und so geweint!«
Da war es wieder, das Gefühl.
Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen.
Clara litt mit jedem Wort der unbeschwert plaudernden Freundin mehr. Jeder dieser Namen, die so angenehm in ihr klingen sollten, vergrößerte ihre Qual. War das Leben hier all die Zeit über auf der Stelle getreten? Tee, Theater, Zeitschriften … Sie erinnerte sich ganz fern an eine Clara, die von all diesen Dingen in Aufregung versetzt worden war. Tee! Theater! Eine neue Zeitschrift! Wo war diese Clara abgeblieben?
Allein der Name Goethe machte ihr Hoffnung. Nicht Ottilie, sondern der Vater. Er hatte das Gleiche erlebt. Er würde verstehen.
»Aber ich rede und rede!«, rief Fanny aus. »Dabei musst du ja erzählen! Du musst alles erzählen, was du in Rom erlebt hast. Du hast viel zu wenig geschrieben! Erzähl mir alles!«
Erzähl …
Clara wollte so gerne alles erzählen. Aber was? Aber wie? Schon als sie die ersten Worte suchte, spürte sie die Unmöglichkeit: Natürlich konnte sie Fanny berichten, dass sie hinaus in die Campagna gewandert war und den ganzen Tag gezeichnet hatte. Aber wie es sich anfühlte, was es mit ihr gemacht hatte, wie sie erfüllt war davon – könnte sie das je in Worte fassen? Auf dem Monte Gianicolo unter der Tasso-Eiche zu sitzen, im Abendwind, mit dem weiten Blick über Rom, wenn es langsam dunkel wurde und immer mehr Sterne auftauchten. Mit einem Stück Brot und einer Flasche Wein auf der Wiese der Villa Borghese zu sitzen, wenn in der Dämmerung die Hirsche zwischen den Bäumen hervortraten und herüberschauten. Dass sie sich verliebt hatte. In einen Betrüger. Der zum Tode verurteilt worden war, weil er vier Menschen ermordet haben sollte.
*
Franz umarmte Clara und küsste ihren kühlen Mund. Wie anders hatte sich das angefühlt, als er das eine Mal ihren wirklichen Mund geküsst hatte! Jetzt hielt er einen hölzernen Rahmen in Händen und küsste ihren Bleistiftmund hinter Glas. Heinrich Zwirner hatte das Bild liefern lassen, und Franz nahm sogleich ein kleines Gemälde in seinem Arbeitszimmer von seinem Haken, um es durch Claras Porträt zu ersetzen. Doch es blieb nicht lange dort hängen, denn nachdem er all die anderen römischen Zeichnungen mittels angeleckter Oblaten rundherum an die Wand geklebt hatte, nahm er Clara wieder ab. Er stellte den Rahmen auf den Sessel ihm gegenüber und erzählte ihr alles, was er bisher gesehen und erlebt hatte. Er unterbrach sich allerdings mitten im Satz, als Signora Donati hereinkam und ihm eine Einladung brachte. Die Haushälterin war ganz aufgeregt: Emilio Canetti, Avvocato. Zwar kannte sie ihn nicht persönlich, aber sie wusste, dass er der Spross einer alten und edlen Familie war. Und so bestieg Franz eine Gondel, zeigte dem Barcariol die Karte und ließ sich zu dem edlen Spross rudern. Franz’ Taktik, sich bei jeder Gelegenheit als Kunsthändler bekannt zu machen, trug also erste Früchte. Vielleicht hatte er die Einladung auch Signora Donati zu verdanken, die auf dem Markt mit anderen Haushälterinnen einen regen Tauschhandel von Neuigkeiten und Gerüchten betrieb und alles Wissenswerte über ihren neuen Dienstherrn zum Besten gab.
Die Gondel hielt am Eingangstor eines Palazzos, der schon bessere Zeiten gesehen hatte. Das bröckelnde Gemäuer schien vor allem von dem grünen und schwarzen Ring aus Muscheln an der Wasserlinie zusammengehalten zu werden.
Franz wurde in einen Salon geführt, der nach altem Leder roch. Hinter einem riesigen Schreibtisch kauerte eine graue Gestalt. Als Canetti aufstand und Franz höflich begrüßte, entpuppte sich der venezianische Spross eher als verdorrter Zweig. »Herr von Stargard, es ist mir eine Ehre«, sagte er auf Deutsch.
»Die Ehre ist ganz auf meiner Seite.«
Canetti wies auf eine altersschwache Gruppe Sessel mit verschossenen Polstern, und als sie sich setzten, brachte ein ebenso altersschwacher Diener Kaffee und Dolci.
Emilio Canetti hob seine Kaffeetasse mit dürren und zittrigen Fingern. Sein graues Haar ragte wirr über seinen knochigen Kopf hinaus. Es wirkte so staubig, dass Franz den Drang verspürte, darüber hinweg zu pusten.
»Ich höre, Sie sind Kunsthändler.«
»Das ist richtig«, bestätigte Franz. »Ich hoffe, hier in Venedig …«
»Ich freue mich, dass Sie noch jung sind. Der Kunsthandel in dieser Stadt stirbt an Überalterung. Die alten Langweiler bringen alles herunter.«
»Machen Sie auch in Kunst?«, fragte Franz.
»Gerade ist wieder ein Alter bankrott. Parsini. Kennen Sie Parsini?«
»Nein, ich …«
»Hat einen Sohn in Ihrem Alter. Kann einen Tritt in den Hintern gebrauchen. Alle schimpfen über die Ausländer. Über die Engländer. Natürlich die Deutschen. Aber machen Sie ruhig ein bisschen Wirbel! Kennen Sie den jungen Parsini? Alessandro?«
»Nein. Ich hatte noch nicht das Vergnügen.«
»Es ist kein Vergnügen! Er ist ein Betrüger und ein Trinker. Ich weiß nicht, ob er trinkt, weil er betrügt, oder ob er betrügt, weil er trinkt. Mit seinem Vater habe ich jahrelang vertrauensvoll Geschäfte gemacht. Auf das Wort des alten Parsini konnte ich mich immer verlassen. Wenn er einen Preis genannt hat, dann war es ein guter Preis. Wir Venezianer sind Kaufleute. Die Grundlage eines jeden Handels ist Vertrauen.«
»Da haben Sie recht«, warf Franz höflich ein.
»Natürlich habe ich recht! Ich stamme aus bester Familie! Ich weiß, wovon ich rede!«
So oft, wie Emilio Canetti betonte, dass er aus bester Familie stammte, beschlich Franz der Verdacht, dass dem nicht so sei. Tatsächlich stellte sich bei Nachforschungen später heraus, dass ein Urgroßvater Canettis erst im späten 17. Jahrhundert nach Venedig gekommen war. Er habe damals hunderttausend Dukaten bezahlt, um im Großen Rat aufgenommen zu werden, und finanzierte mit dieser Summe die Belagerung Athens, die allerdings außer der Zerstörung des Parthenontempels auf der Akropolis nichts Dauerhaftes bewirkte.
»Kommen Sie. Ich will Ihnen ein Gemälde zeigen.« Erstaunlich behände erhob sich der Alte aus seinem Sessel, ging zu einer Tür, und Franz folgte ihm in einen imposanten Portego, der vom vorderen Ende des Palazzos bis zum hinteren reichte. »Ich besitze ein paar schöne Stücke. Natürlich werde ich nichts davon verkaufen. Warum auch. Aber dieses hier bin ich leid.« Er wies auf eine leiberwimmelnde Himmelsszenerie mit verklärten Blicken, Engelsflügeln und nackten Busen. »Der Verbrecher Alessandro hat mir fünfhundert Scudi für das Gemälde geboten. Für einen Ricci! Und zwar Sebastiano Ricci, nicht Marco. Ich habe ihn zum Teufel geschickt. Einen Fußtritt hätte ich ihm geben sollen! Ihn aus dem Fenster in den Kanal werfen lassen! Fünfhundert Scudi! Es ist das Vierfache wert!«
Der altersschwache Diener folgte ihnen lautlos mit der Schale Pralinen. Während Franz das Gemälde betrachtete, griff Canetti mit zittrigen Fingern zu und schloss genießerisch die Augen, als er seine schmalen Lippen um die Süßigkeit schloss. Doch gleich darauf brach seine Erregung über diesen Parsini wieder hervor.
»Kein Wunder, dass der alte Parsini ins Unglück geraten ist! So eine Kakerlake von einem Sohn großgezogen zu haben, ist unerträglich! Er hatte auch einen guten Jungen. Daniele. Eine Zierde fürs Geschäft. Begabt, ehrlich, fleißig. Aber ausgerechnet dieser Sohn stirbt ihm auf einer Reise über die Alpen. Ersäuft in einem Gebirgsbach. Die Kutsche ist vom Weg abgerutscht. Können Sie sich das vorstellen? Ein Venezianer? Ersoffen im Gebirge? Nicht zu fassen. Der andere hätte krepieren sollen. Alessandro! Der Säufer! Der Betrüger!«
Noch einmal stibitzten seine zittrigen Finger ein Cioccolato und ließen es in seinem Mund verschwinden.
»Das heißt, Parsini ist einer der bedeutenden Kunsthändler hier?«
Der Alte blitzte Franz aus seinen kleinen Augen an. »Sie kennen sich nicht aus in Venedig.«
»Um ehrlich zu sein, nein.«
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich erkläre Ihnen den hiesigen Kunsthandel, und Sie kaufen mir den Ricci ab.« Er blickte Franz geradeheraus an. »Ich lasse Ihnen das Bild für tausend. Lassen Sie einen Experten kommen. Es ist ein Freundschaftspreis.« Er hielt Franz die Hand hin, und Franz schlug ein. Was soll’s, dachte er. Es ist nicht mein Geld, und man hat mir gesagt, ich solle Geld ausgeben, um Eindruck zu machen und glaubwürdig zu sein.
Canetti bestellte Essen, und als sie zu Tisch saßen, erzählte er. »Der Kunsthandel funktioniert hier auf drei Ebenen. In den Traditionshäusern bekommen Sie nur Erstklassiges. Alte Meister. Venezianer, Florentiner. Die Bilder stammen aus dem Besitz der alten Familien, und Sie können dort auch nur kaufen, wenn Sie zu einer der Familien gehören.« Der Alte zählte mit seinen dürren Fingern auf: »Fiori, Grigoletti, De Beltrami, Stamaso – und eben Parsini, aber der ist bankrott. Nächste Woche gibt es eine Auktion seiner Bestände. Gehen Sie dahin.« Er aß eine Weile schweigend, während Franz mit einem Bleistift die Namen, die er gehört hatte, in ein Notizbuch schrieb. »Dann gibt es die mittlere Ebene.« Er nannte ein paar Namen, die Franz ebenfalls notierte. »Hier bekommen Sie alles. Natürlich keinen Tintoretto oder Canaletto. Aber gute Sachen. Renaissance, Mittelalter, Antike, alles. Seit Venedig in die Knie gegangen ist, herrscht Ausverkauf. Verkauft wird an jeden, der bezahlen kann. Sie kommen spät. Das Beste ist längst weg.«
»Und alles echt?«, fragte Franz beiläufig.
Der Alte zögerte. »Wer weiß. Natürlich offizielle Kopien ohne Ende. Es wird alles kopiert. Aber in Venedig herrschen strenge Auflagen! Wenn ein Künstler kopiert, dann nur nach Anmeldung. Es wird alles katalogisiert. Und niemals in Originalgröße! Und schließlich gibt es die Weiber. Möchten Sie noch Wein?« Der alte Diener kam und schenkte Franz nach, obwohl er kaum getrunken hatte. »Trödlerinnen. Sie verscherbeln den Schund. An das einfache Volk. In Venedig sind nicht nur die Reichen und Gebildeten kunstsinnig. Auch der Arbeiter will seine Rialtobrücke oder seine Madonna über dem Tisch hängen haben.«
Und als das Dessert gebracht wurde, fügte der Avvocato noch hinzu: »Es gibt ein paar Wirte, bei denen finden Sie ganz hübsche Stücke. Von Malern, die ihre Zeche nicht bezahlen konnten. Aber natürlich nichts Altes. Nichts, was Sie weiterverkaufen könnten.«
Als er aufgegessen hatte, erklärte der alte Canetti, dass er jetzt Mittagsschlaf halten müsse, und verabschiedete sich mit einem kurzen Verweis darauf, dass die Deutschen ja Höflichkeiten nicht ausstehen können.
Am Nachmittag lieferten zwei Diener das Bild. Franz hatte keine Ahnung, ob es ein guter Kauf gewesen war. Aber allein die zahllosen Falten flatternder Umhänge schienen den Kaufpreis zu rechtfertigen. Und vor allem dachte Franz, nachdem er das Bild auf einer Staffelei im Prunksaal aufgestellt hatte: Jetzt bin ich tatsächlich ein richtiger Kunsthändler.
*
Wenn Franz sich mit der venezianischen Kunst vertraut machen wollte, dann fing er wohl am besten an wie ein gewöhnlicher Reisender auf großer Tour. Wie jeder Liebhaber, jeder Kenner und jeder Künstler. Also ging er zu den erst im vergangenen Jahr eröffneten Galerien der Accademia di Belle Arti. Er war erstaunt, dass er ein Eintrittsgeld zahlen musste. Das hatte er bisher noch nicht erlebt.
Die Galerien waren gut besucht. Englische Reisegruppen, deutsche Gelehrte, französische Damen, lautstarke Neapolitaner, römische Priester und eine russische Familie mit einem schönen langhaarigen Jungen betrachteten interessiert die Gemälde. Vor den bedeutenden Gemälden – Tizian, Veronese, Canaletto – herrschte ein regelrechtes Gedränge. Am häufigsten waren natürlich die Dialekte Österreichs von Wien bis Tirol zu hören.
In mehreren Sälen standen Kopisten vor ihren Staffeleien und arbeiteten daran, eine zweite Ausführung eines mehr oder weniger berühmten Gemäldes zu erstellen. Die meisten Kopisten mussten es über sich ergehen lassen, dass selbst ernannte Kunstsachverständige lebhaft die Qualität der entstehenden Kopie diskutierten. Franz beobachtete einen Maler, der sich zweier Schwaben erwehren musste, die im weichen Tonfall ihrer Heimat selbstbewusst Kritik an der Ähnlichkeit einer angemischten Farbe übten. Augenscheinlich fehlte nicht viel, und der Maler, ein hagerer Kleinwüchsiger in einem steifen Anzug, der zum Malen den Hut aufbehielt, hätte den hilfsbereiten Schwaben die angeblich missratene Farbe ins Gesicht gepinselt.
In einem abgelegeneren und weniger besuchten Saal fiel Franz ein junger Maler auf, der die Ärmel seines weißen Hemdes aufgekrempelt hatte und im stabilen Ausfallschritt eines Fechters vor seiner Staffelei stand. Auch den Pinsel hielt er im Florettgriff. Sein Haar, das die Farbe und die Beschaffenheit einer Handvoll gedroschener Strohhalme hatte, glich überraschend den Pinselstrichen auf seiner Leinwand. Diese fügten sich keineswegs brav und sittsam den dargestellten Formen seiner Vorlage, nämlich dem Aufstieg Mariens in den Himmel, begleitet von allerlei Heiligen und Himmelsvolk, sondern beanspruchten ungestüm ihr eigenes Wesen. Aus der Entfernung waren die Komposition der Figuren sowie ihre Farbgebung gut getroffen – Franz erkannte sogar den aufwärtsgerichteten Blick der Madonna. Doch je näher man hinzutrat, desto mehr lösten sich die Gegenstände in eine Wirrnis aus farbigen Strichen auf. Was umso erstaunlicher war, als der Maler ja das Ganze nur aus der Nähe sah.
Offenbar ging es dem jungen Mann nicht darum, ein Bild zum Verkauf zu produzieren; einen solchen malerischen Irrsinn hätte kaum ein Auftraggeber angenommen. Er erfasste in Eile nur die groben Formen, ohne sich mit Feinheiten aufzuhalten. Das Bild übte auf Franz einen Reiz aus, den er nicht erklären konnte.
Er mochte die eigenwillige Pinselzeichnung. Es erinnerte ihn an die schönen Momente, wenn er mit Clara irgendwo im Schatten gesessen hatte, während sie das Wunder vollbrachte, mit sicheren Bleistiftstrichen einen Marktstand oder eine Bäuerin vor einer antiken Ruine zu zeichnen. Mit Bleistiftstrichen, die sich so überraschend von denen Fohrs oder Schadows oder Hornys oder irgendeines anderen unterschieden, dass sie im Grunde mehr über Clara verrieten als über ihren Gegenstand.
Franz wurde aus seinen Gedanken gerissen, als er die strohblonden Haare auf sich zukommen sah. Der junge Maler schritt rückwärts, wobei er den Blick nicht von der Leinwand ließ. Sein Florett mit der blauen Farbe des Madonnengewandes hielt er hinter sich zu Boden gerichtet.
Bevor der Pinsel sein Hosenbein erreichte, trat Franz einen Schritt zur Seite. Zum ersten Mal hatte er Gelegenheit, das Gesicht des Malers zu betrachten. Obwohl er noch jung war, furchten zwei tiefe Falten seine Stirn und zwei weitere seine Mundwinkel. Dadurch erhielt er eine ernste Prägung, die Franz’ Interesse und sogar seine Sympathie weckten.
Franz fragte sich gerade, ob die Sorgenfurchen wohl dauerhaft über seinen klaren blauen Augen standen oder nur von einer Unzufriedenheit mit seinem Werk rührten, als der junge Mann ihn unvermittelt anblickte. »Ich will nichts hören«, forderte er bestimmt, aber nicht unfreundlich.
Franz nickte, während der andere sich wieder seinem Gemälde zuwandte. Dabei legte er den Kopf schräg. »Ich weiß, dass es furchtbar ist! Bis gestern war Tobler hier. Ab morgen hat Wennefeld den Platz vor der Madonna reserviert. Zwei Wochen lang!« Verächtlich stieß er die Luft aus, als würden diesem Wennefeld auch zwei Monate nicht für eine respektable Kopie genügen. »Mir haben sie einen Tag gegeben. Einen Tag! Tu es oder lass es! Was soll ich denn machen! Ich kann doch nicht wochenlang warten, dann geht mir der Auftrag flöten!«
Franz wollte nicht länger schweigen. »Ist das Gemälde zu verkaufen?«, fragte er.
Der Künstler erhob sein Pinselflorett und richtete es bedrohlich auf Franz. »Ihren Spott können Sie sich sparen!«
»Ich spotte nicht.«
»Das ist kein Gemälde! Es ist eine Skizze! Der verzweifelte Versuch, wenigstens etwas herüberzuretten! Ich dachte, ich könnte es in Ruhe im Atelier fertigstellen, aber es ist ja ganz und gar hoffnungslos. – Ein Tag! Ein verfluchter Tag! – Verkaufen …« Er schüttelte ärgerlich den Kopf.
»Ich mag das Zeichnerische.«
Der andere musterte ihn und wog offenbar ab, ob wirklich kein Fall von Spottlust vorlag. »Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Robert von Stargard.«
»Klein«, erwiderte der Künstler. »Johann Adam Klein.«
»Was wollen Sie mit dem Bild anstellen, wenn Sie es nicht verkaufen?«
»Ich werde heute Abend die Farben abschaben, um die Leinwand zu retten. Wenn ich vorsichtig rangehe und die Farbtöne halbwegs trenne, kann ich sie vielleicht sogar noch verwenden.«
»Wenn es nicht zu verkaufen ist, dann tauschen wir: Ich gebe Ihnen zwei Leinwände dafür, und Sie suchen sich in einer Apotheke Ihrer Wahl Pigmente für zwei Gemälde aus.«
Klein erwog den Vorschlag. Dann sagte er: »Drei.«
Franz lächelte. »Abgemacht.«
»Aber ich werde es nicht signieren.«
»Das müssen Sie! Ohne Signatur ist es wertlos!«
»Es ist auch mit Signatur wertlos.«
»Dann tun Sie es mir zuliebe. Zur Erinnerung.« Franz hielt Klein die Hand hin.
»Also schön.« Und damit schlug der Maler ein.
Nun hatte er also schon sein zweites Gemälde gekauft! Und dieses machte ihn sehr viel glücklicher als das staubige Himmelswerk des alten Canetti.
»Was wollen Sie damit anfangen? Sind Sie Sammler?«
»Ich bin Kunsthändler.«
4
Jäger und Gejagte
Franz bestellte den Transport des großen Gemäldes gleich für den nächsten Vormittag, obwohl man ihm abriet, das Bild mit der noch feuchten Farbe ausgerechnet dann über den Kanal zu bringen, wenn die meisten Gondeln und Boote unterwegs waren. Und er begleitete die Fahrt persönlich. Weniger um die Transporteure zu überwachen, als vielmehr um von möglichst vielen Menschen mit einem Gemälde gesehen zu werden. Jedem sollte der Neuankömmling auffallen. Und zwar als Mann der Kunst, als Kunstkäufer, als Kunsthändler. Man hatte den Spannrahmen des Ölbildes an einem hölzernen Gestell befestigt, und Franz setzte sich auf den verbleibenden Platz davor, wobei er sorgsam achtgab, die Farbe nicht mit dem Ärmel zu verwischen. Während die Gondel von zwei Barcarioli über den Kanal gerudert wurde, sahen auch tatsächlich immer wieder Leute neugierig herüber.
Als Franz an seinem Palazzo überwachte, dass die Madonna vorsichtig aus der Gondel gehoben wurde, kam ihm Signora Donati entgegen und berichtete aufgeregt, ein Besucher sei da. Ein Priester. Deshalb habe sie gedacht, sie könne ihn ruhigen Gewissens hereinlassen und im Jagdzimmer warten lassen.
»Ein Priester? Und er will zu mir?«
»Si, aber er wollte mir nicht sagen, warum. Er will nur mit Ihnen sprechen.«
Franz zögerte keine Sekunde und eilte, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf.
»War das nicht richtig?«, rief ihm die Signora besorgt hinterher.
Doch es war goldrichtig. Denn als Franz ins Jagdzimmer platzte, bestätigte sich seine Hoffnung: Er stand einem jungen, hochgewachsenen Priester gegenüber, der ihn aus einem ehrlichen Gesicht entgegenstrahlte.
»Lukas!«, rief Franz aus und umarmte den Gast herzlich. »Welch eine Überraschung!«
»Robert von Stargard! Lass dich anschauen!«
»Bitte nenn mich nicht so.«
»Aber warum? Der Stargard steht dir gut! Du siehst prächtig aus! Als ob du immer schon einen feinen Anzug …«
Als Signora Donati in der Tür erschien, verstummte Lukas.
»Signora Donati, darf ich Ihnen Pater Lukas vorstellen. Ein alter Freund.«
Signora Donati machte einen Knicks.
»Bitte bringen Sie uns Kaffee! Bist du hungrig, Lukas? Wann bist du in Venedig angekommen?«
»Eben erst, aber ich brauche nichts zu essen.«
»Seien Sie so nett und bringen Sie uns trotzdem etwas.«
»Es ist unglaublich«, sagte Lukas, sobald sie alleine waren. »Ich sehe dich noch vor mir, auf dem Schinderkarren, elend und ausgemergelt von der Haft, auf dem Weg zum Schafott. Und jetzt – sieh dich an! Als ob du nie etwas anderes getragen hättest als feine Anzüge! Du bewegst dich hier, als seist du in solcher Umgebung aufgewachsen!«
»Das alles habe ich dir zu verdanken. Du hast Kardinal della Somaglia überredet, mich zu begnadigen. Ohne dich hätte ich meinen Kopf verloren.«
»Mir tut jetzt noch jeder Knochen weh, wenn ich daran denke, wie ich quer durch Rom galoppiert bin! Ich hatte noch niemals solche Angst! Pferde sind einfach zu groß! Ein Priester gehört nicht auf ein Pferd.«
»Dann wirst du Venedig lieben. Hier gibt es keine Pferde.«
»Wasser ist ja noch schlimmer! Ich kann ja nicht einmal schwimmen!«, rief er aus.
Franz lachte. »Wie lange wirst du bleiben?«
»Eine Stunde. Je kürzer ich bleibe, desto besser.«
»Eine Stunde! Ich will dir alles erzählen! Alles zeigen!«
»Nichts wirst du mir zeigen. Wenn jemand sieht, dass du mit einem Priester der heiligen Inquisition umgehst, einem Vertrauten von Kardinal della Somaglia, dann könnte das dein Ende sein.«
»Niemand kennt dich hier! Du bist aus Rom.«
»Eben. Du aber nicht. Vergiss das nicht! Du hättest nicht einmal die römischen Zeichnungen aufhängen sollen.«
»Ich bin Kunsthändler.«
Lukas zuckte mit den Schultern und erwiderte nichts.
Der Freund nahm es wie immer ganz genau. Er hatte persönlich auf jedes Detail geachtet, als Robert von Stargards Lebensgeschichte von erfahrenen Geheimpolizisten des Kirchenstaates erdacht worden war, und er hatte sie gemeinsam mit ihm gründlich auswendig gelernt. Franz hatte den Spott des Priesters ertragen müssen, weil der alles viel schneller im Kopf behalten hatte, und war von Lukas so lange den verwirrendsten Verhören ausgesetzt worden, bis er jede Frage im Schlaf beantworten konnte. Franz war so tief in die erfundene Familie eingetaucht, dass er nahezu körperlich spürte, wie es ist, wenn man die eigene Geschichte bis zu den Kreuzzügen zurückverfolgen kann. Es hatte Stunden gegeben, wenn Lukas ihm endlich erlaubt hatte, zu Bett zu gehen, in denen er wirklich ein Spross dieser alten Familie war.
Die Schreiber der römischen und allgemeinen Inquisition hatten den jungen Robert von Stargard mit einem preußischen Pass ausgestattet, der einem echten vollkommen glich und der beim Grenzübertritt vom Kirchenstaat nach Venetien von den österreichischen Beamten anstandslos gestempelt und unterschrieben worden war. Man hatte ihm sogar eine Mappe mit Briefen von erfundenen Verwandten mitgegeben, die im Fall irgendeiner Überprüfung jeden Zweifel ausräumen sollten.
»Dass du trotzdem gekommen bist«, fuhr Franz fort, »bedeutet dann wohl, es gibt einen wichtigen Grund?«
Lukas musste mit seiner Antwort warten, denn eben kam Signora Donati ins Zimmer und brachte ein Tablett voller Kaffee, Obst und Gebäck.
Die beiden Freunde traten mit ihren Kaffeetassen durch eine Fenstertür hinaus auf die Loggia. Über die Dächer der gegenüberliegenden Palazzi hinweg sahen sie die Takelagen einiger Segelschiffe, die zwischen Dorsoduro und La Giudecca vor Anker lagen. Hier draußen im Wind, in den Geräuschen der Schiffe und Boote, im Geschrei von Händlern, Bettlern und Bootsleuten waren sie am sichersten, nicht gehört zu werden.
»Es gibt Neuigkeiten«, begann Lukas. »Aus Paris sind ein Dutzend Wagenladungen mit Napoleons erbeuteter Kunst zurückgeschickt worden. Sie sind auch ordnungsgemäß angekommen. Doch es hat sich herausgestellt, dass die Kataloge, in denen die Lieferungen verzeichnet sind, gefälscht wurden. Jemand hat die Siegel erbrochen, ganze Seiten herausgenommen, durch unvollständige ersetzt und neu versiegelt.«
»Es fehlt ein Teil der Lieferung?«
»So scheint es.«
»Wie viel?«
»Das weiß niemand. Niemals zuvor hat es einen so großen Kunstraub gegeben. Und es hört nicht auf! Der Kirchenstaat hat versucht, es mit einem massiven Einsatz von Sbirri zu stoppen, aber als Österreich herausgefunden hat, dass die Geheimpolizei des Vatikans hier in Venedig ermittelt, hat es diplomatische Verstimmungen gegeben. Metternich persönlich hat sich strikt gegen die Einmischung in Österreichs innere Angelegenheiten verwahrt. Er wollte es schon zum Anlass nehmen, die Zusagen an den Kirchenstaat auf dem Wiener Kongress infrage zu stellen, und hat durchgesetzt, dass Rom die Sbirri sicher abgezogen hat. Deshalb kam Somaglia ja auch auf die Idee, dich einzusetzen.«
»Ich soll schaffen, was die Geheimpolizei des Vatikans nicht geschafft hat …«
»Zumindest wissen wir inzwischen, dass der Handel über Venedig läuft.«
»Aber welche Kunstwerke? Wonach soll ich die Augen aufhalten?«
Lukas öffnete eine Umhängetasche, die er nicht abgelegt hatte, nahm ein Skizzenbuch heraus und gab es Franz. »Ich habe Zeichnungen der Gemälde und Plastiken anfertigen lassen, die verschwunden sind. Aber es ist nur ein kleiner Teil. Es sind viel mehr.«