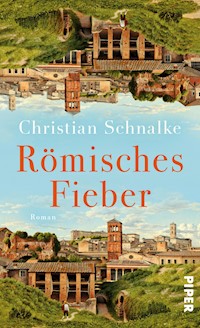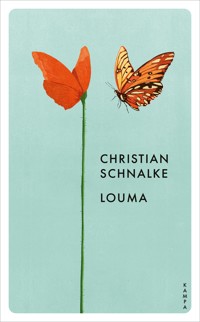
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Louma viel zu jung stirbt, hinterlässt sie vier Kinder von zwei Vätern. Die beiden Männer sind wie Feuer und Wasser, Tristan und Mo verbindet nur, dass sie mit derselben Frau verheiratet waren. Noch ehe Louma beerdigt ist, eskaliert die Situation, und die vier Kinder müssen mitansehen, wie sich ihre Väter prügeln. Beide meinen zu wissen, was das Beste für Toni, Fabi, Fritte und Nano ist, keiner von beiden würde dem anderen seine Kinder anvertrauen. Da hat Fritte eine Idee: Damit die Geschwister nicht auseinandergerissen werden, ziehen die ungleichen Väter einfach zusammen. Und während sie alle auf ihre Weise um Louma trauern, müssen sie zueinander finden. Kann aus der Zweck-WG eine richtige Familie werden?Das berührende, mit feinem Humor erzählte Porträt einer Frau, die über ihren Tod hinaus die Menschen, die sie lieben, verbindet. Ein Roman über Familienbande und den Mut, sich seinen Ängsten zu stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Schnalke
Louma
Roman
Kampa
Prolog:
»Kaffee?«
»Tee.«
»Das war so klar …«
»Warum fragst du dann?«
1
Es dämmerte bereits, als Mo mit den vier Kindern über die Friedhofsmauer kletterte. Mo reichte Fabi erst die beiden Kleinen hinauf und dann das Zelt, die Tasche, den Rucksack und die Schlafsäcke. Er machte für Toni eine Räuberleiter und kletterte schließlich als Letzter über die Mülltonne, die sie vom Hinterausgang des geschlossenen Blumenladens hergerollt hatten, auf die Mauer. Er hätte sich fragen können, wie sie später von der anderen Seite wieder zurückklettern sollten, wenn ihnen keine Mülltonne zur Verfügung stand, aber vorauszudenken war nicht Mos Stärke. Schon in der Klinik damals hatte man vergeblich versucht, ihm das nahezubringen.
Die beiden Großen, Toni und Fabi, trugen die Tasche und drei der Schlafsäcke, Mo trug die anderen beiden Schlafsäcke, das Zelt und den Rucksack mit dem Proviant. Fritte trug die Picknickdecke und Nano die Taschenlampe, die sie für später mitgebracht hatten. Er hatte darauf bestanden, sie nicht in die Tasche zu packen, sondern in der Hand zu behalten, falls es plötzlich dunkel würde.
»Wieso soll es plötzlich dunkel werden?«, hatte Fritte gefragt. Aber Mo hatte ihr gesagt, wenn Nano die Lampe nehmen wolle, dann sei das in Ordnung.
»Ob die Toiletten nachts wohl abgeschlossen sind?«, fragte Toni.
»Ich geh da sowieso nicht rein«, meinte Fabi. »Ich mach lieber ins Gebüsch.«
»Auf einem Friedhof?«
Nano lief mit seiner Taschenlampe voraus. Er fand problemlos den Weg an den Reihen von Gräbern entlang, an der Friedhofskapelle und der großen Wiese vorbei und bis zu dem Wäldchen am hinteren Ende des Friedhofs, wo am Mittag die Beisetzung von Louma stattgefunden hatte. Mo war überrascht gewesen, wie viele Menschen gekommen waren. So viele, die er nie zuvor gesehen hatte. Er hatte alte Freundinnen von Lou kennengelernt, die bedauerten, dass der Kontakt zu ihr in den letzten Jahren abgebrochen war, von Coffee Queen waren einige gekommen, deren Namen Mo gleich wieder vergessen hatte, natürlich Lous Schwester Kitty mit ihrem Mann und den Kindern, die keine Kinder mehr waren, sondern Studenten. Er hatte die Eltern von Tristan kennengelernt und eine Handvoll Tanten oder Großtanten und zwei Cousins, die Mo nie zuvor gesehen hatte. Dafür kannten die Tanten Tristan noch von irgendeiner Familienfeier, die zehn Jahre zurücklag.
Jetzt war der Friedhof vollkommen menschenleer. Dafür wurde er von anderen Wesen bevölkert.
»Kaninchen!«, rief Nano und wies mit der Taschenlampe auf die Wiese. Unzählige braune Wildkaninchen hoppelten herum, mümmelten in der Dämmerung Gras und blickten aufmerksam herüber.
»Ob man die streicheln kann?«, fragte Fritte. Ihr richtiger Name war Friederike. Sie war schon immer zu dünn gewesen und hatte diese hellgoldene Haarfarbe, und niemand weiß, wer damit angefangen hatte, sie Fritte zu nennen, aber es war dabei geblieben.
»Klar«, feixte Fabi. »Die werden hier nachts immer gestreichelt. Von den Zombies!« Toni, die Älteste, stieß ihrem vierzehnjährigen Bruder vorwurfsvoll gegen die Schulter.
Als sie den Trauerwald erreichten, konnten sie den Baum, unter dem Loumas Urne begraben war, schon von Weitem erkennen, weil ein Berg bunter Blumengestecke darunterlag. Sie suchten eine Stelle, die halbwegs frei von Wurzeln war, und breiteten die Decke darauf aus.
»Ich baue das Zelt direkt auf. Bevor es dunkel wird«, erklärte Fabi. Das Zelt würde nicht zwischen die Bäume passen, deshalb packte er es ein paar Meter weiter auf einer kleinen Lichtung aus. Sie wollten es ohnehin nur im Notfall benutzen. Falls es wider Erwarten zu regnen anfinge oder falls es in den Morgenstunden zu sehr abkühlte.
»Ich glaube nicht, dass es zu kalt wird«, sagte Toni. Tatsächlich war es immer noch erstaunlich warm. Genau der richtige Abend, um auf dem Friedhof zu campen, dachte Mo. Doch Fabi schien glücklich zu sein, eine Aufgabe zu haben. Während die anderen etwas befangen am Grab ihrer Mutter standen, begann er, kleine Kiefernzapfen beiseitezuwerfen, den Zeltstoff auseinanderzufalten und sorgfältig auszubreiten.
»Hallo, Lou«, sagte Mo. »Wir sind wieder da.«
»Wir wollten nicht, dass du in der ersten Nacht ganz allein bist«, erklärte Nano. »Papa hat erlaubt, dass wir hier übernachten.«
»Nano wollte unbedingt«, sagte Fritte. »Er hat geweint.«
»Sag ihr das doch nicht!«, zischte Nano ärgerlich.
»Ist doch so«, meinte Fritte.
Während sie mit ihren langen Beinen wie ein Storch durch die Kränze und Blumengestecke stakste, um Schleifen gerade zu rücken und zerdrückte Blüten aufzurichten, stellte sich Toni hinter Nano und legte ihre Arme um ihn.
»Ich krieg keine Luft«, sagte Nano.
»Möchtest du Louma auch etwas sagen?«, fragte Mo, doch Toni antwortete nicht.
Mo zuckte mit den Schultern. »Dann machen wir es uns erst einmal gemütlich. Wir sind ja die ganze Nacht hier.«
»Wo sind denn die Zeltstangen?«, fragte Fabi.
»Na, in dem Sack«, antwortete Mo.
»Nein.«
»Hm.« Mo strich sich nachdenklich durch seinen Vollbart. »Die muss ich vergessen haben einzupacken, als wir neulich das Zelt im Garten aufgebaut haben …«
Während Mo Fabi half, das Zelt wieder zusammenzufalten, setzten sich die anderen auf die Decke und packten aus, was sie mitgebracht hatten. Vor allem Reste, die ihnen Ralf, der Storemanager des Coffee Queen, nach der Trauerfeier eingepackt hatte. Kaum saßen Mo und Fabi bei den anderen, stand Fritte schon wieder auf und verkündete: »Ich gehe und streichle die Kaninchen.«
Während sie zwischen den Bäumen verschwand, sagte Toni: »Ich wette, das schafft sie.«
»Never ever!«, widersprach Fabi.
Sie standen auf, um Fritte zu folgen, aber Mo hielt sie zurück: »Lasst sie.«
»Wir stören sie nicht! Wir schauen nur«, erwiderte Fabi.
»Schauen ist stören. Bleibt hier.«
Als Fritte nach einer Viertelstunde immer noch nicht zurückgekommen war, wurde Mo allerdings selbst neugierig. »Kein Geräusch!«, mahnte er. Sie schlichen, so leise sie konnten. Als sie die Wiese erreichten, traute Mo seinen Augen nicht. Das Bild, das sich ihnen bot, sah aus wie auf einem Werbeheft einer buddhistischen Sekte: Fritte kniete mitten auf der dämmrigen Wiese, die von Bäumen und Gräbern eingerahmt war, vollkommen reglos, die Hände auf ihren dünnen Oberschenkeln, als ob sie meditierte. Die Kaninchen grasten friedlich und ohne jede Scheu um sie herum. Eines kam ganz nah, streckte mit angelegten Ohren den kleinen Kopf vor und schnupperte an Frittes Knie.
»Die Seelen der Toten …«, raunte Fabi. Doch diesmal verzichtete Toni darauf, ihn zu stoßen.
Und Mo vergaß zu atmen, während er in das ruhige Auge des Kaninchens schaute.
Was die wenigsten wissen: Lou Albarella war die Coffee Queen. Lou hieß eigentlich Louise, aber so nannten sie nur ihre Mutter und ihre Schwester Kitty. Tristan hatte oft Louie gesagt, Mo manchmal Loulou und gelegentlich Loubär, die Kinder Louma oder Loumi, Hummel bellte einfach Wou, und wenn Simone mit ihren Freundinnen gehässige WhatsApps austauschte, schrieb sie die Louserin. Aber für gewöhnlich sagte alle Welt Lou. Und so stand es auch auf dem kleinen Stein an ihrem Baum im Trauerwald.
Bevor Tristan und Lou gemeinsam das erste Café eröffneten, hatte Tristan lange überlegt, wie es heißen könnte. Er hatte den Traum, eine kleine Kette von Coffeeshops zu betreiben. Dabei ging es ihm weniger darum, von früh bis spät den Gästen Kaffee und Kuchen zu servieren, obwohl er durchaus Freude daran hatte, wenn die Leute sich bei ihm wohlfühlten und einen guten Kaffee genossen. Aber das war nicht die Rolle, in der er sich selbst sah. Vielmehr wollte er immer schon »etwas aufziehen«, und zwar etwas Großes. Es musste also ein filialtauglicher Name her. Und vor allem wollte Tristan, dass Lou in dem Namen steckte. Der Traum seines Lebens und die Liebe seines Lebens vereint. Sie tranken gemeinsam Wein, sie probierten Worte und Schriften aus, und Lou kritzelte kleine Bildchen: dampfende Tassen, Kaffeebohnen, Gesichter – und plötzlich war es dann da: das in schwungvollen Linien gezeichnete Gesicht mit den genussvoll geschlossenen Augen. Die Coffee Queen.
»Coffee Queen!«, rief Tristan. »Das ist es! Das bist du!« Sie hätten nachher nicht sagen können, wer von beiden die Idee gehabt hatte. Sie war im Durcheinander und Miteinander entstanden. Und als er sie vor sich sah, gab es für Tristan keinen Moment des Zweifels mehr. Lou schlug vor, noch ein paar Alternativen zu überlegen, um sicher zu sein. Aber Tristan sagte nur: »Ich bin sicher.« Und nachdem Lou zwei Tage an dem Logo herumgezeichnet und doch noch alles Mögliche ausprobiert hatte, stand es: das Logo von Coffee Queen, wie man es heute kennt.
Am Anfang arbeiteten sie eng zusammen. Sie suchten Möbel aus, sprachen mit Inneneinrichtern, saßen in Banken und bei Gastronomiegroßhändlern und führten Bewerbungsgespräche. Es war ihr gemeinsames Ding. Als Tristan das zweite und dritte Coffee Queen eröffnete, beobachtete Lou, wie er zur Höchstform auflief. Er war in den Läden, brachte die Mitarbeiter auf Spur, löste Probleme, fand Verbesserungen, scherzte mit Gästen und war überall zugleich. Inmitten von Menschen war er in seinem Element. Er brachte studentischen Aushilfen geduldig bei, wie man Kaffee aufbrüht, er griff zum Lappen und wischte über einen Milchfleck, er half bei der Abrechnung, experimentierte mit einem Koch an den angebotenen Snacks und Salaten, optimierte gemeinsam mit den Filialleitern das Bestellsystem und gab jedem das Gefühl, wichtig zu sein und gebraucht zu werden. Lou versuchte anfangs mitzuhalten, aber sie merkte immer deutlicher, dass die Coffeeshops nicht ihre Welt waren. Ständig unter Leuten, ständig improvisieren, von früh bis spät reden, konferieren, telefonieren und texten und dann noch bis in die Nacht an Restauranttischen taktieren, konspirieren, integrieren und überzeugen. Sie konnte das nicht. Es war nicht ihr Tempo, und es entsprach nicht ihrem Wesen. Tristan schlug vor, dass sie sich mehr um die Büroarbeit kümmerte: Abrechnungen, Mieten, Bestellungen, Gehälter. Sie versuchte das mehrere Wochen lang, aber sie vergaß Überweisungen, sie verlegte Rechnungen, sie ließ Briefe ungeöffnet liegen – es ging so scheußlich schief, dass Lou sich nur noch unbrauchbar und ungeschickt fühlte.
Ihr wurde klar, dass diese Arbeit die grauenhafteste war, an der sie sich jemals versucht hatte, und dass ihr Versagen vor allem daraus resultierte, dass sie sie hasste. Aber ein Gefühl des Scheiterns blieb eben doch, und es schlich sich die Erkenntnis ein, dass Lou von Tristan abgehängt wurde. Tristan machte ihr Mut, stellte ihr frei zu tun, was sie wollte, und sich alle Freiheiten zu nehmen, aber je mehr er leistete, desto mehr sah Lou, was sie nicht schaffte. Und sie konnte noch nicht einmal mit ihm darüber sprechen! Sie konnte doch nicht sagen: He, Tristan, du bist so gut, du bist so sehr Fisch im Wasser, du blühst so sehr auf, wenn du unter Menschen bist, wenn du auf die kleinen und großen Katastrophen reagieren musst – du drückst mich dadurch an die Wand! Während er alles tat und damit erfolgreich war, während er seinen Traum verwirklicht hatte und tagtäglich erlebte, dass er es stemmte, dass eine vierte, eine fünfte Filiale feierlich eröffnet wurde, konnte sie doch nicht hingehen und sagen: Kümmere dich weniger darum, kümmere dich um mich! Stattdessen zog sie sich still zurück.
Natürlich bemerkte er, dass sie das tat, aber er dachte sich nichts weiter dabei. Es war immer noch ihr gemeinsames Projekt. Sie war die Coffee Queen, sie hatte das Logo gezeichnet, das auf jeder Schaufensterscheibe, auf jeder Angebotstafel, auf jeder Tasse, Serviette und Sandwichpackung, auf jedem Briefpapier, auf den Lieferwagen, auf Schürzen und tausendfach im Internet zu sehen war. Und war es nicht auch richtig, dass sie zu Hause blieb und sich um andere Dinge kümmerte, nachdem sie das Haus mit der Brücke gekauft hatten? Nachdem sie Toni zur Welt gebracht hatte? Und dann Fabi?
Als Tristan irgendwann realisierte, dass sie einander verloren hatten, sprach er Lou darauf an. Aber natürlich konnte sie ihm immer noch keine Vorwürfe machen – es gab ja nichts vorzuwerfen. Er machte alles so unglaublich richtig! Und weil sie nichts sagte, er aber doch merkte, dass etwas nicht stimmte, wurde er ungehalten und entfernte sich noch mehr von ihr. Dass sie auf seine Coffeeshops – auf seinen Lebenstraum! – eifersüchtig war, verletzte ihn, und er nahm es als Berechtigung, Trost bei einer anderen zu suchen.
Diese andere war Simone. Schon länger hatte er einen guten Draht zu ihr. Sie war die Filialleiterin eines Coffee Queen, sie zog mit ihm an einem Strang, sie begriff als Erste, was er meinte, wenn er in Meetings eine Idee erklärte, sie war loyal und unterstützte ihn, sie war aufmerksam und sah Dinge, bevor sie ihm auffielen. Und als er sie von der Storemanagerin zur Salesmanagerin der gesamten Kette beförderte, feierten sie das gemeinsam – und schliefen miteinander. Simone verstand auch das ohne viele Worte, sie wusste, dass Tristan mit der Coffee Queen verheiratet war und zwei Kinder mit ihr hatte. Sie hatten eine perfekte geschäftliche Symbiose, sie hatten hervorragenden Sex, und dabei beließen sie es. In Teamsitzungen sahen sie sich an und genossen beide das Gefühl, dass sie mehr wussten als alle anderen. Doch natürlich bemerkten es andere. Es umgab die beiden eine erregte Aura, die körperlich spürbar wurde. Und bei der Eröffnungsfeier eines neuen Cafés sah Lou die Blicke und spürte die Energie und begriff, wie es um Tristan und Simone stand.
Auch Lou hatte Geheimnisse. Nur hatte sie niemanden, mit dem sie sie teilen konnte. Wie verheimlicht man vor kleinen Kindern, dass man nicht die Kraft hat, morgens aufzustehen? Wie schafft man es, den Kindern einen guten Morgen zu wünschen und sie mit Frühstücksdose und gutem Mut im Kindergarten abzuliefern, um danach wieder ins Bett zu fallen? Wie hält man den Anschein eines Zuhauses aufrecht, wenn man das Haus anzünden möchte? Wie schafft man es, nicht den ganzen Vormittag lang zu heulen, weil die Trinkflaschen der Kinder auf dem Frühstückstisch stehen geblieben sind und man wieder einmal daran gescheitert ist, eine gute Mutter zu sein?
Als Lou zusammenbrach, konnte Tristan nicht verständigt werden. Er hatte sein Smartphone ausgeschaltet, weil er mit Simone zusammen war. Er musste einige Cafés im Süden besuchen. Er hatte Lou nicht erzählt, dass Simone ihn begleiten würde. Und in demselben Hotel übernachten würde. Mit ihm in einem Doppelzimmer. Und so erfuhr er erst am nächsten Morgen, dass Lou in einer psychiatrischen Klinik war und Toni und Fabi bei einer Kindergartenfreundin übernachtet hatten.
2
Die Trauerfeier nach der Beisetzung fand im Coffee Queen am Stadtgarten statt. Tristan hatte überlegt, ob sie in die Filiale am Neumarkt gehen sollten, weil sie größer war und sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto besser zu erreichen, aber er hatte sich dann doch für den Stadtgarten entschieden, weil es das ursprüngliche Coffee Queen war. Das allererste, das er damals gemeinsam mit Lou eröffnet hatte. In dem sie wochenlang Tag und Nacht verbracht hatten. Tristan erinnerte sich an die langen Nächte, in denen sie gerechnet und gefiebert und gehofft und gebangt hatten. In denen Lou daran verzweifelt war, die riesigen Aufkleber blasenfrei auf den Fensterscheiben aufzubringen, in denen sie Kaffeetassen mit der Hand gespült hatten, weil sich herausstellte, dass bei der ersten Lieferung der Aufdruck in der Spülmaschine verblasste, und in denen er an der Kaffeemaschine einen Schlag bekam, weil der Installateur sie falsch angeschlossen hatte und Wasser in die Elektrik geflossen war.
Der Laden war brechend voll. Mo stand abseits und registrierte, dass er die meisten Leute nicht kannte, obwohl er seit zehn Jahren Lous Ehemann war. Er tat sich schwer mit Unterhaltungen. Er kümmerte sich um Fritte und Nano, die aber immer mutiger davonliefen und schließlich durch die Trauergäste wuselten. Sie fühlten sich bald hinter der Theke und in der Küche ebenso zu Hause wie Toni und Fabi, die quasi in den Coffee Queens aufgewachsen waren.
Mo beobachtete, wie Tristan geschäftig herumging, Gäste begrüßte und nebenbei für Servietten sorgte und das Buffet überwachte. Er sah Lous Schwester Kitty, die beständig Tristans Nähe suchte und ihn aufhielt. Mo sah Lous Mutter Ilona, die sich am Buffet ein weiteres Glas Wein einschenkte. In den Coffee Queens gab es eigentlich keinen Alkohol, aber bei einer Trauerfeier gehörte er wohl dazu. Lous Stiefvater Karim, ein ruhiger kleiner Mann mit leuchtend brauner Haut, der immer stilvoll gekleidet war und stets ein Büchlein über Vogelkunde in der Tasche seines Jacketts hatte, kam zu Ilona und tauschte ihr Weinglas mit einem Lächeln und ein paar ruhigen Worten gegen ein Wasserglas. Ilona blickte ihn nervös an und ließ es geschehen. Lous alte Freundinnen von der Akademie, Nora, Jenny und Pat, standen beieinander. Nora, mit ihren eigenwilligen grauen Locken die Älteste von ihnen und sicher auch Lous Vertrauteste, hatte verweinte Augen. Sie unterhielt sich mit Toni und nahm sie in den Arm. Mo sah zum ersten Mal Tristans Eltern: Christo mit der kühn gewellten Dichtersträhne und Marianne mit dem glatten weißblonden Haar, hochgewachsen, schlank und mit ihren markanten Wangenknochen immer noch eine Schönheit. Er dachte unwillkürlich an das legendäre Nacktfoto, von dem ihm Toni und Fabi einst aufgeregt erzählt hatten.
Während Mo von einer jungen Frau in dunkler Bluse und Coffee Queen-Schürze einen Tee bekam, gesellte sich Karim zu ihm.
»Ich sehe, du bleibst dir treu«, sagte Karim und lächelte. Er wies auf Mos kurze Anzughose. Mo trug immer kurze Hosen. Zu jeder Jahreszeit und zu jeder Gelegenheit. Seit er denken konnte. Für die Trauerfeier hatte er sich einen Anzug gekauft. Es war der zweite seines Lebens. Sein erster, den er für die Hochzeit gekauft hatte, war zu eng geworden, und er war blau. Also war er mit Toni in eine Herrenabteilung gegangen und hatte schwarze Jacketts anprobiert, bis eines passte.
»Die Hose können wir natürlich kürzen«, hatte der Verkäufer mit einem Blick auf Mos Beine gesagt.
»Ja, bitte.« Mo hatte die Handkante an seinen Oberschenkel gelegt. »Hier über dem Knie.«
Der Verkäufer hatte mehrmals nachgefragt, ob das sein Ernst sei, und erst als Toni den Wunsch bestätigte, füllte er einen Änderungszettel aus, den er sich zur Sicherheit von Mo unterschreiben ließ. Nun stand Mo also in seinem kurzen schwarzen Anzug, der die Tätowierungen auf seinen Beinen sehen ließ, Karim gegenüber. Karims kahler Kopf mit dem perfekt gestutzten Haarkranz glänzte, und sein Goldzahn blitzte auf, als er Mo anlächelte.
»Um ehrlich zu sein, bin ich froh, wenn das hier vorbei ist«, sagte Mo und strich sich über den Bart.
»Ich weiß.« Karim nickte ruhig und trank einen Schluck aus seiner Tasse. »Er macht einen guten Kaffee.«
Mo zuckte mit den Schultern.
Vor der Trauerfeier hatten Mo und Tristan darüber gesprochen, wer von ihnen ein paar Worte sagen sollte. Mo hatte es Tristan überlassen wollen. »Du kannst so was besser«, hatte er gesagt. Doch Tristan hatte vorgeschlagen, dass sie es gemeinsam tun sollten. »Wir stellen uns zusammen da hin. Jeder von uns sagt etwas. Das kriegen wir hin.« Mo war nicht sicher gewesen, ob es eine gute Idee war, aber er hatte zugestimmt. Und schließlich war es dann so gekommen, wie es kommen musste: Sie hatten zwar zusammen dagestanden, aber es war Tristan gewesen, der geredet hatte. Mo hatte sich ein paar Dinge notiert, die er sagen wollte, aber in der Aufregung hatte er dann seinen Zettel nicht gefunden und nur zwei Sätze herausgebracht. Tristan sprang ein, als Mo ins Stocken geriet, und da Tristan im Mittelpunkt des Geschehens, alle Aufmerksamkeit auf sich gerichtet, ganz in seinem Element war, ließ Mo ihn reden.
Irgendwann wurde Nano müde. Er kam zu Mo und sagte: »Ich vermisse Louma.« Mo nahm ihn auf den Arm und sagte: »Ich auch.« Während Nano den Kopf an seine Schulter lehnte, betrachtete Mo das Logo mit der schwungvoll gezeichneten Coffee Queen und erinnerte sich, wie er damals, nachdem er aus der Klinik entlassen worden war, an dem Tisch dort drüben am Fenster gesessen und an Lou gedacht hatte.
Als sich später das Café leerte, schaute Tristan immer öfter auf die Uhr und kam schließlich zu Mo und den Kindern. »Ich muss los«, sagte er. »Mein Taxi kommt jetzt … Ist das wirklich in Ordnung, wenn ich fliege?« Toni und Fabi versicherten ihm, dass es in Ordnung sei, dass sie große Kinder seien, und Mo sei ja immerhin auch noch da.
Tristan umarmte Toni und Fabi und verabschiedete sich von Mo und den beiden Kleinen. Schließlich vergewisserte er sich, dass Ralf, der Storemanager, alles im Griff hatte, bedankte sich bei ihm für seine Bereitschaft, die Trauerfeier zu organisieren, und ging.
Aus dem Taxi rief er Simone an. Natürlich war, wie zu erwarten, in Prag einiges schiefgegangen. Das übliche Durcheinander an den letzten Tagen vor der Eröffnung einer neuen Filiale. Aber Simone hatte es im Griff. Eigentlich hatte sie zur Beerdigung kommen wollen. »Natürlich komme ich. Sie war deine Ex-Frau.« Aber die Filialeröffnung in Prag war wichtig. Und einer von ihnen musste vor Ort sein. Der Einbau der großen Fenster war nicht rechtzeitig fertig geworden, und wenn der Baufirma niemand Druck machte, konnten sie gar nicht eröffnen. Dazu fehlte immer noch eine Genehmigung des Gesundheitsamtes.
Nun saß er zwischen den anderen Fluggästen in der Halle des Terminals, wartete aufs Boarding und trank ein Mineralwasser aus der Flasche (weil der Kaffee der Konkurrenz im Flughafen grauenhaft schmeckte). Zum ersten Mal an diesem Tag hatte er sich um nichts zu kümmern, redete mit niemandem, hörte niemandem zu und kam zur Ruhe.
Das war also die Beerdigung gewesen. Beisetzung der Urne, Trauerfeier, vorbei. Er saß am Flughafen. Ein krasser Schnitt, dachte er: Eben noch zwischen den Kiefern des Trauerwaldes am Rand des Friedhofs, sein vierzehnjähriger Sohn mit der Urne in der Hand, die Beileidsbekundungen von Lous Tanten und Cousins, die er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte – und nun ließ er sein Handgepäck von der Security durchleuchten, zog sich ein Mineralwasser aus dem Automaten und bestieg ein Flugzeug nach Prag.
Der Tag von Lous Beerdigung.
Der Beerdigung der Coffee Queen.
Der Mutter seiner Kinder.
Tonis und Fabis Mutter.
Was tue ich hier eigentlich? Tristan sah sich um, und der Anblick, der sich ihm bot, erschien ihm auf einmal – absurd. Stahl, Beton, Glas, draußen ein startendes Flugzeug, die wartenden Maschinen, ein Passagier wurde ausgerufen, von dem er noch nie gehört hatte und nie wieder hören würde. Sein Boarding wurde angekündigt, und Tristan stand auf.
Zehn Minuten später saß er in einem anderen Taxi und rief Toni an, doch er hörte nur ihre Stimme auf der Mailbox. Er rief Fabi an, doch auch der ging nicht ans Telefon. Als er auf dem Hof des Hauses aus dem Taxi stieg, sah er, dass trotz der Hitze alle Fenster geschlossen waren. »Warten Sie«, sagte er dem Taxifahrer und klingelte an der Haustür, doch niemand öffnete. Er ging ums Haus und schaute durch die Fenster: Niemand war zu sehen. Wo konnten sie nur stecken? Es war schon nach zehn Uhr. Die Trauerfeier war längst zu Ende, und dass Mo mit den Kleinen nach dem zermürbenden Tag noch essen gegangen war, konnte sich Tristan kaum vorstellen. Er rief noch einmal bei Toni und Fabi an, doch auch diesmal ging keiner der beiden ans Handy. Tristan zögerte, Mo anzurufen. Stattdessen schickt er eine WhatsApp: Wo seid ihr?
Er ging zur Brücke über den Bach, während er auf eine Antwort wartete, und es dauerte keine Minute, bis sie kam: Friedhof. Tristan starrte auf sein Handy. Was hatte das zu bedeuten? Der Friedhof hatte längst geschlossen. Er textete: Um diese Zeit? Diesmal kam die Antwort noch schneller: Sind über die Mauer geklettert. Tristan konnte es nicht fassen. Dieser Mistkerl war vollkommen verrückt! Er hatte seine Kinder jahrelang in der Obhut eines Irren gelassen!
Mit den Kindern?!
Nano will Louma nicht allein lassen.
Der Taxifahrer fragte noch einmal nach, ob Tristan wirklich zum Friedhof gefahren werden wollte. »Der hat um diese Zeit geschlossen.«
»Ich weiß, dass der Friedhof geschlossen hat! Fahren Sie einfach los!«
Nachdem der Fahrer ihn abgesetzt hatte und verschwunden war, ging Tristan zum Tor. Durch die schwarz lackierten Gitterstäbe konnte er nichts sehen. Nichts als Bäume, Büsche und Gräber. Tristan schaute die alte Mauer entlang und überlegte, wo sie wohl hinübergeklettert waren. Als er im Beet an der Mauer neben einem Baum eine Mülltonne stehen sah und um die Mülltonne herum Fußspuren in verschiedenen Größen, wusste er die Antwort. Er sah sich um. Kein Mensch. Das Gebäude, in dem der Blumenladen war, hatte im ersten Stock Fenster zu dieser Seite hinaus. Durch die Vorhänge war nichts zu sehen, das Haus machte einen verlassenen Eindruck. In seiner Phantasie sah er eine alte Frau hinter den Gardinen stehen und ihn beobachten. Aber wenn es diese alte Frau je gegeben hatte, dachte er, dann lag sie längst auf der anderen Seite der Friedhofsmauer. Schließlich hielt Tristan sich an dem Baumstamm fest und stieg kurz entschlossen auf die Mülltonne. »Ich glaube das nicht«, sagte er zu sich selbst, als er oben über die Mauer kletterte und auf der anderen Seite hinuntersprang.
Es war noch hell, obwohl die Sonne längst untergegangen war. Um den Trauerwald zu erreichen, musste er erst den klassischen Friedhof mit den rechtwinkligen Grabreihen durchqueren. Vorbei an der scheußlich modern gestalteten Friedhofskapelle, vorbei an den Toiletten, vorbei an der langen Grabreihe für Pfarrer. Plötzlich stutzte er und blieb stehen. Er traute seinen Augen kaum: Auf einer großen Wiese hoppelten in aller Seelenruhe Dutzende von braunen Wildkaninchen umher und grasten in der Abenddämmerung. Mitten auf der Wiese – umringt von den mümmelnden Tieren – kniete ein kleines Mädchen in einem schwarzen Kleid und mit schwarzen Schleifen in ihrem blonden Haar und streichelte eines der Kaninchen mit den Fingerspitzen.
Und als ob das nicht schräg genug wäre, lag in dem kleinen Trauerwald, bei dem Baum, der umringt war von all den Kränzen und Gestecken, die für Lous Beerdigung gespendet worden waren, eine Picknickdecke auf dem Boden. Auf der Decke saßen Mo, Fabi, Toni und auf ihrem Schoß der kleine Nano – und picknickten!
»Toni! Fabi!«, rief Tristan.
Toni kreischte auf. »Papa! Wie kannst du mich so erschrecken!«
»Entschuldige bitte, ich habe versucht anzurufen.«
»Keine Chance. Hier ist kein Netz«, erklärte Fabi.
»Was macht ihr da?«, fragte Tristan. Ihm war klar, dass das eine unsinnige Frage war, weil die Antwort auf der Hand lag. Es sollte weniger eine Frage sein als vielmehr ein Vorwurf.
Trotzdem antwortete Fabi: »Wir picknicken.«
»Ich dachte, du sitzt im Flugzeug«, sagte Toni, während Nano nur aus müden Augen zu Tristan aufschaute.
»Ihr könnt doch nicht einfach … Es ist mitten in der Nacht! Das hier ist ein Friedhof!«
»Möchtest du dich setzen, Tristan?«, fragte Mo. »Du hast sicher Hunger.«
»Ja, Papa, setz dich! Es ist so schön, dass du auch noch gekommen bist!«
»Nein, danke, ich möchte mich nicht setzen. Toni, Fabi, ihr kommt jetzt bitte mit, wir gehen.«
»Aber warum?«, rief Fabi. »Wir wollen hier übernachten. Wir haben ein Zelt mitgebracht.«
»Ohne Stangen«, sagte Nano.
»Das ist mir egal. Kommt jetzt bitte.«
Doch Toni und Fabi wollten nicht. Sosehr sie sich gefreut hatten, ihren Vater zu sehen, so sehr waren sie enttäuscht, dass er sie mitnehmen wollte. Tristan seinerseits war zwar davon ausgegangen, dass sie groß genug waren, am Abend nach der Beerdigung ihrer Mutter allein zu bleiben, aber er hatte nicht erwartet, dass sie groß genug waren, sich schlichtweg zu weigern, mit ihm mitzukommen.
»Wir lassen Fritte und Nano nicht allein«, sagte Toni und schloss ihre Arme enger um Nano.
»Sie sind nicht allein«, erwiderte Tristan. »Mo ist bei ihnen. Er hat das Ganze angezettelt. Er wird sich schon kümmern.«
»Tristan …«, versuchte es auch Mo. Er stand auf. »Jetzt beruhig dich. Es ist ein schöner Abend, es geht allen gut, es wird nichts passieren – niemand wird uns auch nur bemerken.«
»Du bringst die Kinder dazu, auf ein Privatgrundstück einzubrechen! Du bist vollkommen irre!«
»Privatgrundstück?«, sagte Mo. »Was für ein Quatsch!«
»Und misch dich nicht ein, wenn ich mit meinen Kindern rede!«
Mo hob beschwichtigend die Hände, setzte sich wieder und goss sich demonstrativ aus seiner Thermoskanne Tee ein.
Es blieb dabei. Toni und Fabi weigerten sich mitzukommen, Tristan lehnte es ab, sich zu setzen. »Und dafür habe ich meinen Flug sausen lassen«, sagte er schließlich, drehte sich um und ging davon. Die anderen sahen ihm nach.
»Sollen wir nicht doch mitgehen?«, fragte Fabi.
»Nein«, erwiderte Toni. »Er hätte ja bleiben können.«
Mo blickte ihm nachdenklich hinterher und sagte nichts.
Als Tristan den breiten Weg entlangkam, der zum Tor führte, erschrak er: Ein Flügel des eisernen Tores stand offen. Am Tor redete ein Mann mit einem Schlüsselbund in der Hand und einer Schiebermütze auf dem Kopf auf zwei Polizisten ein, und draußen vor dem Tor stand ein Streifenwagen. Tristan atmete tief durch und ging auf die Gruppe zu. Als er bei ihnen ankam, entpuppten sich die beiden Polizisten als Polizistinnen. Eine große Dunkelhaarige, die Kaugummi kaute, und eine kleine Blonde.
»Guten Abend«, sagte er so selbstverständlich wie möglich.
»Sie wissen, dass es verboten ist, sich Zutritt zu einem geschlossenen Friedhof zu verschaffen?«, fragte ihn die Blonde.
»Es tut mir leid«, antwortet Tristan.
»Was treiben Sie hier?«, fragte der Mann mit dem Schlüsselbund. So gelassen die beiden Polizistinnen waren, so wütend war er. Mit seinem Schlüsselbund erinnerte er Tristan an einen Kerkerwächter aus einem alten Film. Der Alte wandte sich an die Polizistinnen: »Zwei Mal in diesem Jahr! Zwei Mal schon hatten wir Grabschändungen! Einmal ist sogar ein Grabstein umgetreten worden!«
»Ich trete keine Grabsteine um«, sagte Tristan. Er knöpfte sein Jackett zu, um unterschwellig auf sein gepflegtes Äußeres hinzuweisen. Er trug immer noch den dunklen Sommeranzug, den er für die Trauerfeier gekauft hatte, und neue Slippers.
»Können Sie sich ausweisen?«, fragte die Große.
Während Tristan seinen Ausweis aus der Brieftasche nahm und ihr gab, erklärte er: »Meine Frau ist heute hier beerdigt worden. Ich wollte nur … Ich wollte nur noch einmal in Ruhe Abschied nehmen.«
»Und das können Sie nicht morgen machen?«, fragte der Kerkerwächter.
»Es tut mir leid«, sagte Tristan.
»Sind Sie allein?«, fragte die Blonde und schaute an Tristan vorbei übers Gelände.
»Ja«, antwortete Tristan. »Ja, ich bin allein.«
»Überprüfen Sie das!«, rief der Kerkerwächter und schüttelte energisch seinen Schlüsselbund.
»Ein Rundgang kann nicht schaden …«, sagte die große Dunkelhaarige.
»Hören Sie«, sagte Tristan und legte all seinen Charme in seine Worte. Er wusste, dass die Polizistinnen Besseres zu tun hatten, als den Friedhof nach Komplizen abzusuchen. »Falls Sie mir ein Bußgeld aufschreiben müssen, bin ich bereit, das zu zahlen. Ich bin nicht betrunken, ich habe nichts zerstört, ich hatte einfach nur Sehnsucht … Ich vermisse meine Frau …« Er legte in den Blick, mit dem er die beiden Frauen ansah, alle Kultiviertheit und alle Vertrauenswürdigkeit, deren er fähig war. Er wusste, dass dieser Blick noch immer seine Wirkung getan hatte.
Die Polizistin gab ihm seinen Ausweis zurück. »Wir verzichten auf ein Bußgeld. Mein Beileid.«
Der Kerkerwächter schimpfte: »Wenn das jeder machen würde!« Aber es war zu spät. Er konnte sich mit seinem Ärger nicht durchsetzen. Tristan warf noch einen letzten Blick durch die Gitterstäbe zurück auf den Friedhof, als der Mann das Tor abschloss.
Als Tristan später allein zu Hause war, fühlte er sich elend. So elend, dass er sich nicht einmal ärgerte, nicht nach Prag geflogen zu sein. Seine innere Unruhe hatte sich zu einer verkrampften Anspannung gesteigert, und die verbohrte Ungeschicklichkeit, mit der er sich selbst am Friedhof ausgegrenzt hatte, machte ihm Angst.
3
Toni saß in ihrem Zimmer und starrte den grünen Rucksack an. Sie hatte sich vorgenommen, ihn heute auszupacken. Endlich.
Der Rucksack duckte sich störrisch.
»Ich packe dich jetzt aus«, sagte sie.
»Untersteh dich«, erwiderte der Rucksack. Er war prall gefüllt, jede seiner Seitentaschen aufgebläht wie die Backen eines erregten Frosches. »Fass mich nicht an. Du wirst es bereuen.«
Toni hatte ihn am Abend vor dem Unfall gepackt. Sie hatte die Tickets und ihren Reisepass noch einmal aufgeschlagen und sich zum wiederholten Male versichert, dass sie nicht aus Versehen Frittes Pass oder eine leere Hülle des Reisebüros mitnahm. Dann hatte sie die Papiere auf den Rucksack gelegt und war schlafen gegangen.
Direkt nach dem Aufwachen war es dann zu dem Streit gekommen. Wegen des verfluchten T-Shirts! Wegen eines Schokoladenflecks! Ihr wurde übel, wenn sie daran dachte. Ihr Magen verkrampfte sich und begann sich umzudrehen. Nur weil sie sich so kindisch aufgeführt hatte, stand der Rucksack noch da. Mit den Tickets, dem Pass und dem Visum. Sie war nicht abgereist. Sie konnte nicht abreisen, aber genauso wenig konnte sie den Rucksack auspacken. Sich eingestehen, dass sie für lange Zeit nirgendwohin reisen würde. Es schien ihr unvorstellbar, dass sie jemals wieder irgendwohin reisen würde. Sie war gefangen in einer Zwischenwelt und wagte nicht, einen Fuß in irgendeine Richtung zu setzen. Und der Rucksack wusste das. Er blähte sich selbstgefällig auf. »Pack mich doch aus«, quakte er. »Wenn du dich traust …«
Als Toni sich auf den Boden kniete und die Hand nach ihm ausstreckte, wurde sie von Hitzewellen überrollt. Sie zog ihren Pullover aus und hockte im T-Shirt auf dem Boden, während ihr der Schweiß den Rücken hinunterlief. Als sie noch einmal versuchte, ihren Arm nach dem Rucksack auszustrecken, kamen die Tränen. Toni saß in ihrem Zimmer vor einem Rucksack, der neu war und niemals benutzt werden würde, und konnte nicht aufhören zu weinen.
Wieso hatte sie sich mit ihrer Mutter gestritten? Wenn sie nicht wegen ihres idiotischen T-Shirts ausgeflippt wäre, dann wäre das alles nicht passiert!
Mo hatte lange wach gelegen. Als er aufstand, aktivierte er sein Smartphone. Es war fünf Uhr früh. Er ging durchs Haus und schaute leise in die Kinderzimmer. Alle vier schliefen. Nano lag quer im Bett, Arme und Beine von sich gestreckt. Er schlief ruhig und entspannt. Mo deckte ihn vorsichtig zu, um ihn nicht zu wecken.
Als er die Treppe hinunterging, sah er vor seinem inneren Auge Lou in ihrem Schlaf-T-Shirt in der offenen Küche stehen und kochendes Wasser über Teeblätter gießen. Noch bevor er unten ankam, war das Bild zerfallen. Niemand war in der Küche.
Dort am Tisch hatte Toni gesessen, mit ihrem Handy, ein Bein untergeschlagen, als Mo das Telefon abgenommen hatte und Tristans Stimme gehört hatte: »Die Polizei hat mich gerade angerufen. Lou hatte einen Unfall … Sie ist tot.«
Nein, hatte Mo gedacht. Das kann nicht sein. Sie ist nur kurz losgefahren, um die Kleinen wegzubringen. Sie kommt jeden Moment zurück. Wir warten hier auf sie, damit wir Toni zum Flughafen bringen können. Sie schreibt gerade eine WhatsApp an Fiona, wo sie sich treffen wollen. Es hat ja Streit gegeben. Das müssen wir noch klären. Toni will sich entschuldigen. Lou hat noch nichts gegessen. Da steht ihr Teller.
Sie kommt jeden Moment zurück. Das war die Gewissheit, in der er fortwährend lebte. Sie kommt nie wieder zurück. Das war die andere Gewissheit. Zwischen diesen beiden wurde er zerrissen.
Mo füllte Wasser in den Kocher und Teeblätter in das Sieb. Als der Tee fertig war, nahm er seine Tasse und schloss die Kräutergartentür auf. Sie nannten sie so, weil sie von der Küche zum alten Kräutergarten hinausführte, obwohl der eigentlich Unkrautgarten heißen müsste. Mo schlüpfte in die alten Crocks, die immer dort standen, ging ums Haus zur Garage und öffnete die Flügeltüren eines der beiden Tore. Im Inneren stand sein alter VW-Bus. Sein Bulli. Die Motorhaube im Heck zwischen den ovalen Rücklichtern stand weit offen. Der Motorraum war leer. Ein Loch mit ein paar nutzlos herumhängenden Kabeln. Der Motorblock stand auf zwei Holzböcken, die meisten seiner Einzelteile lagen verstreut auf der Werkbank. Die Sitze standen auf dem Boden, abgedeckt mit alten Laken. Nachdem er eine Weile ratlos zwischen den Teilen herumgestanden hatte, setzte sich Mo in die offene Seitentür des Bullis.
Er wusste nicht, wie lange er dort gesessen hatte, sein Tee war jedenfalls kalt, als ein Schatten im Tor erschien. Es war Fabi. Er hielt eine angebissene Scheibe Toast mit Nutella in der Hand.
»Hallo, Mo.«
»Hallo, Fabi.« Als Mo ihn im Gegenlicht stehen sah, dachte er, Fabi ist in letzter Zeit etwas in die Breite gegangen. Wahrscheinlich nahm er Anlauf für einen neuen Wachstumsschub. Dabei war Fabi ohnehin schon größer als er.
Eine Weile sagte keiner von ihnen etwas. Fabi biss von seinem Toast ab und kaute. »Eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie wir ihn gemeinsam raus auf den Hof schieben. Ich erinnere mich noch genau an das Geräusch des Motors. Einmal hast du ihn zum Laufen gekriegt.«
Mo nickte. »Eine Runde über den Hof hat er geschafft. Ihr habt gejubelt.«
»Toni und ich haben immer mit den ausgebauten Sitzen Autofahren gespielt.« Er aß den Rest seines Toastes. »Glaubst du, er wird jemals fahren?«
Mo zuckte mit den Schultern. »Mein Traum war immer, dass wir alle zusammen damit verreisen. Wenn ich hier gearbeitet habe, dann habe ich immer ein Bild vor Augen gehabt. Wir alle auf einer Landstraße. Hoch über dem Meer – vielleicht Capri oder so. Die Sonne scheint durch das offene Dach auf uns runter, Louma und ich sitzen vorne, ihr vier Kinder hinten … Louma hat einen Korb neben sich, aus dem sie euch etwas zu essen gibt.« Er sah die Bilder wieder vor sich. Er hatte sie so oft gesehen, dass er sie problemlos abrufen konnte. Er lächelte tapfer. »Aber ich war zu langsam. Ich hab’s nicht geschafft …«
Es war still in der Garage. Mo saß vor dem leblosen Motorblock und kämpfte gegen die Tränen.
»Tut mir leid«, sagte Fabi. »Ich wollte nicht …«
»Schon gut. Es ist nur ein altes Auto …«
Tristan war auf seiner Dachterrasse, als der Anruf kam. Er hatte sich einen Tag freigenommen, weil man ihm am Vortag eine neue Sitzgruppe aus wetterfestem Rattan geliefert hatte. Sie sah auf Tropenholz und zwischen den großen Bottichen mit knorrigen Oliven- und schlanken Zitronenbäumchen wirklich einladend aus. Nachdem die Transporteure die edlen tiefroten Sitzpolster aus ihren Plastikhüllen ausgepackt hatten, beschloss Tristan, sich einen freien Tag zu gönnen, um auf dem neuen Sofa Kaffee zu trinken und den Sommertag zu genießen. Am Nachmittag sollte er Toni zum Flughafen bringen – der große Tag war da –, warum also nicht gleich den ganzen Tag schwänzen?
Doch als er dann dort saß, unter dem farblich passenden Sonnenschirm vor der Vormittagssonne geschützt, war er keineswegs entspannt. Vielmehr wurde er von einer inneren Unruhe getrieben, die er nicht in den Griff bekam. Dieses Gefühl begleitete ihn seit Längerem hartnäckig, und er wurde es nicht los, was auch immer er versuchte. Er las eine Weile auf dem Tablet die Tageszeitung, er brühte sich einen weiteren Espresso macchiato auf, er stellte sich ans Geländer und schaute über die Dächer der Stadt zu den Domspitzen in der Ferne, er setzte sich und versuchte es mit der Betrachtung seines Lieblingsolivenbaumes, er probierte es sogar mit einem Buch, das seit Wochen mit einem Zuckertütchen von Coffee Queen als Lesezeichen neben seinem Bett lag. Während er las, musste er schon auf den ersten Seiten mehrmals dem Reflex widerstehen, seine Mails zu öffnen. Als er es schließlich tat, überkam ihn beim Anblick des ellenlangen Posteingangs ein so beklemmendes Gefühl in der Magengegend, dass er nicht in der Lage war, sie zu lesen. Dabei liefen die Coffee Queens inzwischen wieder gut. Es war knapp gewesen, aber Tristan hatte die Corona-Krise überstanden. Er hatte all seine Rücklagen, sein privates Vermögen, investieren müssen, um die Kette zu retten. Um das Personal so gut wie möglich zu halten, um die Mieten und die anderen laufenden Kosten zu zahlen. Die Schwierigkeiten hatten ihn zu persönlichen Höchstleistungen angetrieben, und er hatte nicht nur all seine Filialen retten können, sondern am Ende sogar noch Standorte in Tschechien und Österreich übernommen. Damit hatte er sich selbst an den Rand des Abgrunds gebracht, aber er hatte es geschafft. Er war erfolgreich, seine Arbeit machte ihm Freude, und er bekam viel Bestätigung. Alles war bestens. Bis auf den inneren Druck.
Simone war der Meinung, es sei Burn-out. Aber das war es natürlich nicht. Sie waren jetzt seit einem Jahr wieder zusammen, zum zweiten Mal, nachdem sie eine Weile getrennte Wege gegangen waren. Er hatte ein paar ebenso beliebige wie kurzlebige Beziehungen gehabt, Simone war mit einem Mann zusammen gewesen, den er nie kennengelernt hatte, und dann hatten sie auf einer gemeinsamen Reise zu Kaffee-Kooperativen in Kolumbien wieder zusammengefunden. Er begriff inzwischen immerhin, dass das nicht richtig gewesen war. Sich selbst und Simone gegenüber nicht ehrlich. Simone kannte ihn gut genug, um zu spüren, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er widersprach nicht, wenn sie von Burn-out sprach, und auch ihre ernst gemeinten Scherze über seine Midlife-Crisis ließ er im Raum stehen. Er wusste, dass es nicht fair war. Es war nicht fair, ihr die Wahrheit zu verschweigen. Aber er konnte ihre Beziehung nicht beenden. Er hatte Angst, dann endgültig ins Bodenlose zu stürzen.
Kurz vor Ostern (war das wirklich schon so lange her?) hatte er sich drei Mal mit Lou getroffen. Er hatte einige Hoffnung in diese Treffen gelegt. Auch das hatte er Simone verschwiegen.
Wenn er arbeitete – im Büro, in den Cafés, auf Reisen, bei Konferenzen und Arbeitsessen –, ging es ihm etwas besser, doch auch das funktionierte immer schlechter. Sobald er ein wenig Druck wegnahm, kroch die Unruhe herauf. Und am deutlichsten ergriff sie ihn, wenn er an Tonis Abreise dachte. Dann wühlte sie in seinen Eingeweiden. Seine Kleine ging für ein halbes Jahr ins Ausland. Gerade erst hatte er sich von Lou scheiden lassen – und plötzlich war Toni erwachsen. Sie war einfach so groß geworden, und er saß hier mit Olivenbäumchen und Designermöbeln. War es wirklich zehn Jahre her, dass Lou und er sich getrennt hatten? Die Vorstellung, gleich am Flughafen zu stehen, quälte ihn. Mit Lou, mit den Kindern – aber zum Glück nicht mit diesem Blindgänger, von dem er bis heute nicht begriff, was Lou an ihm fand.
In diese innere Unruhe hinein klingelte das Telefon. Die Polizei rief nicht bei Mo an, der Lous Ehemann war, sondern bei Tristan, dem Ex-Mann. Das lag daran, dass der Wagen auf seinen Namen angemeldet war. Formal war es ein Geschäftswagen, und er setzte ihn von der Steuer ab. Dies gehörte zu den zahlreichen Verflechtungen, die immer noch zwischen ihm und Lou bestanden.
Gegen Mittag kamen Ilona und Karim. Karim spielte mit den Kleinen ein Spiel, aber sie brachen ab, weil keiner bei der Sache war. Karim zog sein Büchlein über Vogelkunde aus der Tasche seines Jacketts und schlug vor, mit ihnen hinauszugehen und Vogelrufe zu bestimmen. Das funktionierte besser. Auch wenn es in ihrem Zustand unmöglich erschien, Interesse für Vogelstimmen aufzubringen, fanden sie es doch beruhigend, mit dem geduldigen Opa Karim draußen zu sein. Nachdem die beiden Großen noch eine Weile bei Ilona und Mo am Tisch ausgehalten hatten, erlaubte er ihnen, in ihre Zimmer zu gehen. Deshalb blieb er schließlich allein mit Ilona zurück. Es war von Ilona sicherlich gut gemeint gewesen zu kommen, aber Mo wäre lieber mit den Kindern allein gewesen. Er nahm es hin, weil er merkte, dass Karim den Kleinen guttat. Seine ruhige Freundlichkeit war gut, und auf Vogelrufe zu horchen war gut. Also trank er mit Lous Mutter schweigend Tee.
»Was werdet ihr mit Louises Kleidern machen?«
»Ich weiß es nicht, Ilona. Darum mache ich mir später Gedanken.«
Wieder Schweigen. Und irgendwann sagte Ilona in die Stille hinein: »Dann werden die Kinder jetzt wohl auseinander müssen.«
Mo schenkte sich noch einen Tee ein. Seine Hand zitterte.
»Ich meine, jetzt, wo Louise nicht mehr … Toni und Fabi werden doch wohl zu ihrem Vater gehen.«
»Sie sind bei ihrem Vater.«
»Aber es sind doch Tristans Kinder!«
Es sind nicht Tristans Kinder. Wir leben seit zehn Jahren zusammen! Es sind meine Kinder! Wieso sollten es seine Kinder sein? Er interessiert sich nicht für sie!
»Ihr müsst jetzt gehen«, sagte Mo und stand auf.
Ilona sah ihn erstaunt an. »Was ist los mit dir?«
Wo sind die Kinder? Warum sind die Kinder nicht bei mir? Warum muss ich hier mit Lous Mutter sitzen, und die Kinder ziehen sich zurück. Werden von Karim beschäftigt.
»Ich danke euch für euren Besuch.« Er ging zur Kräutergartentür, um Karim zu rufen.
Als sie zum Auto gingen, beteuerte Ilona: »Wir haben es nur gut gemeint. Man will doch da sein.«
Karim sagte: »Es ist in Ordnung, wenn sie allein sein wollen.« Und zu Mo: »Ruf mich jederzeit an.«
Später saßen sie zu fünft beim Abendessen: Mo, Toni, Fabi, Fritte und Nano. Es war ein harter Tag gewesen, und alle waren erschöpft. Keiner sagte etwas. Nicht einmal Fritte. Sie trug seit Tagen ihr schwarzes Kleid von der Beerdigung. Das Kleid ließ ihre schmalen Schultern frei. Im Kontrast zu ihren blonden Haaren und ihrer durchschimmernden Haut wirkte das Schwarz des Kleides noch schwärzer. Mo hatte ihr am Morgen gesagt, sie solle ein anderes anziehen, irgendeines, das sie gern mochte, aber sie wollte nicht. Sie wollte das schwarze.
Alle stocherten in ihrem Essen herum, keiner aß. Lous Stuhl war leer. An ihrem Platz stand kein Teller. Es lag kein Besteck da, weil niemand da war, der es benutzen würde, und deshalb stand dort auch kein Glas. Niemand schaute hin. Niemand schaute irgendwohin.
Dann werden die Kinder jetzt wohl auseinander müssen. Er schaute die vier an, die schweigend vor ihren Tellern saßen. Wie konnte man den Rest dieser Familie auch noch auseinanderreißen? Wieso sollten diese Kinder nach ihrer Mutter nun auch noch zwei ihrer Geschwister verlieren?
Nach der Trennung von Lou und Tristan waren Toni und Fabi regelmäßig bei Tristan gewesen: jedes zweite oder dritte Wochenende sowieso, dazu mehrere Wochen in den Ferien und gelegentlich, wenn es die Umstände erforderten. Zum Beispiel als Fritte und dann später Nano geboren wurden. Vor allem in der schweren Zeit nach Frittes Geburt, als der Herzfehler diagnostiziert worden war und Lou und Mo mit den Aufnahmen von Frittes Herz von einem Spezialisten zum nächsten gefahren waren, um die Möglichkeiten und Risiken einer Operation zu diskutieren. Es war eine schwere Zeit für alle gewesen, die Nächte am Kinderbett, die sorgenvollen Tage, die Telefonate, die Briefe, die Recherchen im Internet. All die Ängste ließen die Scheidung von Lou und Tristan weit in den Hintergrund treten. Wer will in einer solchen Lage streiten? Selbst Simone hatte sich damals in das Unvermeidliche gefügt, hatte Toni klaglos zur Schule gefahren und hatte sich um die beiden gekümmert, wenn Tristan für Coffee Queen unterwegs war.
Toni hatte anfangs mehr Schwierigkeiten mit dem neu hinzugekommenen Vater Mo gehabt. Fabi war noch so klein gewesen, und Mo hatte sich gleich zu Beginn so unaufgeregt und ruhig in die Familie eingefügt, dass er in ihm eher eine Art Vertrauensperson in dem Scheidungsdurcheinander seiner Eltern sah. Mo hatte die Verlässlichkeit eines alten Baumes ausgestrahlt. Sie wussten zu der Zeit noch nicht, dass Lou ihn in der Klinik kennengelernt hatte und er über den Rand des Abgrunds hinausgesehen hatte. Aber im Nachhinein lässt sich wohl sagen, dass er genau deshalb diese Coolness besaß: Ihn brachte nichts mehr aus der Fassung. Als dann der Sturm um das Baby mit dem Herzfehler losbrach, erlebten sie Mo als so ernsthaft und so sorgenvoll – sie sahen ihn mehrfach auch weinen –, dass es ihnen überhaupt nicht in den Sinn kam, eifersüchtig zu sein oder Mo als Eindringling zu empfinden. Und im Übrigen fanden sie einen Typen mit Tattoos auf den Armen und Beinen erst einmal faszinierend.
»Hast du die gemalt?«, hatte Toni Lou gefragt, weil sie schon oft das Talent ihrer Mutter fürs Zeichnen bewundert hatte.
Lou besaß eine Menge Bücher mit Zeichnungen und konnte stundenlang am iPad im Internet surfen und sich in alles Gezeichnete vertiefen: alte Meister, Cartoons, historische Reiseskizzen, Architekturansichten, Fantasyillustrationen – einfach alles. Manchmal hatte Toni im Arm ihrer Mutter gesessen, und Lou hatte sie auf das eine oder andere aufmerksam gemacht. Auf einen besonders schönen Strich, eine ungewöhnliche Bildaufteilung, den Umgang eines Zeichners mit Licht und Schatten oder die verblüffende Einfachheit, mit der Rembrandt Figuren andeutete. Auch wenn Toni vieles davon erst einmal nicht verstand, spürte sie die Faszination ihrer Mutter. Als Toni dann die Tätowierungen auf Mos Armen und später auf seinem Rücken sah, hatte sie die natürliche Vorstellung, dass ihre Mutter ihn der Zeichnungen wegen mochte. Dass Lou bei der Betrachtung der Formen und Farben auf seinem Körper die Zeit vergaß und ihn allein deswegen gern um sich hatte.
4
Zwei Tage vor der Beerdigung hatte Tristan in Lous und Mos Küche gestanden. In der Küche, die er selbst eingerichtet hatte, als Lou mit Toni schwanger gewesen war. In Lous und seiner Küche. Er war überrascht, wie sehr ihn die Nachricht von Lous Tod mitnahm. Sie waren seit zehn Jahren getrennt. Er hatte vor Lou unzählige Beziehungen gehabt, und auch nach Lou hatte es mehrere Frauen gegeben. Aber in dem Moment, als er begriff, dass Lou tot war, wurde ihm bewusst, dass sein Leben aus drei Abschnitten bestand: vor Lou, mit Lou und nach Lou. In all dem Kommen und Gehen, in all dem Fluss stand Lou fest und unumstößlich wie ein Fels. Er verstand das nicht. Ausgerechnet Lou! Die jahrelang selbst so haltlos gewesen war. Und jetzt war er es, der in die Strömung geraten war. Seit ihren Gesprächen zu Ostern hörte er das Tosen des Wasserfalls, auf den er zutrieb.
Es ließ sich nicht umgehen, dass er mit Mo redete. Es gab Dinge zu regeln, die sie beide betrafen. Durch Lous Tod steckte er in einem Dilemma, aus dem er keinen Ausweg sah. Und auch wenn Mo nach wie vor der letzte Mensch auf diesem Planeten war, mit dem er reden wollte, waren sie schließlich erwachsene Menschen, die kultiviert miteinander umgehen konnten.
»Ich bin gerade dabei, meine ersten Filialen in Tschechien zu eröffnen. Ich muss ständig reisen«, sagte er und wischte mit dem Daumen über den Bildschirm seines Smartphones. »Den Termin für die Beerdigung habe ich mir freigeschaufelt. Aber ich muss gleich danach weg. Eigentlich am Abend noch. Wäre es okay für dich, wenn ich die Kinder erst Donnerstag oder Freitag abhole?«
»Freigeschaufelt?«, fragte Mo.
»Wie bitte?«
»Du hast dir den Termin für die Beerdigung freigeschaufelt.«
»Sehr witzig! Hauptsache, du amüsierst dich.«
»Alles, was du sagst, ist witzig, merkst du das gar nicht?«
»Weil ich dich bitte, die Kinder drei Tage zu nehmen? Was ist daran witzig?«
»Weil du deine Kinder sogar an dem Tag, an dem ihre Mutter beerdigt wird, allein lässt. Und weil du redest, als ob ich deine Ex-Frau wäre!«
»Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt mit dir rede.«
»Was wird Simone dazu sagen, wenn deine Kinder ab sofort immer bei dir sind? Wird ihr das gefallen? Dann könnt ihr ja gar nicht mehr in ihrem Cabrio cruisen.«
»Ich habe nicht vor, mit dir über Simone zu sprechen.«
»Warum nicht? Wir reden ja auch über meine Frau.«
»Unsere Frau.«
»Im Ernst. Wie soll das weitergehen? Du lässt die beiden schon bei der Beerdigung allein, weil du wichtige Termine hast.« Bei dem Wort wichtig malte er ironische Anführungszeichen in die Luft.
Da war es. Tristans Dilemma. Er führte eine Beziehung mit einer Frau, die sich entschieden hatte, keine Kinder zu bekommen. Sie hatten beide eine beglückende und befriedigende Arbeit und genossen ihre Freiheit. Wenn Toni und Fabi am Wochenende kamen, unternahmen sie etwas gemeinsam – zumal die beiden inzwischen in einem brauchbaren Alter waren –, und wenn Tristan und Simone zufälligerweise einmal genau für den Abend Theaterkarten hatten, dann konnten sie Toni und Fabi allein lassen. Die gemeinsamen Mahlzeiten waren etwas abenteuerlicher, weil sie anstrengende Diskussionen über vegetarische und vegane Ernährung, über Verpackungen, Autofahren und Flugreisen führen mussten, aber es waren nur zwei Mahlzeiten alle zwei Wochen. (Und Tristan musste sich eingestehen, dass er ohne die beiden nie so früh und nie so konsequent Coffee Queen auf Nachhaltigkeit getrimmt hätte.) Wenn die beiden nun aber dauerhaft bei ihm lebten, würde das Konstrukt zusammenbrechen. Sowohl was seine Beziehung mit Simone anbelangte als auch was seine Arbeit betraf. Er war hohe Risiken eingegangen, um Coffee Queen auszuweiten, hatte alles einsetzen müssen, um die Krise zu überstehen. Alles, was er über die Jahre aus den Cafés gewonnen hatte, war wieder zurückgeflossen, um die immensen laufenden Unkosten zu decken und Coffee Queen zu erhalten. Er würde die nächsten Jahre hart arbeiten müssen. Wenn er abends überhaupt nach Hause kam, würde es spät werden.
Er hatte natürlich mit Simone darüber gesprochen. Ihnen beiden war klar, dass er die Kinder zu sich nehmen musste. Und ihnen beiden war klar, dass es unmöglich war. Simone hatte gesagt: »Wir wollten eigentlich keine Kinder …« Sie hatten im Bett gelegen, alle Fenster weit offen, weil es in der Dachwohnung unerträglich heiß war.
»Das weiß ich, Simone. Aber ich habe nun einmal Kinder.«
»Die Idee war, dass Toni und Fabi bei ihrer Mutter sind.«
»Ihre Mutter ist leider tot.«
Eine Weile lagen sie schweigend im Bett. Dann sagte Simone: »Die beiden Großen von Borgsmüller sind im Internat. Sie sind da glücklich. Segeln, spielen Hockey …«
»Haben keine Familie …«