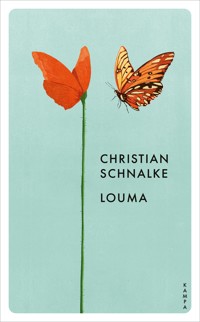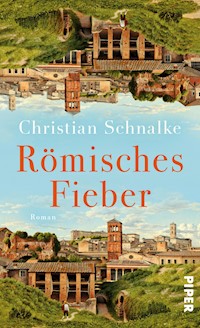Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei hoffnungslos zerstrittene Schwestern: Die flatterhafte, schöne und bei allen beliebte Fiona ist vor zehn Jahren nach immer unerträglicheren Streitereien abgehauen und nicht mal auf der Beerdigung ihrer Mutter aufgetaucht. Grit, die fürsorgliche, vernünftige Ältere, bemüht sich um ein geordnetes Leben, damit ihre elfjährige Tochter Milli sorgenfrei aufwachsen kann. Doch plötzlich steht Fiona vor der Tür und tut, was sie nach Grits Überzeugung am besten kann: Sie macht alles kaputt. Fiona fordert von Grit ihre Tochter zurück - und Milli erfährt, dass in Wahrheit Fiona ihre Mutter ist. Grits Leben liegt in Scherben. Doch die wahre Leidtragende ist Milli - und zugleich die Einzige, die weiß, was zu tun ist: Sie muss die beiden Schwestern miteinander versöhnen. Grit und Fiona stellen sich ihrer Vergangenheit. Und das Ungeheuer, das dort lauert, lässt sich nur mit gnadenloser Ehrlichkeit bezwingen …Ein dramatischer, berührender Roman über die Frage, wie es passieren kann, dass man sich unendlich gut kennt - und eines Tages nicht mehr versteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Schnalke
Gewitterschwestern
Roman
Oktopus
Gewidmet allen Schwesternschwestern.
»Jetzt, Schwester, redet!«
Friedrich Schiller: Maria Stuart.
Dritter Aufzug, vierter Auftritt,
Maria zu Elisabeth
Prolog
Grit war am Ende ihrer Kräfte. Sie konnte nicht mehr. Ihre Oberschenkel brannten, sie hatte Blasen an Fersen und Handflächen, und der Gurt schnitt in ihre Schulter, dass sie glaubte, ihr Kopf fiele jeden Moment ab. Ihre Hände waren verkrampft, ihr linkes Knie war von einem der Stürze aufgeschlagen, ihre Lippen waren trocken und aufgesprungen, auf Nase, Wangen und Stirn hatte sie einen üblen Sonnenbrand, und sie wusste genau, dass es nur noch wenige Schritte dauern würde, bis ihr Rücken endgültig durchbrach. Wenn nicht vorher noch ihr Herz platzte oder ihre Lunge kollabierte. Hier war die Grenze. Mehr konnte sie nicht ertragen. Sie kämpfte sich auf die Beine und keuchte: »Weiter. Los, kommt. Weiter. Bringen wir es hinter uns.«
Grit legte sich den Riemen über die Schulter, während sich auch Fiona aufrappelte. »Na, endlich«, keuchte Fiona. »Ich dachte schon, du gibst auf.«
»Vergiss es. Diesmal mache ich dich fertig.«
»Lächerlich …«
Auch Fiona schulterte ihren Gurt. Sie hoben den Sarg an, wobei er hohl gegen den Felsen polterte.
»Und lass dich nicht wieder die ganze Zeit ziehen!«
»Ziehen? Ich schiebe dich doch!« Grit stieß Fiona den Sarg ins Kreuz, und die beiden Schwestern stolperten weiter.
1
Grit hatte die Burg gewollt. Sie hatte immer eine Burg gewollt. Schon als kleine Mädchen hatten Fiona und sie davon geträumt, eines Tages auf einer Burg zu leben. Für Fiona war es vielleicht nur ein Kinderspiel gewesen, aber Grit hatte es ernst gemeint.
Die meisten Leute sagten, es sei überhaupt keine Burg. Jedenfalls keine richtige. Grit sah das anders. Es gab einen Hof, es gab eine Mauer – wenn auch nur eine halbe –, und es gab außerhalb der halben Mauer eine Mulde, die einmal ein Burggraben gewesen sein könnte. Sie war vollkommen zugewuchert von dornigen Brombeeren, den riesigen Blättern Gemeiner Pestwurz und von Haselnusssträuchern, die bis zu den Fenstern im ersten Stock hinaufragten, den einzigen Fenstern auf dieser Seite des Hauses. Es wuchsen dort hohe Dolden von Rotem Fingerhut, vor denen Grit die kleine Milli eindringlich gewarnt hatte, weil sie giftig waren, und im April blühten ganze Teppiche von Bärlauch, von dem man Grit gesagt hatte, dass sie ihn ernten könne. Sie scheute aber davor zurück, weil sie Angst hatte, ihn mit Aronstab oder der Herbstzeitlosen zu verwechseln, die ebenfalls hochgiftig sind. Jenseits der Wiese, am Waldrand, blühten zur selben Zeit Unmengen von Buschwindröschen.
Die herrlichste Zeit auf der Burg war aber der Sommer. Auf den Feldern und Wiesen rundherum blühte der Mohn, und die halbe Burg sah aus, als schwebe sie auf einer Wolke aus leuchtend roten Blüten. Nachmittags saßen sie im Schatten der alten Platane im Burghof, abends auf dem Balkon oben auf der alten Mauer, wo sie ans Haus stieß und sich zu einem kleinen Plateau verbreiterte. Sie saßen bis tief in die Nacht draußen, im Schein von Kerzen und einer bunten Lichterkette, mit Cora oder mit anderen Freunden, während Milli mit dem Kopf auf Grits Schoß einschlief. Im Winter, wenn die Bäume kein Laub trugen, konnte man von dort oben weit in der Ferne die spitzen Türme des Doms sehen und ein paar hohe Schornsteine in der Rheinebene. Wenn das alte Haus auch den Vorteil hatte, dass es sogar an den heißesten Tagen zum Schlafen angenehm kühl war, so lebte es sich im Winter – das musste Grit zugeben – oft nicht so angenehm.
»Immer friert man«, maulte Milli.
»Du musst dich wärmer anziehen«, erklärte ihr Grit.
»Was soll ich denn noch anziehen? Handschuhe und Mütze?«
»Jetzt übertreib nicht. Dafür leben wir in einer Burg!«
»Andere Leute leben in einem Niedrigenergiehaus. Einem Passivhaus. Mit Solaranlagen. Wärmetauschern. Effizienter Wärmedämmung.«
»Eine Solaranlage plane ich auch. Vielleicht nächstes Jahr.«
»Es ist ja nicht einmal eine richtige Burg! Es ist nur ein schäbiges, uraltes Haus, das sich nicht heizen lässt und viel zu weit von allem weg ist. Und wenn man warmes Wasser aufdreht, dann röchelt es irgendwo, als ob in einer hohlen Wand einer stirbt.«
Tatsächlich hatte die Behauptung, es sei keine Burg, viel für sich, denn es gab um den Innenhof außer der halben Mauer zwar das Haus mit bemerkenswert kleinen Fenstern und ein ehemaliges Stallgebäude, aber es gab keinen Turm, es gab kein Verließ, es gab keine Kapelle, es gab keine Zugbrücke, die Scheune war zu einem Haufen Steine und Ziegel zusammengefallen, und alles zusammen war kleiner als ein Bauernhof auf einer Kinderzeichnung. Das Herrenhaus, wie Grit es nannte, machte eher den Eindruck, als sei es ein Dienstbotenhaus gewesen. Von einem wirklichen Herrenhaus, das den Namen verdiente, keine Spur. Die Burg war an die vierhundert Jahre alt, und genauso sah sie auch aus. Heruntergekommen. Deshalb hatte Marek sie damals auch für einen symbolischen Betrag vom Landkreis kaufen können. Mit der Verpflichtung, alles zu renovieren und zu erhalten, denn dem Landkreis, der die Burg geerbt hatte, fehlte dafür das Geld. Marek hatte damals plötzlich viel verdient, nachdem er in eine Firma für Elektroscooter investiert und mehrere Städte überzeugt hatte, ihm Lizenzen für das Sharing seiner Scooter zu erteilen. Kurz darauf hatte er sich dann allerdings von Grit getrennt und ihr die Burg überlassen, was wegen der daran hängenden Verpflichtungen juristisch nicht einwandfrei war. Aber das kam erst Jahre später ans Licht. Natürlich fehlte Grit das Geld für die Renovierungen. Sie tat, was sie konnte, steckte selbst so viel Arbeit wie möglich in die Burg und überredete immer mal wieder einen Unternehmer, ihr für kleines Geld oder auf Pump zu helfen. Der Landkreis schrieb regelmäßig Mahnungen und Vorladungen, drohte, den Vertrag zu kündigen, wenn die Arbeiten nicht unverzüglich erledigt würden, aber da es unbestreitbar voranging, folgten lange Zeit keine Konsequenzen. Es hatte Grit viel Mühe gekostet, immer wieder bei den entsprechenden Stellen vorzusprechen, aber sie war erfolgreich gewesen.
Jedenfalls manchmal. Es war ein fortwährender harter Kampf. Es hatte Rückschläge gegeben, sie hatte Geld aufgetrieben, sie hatte die Renovierungen vorangebracht, und sie hatte ihre Schulden teilweise abgezahlt. Es sah hoffnungsvoll aus, bis sie dann diesen Gutachter ohrfeigte.
»Die können mich mal!«, sagte sie zu ihrer Freundin Cora. »Die Burg steht jetzt seit vierhundert Jahren. Sie wird wohl nicht gleich einstürzen, wenn ich nicht sofort all mein Geld hier reinstecke!«
»Welches Geld?«, fragte Cora.
»Du könntest symbolisches Geld reinstecken«, schlug Milli vor.
»Handwerker arbeiten leider nicht für symbolisches Geld«, entgegnete Grit.
»Ist nicht alles Geld symbolisch?«, fragte Milli.
»Da hast du recht«, stimmte Grit ihr zu. Und der Gedanke, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie dieses symbolische Geld beschafft hätte und die Burg in neuem Glanz erstrahlen würde, brachte ihr Zuversicht. Was für ein kluger Gedanke für eine Elfjährige! Alles Geld ist symbolisch. Man muss nur daran glauben, dass man es bekommt.
»Hallo, Milli«, sagte Grit, als Milli in die Küche kam, wobei sie wie immer leicht humpelte. Es war schon fast fünf Uhr, Milli hatte am Nachmittag noch Sport gehabt. Es nannte sich Sport, aber meist saßen sie nur herum und warteten auf irgendetwas. Erst warteten sie auf Frau Krug, ihre Sportlehrerin, dann warteten sie darauf, dass alle umgezogen und versammelt waren, weil die Jungen meist noch wild in der Halle herumrannten und gegen die Matten sprangen oder sich gegenseitig traten. Als Nächstes warteten sie, bis Frau Krug die Klassenliste abgehakt hatte, was in der Regel lange dauerte, denn einige Kinder waren schon wieder verschwunden, um doch noch auf Toilette zu gehen oder sich in den Geräteräumen zu verstecken und erst dann wieder herauszukommen, wenn Frau Krug sie als fehlend eingetragen hatte. Danach wurden alle möglichen Geräte aus den Geräteräumen herausgeschafft und aufgebaut, wobei einer der Jungen mit dem Mattenwagen über seinen Fuß fuhr und Frau Krug sich um ihn kümmern musste. Und wenn endlich alles aufgebaut war, erklärte Frau Krug, was sie in welcher Reihenfolge tun sollten, und das war meist so kompliziert, dass sie es mehrmals wiederholen musste. Das Ganze endete damit, dass alle in Schlangen an den jeweiligen Geräten standen und warteten, bis sie an der Reihe waren. Denn sobald Frau Krug ihnen den Rücken zuwandte, gaben die Kinder, die gerade dran waren, das Gerät nicht mehr frei, sondern spielten so lange an den Ringen oder auf den Kästen oder dem Trampolin, bis Frau Krug es bemerkte. Milli hatte also in dieser Sportstunde ein paar Mal an den Ringen geschwungen und war über einen Kasten geklettert, über den sie eigentlich hätte springen sollen, wobei sie sich wehgetan hatte, weil sie mit dem Knie dagegen gestoßen war. Zwei Jungen hatten dreckig gelacht, aber das taten sie natürlich nur, weil sie hofften, Milli so sehr zu beschämen, dass sie den Kasten gleich wieder freigab. Was ihnen auch gelang. Milli verzog sich lieber früher als später. Sie war froh, dass die Zeiten vorbei waren, in denen sie ständig wegen ihres Fußes und ihrer orthopädischen Schuhe gehänselt worden war. Aber es steckte ihr noch in den Knochen, weshalb sie versuchte, möglichst wenig Anlass für Spott zu bieten.
Als Milli in die Küche kam, war ihr Gesicht gerötet und schweißnass, denn sie war gerade durch die Augusthitze geradelt. Tapfer fuhr sie jeden Morgen sieben Kilometer weit zur Schule und am Nachmittag dieselbe Strecke zurück. Den größten Teil des Weges legte sie mit ihren Freundinnen Jennifer und Lea zurück, aber nur, wenn Milli sich nicht verspätete. Denn obwohl Grit schon mehrfach ihren Müttern ins Gewissen geredet hatte, warteten die Mädchen dann nicht, sondern ließen Milli alleine fahren. Sie waren keine wirklichen Freundinnen.
Auf der Arbeitsplatte lagen geschälte Möhren und Kartoffeln. Auf dem Herd stand ein Topf mit Wasser, das aber noch kalt war. Grit telefonierte, wobei sie hauptsächlich zuhörte und das Mikrophon stummschaltete, um nebenbei mit Milli zu sprechen.
»Hast du Hände gewaschen?«
»Wie denn, ich komme doch grad erst rein.«
»Dann wasch sie bitte.«
»Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen«, sagte Milli, während sie ins Bad ging.
»Wie war’s in der Schule?«, rief Grit aus der Küche.
»Blauer Fleck.«
»Wie viele?«
»Einer.«
»Also ein guter Tag.«
Als Milli zurück in die Küche kam, nahm Grit ihr behutsam die Brille ab, begann, sie mit einem Küchentuch zu putzen und sah mehrmals hindurch, bis sie zufrieden war. Dann schob sie die Bügel vorsichtig wieder über Millis Ohren. »So, jetzt kochen wir zusammen.«
Milli hätte sich am liebsten einfach nur auf die Eckbank gesetzt, obwohl sie eigentlich sehr gern mit ihrer Mutter kochte.
»Setz dich hin«, sagte Grit, als ob sie Millis Gedanken gelesen hätte. (Milli hatte oft den Verdacht, dass Mütter so etwas können.) »Du kannst die Möhren in Scheiben schneiden, den Rest mache ich.« Sie legte das Schneidebrett und ein Messer auf den Esstisch. »Und nun erzähl, was passiert ist.«
Während sie noch beim Essen saßen, klingelte wieder Grits Telefon. Milli hoffte, dass Grit den Anruf nicht annehmen würde. Das tat sie manchmal. Aber sie schaute aufs Display und sagte: »Tut mir leid, Kleines, da muss ich drangehen.«
Grit hörte eine Weile zu, während der sich die angespannte Mulde zwischen ihren Augenbrauen zu einer wütenden Falte verhärtete, und sagte dann entschieden: »Alicia, wir müssen die Polizei rufen. – Ja, ich weiß, dass er dein Vater ist. Aber er wird es wieder tun. – Auch wenn er es versprochen hat. Deine Mutter wird nie etwas unternehmen. – Nein, ich kann jetzt nicht kommen. Wir haben das alles oft genug durchgesprochen.«
Milli war daran gewöhnt, dass ihre Mutter solche Telefonate führte. Grit arbeitete als Sozialarbeiterin beim Jugendamt und hatte den Bereich mit den hoffnungslosesten Fällen. Sie hatte ihn sogar freiwillig angenommen. Milli fragte sich schon, ob dieses Telefonat eines von denen war, die damit endeten, dass ihre Mutter noch einmal wegfahren musste.
»Du hast was? Ihn eingesperrt? Er schlägt alles kurz und klein? – Nein, Alicia, gib ihr nicht den Schlüssel. Gib ihr nicht den Schlüssel. Ich rufe die Polizei. – Alicia, nein, tu das nicht. Alicia, hörst du! – Alicia, ich komme, ja, ich bin in zehn Minuten da. Sag ihm, dass ich komme. Er kann nur hoffen, dass die Polizei vor mir da ist.«
Sie legte auf, sah Milli an und seufzte: »Es tut mir leid. Ich muss noch mal los. Ich bin in einer halben Stunde zurück. Dann spielen wir noch etwas, und ich bringe dich ins Bett.«
»Ist gut«, antwortete Milli. Als die Haustür hinter Grit zugefallen war, stocherte Milli noch ein wenig in ihrem Essen herum, aber sie mochte nicht mehr. Sie räumte den Tisch ab, füllte die Reste in Dosen und stellte sie in den Kühlschrank. Dann packte sie in ihrem Zimmer den Ranzen für den nächsten Tag. Millis Zimmer war klein und hatte nur ein schmales Fenster zum Hof hinaus. Sie hätte auch das größere Zimmer haben können, das jetzt Arbeitszimmer hieß, wenngleich es nie zum Arbeiten genutzt wurde, weil es voll war mit Akten und Büchern und Kartons. Die Schreibtischplatte war vor lauter Papieren und aufgeschlagenen Ordnern schon lange nicht mehr zu sehen, und sogar auf dem Stuhl davor lagen zwei Stapel alter Bücher, die Grit herausgesucht hatte, um sie im Internet zu verkaufen, aber dann doch nie eingescannt und verschickt hatte. Eigentlich war es schade um das Zimmer, weil es sehr schön war. Aber sein Fenster blickte auf den Wald hinaus, und das bedeutete, dass der Wald auch zum Fenster hereinblickte, was Milli unheimlich war. Also begnügte sie sich mit weniger Platz und schaute auf den Hof und auf die Wiesen dahinter. Über ihrem Schreibtisch, der sehr ordentlich war, hingen mehrere Postkarten und Plakate, die zum Schutz des Klimas aufriefen oder schmelzende Eisberge und überschwemmte Dörfer zeigten, und mitten darin ein Foto von Greta Thunberg. Milli bewunderte Greta sehr und hatte eine Zeit lang sogar einen ähnlichen Zopf getragen wie die unbeugsame Aktivistin. Milli war nicht ganz so unbeugsam, aber sie nahm an allen möglichen Aktionen teil. Seit sie in einem Wochenseminar zur Klimabotschafterin ausgebildet worden war, wurde sie nicht müde, ihren Mitschülern ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Leben nahezubringen. Und nicht nur ihren Mitschülern. »Ihr Erwachsenen seid so naiv«, hatte sie Grit und Cora und ein paar anderen Gästen bei einem Abendessen erklärt. »Ihr glaubt wirklich, ihr könntet die Welt sauber kriegen und das Klima retten, ohne auf irgendwas zu verzichten! Ihr fahrt einfach saubere Autos, fliegt sauber ans Meer, baut saubere Häuser und geht in ein sauberes Internet! Aber das ist verlogen! Es gibt keine sauberen Autos! Das einzige saubere Auto ist kein Auto!«
Beim Packen des Ranzens fiel Milli ein, dass sie am nächsten Tag einen Vokabeltest schreiben würde, aber sie hatte keine Lust zu lernen. Mit ein bisschen Glück würde sie es auch so hinbekommen. Sie saß eine Weile in der Stille. Wieder einmal fiel ihr auf, wie still es in der Burg war. Für ihren Geschmack viel zu still. Jedenfalls, wenn man auf einer vierhundert Jahre alten Burg alleine ist.
Grabesstill.
Vierhundert Jahre sind eine lange Zeit, in der eine Menge scheußlicher Dinge passieren können. Und Milli hatte bereits gelernt, dass früher eine Menge scheußlicher Dinge passiert waren. Menschen sind zu Tode gemartert, in tiefe Verliese gesperrt, lebendig verbrannt oder eingemauert worden, Frauen waren gestorben, wenn sie Kinder kriegten, und Kinder waren ohnehin alle gestorben. Solange es hell war, wusste Milli natürlich, dass es keine Geister gab. Auch im Dunkeln glaubte sie nicht wirklich daran, aber da waren doch einige besorgniserregende Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen musste: die Fußböden, die gelegentlich sogar dann knarrten, wenn niemand darüber ging, das leise Jammern, das der Wind im alten Kamin erzeugte, und hinter der Burg der dunkle Wald, der eine Vielzahl ganz eigener Geräusche hervorbrachte. Manchmal schrie dort ein Tier, und Milli mochte sich gar nicht vorstellen, ob es gerade ein anderes Tier fraß oder ob es gefressen wurde. Ob es nun eine richtige Burg war oder nicht, auf jeden Fall gab es Dinge, die man als unheimlich und unheilvoll bezeichnen konnte. So gab es in der halben Mauer einen steinernen Türrahmen (alleine deswegen konnte es keine wirkliche Burgmauer sein), in dessen oberen, schiefen Abschlussstein ein Totenschädel eingemeißelt war. Und zwar von außen. Man sah ihn also, wenn man die Burg betrat. Es schien eine Warnung oder ein Omen zu sein. »Betritt die Burg und stirb!«, sagte Lawine dazu. Doch Grit vertrat die Meinung, es sei lediglich eine Warnung, sich nicht den Kopf zu stoßen, denn das sei bei dem massiven Stein unter Umständen tödlich. Dann waren da noch die drei Grabsteine, die mit rostigen Spangen an der Rückseite des Hauses angebracht waren. Sie waren so alt und verwittert, dass man die Inschriften nur noch erahnen konnte.
Vor allem aber gab es unter der Burg ein Gewölbe. Durch eine kleine Tür in der Küche gelangte man auf eine steile und ausgetretene steinerne Treppe, die in einen niedrigen Raum mit einem Fußboden aus Lehm führte. Dort unten herrschte, wie Grit erklärte, das ganze Jahr hindurch (alle vergangenen vierhundert Jahre hindurch) dieselbe Temperatur. Das Gewölbe war also ideal zum Lagern von Lebensmitteln. Es war nur etwas lästig, die winzige Stiege mit eingezogenem Kopf hinunter- zusteigen. Unbestreitbar war das Gewölbe unheimlich. Das lag vor allem an dem zugemauerten Durchgang. Außer der Tür zur Küche am oberen Ende der Treppe gab es nämlich unten noch eine zweite Öffnung: einen Türbogen aus Granitsteinen, der mit sehr alten Ziegeln zugemauert war. Am oberen Ende war einer der Ziegelsteine herausgebrochen, und wenn man mit der Handy-Taschenlampe durch das kleine Loch hineinleuchtete, sah man einen kurzen Gang. Das hintere Ende war mit Erde, Sand, Steinen und zerbrochenen Ziegeln zugeschüttet, aber nur locker, und es sah aus, als könne man es ohne große Mühe freischaufeln und dahinter Gott weiß was entdecken. Vielleicht eine Gruft mit Knochen oder einen Geheimgang, der irgendwo in den Wald führte. Grit hatte das Ganze irgendwann untersuchen wollen, war aber nie dazu gekommen. Sie ging ohnehin davon aus, dass die Schüttung kein Geheimnis verbarg, sondern nur einen feuchten und unbrauchbaren Keller. »Da könnte natürlich auch ein alter Brunnen sein. Wenn wir den wiederherstellen, dann wären wir von den Stadtwerken unabhängig.«
Die Stadtwerke waren Milli ziemlich egal. Aber die Vorstellung, dass unter dem unheimlichen Kellergewölbe auch noch ein vollkommen schwarzer Schacht in die Tiefe führte, beunruhigte sie. Um der Stille zu entgehen, ging sie ins Ofenzimmer, wie sie ihr kleines Wohnzimmer nannten, setzte sich mit dem iPad aufs Sofa und begann, Minecraft zu spielen. Und als es Zeit wurde, ging Milli ins Bett.
2
Unabhängigkeit war ein wichtiges Ding für Mama. Selbst Milli, für die Männer noch nicht viel mehr waren als die Idioten, die sie im Sportunterricht auslachten, hatte begriffen, dass das nicht nur für Grits Job galt, nicht nur für die Art und Weise, wie sie lebten, sondern eben auch für Männer. Milli begriff noch nicht so recht, was daran so schwierig war. Sie selbst war längst unabhängig von Männern. Sie ignorierte sie, und ihr war schleierhaft, wie irgendeine Frau bei Verstand das nicht tun konnte. Sogar ihre Lehrer begriffen das. Wenn sie in der Klasse endlich Ruhe haben wollten, dann änderten sie einfach die Sitzordnung: abwechselnd Junge und Mädchen. Milli verstand nicht, was an diesem Männer- und Frauending kompliziert sein sollte, aber offensichtlich war es das für manche Leute. So auch für Mama.
Grit hatte sich mit verschiedenen Männern getroffen, die dann eine kurze oder nicht ganz so kurze Weile bei ihnen ein und aus gingen. Da war Giulio gewesen, der ein lustiges Deutsch gesprochen und immer Späße gemacht hatte. Der lange Freddy, der neben Mama ausgesehen hatte wie ein Riese und am Dom als Steinmetz arbeitete. Sie hatten ihn einmal besucht und durften auf das schwindelerregend hohe Kirchendach – wie Quasimodo und Esmeralda. Freddy war ein Freund von Grits Freundin Cora, und deshalb hatte Grit gedacht, es könnte was werden, es wurde dann aber doch nichts. Hamza arbeitete für ein Start-up, das veganes Essen entwickelte. Er war Spezialist für Eiscreme und brachte oft welche mit. Er war immer ein bisschen schneller als seine Umgebung und trieb Grit in den Wahnsinn, weil er alles immer sofort erledigte und nie still saß. Dann gab es noch Schulze, der allerdings nur zwei Mal auf der Burg gewesen war. Milli hatte in einem Gespräch zwischen Grit und Cora gehört, dass er Depressionen hatte und in einer Klinik war.
Immer, wenn es Grit zu eng wurde oder irgendwie lästig oder wenn die Dinge sich so gestalteten, dass sie Grit nervös machten, dann gingen die Männer nicht mehr ein, sondern nur noch ein letztes Mal aus. Lieber früher als später. »Man muss da nicht lange drauf rumkauen. Wenn es so weit ist, muss man ehrlich sein.«
»Mama, muss man immer ehrlich sein?«, hatte Milli einmal gefragt.
»Natürlich«, hatte Grit geantwortet. »Wenn man nicht ehrlich ist, spüren das alle. Und alle quälen sich herum.«
Ebenso wie Männern gegenüber war ihre Mutter unabhängig genug, ihren jeweiligen Chefs oder Kollegen, damals irgendwelchen Kunden und heute Klienten gegenüber ehrlich zu sein. Das wollten aber nicht alle hören. Deshalb war sie dann immer mal wieder plötzlich noch unabhängiger, als sie es eigentlich geplant hatte. Jedenfalls war das so bei den Jobs, die sie während ihres Studiums gehabt hatte. Denn neben diesen Jobs, neben ihren Renovierungsarbeiten auf der Burg und neben Millis Aufzucht (wie Cora es nannte) hatte sie dann doch ihr Studium wieder aufgenommen und unter einschneidenden Entbehrungen abgeschlossen. Nach einigem Hin und Her arbeitete sie nun seit vier Jahren als Sozialarbeiterin für das Jugendamt.
Milli hatte sehr wohl begriffen, dass ihre Mutter zu Nervosität neigte, wenn sie unter Druck gesetzt wurde. Das war sicherlich auch der Grund dafür, dass sie den Gutachter des Liegenschaftsamtes geohrfeigt hatte. Grit hatte nicht darüber gesprochen, aber scheinbar lief alles darauf hinaus, dass man ihr die Burg wegnehmen wollte, weil sie mit der Renovierung nicht vorankam. Aber auch das hatte Milli lieber nicht nachgefragt. Milli bedauerte nur, dass sie bei dem Vorfall mit dem Gutachter nicht dabei gewesen war. Sie hatte es nur aus einem Telefongespräch herausgehört, das ihre Mutter ziemlich erregt und teilweise recht lautstark geführt und an dessen Ende sie eingewilligt hatte, sich bei dem Mann zu entschuldigen.
Milli hatte noch mehr Freundinnen, die nicht wirkliche Freundinnen waren. Jenni und Lea und ein paar andere waren einige Male zu ihr nach Hause gekommen, weil sie es cool fanden, in einer Burg zu spielen, aber in letzter Zeit interessierten sie sich nur noch für ihre Handys. Sie posteten eigene Videos und reposteten fremde, sie schrieben sich Nachrichten, gaben sich gegenseitig Likes und waren stolz darauf, dass ein Mädchen, dessen Kanal sie abonniert hatten, über eine Million Follower hatte. Milli versuchte eine Weile lang mitzuhalten, aber die anderen merkten bald, dass sie sich nicht wirklich begeisterte, und es geschah immer öfter, dass Milli keine Likes bekam und keine Nachrichten. Im Grunde machte es ihr nicht viel aus. Eine Freundin hatte sie zumindest. Allerdings eine, von der sie zu Hause nicht erzählen durfte. Denn obwohl es sich gelegentlich nicht vermeiden ließ, dass Milli Grits Klienten oder Klientinnen kennenlernte, hatte Grit ihr eingeschärft, den Umgang mit ihnen zu meiden. Auf eine sehr vorsichtige Art und Weise, denn Grit wollte ihre Tochter nicht in einem Geiste erziehen, dass sie sich für etwas Besseres hielt. Aber es waren eben oft schwierige und unberechenbare Kinder und Jugendliche, die Straftaten begangen hatten oder an denen Straftaten begangen worden waren. Also galt Grits Prinzip, Arbeit und Privatleben strikt zu trennen. Trotzdem waren sie sich nähergekommen: Milli und Lavinia, die ein paar Jahre älter war und einen Kopf größer und spindeldürr und von allen nur Lawine genannt wurde. Außer natürlich von Millis Mutter, zu deren Schützlingen Lawine gehörte und die regelmäßig bei ihr zu Hause nach dem Rechten sah. »Ob ich noch lebe«, sagte Lawine, »oder ob meine Alte mich schon enthauptet hat.«
Lawine mochte ihren Spitznamen. Sie sagte: »Eines Tages gehe ich ab wie eine richtige Lawine, und dann reiße ich jeden mit, der in meiner Nähe ist.« Ihre Arme waren voller Narben, von oben bis unten. Milli hatte sie einmal gefragt, woher sie die habe, und Lawine hatte geantwortet, die habe sie selbst gemacht. Und dabei mit einem irgendwie stolzen Blick darüber gestrichen.
»Warum?« Auf diese Frage hatte Lawine nicht geantwortet, aber Milli wusste, dass die Besuche ihrer Mutter bei Lawine zu Hause damit zu tun hatten.
Grit kümmerte sich schon seit einer Weile um Lawines Familie. Eine Zeit lang hatte Lawine bei einer Pflegefamilie gewohnt, weil ihre Mutter in einer Klinik gewesen war. Damals hatte sich Lawine zum ersten Mal in der Nähe der Burg herumgedrückt, und die beiden Mädchen hatten sich kennengelernt. Mit Lawine traf sich Milli am liebsten an ihrem geheimen Platz, dem Schutthaufen, der einmal eine Scheune gewesen war. Marek (von dem Milli nichts wusste) hatte sie damals einreißen lassen, weil sie einsturzgefährdet war. Den Schutthaufen hatte er abtransportieren lassen wollen, aber dann hatte er das Geld lieber für neue Fenster ausgegeben. Seither lag er dort. Unkraut, Mohnblumen und Haselnussgebüsch wuchsen inzwischen aus den Lücken und Löchern, und sogar ein Hain Birken mit weißen Stämmchen und dünnen, im Wind flirrenden Blättern gedieh auf den Überresten des alten Bauwerkes. Grit hatte Milli streng verboten, auf dem Schuttberg herumzuklettern, deshalb ging Milli immer nur von der Rückseite aus hinein. Inmitten des Birkenwäldchens und des Haselnussgebüschs hatte sie einen geheimen Platz, ihren Lieblingsplatz. Aus ein paar Brettern hatte sie sich in einer Mulde zwischen den Steinen eine Hütte gebaut, und wenn sie dort alleine war, dann war der Schuttberg ihre eigene kleine Welt.
Manchmal war Lawine schon da, wenn Milli aus der Schule kam, denn Lawine ging oft nicht hin. Milli bewunderte sie dafür, weil sie sich das nicht trauen würde. »Schule ist scheiße«, sagte Lawine, wenn Milli sie ermunterte, doch hinzugehen. »Lehrer sind scheiße. Und von einer Scheißlehrerin lernst du nur Scheiße. Du solltest auch nicht hingehen.« Aber Milli mochte die Schule, und sie mochte ihre Lehrerinnen und Lehrer. Als sie Lawine das gestand, zuckte die nur verächtlich mit den Schultern und sagte: »Klar, du bist eine Brillenschlange. Brillenschlangen stehen auf Schule.« Milli wusste natürlich, dass das Unsinn war, aber sie hatte das Gefühl, dass es Lawine half, wenn das so im Raum stehen blieb, und widersprach nicht.
»Lass uns doch mal zusammen schwänzen.«
»Zusammen? Wir gehen doch gar nicht auf dieselbe Schule.«
»Das spielt doch keine Rolle, Fliegenhirn! Du schwänzt deine Schule, ich schwänze meine, und wir machen was Schönes!«
»Ich weiß nicht …«
»Ich weiß nicht.« Lawine lachte.
Manchmal kam Lawine tagelang nicht, auch wenn sie verabredet waren, und wenn Milli fragte, was sie gemacht hatte, antwortete sie nicht. Dann wieder brachte sie teure Dinge mit, die sie sich ganz sicher nicht leisten konnte. Wahrscheinlich hatte sie sie geklaut, aber Milli wusste es nie so genau.
»Habe ich zum Geburtstag gekriegt.«
»Geburtstag? Aber du hattest doch vor drei Monaten Geburtstag.«
»Ist doch meine Sache, wann ich Geburtstag habe, oder?«
»Ich sag ja nur …«
»Habe ich von meinem Vater gekriegt. Wir haben uns jetzt erst gesehen.«
»Du hast deinen Vater getroffen? Das hast du gar nicht erzählt!«
Milli dachte wieder einmal daran, dass sie ihren Vater noch nie getroffen hatte. Sie hatte sich oft gefragt, warum sie keinen Vater hatte, und schon mehrmals war sie kurz davor gewesen, ihre Mutter nach ihm zu fragen. Es war nicht so, dass sie sich nicht trauen würde. Sie hatte keine Angst davor, natürlich nicht, sie wusste ja, dass sie alles fragen und alles sagen konnte. Aber sie scheute davor zurück. Sie hatte ein komisches Gefühl dabei. Sie konnte es sich nicht erklären. Irgendetwas hielt sie davon ab zu fragen. Natürlich würde sie es irgendwann tun. Aber vielleicht gab es ja einen Grund, dass Grit noch nie über ihren Vater gesprochen hatte. Und wenn Milli fragte, würde Grit ihr womöglich nicht die Wahrheit sagen. Davor hatte Milli noch mehr Angst, als es nicht zu wissen.
Umso mehr interessierte sie sich für Lawines Vater.
»Ich erzähl’s eben jetzt«, sagte Lawine.
»Wie war es? War er nett? Wie ist er?«
»Jetzt frag doch nicht so viel!«
»Ich frage total wenig! Ich könnte noch viel mehr fragen.«
»Er war richtig cool. Hat mir das Handy geschenkt.«
»Er ist reich?«
»Und wie! Er fährt ein Riesenauto. So einen Sportwagen, aber riesig. Und er trägt eine Rolex.«
»Was ist eine Rolex?«
»Du weißt aber auch gar nichts. Eine Uhr. Die teuerste Uhr der Welt.«
»Ach so?«
»Klar. Die tragen nur die wirklich coolen Leute.«
»Was habt ihr gemacht?«
»Wer?«
»Na, du und dein Vater.«
»Ach so, klar. Wir sind essen gegangen und ins Kino.«
»Warum hat er sich all die Jahre nicht gemeldet? Wenn er so nett ist.«
»Weil er nicht konnte.«
»War er in Taka-Tuka-Land?«
»Was ist das denn?«
»Da war der Vater von Pippi Langstrumpf Häuptling von einem Eingeborenenstamm.«
Lawine starrte sie vernichtend an. »Du kommst dir ganz witzig vor, was?«
Milli merkte, dass Lawine echt getroffen war. »Tut mir leid, ich wollte nicht …«
»Du kriegst Brüste«, wechselte Lawine abrupt das Thema.
Milli sah an sich herunter. Es stimmte. Milli beobachtete jeden Tag aufmerksam, was ihre Brüste machten. Das Schwierige war, dass sie eigentlich immer schon welche gehabt hatte. Babyspeck, wie Mama erklärte. In letzter Zeit war Milli allerdings sicher, dass sich etwas veränderte. Lawine hatte schon richtige Brüste. »Titten«, wie sie sagte. »Titten nerven. Hängen da so blöd rum und jeder glotzt drauf.«
»Dann trag doch nicht immer so enge T-Shirts.«
»Doch, gerade! Dann glotzen sie einem wenigstens nicht ins Gesicht. Ich wette, neunzig Prozent der Leute können nicht sagen, wie mein Gesicht aussieht. Und das ist gut so. Du hast eine Brille. Das hilft auch. Dann brauchst du keine Brüste.«
»Wenn man eine Brille hat, braucht man keine Brüste?«
»Dann bleiben die Leute an deiner Brille hängen und schauen dich auch nicht richtig an.« Lawine sah auf Millis Oberkörper. Milli setzte sich gerade auf, reckte die Brust heraus und zog ihr T-Shirt glatt.
»Ja«, bestätigte Lawine. »Da kommen sie. Wahrscheinlich wirst du große kriegen. Wie deine Mutter. Das bleibt immer in der Familie.«
»Die von meiner Mutter sind gar nicht so groß.«
»Keine Ahnung. Vielleicht wirkt es nur so, weil sie klein ist.«
Grit hatte die Akten, die sie durcharbeiten musste, mit nach draußen genommen. Sie saß an dem Tisch im Hof, der von der halben Mauer geschützt wurde, unter der riesigen Platane, von der es hieß, sie sei über zweihundert Jahre alt. Es war ein heißer Tag, und auch im lichten Schatten des Baumes war Grit in ihrer luftigen knopflosen Bluse warm. Sie mochte Platanen wegen der besonderen Schatten, die sie spendeten. Während es unter vielen anderen Bäumen oft düster wurde und die Schatten immer etwas Trübes hatten, schimmerte durch die dünnen Platanenblätter so viel Licht, dass darunter eine zauberhafte Stimmung herrschte. Doch heute hatte Grit dafür keinen Blick.
Auf dem Tisch lagen ihre Papiere, ihr Handy, ihr Laptop. Außerdem standen dort eine Tasse Kaffee und eine Karaffe Wasser. Grit hatte ein Gutachten zu schreiben, das sie bis zum übernächsten Tag beim Landgericht einreichen musste. Übermorgen ist verdammt eng, dachte sie. Aber trotz des Termindrucks kam sie nicht so recht in Schwung.
Das lag vor allem an einem anderen Schriftstück, das ihr schon vor einer Woche zugegangen war. Sie hatte es seither abwechselnd ignoriert und mit wachsenden Bauchschmerzen durchgekaut, um es schließlich wütend wegzuwerfen. Mit jedem Tag wurde ihr klarer, dass sie etwas unternehmen musste, denn die Frist, die ihr in dem Schreiben gesetzt worden war, rückte näher und näher: Das Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster drohte ihr unter Berufung auf ein Gutachten des Amtes für Denkmalschutz und Denkmalpflege mit einer Klage und einer endgültigen Annullierung des Kaufvertrages, da sie ihren Verpflichtungen zu vertraglich bindenden Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten nicht vollumfänglich nachgekommen sei. Kurz gesagt: Sie wollten Grit rauswerfen. All die Arbeit, all die Mühen, all die Ersparnisse, die sie seit über elf Jahren in die Burg gesteckt hatte, wären umsonst gewesen. Grit hatte ihnen all die schönen Dinge gezeigt, die sie geleistet hatte. Gerade erst hatte sie das Dach ausbessern lassen! Aber es reichte nicht. Den Zuständigen der Behörde war klar geworden, dass Marek ihnen damals das Blaue vom Himmel versprochen hatte. Dass er seit Langem verschwunden war und Grit es niemals schaffen würde zu leisten, was er zugesagt hatte.
Vor zwei Wochen war ein Gutachter des Liegenschaftsamtes aufgetaucht, um sich alles anzusehen. Grit hatte zwei Stunden lang auf ihn eingeredet wie auf ein krankes Pferd, aber er hatte alles kleingemacht, was sie geleistet hatte, und ihr war mehr und mehr klar geworden, dass seine Meinung schon festgestanden hatte, bevor er überhaupt gekommen war. Sie hatte sich beherrscht, so gut sie konnte, aber schließlich war sie so wütend geworden, dass ein Wort das andere ergeben und sie ihn geohrfeigt hatte. Worauf er wortlos in seinen Wagen gestiegen war. Sie musste sich etwas einfallen lassen, und zwar schnell.
Grit trank ihren Kaffee und versuchte sich zu konzentrieren. Doch es gelang ihr nicht. Diese Gerichtsunterlagen waren grauenhaft zu lesen. Warum konnten Leute nicht klar und deutlich formulieren, was gemeint war? Grits Blick fiel auf das Baugerüst, das an der Seitenwand des Hauses stand. Dachdeckermeister Jurgan hatte es aus Gutmütigkeit stehen lassen, weil Grit noch den alten Putz abschlagen und die Wand neu verputzen wollte. Schon fürs Dachdecken hatte sie ihm kaum etwas bezahlt. Normalerweise arbeitete Jurgan für Geld. Grit hatte kein Geld. Aber sie redete so lange und so oft mit ihm, bis er einsah, dass es für ihn einfacher war, ihr Dach zu decken, als es nicht zu tun. Sie bezahlte, was sie bezahlen konnte, aber vor allem bestand ihre Gegenleistung schließlich darin, ihm Mut zuzusprechen. Seine Frau ließ sich gerade von ihm scheiden, und es brach ihm das Herz. Vor allem der Kinder wegen. Er hatte eine neunjährige Tochter und einen siebenjährigen Sohn, und er liebte die beiden über alles. »Ich ertrage das nicht«, sagte er unter Tränen, als er eines Vormittags an Grits Küchentisch saß und mit schmutzigen, zitternden Händen eine Kaffeetasse umfasste. Seine beiden Lehrlinge besserten derweil das Dach aus. »Alle zwei Wochen! Am Wochenende! Sie sagt, ich arbeite doch sowieso immer. Da schuftet man Jahr für Jahr, um alles abzuzahlen, und dann sagt sie: Du arbeitest doch sowieso immer!«
Grit redete mit seiner Frau, und es stellte sich heraus, dass auch sie weinte. Als das Dach fertig war, lud Grit die ganze Familie als Dank zum Essen ein. Anschließend zeigte sie den Kindern die Burg. Sie stieg mit Milli und den beiden in das Kellergewölbe hinab und leuchtete in den zugemauerten Gang, sie kletterte mit ihnen die Treppe zur halben Mauer hinauf und zeigte ihnen die Aussicht, sie erklärte den Kindern die Kräuter, die hinter dem Haus wuchsen, und sie ging mit ihnen in den Wald. Sie ließ die Eltern warten.
Am nächsten Tag rief Jurgan an und fragte, ob Grit bereit wäre, sich am Abend mit ihnen beiden zu unterhalten. Sie redeten lange, es gab Entschuldigungen und Beteuerungen, es wurde zugehört und verstanden, und schließlich waren beide bereit, einander mehr zu vertrauen, und vor allem die Kinder einander anzuvertrauen. Jurgan war so glücklich darüber, auch wenn seine Frau nicht zu ihm zurückkam, wie er gehofft hatte, dass er kein weiteres Geld von Grit nehmen wollte, das Gerüst stehen ließ, bis sie es nicht mehr bräuchte, und sogar versprach, die Mauerkrone der halben Mauer, die zurzeit noch schutzlos Regen, Eis und Bewuchs ausgesetzt war, ebenfalls zu decken.
Grit war in den letzten Wochen nicht dazu gekommen weiterzuarbeiten. Vielleicht könnte sie jetzt zwei Stunden Putz abschlagen und später mit den Gerichtsakten weitermachen. Das würde auch noch reichen. Das Gutachten musste ja erst übermorgen fertig werden. War das nicht in ihrem Leben immer so: Was morgen fertig sein musste, wurde sofort erledigt (und wenn es bis spät in die Nacht dauerte), übermorgen konnte bis morgen warten.
Kurz darauf stand sie oben auf dem Gerüst, auf dem Kopf die alte Malermütze, die ihr Haar ein wenig vor dem Staub schützte, Arbeitshandschuhe an den Händen, in der linken einen Meißel und in der rechten einen Fäustel. Unter ihren Schlägen prasselten Putzstücke in die Tiefe, und bald war Grit weiß eingestaubt. Während der Verputz sich in kleinen und größeren Platten von der Wand löste, war ihr, als käme ihr eigenes Leben darunter zum Vorschein, und eine kleine Verzweiflung überfiel sie. Es war ein endloser Kampf, der nie aufhörte. Sobald sie irgendwo einen Riss repariert hatte, erschien ein neuer. An dieser hoffnungslos riesigen Wand ebenso wie in ihrem Leben. Warum nur gelang es ihr nie, ihr Leben kreativ zu gestalten? Warum musste sie sich immer damit begnügen, Risse zu spachteln, absinkende Fundamente zu stützen und nässende Dächer zu flicken? Niemals ging es vorwärts, immer musste man dankbar sein, wenn es einem gelang, alles vor dem Einsturz zu bewahren. Während wieder eine Scholle in die Tiefe stürzte und unten zerschellte, dachte sie an die Männer, die gekommen und gegangen waren. Warum war nie der Richtige dabei gewesen? Wieder einmal kam ihr der Witz mit dem Geisterfahrer in den Sinn. Der Mann, der auf der Autobahn fährt, im Radio die Warnung vor einem Geisterfahrer hört und denkt: »Einer? Dutzende!« Sie schob den Witz beiseite. Sie wusste selbst, dass sie nicht einfach war. Aber doch nur, weil sie immer das Beste wollte. War es verkehrt, das Richtige zu tun und das Richtige zu verlangen? Vor allem doch für Milli! Um Milli tat es ihr am meisten leid. Es war natürlich nicht einfach für das Kind, wenn Männer kamen und gingen und niemals ein Vater dabei war.
Grit hörte das Brummen eines Autos, das näher kam. Sie drehte sich um, schaute über die Wiesen, hinter denen die Landstraße lag, – und sah einen schwebenden Sarg.
3
Die schmale Straße führte in einem Bogen am Hang des sanft aufsteigenden Hügels entlang. Wer zu Grit kam, musste um diesen Bogen herum. Wenn es der Paketwagen war, sah man zuerst sein Dach. Es war aber nicht der Paketwagen, wie Grit zuerst vermutet hatte. Es war ein Sarg. Die Form war unverkennbar, wenn er auch rot und bunt bemalt war.