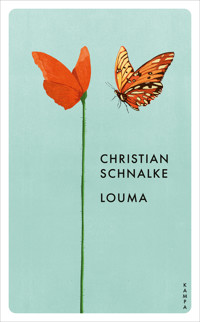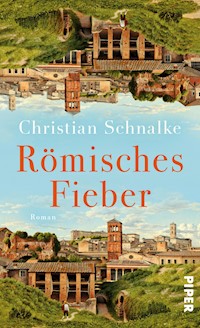
17,48 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
1818. Franz Wercker, dessen Traum es immer war, Schriftsteller zu sein, flieht vor einer unseligen Familiengeschichte. Als ihn am Gardasee die Kräfte verlassen, will er seinem Leben ein Ende setzen. Die zufällige Begegnung mit dem jungen Dichter Cornelius Lohwaldt, der mit einem Stipendium des bayerischen Königs auf dem Weg nach Rom ist, ändert alles: Franz nimmt seine Identität an. In Rom taucht er ein in die Gemeinschaft deutscher Künstler - junger, begeisterter Enthusiasten, die fern der Heimat hart arbeiten und glücklich leben. Franz findet Freunde, erlebt amouröse Abenteuer - und verliebt sich in eine junge Malerin. Doch als sich Lohwaldts Schwester Isolde auf den Weg nach Rom macht, um ihren Bruder zu suchen, droht das mühsam errichtete Lügenkonstrukt einzustürzen. Als ein Mord geschieht, zieht sich die Schlinge um Franz zusammen...
»Liebevoll, gleichwohl mit trockenem, manchmal bösem Humor und einer feinen Ironie erzählt — mein Freund Christian Schnalke hat einen grandiosen Roman geschrieben.« Volker Kutscher
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
ISBN 978-3-492-99261-9
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: AKG Images/CHRISTOFFER WILHELM ECKERSBERG/ / WASHINGTON, NATIONAL GALLERY OF ART
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Zitate
Prolog
I - Franz Wercker schleppte …
II - Isolde hasste …
III - Das Zimmer …
IV - Am kommenden Sonntag …
V - Blendendes Licht schmerzte …
VI - Etwas stimmte nicht. …
VII - Franz erwachte in …
VIII - Da es in seiner …
IX - Obwohl Isolde schnell …
X - Die herrliche Villa …
XI - Als mit dem nächsten …
XII - Franz saß bei Georg. …
XIII - Franz war überrascht, …
XIV - Clara war es nie …
Nachwort
Danksagung
Für Max, Ben und Tom
»Die deutschen Künstler in Rom – das darf man ohne Weiteres behaupten – sind vielleicht das glücklichste Völkchen unter der Sonne. Inmitten dieser unvergleichlichen Umgebung, voll von Plänen, Hoffnungen und Entwürfen …«
E. Eckstein, 1878
»Ja, ich kann sagen, dass ich nur in Rom empfunden habe, was eigentlich ein Mensch sei. Zu dieser Höhe, zu diesem Glück der Empfindung bin ich später nie wieder gekommen; ich bin, mit meinem Zustande in Rom verglichen, eigentlich nie wieder froh geworden.«
Goethe, nach Eckermann, 1828
»Hier, hier lebt der Mensch!«
Ludwig I.
»Die Welt mit ihrem Treiben liegt so fern.«
Caroline von Humboldt
Im Jahr 1818 hat der Künstler Carl Fohr in Rom alle deutschen Maler und Dichter, die zu der Zeit dort lebten, zu zeichnen begonnen. Genau siebenundvierzig Vorzeichnungen für ein großes Gruppengemälde, das aufgrund des Todes von Fohr im selben Jahr nicht vollendet wurde. Eine der Zeichnungen zeigt einen Unbekannten, der nie identifiziert werden konnte. Dies ist seine Geschichte.
I
Franz Wercker schleppte sich die letzten Schritte bis zum Ufer. Seine Beine zitterten, sein Magen verkrampfte sich, Hände und Knie waren aufgerissen vom Rennen, vom Stürzen, vom Klettern, vom Kriechen. Die Streifen seines schwarzen Mantels, die er nach und nach abgerissen hatte, um damit die Fetzen seiner zerlumpten Schuhe zusammenzuknoten, ringelten sich um seine schmerzenden Füße, als ob sich das Schlangengezücht seiner Vergangenheit in seine Fersen verbissen hätte. Vor ihm glitzerte im Licht des spitzen und scharfkantigen Mondes der fantastische See, zu beiden Seiten eng eingefasst von schwarzen, unwegsam aufragenden Bergmassen. Nach vorne zu, in Richtung seines Blicks, legte sich die endlose Wasserfläche schwer um die Biegung der Erdkugel und verschwand im Unbekannten.
Wochenlang hatte Franz sich bis hierher gekämpft. Hatte zu Fuß die Pässe der Alpen überquert, war durch eisige Bäche gewatet, steile Hänge emporgeklettert, Geröllhalden hinabgerutscht, hatte Grenzposten, Zollstationen und bewachte Brücken gemieden und war stundenlang mit fühllosen Zehen durch Schneefelder gestapft. Noch vor dem Brennerpass hatte er die letzten armseligen Münzen weggegeben, er hatte in einem Gasthof die wohl letzte Mahlzeit seines Lebens bezahlt und die vergangenen vier Tage nahezu nichts gegessen, außer ein wenig Schüttelbrot und Käse, die ein schweigsamer Geselle aus Tirol mit ihm geteilt hatte. In Trient schließlich war er trotz aller Vorsicht österreichischen Gendarmen über den Weg gelaufen, denen er aufgrund seiner abgerissenen Kleidung, des struppigen Bartwuchses und der vor Erschöpfung unbeherrschten Angst in seinen Augen verdächtig vorgekommen war und die ihn umgehend festgenommen hatten. Da Franz nichts Besseres eingefallen war, als den Namen Filippo Miller anzugeben, den Namen, unter dem einst Goethe gereist war, und sich ansonsten in Widersprüche verstrickt und durch verstocktes Schweigen verdächtig gemacht hatte, hielt man ihn gefangen. Essen und Trinken verweigerte man ihm, um ihn zu einer ehrlichen Aussage zu zwingen. Doch in der zweiten Nacht, als man einen unbeherrscht brüllenden Betrunkenen in seine Zelle zerrte, nutzte er die Verwirrung aus, als der Säufer einen der beiden Gendarmen ins Gesicht schlug und von dem anderen mit dem Säbelknauf niedergeprügelt wurde, sprang auf und rannte aus der Zelle. Die Gendarmen ließen den blutenden Alten liegen und verfolgten ihn mit blanken Säbeln und lautem Geschrei durch die nächtlichen Gassen des Städtchens, doch er rannte ums Leben, ließ sich nicht aufhalten, auch nicht, als ihm die Seite stach wie von Messern durchbohrt, als seine Lunge unter Krämpfen nach Luft rang und die Brust ihm zu zerreißen drohte. Er rannte aus der Stadt, stolperte über Felder und Wiesen, watete durch einen eiskalten Bach und stürzte erst im Schutz eines Waldes zu Boden. Mehr tot als lebend, aber frei. Von seinen Verfolgern war nichts zu sehen und zu hören, Franz hatte keine Ahnung, wann er sie abgehängt hatte, und dann schwanden ihm die Sinne.
Von da an hatte er die Straßen gemieden, war nur auf Waldwegen und Jägersteigen gegangen, bis an diesem Nachmittag das Land vor ihm jäh abbrach und er zwischen Olivenbäumen hindurch, die sich knorrig und zäh in den felsigen Boden krallten, die riesige blaue Fläche des Sees unter sich liegen sah. Die wuchtigen bewaldeten Hänge zur Linken strahlten in der letzten Abendsonne, die zerklüfteten Berge zur Rechten warfen ihre düsteren Schatten übers Wasser. Unten, auf dem grünen Landstreifen vor dem See, lag das Dörfchen Turbel am Gartsee. Oder, wie es ein verwitterter Wegweiser auch in italienischer Sprache anzeigte: Torbole sulLago di Garda. Franz versteckte sich in einer Burgruine abseits der steil abfallenden Straße, um die Dunkelheit abzuwarten.
Durch eine Fensteröffnung des zerfallenen Gemäuers spähte er immer wieder über den See. Sein Blick wurde wie magisch angezogen von dem schmalen, überirdisch leuchtenden Streifen, wo sich Wasser und Himmel im Dunst zu einem unwirklichen Strahlen vereinten. Dort irgendwo, in entmutigender Ferne, lag sie, im Licht der verschwindenden Sonne, und streckte sich für eine weitere Nacht an den Ufern des Tiber aus, um ihren wohlverdienten Schlaf zu finden: die Königin am Tiberstrande. Rom, die Stadt seiner Träume. Seit er denken konnte, das Ziel seiner Wünsche und Sehnsüchte.
Doch nun, die Wange an den rauen und warmen Stein der Burgruine gepresst, war er am Ende seiner Kräfte. Die Reise, von der er seit jeher geträumt hatte, war keine Reise geworden, sondern eine Flucht. Er hatte sich aus zwei Gefängnissen davongestohlen, von Zuchthaus und Hinrichtung bedroht, hatte nichts mitnehmen, nichts vorbereiten können. Ein Zuhause gab es für ihn nicht mehr, Freunde hatte er keine, nirgendwo auch nur einen, der an ihn glaubte oder seinem unwürdigen Leben den geringsten Wert zumaß.
Jahrelang hatte Franz davon geträumt, aufzusteigen vom Sohn eines Tagelöhners zu einem respektierten, vielleicht sogar angesehenen Dichter, doch seine geduldigen heimlichen Studien, all die durchlesenen und durchschriebenen Nächte, in denen er mit fiebernden Augen und glühendem Herzen in die Welt der Dichtung versunken war, hatten ihm nichts eingebracht als Verachtung und Prügel des Vaters. Seine Liebe und seine Mühen hatten ihn nicht das kleinste bisschen emporgetragen in der menschlichen Gesellschaft, sondern ihn im Gegenteil auf die unterste Stufe stürzen lassen, wo nur menschlicher Abschaum sich wand.
Der stolze Gardasee, über den er in seinen Träumen immer, am Bug eines soliden Fährboots stehend, dem lockenden Rom entgegengefahren war, lag nun vor ihm als unüberwindliches Bollwerk. Niemals würde er ihn überqueren. Das Wasser, das vor seinen Blicken dort unten in der Tiefe immer schattenreicher, immer düsterer und bedrohlicher wurde, war das Ende. In diesen Fluten würde in der kommenden Nacht nicht nur seine Flucht, sondern sein ganzes missratenes Leben einen Abschluss finden.
Wie gerne hätte er den Ort seiner Sehnsucht wenigstens einmal gesehen, bevor er seinem schuldbeladenen Leben ein Ende setzte. Die Träume von Rom hatten ihm Mut gemacht in der Kerkerhaft. Aber vor allem hatten sie ihn am Leben erhalten, als er begraben war. Als er unter der Erde lag und das panische Entsetzen in grausamen Wellen über ihn hinwegrollte. Er hatte das nur ertragen können, indem er sich alles vor Augen führte, was er in Büchern gelesen und auf Stichen gesehen hatte: das Pantheon, das Forum, die Caracalla-Thermen, den Titusbogen, die Säule des Trajan und allem voran das Kolosseum. Franz konnte es sich nicht erklären, aber dort im Waldboden erinnerte er sich plötzlich an jedes Wort, das er über Rom gelesen hatte. Irgendwann hatte er das Grauen unter sich gelassen und wurde in einen unbegreiflichen Zustand der Klarheit gehoben – eines inneren Leuchtens – und hatte alles in strahlenden Farben vor sich gesehen: Goethes Streifzüge durch Rom, in die Sixtinische Kapelle, auf die Via Appia, nach Frascati, schreibend an der Iphigenie, aquarellierend im Kreise der Künstlerfreunde, beim Begutachten der täglichen Zeichnungen – Franz hätte nicht sagen können, welches Bild davon Erinnerung war und welches Erfindung. Er wusste nur, dass sie ihm das Leben gerettet hatten – oder zum Mindesten seinen Verstand. Deshalb hatte er sich so sehr danach gesehnt, die Ewige Stadt wenigstens einmal mit eigenen Augen zu sehen. Doch dazu fand er nicht mehr die Kraft. Er konnte nicht weiter. Und wozu sich länger quälen? War es nicht ohnehin nur der Wahn eines Verzweifelten gewesen? Lieber gleich ein Ende finden. Gleich heute Nacht. Gleich dort unten im See.
Cornelius Lohwaldt, der aufstrebende junge Dichter aus Nürnberg, in den man seit der Veröffentlichung seiner Ode an die erwachende Germania so viel Hoffnung setzte, dass der König ihm in einer überraschenden Geste eine Leibrente ausgesetzt hatte, mit der es ihm ermöglicht werden sollte, ein Jahr lang in den römischen Bibliotheken und Galerien seine klassischen Studien zu vervollkommnen, war in aller Bequemlichkeit mit der Kutsche über die Berge gerollt. Im Tal der Etsch hatte er den mutwilligen Wunsch geäußert, einen Umweg über Turbel zu unternehmen, wie es Johann Wolfgang von Goethe seinerzeit getan hatte. Er wollte genau wie der große Dichter, anstatt bequem auf dem üblichen Weg weiter durchs Tal zu rollen, das Erlebnis genießen, über das Wasser des Sees aus den Alpen heraus in die fruchtbare Ebene des Po zu gelangen. Er gefiel sich in der Vorstellung, den gleichen Blick zu genießen, mit dem auch der große Dichter zum ersten Mal die Provinz Venetien gesehen hatte. Die Pension zu finden, in der Goethe gewohnt und an seiner Iphigenie gearbeitet hatte, um dort ebenfalls, am Fenster den See vor Augen, vielleicht tatsächlich etwas zu schreiben.
Lohwaldt musste sich erst noch daran gewöhnen, dass er nun Dichter war. Von höchster Stelle durch Maximilians Stipendium als solcher ausgewiesen. Er hatte sich sogar einen künstlerisch anmutenden Bart wachsen lassen, der sich allerdings noch ungewohnt und fremd anfühlte. Zufrieden mit sich und der Welt stieg er nach der steilen Abfahrt am Seeufer aus der Kutsche. Auf Deutsch erkundigte er sich bei einem schmutzigen Jungen, welches das Haus sei, in dem einst der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe Quartier bezogen habe.
»Ah, Geethe!«, rief der Junge, der offenbar Bescheid wusste. »Lì! Dort!« Er wies auf ein Haus mit einem bogenförmigen Durchgang, durch den man von der Seepromenade auf einen engen Platz gelangte. Der mit Kopfsteinpflaster belegte Hof ruhte im Schatten, umringt von schmalen und hohen Häusern, deren Fensterläden halb oder ganz geschlossen waren. Durchgänge und Treppen öffneten den Blick auf weitere Häuser, die den Berghang hinauf eng verschachtelt standen, wie es die Felsen gerade erlaubten. Während Lohwaldt noch den Blick schweifen ließ und zum ersten Mal das Gefühl hatte, auf südlichem Boden zu stehen, trat ein kleiner, krumm gewachsener Mann auf ihn zu, der ihm gleich zuwider war.
»Signore suchen ein Zimmer?«
»Jawohl. Ich möchte das Zimmer, in dem einst der große Dichter Johann Wolfgang von Goethe genächtigt hat.«
»Geethe! Selbstverständlich, der Herr. Es ist unser bestes! Kein anderes hätte ich dem feinen Herrn angeboten. Es hat einen Ausblick auf unseren herrlichen See.«
Nachdem das Gepäck durch den schmutzigen Jungen hinaufgeschafft war und der krumme Wirt ihm eine Karaffe Wein gebracht hatte, wobei er umständlich erklärte, dass es zum Abendessen Fisch aus dem See geben werde, der am selben Tage gefangen worden sei, kleidete Lohwaldt sich um und wusch sich. Nachdem er sich erfrischt hatte, rückte er den wackligen Tisch ans Fenster, holte Papier, Feder und Tinte aus der Reisetasche, setzte sich und gedachte des großen Dichters und seiner Iphigenie, in der irgendwo die Worte steckten, die Goethe genau hier, an diesem Tisch, geschrieben hatte. Lohwaldt entkorkte das Tintenfass, nahm die Feder, tunkte sie hinein und überlegte. Der Wein hatte sein Blut angenehm belebt und seinen Gedanken einen freieren und lebhafteren Gang verschafft. Doch recht eigentlich war der Tag viel zu schön, um mit Denken in der Stube verbracht zu werden. War er nicht zum ersten Mal im Süden? War es nicht Sünde, die kostbare Stunde verstreichen zu lassen, ohne sie zu würdigen? Also korkte er die Tinte wieder zu und reinigte die Feder im gebrauchten Waschwasser. Doch die Reise des Tages hatte ihn ermüdet, und so beschloss Cornelius, sich angekleidet auf seinem Bett auszustrecken und für einen Moment die Augen zu schließen.
Als er wieder erwachte, war die Sonne hinter den Bergen gegenüber verschwunden, und die Dämmerung ließ kaum noch Licht in das kleine Zimmer. Lohwaldt blickte hinunter zum See und sah einen Mann am Ufer stehen. Der Fremde erweckte seine Neugier, denn es war nicht zu erkennen, was er dort zu schaffen hatte. Er war kein Fischer, der sein Boot ans Ufer gezogen hatte, denn warum sollte er dort stehen bleiben und aufs Wasser hinausstarren, wenn er von seinem Tagewerk hungrig und müde war? Der Mann führte nichts mit sich, was zum Waschen oder Angeln oder Wasserschöpfen dienen könnte. Und darüber hinaus stand er in seiner Reglosigkeit in einer merkwürdig gebeugten – und dies war der Ausdruck, der Lohwaldt in den Sinn kam: geknickten Haltung. Nachdem Lohwaldt seine Weste zugeknöpft, den schwarzen Rock übergezogen und die Schuhe gebunden hatte, stand der eigentümliche Mann immer noch dort.
Lohwaldt bereute bereits, den unnötigen Umweg über den See genommen zu haben, anstatt direkt in der Kutsche nach Süden weitergefahren zu sein. Der zwischen Bergen und See eingezwängte Ort hatte eine bedrückende Wirkung auf ihn. Die wenigen Menschen, die er bisher zu Gesicht bekommen hatte, schienen ihm von harter Arbeit und einseitiger Ernährung verwachsen und niedergebeugt, mit einer Farbe der Haut, die mehr an Oliven erinnerte denn an Lebewesen aus Fleisch und Blut. Als er die krumme Treppe herabkam, fand er den Wirt äußerst aufgeregt, weil er so spät zum Essen erschien, und der Umstand, dass er der einzige Gast war und allein in dem fensterlosen Speiseraum seine Mahlzeit einnehmen musste, hellte seine Stimmung keineswegs auf. Nichts langweilte ihn mehr, als alleine zu speisen. Und an diesem Ort, der weder Norden noch Süden zu sein schien, sondern eine kränkelnde Zwittergeburt zwischen beidem, in dem die Menschen ihre Oliven dem kargen Boden abrangen und niemand ein Wort zu viel sprach oder einen Gedanken zu viel dachte, war die Hoffnung auf eine anregende Unterhaltung und eine fröhliche Gesellschaft aussichtslos.
»Ich werde gleich morgen früh weiterreisen. Beschafft mir ein Boot, das mich über den See bringt«, wies er den Wirt an.
»Morgen früh? Das ist nicht möglich.«
Die bockige Antwort war nicht das, was Lohwaldt erwartet hatte. »Da ich die Fahrt bezahle, wird es wohl möglich sein.«
»Dann müsst Ihr auch den Wind bezahlen«, erwiderte der Wirt, dem seinerseits die Überheblichkeit des deutschen Gastes missfiel.
»Ich denke nicht, dass Eure Frechheit angemessen ist.«
»Nicht ich bin frech.« Der krumme Wirt richtete sich so gerade auf, wie er nur konnte. »Ihr wäret mir etwas schuldig, würde ich nicht Eure Jugend und Eure Ahnungslosigkeit als Entschuldigung gelten lassen. Ihr wisst nicht, dass unser schöner See von zwei widerstreitenden Winden beherrscht wird. Ebenso unnachgiebige wie verlässliche Herrscher, denen wir uns umso lieber unterwerfen, als sie uns das ganze Jahr über …«
Hier fiel ihm Lohwaldt ins Wort. »Verschont mich mit Eurem Geschwätz! Was habe ich mit Euren Winden zu schaffen?«
»Nicht mehr als dies: Wer von hier aus den See überqueren will, muss um Mitternacht das Boot besteigen.«
»Ihr glaubt doch nicht, dass ich morgen den ganzen Tag hier verbringen werde!«
Der Wirt zuckte nur mit den Schultern.
»Nein. Dann fahre ich diese Nacht noch. Beschafft mir ein Boot, lasst mein Gepäck an Bord bringen, und jetzt will ich Wein.«
Nachdem der missmutige Wirt ihm seinen Platz zugewiesen und eine Karaffe Wein gebracht hatte, verschwand er mit verkniffenen Lippen, um das Essen zu bereiten. Während Lohwaldt schnell hintereinander mehrere Gläser Wein austrank, kehrten seine Gedanken zurück zu dem Geknickten draußen am Ufer. Und um nicht alleine in dem nur von einer einzigen knauserigen Lampe erhellten Raum auf das Essen warten zu müssen, beschloss er, für einen Moment hinauszugehen und zu sehen, ob er immer noch dort stand.
Franz Wercker bemerkte den Mann erst, als er neben ihm stehen blieb. Er schaute auf und sah, dass der andere jung war, wohlfrisierte blonde Haare hatte, die den Glanz des Mondlichts angenehm widerspiegelten, und dass er genau wie er selbst zu seinen knöchellangen Hosen den schwarzen, eng geschnittenen Altdeutschen Rock mit den mittelalterlich anmutenden Ärmeln trug, dessen Schöße bis fast zu den Knien reichten. Letzteres war an sich schon bemerkenswert, galt das Kleidungsstück doch als Ausdruck des freien Geistes und des deutschen Freiheitsdrangs und war in Bayern und einigen anderen Ländern verboten, doch hier in der Fremde war es doppelt ungewöhnlich. Nur war sogar in der Dunkelheit offenbar, dass der Rock des anderen über den glänzenden Schuhen neu und wohlgeschnitten war, während er den seinen lächerlich gekürzt hatte, indem er mit den abgerissenen Streifen des staubigen Stoffs die klaffenden Sohlen seiner Schuhe festgeknotet hatte.
Der Fremde sprach ihn an mit den Worten: »Ich sehe, er trägt denselben Rock wie ich!«
Franz, der seit Tagen mit niemandem gesprochen hatte – wenn man die Haft in Bayern hinzurechnete, die er nach den anfänglichen Verhören alleine in seiner Zelle verbracht hatte, sogar seit Wochen –, kam keine Antwort in den Sinn.
»Er ist doch Deutscher und versteht, was ich sage?«
Er nickte.
»Nun, wenn ihm nicht der Sinn nach Unterhaltung steht …« Der junge Mann schien ungehalten über seine Einsilbigkeit. Franz roch den Wein in seinem Atem und rechnete die Ungeduld des anderen dem Alkohol zu. Das kannte er von klein auf: Wenn der Vater nach Wein oder sogar Branntwein roch, dann schien er in einem Moment freundlich und dem Sohn zugetan, nur um im nächsten aus dem nichtigsten Anlass heraus in Wut zu geraten und zu schlagen. Und wie auch immer er auf den ersten Schlag reagierte – ob er weinte, ob er aufschrie, ob er die Erniedrigung trotzig herunterschluckte oder verschlossen und in sich gekehrt alles Weitere abwartete –, es brachte den Alten noch mehr in Rage und den Alkohol in seinem Blut zum Kochen. Und so folgten auf den ersten unbeherrschten Schlag immer Prügel, die erst endeten, wenn Franz zu Boden gegangen und unter den Fußtritten des Vaters aus dem Zimmer gekrochen war. Deshalb reagierte seine Nase äußerst feinfühlig auf bedrohliche Ausdünstungen im Atem, und er musste den darauffolgenden Drang zur Flucht willentlich unterdrücken.
»Nur scheint Ihr Euren Rock«, antwortete Franz endlich, »unter glücklicheren Umständen zu tragen.« Der Fremde betrachtete seine abgerissenen Rockschöße und die damit umwickelten Schuhe.
»Ich will nicht leugnen, dass meine Umstände die glücklichsten sind. Was führt ihn hierher an dieses trostlose Ufer?«
»Trostlos …« Dies Ufer ist nicht trostloser als der lange Weg, der ihn hierhergeführt hatte, dachte Franz, doch er sprach es natürlich nicht aus. Stattdessen fragte er zurück: »Wohin führt Euch Euer Weg?«
»Rom.«
Das Wort traf Franz in die Brust wie ein Pistolenschuss.
»Rom … Dann verstehe ich Euer Glück.«
»Er kennt die Stadt? Ist er etwa schon dort gewesen?«
»Nein. Aber einst wollte ich auch hin … Ich habe alles gelesen, was es darüber zu lesen gibt. Seid Ihr etwa Maler?«
»Nein. Ich bin Dichter.« Unwillkürlich nahm der blonde Mann eine Haltung ein, die er dem Poeten angemessen fand, wobei er allerdings schwankte.
»Dichter!«
»Jawohl. Mit einem Stipendium des bayerischen Königs ausgestattet, werde ich ein Jahr lang die Spuren der Klassiker studieren.«
Franz sah ihm seinen Stolz an. Er hatte nichts gegen eine gesunde Selbstachtung einzuwenden, doch diese hier paarte sich mit Überheblichkeit und war ihm zuwider. »Wenn der König Euch eine Rente gewährt, müsst Ihr ein berühmter Mann sein.«
»Nun, mein Ruhm gründet sich noch auf eine einzige Dichtung. Aber sie hat den König so sehr bewegt, dass er mir seine Gunst geschenkt hat.«
»Vielleicht kenne ich Euer Werk?«
»Kaum«, entfuhr es Lohwaldt mit einem abfälligen Blick auf Franz’ Erscheinung. »Es ist die Ode an die erwachende Germania.«
»Ihr seid Cornelius Lohwaldt!« Selbstverständlich kannte er die Ode, die der unbekannte junge Dichter das Selbstbewusstsein besessen hatte, Maximilian von Bayern persönlich zu widmen. Franz hatte sich gewundert, dass Maximilian sich für die Germania erwärmte. War er doch wie die meisten anderen Landesherren froh, sein junges Königreich über die Napoleonischen Kriege und den Wiener Kongress gerettet zu haben. Alles mit dem Geruch des Deutschnationalen war dem Monarchen naturgemäß zuwider – weswegen er ja auch den Altdeutschen Rock als Symbol der Freiheit und Selbstbestimmung und des Widerstands gegen die Monarchien verboten hatte.
Die Germania war zunächst im Morgenblatt für gebildete Stände erschienen, der führenden literarischen Zeitung deutscher Sprache, hatte Wohlwollen hervorgerufen und war in den verschiedensten Kreisen sogar mit Begeisterung aufgenommen worden. Andere wiederum empörten sich über sie, was ihre Bekanntheit mehrte, worauf einige Zeitschriften sie nachgedruckt hatten. So war Cornelius Lohwaldt in nur einer Saison in aller Munde gelangt.
Dass Franz die Germania kannte, schien ihn in der Achtung des anderen wachsen zu lassen. Er sah, dass der gerühmte Jungdichter ihn prüfend musterte. Vielleicht überlegte er, ob er ihn zum Abendessen einladen sollte, doch dann schien er sich dagegen zu entscheiden. Franz konnte es ihm nicht verdenken: Sein Äußeres war nicht gesellschaftsfähig. Und doch versetzte es ihm innerlich einen Stich, denn er fühlte nur zu gut – er hatte die Lektion gründlich gelernt –, dass nicht nur sein Äußeres, sondern er selber nicht gesellschaftsfähig war.
Sein Vater hatte sich nach seinen Wanderjahren als Zimmermann in Grunenfurth, einem Ort in der Gegend von Memmingen, niedergelassen. Die Walz hatte ihn weit nach Ungarn hinein gebracht, und auch von der Goldenen Stadt Prag hatte er unglaubliche Geschichten erzählen können. Dies war vielleicht auch der Grund gewesen, dass er eine sehr schöne, aber leider engherzige junge Frau für sich gewann. Aufgrund ihrer Schönheit sah er über ihr zänkisches Wesen hinweg, denn er war gewiss, dass sie weicher werden würde, wenn sie erst für eine Schar Kinder sorgte. Tatsächlich schien sich nach Franz’ Geburt eine zufriedene Zeit anzubahnen. Doch zeigte sich bald, dass der Charakter des Vaters von zweifelhafter Natur war. Er verspielte viele Sympathien, als man ihn beim Diebstahl eines Säckchens mit Jesusnägeln erwischte, und als der Geldbeutel des Meisters verschwand, den nur er gestohlen haben konnte, was er allerdings vehement leugnete. Mehrfach übervorteilte er Kameraden bei kleinen Tauschgeschäften, sodass man begann, ihm zurückhaltend und misstrauisch zu begegnen, und bei der Arbeit oft andere Zimmerleute bevorzugte. Auch über die Ehe legte sich ein dunkler Schatten, als zwei Säuglinge nach nur wenigen Lebenstagen starben. Seine Frau verwand diese Unglücke nur schwer, und sie gab ihrem Mann und den ärmlichen Verhältnissen, unter denen sie die Kinder hatte gebären müssen, die Schuld an ihrem Tode. Im selben Maße, wie sie ihr zänkisches Wesen gegen ihn kehrte, zog er sich von ihr zurück. Und eines Tages – sie war zum vierten Mal schwanger – fand sie heraus, dass er sie mit der Tochter eines Nagelschmiedes betrog, der er von dem wenigen, das er verdiente, kleine Geschenke machte. Franz erinnerte sich an Geschrei und auch an Schläge, und als der Vater daraufhin betrunken zur Arbeit ging, erlitt er beim Errichten eines Dachstuhls einen Unfall: Ein herabstürzender Balken, die große Firstpfette, zerquetschte ihm das Bein, das ihm ein kunstfertiger Arzt, als er am Wundfieber zu sterben drohte, amputierte. Zwar rettete ihm der Arzt damit das Leben, aber es war nicht mehr das Leben, das es vorher gewesen war. Als Zimmermann konnte er nicht mehr arbeiten. Er nahm Aushilfsarbeiten an, und während die alten Kameraden das Fachwerk hinauf nach oben in die Dachstühle stiegen, humpelte er am Boden einher, sägte Balken zu, hobelte, bohrte und trank. Natürlich verdiente er noch weniger als vorher, weswegen sowohl die Mutter als auch später der Sohn dazuverdienen mussten, wo es eben ging. Die Familie gehörte zu den ärmsten im Ort, und es schien, als hätte der kunstfertige Arzt dem Vater nicht nur das Bein, sondern auch den Stolz amputiert. Sein Neid und seine Wut auf Menschen mit zwei Beinen, und später auf alle Menschen mit Hoffnungen, brachen immer gröber aus ihm heraus, und das umso mehr, je betrunkener er war. Wo er anfangs noch aus Mitleid und aufgrund seines Fleißes beschäftigt wurde, war man bald von seinem feindseligen und fordernden Wesen abgestoßen und mied seine Nähe. Er verfiel der Trunksucht und konnte schließlich überhaupt nicht mehr arbeiten.
Als Franz sechs Jahre alt war, hatte die Mutter in die schlimmste Krise des amputierten Vaters hinein ein Mädchen geboren. Inmitten all der Widerwärtigkeiten klammerte sie sich mit ganzer Seele an dieses Kind. Sie sah in der Kleinen irgendetwas, das sie in Franz nicht gesehen hatte, und liebte sie abgöttisch. Eifersüchtig hielt sie jedermann von dem Mädchen ab. Nicht einmal Franz durfte sein Schwesterchen halten. Aber auch er liebte die kleine Schwester, und deshalb nahm er sie manches Mal heimlich, um ihre warme Nähe zu spüren. Als die Mutter ihn einmal mit dem Kind auf dem Arm erwischte, verbot sie ihm tagelang, das Haus zu betreten. Er musste im Holzschuppen schlafen. Doch nach zwei Jahren starb auch dieses Kind an einem Fieber. Dem Vater schien das Ereignis gleichgültig, doch die Mutter erstarrte. Sie wurde hart wie Salz, und als Franz einmal ihre Nähe suchte, stieß sie ihn von sich und zischte ihn an, ihre Tochter könnte noch leben, wenn er sie nicht mit seinem Schmutz befleckt hätte.
Dies waren die letzten Worte, die sie für lange Zeit zu irgendjemandem sprach, und von nun an herrschte bitterste Not. Weder die erstarrte Mutter noch der saufende Vater schienen unter dem ewigen Hunger zu leiden, oftmals überlebte Franz nur durch Diebstähle und indem er unreife Kartoffeln ausgrub und im Wald versteckte.
Am Jahrestag des Todes der kleinen Schwester entschied die Mutter, nicht länger zu trauern, ging zum Schloss Grunenfurth, dem Landgut des Freiherrn Georg von Unold, das nur mit einigem guten Willen als Schloss bezeichnet werden konnte, und forderte eine Stelle als Näherin, die man ihr gnädig gab. Von da an war sie kaum noch zu Hause. Auch wenn ihre Finger vom stundenlangen Gebrauch der Nadeln schmerzten, fühlte sie sich – im abgeschirmten Kreis des Schlossparks und über die schönen alten Stoffe gebeugt – der gehobenen Welt des Adelslebens auf so selige Weise zugehörig, dass sie alles umso mehr verachtete, das sie in die widerwärtige Wirklichkeit zurückzog. Und das waren vor allem ihr prügelnder Mann und ihr geprügelter Sohn.
Dies also war das Elternhaus, in dem Franz aufwuchs. Auch er fand schon früh Arbeiten in Schloss Grunenfurth – bei der Ernte, als Stallbursche, als Hirte. Franz war fleißig und willig, und er glich dem Vater in dessen jungen Jahren, als er voller Hoffnung auf die Walz gegangen und vom zufriedenen Gefühl durchdrungen war, wenn er nur ordentlich zupackte, gehörten ihm der Himmel und die Erde – oder jedenfalls der Flecken Erdboden, auf dem er abends die müden Beine ausstreckte. Franz besaß die Zuversicht seines jungen Vaters, nachdem er von seiner Wanderschaft heimgekehrt war. Vielleicht war dies der Grund, dass die Mutter ihm schon als Kind misstraute und, anstatt dem Jungen seinen aufrechten Geist zu gönnen, voller Neid und Missgunst gegen ihn war. Die Mutter war so verbittert über den Verlauf ihrer Ehe, dass sie wohl am liebsten gesehen hätte, wie der Junge recht bald gemeinsam mit seinem verkrüppelten Vater unterging.
Doch war es genau sein offenes Wesen, das ihm, als er eines Tages Ziegen hütete, die Aufmerksamkeit von Jacob, dem jungen Freiherren, einbrachte, der im Grünen saß und sich davor drückte, seine Lektionen auswendig zu lernen. Franz ließ sich die Bücher zeigen, die achtlos im Gras lagen. Der gelangweilte junge Herr, zwei Jahre älter als er, hatte gleich die Idee, dass er den neugierigen Jungen ärgern konnte, indem er ihm seine Unwissenheit unter die Nase rieb. Doch gelang ihm das nicht: Franz, dem seine Unwissenheit trotz des kindlichen Alters sehr wohl bewusst war, litt keineswegs darunter, sondern sog im Gegenteil alles Wissen, das er dem jungen Herrn abschauen konnte, auf wie ein frisch gepflügtes Feld den Regen. Es dauerte nicht lange, und der Spieß war völlig herumgedreht: Statt dass Jacob von Unold den Kleineren entmutigte und mit der Schwierigkeit seiner ihm selbst so verhassten Bücher niederdrückte, steckte Franz ihn mit seiner Neugier und seiner Begeisterung an, und bald empfand der junge Freiherr Freude dabei, Franz das Lesen beizubringen und ihm später Bücher zu leihen. Die beiden trafen sich oft heimlich, um zu lesen und das Gelesene weiterzuspielen: Sie wurden zu Achill und Hektor, zu Cäsar und Brutus, zu Siegfried und Hagen und irrten als Odysseus und Eurylochos durch Wälder, Schafställe und Schweinekoben. So ging das über mehrere Sommer, bis Jacob zwecks militärischer Erziehung nach München geschickt wurde.
Franz, der kaum jemals die Schule besucht hatte, begann eine Lehre als Zimmermann. Er fand einen Meister, der ihm trotz seines Vaters vertraute, und tatsächlich arbeitete Franz geschickt und fleißig. Immer wieder allerdings lachten die anderen Lehrlinge und Gesellen über ihn, weil er oft abwesend und in eigenen Gedanken war. Er hatte gemeinsam mit Jakob Grunenfurth in aller Heimlichkeit die Dichtkunst nicht nur kennen sondern auch lieben gelernt. Es war dem Jungen, als ob sich ihm die Welt geöffnet hätte, die seine eigentliche Heimat war. Dass er nur versehentlich ins trübe und bedrückende Haus seines Vaters geraten war, während er doch stattdessen, umgeben von Büchern, durch einen französischen Erzieher hätte unterrichtet werden sollen, der alle Segnungen der Klassik, der Aufklärung, der Empfindsamkeit und natürlich das Ungebändigte der Jungen vor ihm ausbreitete. Nur, wo sollte Franz Bücher herbekommen? Nachdem er einen Sommer lang buchlos gelitten hatte, fand er Möglichkeiten: Er bestach einen Diener, der ihm kleinere Bände aus der Bibliothek des Landschlosses stahl. Bis sein Vater die Bücher fand und ihn halb totprügelte. Dann stahl er aus dem Schulhaus eine Übersetzung von Homer, einige Dramen und eine Fibel, die er später zurückbrachte und gegen neue tauschte. Doch trotz aller Vorsicht wurden auch diese Bücher gefunden – diesmal von der Mutter. Der Vater prügelte ihn und verbrannte die Bücher, worauf er natürlich keine neuen bekam. Schließlich behielt er von dem wenigen, das er verdiente, heimlich kleine Beträge zurück und wanderte bis nach Memmingen, wo er bei einem Buchhändler regelmäßig billige Bücher und Schriften kaufte, darunter in großer Zahl auch Mordgeschichten, Geheimbundromane, Schauererzählungen und Liebesromanzen. Es waren zerrissene, schimmelige, von Mäusen angefressene Exemplare, aus denen der Buchhändler noch ein paar Münzen schlug. Franz kaufte auch Bücher, deren Bindung sich gelöst hatte, und deren Anfang oder Ende verloren gegangen war. Diese bereiteten dem Jungen sogar ein besonderes Vergnügen, weil er halbe Nächte lang oder während der eintönigen Arbeit an den unfertigen Holzbalken ein eigenes Ende für die Geschichten ersann. Oftmals sogar mehrere unterschiedliche, die sich zu ganzen Geschichten fortspannen. Das ging mehrere Jahre lang gut, zumal er seine Schätze in einer Kiste im Wald vergrub und nur jeweils einen einzigen mit nach Hause nahm, um ihn im Schein einer Kerze nächtens zu lesen. Franz schloss seine Lehre ab und wollte ebenfalls auf die Walz gehen. Tagtäglich fieberte er dem Tag seiner Abreise entgegen. Sobald die Bürde des Vaters von seinen Schultern wäre, würde er lesen können, wann immer er Zeit fand. Doch der Vater verweigerte ihm die Erlaubnis. Er forderte von Franz, seine Sohnespflicht dem verkrüppelten Vater gegenüber zu erfüllen. Also blieb Franz zu Hause und lieferte seinen Verdienst ab, den der Vater umgehend versoff. So war es zu seiner Wanderschaft nie gekommen. Stattdessen hatte Franz das niederste aller Verbrechen begangen.
»Nun«, sagte Cornelius Lohwaldt, um mit diesem vielseitigen kleinen Wort, diesem Luder unter den Worten, einen Riegel vor ihre Unterhaltung zu schieben. »Er scheint mir recht im Unglück zu stecken. Vielleicht möchte er etwas von mir annehmen, damit er sich ein Abendessen und ein Zimmer für die Nacht leisten kann?«
»Nein danke«, erwiderte Franz. »Wie so oft trügt der Schein. Ich bin nicht so bedürftig, wie ich aussehe. Aber man scheint nach Euch zu suchen.«
Er wies auf die Pension, wo unter dem Durchgang der Wirt erregt hin und her lief und in der Dunkelheit nach seinem Gast spähte. Die beiden jungen Männer wünschten sich Glück, und Franz sah dem Dichter nach, der über den knirschenden Uferkies unsicheren Schrittes und mit missmutig eingezogenen Schultern seiner bedeutenden Zukunft entgegenstolperte.
Er blieb alleine am Strand zurück. Vor ihm plätscherten die Wellen ans Ufer, sonst war nichts mehr zu hören. Eben noch war er sicher gewesen, dass die Sonne seinen Körper nie wieder bescheinen würde, weil er tief unten am dunklen Grund des Sees sein Grab finden würde. Sein zweites und diesmal endgültiges. Doch die Begegnung mit Cornelius Lohwaldt hatte ihn verwirrt.
Alle Gewissheiten waren plötzlich durcheinandergeworfen wie Spielzeug von der Hand eines mutwilligen Kindes. Warum hatte dieser unwirsche Mensch all das Glück, das er sich immer schon erträumte? Warum ging dieser Jüngling auf die Reise, ohne Neugier, ohne Wissensdurst, ohne Neigung – im Erwarten, dass ihm die großen Schätze der Kultur geboten würden, doch ohne den geringsten Willen, sich nach den Kleinoden zu seinen Füßen zu bücken!
Franz sah sich um, wo er ein wenig Schutz finden könnte. Einen Moment lang bereute er, dass er das Almosen Lohwaldts ausgeschlagen hatte, doch im Grunde war er froh darum. Von diesem wollte er nichts annehmen. Sein Blick fiel auf ein Boot, das umgedreht auf dem Strand lag. Darunter, meinte er, ließe sich ordentlich übernachten. Er hatte in seinem Leben unbequemere und auch feuchtere Nächte verbracht als in dem hölzernen Hohlraum, in dem es gewiss ganz gemütlich werden könnte. Er hob das Boot auf einen der Findlinge, die halb im Strand steckten, sodass sich ein Spalt ergab, durch den er bequem in seine Behausung kriechen konnte. Unter dem Boot fand er einen Haufen zusammengelegter Fischernetze, die er ausbreitete, um sich eine warme Unterlage zu schaffen. Und so war es dann tatsächlich recht behaglich. Er dachte, wenn er ein Licht hätte und etwas zu lesen, dann ließe sich die Nacht hervorragend an. Doch er hatte weder das eine noch das andere, und so lag er im Dunkeln und dachte darüber nach, wie es kommen konnte, dass er eben noch den entschlossenen Schritt ins Wasser vor Augen gehabt hatte und nun, ungeachtet dessen, welche Entbehrungen auf ihn zukamen, im Innern seiner bescheidenen Hütte zufrieden und lauschig den Schlaf erwartete. Vielleicht, dachte er, liegt alle Kunst darin, nicht an morgen zu denken. Denn sobald er das tat, wurde ihm übel. Doch seine Erschöpfung war so durchdringend, dass er nicht lange wach blieb, sondern in einen unruhigen Schlummer fiel.
Als Franz von Schritten erwachte, wusste er nicht, wie lange er geschlafen hatte, doch er hatte das Gefühl, noch nicht in die tiefen Träume gesunken zu sein. Jemand näherte sich deutlich hörbar über den Uferkies. Die Schritte knirschten, von der kleinen Ortschaft kommend, bis nah ans Boot heran. Franz fürchtete, man habe ihn beobachtet und wolle ihn aus seinem Heim vertreiben. Er hielt den Atem an und glaubte, zu hören, dass die Schritte unregelmäßig waren, wie von jemandem, der es nicht gewohnt ist, auf solch nachgiebigem Grunde im Dunkeln zu gehen, und deswegen immer wieder um sein Gleichgewicht ringt. Außerdem hörte er das leise Summen eines Lieds. Als er eben glaubte, jetzt werde man gegen das Boot pochen und rufen, entfernten die Schritte sich und stapften weiter. Franz kroch vorsichtig zum Spalt und spähte hinaus. Er sah einen Mann am Ufer entlanggehen. Dem Körperbau nach schien es der Nürnberger Dichter zu sein. Er trug denselben Rock, mit dem er zuvor an ihn herangetreten war, und torkelte wie ein Betrunkener. Ein Stückchen weiter ragte ein roh gezimmerter Bootssteg ins Wasser. Lohwaldt blieb vor dem Steg stehen, schaute sich nach beiden Seiten um und betrat das hölzerne Gestell. Unsicheren Schrittes balancierte er bis ans Ende und dann – knöpfte er sich die Hose auf. Franz hörte, wie sein Strahl ins Seewasser plätscherte. Er zog sich zurück, um nicht doch noch entdeckt zu werden, als er plötzlich durch ein Platschen aufgeschreckt wurde. Lohwaldt war verschwunden! Nach einem Moment des Erstaunens wurde dem schlaftrunkenen Franz klar, dass der junge Günstling des bayerischen Königs in den See gefallen sein musste. Und tatsächlich sah er im Mondlicht hell glitzernde spritzende Bewegungen im Wasser. Eilig kroch er unter seinem Boot hervor und rannte zum Steg. Er tastete sich mit den Füßen über das schwankende Holz zum vorderen Ende. Die Oberfläche lag jetzt ganz still. Nur kleine Wellen deuteten an, dass eben noch etwas das Wasser aufgewühlt hatte. Wo war Lohwaldt? Konnte er etwa gar nicht schwimmen? Und würde ein Mensch überhaupt so schnell untergehen? Er zögerte nicht, sondern sprang. Eiskalt schlug das Wasser über ihm zusammen und drang überraschend eisig in seine Kleider ein. Für einen Moment schien der Schlag seines Herzens auszusetzen, um dann umso wilder wieder Fahrt aufzunehmen. Mit wenigen geübten Bewegungen drückte er sich nach oben und durchbrach die Oberfläche. Noch während er tief einatmete, sah er sich um. Die Wasserfläche kräuselte sich in gegeneinanderlaufenden kleinen Wellen. Noch einmal holte Franz tief Luft und tauchte unter. Er musste Lohwaldt schnell finden! Unter Wasser wühlte er mit Armen und Beinen, bis er tatsächlich mit der Hand gegen etwas stieß. Da war er! Noch ein kräftiger Schwimmstoß, dann fühlte er den Stoff eines Rocks, griff zu und zog. Er wollte hinauf zur Oberfläche, doch plötzlich waren da Finger, die sich an ihn krallten und ihn in wilder Panik nach unten zerrten. Eine Hand umklammerte seinen Arm, sodass er damit nicht rudern konnte, eine andere schlug und kratzte in sein Gesicht. Plötzlich stießen die Finger mit Urgewalt in seinen Mund und packten eisern zu. Die Hand hielt seinen Unterkiefer umklammert, riss daran herum und drohte ihn vom übrigen Kopf abzureißen, als ob ein Wassergeist ihm das warme Blut aus dem Körper schütteln wollte. Der Schmerz war übermächtig, Luft schoss aus seinem Mund. In Todesangst schlug er mit dem freien Arm um sich, traf irgendetwas, irgendwo, und als sich der Griff immer noch nicht lockerte, stieß er mit dem Fuß zu. Zugleich – um den Mann, den er ja retten wollte, nicht zu verlieren – packte er einen Zipfel, den er zufällig erwischte, und hielt daran fest. Doch schon fühlte er das Ende kommen. Wasser strömte in seinen Hals, die Luftnot war kaum noch zu ertragen, Schläge, Tritte, Stöße – plötzlich spürte er sich befreit, ruderte mit den erlösten Armen – und dann Ruhe.
Stille, Frieden.
Franz lag im nassen Kies, als er wieder zur Besinnung kam. Er hustete und spuckte das Seewasser aus sich heraus, erbrach sich in die plätschernden Uferwellen und kroch höher auf festen Boden. Im den ersten Momenten wusste er nicht, wo er war. Doch dann kehrte die Erinnerung schlagartig zurück.
Lohwaldt!
Er stemmte sich auf die Arme und schaute sich um.
Der Holzsteg ragte in den stillen See hinaus, drüben die Häuser, zur anderen Seite das bewachsene Ufer, das sich bald den Blicken entzog und wo – wie Franz tagsüber von der Festungsruine aus gesehen hatte – ein kleiner Fluss in den See strömte. Die Wasserfläche lag unter den feinen, regelmäßigen Wellen ruhig und still. Ihm wurde bewusst, dass seine rechte Hand sich in etwas Nasses verkrallte, und als er es hochhob, erkannte er Lohwaldts Rock. Wie war das geschehen? Wieso hielt er diesen Rock in der Hand? Hatte er daran gezogen, und der Dichter war unter Wasser aus den Ärmeln herausgeglitten? Voller Entsetzen starrte er auf die leere Hülle, in der eben noch ein lebendiger Mensch gesteckt hatte, der nun tot im eisigen Wasser trieb. Denn es konnte nicht der geringste Zweifel daran bestehen, dass Lohwaldt tot war. Franz lief am Ufer auf und ab. Doch Cornelius Lohwaldt blieb in den Tiefen des Sees verschwunden.
Er ließ sich in den Kies sinken und saß lange da, starrte vor sich hin und versuchte, zu begreifen, was geschehen war. Nicht er hatte sein Grab im See gefunden, sondern der junge Dichter, der behaglich und selbstzufrieden, mit seinem Stipendium ausgestattet, auf dem Weg nach Rom gewesen war. Vielleicht wäre dort, angesichts der Wunder der Ewigen Stadt, aus dem hochnäsigen Jüngling sogar ein anständiger und großherziger Mensch geworden.
Franz hörte aus der Ferne ein Rufen: »Signor Lohwaldt!«, erklang es. Jemand stand am Dorfrand und winkte mit einem Hut. »Das Boot ist bereit!«
Ihm wurde schlagartig bewusst, in welcher Gefahr er schwebte: Lohwaldt war verschwunden, und natürlich würde man ihn, den zerlumpten Dahergelaufenen, verdächtigen, etwas damit zu tun zu haben. Umso mehr, als man schnell wissen würde, dass er in Trient aus dem Gefängnis geflohen war, nachdem er einen falschen Namen angegeben hatte. Man würde ihn festsetzen und gründlich prüfen, woher er stammte. Bis man schließlich erfuhr, dass er schon in Bayern dem Kerker entflohen war. Jedermann war dann klar, dass er, vielleicht um ein paar Münzen willen, vielleicht um eine goldene Uhr, Cornelius Lohwaldt ebenfalls getötet hätte. Und immer noch hielt er den Rock Lohwaldts in Händen! Gott im Himmel! Sie mussten ihn für einen Mörder halten! Und – war er nicht vielleicht wirklich einer? Was war dort im Wasser geschehen? Franz erinnerte sich nur in zerrissenen Fetzen. Er erinnerte sich an Schläge. An Tritte. Warum hatte er den Rock Lohwaldts aus dem Wasser geborgen, Lohwaldt selber aber nicht? Hatte er Lohwaldt umgebracht? Vielleicht, um –
»Es ist Zeit! Kommen Sie!«
Franz starrte auf die winkende Gestalt. Man meinte ihn! Der Mann hielt ihn für Lohwaldt! Natürlich, er saß ja dort, wohin man den Gast vor einer Weile hatte spazieren sehen. Offenbar hatte man das Boot aufgetakelt, um den See zu überqueren, und Lohwaldts Gepäck verladen. Nun rief man den Dichter, um abzulegen.
Und ihn hielt man in der Dunkelheit für den Reisenden. Was geschah denn jetzt schon wieder? Spielte diese Nacht ihm etwa noch einen Streich?
»Kommen Sie! Avanti! Wir müssen den Wind ausnutzen.«
Und dann hörte Franz aus seinem eigenen Munde: »Ich komme!«
Hatte er das wirklich gerufen?
Ich komme!
Ich, Cornelius Lohwaldt.
»Ich komme!«
Natürlich! Nicht der junge Dichter aus Nürnberg war im See ertrunken, sondern der entflohene Häftling aus Memmingen. Er käme doch noch nach Rom. Und – in seinen kühnsten Träumen hätte er nicht daran gedacht – versehen mit einem Stipendium des königlich bayerischen Hofes! Von heute an könnte er als Cornelius Lohwaldt leben. In Rom wäre es möglich, wo den jungen Dichter aus der Provinz noch niemand kannte. Sicher würden einige seine Ode kennen, seinen Namen. Aber ebenso sicher war niemand dort, der Lohwaldt je gegenübergestanden hatte. Er könnte ein Jahr lang als Cornelius Lohwaldt in Rom leben, und dann –
Und dann?
Nicht daran denken. Niemals an morgen denken. Einer wie er durfte das nicht tun. Als Franz Wercker ebensowenig wie als Cornelius Lohwaldt.
Aber Lohwaldts Leichnam! Würde er nicht ans Ufer treiben? Würde man ihn nicht finden und erkennen? Und dann wäre gleich alles aus. Nein, überlegte er. Einen Steinwurf weiter schob der kleine Fluss sein kaltes Bergwasser in den See. Mit etwas Glück trieb der leblose Körper weit hinaus und wurde von den Umwälzungen in die tiefsten Tiefen gedrückt. Mit etwas Glück …
Und so stand Franz auf, zog den eigenen, zerrissenen Rock aus und streifte den neuen Mantel über. Es war schwierig, in die tropfnassen Ärmel zu gelangen, aber als er sich endlich hineingezwängt hatte, engte ihn der Rock nur um ein weniges ein. In den Schultern spannte der Stoff, weil Franz durch die Arbeit mit dem Holz kräftiger war als Lohwaldt, aber beinahe hätte der Rock sein eigener sein können.
Während er zur Ortschaft hinüberging, fühlte er in den Taschen, ob etwas darin war, doch er fand nichts. Wenn Lohwaldt etwas bei sich getragen hatte, eine Uhr oder vielleicht Geld oder seinen Pass, dann steckte es in seiner Weste und war mit ihm untergegangen. Die Uhr überließ er dem Verstorbenen gerne, doch ohne den Pass würde er Schwierigkeiten bekommen. Bis nach Rom hatte er noch mehrere Grenzen zu überschreiten, überall herrschte Misstrauen: Die Österreicher waren wieder die Herren in Lombardo-Venetien, doch Parma, Modena und Toskana trotzten nervös um ihre Unabhängigkeit, und der Kirchenstaat mühte sich, die Demütigung der Papstentführung durch Napoleon zu vergessen.
Als Franz vom Kies des Strands auf die Uferstraße trat, war kein Mensch zu sehen. Der Ort schlief. Auch das Zollhaus auf der Mole mit dem Wappen der österreichischen Monarchie war um diese Zeit unbesetzt. Tür und Fenster waren verschlossen. Nur an dem Segelboot, das zur Abfahrt bereitlag, waren drei Gestalten beschäftigt. Einer stand an Bord und begann, das Segel zu setzen, ein Junge hielt auf der Mole das Tau, um es zu lösen, sobald der Fahrgast das Boot bestiegen hätte, und ein verwachsener Mann mit Hut kam ihm mit einer Laterne entgegen. Zum Glück war es eine recht armselige Funzel, die noch nicht einmal sein eigenes Gesicht erhellte. »Es ist höchste Zeit, junger Herr! Ich habe persönlich dafür gesorgt, dass von Eurem Gepäck nichts verloren geht.« Das musste der Wirt sein, der sich noch ein Trinkgeld versprach. Franz hoffte, dass Lohwaldt die Zeche für Essen und Zimmer bereits gezahlt hatte, denn er hätte nicht gewusst, wo er in Lohwaldts Taschen und Koffern in der Eile hätte Geld finden sollen. Um nicht angeleuchtet zu werden, wandte er den Kopf ab.
»Schön, ich danke Euch«, murmelte er. »Das Boot sieht gut aus.«
»Natürlich sieht es gut aus. Glaubt Ihr, die Männer überqueren in einem schlechten Boot bei Nacht den See?«
»Also, lebt wohl.« Er wollte gerade ins Boot steigen, als der Wirt sagte: »Aber Ihr seid ja vollkommen durchnässt!«
Er erstarrte. Auf diese Frage hätte er vorbereitet sein müssen. Doch wie hätte er dafür eine vernünftige Erklärung abgeben sollen? Und – einerlei, was für eine Geschichte er erzählt hätte – der Wirt hätte ihn währenddessen in aller Ruhe betrachten können. Also antwortete er nur: »Ja, das bin ich«, und stieg ins Boot, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Der Bootsjunge mit der Leine sprang hinterher, das Segel ruckte hoch, flatterte und knatterte, bis es sich brav mit Wind füllte und das Boot vom Ufer wegzog. Erst als sie mehrere Bootslängen hinaus auf dem See waren, wagte es Franz, sich umzuschauen. Aber da sah er den Wirt schon mit seiner Laterne zum Haus zurückeilen. Offenbar froh, den ungeliebten und unverstandenen Gast aus dem Norden so schnell wieder loszuwerden.
Franz kauerte erschöpft auf der hölzernen Bank, während das Boot mit gutem Wind südwärts segelte. Malcesine, das kleine Städtchen mit der malerisch auf dem Felsen thronenden Festungsruine, in der Goethe einst festgenommen werden sollte, als er das verfallene Gemäuer zeichnete und für einen österreichischen Spion gehalten wurde, ließen sie noch in der Dunkelheit hinter sich. Als es dämmerte, rief ihm der Bootsführer zu, sie seien jetzt aus dem Bereich heraus, in dem der Wind ihre Fahrt behindern könnte. Doch Franz begriff kaum, was er ihm sagte, denn er starrte auf das Gepäck Cornelius Lohwaldts, das jetzt seines sein sollte. Indem er die Arme frierend um seine feuchten Kleider schlang, war sein Blick wie gefangen von den Gepäckstücken – zwei kleinere Taschen und zwei große Koffer. Er wagte nicht, auch nur eine der Taschen anzurühren. Er wäre sich vorgekommen wie ein Leichenfledderer.
Doch was er dringend brauchte, war ein Paar Schuhe. Und so legte er den ersten Koffer um – der Bootsjunge half ihm dabei – und öffnete ihn. Unter Kleidern und Büchern fand er ein Paar halbhohe Schnürstiefel und ein Paar glänzende Schuhe für die Abendgarderobe. Er zog sich die alten Fetzen von den Füßen und streifte Lohwaldts Stiefel über seine seit Stunden feuchten, aufgedunsenen und eiskalten Füße. Die Stiefel waren zu klein. Lohwaldt war schmaler und feingliedriger gewesen, doch mit Gewalt quetschte Franz seine Füße hinein. Er hoffte, in den nächsten Tagen nicht allzu viel laufen zu müssen, und beschloss, bei nächster Gelegenheit eigene Stiefel schustern zu lassen.
Im Licht der Morgensonne, die sich über die flacher werdenden Berge erhob, betrachtete Franz ein letztes Mal die alten Stiefel und dankte ihnen, dass sie ihn so weit getragen hatten. Nun hatten sie ihre Pflicht erfüllt, und er ließ sie über Bord fallen. Während das Boot in zügiger Fahrt über das Wasser glitt, beobachtete er, wie sie zurückblieben und unter der spiegelnden Oberfläche versanken.
II
Isolde hasste das scheinheilige Gebaren ihrer Mutter, sie verachtete die biedere Würde ihres Vaters, sie erstickte im Haus ihrer Eltern, und auch den Park, in dem alles gepflegt, geordnet, sauber und gerade beschnitten war, ertrug sie nicht. Deshalb freute sie sich nicht wirklich, als Professor von Schabeisen – dessen joviale Hilfsbereitschaft sie nicht ausstehen konnte – am Morgen feierlich verkündet hatte, sie dürfe zum ersten Mal wieder hinaus in den Garten. Nachdem sie drei Wochen ausschließlich im Bett verbracht hatte, schien dem Professor ihre Verfassung gekräftigt genug, um der frischen Luft standzuhalten. Wenn sie hustete, fanden sich in ihren Taschentüchern keine Blutstropfen mehr, doch ihre Haut war immer noch durchschimmernd wie Pergament. Die zum Zerreißen gespannte Hülle ihres schmalen Körpers war so überempfindlich und reizbar, dass ihr jede Berührung unangenehm war und nahezu schmerzte. Sie hatte festgestellt, dass enge Ärmel ihr wohler waren als weite, weil sie weniger über die Haut strichen. Ihre knochigen Schultern und den schwungvoll aufragenden Hals hielt sie unbedeckt, und das seidene Tuch, das die Mutter ihr aufgedrängt hatte, im Glauben, zumindest die teuerste Seide sei ihrer Tochter weich genug, hatte sie ins Gras fallen lassen.
Als Frau Kommerzienrat Agnes Lohwaldt sich dem Korbsessel näherte, den man für Isolde im Schatten einer Linde aufgestellt hatte, fuhr ihr der Anblick tief ins Mark: Sie konnte durch ihre Tochter hindurchsehen wie durch einen der Geister aus den Geschichten von E. T. A. Hoffmann, die sie heimlich las, obwohl ihr Ehemann ein entschiedener Feind dieser gottlosen Machwerke war. Doch dann erkannte sie, dass es lediglich die bewegten Schatten der Blätter waren, die auf Isolde denselben Eindruck wie auf dem Hintergrund hervorriefen, denn der sonnenbeschienene Rasen verlieh ihrer fahlen Haut eine grünliche Färbung. Schlimm genug, dass Isoldes Haut keinen eigenen Ton hatte, sondern die Farbe ihrer jeweiligen Umgebung annahm – das Weiß der Bettlaken, das Rot des Wageninneren, die Glut des Kaminfeuers –, war sie doch zum Mindesten noch kein Geist. Wenn auch an den sorgenvollsten Tagen und in den schlimmsten Nächten nicht viel gefehlt hatte, dass sie von diesem Leben in ein anderes hinübergeglitten wäre.
Agnes Lohwaldt hob das Tuch vom Rasen auf. »Isolde, mein Kind, du darfst dein Tuch nicht ablegen. Professor von Schabeisen hat strikte Anweisungen gegeben.«
Langsam hob Isolde den Blick von dem Büchlein, das sie auf dem Schoß hielt, und wandte ihrer Mutter den Kopf zu, der auf ihrem hohen Halse ein Eigenleben zu führen schien. Das Schwarz ihrer Augen traf die Mutter mit einer Wucht, die der gutmütigen Dame immer wieder aufs Neue den Atem nahm. Auch wenn an ihrer Tochter alles blass und farblos war, kränklich, schwach und hilfebedürftig, Isoldes Augen zu sehen bedeutete einen Schock. Sie kauerten schwarz glänzend in dunklen Höhlen wie zwei starrsinnige Tiere, von denen man niemals wusste, ob sie sich argwöhnisch vor der Welt versteckten oder ob sie verschlagen und bösartig auf eine Gelegenheit lauerten, hervorzuspringen und zu beißen. Die Mutter schämte sich ihrer Gedanken, die sie in ihrem Herzen verschloss, aber gegen die sie sich nicht wehren konnte.
»Heute wieder kein Brief von deinem Bruder«, sagte Agnes Lohwaldt mit einem Seufzen. Ihr fiel auf, dass man keinen zweiten Sessel herausgestellt hatte, in den sie sich setzen konnte, und so blieb sie vor ihrer Tochter stehen, als ob es sich um eine Audienz handelte. Isolde antwortete nichts. Die zwei schwarzen Tiere lauerten in ihren Höhlen.
»Ihm wird doch nichts zugestoßen sein …«
»Mutter. Ihm ist nichts zugestoßen. Er hat Besseres zu tun, als an zu Hause zu denken.«
»Ein paar beruhigende Worte an die Familie wird er doch schreiben können, abends nach dem Essen. Oder am Morgen, zwischen Frühstück und Abfahrt der Kutsche.«
»Er wird schreiben, sobald er in Rom angekommen ist.«
Es waren nicht nur Isoldes Augen. Es war ihr gesamtes Wesen: Agnes Lohwaldt wurde das Gefühl nicht los, dass ihre Tochter sie verachtete. Wenn Isolde zu ihr sprach, schwang in ihrer Stimme ein Unterton mit, der nicht mit Worten zu benennen und der ihr doch unerträglich war. »Jedenfalls freue ich mich«, sagte sie also, »dass es dir besser geht.«
»Mutter, ich möchte lesen.«
Im selben Moment fühlte sich die Kommerzienrätin unwohl. Ihr Nacken verkrampfte sich, als ob jeden Moment ein Raubvogel seine Krallen hineinschlagen würde. Unwillkürlich blickte sie hinauf zum Himmel, aber da war nur strahlendes Blau. Doch dann erkannte sie, woher ihr Unwohlsein kam: Am Rande des Rasens, am seitlichen Zugang zum Haus, stand Theresa. Sie stand gerade wie ein Stock in ihrem taubengrauen Kleid, das sie immer zu tragen schien, in der Hand hielt sie den Beutel mit Pulvern, Tropfen und Tüchern für Isolde. Und sie blickte sie aus ihren kalten und mitleidlosen Augen an, vor denen sie sich noch mehr fürchtete als vor den Augen ihrer Tochter. Theresa war Isoldes Gesellschaftsdame – wenn auch das Wort Gesellschaft für ihre Anwesenheit abwegig war – und vor allem Isoldes Krankenpflegerin. Sie hatte Isolde schon mehrfach gebeten, Theresa zu entlassen, weil sie der Überzeugung war, dass sie ein böses Wesen sei, aber Isolde bestand darauf, Theresa zu behalten. Sie war der einzige Mensch, den sie Tag und Nacht neben sich duldete. Sie begriff nicht, warum. Denn sie war sicher: Genau so, wie Theresa jetzt dastand und ihren bösen Blick auf ihr ruhen ließ, würde sie eines Tages dastehen, wenn das Haus lichterloh in Flammen stünde und alle darin verbrannten.
»Natürlich … Natürlich, du willst lesen, Kind, entschuldige.« Die Kommerzienrätin wandte sich von ihrer Tochter ab und ging zurück zum Haus.
Isolde sah ihr nach. Sie wollte nicht lesen, das Buch langweilte sie, doch sie ertrug die Nähe der Mutter nicht, an der alles weich war: ihr Äußeres, ihre Stimme, ihr Wesen, ihre Prinzipien, ihre Standpunkte.
Isolde wusste natürlich, warum Cornelius nicht schrieb. Er war heilfroh, endlich von zu Hause wegzukommen, endlich dem Genörgel des Vaters und der lächerlichen Umsorgung der alten Glucke zu entfliehen. Warum sollten seine Gedanken dem verlassenen Zuhause gelten? Warum sollte er sich darum scheren, ob sich die Mutter sorgte oder nicht? Hatten sie nicht beide längst gelernt, ihrer Bemutterung gleichgültig gegenüberzustehen, um nicht von ihr erdrückt zu werden? Cornelius hatte Isolde hier zurückgelassen, obwohl sie es einander anders versprochen hatten. Denn natürlich war nicht er es, der den Absprung geschafft hatte. Sie hatte ihm ermöglicht, nach Rom zu reisen. Sie hatte ihn auf die Idee gebracht, und ihr hatte er das Stipendium zu verdanken. Ohne sie würde er sein Leben lang den leichten Weg gehen, den Weg der täglichen Ausflüchte und Heimlichkeiten, um Mutter und Vater auszuweichen. Alleine wäre er niemals imstande, einen großen Schritt zu tun.
Isolde war fest entschlossen, ihrem Bruder nachzureisen. Professor von Schabeisen hatte ihr eine Kur im Süden in Aussicht gestellt, doch dafür musste sich ihre Krankheit erst einmal glücklich entwickeln. Und das würde sie. Sie würde ihre gesamte Willenskraft auf dieses Ziel ausrichten. Sie vor allem wollte ja weg von der Mutter, weg vom Vater, weg von der Engstirnigkeit der Kleinstadt. Der übliche Weg einer jungen Frau, das zu erreichen, war eine geschickte Heirat. Doch wenn es eines gab, das sie ganz sicher niemals tun würde, dann dies! Die Vorstellung, sich einem Mann zu unterwerfen, war ihr derart zuwider, dass ihr alleine beim Gedanken daran übel wurde. Dieser Mann würde sie berühren! Sie würde schwanger werden! Sie würde gebären! Sie würde Kinder um sich haben! – Niemals! Sie wird zu ihrem Bruder nach Rom fahren, sie wird ihn zwingen dortzubleiben, und unter dem Deckmantel des brüderlichen Schutzes wird sie dort ein Leben führen, wie sie es will.
Isolde wandte sich wieder ihrem Buch zu und las ein paar Zeilen, ohne im Geringsten zu merken, was sie las. Und als sie tief durchatmete, um die schwarzen Gedanken, die in ihr wühlten, aus sich herauszubringen wie ein alter Bergmann den zersetzenden Kohlestaub, überfiel sie ein erneuter Hustenanfall. Während sich ihre schmale Brust unter den scheußlichen Krämpfen wand, einer Ringelnatter gleich, die man in der Mitte durchgeschnitten hat, flogen rote Blutspritzer auf das Buch. Es fiel von ihrem Schoß ins Gras, und sie presste eilig ihr Taschentuch vor den Mund. Im selben Augenblick schon stand Theresa bei ihr, reichte ihr ein frisches Tuch und Wasser und umfasste mit eisernem Griff Isoldes Schultern, um ihr die Krämpfe zu erleichtern.
An die Schmerzen beim Husten hatte Isolde sich längst gewöhnt. Doch was sie maßlos wütend machte, war das Gefühl des Ausgeliefertseins, der Machtlosigkeit, wenn die Krankheit sie in Form des zähen Hustens packte und erst wieder losließ, wann es ihr gefiel. Und die keineswegs so gnädig war, sich zurückzuziehen, wie alle in den letzten Tagen gehofft hatten, sondern in tiefroter Schrift auf ihrem Buch das geschwächte Menschenkind als ihren alleinigen Besitz bezeichnete. Und so war es ihr kranker Körper, den Isolde am allermeisten hasste.
Als Franz in Sirmione von Bord ging, staunte er, wie sich alles von selbst fügte. Das Gepäck wurde ans Ufer gestellt, man verbeugte sich vor ihm, hielt die Hand um ein Trinkgeld auf und verbeugte sich – nachdem er ein paar Münzen gegeben hatte – noch einmal.
Noch auf dem Boot hatte Franz in einer der beiden kleineren Taschen, die der Reisende selber trug und keinem Träger anvertrauen musste, einen Beutel mit bayerischen Gulden und einigen vom Kirchenstaat geprägten Scudi gefunden und eine lederne Börse, zusammengefaltet und mit einem schmalen Band aus demselben Leder zugebunden. Darin, mit dem Siegel des bayerischen Königs versehen, einen Pass. Ausgestellt auf den Namen Cornelius Lohwaldt und mit dem Reiseziel Rom, über Innsbruck, Bozen, Mantua, Modena, Bologna und Florenz. Dazu einige Empfehlungsschreiben, die Franz sich später in Ruhe anschauen wollte.
Er konnte also den Bootsmann bezahlen und einem Beamten in österreichischer Uniform, der auf ihn zutrat, um seinen Pass zu kontrollieren, das Dokument überreichen. Der Mann warf kaum einen Blick darauf, die Kontrolle schien ihm nur eine lästige Formalität, da der fremde Besucher ohnehin nur vom österreichischen Tirol ins ebenso österreichische Lombardo-Venetien wechselte.
Als Franz sich nach der Kutsche in Richtung Mantua erkundigte, wurden die Koffer im Nu auf einen Wagen gewuchtet, der auf dem sonnigen Platz neben einem steinernen Brunnen bereitstand. Franz staunte, wie leicht es sich als wohlhabender Mann lebte! Da bis zur Abfahrt noch Zeit für eine Mahlzeit blieb, führte ihn der Bootsjunge zu einem Gasthof, wo man Franz einen guten Tisch im Schatten wies. Als er den Wunsch äußerte sich umzukleiden, wurden ohne weitere Umstände seine Koffer wieder von der Kutsche heruntergehoben und in ein Fremdenzimmer gebracht.
Franz zwängte sich in einen sauberen Anzug und einen schwarzen Rock Lohwaldts und legte den Altdeutschen Rock, der zwar in der Sonne schnell getrocknet war, aber vom Wasser arg zerbeult aussah, in den Koffer. Seine eigenen Hosen gab er einer Dienstmagd, um Putzlumpen daraus zu machen. Dann ließ er einen Barbier rufen, der ihn rasierte.
Als Franz zu seinem Tisch zurückkam, wartete bereits ein üppiges Essen auf ihn. Brotfladen, Oliven, Eierkuchen, eine Gardaseeforelle, röhrenförmige Nudeln mit Tomaten und geriebenem Käse darüber, verschiedene Käsestücke, die einen intensiven Geruch verströmten, ein geräucherter Schinken und ein Schälchen mit einem körnigen Brei, den der Wirt als risotto bezeichnete.
Von der Stunde in Sirmione war ihm aufgrund seiner Erschöpfung und inneren Aufgewühltheit später nichts mehr erinnerlich als dieses erste Essen seit vielen Tagen und zugleich das erste in seinem neuen Leben. Obwohl er schon oft Hunger gelitten hatte, erinnerte er sich nicht daran, das Glück einer Mahlzeit jemals so tief empfunden zu haben. Als er von dem Fladenbrot ein Stück in den Mund steckte, als seine Zähne die knusprige Kruste zerbrachen, als er den aromatischen, leicht salzigen Geschmack auf der Zunge spürte, begann er haltlos zu weinen.