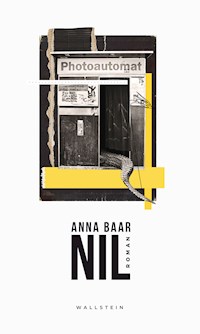Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine große Geschichte von Liebe und Versöhnung, Krieg und Frieden, Ausgrenzung, Vereinnahmung und Entfremdung im Heranwachsen zwischen den Kulturen. Sommer für Sommer findet ein Mädchen sich fernab seiner österreichischen Heimat auf einer dalmatinischen Insel in der Obhut der Großmutter, nur einen Steinwurf vom Meer entfernt unter dem Blätterdach der Mandelbäume im Lärm der Zikaden. Es hat etwas Paradiesisches und ist zugleich doch auch das Andere, Fremde. Hier die archaische Inselwelt eines Fischerdorfs im Mutter- und Großmutterland, wo man Marschall Tito und seinen Partisanen huldigt und den Sieg über die Deutschen feiert, während die abermals über das Land kommen, diesmal willkommen - als zahlende Touristen. Dort das bürgerliche, behütete Leben in einer österreichischen Provinzhauptstadt (Vaterland), in der sich der nationalsozialistische Bodensatz lange hartnäckig hält und Jugoslawen hauptsächlich als Gastarbeiter in Erscheinung treten. In diesem Roman geht es um Identitätsfindung, Entfremdung, um das Heranwachsen zwischen zwei Kulturen und Kindheitsschauplätzen, nämlich der archaischen Inselwelt in Kroatien und der österreichischen Welt. Es geht auch um die geschlechtliche Identität, um die Widersprüchlichkeit der Erwartungen, Anforderungen und Zumutungen und um die Zugehörigkeit zu Muttersprache und Vatersprache und um die Großmuttersprache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Baar
Die Farbe desGranatapfels
Roman
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2015www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus der Stempel GaramondUmschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorfunter Verwendung einer Vorlage von © plainpicture/MillenniumDruck und Verarbeitung: Pustet, RegensburgISBN (Print) 978-3-8353-1765-9ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2874-7ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2875-4
Inhalt
Impressum
[Zwei Jahre nach Hanins Tod ...]
Die Zunge des Basilisken
Das Lieben der anderen
Minderjahre
Atemlauern
Zwei Jahre nach Hanins Tod wurde die Eisenbahntrasse hinter unserem Haus stillgelegt. Als die Züge den Landstrich noch mit ihren flüchtigen Girlanden aus Pfiffen und Rauch behängten, war uns der Damm ein heiliger Ort, ein von Gräsern dichtbewachsenes Zwischenreich auf Leben und Vergehen. Im Sommer glühten die Schienen an manchen Tagen so, dass die Luft darüber aufsprang und in ungestüme Lichtwesen zerfiel, die sich leichtfüßig über dem Stahllauf kräuselten, schneller noch als die Mückenschwärme. An Wintertagen waren die Gleise frostkalt, die Schattenseiten morgens noch mit den Splitterblüten des Raureifs besprengt, dass unsere Ohren, die wir zwischendurch auflegten, um herannahende Züge aufzuspüren, beinahe daran haften blieben. Es gab keinen Zweifel, dass dieser verbotenste aller Orte der geeignetste war, die Orakel und Gespenster, die uns in Wermutnächten aus den Träumen schreckten, zu verhöhnen mit unserem Übermut, der der Übermut der Kleinlauten war, die ihre Schreckbilder wenigstens bis zum Einbruch der Dunkelheit ins Vergessen zu drängen hofften – einmal im verschwörerischen Flüstern, einmal im Narrengeschrei, denn wer hätte die Stille ertragen, die uns daran erinnerte, dass wir in den Klüften unserer Seelen abgesprengt und allein waren und das Versprechen der Unzertrennlichkeit nicht einzulösen vermochten.
Heimlichtuer waren wir, die Stunde um Stunde jede Glückserwartung daran bemaßen, als Erster die Richtung zu erraten, aus der sich ein Zug näherte – und nichts schien mehr von Belang als das Horchen und Lauern. Und Späher waren wir, allzeit bereit, auf die richtige Vorhersage Arsch und Ehre zu verwetten – und wenn auch unsere todernst behauptete, aber immerzu an den nächstbesten Winkelzug verhökerte Ehre nichts galt, galt der Arsch doch allemal.
Manchmal war ich es, der einen Tag lang jenes erhebende Selbstgefühl zuteil wurde, das selbst Angsthasen zu Helden macht, doch das Glück reichte nie hin, den Triumph leichten Herzens auszukosten und den Kopf auch nur ein klein wenig höher zu tragen als an gewöhnlichen Tagen, denn durch die stillen Schauer der Genugtuung flackerte meine Verlegenheit: Die wahren Helden, so viel stand fest, waren Hanin und Ela, denen nur ebenbürtig sein konnte, wer das Verrecken, wie sie es nannten, nicht einmal im Geheimen fürchtete, Hanin und Ela, die sich nicht auf unser kindisches Ratespiel beschränkten, mutig und leichtsinnig, wie sie waren, zwei aus der Zeit gestürzte Engel, die den Makrofonpfiffen der herandonnernden Lokomotiven zu den Schummerstunden ohne Wimpernzucken die Hitzköpfe hinhielten – Hand in Hand auf immer derselben Bahnschwelle –, allen Warnrufen und Leuchtsignalen die Stirn boten und sich erst im letzten Atemholen, unter dem Kreischen notgebremster Stahlgussräder, im Lichtkegel der Diesellok über die Schüttung von Fels- und Trümmergestein in den Graben warfen, wo wir anderen uns mit angststeifen Fingern umfangen hielten, zitternd, die Augen zugekniffen, winselnd oder aus Leibeskräften anbrüllend gegen Panik und Höllenlärm, denn es war nicht auszumachen, ob die zwei Gliederpuppenkörper, die zuerst in die Senke kollerten und dann wie für die Ewigkeit liegen blieben, tot oder lebendig waren.
So vergingen die Jahre. Und immer ging es gut. Bis auf das eine Mal. Und irgendwann, ich schwor es Ela hoch und heilig, würde ich es sein, die es am längsten auf den Gleisen hielte. Vielleicht an jenem Tag im September, an dem wir uns daran erinnern, wie sich Hanin seiner Flügel entsann und durchbrannte – ohne Lebewohl, wie es seine Art war.
Die Zunge des Basilisken
Was reden mit ihr? Ich glaubte Nada schon vor zwanzig Jahren alt, jetzt ist sie es wirklich. Wir sitzen auf der Veranda, rauchen eine Zigarette nach der anderen. Die Asche wird lang, fällt auf das Plastiktischtuch, das schon voller Brandlöcher ist, fällt zu Boden, krümmt sich unter einem Windstoß fort, sammelt sich da und dort in den geschützten Ecken und Winkeln. Manchmal sehe ich Nadas Asche im Ringelspiel des Winds über die Terrasse wirbeln. Überall Asche: im brüchigen Weidenrutengeflecht der verwitterten Korbsessel, in den bodennahen Spinnwebnestern, die Nada längst nicht mehr sieht, in Rachen und Nase dann und wann. Darauf angesprochen, reißt Nada Mund und Augen auf und zieht dabei die Luft so mühevoll in die verschleimten Lungen, dass mich ein schlechtes Gewissen beschleicht. U ime oca i sina i duha svetoga, amen! Sie bekreuzigt sich, wirft die Hände hoch, fährt mit ihren knorrigen Fingern über das glutvernarbte Tischtuch, dass die Asche zerstäubt und zu Boden fällt, und noch während sie über das ausgebleichte Muster streicht und mit ihren rotlackierten Krallen an den Brandschrunden kratzt, als wollte sie auch diese unbemerkt entfernen, behauptet sie, da sei doch nichts, sei auch nichts gewesen: Wo siehst du Asche? Wo? Da ist nichts! Du mit deinem Sauberkeitswahn! Schlimmer als deine Mutter! Und dann, nach einem Kopfschütteln: Gore infišat nego poludit – Spinnen ist schlimmer, als verrückt zu werden.
Es dämmert. Die Bora macht mich frösteln, jagt Blätter, Staub und Asche über die Veranda. Nada sagt, ihr sei nicht kalt, nie. Und nein, sie wolle keine Strickweste und auch kein Glas Wasser und ich solle – verdammtnochmal – aufhören mit meiner Fürsorge, mit meinem lachhaften Gesundheitswahn – neunundachtzig Jahre sei sie, immerhin, obwohl oder gerade weil sie nie einen Gedanken an das Trinken verschwendet habe. Ich habe keinen Durst. Nie! Ich unterdrücke ein Lachen, nach dem mir ohnehin nicht zumute war, dann, den letzten Lungenzug kaum ausgehustet, beginnt sie von vorne: Du bist doch meschugge, dass du immer und überall Asche siehst. Sie wird nicht locker lassen, bis wir schlafen gehen.
Nadas Angewohnheit, das Offensichtliche abzustreiten, klemmt mir jedes Mal den Hals ab. Ich halte still, wie im Sturm geduckt, halte ihr nichts entgegen, um jede Zuspitzung zu vermeiden, presse den Atem in ungeschickten Stößen durch den Kehlspalt und versuche den Zaunkönig zu erdrücken, der wieder darin zu nisten beginnt, dass mir von seinem Scharren ums Haar das Wasser in die Augen tritt. Ich will die Alte auf ihren Rückzugsgefechten nicht um die letzten Siege bringen, denn wie viel schwerer wöge meine Schuld als ihre Vorhaltung, Asche zu sehen, wo keine ist! Lieber ziehe ich aus freien Stücken den Kürzeren, wenn es denn zwischen uns überhaupt so etwas wie freie Stücke gibt.
Der Sturm reißt an, fällt in scharfen Böen über dem Berghang ein, zerrt an den Fensterbalken, an den abgepflückten Wäscheleinen, an Nadas schlampiger Steckfrisur. Im Geäst des alten Mandelbaums ein Trommelwirbel, ein Fauchen im Schilf. So hält er es, wie immer, und fegt die guten Schiffe in den Hafen und zermalmt die schlechten an Molen und Klippen oder wälzt sie in die Schlünde der Wasserwirbel.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!