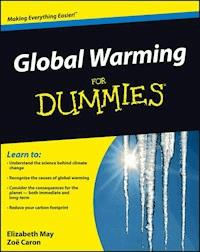11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Feenjägerin
- Sprache: Deutsch
Die Schlacht um Schottland ist verloren, und Aileana Kameron, die letzte Feenjägerin, verschwand durch das magische Portal, das sie eigentlich für immer verschließen wollte. Nun ist sie in den Händen ihres gefährlichsten Feindes und gefangen in der düsteren Feenwelt. Aileana hat schon jede Hoffnung auf Rettung aufgegeben, als sie Hilfe von unerwarteter Seite bekommt und zurück in die Welt der Menschen fliehen kann. Doch dort herrschen inzwischen die Feen. Nur wenn Aileana alles auf eine Karte setzt, kann sie die, die sie liebt, noch retten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ELIZABETH MAY
DIE FEENJÄGERIN
DASVERBOTENE KÖNIGREICH
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Seit Feenjägerin Aileana Kameron durch das magische Portal, das sie eigentlich für immer verschließen wollte, verschwunden ist, ist sie gefangen in einer anderen Welt. Einer Welt voller Spiegel, verwunschener Geheimnisse und rätselhafter Täuschungen – die Welt der Feen. Doch damit nicht genug: Aileanas schlimmster Feind, die uralte und mächtige Fee Lonnrach, hat die Feenjägerin in seiner Gewalt und raubt ihr Stück für Stück ihre Erinnerungen. Gerade als Aileana schon jede Hoffnung auf Rettung aufgegeben hat, bekommt sie Hilfe von unerwarteter Seite und kann zurück nach Hause fliehen, wo sie endlich ihrem mysteriösen Lehrmeister Kiaran wieder begegnet. Doch die Welt, die Aileana einst kannte, gibt es nicht mehr: Edinburgh liegt in Trümmern – und die Feen haben die Herrschaft an sich gerissen. Nur wenn Aileana alles auf eine Karte setzt, kann sie die, die sie liebt retten, doch das könnte sie selbst das Leben kosten …
Die Autorin
Elizabeth May wurde in Kalifornien geboren, wo sie auch ihre ersten Lebensjahre verbrachte, bevor sie nach Schottland zog. Sie studierte Anthropologie an der Universität von St. Andrews. Seit dem Abschluss ihrer Doktorarbeit widmet sie sich hauptberuflich dem Schreiben und stürzt sich mit Begeisterung in fantastische Welten. Die Autorin lebt zusammen mit ihrem Mann in Edinburgh.
@HeyneFantasySF
twitter.com/HeyneFantasySF
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Titel der englischen Originalausgabe
THE VANISHING THRONE
Deutsche Übersetzung von Sonja Rebernik-Heidegger
Deutsche Erstausgabe 12/2016
Redaktion: Martina Vogl
Copyright © 2015 by Elizabeth May
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkterstr. 28, 81673 München
Umschlagillustration: Daniel Castro
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Augsburg
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-18479-7V001
www.heyne.de
Für meine liebe Freundin Tess Sharpe,
die mich gelehrt hat,
in meine dunklen Geschichten einzutauchen
und sie in die Welt hinauszutragen.
1
Ich erinnere mich, dass die Luft um mich herum brannte und nach Asche und Zunder roch. Dass sein Schwert die Haut an meinem Hals durchbohrte und das Blut warm meine Kehle hinab lief. Dass die Schlacht, die um mich herum tobte, plötzlich verstummte und sich verlangsamte, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Es gab bloß noch Lonnrach und mich, die Spitze seines Schwertes entschied über Leben und Tod. Bloß ein kleiner Stoß und …
Dunkelheit.
Meine Lider sind schwer, meine Augen brennen. Kampfszenen blitzen vor mir auf. Jene kostbaren Momente, die ich hatte, um das Rätsel des Siegels der Falknerinnen zu lösen und die Feen wieder in den Untergrund zu verbannen, bevor es zu spät war. Das Lichtschild um mich herum wurde immer schwächer und löste sich unter der Wucht der Feenangriffe langsam auf.
Ein Lachen reißt mich jäh aus meinen Erinnerungen. Dann drängen sich andere Stimmen zwischen die Bilder in meinem Kopf. Wo bin ich? Sie sprechen im selben klingenden Akzent wie Kiaran, es ist ein liebliches Gemurmel in einer Sprache, die ich nicht kenne und auch nicht verstehe.
Mach die Augen auf, befehle ich mir selbst. Mach die Augen auf.
Panik zwingt mich, aufzuwachen. Ich sehe einen winzigen Lichtblitz, bevor ich erneut niedergedrückt werde. Eine Hand schließt sich um meine Kehle, und ein sengender Schmerz bohrt sich in meine Schläfe.
»Ich habe dir nicht erlaubt, dich zu bewegen.« Ein Zischen, hervorgepresst durch Reihen spitzer Zähne an meinem Hals.
Ich sacke zusammen. Ich kann mich nicht bewegen, selbst als jemand mit so scharfkantigen Nägeln über meinen Arm kratzt, dass ich zu bluten beginne. Ein Lachen, tief und gurrend. Ein Flüstern in meinem Ohr, heißer Atem an meinem Hals.
Du hast verloren. Und jetzt gehörst du mir.
Dann träume ich erneut – Erinnerungen an mein vergangenes Leben, an die vielen Male, als ich fast gestorben wäre. Eine Abfolge beinahe tödlicher Erlebnisse, jedes durch das vorherige bedingt. Das erste Mal, als Kiaran mich vor dem Wasserdrachen und damit mein Leben rettete. Und die vielen Male danach – Hunderte namenlose Feen, die ich abgeschlachtet habe und von denen jede ein Abzeichen auf meinem Körper hinterließ. Die erste, die mir eine Narbe verpasste. Die erste, die ich mit Kiaran gemeinsam getötet habe. Und wie er mich danach mit so etwas Ähnlichem wie Stolz angesehen hatte.
Wir werden sie alle töten, hatte er zu mir gesagt, und ein Lächeln war wie ein Geist über sein Gesicht gehuscht.
Die Erinnerungen lösen sich in Rauch auf. Plötzlich befinde ich mich wieder auf dem Schlachtfeld. Meine Rüstung ist so schwer, dass jede Bewegung einer Todesqual gleichkommt. Kiaran liegt regungslos neben mir, durch die Brandwunde auf seiner Wange scheinen Knochen hindurch. Ist er tot?
Nein, er ist nicht tot. Er kann nicht tot sein. Ich schreie ihn an, hämmere mit meinen Fäusten auf ihn ein. Wach auf. Wach auf! Wach …
Ich reiße die Augen auf und schließe sie genauso schnell wieder, so hell ist das Licht. Ich atme tief ein und zucke unter dem pochenden Schmerz zusammen, der sich in meinen Kopf bohrt. Ich presse mir die Hand auf die Schläfe.
Feucht.
Ich ziehe die Hand zurück und blinzle, bis mein Blick klar wird. Meine Finger sind voller Blut, eine klebrige Erinnerung an meine Verletzungen.
Ich habe dir nicht erlaubt, dich zu bewegen.
Meine Rüstung ist fort. Ich sehe an mir hinab. Meine Brust ist mit eingetrocknetem Blut befleckt, und drei ausgeprägte Kratzer verlaufen über meinen Oberarm. Die Haut ist jedoch nur ein wenig angeritzt, als wäre es bloß eine Drohung gewesen. Eine Warnung.
Du hast verloren. Und jetzt gehörst du mir.
Grauen steigt in mir hoch, doch ich schüttle den Kopf, um es zu vertreiben. Konzentrier dich. Orientier dich. Ich höre Kiarans Stimme in meinen Gedanken. Das war eine seiner wirklich wichtigen Lektionen. Allein der Gedanke an ihn lässt mich beinahe erstarren – Wo ist er? Ist er tot? Sind alle, die ich liebe, tot? –, doch sein nützlicher Rat hält mich erneut davon ab. Bewerte deine Umgebung.
Ich schiebe meine Emotionen beiseite, unterdrücke die heiße, aufkeimende Panik und ersetze sie durch kalte Vernunft. Ich trage ein dünnes, figurbetontes, edles Kleid wie Sorcha. Ich streiche mit der Hand über den seidenen Stoff, der jedoch keiner Seide ähnelt, die ich kenne. Das hier ist glatter, glänzender und wärmer. Als hätte jemand schwarze Rabenfedern und Blumen zu einem Stoff verwoben. Die Ärmel fallen lose über meine Handgelenke, und der Stoff rutscht zurück, wenn ich die Arme hebe. Meine Füße stecken in zarten Schühchen aus dunklen Orchideenblättern, die mit Metallperlen vernäht sind.
Nach einem schnellen Blick auf meine Wunden wende ich mich meiner Umgebung zu. O Gott. Angst steigt durch die unbeteiligte, analytische Ruhe hoch, die ich mir gerade erkämpft habe. Das kann doch nicht real sein? Oder doch?
Ich befinde mich auf einer Platte aus schwarzem Stein, der wie ein Obsidian schimmert. Sie ist abgesplittert und schwebt über einem Tal voller dunkler Klippen, einer Schlucht, die sich bis über mein Blickfeld hinaus ausdehnt. Es sieht aus, als wäre das Land in zwei Hälften auseinandergebrochen, und vereinzelte Platten, wie jene, auf der ich mich befinde, treiben durch den leeren Raum in der Mitte wie Blätter auf einem Fluss.
Auf den anderen schwebenden Platten befinden sich Gebäude – eines davon ist ein Palast, der sich auf einem felsigen Bruchstück erhebt. Die Bruchstellen des Felsens unter ihm sind so scharfkantig wie Messerklingen. Der Palast selbst ist prächtig und schöner als alles, was ich bisher gesehen habe. Er sieht aus, als bestünde er aus reinem, glänzendem Metall – doch sein Schimmern verrät, dass er aus einer anderen Welt stammt. Selbst aus der Ferne glitzert und glänzt er in zahllosen Schattierungen wie ein Opal. An den Seiten des Palastes ragen Türme wie Scherben empor. Sie umgeben eine Kuppel aus schimmerndem roten, blauen und gelben Metall, die einem eingeschlossenen Firmament gleicht.
Unter dem hoch aufragenden Palast schweben andere Gebäude auf ihren eigenen Platten in der unermesslichen Leere zwischen den gewaltigen Klippen. Manche haben ebenfalls kuppelförmige Dächer aus Metall, andere aus glänzendem Stein, der wie reinster Saphir schimmert.
Im Gegensatz dazu sind die Klippen zu beiden Seiten vollkommen eintönig und kein einziger Farbtupfer stört ihre Gleichmäßigkeit. Selbst die Bäume scheinen aus Glas zu bestehen, und die dünnen, spitzen Äste wirken scharf genug, um jemanden zu töten. Unter den Bäumen am Rand der Klippen glimmen Blumen, ihre zarten Knospen bestehen aus glitzerndem Eis.
Ich atme ein, und der eisige Duft des Winters dringt schmerzhaft in meine Brust. Es riecht wie am Strand, nachdem Schnee gefallen ist. Der Wind bringt den Geruch nach Salz, Erde, Eis und einer Spur Myrrhe mit sich.
Ich träume. Das hier muss ein Traum sein. Ich presse meine Hand auf den kalten Stein unter mir und gleite mit den Fingern über die glänzende Oberfläche. Am äußeren Rand der Platte bohren sich kleine Scherben in meine Haut und hinterlassen rote, schmerzende Kratzer.
Das hier ist kein Traum. Kein Traum. Ich atme panisch aus. Ich ziehe ruckartig die Hand zurück, stemme mich hoch und bleibe vor dem Rand der Platte stehen.
Ich mache den Fehler, über die Kante zu blicken.
Mein Magen krampft sich zusammen. Unter mir ist bloß Dunkelheit. Ein Steilabbruch, der im Nichts verschwindet. Kein Licht durchdringt die Leere, und es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte, sollte ich fliehen müssen. Keine anderen Platten in unmittelbarer Nähe, keine Felsen, auf die ich springen könnte, und auch die schwebenden Gebäude sind zu weit entfernt.
Das hier ist ein Gefängnis, und die einzige Möglichkeit zur Flucht wäre ein Sprung in den Tod. Wo zur Hölle bin ich, verdammt noch mal?
»Gut. Du bist wach.«
Ich wirble herum und sehe Lonnrach, der auf einer weiteren Platte steht, die etwas kleiner als meine eigene ist. Ich war so abgelenkt, dass ich den Geschmack seiner Kraft nicht bemerkt habe, der sich jetzt über meine Zunge legt und süß nach Blütenblättern, Natur und Honig schmeckt. Seine glänzende Feenrüstung ist verschwunden. Stattdessen ist er wie ein Mensch gekleidet und trägt eine rauchgraue Hose und ein weißes Batist-Hemd. Er hat sich die salzweißen Haare aus dem Gesicht gekämmt und im Nacken zusammengefasst.
Er betrachtet meine Kopfverletzung. »Ich hoffe, es bleibt kein dauerhafter Schaden zurück.«
Warum?, hätte ich beinahe gefragt, doch die bloße Tatsache, dass er noch lebt, lässt Wut in mir hochsteigen. Mein Blick wandert zu der Wunde auf seiner Wange, die ich ihm mit meinem Schwert zugefügt habe. Ich hatte die Chance, ihn zu töten, und habe sie nicht genutzt. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal begehen.
»Wo sind wir?«, frage ich. Meine Stimme klingt rau, meine Kehle ist wund. Ruhig. Bleib ruhig.
»Im Sìth-bhrùth, im ehemaligen Königreich der Dunkelfeen.« Sein Blick wandert über die Klippen rechts und links von uns, und sein Gesichtsausdruck verhärtet sich. »Das ist alles, was davon übrig blieb.«
Hätten wir uns in einem Ballsaal befunden, und hätte ich nicht gewusst, dass er kein Mensch ist, hätte ich ihn wohl als schmerzhaft schön bezeichnet. Magnetisch. Doch das ist alles Teil seiner körperlichen Anziehungskraft, seiner Macht, seine menschlichen Opfer mühelos anzulocken – einer Fähigkeit, die alle Daoine Sìth besitzen. Auf dem Schlachtfeld wäre ich dieser Kraft beinahe erlegen, doch mittlerweile ist er bloß noch ein Bastard, der mich verletzt hat, mich bluten ließ, mich gefangen nahm, und …
»Wenn du meinem Zuhause irgendetwas angetan hast«, meine Stimme klingt tief und gefährlich, »dann töte ich dich.«
Ich töte dich ohnehin. Ich lasse mir bloß länger Zeit.
Lonnrach neigt seinen Kopf leicht zur Seite. Sein Mund verzieht sich zu einem trägen, amüsierten Lächeln, als wären wir tatsächlich auf einem Ball und er würde mit mir flirten. Es raubt mir den letzten Nerv. Auf seine arrogante Art scheint er anzudeuten, dass er etwas weiß, was ich nicht weiß, und was immer es ist, ich spüre, dass meine mühsam erlangte Selbstbeherrschung fast verloren geht.
»Tatsächlich?«, fragt er.
Ich beiße mir auf die Zunge, um ihn nicht nach Kiaran und all den anderen zu fragen, die ich liebe. Er darf nicht wissen, dass ich Angst davor habe, dass sie alle tot sind. Ich muss so tun, als würde ich nichts empfinden.
Also streiche ich stattdessen mit den Fingern über meine Seilgflùr-Kette, die zu einem einzelnen Strang verflochten ist. Die weiche Distel ist für Feen wie ihn tödlich und effektiv genug, um sich in sein Fleisch zu brennen. »Ich könnte die hier um deinen Hals schlingen, wenn ich wollte. Es wäre kein schneller Tod. Ich habe es selbst gesehen.«
Lonnrach steckt die Hände in seine Hosentaschen, und hätte es auf seiner Platte etwas zum Anlehnen gegeben, hätte er sich ohne Zweifel dagegen gelehnt. Kalt, lässig und offensichtlich nicht im Geringsten beunruhigt.
Vielleicht ist er aber auch ein guter Lügner. Genau wie ich.
»Du bist nicht in der Position, mir zu drohen«, sagt er leichthin und wirft einen Blick hinunter in den tiefsten und dunkelsten Teil der Schlucht.
Ich versuche, nicht ebenfalls hinunterzusehen. Es gelingt mir nicht. Selbst wenn ich es schaffe, ihn zu töten, sitze ich in der Falle. Und ihn über den Abgrund zu stoßen ist auch keine Option – dank seines verdammten, unverwundbaren Feenkörpers würde er den Sturz vermutlich überleben.
Ich bringe meinen Gesichtsausdruck wieder unter Kontrolle und wirke kalt und unbeteiligt. Es erfordert sämtliche Fähigkeiten der Täuschung, die ich erlernt habe, seit ich herausgefunden habe, dass es Feen wirklich gibt und eine von ihnen meine Mutter ermordet hat. Wenn man einer Fee gegenübersteht, ist alles ein Spiel. Selbst die Trauer. Wenn er die Chance erhält, wird Lonnrach sie gegen mich verwenden und mich damit quälen. Ich muss dieses Spiel mitspielen.
Ein Atemzug und dann noch einer, um mich wieder zu beruhigen. »Woher weiß ich, dass das alles nicht bloß ein Trick ist?« Meine Stimme klingt beinahe neckisch, aber auch anklagend. Sie ist vollkommen ruhig. Ich bin eine meisterhafte Lügnerin. Immerhin habe ich beim Besten gelernt. »Dieser Ort?«
Lonnrachs Gesichtsausdruck verändert sich nicht. »Das ist er nicht.«
Ich denke an sein schnelles, flüchtiges Lächeln und daran, dass alle, die mir etwas bedeuten, womöglich tot sind. Wenn dem so ist, kann ich ruhig leichtsinnig sein, denn ich habe nichts mehr zu verlieren.
Lonnrach hingegen schon. Es gibt etwas, was er braucht: mich. Wenn es nicht so wäre, wäre ich längst tot.
Es wird Zeit, diese Theorie zu überprüfen. Ich trete an den Rand der Platte, der ihm am nächsten liegt. »Wenn ich also so mache …« Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und balanciere nahe dem Abgrund auf einem Bein, »… und falle, dann sterbe …«
Ehe ich michs versehe, springt Lonnrach von seiner Platte. Sein Körper prallt gegen meinen, und er wirft mich mit solcher Wucht um, dass ich schon befürchte, wir schlittern beide über den Rand und er bringt mich tatsächlich um.
Doch das tun wir nicht. Er packt schmerzhaft meinen Oberarm und zieht mich daran hoch. Seine silberfarbenen Augen glänzen vor Wut. Dieser Gefühlsausbruch überrascht mich. Feen scheinen sich stets unter Kontrolle zu haben und ihre Gefühle perfekt zu verbergen.
»Du bist ein dummes Mädchen«, sagt er.
Jetzt weiß ich es also. Lonnrach hat die wichtigste Regel in unserem kleinen Spiel vergessen: Lass deinen Feind niemals wissen, wie dringend du etwas brauchst. Er braucht mich lebendig, nicht bloß als Gefangene. Deshalb hatte er Angst, dass meine Kopfverletzung dauerhafte Schäden nach sich zieht.
Trotzdem kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Ich kann es einfach nicht. Ich merke, dass mir die Frage, die ich ihm wirklich stellen will – nämlich, ob er alle getötet hat, die ich liebe – im Hals stecken bleibt. Also stelle ich ihm eine andere: »Wo ist Kiaran?«
Mir entgeht nicht, dass er einen Moment lang meinem Blick ausweicht, als würde er versuchen, seinen Gesichtsausdruck noch schnell unter Kontrolle zu bringen. »Seine Schwester hat meine Leute getötet, um ihn zu retten.« Sein grausames Grinsen zerreißt mir das Herz. »Offensichtlich waren sie nicht der Meinung, dass du es ebenfalls wert bist, gerettet zu werden.«
Plötzlich sehe ich erneut Kiaran auf dem Schlachtfeld vor mir. Seinen regungslosen Körper, sein verbranntes Gesicht. Wach auf. Wach auf! Ich konnte ihn nicht dazu bringen, sich zu bewegen. Nicht einmal seine Wimpern zuckten.
Lonnrach behauptet zwar, dass Kiaran am Leben ist, aber wenn das stimmt, dann hätte er mich niemals im Stich gelassen. Das kann nicht sein.
»Du hast Gefühle für ihn.« Lonnrach packt mein Kinn und zwingt mich, ihn anzusehen. »Er hat dich glauben lassen, dass du ihm etwas bedeutest.« Er wirkt beinahe, als würde ich ihm leidtun, aber ich weiß, dass es bloß ein Trick ist. »Kadamach schert sich einen Dreck um irgendjemanden und am allerwenigsten um dich.«
Tu so, als würden seine Worte nichts bedeuten. Ich versuche es, doch dann höre ich Kiaran in jener Nacht flüstern: Habe ich dir je gesagt, wie der Schwur lautet, den eine Fee leistet, wenn sie sich einer anderen verspricht? Ein federleichter Kuss und dann die beiden Worte an meinen Lippen, sodass ich sie bis in meine Seele hinein spürte.
Aoram dhuit.
Ich werde dir huldigen.
Lonnrachs grausame Worte reißen mich aus meiner Erinnerung. »Du bist nicht das erste menschliche Spielzeug, dessen er sich entledigt.«
Bevor ich mich noch zurückhalten kann, entwinde ich mich Lonnrachs Griff und versenke meine Faust in seinem Gesicht. Er taumelt zurück. Ich ramme mein Knie in seinen Bauch und schlage erneut zu. Und noch einmal. Ich trete einen Schritt zurück, um mich auf ihn zu stürzen, doch er packt mein Handgelenk und dreht mir meinen Arm in einem schmerzhaften Winkel auf den Rücken. Er steht nun hinter mir, und sein Atem kitzelt meinen Nacken.
»Du brauchst mich lebendig.« Ich schlucke, damit er nicht hört, welche Schmerzen er mir bereitet. Ich winde mich in seiner Umklammerung, um mich zu befreien, doch er lockert seinen Griff nicht. Jedes Mal, wenn ich mich bewege, werden die Schmerzen unerträglich. »Warum?« Als er nicht antwortet, bohre ich weiter. »Warum?«
»Du kannst einen Gegenstand entsperren, den ich suche. Das ist deine einzige Bestimmung.« Ich weiß, was das auch bedeutet: Und wenn ich bekommen habe, was ich will, werde ich dich töten.
Ich reiße den Kopf zurück und ramme ihn in seine Nase. Ich muss grinsen, als ich das befriedigende Krachen seiner Knorpel und seinen überraschten Feenfluch höre. Ich versuche, mich zu ihm umzudrehen, doch er ist zu schnell. Er fixiert mich, und seine Finger graben sich in mein Handgelenk, mit dem ich normalerweise mein Schwert führe. Eine unbedachte Bewegung und er würde es brechen. Es heilt vielleicht schneller als bei einem normalen Menschen, aber ich möchte lieber nicht ausprobieren, wie lange es dauert, bis meine Knochen wieder zusammenwachsen.
Wie zur unterschwelligen Warnung wird sein Griff fester. Ich beiße die Zähne zusammen, so weh tut es. »Sobald ich weiß, wonach du suchst, werde ich es eher zerstören, als es dir zu überlassen.«
Ich spüre, wie er zittert. Es scheint, als wäre er wütend. »Du verstehst es einfach nicht, oder? Du glaubst, hier geht es bloß um den Krieg. Deine Leute gegen meine.«
Das überrascht mich jetzt. »Tut es das etwa nicht?«
»Sieh dich um, Falknerin.« Er deutet mir der freien Hand auf unsere Umgebung. »Glaubst du, hier hat es immer schon so ausgesehen? Im Sìth-bhrùth gab es einst Tausende verschiedene Farben. Mehr als deine menschlichen Augen jemals erfasst haben. Das Land war ganz, und jetzt ist es einfach in der Mitte zerbrochen. Es fällt alles auseinander.«
Er zieht mich näher an sich, und sein Griff um mein Handgelenk wird etwas lockerer. »Ich habe dich hierhergebracht, um dir diese Schlucht zu zeigen. Sie soll dich daran erinnern, dass alles hier eines gar nicht mehr so weit entfernten Tages zu Staub zerfallen wird. Die Königreiche gehen unter, und der Thron verschwindet. Es hat bereits begonnen.«
Ich kann nicht anders, ich muss hinüber zu den Klippen rechts und links von uns schauen, auf die schwarz-weiße Landschaft, die nur noch aus Schattierungen zu bestehen scheint. Auf die Gebäude, die über dem Abgrund schweben und die letzten Überreste dessen sind, was Lonnrach gerade beschrieben hat. »Ich verstehe nicht, was das mit mir zu tun hat.«
»Das, was ich suche, kann das Sìth-bhrùth retten. Und du bist der Schlüssel, um es zu finden.«
Ich sage nichts. Das Sìth-bhrùth kümmert mich nicht im Geringsten, aber Kiaran bedeutet es vielleicht etwas. Allerdings hat er nicht sehr oft über das Feenreich gesprochen. Er meinte einmal, dass es wunderschön und grauenhaft wäre und er es zugleich liebte und hasste. Ich frage mich, ob er es denn retten würde.
Ich selbst muss jedoch noch eine Sache wissen. Ich stelle die Frage, der ich bis jetzt ausgewichen bin: »Warum sollte ich statt meiner Welt deine retten?«
Lonnrachs Schweigen ist ohrenbetäubend laut, gewaltig, ewig während. Er hätte keinen Grund, so zu reagieren, es sei denn … es sei denn …
Es gibt keine Welt mehr, die ich retten könnte.
Ich schlucke den Kloß in meinem Hals hinunter. »Zeig es mir.« Als er zögert, fauche ich: »Sofort.«
Lonnrach lässt mein Handgelenk los. Bevor ich noch die Gelegenheit bekomme, mich zu bewegen, packt er mich an den Haaren und seine Finger graben sich in die Wunde an meiner Schläfe.
Ich blinzle … und finde mich in der Hölle wieder.
Es ist zu viel, um alles auf einmal zu begreifen. Ich kann den Blick kaum scharf stellen. Asche regnet vom Himmel und schwebt wie Schnee zur Erde. Überall um mich herum sehe ich zerstörte Gebäude, als hätte sie eine ungeheuerliche Kraft einfach weggefegt. Die Straßen aus Kopfsteinpflaster sind aufgebrochen und unter der dicken Ascheschicht beinahe nicht zu erkennen. Ich kann kaum weiter als bis zu den Häusern direkt vor mir sehen, so dicht ist der Rauch. Ich atme den Geruch nach verbranntem Holz, Metall und Stein ein, und meine Lungen krampfen sich zusammen.
Der herumwirbelnde Staub und Ruß legt sich gerade genug, um zu erkennen, wo ich bin. In der Princes Street. Oder dem, was davon übrig ist. Kaum eines der Geschäfte, die die Straße zu einer Seite gesäumt hatten, existiert noch. Das Scott-Monument – dieses wunderschöne, spitze, elfenbeinfarbene Denkmal, das erst einige Monate vor der Schlacht fertiggestellt worden war – liegt umgestürzt am Boden. Die Statue Scotts ist zu Staub zerfallen.
Das war mein Werk. Es ist meine Schuld. Sie sind alle tot, und es ist meine Schuld. »Aufhören.« Das Wort ist bloß ein ersticktes, kaum hörbares Seufzen. »Ich sagte: Aufhören!«
Plötzlich befinde ich mich wieder im Feenreich. Ich knie auf dem scharfkantigen Obsidian. Heiße Tränen verschleiern meinen Blick, und ich atme stoßweise.
Wie konnte das alles innerhalb so kurzer Zeit geschehen? Ich presse meinen Finger auf die Wunde über meinem Ohr. Sie ist noch immer feucht. Ich taste verzweifelt nach dem kleinen Schnitt, den Lonnrachs Schwert auf dem Schlachtfeld auf meinem Hals hinterlassen hat. Er ist entzündet und brennt noch immer. Der Heilungsprozess hat noch nicht begonnen.
»Das ist ein Trick«, sage ich. Das muss es einfach sein. Sie können doch nicht in derart kurzer Zeit eine solche Zerstörung angerichtet haben. »Meine Wunden sind noch frisch.«
Lonnrach bewegt sich nicht und kniet sich auch nicht neben mich. »Du bist im Sìth-bhrùth«, antwortet er schlicht.
Ich schließe meine Augen. O Gott. Ich habe die einfachste aller Regeln vergessen: In der menschlichen Welt vergeht die Zeit wesentlich schneller. Selbst wenn ich nur ein paar Stunden im Feenreich verbringe, vergehen dort womöglich Wochen. Tage können zu Monaten werden.
»Wie lange bin ich schon hier?«, flüstere ich und hasse es, wie erschrocken meine Stimme dabei klingt. Ich hasse es, dass ich ihm gerade ein kleines Anzeichen von Schwäche gezeigt habe. »In meiner Welt? Wie lange?«
»Ich verstehe euer menschliches Konzept der Zeit nicht.« Er klingt vollkommen lässig, gleichgültig. »Tage. Wochen. Monate. Jahre. Das alles bedeutet mir wenig. Mir geht es bloß darum, diesen Gegenstand zu finden, der in deiner Welt versteckt ist. Und du wirst mir dabei helfen, ob du willst oder nicht.«
Ich bekomme die Bilder nicht aus dem Kopf. Ich habe das alles verursacht. Ich war daran beteiligt. Was haben wohl Derrick und Gavin am Ende von mir gedacht? Und Catherine? Sie müssen geglaubt haben, dass ich entweder tot bin oder sie im Stich gelassen habe. Dass ich aufgehört habe zu kämpfen.
Als ich zu Lonnrach emporblicke, laufen neue Tränen über meine Wangen. Ich sehe ihm in die Augen. »Dann hast du also auf deiner Suche nach diesem Gegenstand einfach alles zerstört. Du hast meine Welt geopfert, um deine zu retten.«
Auf Lonnrachs Gesicht ist keine Regung zu erkennen. »Das klingt so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Du hättest uns doch auch alle abgeschlachtet, um sie zu retten. Deine Menschen.« Mittlerweile kniet er neben mir. Sein Gesicht ist ganz nah an meinem. »Du würdest töten, um deinesgleichen zu beschützen. Das würden wir beide. Wir sind ein und dasselbe, du und ich.«
Kiarans Flüstern steigt aus den Tiefen meiner Erinnerung empor. Ich habe dafür gesorgt, dass du so wirst wie ich.
Eine Kreatur der Nacht. Ein Teufel. Ein Ungeheuer, das Tod und Zerstörung mit sich bringt. Wir sind ein und dasselbe, du und ich.
Dann soll es so sein. Ich sehe ihm in die Augen, und einen Moment lang wirkt er verletzlich. Er hat Angst. Das sollte er auch. »Ich hoffe, dein Königreich verrottet. Ich werde es selbst niederbrennen.«
Lonnrachs Gesichtsausdruck verhärtet sich, er wirkt wütend. »Noch mehr Drohungen. Ich könnte dich einfach so lange ich möchte hier lassen. Vielleicht sperre ich dich auch in eine wasserdichte Kiste und werfe dich ins Meer unter uns, bis ich dich brauche. Draußen könnten Tausende Jahre vergehen, und du wärst immer noch so jung wie in dem Augenblick, als ich dich gefangen nahm. Du bist auf meine Gnade angewiesen.«
Das Meer unter uns. Das befindet sich also dort unten am Fuß der Klippen. Darum klingt es, als würde es atmen. Es sind die Wellen, die gegen die Felsen branden, die Steine, die an ihnen reiben.
Bevor ich antworten kann, steht er bereits wieder auf seiner eigenen Platte. Es war ein Sprung von etwa sieben Metern, den ich ihm unmöglich nachmachen kann. Bevor er verschwindet, dreht er sich noch einmal zu mir um. »Du hast keine andere Wahl, Falknerin. Wenn dieser Ort in Flammen aufgeht, dann stirbst du mit uns.«
2
Ich denke mir tausend verschiedene Fluchtmöglichkeiten aus. Ich versuche mein Körpergewicht einzusetzen, um die Platte näher an die Klippen zu schieben. Ich springe hoch, und meine Beine prallen so hart auf den Stein, dass ein regelrechter Stoß durch meinen Körper fährt, doch die Platte rührt sich nicht.
Sie schwebt bloß weiterhin gleichmäßig durch die Luft, als würde sie auf einem Fluss dahintreiben und nicht durch einen leeren Raum. Der Palast und die anderen Gebäude sind noch immer gleich weit entfernt wie zuvor – sie kommen weder näher noch entfernen sie sich weiter.
Minuten oder auch Stunden vergehen, ich kann es nicht beurteilen. Jetzt weiß ich, warum Zeit für Lonnrach keine Bedeutung hat. Sie existiert hier einfach nicht. Das Licht bleibt immer gleich: Der Himmel ist grau und nebelverhangen, wie ich es auch von zu Hause gewöhnt bin. Die schweren Regenwolken bewegen sich nicht, selbst als die Platte weiter den leeren Raum hinabtreibt und sich die Landschaft um mich herum verändert.
Ich bekomme keine andere Fee zu Gesicht. Nicht einmal den Schatten einer Gestalt in den majestätischen Gebäuden, die in der Schlucht treiben. Dieser Ort ist wie eine Ödnis, vollkommen leer. Wenn ich jetzt schreie, würde mich niemand hören.
Vermutlich hat Lonnrach genau das vor: Er will mich isolieren, meinen Widerstand brechen, mich benutzen und schließlich töten.
Während meine Platte sich beständig vorwärts bewegt, suche ich nach einer weiteren Fluchtmöglichkeit. Nach irgendetwas. Doch die Schlucht ist ein ruheloses, sich ständig veränderndes, unendliches Etwas. Ich komme an Bergen und Wäldern vorbei, alle im selben eintönigen, melancholischen Grau. Ich sehe Felder voller Glasblumen und Wälder mit schwarzen Bäumen aus Metall, die so dunkel und dicht sind, dass kein Licht durch sie hindurchfällt.
Die Landschaft wirkt wie eine Kohlezeichnung. Die Klippen zu beiden Seiten gleichen dunklen, groben Strichen, die Felsen ragen skizziert in die Luft.
Das Land war ganz, und jetzt ist es einfach in der Mitte zerbrochen. Es fällt alles auseinander.
Mit der Zeit merke ich, dass immer wieder Steine aus den zerklüfteten Klippen brechen und in die Schlucht unter mir stürzen. Dieser Ort zerfällt Stück für Stück zu Staub.
Wie Edinburgh. All die Gebäude, von denen nur noch Trümmer auf den Straßen übrig sind. Fort. Genau wie …
Ich schließe fest die Augen, lasse mich auf den kalten Stein sinken und ziehe die Knie zur Brust. Ich versuche, die Bilder zu verdrängen. Meine Erinnerungen. Meine Gefühle.
Tief unter meiner Platte höre ich das Meer atmen. Ich lausche, wie das Wasser ruhig einatmet, ausatmet, einatmet, ausatmet und stelle mir vor, ich wäre wieder dort. In Schottland. In der menschlichen Welt. Ich tue so, als gäbe es noch einen Ort, der es wert ist, gerettet zu werden. Als wären die, die ich liebe, noch am Leben.
Ich tue so, als wäre ich nicht die Einzige, die noch übrig ist.
Als ich aufwache, ist das entfernte Atmen des Meeres verschwunden, und um mich herum ist es so still wie in einem Grab. Der kalte Winterwind hat sich gelegt.
Ich öffne die Augen und sehe, dass ich mich nicht mehr länger draußen in der Schlucht befinde. Ich liege nicht mehr länger auf der rauen Steinplatte, wo sich ein Teil von mir gewünscht hat, ich würde einfach in den Abgrund fallen. Die einzige Erinnerung an diesen Ort sind die roten, pockennarbigen Abdrücke auf meinen Armen, wo sich der Obsidian in meine Haut gebohrt hat, und die bald verschwinden werden. Eine Erinnerung mit Ablaufdatum.
Ich rolle mich auf den Rücken und zucke zusammen, als mir plötzlich ein Gedanke kommt. Er schießt hervor wie die Zunge einer Schlange. Es ist egal, wo du bist. Du bist vollkommen alleine, weil du alle anderen hast sterben lassen. Du hast sie nicht gerettet. Du …
Meine Fingernägel graben sich in meine Handflächen. Der Schmerz bringt mich wieder auf klare Gedanken. Ich habe mir diese Methode angeeignet, um die Schuldgefühle nach dem Tod meiner Mutter zum Schweigen zu bringen. Bloß ein Kneifen, sodass ich beinahe zu bluten beginne, und das immerwährende Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld wird zurück in meine Brust verbannt, wo ich es immer mit mir trage wie eine schmerzhafte, innere Narbe. So ist es zumindest eine Weile erträglich.
Nachdem die Gedanken verschwunden sind, öffne ich meine Augen, um mich umzusehen. Wo bin ich?
Über mir ragt eine Kuppel aus Spiegeln auf, die alle auf die Mitte des Raumes ausgerichtet sind, wo ich liege. Der Boden unter mir ist mit leuchtend grünen Blättern bedeckt. Es sind echte Blätter, die aussehen, als wären sie direkt aus dem Boden gewachsen und dann plattgedrückt worden. Es ist die erste Farbe, die ich im Feenreich zu Gesicht bekomme. Das Einzige, das nicht aus Glas, schwarzem Stein oder Metall besteht. Sie bedecken den gesamten Boden und wachsen die Wände zwischen den Spiegeln empor.
Ich liege mitten in den Blättern. Meine Haare sind gebürstet, und die kupferfarbenen Naturlocken breiten sich um mich herum aus und heben sich stechend von dem Grün ab. Selbst in den Spiegeln an der Decke kann ich noch die Sommersprossen auf meinen Wangen und auf meinen Schultern erkennen, wo das schwarze Kleid den Blick auf meine Haut freigibt.
Es ist kein Blut mehr zu sehen. Fortgewischt, als hätten meine Verletzungen nie existiert. Ich presse eine Hand auf meine Schläfe und meinen Hals. Beide Wunden sind verheilt, an der Stelle, wo das Schwert mein Fleisch durchbohrt hat, ist bloß eine strichförmige Narbe zurückgeblieben.
Ich erschaudere bei dem Gedanken daran, dass sie mich angefasst, geheilt und sauber gemacht haben, während ich schlief. Ich weiß, dass sie es nicht aus Nächstenliebe getan haben.
Du kannst einen Gegenstand entsperren, den ich suche. Das ist deine einzige Bestimmung.
Ich muss hier raus. Ich habe vielleicht kein Zuhause mehr, wohin ich zurückkehren kann, doch Kiaran ist noch immer irgendwo dort draußen. Und vielleicht haben Gavin und Derrick in meinem Ornithopter überlebt.
Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht sind sie aber auch tot.
Ich schiebe meine Gedanken zur Seite und stemme mich hoch. Ich befinde mich nicht in einem einfachen Raum, wie ich zunächst angenommen habe, sondern in einem Saal, so groß wie ein Ballsaal. Die Wände und auch die Decke sind mit Spiegeln verkleidet. Ich drehe mich um meine eigene Achse und suche nach einer Tür – irgendeiner Fluchtmöglichkeit –, doch es starrt mir von überallher bloß mein Spiegelbild entgegen.
Kein Abbild gleicht dem anderen. Einmal blicke ich hintergründig und spöttisch. Einmal leiderfüllt. Ein weiteres Mal ist meine Haut blutbefleckt, und meine Augen sind so schwarz und grausam wie die eines Teufels. Diese Aileana jagt mir am meisten Angst ein. Ihr Blick ist schwer und dringt so scharf wie eine Schwertspitze in meinen Körper.
Als würde sie mein Herz herausschneiden und es auch noch genießen.
Ich mache einen Schritt zurück, doch der Spiegel scheint bloß noch näher zu rücken. Die grausame Aileana hält meinen Blick fest. Gänsehaut überzieht meine Arme, die Stiche des Schwertes werden heftiger.
Und dann lächelt sie.
Ich laufe. So schnell, wie es mir in diesen verdammten, eleganten Schühchen überhaupt möglich ist. Es scheint, als würde ich an Tausenden verschiedenen Spiegeln vorbeilaufen, an Tausenden Abbildern meiner selbst, und niemals am Ende des Raumes ankommen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass die Wände immer näher rücken, dehnt er sich unendlich weit aus.
Die grausame Aileana ist nahe, ihr Abbild überdeckt all die anderen. Ihre Gegenwart fühlt sich an wie Fingernägel, die meinen Rücken blutig kratzen, während ich laufe. Unerbittlich und spitz. Ihr Bild hat sich in meinen Gedanken festgesetzt, als würde ich noch immer in den Spiegel sehen, ihre Augen gleichen einem leuchtend grünen Peridot, sind wie jene von Sorcha, der Fee, die meine Mutter ermordet hat. Sie hat messerscharfe Zähne, sie ist der Tod. Unmenschlich, ungeheuerlich.
Sie repräsentiert all die Male, als ich getötet und es genossen habe. Blutrot steht dir am besten.
Etwas in mir zerbricht, und eine unkontrollierbare Flut Erinnerungen bricht über mich herein. Meine Mutter in der Nacht, als ich in die Gesellschaft eingeführt wurde, und die mich so fest umarmt, dass meine Rippen schmerzen. Meine Mutter, die auf der Straße liegt. Tot. Ich, wie ich ihren Namen schreie, obwohl mich niemand hört.
Ich pralle gegen eine Spiegelwand, und meine Finger kratzen verzweifelt über die Oberfläche. Ich trommle mit den Fäusten auf den nächstbesten Spiegel ein, um ihn zu zerbrechen, doch dann bemerke ich, dass er gar nicht aus Glas besteht.
Sondern aus Stein.
Verdammt, verdammt, verdammt. Ich trete zitternd zurück. Hände packen meine Schultern und reißen mich brutal herum.
Lonnrach.
Mein erster Impuls ist, zu kämpfen – ihm gegen die Kniescheibe zu treten –, doch meine Füße verheddern sich in den Schlingpflanzen auf dem Boden. Als ich gegen sie ankämpfe, wachsen die Pflanzen weiter empor und ranken sich um mein Bein. Ich versuche, sie fortzutreten – irgendetwas zu tun –, aber ich kann mich nicht einmal mehr bewegen. Ich ziehe mit beiden Händen daran, doch die Schlingpflanzen ranken sich um meine Handgelenke.
»Je mehr du dagegen ankämpfst, desto schneller wachsen sie.«
Lonnrachs vages Lächeln wirkt spöttisch. Er hat sich umgezogen. Mittlerweile ist er vollkommen schwarz gekleidet, von der Hose bis zum Hemd. Selbst auf seinem langen, maßgeschneiderten Mantel ist kein Farbtupfer zu erkennen.
Ich halte inne, und tatsächlich hören die Schlingpflanzen in Hüfthöhe auf zu wachsen. »Dann ist das hier also mein neues Gefängnis?« Ich versuche, seinen bissigen Tonfall nachzuahmen. Ich beuge mich nach vorne und grinse ihn ebenfalls höhnisch an – es ist reine Angeberei, aber an der Art, wie sein Mund hart wird, merke ich, dass es durchaus Wirkung erzielt. »Ich nehme an, dass es hier auch einmal anders ausgesehen hat. Schöner und farbenfroher. Dass das hier bloß ein weiteres Beispiel für den Untergang deines Königreiches ist.«
Ich hoffe, dieser Ort brennt irgendwann nieder. Ich hoffe, ich bin diejenige, die das verdammte Zündholz entfacht.
Lonnrachs Gesichtsausdruck verhärtet sich. Er streicht mit dem Finger über meine Wange und weiter den Hals hinab. Ich zucke zurück, und die Bewegung bringt die Schlingpflanzen dazu, sich noch weiter meine Arme hinaufzuwinden. »Ich bin schon gespannt, vor welcher Erinnerung du gerade davongelaufen bist.«
Eine Erinnerung. Die grausame Aileana war also ein Symbol für eine Erinnerung.
Obwohl sie mittlerweile aus den Spiegeln verschwunden ist, spüre ich sie tief in meinem Inneren noch immer. Das Gefühl, das ihre Schwertstiche hinterlassen haben, ist noch immer nicht vollständig verebbt. Und ich sehe noch immer ihr bösartiges Lächeln vor mir.
»Was meinst du damit?« Ich versuche, ruhig zu klingen, obwohl ich noch immer das Flüstern höre, das wie ein Schwerthieb durch meine Gedanken zischt. Blutrot steht dir am besten.
»Wir haben herausgefunden, wie wir aus den Erinnerungen unserer Feinde Informationen herausfiltern können.« Lonnrach tritt zur Seite. Er schlüpft langsam aus seinem Mantel und faltet ihn zusammen. »In diesem Raum werden Erinnerungen vervielfältigt und nehmen dadurch Gestalt an. Und nachdem mir Kadamach entkommen ist, bevor ich das hier mit ihm machen konnte, muss ich nun mit dir vorliebnehmen.«
Mein Gott. Zum ersten Mal steigt so etwas wie Angst in mir hoch und lässt mich erzittern. Auch Sorcha hat bereits meine Erinnerungen gegen mich verwendet und mich Dinge erneut durchleben lassen, die ich am liebsten vergessen würde.
»Was auch immer du suchst, ich weiß nicht, wo es sich befindet.«
Lonnrach legt den Mantel auf den Boden. Dann rollt er seinen Hemdsärmel hoch, sodass die glatte, glänzende Haut auf seinem Unterarm zum Vorschein kommt. Als würde er bald schmutzig werden.
»Die Art und Weise, wie das menschliche Gehirn arbeitet, ist faszinierend«, sagt er beiläufig. »Das Gedächtnis von Feen funktioniert einwandfrei, unsere Erinnerungen sind absolut lückenlos. Menschen erinnern sich hingegen nur bruchstückhaft. Alles wird seiner Wichtigkeit nach sortiert, der Rest wird verdrängt.« Er ist mittlerweile beim zweiten Ärmel angelangt, den er ebenso bedächtig aufrollt. »Das bedeutet natürlich, dass ich die Erinnerungen langsamer extrahieren muss und es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dein Geist würde zu leicht brechen.«
Langsamer extrahieren. Dein Geist würde zu leicht brechen. Er wird ihn ohnehin Stück für Stück auseinandernehmen, um zu finden, wonach er sucht. Ich mag vielleicht eine Falknerin sein, aber ich bin immer noch ein Mensch.
»Wenn ich einen Gegenstand kennen würde, der den Feen hilfreich sein kann, dann würde ich mich bestimmt daran erinnern«, sage ich schnell, um die Situation zu entschärfen. Ich hätte ihn aufgespürt und zerstört.
Lonnrach sieht mir in die Augen. »Du wurdest ein Jahr lang von meinem Feind und dieser bösartigen kleinen Fee trainiert. Ich nehme an, sie haben oft über Dinge gesprochen, die du nicht verstanden hast.«
Ich presse die Lippen aufeinander, um nicht laut zu fluchen. Kiaran und Derrick waren ganz versessen darauf, sich in rätselhaften Sätzen zu unterhalten, bei denen es um Dinge aus ihrer Vergangenheit ging, die sie beide nicht weiter kommentieren wollten. Manchmal sprachen sie überhaupt in einer vollkommen anderen Sprache, einer Art Feensprache, die dem Gàidhlig ähnelt und doch anders ist als alles, was ich jemals gehört habe.
»Auch das, was du nicht verstanden hast, ist für mich von Nutzen«, fährt er fort. »Ihre Schwächen. Deine Schwächen.« Bevor ich etwas erwidern kann, steht Lonnrach plötzlich dicht vor mir und greift nach meinem Handgelenk. »Ich will alles wissen«, flüstert er, und seine stahlgrauen Augen schimmern. »Wenn es nötig ist, nehme ich jede einzelne deiner Erinnerungen auseinander. Ich brauche bloß dein Blut dazu.«
Dein Blut.
Eine plötzliche Erinnerung an meine Mutter stürzt auf mich ein. Sie liegt in Sorchas Armen, von Sorchas Zähnen tropft Blut. Das Blut meiner Mutter.
Nein. Nein, nein, nein. Ich kämpfe dagegen an, und die Schlingpflanzen ranken sich erneut um mich. Sie lassen bloß meinen Arm frei, damit er ihn zu sich ziehen kann – zu seinen Lippen.
Lonnrach öffnet seinen Mund, und vor seinem makellos weißen, geraden Gebiss senken sich zwei Reihen messerscharfe Zähne herab.
Wie bei Sorcha. Ich fühle mich wie betäubt, tot. Unfähig, mich zu bewegen, selbst wenn ich wollte. Er ist ebenfalls eine Baobhan Sìth. Eine vampirähnliche Fee, wie aus einem Albtraum entsprungen.
Lonnrach beugt sich über mein Handgelenk, und seine Stimme ist ein Flüstern, das wie ein Zischen klingt, während er lächelnd fünf Worte sagt: »Das wird jetzt sicher wehtun.«
Und dann beißt er zu.
3
Lonnrachs Biss fühlt sich an wie Gift, das durch meinen Körper fließt und in meinen Adern und meine Wirbelsäule hinunterbrennt. Der Schmerz ist so intensiv, dass ich nichts und alles zugleich spüre. Meine Haut spannt sich über meine Knochen, mein Blut schießt rauschend und pochend durch meine Glieder, meine Muskeln krampfen sich zusammen.
Lonnrach hebt einen kurzen Moment lang seinen Kopf. Sein Mund ist mit meinem Blut verschmiert. Seine Augen sind geschlossen. Kurz bevor ich seinen Biss erneut spüre, flüstert er: »Du schmeckst nach Tod.«
Erinnerungen explodieren in meinem Kopf. Bilder, die so schnell vorüberziehen, dass ich sie nicht zu fassen bekomme. Zuerst sind es belanglose Gedanken, Erinnerungen an die Zeit, als meine Mutter noch am Leben war. An jene Tage, als mein Leben noch aus Etikette, Tee und Tanzstunden bestand und ich die Abende damit verbrachte, gemeinsam mit ihr an unseren Erfindungen zu basteln.
Ich spüre, wie Lonnrach sie als unwichtig einstuft und beiseiteschiebt.
Das Lachen meiner Mutter reißt mich aus meiner Entrüstung. Beinahe schreie ich ihn an, dass er aufhören soll, doch er erlaubt mir bloß den Bruchteil einer Sekunde lang einen Blick auf ihr breites Lächeln, das so klar ist, als stünde sie mit mir im selben Raum. Als wäre sie tatsächlich hier. Der Duft ihres Parfums nach Heidekraut erfüllt meine Sinne, bevor er ebenso schnell wieder verschwunden ist.
Ich werde fortgeschwemmt. Die Bilder durchfluten mich noch brutaler, ohne irgendeiner Ordnung zu folgen. Die Nächte vor der Schlacht, als Kiaran und ich gemeinsam jagten und wie Mitglieder einer Bürgerwehr durch die Straßen hasteten. Wir jagen, schleichen uns an, töten und verschwinden wieder.
Ich spüre, wie Lonnrach versucht, alles in eine zusammenhängende Abfolge zu bringen und die Erinnerungen zu verlangsamen, damit er sie genauer betrachten kann. Er geht wieder zum Anfang zurück. Zu jener Nacht, bevor ich Kiaran kennenlernte.
Tu das nicht! Bevor ich ihn davon abhalten kann, stehe ich plötzlich wieder im Garten hinter dem Ballsaal. Ich trage mein weißes Seidenkleid mit den Spitzenbesätzen und Blumenstickereien. Darunter blitzen wunderschöne Tanzschuhe hervor, deren sorgsam aufgestickte rosa Rosenknospen im hellen Mondlicht glänzen. Der Punsch fühlt sich warm in meinem Magen an, mein Blick ist vom Alkohol getrübt, und ich schwanke ein wenig.
Zwing mich nicht, mich daran zu erinnern, flehe ich Lonnrach in meinen Gedanken an. Da gibt es nichts, was dir helfen könnte. Doch meine Proteste verleiten ihn nur dazu, noch vehementer an der Erinnerung festzuhalten. Sie läuft weiter.
Ich weiß genau, was jetzt kommt. Ich habe es Nacht für Nacht in meinen Albträumen durchlebt. Zuerst dringt ein leises Seufzen von der gegenüberliegenden Seite des Gartens zu mir, und ich zucke zusammen. Beinahe wende ich mich ab, um wieder ins Haus zu gehen, doch dann höre ich noch etwas – einen erstickten Schrei, der in ein Keuchen mündet.
Nein, nein, nein. Ich sehe mir zu, wie ich durch den Garten zu dem Tor gehe, das hinaus auf die Straße führt. Egal, wie oft ich mich schon daran erinnert habe, ich hoffe immer noch, dass die Geschichte irgendwann einmal anders ausgehen wird. Ich hoffe, dass ich davonlaufen und Hilfe holen werde. Ich hoffe, dass ich ein Messer ziehen und kämpfen werde. Ich hoffe, dass jemand kommt. Ich hoffe und hoffe und hoffe.
Aber es ist wieder dasselbe. Wie immer.
Ich spüre, dass Lonnrach mich ebenfalls beobachtet. Wir sehen zu, wie seine Schwester ihr Gesicht an den Hals meiner Mutter presst. Sie hebt den Kopf, und ihre Zähne glänzen im Mondlicht, während das Blut meiner Mutter von ihnen herabtropft. Wir hören Sorchas Lachen. Ein tiefes, kehliges Schnurren, unter dem sich mein Magen zusammenkrampft. Wir sehen zu, wie sie das Herz meiner Mutter mit einer einzigen, schnellen Bewegung herausreißt.
Lonnrach steht vollkommen regungslos neben mir, während meine Erinnerung in Panik versinkt. Ich bekomme kaum noch Luft, und meine Gedanken rasen, während Sorcha im Dunkel der Nacht verschwindet. Meine Erinnerung beschleunigt sich immer mehr, bis alles plötzlich schwarz wird, bis zu dem Moment, als ich mich neben dem Körper meiner Mutter wiederfinde und meine Hände auf ihre Brust presse.
Wir sehen zu, wie ich ihren Namen brülle, bis meine Stimme versagt.
Ohne jede Vorwarnung befinde ich mich plötzlich wieder in dem Spiegelzimmer. Lonnrach hält noch immer mein Handgelenk fest, und sein Mund schwebt über der Stelle, an der seine Zähne ihre Abdrücke in meiner Haut hinterlassen haben. Seine Lippen sind feucht von meinem Blut, und es tropft seinen Hals hinab. Genauso, wie in meinen Erinnerungen an sie.
Sorcha.
Ein Laut dringt aus meiner Kehle, bevor ich etwas dagegen unternehmen kann. Lonnrach sieht mir in die Augen, er atmet stoßweise, und ich sehe überrascht eine kurze Emotion in seinem Blick aufflammen.
Doch bevor ich mir noch einen Reim darauf machen kann, wendet er sich abrupt ab. Er hebt den Arm, um sich den Mund abzuwischen, und verschmiert dabei mein Blut auf seinem Unterarm, sodass es aussieht, als hätte er sich verbrannt. »Das reicht für heute.«
Lonnrach greift nach seinem Mantel auf dem Boden und tritt durch den nächstgelegenen Spiegel. Er verschwindet darin, als wäre er aus Wasser. Die Oberfläche wirft kleine Wellen, die sich durch sämtliche anderen Spiegel fortsetzen, bevor sie wieder glatt wird und nur noch mein eigenes Spiegelbild zeigt.
Ich bin wieder alleine. Die Schlingpflanzen ziehen sich in den Boden zurück, und ich bin erneut von meinen vielen Spiegelbildern umgeben.
Erst jetzt merke ich, dass Tränen über meine Wangen laufen.
Als Lonnrach mich die nächsten Male aufsucht, spricht er kein Wort mit mir. Er meidet meinen Blick und sein Gesichtsausdruck ist vollkommen beherrscht. Er ist auf der Hut.
Zuerst wehre ich mich noch. Ich bin verzweifelt genug, um ihn anzugreifen – zu versuchen, die Seilgflùr-Kette um seinen Hals zu wickeln –, doch die Schlingpflanzen ranken sich so schnell um meine Arme und Beine, dass ich aufgeben muss. In den darauffolgenden Tagen fordern der Blutverlust und das Gift ihren Tribut, und mein Körper wird immer schwächer, weshalb ich aufhöre, mich zu wehren.
Ich sehe meine Zeit mit Lonnrach als Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gibt. Wenn er seine Zähne in mir versenkt, schließe ich die Augen und schaffe es beinahe, mich selbst davon zu überzeugen, dass ich gerade träume, und das hier nicht real ist. Dass er nicht real ist.
Nach einer Weile habe ich mich so sehr an den Schmerz seiner Bisse gewöhnt, dass er mich kaum noch berührt. Inzwischen spüre ich bloß noch ein schnelles Pieken der Zähne, die sich ins Fleisch bohren und ein Stechen, wenn das Gift durch meine Adern fließt.
Lonnrach erkundet meine Erinnerungen und verschwindet danach wie ein Dieb mit seiner Beute. Jede Erinnerung an Derrick und Kiaran wird langsam und bedächtig abgespielt und sorgfältig untersucht.
Während seiner Erkundungen erlebe ich das letzte Jahr meines Lebens noch einmal. Seine Bisse werden zu einer Ruhepause von der Einsamkeit inmitten meiner Spiegelbilder, und ich hasse mich dafür. Die grausame Aileana hat nicht wieder angegriffen, doch ich spüre sie noch immer hinter all den anderen. Sie wartet, sie beobachtet. Ihr monströses Lächeln blitzt kurz auf und erinnert mich daran, dass auch Sorcha noch immer in meinen Erinnerungen lauert, dann ist sie wieder verschwunden.
Zuerst versuche ich, die Zeit, in der ich von ihr verschont bleibe, zu nutzen und presse meine Hände gegen die verspiegelte Steinoberfläche. Ich versuche schon seit einiger Zeit, durch sie hindurchzutreten, wie es Lonnrach immer tut, doch die Oberfläche bleibt immer hart und massiv. Ich zähle die Spiegel – eintausendvierhundertundsiebenundsechzig –, doch sie alle sind und bleiben undurchdringlich. An besonders schlechten Tagen trommle ich auf die Spiegel ein, bis meine Hände zu bluten beginnen. Bis meine Fäuste von Blutergüssen übersät sind.
Je länger Lonnrach mein Blut trinkt, desto schwächer werde ich. Es wird auch kaum besser, als ich mich schließlich dazu entschließe, das Essen anzunehmen, das er mir bringt. Brot, Käse, Obst. Kiaran hat mich immer gewarnt, Essen oder Getränke von einer Fee anzunehmen, denn es verschafft ihnen noch größere Macht über uns Menschen. Die Tatsache, dass ich das Essen annehme, ist mein stillschweigendes Einverständnis, dass ich hier im Sìth-bhrùth bleiben werde, bis Lonnrach mich gehen lässt.
Vermutlich wird er mich vorher töten.
Ich präge mir die Form seiner Zähne auf meiner Haut ein. Meine Finger gleiten über die Abdrücke, die sie hinterlassen haben, während ich an die Erinnerungen zurückdenke, die er heraufbeschworen und untersucht hat.
Sechsunddreißig menschliche Zähne. Sechsundvierzig dünne Fangzähne, so spitz wie die einer Schlange. Zusammen bilden sie zwei halbkreisförmige Umrisse, die überall auf meinen beiden Armen und auf beiden Seiten meines Halses Abdrücke hinterlassen haben.
Siebenundzwanzig Mal.
Manche sind noch mit Blut besprenkelt. Andere sind durch das Gift der Baobhan Sìth schnell verheilt, und es haben sich bereits Narben gebildet. Früher habe ich meine Narben als Abzeichen bezeichnet. Jede einzelne wurde mir von einer der Feen zugefügt, die ich getötet habe. Aber das hier … das hier sind keine Abzeichen. Es sind keine Siegestrophäen.
Diese Narben sind eine Erinnerung daran, dass ich alles verloren habe.
Heute stöbert Lonnrach in weiter zurückliegenden Erinnerungen. Er verweilt in der Zeit, bevor meine Mutter starb, in Erinnerungen, die eigentlich unwichtig für ihn sein sollten. Ich frage mich, ob ihm bewusst ist, dass ich durchaus bemerkt habe, wie er die Stunden, die ich mit ihr an unseren Erfindungen gebastelt habe, oder die Tage, als ich zum Tee mit meiner Freundin Catherine verabredet war, in die Länge zieht. Es sind belanglose Erinnerungen an einfache Freuden, bevor ich überhaupt wusste, was Trauer ist.
Dann springt Lonnrach in der Zeit nach vorne, als wäre es ihm unangenehm. Ich sehe zu, wie die Erinnerungen vorbeiziehen, bis ich mich erneut mit Kiaran im Queen’s Park wiederfinde. Es ist die Nacht, als die Schlacht stattfand, doch mittlerweile erscheint es mir sehr lange her. Damals beschloss Kiaran, den Platz seiner Schwester einzunehmen, falls es uns gelingen sollte, die Feen wieder gefangen zu nehmen. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen.
Noch vor einiger Zeit hätte ich gegen Lonnrachs Eindringen in diese Erinnerungen angekämpft, doch mittlerweile durchlebe ich sie bereitwillig noch einmal. Ich wünsche mir verzweifelt, wieder etwas zu spüren, sehne mich nach der ganzen Bandbreite an Emotionen, die meine Erinnerungen mit sich bringen. Sie erinnern mich daran, wer ich einmal war. Daran, dass ich immer noch ein Mensch bin.
Bloß eine Weile, denke ich mir. Damit ich etwas habe, woran ich festhalten kann.
Ich spüre Lonnrachs Überraschung, als Kiaran und ich uns küssen, als er meinen Mantel packt, um mich an sich zu ziehen. Es ist eine der wenigen Erinnerungen, die ganz und vollständig geblieben sind. Dieser Kuss hat sich in meine Gedanken eingebrannt. Der Druck von Kiarans Lippen, seine Finger auf meiner Haut. Ich habe ihn mir eingeprägt, ich habe diesen Kuss verinnerlicht.
In meiner Erinnerung löse ich mich von ihm. »Geh.« Ich höre die Verzweiflung in meiner Stimme. »Du hast noch Zeit. Bring dich in Sicherheit …«
Ein weiterer Kuss, als ob Kiaran mir Lebewohl sagen wollte. Als wollte auch er sich meine Lippen einprägen. »Habe ich dir je gesagt, wie der Schwur lautet, den eine Fee leistet, wenn sie sich einer anderen verspricht? Aoram dhuit. Ich werde dir huldigen.«
Lonnrach zieht sich so schnell aus der Erinnerung zurück, dass ich zu taumeln beginne. Wir befinden uns wieder in dem Spiegelzimmer, und er wischt sich bereits die Lippen mit dem weißen Taschentuch sauber, das er mitgebracht hat. Es ist jedes Mal ein neues. Jedes einzelne voll mit meinem Blut.
Meine Beine geben unter mir nach. Ich sinke auf den schlingpflanzenbedeckten Boden, während Lonnrach sich abwendet und wortlos auf den nächstgelegenen Spiegel zueilt.
»Warte.« Der Klang meiner Stimme überrascht mich. Es scheint eine Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal etwas gesagt habe. Meine Stimme klingt rau und trocken.
Lonnrach hält inne. Doch er dreht sich nicht um, als er mir antwortet. »Was ist?«
Ich habe seine Stimme ebenfalls schon lange nicht mehr gehört. Er muss mich nicht mehr verhöhnen, muss mich nicht mehr mit seinen Worten brechen. Ich habe sein Essen und seine Getränke zu mir genommen. Er hat mein Blut bekommen. Er hat meine Erinnerungen gestohlen. Was gibt es dazu noch zu sagen?
Und dennoch … die letzte Erinnerung hat ein Gefühl der Sehnsucht in mir hinterlassen. Leidenschaft. Trauer. Sobald ich wieder alleine bin, werden diese Gefühle wieder verschwinden, und ich werde erneut meine Finger auf die blutigen Abdrücke seiner Zähne pressen und hoffen, sie dadurch wieder heraufzubeschwören.
»Ich möchte bloß reden.« Ich schlucke. Mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das hier gerade tue. Ich würde ihn töten, wenn ich könnte. »Das ist alles.«
Nun wendet Lonnrach doch den Kopf zu mir und sieht mich durchdringend und abwägend an. »Warum?«
Weil ich nicht mehr alleine sein will. Weil ich nicht weiß, wie lange ich bereits hier bin. Weil es niemanden mehr gibt, der mir etwas bedeutet. Weil wir mehr als ein Jahr meiner Erinnerungen miteinander geteilt haben. Weil du zweitausendzweihundertundvierzehn Zahnabdrücke auf meiner Haut hinterlassen hast, die mich bis in alle Ewigkeit daran erinnern werden, dass es meine Schuld ist, dass ich alles verloren habe.
Ich beiße mir auf die Zunge, damit ich nichts von alldem sage. Vielleicht wird er mich eines Tages so weit brechen, dass ich verzweifelt genug bin, es auszusprechen. Vielleicht. Aber noch ist es nicht so weit. »Weil du meine Erinnerungen kennst, mir aber noch sehr wenig von dir erzählt hast.«
»Deine Erinnerungen dienen einem Zweck.« Er macht einen Schritt nach vorne und streckt seine Hand in Richtung Spiegel. »Meine nicht.«
Ich versuche es noch einmal. Ich gehe nicht weiter darauf ein, dass er unbedeutende Erinnerungen aus der Zeit, bevor ich meine erste Fee zu Gesicht bekommen habe, angezapft hat, die für ihn absolut keinen Zweck erfüllen. »Warum hasst du Kiaran?« Lonnrach ballt die Hand zur Faust. Wider besseren Wissens bohre ich weiter. »Du hast gesagt, dass ich es noch bereuen werde, ihn nicht getötet zu haben. Ich will wissen, warum.«
Lonnrach dreht sich langsam zu mir um. Seine Augen sind hart und so grau wie Waffenstahl. Sein Blick fällt auf die Zahnabdrücke, die er auf meinem Handgelenk hinterlassen hat.
Ich ziehe schnell die Knie zur Brust, um mich zu schützen. Gerade als ich denke, dass ich nun bereuen werde, überhaupt etwas gesagt zu haben, antwortet er schließlich. »Dein Kiaran ist der schlimmste Verräter von allen, und seine Schwester ist keinen Deut besser. Jetzt liegt es an mir, ihre Fehler wieder auszubügeln.« Die Art, wie er mich ansieht, lässt keine Zweifel übrig. Und du gehörst auch dazu.
Ich. Er meint, ich sei ein Fehler. Weil Kiaran mich dazu gebracht hat, zu werden wie er.
»Und dadurch deine Welt zu retten?« Ich versuche, locker zu klingen, doch ich kann nichts gegen den bitteren Unterton in meiner Stimme machen. Du hast meine Welt geopfert, um deine zu retten. »Ist eure Königin tot?«
Lonnrach scheint zu erstarren, als hätte ihn meine Frage überrascht. »Vielleicht.« Er scheint seine Worte genau abzuwägen. »Die Cailleach wurde seit Tausenden von Jahren nicht mehr gesehen. Die Erben, denen sie ihre Macht übergab, waren … unwürdig. Ohne Herrscher wird das Sìth-bhrùth untergehen. Jemand muss ihren Platz einnehmen.«
»Und du denkst, du bist würdig.« Es klingt wie ein Vorwurf, doch ich versuche bloß zu verstehen, warum er so viel Zeit darauf verwendet, meine Erinnerungen derart genau zu untersuchen.
Er wirft mir einen vielsagenden Blick zu, als könne er meine Gedanken lesen. »Nein. Aber ich werde es eines Tages sein.«
Er wendet sich ab, um zu gehen, doch ich rufe erneut seinen Namen. Ich sehe, wie sich seine Schultern anspannen, als hätte er Angst vor meiner nächsten Frage. »Wie war es, als ihr unter der Stadt gefangen wart?«
War es wie hier in diesem Zimmer? Habt ihr auch aufgehört, dagegen anzukämpfen?
Lonnrach wägt seine Antwort sorgfältig ab, seine Stimme ist bar jeglicher Emotion. »Die ersten hundert Jahre versuchten wir zu fliehen, bis unsere Fingernägel Furchen in die unterirdischen Felsen zogen. Es war wie in einer Gruft.«
Ich sehe sein Gesicht nur von der Seite, doch mir fällt auf, wie angespannt sein Kiefer wirkt, als würde er versuchen, seinen Ärger in Zaum zu halten. »Ich werde niemals vergessen, dass es deinesgleichen waren, die uns hierher verbannt haben. Und dass dein kostbarer Kiaran und seine Schwester ihnen dabei halfen.« Er wirft einen Blick auf meine Spiegel, auf die Hunderte verschiedenen Spiegelbilder. Auf meinen Käfig. »Und jetzt weißt du auch genau, wie es sich anfühlt, wenn man derart hilflos ist.«
4
Mittlerweile verblassen die Erinnerungen an mein früheres Leben immer mehr. Es ist TageWochenMonateJahre her – ich weiß es nicht genau –, seit ich jemanden außer Lonnrach gesehen habe. Ich kann mich ohne ihn nicht einmal mehr an die Dinge erinnern, die er mir gestohlen hat.
Um mich zu erinnern, muss ich meine Finger in die Bisswunden graben, die seine Zähne hinterlassen haben, bis sie über den Narben ihre eigenen halbkreisförmigen Abdrücke hinterlassen. Ich muss meine Augen so fest zusammenpressen, bis ich hinter meinen geschlossenen Lidern Sterne sehe.
Jedes Mal, wenn ich es schaffe, die wertvollen Momente mit allen, die mir etwas bedeutet haben, noch einmal zu durchleben, bricht Erleichterung über mich herein. Ich kann nichts dagegen tun, dass Kiaran immer wieder in meinen Gedanken hängen bleibt, auch wenn der Schmerz, den Lonnrachs Worte verursacht haben, noch immer da ist. Er ist noch nicht einmal annähernd verblasst.
Er hat dich glauben lassen, dass du ihm etwas bedeutest. Du bist nicht das erste menschliche Spielzeug, dessen er sich entledigt.
Ich zucke zusammen und versuche, nicht mehr an Kiaran zu denken. Ich muss ihn vergessen. Er hat mich im Stich gelassen. Ich habe hier im Sìth-bhrùth Dutzende von Lonnrachs kleinen Sitzungen über mich ergehen lassen. Habe Stunden, Tage und vielleicht auch Wochen alleine mit meinen Spiegelbildern verbracht. Habe Spiegel und Efeublätter gezählt. Er hat sich meiner entledigt. Ich bin …
»Kam.« Sein Flüstern dringt in meine Gedanken. Es ist sein Spitzname für mich. Die Art, wie er ihn in seinem starken Highland-Akzent ausspricht, lässt mich beinahe erzittern. Es klingt, als würde er den Klang des Namens lieben. Es klingt so intim. Wie ein Versprechen.
Ich versuche es noch einmal. Verzweifelt beschwöre ich ein Bild meiner Mutter herauf. Ich denke an ihr Lächeln, an ihr Lachen, an die Art, wie sie immer …
»Kam.« Ich höre erneut Kiarans Stimme, dieses Mal jedoch lauter. Eindringlicher.
»Verschwinde«, zische ich. Ich presse meine Finger tiefer in die Bisswunden unter dem Ärmel meines Kleides. Meine Nägel graben sich in meine Haut. Konzentrier dich. Erinnere dich.
»Verdammt, jetzt mach die Augen auf und sieh mich an.«
Was zum …? Ich reiße die Augen auf. O Gott. Meine Erinnerungen können Kiaran nicht gerecht werden. Er steht über mir, und seine tintenschwarzen Haare locken sich über den Kragen seines hellen Wollhemdes. In meinen Erinnerungen schaffte ich es nie, das lohfarbene Strahlen seiner Haut oder das Leuchten seiner Augen heraufzubeschwören, die mich immer an blühenden Flieder erinnern.
Ohne es zu wollen, wandert mein Blick zu der Stelle auf seiner Wange, wo das Schutzschild ihn so schwer verbrannt hat, dass ich die Knochen unter seiner verkohlten Haut sehen konnte. Seine Wunden sind verheilt, und es ist nichts, außer glatter, makelloser Haut zu sehen.
Er kann nicht real sein. Ich bilde mir ihn bloß ein. Er ist nicht real. »Du hast doch gesagt, du kannst das Sìth-bhrùth nicht betreten«, sage ich und bin mir mit einem Mal sicher. Lonnrach muss ihn erschaffen haben, um mich zu quälen. Er ändert seine Taktik. »Sonst würdest du sterben.«
Kiaran wirft mir einen ungeduldigen Blick zu und streckt die Hand aus. Als ich ohne nachzudenken nach ihr greife, fährt meine Hand durch sie hindurch. Sie fährt einfach hindurch. Als wäre er ein verdammter Geist.
Ich ziehe meine Hand ruckartig zurück. »Dann hat Lonnrach dich also wirklich erschaffen. Nun, das wird aber nicht funktionieren.«
Er flucht leise und klingt dabei tatsächlich wie Kiaran. Lonnrach versteht sein Handwerk.