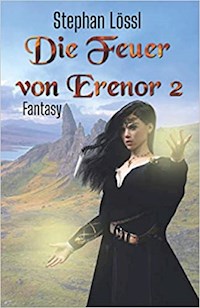
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cuillin Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Winter hat den Kampf gegen den Frühling verloren. Für Alexander und Anna ist es an der Zeit, mit Askaya und Min aufzubrechen, um die Artefakte zu den magischen Orten, denen sie einst entrissen worden waren, zurückzubringen. Sie hoffen, dadurch die Herrschaft der Einaren beenden und den grausamen Feind für immer hinter die Ringberge verbannen zu können. Doch die abenteuerliche Reise entbrennt nicht nur zu einem Wettlauf gegen die Zeit, sondern offenbart auch so manches Geheimnis der Gefährten. Am Ende, als der tödliche Schlag der Einaren nur noch einen Herzschlag weit entfernt ist, müssen sie feststellen, dass ihnen ein Artefakt fehlt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die Feuer von Erenor
Das letzte Artefakt
Stephan Lössl
Impressum
Die Feuer von Erenor
Fantasy
© 2020 Cuillin Verlag Lössl Stephan
Dietzhof 77, 91359 Leutenbach
1. Auflage 2020
ISBN 978-3-941963-18-4
Covergestaltung: Isabell Valentin, www.IsabellValentin.de
Verwendete Fotos:
©Depositphotos/ Ravven
©iStock/1111/ESPDJ
For the Ladies we loved, and the Ladies we lost
Prolog
High Pasture Caves, Isle of Skye, Schottland, 2005 n.Chr
Es war ein wolkiger Tag auf der Isle of Skye, dennoch kämpften sich immer wieder Sonnenstrahlen durch die Wolken und tauchten die High Pasture Caves in goldenes Licht. Die Ausgrabungen gingen daher gut voran. Emsig, aber dennoch vorsichtig, legte Martin die letzten Reste einer Gesteinsschicht frei, entfernte Erde und kleine Steinchen. Er wollte nicht zerstören, was andere vor Tausenden von Jahren in harter Arbeit erbaut hatten. Plötzlich jedoch hielt er inne. Martin glaubte seinen Augen nicht zu trauen, denn das, was da zum Vorschein kam, waren keine Steine. Ohne den Blick abzuwenden, griff er nach einem feinen Pinsel. Behutsam säuberte er damit die Entdeckung, die ihm einen Schauer über den Rücken trieb. Er blies den feinen Staub zur Seite und nach und nach zeichnete sich sein elfenbeinfarbener, aber auch deutlich verblichener Fund von der dunklen Erde ab. Martin stutzte und schüttelte den Kopf. »Ich fasse es nicht«, flüsterte er, dann hielt er nach seinem Kollegen Ausschau. »Steven, schnell, das musst du dir ansehen!«, rief er.
»Moment noch, ich komme gleich«, murmelte Steven und inspizierte eingehend eine Pfeilspitze, die sicherlich noch aus der mesolithischen Periode stammte und womöglich einem nomadisierenden Jäger bei seinem Überlebenskampf geholfen hatte.
»Steven, schnell, das hier wirst du nicht glauben.« Steven, durch die Dringlichkeit in Martins Stimme nun offenbar doch alarmiert, legte die Pfeilspitze weg und kam endlich herbeigeeilt.
»Was gibt es denn?«
»Hier, sieh dir das an. Was glaubst du, was das ist?« Martin deutete auf seine Grabungsstelle.
Steven erstarrte wie vom Donner gerührt. »Aber das ist doch … das glaube ich nicht.« Langsam ließ er sich auf die Knie nieder und betrachtete Martins Entdeckung. Vorsichtig strich er mit den Fingern darüber, so als müsse sein Tastsinn ihm erst bestätigen, was seine Augen sahen.
»Es ist eindeutig, oder?« Martin sah Steven gespannt an und dieser nickte. »Das ist der Unterkiefer eines Menschen. Der Gesteinsschicht, in der er liegt, nach zu urteilen, circa zweitausend Jahre alt.«
»Möchtest du hier weitermachen?«
Steven sah Martin ungläubig an. »Ist das dein Ernst?«
»Natürlich!«
»Nichts lieber als das«, lachte Steven und gab Martin einen herzhaften Schlag auf den Rücken. Schon machte sich Steven an die Arbeit und setzte die Grabungen fort.
Die Aufregung der beiden Archäologen wuchs immer mehr, als in den folgenden Tagen ein weibliches Skelett zum Vorschein kam. Auch förderten die beiden ein Bündel mit weiteren Knochen zutage, bei welchen es sich um die Knochen von Kindern handelte, die zwischen den Beinen der Frau niedergelegt worden waren.
Pollen von Wasserlilien und Weidenkätzchen wiesen darauf hin, dass man die Frau wohl eines Tages im Frühjahr hier begraben hatte. So gelang es zwar, viele Fragen zu den Begleitumständen zu beantworten, doch eine erschloss sich Martin und Steven nicht: Wer war diese Frau gewesen? Was für ein Leben hatte sie geführt, damals, vor über zweitausend Jahren?
1. Der Aufbruch
Der Alte begann zu wanken, obwohl der Wirbelsturm, der ihn eben noch umgeben hatte, allmählich abebbte. Er taumelte einen Schritt rückwärts, dann noch einen, und plötzlich gaben seine Knie nach. Der Kalte Mann brach zusammen. Geschickt fing ihn die junge Frau auf, ließ ihn langsam zu Boden sinken und bettete ihn in ihre Arme.
»Wie ich dir sagte«, begann die Frau leise auf den Alten einzureden, »bald schon wirst du in meinen Armen liegen und dahinschmelzen.«
Der Alte hob einen Finger, deutete damit auf die Frau. Seine Augen weiteten sich jedoch, als er seine Hand betrachtete, die nur noch ein Klumpen Schnee war. Die aus Eiszapfen bestehenden Fingernägel waren, ebenso wie die Finger selbst, dahingeschmolzen. Langsam legte die junge Frau ihre Hand auf des Kalten Mannes Arm, was dazu führte, dass auch dieser zu Wasser wurde, das auf das grüne Gras tropfte.
»Wehre dich nicht«, hauchte sie ihm ins Ohr. »Es geschieht nur, was geschehen muss. Dein Versiegen ist mein Erwachen, mein Untergang ist deine Geburt!« In der Stimme der jungen Frau lagen weder Hohn noch Spott. Stattdessen waren es fast schon liebevoll gesprochene Worte, so wie eine Mutter sie ihrem Kind zuflüstern würde.
Der alte Mann öffnete noch einmal den Mund, stieß einen letzten, kalten Atemzug aus, ehe er mit einem friedvollen Lächeln starb.
Der Frühling war gekommen. Die Wälder in den Tälern des Wissens waren erfüllt vom Gezwitscher der Vögel, der Wind strich geräuschvoll durch die Bäume, die sich sanft hin und her wiegten und nicht selten Augen hatten. Wurzelwichte begrüßten die Geburt der neuen Jahreszeit, indem sie drei Tage und drei Nächte lang ums Feuer herumtanzten, während die moosbewachsenen Maamuks durch die Wälder streiften und sich dem Beobachten von Insekten hingaben. War der Winter in den Tälern von stillem, bedächtigem Leben erfüllt gewesen, so sprudelte die Schöpfung nun schier über.
An den Ufern des großen Sees, unweit des Eremitenherzens, ließ Alexander gerade sein Schwert kreisen, dann stach er zu. Fynja glitt zur Seite, doch Alexanders Klinge folgte sofort. In diesem Augenblick zischten die Systóras, die Klingen in den Zöpfen der hochgewachsenen Kriegerin mit den schwarzen Haaren und den gelb-roten Augen, auch schon auf ihn zu. Er brachte sein Schwert dazwischen, stoppte eines der Messer, das klirrend gegen sein Schwert krachte, und wich dem zweiten Dolch aus.
»Eine geschickte Bewegung«, lobte ihn Fynja, packte jedoch sofort ihren Kampfstock fester, wirbelte diesen herum und ließ ihn direkt auf die blonde junge Frau mit den dunkelbraunen Augen zurasen. Anna sprang auf, blockte den Schlag mit ihrem eigenen Stock und duckte sich. Sofort hieb sie nach Fynjas Füßen. Die Kriegerin sprang leichtfüßig über den Stab hinweg und schon wieder zuckte ihre Waffe in Annas Richtung. Erneut glitt Anna zur Seite und griff an. Ein rascher Schlagabtausch folgte, Stock krachte auf Stock. Anna war gut, bewegte sich gewandt und schnell. Fynja drehte auf, erhöhte die Geschwindigkeit und Anna musste nun doch zurückweichen, erst einen Schritt, dann noch einen. Dann kam der Schlag, der ihrem Leben wohl ein Ende bereitet hätte, wäre es ein Kampf auf Leben und Tod gewesen. Anna brachte ihren eigenen Stock nicht mehr rechtzeitig zwischen sich und die Waffe ihrer Kampfpartnerin, doch in diesem Moment ertönte auch schon ein metallisches Klirren. Ein Schwert hatte Fynjas Stock geblockt.
Amüsiert blickte die Kriegerin auf die Klinge und dann in Alexanders Gesicht. Schließlich nickte sie Askaya anerkennend zu. »Du hast den beiden viel beigebracht. Sie sind gut geworden.«
Eine Reihe weißer Zähne zeigte sich, als ein blitzendes Lächeln auf Askayas Gesicht erschien. Schnell jedoch verschwand es wieder und die Ananeki wurde ernst.
»Auf den Kampf konnte ich sie vorbereiten, jedoch nicht auf die Brutalität der Einaren und die Gefahren unserer Welt.« Mit zusammengezogenen Augenbrauen blickte Askaya zu Alexander und Anna. »Werdet nicht hochmütig, sondern zeigt Demut gegenüber den Unbilden, die euch noch begegnen werden.«
»Dennoch kannst du zufrieden sein, Askaya«, mischte sich nun auch Min ein, wobei sie näher trat und sich ihre dunkelblonden Haare über die Schultern warf. Dann zwinkerte sie Alexander und Anna aus ihren bernsteinfarbenen Augen zu. »Askaya ist nie zufrieden. Immer schon war sie ehrgeizig und begierig darauf, ihre Kampfkunst zu verbessern. Nie hielt sie sich für gut genug, obwohl sie eine der Besten unter uns ist.«
Alexander entging nicht, dass Askaya ihren Kopf einen Augenblick lang stolz erhob, dennoch winkte sie ab. »Es ist die höchste Kunst des Kampfes, in ihm die große Gleichgültigkeit und das Loslassen von allem zu finden.«
Fragend hob Alexander eine Augenbraue. »Was meinst du damit?«
»Nicht die Verbissenheit und das unbedingte Erzwingen des Sieges verhindert die Niederlage«, setzte Fynja an zu erklären, dabei strich sie versonnen über ihren Stock, »es ist vielmehr das Loslassen dieser ehrgeizigen Ziele. Nur wer Gleichgültigkeit erreicht und für wen linker Schlag und rechter Streich, Angriff und Abwehr, Leben und Tod gleiche Gültigkeit haben, für den offenbart sich das Loslassen. Damit wird der Kampf frei und lebendig. Der Ausgang des Kampfes verliert in der Gleichgültigkeit seine Bedeutung.«
Askaya kniff die Augen zusammen und nickte bestätigend, während ein Lächeln über Mins Gesicht huschte. Askaya war mit dem Kommen des Frühlings eher verschlossener und grimmiger geworden, was vermutlich an ihrer bevorstehenden Aufgabe lag. Es war schon bald an der Zeit, loszuziehen und die Artefakte zurückzubringen. Min hingegen hatte sich geöffnet und ein fröhliches, bisweilen sogar lustiges Wesen gezeigt. Alexander und besonders Anna mochten sie sehr.
»Ich denke, du hast die Antwort nicht verstanden, Alexander vom Rabenstein«, meinte Min und das Grinsen in ihrem Gesicht wollte nicht verschwinden.
»Begeht nicht den Fehler, darüber nachdenken zu wollen«, meinte plötzlich eine tiefe Stimme. »Den Zustand der Gleichgültigkeit erreicht ihr nicht mit euren Gedanken, er erreicht euch, und das auch nur, wenn ihr gedankenlos seid.«
»Ednur!«, rief Anna erfreut und umarmte den Eremiten. Auch die anderen begrüßten den alten Mann mit den langen, weißen Haaren. Mittlerweile empfand Alexander ihn als eigentümlichen Eremiten, verglich man ihn mit den anderen, die entweder Wurzelwichte, Maamuks, Felslinge, Tiere, manchmal sogar Bäume oder gar Kinder waren. Galt Ednur in den Tälern des Wissens für einen Eremiten als ganz untypisch, ja sogar sonderbar, so hätte man ihn in einem der Fantasyromane seiner Mutter wohl als klischeehaft empfunden.
»In der Welt, aus der wir kommen, gilt Gedankenlosigkeit nicht gerade als erstrebenswert«, klärte Anna Ednur auf, was diesem ein Schmunzeln entlockte. Er legte Anna eine Hand auf die Schulter.
»Dann ist es wohl eine Welt, in der zu leben mir wenig erstrebenswert erscheint.«
Anna neigte den Kopf zur Seite und dachte nach. »Ja, das mag sein. Verglichen mit dem hier«, sie deutete auf die in leuchtendem Grün erstrahlende Welt der weiten Täler, »scheint vieles in unserer Welt so oberflächlich zu sein, alles dreht sich nur um Besitz, Macht und Reichtum.«
»Nun, solche Dinge sind meist nicht von langer Dauer und dem Untergang geweiht«, folgerte Ednur.
»Nicht überall ist es wie in diesen Tälern, Anna«, beschwerte sich Askaya und legte abermals die Stirn in Falten. »Die Täler des Wissens sind ein wundervolles Kleinod, eine grüne Insel in einem sturmgepeitschten Ozean. Du siehst nur das Grün dieser Welt, nicht die Verderbnis.«
Anna schaute Askaya in die Augen und schüttelte den Kopf.
»Nur weil ich das Schöne bestaune, bedeutet das noch lange nicht, dass ich meinen Blick vor der anderen Seite verschließe, Askaya.«
Askaya trat vor und fasste Anna fest an den Schultern.
»Das rate ich dir auch, denn die andere Seite, das Dunkel, das Übel und die Verderbnis sind allgegenwärtig.«
Ruckartig wirbelte Askaya herum und stapfte raschen Schrittes davon. »Weshalb ist sie bloß so zornig?«, fragte Alexander.
»Sicher macht sie sich Sorgen«, vermutete Anna.
»Askaya nimmt ihre Aufgaben sehr ernst«, sagte Min. »Sie ist ehrgeizig und hat Angst zu versagen. Die Artefakte zurückzubringen ist ein schwieriges und gefährliches Unterfangen.«
»Min hat recht.« Ednur seufzte und blickte Askaya hinterher. »Askaya spricht vom Loslassen im Kampf, doch ist gerade sie diejenige, die es am wenigsten kann, auch wenn ihre kämpferischen Fähigkeiten hervorragend sind.«
»Und genau diese Fähigkeiten sind es, die ihr Probleme bereiten«, meinte Fynja und erntete fragende Blicke. Freundschaftlich legte die große Kriegerin die Arme um Anna und Min. »Sie ist so gut, dass sie im Kampf selten in Bedrängnis gerät. Immer hat sie noch Zeit zum Nachdenken, doch nur wenn sie diese Zeit nicht mehr hat, wenn der Kampf so tödlich wird, dass kein Raum mehr für Gedanken bleibt, nur dann kann sie loslassen, kann in die große Gleichgültigkeit finden.« Fynja wurde ernst und zog die Augenbrauen besorgt zusammen. »Deshalb fürchte ich auch um sie, denn die Grenze zwischen Loslassen und Tod ist ein schmaler Grat.«
Fynjas Worte verursachten betretenes Schweigen. Alexander presste die Lippen zusammen und musterte Anna. Der Aufbruch stand bevor und er konnte die Gefahr beinahe spüren. Seine eigenen Gefühle verwirrten ihn. Einerseits hatte er Angst um Anna, der Gedanke, ihr könnte etwas zustoßen, war unerträglich. Andererseits fühlte er in sich eine gewisse Begierde heranwachsen, eine Begierde, sich endlich in den Kampf zu stürzen, um seine Fähigkeiten, die er sich den langen Winter über angeeignet hatte, unter Beweis zu stellen. Das war eine Seite, die er an sich nicht kannte und von der er nicht wusste, was er davon halten sollte.
Zornig riss Askaya ihren Stab in die Höhe und wirbelte ihn umher. Der Kampfstock aus dem Holz von Sanduril, den Kämpfenden Wäldern, zischte ungebremst durch die Luft, fegte hierhin und dorthin, suchte sich seinen Weg über Askayas Kopf, raste an ihrer Seite vorbei, schlug aufwärts oder nach unten. Ruckartig drehte sich die Ananeki-Kriegerin und ihre Zöpfe wirbelten um sie herum. Die Dolche surrten durch die Luft, sofort stoppte Askaya, fing mit dem Stock eines der beiden Messer ab, bevor es sie selbst verletzen konnte, und ließ dann den anderen Dolch eine gefährliche Wendung beschreiben. Es war eine hohe Kunst, die Systóras so zu führen, dass man seine Gegner verletzte, nicht jedoch sich selbst. Schweiß rann ihr über das Gesicht, lief ihr den Rücken und zwischen den Brüsten hinab. Dann hielt sie inne, als sie sich beobachtet fühlte. Askaya stellte den Stock ab, wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht, tat, als höre sie die Schritte hinter sich nicht. Sie spürte, wie sich eine Hand auf ihre Schulter legte, fest und weich zugleich, und der Zorn in ihr schmolz wie Schnee in der Sonne. Als sie sich umdrehte, sah sie in Annas dunkle Augen, die sie musterten, ohne Zorn, ohne Vorwurf, ohne Urteil. Manchmal wünschte sie sich, sie könnte so sein wie Anna.
»Wir werden es schaffen, Askaya! Wir bringen die Stundengläser zurück. Du, Alexander und ich. Wir halten zusammen und dann schaffen wir das auch.«
Kurz fühlte Askaya erneut Wut in sich aufsteigen. Wut über die Naivität dieses eigenartigen und ihr fremden Mädchens. Sie hatte doch nicht die geringste Ahnung von der Welt da draußen.
Anna schien ihre Emotionen zu spüren, drückte ihre Schulter nur etwas fester und die Hitze in Askaya löste sich auf. Sie entspannte sich und nickte. »Das werden wir. Es ist nur …«, sie hielt inne, senkte den Blick und betrachtete ihren Stock.
»Was?« Anna sah sie fragend an.
»Ich habe Angst, Anna«, platzte es dann aus ihr heraus. »Angst um dich, um Alexander. Angst, dass ich versagen könnte.« In ihren hellen blauen Augen begann es nun feucht zu glitzern. »Und da ist noch etwas. Die Bürde ist so groß. Es heißt, es war eine Kriegerin des Wassers, mit Augen vom selben Blau wie die meinen, die den Verrat begangen hat. Nach zweitausend Sommern lastet nun alles auf mir. Es ist eine Herausforderung, eine Ehre, und ich sollte stolz darauf sein, dass ich es bin, die die Artefakte zurückbringt, doch Zweifel nagen an meinem Herzen.«
Askaya wusste nicht, ob es richtig war, ihre Ängste, die sie bislang stets gehütet hatte, so offen auszusprechen. Aber Anna und Alexander würden sie auf ihrer Reise begleiten und daher hatten sie vielleicht ein Recht darauf, davon zu erfahren.
»Ich wusste nicht, dass Elumiel eine Kriegerin des Wassers war«, sagte Anna. »Aber nur weil sie einst den Verrat begangen hat, heißt das nicht, dass auch du versagen wirst.«
Askaya holte tief Luft und seufzte. »Es macht die Aufgabe aber nicht leichter. Elumiel hat Schande über die Hüterinnen des Wassers gebracht. Bin ich erfolgreich, ist unsere Ehre wiederhergestellt. Wenn nicht, ist sie für immer verloren.«
»Ich habe nun einen Winter in diesen Tälern verbracht«, sagte Anna leise. »Viele der Eremiten und auch der Ananeki sprechen mit großer Achtung von dir.« Anna schmunzelte. »Ein junges Mädchen, das noch nicht einmal seine Systóras selbst in seine Haare flechten konnte, nannte dich die Kriegerin der zwei Welten, weil du meiner Welt die Artefakte entrissen hast. Askaya, sie verehren dich schon jetzt!«
»Und genau das ist es, was meine Bürde umso größer macht.« Askaya packte ihren Stock fester. Er war ihr vertraut und gab ihr ein Gefühl der Sicherheit.
»Dann denke nicht an die Bürde, sondern an die bevorstehende Aufgabe«, riet ihr Anna. »Außerdem sind Alex und ich bei dir und wenn es schiefgeht, kannst du uns die Schuld dafür geben.«
»Glaubst du wirklich, ich würde …«, setzte Askaya an, doch sie hielt inne, als sie erkannte, dass Anna nur einen Scherz gemacht hatte, denn ihre Mundwinkel zuckten.
»Du hast recht«, entgegnete sie. »Ich werde mich an deinen Rat halten, Anna aus der anderen Welt.«
Askaya lächelte, wurde jedoch ernst, als sie bemerkte, wie Anna die Nase rümpfte. »Was ist?«
»Du bist verschwitzt«, erklärte Anna ernst, doch schon breitete sich ein Lächeln in ihrem Gesicht aus. Askaya runzelte einen Moment lang die Stirn und schließlich stimmte sie mit in das Lachen ein. Am Ende zog Anna sie einfach zu sich heran und umarmte sie. Askaya musste zugeben, dass es sich gut anfühlte, so als würde sich ein wenig Frieden in ihr ausbreiten.
»Wenn ich deine Nase beleidige«, meinte Askaya schließlich, »sollte ich wohl ein Bad nehmen und du ebenfalls! Du riechst auch nicht besser.«
»Du meinst jetzt, hier im See? Nur du und ich?«, fragte Anna verblüfft.
Askaya zuckte mit den Schultern. »Natürlich, es ist ja sonst niemand hier und …«, sie beugte sich nach vorne, »… wir schwimmen ja nur.«
Entrüstet riss Anna die Augen auf. »Askaya!«, rief sie, grinste dann aber. Die beiden entledigten sich ihrer Kleider und sprangen schließlich ins Wasser.
Mit konzentriertem Blick polierte Alexander sein Schwert. Die Klinge war in der Eremitenhöhle geschmiedet worden und er hatte sie als seine Waffe auserwählt. Anna war nochmals weggegangen und hatte unbedingt mit Askaya reden wollen. Das Licht des Tages begann mittlerweile zu schwinden, als die Tür der kleinen Hütte aufschwang und Anna hereintrat. Ihre Haare waren nass und ihre Kleider hielt sie in den Händen. Nur den Umhang hatte sie um sich geschlungen. Alexander legte das Schwert zur Seite und erhob sich mit einem Lächeln im Gesicht.
»Na, du warst schwimmen?«
»Ja, mit Askaya.«
»Wie geht es ihr?«
Anna seufzte. »Sie macht sich einfach nur Sorgen und hat Angst, sie könnte es nicht schaffen, die Artefakte zurückzubringen. Ihre Ehre, du weißt schon!«
»Die Ehre, ja. Ein schwieriges Thema.« Dann schüttelte er den Kopf. »Aber wir sind doch bei …«
Rasch legte Anna ihren Finger auf seine Lippen und lächelte.
»Pst. Das habe ich ihr alles schon gesagt und ich denke, ich konnte sie ein wenig aufheitern.« Sie ging einen Schritt auf ihn zu und blickte aus ihren dunkelbraunen Augen zu ihm auf. »Dies ist unsere letzte Nacht. Morgen ziehen wir los.«
Anna legte das nasse Kleiderbündel zur Seite und ließ dann ihren Umhang von sich gleiten. Alexander nahm sie in die Arme, versenkte seinen Kopf in ihrem nassen Haar und sog den feinen Duft von Kräuterseife in sich hinein. Bald schon hatte Anna ihn auf ihr Nachtlager geschoben und von Hemd und Hose befreit, liebkoste seinen Körper, sanft wie eine Abendbrise. Schließlich küsste sie ihn, zärtlich zunächst, dann immer leidenschaftlicher. Sie fielen beide, tiefer und tiefer in einen weiten Raum endlosen Verlangens. Zeit war bedeutungslos geworden, als er die heiligste ihrer Pforten durchschritt und sie sich ineinander verloren, sich selbst aufgaben, um eins zu werden mit dem anderen.
Am nächsten Morgen war es so weit. Der Tag des Aufbruchs war gekommen und eine gewisse Traurigkeit erfüllte sie alle. Selbst Ednur und Fynja starrten mit versteinerter Miene in die Runde, als Alexander, Anna und Askaya ihre Sachen packten, Proviant verstauten und schließlich den kleinen ledernen Beutel mit den Artefakten an Askayas Gürtel banden. Ednur hatte ihnen geraten, Min mitzunehmen und die Ananeki war seinem Rat gefolgt, jedoch nicht ohne sich vorher die Erlaubnis von Fynja zu holen. Der Eremit war der Meinung gewesen, Mins lockere Art könnte den dreien Zuversicht geben und würde der Gemeinschaft ein inneres Gleichgewicht verleihen. So trat der alte Eremit nun nach vorne und seine dunklen Augen betrachteten die Gefährten einen nach dem anderen.
»Ganz gleich wie viele Kerzen in eurem Inneren auch verlöschen mögen, lasst niemals zu, dass es das Licht der Zuversicht ist, welches verlischt.«
Askayas Gesichtszüge waren reglos und erstarrt wie ein zugefrorener See. Alexander war bewusst, dass sie unter dem Druck, die Artefakte heil zurückzubringen, sehr litt. Anna hatte ihm erzählt, dass sie die Bürde als umso größer empfand, da Elumiel, die sogenannte Verräterin - eine Bezeichnung, die Anna gar nicht mochte - eine Kriegerin des Wassers gewesen war. So nickte Askaya nur und presste die Lippen zusammen. Ednur nahm die vier Reisenden, einen nach dem anderen, in die Arme.
»Da ist noch etwas«, meinte der Eremit plötzlich. »Hier!« Er reichte Anna und Alexander je einen dunkelblau schimmernden Umhang. »Min und Askaya sind bereits im Besitz dieser Umhänge und ihr solltet sie auch bei euch tragen. Sie verbergen euch vor den Blicken des Araaken.«
»Danke!«, sagte Anna, während sie ihren Umhang entgegennahm.
»Wie kann es eigentlich sein, dass wir unter diesen Umhängen für die Araaken unsichtbar sind?«, fragte Alexander und strich über den weichen Stoff.
»Sieh genau hin!«, forderte ihn Ednur auf.
Alexander tat wie ihm geheißen und nun stellte er fest, dass der Umhang aus feinen und ganz winzigen Federn gewoben schien.
»Es ist äußerst mühsam, die kleinen Daunen der Araaken zu sammeln. Hat man jedoch nach langer Suche genug zusammen, kann man sie zu einem Umhang weben, unter dem man vor dem Araaken verborgen bleibt.« Ednur schmunzelte. »Um ehrlich zu sein«, fuhr er dann fort, »können wir nicht einmal mit Sicherheit sagen, dass die Araaken nicht durch den Stoff sehen können. Manch einer der Eremiten hier ist der Meinung, die Araaken erkennen den Stoff und respektieren jeden, der ihr Federkleid trägt, und lassen ihn daher einfach in Ruhe.«
»Hauptsache, wir sind darunter sicher«, murmelte Alexander.
Schließlich verabschiedeten sie sich auch von Fynja und Ebenih, die beide überlegt hatten, sie zu begleiten, den Gedanken aber rasch wieder verworfen hatten, da die Gruppe sonst zu groß geworden wäre.
So wanderten sie nun dahin, marschierten durch die Täler, vorbei an Flüssen, rauschenden Bächen und Seen, gingen durch die Wälder und über Lichtungen und obwohl sie Herbst und Winter hier verbracht hatten, versetzten sie die Täler des Wissens immer noch in Staunen. Alexander sah sich um, während er neben Anna herlief, und erfreute sich an der Natur und der wärmenden Sonne des Frühlings.
»Es ist seltsam«, meinte er nach einer Weile zu Anna, »auch wenn mich der Abschied von den Tälern traurig macht, habe ich nicht einmal das Gefühl, die Zeit wäre zu schnell vergangen.«
»Stimmt«, meinte sie. »Mir geht es da genauso.«
»Vielleicht liegt es ja daran, dass in diesen Tälern jeder Tag etwas Besonderes war«, überlegte Alexander. »Es kommt mir so vor, als ob die Erinnerungen an alles, was wir erlebt haben, regelrecht in mein Gedächtnis hineingeprägt worden wären.«
Anna nahm sein Hand und lächelte ihn an. »Wir haben einfach jeden Tag intensiv gelebt, Alex. Vermutlich sogar mehr, als wir das jemals zuvor getan haben.«
»Du hast recht«, erwiderte Alexander. »Zu Hause hatte ich häufig das Gefühl, in einem Zug zu sitzen, der so schnell fährt, dass das Leben um einen herum zu einem graugrünen Schemen verblasst. Weißt du, Anna«, fuhr er fort, »das Verrückte ist: Auch wenn wir uns nun auf eine gefährliche Reise begeben, bin ich doch irgendwie froh, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Trotzdem bereitet es mir ein schlechtes Gewissen.«
Anna blickte zu ihm auf. »Es ist wegen deiner Eltern, nicht wahr?«
»Ja. Irgendwie vermisse ich sie. Ich mache mir noch immer furchtbare Sorgen um sie. Außerdem sind in meinem Kopf so viele Fragen. Aber irgendwie bin ich nicht bereit, zurückzukehren, weil ich das Gefühl habe, mein Vater hat mich betrogen.
Ich meine, er hat ein Schwert geschwungen und …« Kopfschüttelnd brach Alexander ab.
Anna strich ihm mit der flachen Hand über den Rücken. »Ich weiß, was du meinst. Genauso geht es mir mit Sebastian. Ich mache mir Sorgen, habe Angst um ihn, dennoch ist da das Gefühl, belogen worden zu sein.«
»Vielleicht finden wir eines Tages heraus, was es mit all dem auf sich hat«, meinte Alexander.
Anna lächelte zaghaft. »Ja, eines Tages.«
Alexander beließ es dabei und holte tief Luft, während er das Schwert, das er unauffällig unter seinem dunklen Umhang trug, zurechtrückte. Es war Fynjas Idee gewesen, die Klinge zu verbergen, da sie meinte, Schwerter würden zu viel Aufmerksamkeit erregen. Er musste schmunzeln, als er auf Anna, Askaya und Min blickte. Besonders die Erscheinung der beiden Ananeki mit ihren Kampfstöcken und den Dolchen in den Zöpfen und vor allem Askayas stechend blaue Augen waren doch sicher auffälliger als zehn Schwerter. Anna hingegen wirkte in ihrer einfachen Schönheit, mit ihrem mittlerweile sehr langen blonden Zopf und den dunklen, braunen Augen so unscheinbar, dass er fürchtete, gerade sie könne es sein, die neugierige Blicke auf sich zog.
Als hätte sie seine Gedanken gespürt, warf sie ihm ein Lächeln zu, das ihm warm ums Herz werden ließ. Wortlos wanderten sie weiter und folgten den beiden Ananeki-Kriegerinnen auf unsichtbaren Pfaden.
Nach und nach ließen sie die unzähligen, verzweigten Täler hinter sich und erreichten am Nachmittag die äußeren Gipfel der Einsamen Berge, welche die Täler weitläufig umschlossen. Sie waren erst wenige Schritte aus einem Wald herausgetreten, als Anna plötzlich innehielt und sich umdrehte.
»Was ist?«, fragte Alexander. Auch Askaya und Min waren stehen geblieben.
Anna deutete auf den Waldrand. Die anderen folgten ihrem Blick. Alexander konnte erkennen, dass sich irgendetwas hinter den Bäumen bewegte. Es war weiß, weiß wie Schnee und huschte hinter den dunklen Stämmen entlang. Kurz darauf trat ein großer, weißer Wolf aus dem Schatten der Wälder hervor und schaute zu ihnen herüber.
»Wyndor«, flüsterte Anna mit einem Lächeln. Min und Askaya sahen einander mit gerunzelter Stirn an, doch plötzlich stürmte Anna auch schon los, direkt auf den weißen Wolf zu.
»Sei vorsichtig!«, rief ihr Alexander besorgt hinterher, aber Anna hatte den Wolf bereits erreicht.
Irritiert wandte Alexander sich an Askaya und Min. »Wie kommt sie darauf, dass es Wyndor ist? Bei unserer Ankunft hier war Wyndor ein Hirsch.«
»Die Wächter erscheinen in den Gestalten vieler Tiere, doch niemand weiß, was ihr wahres Wesen ist«, antwortete Min. »Sie enthüllen ihre Namen nie. Weshalb sie es ausgerechnet bei Anna getan haben, weiß ich nicht. Anna jedenfalls scheint ihn erkannt zu haben.«
Alexander beobachtete seine Freundin, die sich vor dem Wolf auf ein Knie niedergelassen hatte und ihn streichelte. Dann legte sie beide Hände auf den Kopf des Tieres und schloss die Augen. Nach einiger Zeit erhob sie sich und kehrte zurück. Der Wolf indes verschwand mit ein paar Sprüngen unter dem Grün der Bäume.
»Alles in Ordnung?« Alexander neigte den Kopf zur Seite und sah sie abwartend an.
Anna nickte zwar, wirkte aber irgendwie geistesabwesend.
Auch Askaya und Min musterten sie besorgt.
»Anna?«, versuchte Alexander erneut zu ihr durchzudringen.
Kurz noch starrte sie vor sich hin, dann breitete sich ein zögerliches Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Sie strich Alexander über die Wange.
»Ja, alles in Ordnung, es ist nichts. Lasst uns weiterziehen«, meinte sie nur und ging einfach voraus. Die beiden Ananeki zuckten nur kurz mit den Schultern, folgten ihr dann aber.
Alexander schaute noch einmal zurück zum Wald, doch der weiße Wolf war verschwunden. Annas Verhalten war seltsam und ihre Antwort, alles sei in Ordnung, beunruhigte ihn eher. Er wusste, dass Anna sehr empfindsam war und anscheinend die Gabe besaß, Dinge und, wie es schien, auch andere Wesen berühren und dabei etwas über sie erfahren zu können. Sicher war es auch diesmal so gewesen. Er beschloss, die Angelegenheit zunächst auf sich beruhen zu lassen und folgte den drei Frauen hinauf in Richtung der Gipfel der hohen Berge.
2. Auf den Spuren der Einaren
Am späten Nachmittag hatten sie die höchste Stelle der Berge überquert und erreichten kurze Zeit später eine abgeflachte, mit Gras bewachsene Stelle, wo sie Rast machten und die Nacht verbringen wollten. Eine auffrischende Brise hatte vereinzelte Wolken über den blauen Himmel geschoben und als es schließlich dunkel wurde, blitzten nur wenige Sterne am nächtlichen Firmament. Ein Feuer entzündeten sie nicht, da es von hier oben auf weite Entfernung gut sichtbar gewesen wäre, und statt knisternder Flammen war nur das leise Rauschen des Windes in den Büschen und Tannenbäumen zu vernehmen. Als sie die letzten Bissen hungrig hinuntergeschlungen hatten, erzählte Askaya, welchen Weg sie nehmen würden. Dabei deutete sie hinab in Richtung Nordwesten, wo die Gipfel der Berge von Erenor noch immer aussahen, als würden sie brennen, obwohl die Sonne bereits weit hinter den Horizont gesunken war.
»Wir gehen nach Nordwesten, durchqueren die Ebene von Erenor in Richtung der Eichenwälder. Von dort halten wir uns nach Norden. Im Süden der Bergkette liegt das Tal der Seen. Dorthin müssen wir das Stundenglas des Wassers bringen, damit Wasser auf Wasser ruhen kann.«
»Was bedeutet Wasser auf Wasser?«, wollte Anna wissen.
Min lächelte verträumt und in ihren Wangen bildeten sich sogar kleine Grübchen.
»Es ist wunderschön dort«, erzählte sie, legte sich ins flache Gras und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Dennoch ist es nicht ganz ungefährlich. Das Tal ist durchzogen von vielen blauen und grünen Seen. Der schönste See jedoch, den wir den Smaragdsee nennen, ist der Ort des Artefaktes.« Min sah Askaya an, die den Ausführungen ihrer Weggefährtin aufmerksam lauschte.
»In der Mitte des Smaragdsees liegt eine Insel mit einem kleinen Berg und einem Wasserfall«, fuhr Min fort. »Unter dem Wasserfall gibt es einen Fels, auf dem das Artefakt aufbewahrt wurde. Das Gefährliche jedoch ist, dass der Smaragdsee in der Mitte des Feuersees liegt.«
Alexander zog verwundert eine Augenbraue in die Höhe. »Ein See im See?«
»Ja«, antwortete Min. »Der Feuersee liegt wie ein Ring um den Smaragdsee. Beide Gewässer werden von Unterwasserbergen getrennt, deren Gipfel nur zwei Mann hoch über das Wasser hinausragen.«
»Und woher hat der Feuersee seinen Namen?«, fragte Anna. »Tanzen etwa Flammen auf dem Wasser?«
»Nein«, Askaya schüttelte den Kopf. »In den Unterwasserbergen leben die Mydras. Sie bringen Feuer und Tod.«
Erneut lächelte Min, richtete sich ein wenig auf und legte Askaya freundschaftlich eine Hand aufs Bein. »Sieh nicht immer nur das Schlechte, Askaya. Die Mydras haben auch eine gute Seite …«
»… die ob der schlechten Seite aber bedeutungslos wird«, unterbrach sie Askaya. Min neigte abwägend den Kopf zur Seite. »Die Mydras sind von Natur aus freundliche Wesen. Sie nähern sich jedem, der sich auf ihren See begibt, in Freundschaft, begrüßen ihn, wollen mit ihm spielen und tanzen um die Boote herum.«
»Und sich auf ihr Spiel einzulassen bedeutet den Tod«, erklärte Askaya.
Min seufzte. »Askaya hat recht«, gab sie schließlich zu. »So freundlich die Mydras auch sind, alles, was sie berühren geht, in Flammen auf.«
Anna schlang die Arme um ihren Oberkörper. »Zu wissen, dass alles, was man in Freundschaft berührt, den Tod erleidet, muss schrecklich sein.«
»Ein Wissen, dass dich sicher davon abhalten würde, etwas zu berühren, Anna«, entgegnete Alexander und Askaya pflichtete ihm bei.
»So ist es. Die Mydras jedenfalls hält es nicht ab.«
Anna schwieg und blickte nur nachdenklich in die Dunkelheit. Wieder fragte sich Alexander, was in ihr wohl vorging und was ihr Wyndor während ihrer heutigen Begegnung mitgeteilt hatte.
»Wenn das kleine Wasser auf dem großen Wasser ruht«, riss ihn Askaya aus seinen Gedanken, »müssen wir weiter nach Westen ziehen, tiefer hinein in die Eichenwälder und durch das Moosland weiter nach Norden, wo wir den Weltengrat überqueren müssen.« Askayas dunkle Stimme war fast nur noch ein Flüstern, und selbst in der blauschwarzen Nacht blitzten ihre Zähne hier und da weiß auf. Manchmal erhaschte Alexander sogar ein flüchtiges Glitzern in Askayas hellblauen Augen. »Im Westen der Bergkette von Erenor«, fuhr die Ananeki fort, »wartet ein Ort auf das Feuerartefakt und weiter im Norden, wo das Eisreich beginnt, liegt jener, zu dem der Bewahrer der Feste der Welt - das Artefakt der Erde - zurückkehren muss.«
Alexander lauschte Askaya, die ihn nun neugierig musterte. Ganz bestimmt erinnerte sie sich daran, dass das Artefakt der Erde seiner Schwester Kara gehört hatte.
»Im Osten liegt Sanduril. Dorthin muss das Stundenglas mit dem Baum gebracht werden, um seinen Platz in den Kämpfenden Wälder zu finden«, schloss sie schließlich ihre Aufzählung.
Kurz herrschte Schweigen, eine Weile noch lagen Askayas Worte in der Luft.
Am Ende beugte sich Min vor, drückte Anna und Alexander und danach Askaya die Schulter und blickte sie mit einem vor Zuversicht strahlenden Lächeln an. »Wir werden das schaffen. Alle Artefakte werden ihren rechten Platz finden.«
Askaya schwieg, presste nur die Lippen aufeinander, während Anna Mins Lächeln erwiderte. Oder zumindest versuchte sie es, denn in ihren Augen zeigte sich für einen Herzschlag eine gewisse Traurigkeit.
Wenig später hüllten sie sich in ihre Decken und Alexander legte seine Arme von hinten um Anna.
»Du kannst mir erzählen, was Wyndor dir gesagt hat.«
»Ich weiß, Alex«, flüsterte sie. »Als ich ihn berührte, habe ich etwas gesehen. Etwas, das ich nicht verstehe - noch nicht.« Sie schwieg und Alexander wartete ab, in der Hoffnung, dass sie sich ihm offenbaren würde.
»Lass mir Zeit«, bat sie ihn nach einer Weile. »Ich muss erst selbst damit klarkommen. Eines Tages werde ich es dir erzählen.«
Alexander machte sich Sorgen, doch er bohrte nicht weiter nach. So schloss er einfach die Augen und zog Anna an sich.
Am nächsten Morgen, Wolken hatten den Himmel gänzlich verdeckt, stiegen sie von den Einsamen Bergen herab und liefen in nordwestliche Richtung über die Ebenen von Erenor, die immer wieder von kleinen Baumansammlungen oder grünen Büschen unterbrochen waren. Die Büsche erstaunten die Wanderer aus der Welt jenseits des Portals, waren sie doch ebenso hoch wie ein Baum und mit vielen weißen Blüten bewachsen. Auch das Land war nicht wirklich eben, wie man es von einer Ebene hätte erwarten können. Stattdessen gab es sanft geschwungene Hügel und versteckte Senken mit kleinen Seen darin, die manchmal dunkelblau, manchmal tiefschwarz schimmerten.
Alexander fragte sich bereits, wann sie das erste Mal auf ein Dorf oder eine Siedlung oder sonst ein Lebenszeichen stoßen würden, als Askaya am Rande eines der hohen Büsche anhielt und auf eine dahinterliegende Senke deutete.
»Ananeki!«
Die anderen drängten leise näher und schauten nach unten. In der Mitte des kleinen Tales, an den Ufern eines schmalen Baches, lagerten Männer und Frauen, deren Zahl Alexander auf etwa dreißig schätzte. Allerdings gab es weder Hütten oder Zelte noch sonst etwas, das als Behausung dienen konnte. Nicht einmal Pferde oder andere Reittiere waren zu sehen. Die meisten der Männer, Frauen und Kinder saßen einfach im Kreis, in der Mitte brannte ein kleines Feuer, über dem irgendetwas briet.
»Sie leben in vollkommener Freiheit«, erklärte Askaya. »Sie ziehen durch das Land, streifen durch Wälder und über Ebenen, trinken aus Flüssen und ernähren sich von dem, was das Land ihnen gibt.«
»Niemand von ihnen trägt Klingen in den Haaren«, stellte Anna fest.
»Nein, selbstverständlich nicht!«, erwiderte Askaya streng.
»Die sind nur den Kriegerinnen von Erenor vorbehalten«, antwortete Min ein wenig versöhnlicher als Askaya. »Die Männer und Frauen der Ananeki verteidigen sich mit Stöcken oder Messern, oder mit bloßen Händen. Das Kämpfen bringen wir bereits unseren Kinder bei, seht dort.« Sie zeigte auf eine Stelle etwas oberhalb des Feuers, wo ein Mann und eine Frau drei Kindern gerade den Umgang mit dem Stock beibrachten. Spielerisch griff die Frau einen Jungen an, der eifrig versuchte, ihren Stab abzuwehren, dabei aber aus lauter Übereifer viel zu früh blockte. Die Frau redete geduldig auf den Kleinen ein, lachte dann, wobei sie ihm die Haare zerzauste. Dann hob sie ihn hoch und wirbelte ihn herum. Der Kleine jauchzte, und sofort stimmten die anderen Kinder mit ein. Selbst Askaya lächelte kurz, als sie das ausgelassene Treiben sah.
»Die Ananeki scheinen mir ein sehr fröhliches Volk zu sein«, stellte Anna schmunzelnd fest.
»Das ist richtig«, pflichtete Min ihr bei. »Das liegt daran, dass wir frei von Zwängen und unbekümmert in der Natur leben.« Dann legte sich ein Schatten über Mins Gesicht und ihre Grübchen verschwanden. »Dennoch fühle ich bis hierher eine Anspannung bei diesen Männern und Frauen, die Bedrohung durch die Einaren ist allgegenwärtig. Lediglich die Kinder scheinen frei davon zu sein.«
»Lasst euch nicht täuschen, Anna und Alexander.« Askayas Miene war nun wieder starr, als sie in die Senke hinab spähte. »Schnell wie der Sturzflug eines Raubvogels kommen die Einaren und der Streich ihrer Speere bringt Schatten und Dunkelheit.«
Schatten und Dunkelheit, erinnerte sich Alexander an ihre erste Begegnung mit Askaya am Old Man of Storr. Noch konnte er davon nichts erkennen und es erschreckte ihn, dass irgendetwas tief in ihm danach verlangte, eben jene Schatten und Dunkelheit zu finden. Den ganzen Winter lang hatte er geübt, die Klinge zu führen und etwas in ihm brannte nun darauf, das Gelernte einzusetzen.
»Sollen wir zu ihnen hinuntergehen?«, fragte Anna. Vorfreude schwang in ihrer Stimme mit.
Askaya jedoch schüttelte den Kopf. »Nein, sie wissen nichts von uns und der Rückkehr der Artefakte und sollen es auch nicht. Das würde sie nur in Gefahr bringen.«
»Schade, ich hätte sie gerne kennengelernt.«
Min legte Anna einen Arm um die Schultern und sah sie mit ihren großen bernsteinfarbenen Augen an. »Das kannst du immer noch, Anna. Eines Tages.«
»Eines Tages, wenn die Artefakte dort sind, wo sie hingehören«, entgegnete Askaya und erhob sich.
Traurig ließ Anna den Kopf hängen und flüsterte etwas, das niemand verstand.
So verweilten sie nicht länger, sondern wanderten weiter. Häufig rannten sie sogar und gönnten sich nur kurze Verschnaufpausen. Immer wieder sahen die Gefährten Männer und Frauen vom Volk der Ananeki, doch es entging ihnen nicht, dass sie sich immer an geschützten Stellen, in Senken oder in kleinen Wäldchen aufhielten. Wie Min ihnen noch erklärte, wusste sich das nomadisierende Volk der Ananeki zwar ihrer Angreifer zu erwehren, doch ganz im Gegensatz zu ihren kriegerischen Schwestern, die im Dienste der Artefakte standen, war es stets ihr Bestreben, eine Auseinandersetzung mit dem Feind zu vermeiden.
Selten nur schmiegten sich kleine Gehöfte in den Schutz von Senken oder Hainen. Hier und da erspähten sie wilde Pferdeherden und Tiere, die Alexander an Büffel aus alten Indianerfilmen erinnerten. Nur dass diese hier schlanker waren und anstatt Hörnern riesige Geweihe auf den kräftigen, gedrungenen Köpfen trugen. Das waren Ekknus, wie ihnen Askaya erklärte, eine Art wilder Rinder, welche die Ananeki manchmal jagten.
So war es ein recht einsamer Weg, den sie beschritten. Erst nach einigen Tagen zeichnete sich im Norden endlich die dunkle Silhouette eines Waldes ab. Doch nicht der Wald war es, der ihre Aufmerksamkeit anzog, sondern Rauch, der unweit der Waldgrenze in die Luft stieg. Ruckartig und fast gleichzeitig waren Min und Askaya stehen geblieben und hatten mit ihren feinen Nasen die Luft geprüft. Die Anspannung, die von den beiden ausging, war beinahe greifbar. Alexander hatte das Gefühl, nicht einmal atmen zu dürfen.
»Ein Schatten liegt über diesen Bäumen«, meinte Askaya unheilvoll.
Alexander bekam eine Gänsehaut. »Kannst du das denn wirklich spüren?«
»Du nicht?« Die Ananeki schien verwundert.
»Askaya hat recht«, sagte Min. »Auch ich fühle, dass dort etwas Schreckliches geschehen ist.«
»Tod!«
Alle drehten sich zu Anna um. Alexander schluckte. Annas dunkle Augen wirkten glasig, schienen zu sehen, was ihm verborgen blieb. »Der Tod liegt über diesen Bäumen. Ich…«, Annas Stimme zitterte, »ich kann es ebenfalls spüren.«
»Die Zeit in den Tälern des Wissens hat vermutlich schlummernde Fähigkeiten in dir freigelegt«, vermutete Min.
»Vermutlich«, entgegnete Anna.
»Lasst uns hingehen. Aber seid leise!«, mahnte Askaya und lief weiter.
Am späten Nachmittag näherten sich die Gefährten schließlich einem kleinen Wäldchen jüngerer Eichen, das direkt vor dem großen Eichenwald lag. Mittlerweile konnten sie den Rauch auch deutlich riechen. Langsam und leise schlüpften Min und Askaya unter die Bäume und bedeuteten ihren Freunden, umsichtig zu sein. Alexander hielt den Atem an und setzte behutsam einen Fuß vor den anderen, immer peinlichst darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen. Auch Anna schlich leise durchs Unterholz. Der Wald wurde nach wenigen Schritten schon dunkler, nur spärlich drang Sonnenlicht durch die Baumkronen. Plötzlich raschelte etwas oben in den Bäumen. Erschrocken blickten sie hinauf, doch es war nur ein Vogel, der die Stille durchbrach. Genau diese Stille war es, die Alexander Unbehagen verursachte. Es war nicht die Stille des Waldes, wie sie sein sollte. Keine Vögel zwitscherten, keine Insekten surrten durch die Luft, keine Maus huschte vor ihren Füßen vorbei.
Ohne es zu bemerken, hatte Alexander unter seinen Umhang gegriffen und das Schwert herausgeholt. Anna wandte sich um und blickte auf die Klinge in seinen Händen. Sie schluckte und er legte einen Finger an seine Lippen. Viel lieber hätte er ihr tröstende Worte zugeflüstert, doch das traute er sich nicht, außerdem war er viel zu angespannt.
Der dunkle Wald wurde wieder etwas heller. Unmittelbar vor ihnen bahnten sich einige Sonnenstrahlen den Weg durch die Bäume, berührten zaghaft den Waldboden. Doch das Licht der Sonne wurde getrübt von Rauch, der langsam nach oben stieg. Der Geruch von schwelendem Holz lag in der Luft. Als sie den Rand des Waldes und damit die Lichtung erreichten, hob Askaya die Hand und ging in die Hocke. Langsam ließ sie den Blick über die frei Fläche schweifen. In der Mitte schwelten die Reste eines großen Feuers. Um das Feuer herum lagen Gestalten im Gras - tot und entsetzlich zugerichtet.
»Einarenwerk!«, flüsterte Askaya, richtete sich langsam auf und trat aus dem Schatten der Bäume hinaus. Die anderen folgten ihr. Auf der Lichtung war es stiller noch als eben im Wald und es bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Überall lagen die Leichen von Männern, Frauen und Kindern herum. Alexanders Hand schloss sich krampfhaft um das Heft seines Schwertes, sodass die Gelenke seiner Finger knackten. Askaya presste die Lippen aufeinander, Min hatte Tränen in den Augen. Rasch blickte Alexander zu Anna, die etwas abseits von ihm stand und sich gerade neben eine tote Frau kniete. Alexander trat näher, er schätzte, dass die Frau nicht älter war als Anna. Entsetzen spiegelte sich in Annas Augen, dennoch streckte sie eine Hand aus, zitternd und zögernd zugleich. Diese legte sie dem toten Mädchen, dessen Kleider schrecklich zerfetzt worden waren und in dessen Herz noch ein Speer steckte, auf den Kopf.
Ein heftiger Ruck lief durch Anna hindurch, als ihre Hand den Kopf des Mädchens berührte. Sie fühlte sich, als würde sie gegen eine Wand geschleudert werden, dann raste die Welt um sie herum. Genauso schnell wie es begonnen hatte, hörte es auch wieder auf. Anna sah das getötete Mädchen als es noch lebte, nein, sie war dieses Mädchen, erlebte durch dessen Augen das schreckliche Geschehen. Eine Gestalt, groß und schemenhaft, schoss auf sie zu, zu schnell, als dass sie hätte Genaueres erkennen können. Dennoch wusste Anna, um was es sich handelte: einen Einarenkrieger. Etwas traf sie ins Gesicht und schleuderte sie zu Boden. Der Aufprall war heftig, trieb ihr die Luft aus den Lungen. Sie versuchte sich aufzurappeln, hörte ein Kind schreien, und ein Ananekikrieger verteidigte sich tapfer gegen drei Einaren zugleich. Sein Stab surrte durch die Luft, krachte in einen Schädel, zertrümmerte ein Schienbein und trieb einem Gegner einen Dolch, der plötzlich in seiner Hand lag, durch die Kehle. Blut spritzte, dann kam der Speer, traf den Ananeki mitten in die Brust und hob ihn von den Füßen. Als er auf dem Boden aufschlug, war er auch schon tot. Die Ananeki fochten erbittert, rissen einige der Angreifer in den Tod, doch es waren der Feinde zu viele. Immer mehr strömten auf die Lichtung, Schreie ertönten, Kampfstöcke krachten auf Metall. Der Geruch von Blut, Schweiß und Gedärm breitete sich auf der Lichtung aus. Eine der hochgewachsenen Kreaturen kam auf sie zu. Anna betrachtete den ausholenden Arm des Einaren, dann raste der gewaltige Speer schon auf sie zu. Das Geschoss bohrte sich zwischen ihre Rippen. Die Wucht war so gewaltig, dass Anna zurückgerissen wurde und sich überschlug. Sie schaute noch in den Himmel, sah den Speer aus in ihrem Körper ragen, so als würde er sich nicht nur in ihre Brust, sondern auch in das endlose Blau bohren. Sie fühlte keinen Schmerz, als das Licht schwand. Entsetzen packte sie, sie wollte nicht sterben. Irgendjemand rief ihren Namen. Schrie ihn hinaus, verzweifelt und aus vollem Hals.
»ANNA!« Sie bäumte sich auf, riss ihre Hand zurück und wurde erneut nach hinten geworfen. Anna lag auf dem Rücken, blickte zum Himmel und dann in Alexanders Gesicht, das sich über sie beugte.
»Anna!«, rief Alexander, schob einen Arm unter ihre Schultern und half ihr auf. Sie atmete heftig, ihre Brust hob und senkte sich und ihre Augen waren weit aufgerissen.
»Es ist niemand hier«, versuchte Alexander sie zu beruhigen.
»Ich habe sie sterben sehen!«, schluchzte Anna und deutete auf das tote Mädchen. Tränen rannen dabei über ihr Gesicht. »Ich konnte den Kampf durch ihre Augen beobachten, es …«, ihre Lippen bebten, »es war fürchterlich. Ich war sie!«
Schon gut. Was auch immer du erlebt hast, es ist vorbei.« Sanft streichelte Alexander ihr über die Haare und Min legte Anna mitfühlend eine Hand auf die Schulter. Askaya stand etwas abseits und wirkte ebenso hart wie ihr Stock. Zornig ließ sie ihren Blick über die Toten schweifen, Männer, Frauen und Kinder, die Angehörige ihres Volkes gewesen waren. Doch auch in Askayas blauen Augen glitzerte es feucht.
»Ist es immer so?«, fragte Alexander.
»Seit zweitausend Sommern«, bestätigte Askaya. »Das Volk der Ananeki hat nur überlebt, weil es zerstreut in den Weiten Erenors umherstreift und weil die Ananeki gute Krieger und Kriegerinnen sind, und dennoch stets versuchen, den Kampf zu vermeiden. Diese hier«, ihre Stimme bebte, »haben es jedoch nicht geschafft.«
»Weshalb verbergen sich denn Ananeki, die keine Kriegerinnen des Feuers sind, nicht in den Tälern des Wissens?«, wollte Alexander wissen.
»Für eine gewisse Zeit mag das möglich sein«, antwortete Askaya. »Doch der drang nach Freiheit würde sie immer wieder erneut weiterziehen lassen.«
»Wir sollten weiterziehen«, drängte Min plötzlich. »Dieses Gemetzel hat erst vor kurzer Zeit stattgefunden. Das Blut ist noch nicht getrocknet.« Sie blickte auf ihre Fingerkuppen, die dunkelrot gefärbt waren, und säuberte sie dann rasch im Gras.
»Min spricht die Wahrheit«, stimmte Askaya zu. »Der Gestank der Einaren liegt noch immer in der Luft.« Die Ananeki wirbelte herum und wollte schon losstürmten.
»Aber wir können sie doch nicht einfach so liegen lassen«, protestierte Anna.
»Wie bestatten die Ananeki denn ihre Toten?«, wollte Alexander wissen.
»Jedem Ananeki ist es gestattet, seinen Körper so der Natur zurückzugeben, wie er es wünscht, ganz gleich, ob Feuer, Wasser oder Erde«, erklärte Min. »Nur bei uns, bei den Kriegerinnen der Sieben Feuer von Erenor, ist es anders. Die Araaken tragen uns in die nächste Welt.«
Verdutzt runzelte Alexander die Stirn.
»Ja, sie kommen und holen uns. So war es immer, so wird es immer sein«, bestätigte Askaya Mins Worte. »Sie bringen uns in ein fernes Land, über das weite Meer, in eine Welt der Unvergänglichkeit. Dort können unsere Seelen wählen, ob unser Geist verweilen oder in einen neuen Körper zurückkehren möchte.«
»Was ist mit ihren Seelen?« Anna deutete auf die Leichen, die auf der Lichtung lagen.
»Auch sie ziehen in die Unvergängliche Welt«, fuhr Askaya fort. »Doch nur den Kriegerinnen der Sieben Feuer wird die Ehre des Araaken zuteil. Ist der Araaken im Leben auch gefährlich und unberechenbar, so ist er im Tode für eine Kriegerin doch vorhersehbar.«
»Ihre Körper holt sich die Natur auf ihre Weise zurück«, sagte Min schließlich.
»Dennoch verstehe ich nicht, weshalb die Araaken die Ananeki-Kriegerinnen wegtragen, jedoch nicht die normalen Angehörigen eures Volkes.«
»Das wird wohl immer ein Rätsel bleiben«, erklärte Askaya. »Vielleicht tun sie es ja, um die besondere Aufgabe, derer wir uns verpflichtet haben, zu ehren.«
Anna nickte bedächtig, dennoch schien sie über etwas nachzudenken. »Was ist mit Elumiel, kann sie denn jemals in die Unvergängliche Welt zurückkehren?«
Min zuckte mit den Schultern und Alexander glaubte eine Spur von Traurigkeit in ihren Augen zu erkennen.
»Sie ist in einer anderen Welt gestorben. Niemand weiß, ob ihr Geist zurückfinden kann.«
»Und wenn doch, dann wagt ihr Geist es sicher nicht«, stieß Askaya hervor. »Denn selbst in der anderen Welt wäre ihr der Zorn ihrer Kameradinnen gewiss.«
Anna hob den Kopf. »Irgendwann muss man ihr doch verzeihen. Keiner kann ewig schuldig bleiben.«
Askaya erwiderte nichts, doch ein angespannter Zug lag um ihre Mundwinkel.
Min hingegen betrachtete Anna, als würde sie über ihre Worte nachdenken und so blieben Annas Worte für diesen Tag die letzten zu dieser Angelegenheit.
3. Gefahr
»Nun lasst uns weiterziehen! Wir müssen vermeiden, in einen Kampf mit den Einaren zu geraten. Es ist unsere oberste Pflicht, die Artefakte zurückzubringen«, verlangte Askaya und lief los. Doch noch bevor sie den Rand der Lichtung erreichten, hielt sie inne. Sie tat dies so unvermittelt und bestimmt, dass auch Alexander, Anna und Min augenblicklich erstarrten und in den Wald hineinspähten.
Nichts, kein verdächtiges Geräusch war zu hören. Oder etwa doch? Alexander drehte den Kopf leicht zur Seite und lauschte. Plötzlich raschelte es im Gehölz, Zweige knackten, Äste wurden bewegt. Etwas kam näher, noch war es nur ein Schemen unter den Bäumen.
»Sie kommen!«, flüsterte Askaya, griff langsam unter den Umhang und zog ihr Blasrohr hervor. Min tat es ihr gleich. Während Anna mit aufgerissenen Augen neben Alexander kauerte, wurde er selbst von einer eigentümlichen Mischung aus Panik und Kampfeslust ergriffen. Die Klinge fühlte sich gut an in seinen Händen.Dann traten sie aus dem Schatten der Bäume hervor - Einaren! Sie warteten, als wollten sie ihren Opfern Zeit lassen, sie zu betrachten, um all den Schrecken zu erfahren, den sie verbreiten würden. Alexanders Herz schlug schneller, als er die Einaren sah, seine Knie wurden weich. Groß waren sie, ein jeder von ihnen erreichte sicher zwei Meter. Mit erschreckender Faszination zogen sie Alexanders Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Gesichter waren schmal und länglich geschnitten. Die buschigen, weißen Augenbrauen standen schräg nach oben und zogen sich über der breiten und markanten Nasenwurzel zusammen, was ihnen ein grimmiges Aussehen verlieh. Die Augen waren dunkel, fast schwarz, die ungewöhnlich großen Pupillen in der Mitte erinnerten an Kohlen. Lediglich ein schmaler weißer Ring, der der Sichel eines Halbmondes glich, zeichnete sich am oberen Rand der Augäpfel schimmernd ab. Dunkle, ledrige Haut spannte sich über hohe, ebenfalls schräg nach oben laufende Wangenknochen. Aus den dicken, zumeist hüftlangen und schmutzig braunen Haaren ragten spitz zulaufende Ohren heraus. Zu Alexanders Erstaunen waren diese beweglich und die Einaren legten sie nun zornig zurück. Dann kamen sie näher, langsam aber bedrohlich. Zerrissene Umhänge, aus Leder, wie Alexander vermutete, berührten fast das niedergetretene Gras der Lichtung. Verkrustet von Schmutz und Blut verbreiteten die Mäntel einen scheußlichen Gestank: süß, schwer, ekelerregend. Wie Aas. Todesverheißend hielten klauenbewehrte Hände hielten massive Holzspeere gepackt.
Einer der Einaren kniff die Augen zu Schlitzen zusammen, sodass die weiße Sichel verdeckt wurde. Dann duckte er sich zum Sprung. Alexander hörte ein Zischen, und Pfeile aus Askayas und Mins Blasrohren rasten auf die Feinde zu. Diese wirbelten herum und die Pfeile wurden einfach von den verschlissenen Umhängen beiseite gefegt. Neue Pfeile folgten, einer traf schließlich das Auge eines Gegners, ein anderer grub sich in seinen Hals. Schon stürmten die Einaren herbei, mehr als ein Dutzend rannte auf die Lichtung. Keine Zeit mehr für Blasrohre, keine Zeit zur Flucht. Der Kampf begann. Ein Einar, aus dessen blutigem Auge noch ein Pfeil ragte, schleuderte einen Speer. Alexander wich aus, der Speer flog ins Leere. Sofort ragte der Gegner über ihm auf und hieb mit den Klauen nach ihm. Alexander tauchte weg, sein Schwert zuckte nach vorne, so wie er es einen Winter lang geübt hatte. Er traf nur den Mantel, stieß mit aller Kraft erneut zu und fühlte wie Haut und Fleisch nachgaben. Der Einar sackte zu Boden. Alexander setzte nach, zögerte, was ihm fast zum Verhängnis geworden wäre, den der Gegner riss einen Dolch unter seinem Mantel hervor. Sofort rammte Alexander dem Einaren das Schwert in die Kehle. Er hatte Glück gehabt, denn der Einar war durch den Pfeil in seinem Auge beeinträchtigt.
Alexander blieb keine Zeit zum Nachdenken, denn schon griff der Nächste an und stach mit dem Speer nach ihm. Er wich im letzten Moment zur Seite aus. Dann deckte ihn sein Gegner mit Schlägen ein und er musste zurückweichen. Er glitt zur Seite, versuchte zu parieren, musste jedoch feststellen, dass das kaum möglich war. Die wuchtigen Hiebe prellten seine Gelenke und das Schwert wurde ihm beinahe aus den Händen geschlagen.
Wieder zuckte der Speer nach vorne, Alexander wich aus. Die Waffe stach ins Leere, wurde jedoch kraftvoll und in einem Bogen herumgerissen und raste seitlich auf Alexander zu. Nur im letzten Moment brachte er das Schwert zwischen sich und die Waffe seines Gegners. Der Aufprall war so hart, dass er zurückgeworfen wurde. Zorn brandete plötzlich in Alexander hoch, heiß wie Feuer. Er schlug zu, schneller und schneller. Ein Streich ritzte die Haut seines Gegners auf, sofort nutzte er die Chance und hieb weiter auf seinen Angreifer ein. Beinahe war es befriedigend zu spüren, wie sein Schwert in den Körper des Feindes schnitt. Die Klinge in seinen Händen fühlte sich nun besser an.
Dann jedoch erinnerte er sich an Anna. Wo war sie? Rasch wirbelte er herum und entdeckte sie schräg hinter sich, wo sie von einem Einaren bedrängt wurde.
Anna wurde klar, dass sie ihren Angreifer nicht würde besiegen können. Zwar gelang es ihr, zurückzuweichen und so ein wenig Distanz zu wahren, doch die Schläge waren zu hart, als dass sie diese hätte abwehren oder gar blocken können. Sie versuchte, immer wieder wegzutauchen, um die gegnerische Waffe an sich vorbeigleiten zu lassen. Sie hasste den Kampf, hasste es, zu töten. So zog sie sich weiter zurück, bis sie über etwas stolperte und beinahe zu Boden gefallen wäre. Es war der Körper jenes Mädchens, auf dessen Kopf sie vor wenigen Augenblicken ihre Hand gelegt hatte. Anna presste verzweifelt die Lippen aufeinander und fasste sich ein Herz. Sie rappelte sich auf und griff an, ließ den Stock durch die Luft kreisen. Ihr Gegner jedoch wehrte mühelos ab. Eine tödliche Intelligenz funkelte in den schwarzen Augen mit den weißen Sicheln. Anna gelang es nicht, ihn auch nur ein einziges Mal zu treffen. Plötzlich griff sich der Einar an den Hals. Ein kleiner Dolch ragte daraus hervor. Ein Blick zu Min zeigte ihr, dass die Ananeki das Messer geworfen hatte. Geistesgegenwärtig schlug Anna dem Einar den Stock auf den Schädel und er fiel, wurde jedoch von einem anderen ersetzt.
Alexander stürmte los und eilte Anna zu Hilfe, die von einem weiteren Einaren zurückgetrieben wurde. Es gelang ihm, den Gegner durch einen seitlichen Angriff zu überraschen. Mit aller Kraft schlug er dem Einaren auf die Hand. Der Getroffene ließ seinen Speer fallen, schrie auf und wirbelte herum. Sofort stieß Alexander seine Klinge nach oben und trieb dem Feind sein Schwert durch die Kehle. Blut spritzte, mit einem gurgelnden Laut brach der Einar zusammen.
Rasch zog er Anna mit sich und hielt nach Askaya und Min Ausschau.
Er entdeckte sie. Die beiden waren umzingelt von Feinden. Einige ihrer Gegner lagen jedoch bereits tot am Boden. Vielleicht zum ersten Mal überhaupt begriff Alexander, wie ausgereift und vollkommen die Kampfkünste der Ananeki waren. Die Stöcke der zwei Kriegerinnen sausten kaum mehr sichtbar durch die Luft, lenkten Speere ab, schlugen zu. Blitzschnell wirbelten die Kriegerinnen herum und die Systóras in ihren Haaren zuckten wie giftige Schlangen nach vorne. Prompt fuhr Askayas Dolch durch eine Kehle, der Gegner hatte keine Zeit zu schreien: Ein Schlag mit dem Stock aus dem Holz von Sanduril folgte unmittelbar, zertrümmerte ihm den Schädel. Es war ein wilder Schlagabtausch, zwei weitere Einaren gingen blutüberströmt zu Boden. Doch die Einaren waren in der Überzahl und hatten längst begriffen, dass dies keine harmlosen Gegner waren. Rasch trieben sie die beiden junden Frauen auseinander. Einer von ihnen tauchte plötzlich ab und fegte Mins Beine weg, bevor diese reagieren konnte. Min wurde zu Boden geschleudert und ein tödlicher Speer folgte, um ihr den Garaus zu machen. Im letzten Moment rollte Min zur Seite, der Speer drang neben ihr tief in den Boden ein. Die Ananeki sprang auf, schmetterte ihren Stock gegen das Knie ihres Widersachers. Der Einar schrie, fuhr seine Klauen aus und hieb nach dem Bein der jungen Frau, zerfetzte einen Teil ihrer Hose und sofort zeichneten sich fünf blutige Spuren auf Mins Haut ab.
Einen Kampfschrei ausstoßend stürzte sich Alexander auf den Einaren. Einen Schlag nach dem anderen ließ er auf seinen Feind niederprasseln. Er täuschte an, hieb zu und blockte. Endlich machte sein Gegner einen entscheidenden Fehler und legte sich zu weit in den Schlag. Sofort machte Alexander einen Schritt zur Seite, riss die Klinge empor und zog sie mit aller Macht wieder nach unten. Er fühlte, wie seine Bauchmuskeln sich anspannten, als er sein Schwert mit voller Wucht in den Hals des Einaren schlug und dessen Kopf abtrennte.
Die Klinge in seinen Händen fühlte sich berauschend an.
Unweit von ihm krachte Askayas Stab gegen den Arm eines Einaren. Sofort sprang Min herbei, drehte sich und die Dolche in ihren Haaren schnitten durch das Gesicht des Angreifers. Dann sauste ihr Stab nach vorne, zertrümmerte den Kehlkopf des Gegners. Verbissen warfen sie sich den Angreifern entgegen, doch mit jedem der Einaren wurde es schwieriger. Mit brutaler Kraft schlugen ihre Feinde zu und trieben die Freunde zurück. Die Schläge waren nicht nur kraftvoll, sondern wurden immer schneller. Dann ertönte ein Brüllen. Unverständlich und laut hallte es vom Rande der Lichtung zu ihnen herüber. Kurz stoppte der Kampf und aller Augen erfassten einen Einaren, der doppelt so breit war wie die anderen. Seine Haare wallten wie weißer Rauch über seine Schultern, während er auf die Gefährten zu stürmte. Sein Angriffsschrei stachelte auch seine Kampfgefährten weiter an.
Annas Arme schmerzten höllisch, sie konnte den Stock kaum mehr halten. Schweiß rann an ihrem Körper hinab, der Geruch des Blutes und der Schrecken des Kampfes brachten sie zum Würgen. Sie stolperte rückwärts, als der weißhaarige Feind auf sie und ihre Freunde zu rannte. Doch noch bevor dieser sie erreichte, attackierte sie ein anderer Einar. Ehe Anna reagieren konnte, tauchte eine blutige, von hinten gestoßene Klinge aus der Brust des Angreifers auf. Als er zusammenbrach, blickte Anna in Alexanders Augen. Ein Schrecken durchfuhr sie, als sie dort etwas sah, das ihr nicht gefiel. Sie schluckte und riss sich davon los. Anna wollte nicht mehr kämpfen, sie hatte genug davon.
Auch Alexander begriff schließlich, dass sie hier weg mussten. Der Weißhaarige hatte sich auf Min gestürzt. Die Ananeki jedoch war verletzt und würde sicher nicht mehr lange durchhalten. Jeder Hieb des weißhaarigen Einaren drängte sie zurück. Nur Askaya kämpfte mit einer Leidenschaft, die an Besessenheit grenzte.
»Wir müssen fliehen!«, schrie Min plötzlich, doch Askaya schüttelte grimmig und entschlossen den Kopf.
»Askaya!«, rief nun auch Anna. Askaya reagierte nicht. Zu viert versuchten sie, eine Front zu bilden, doch es waren noch immer acht Einaren, einschließlich des Weißhaarigen, die nun versuchten, sie einzukreisen.
»Alexander, Anna, lauft!«, brüllte Min erneut, ihre dunkelblonden Haare waren schweißverklebt. Alexander zögerte kurz. Schon schnellte der Weißhaarige nach vorne, direkt auf Askaya zu. Die Ananeki reagierte sofort, doch die Wucht eines gegnerischen Schlages warf sie zurück.
Min ergriff die Gelegenheit, packte Askaya grob an der Schulter und schlug ihr plötzlich mit der flachen Hand ins Gesicht.
»Wir müssen weg! Um unser aller Leben und der Artefakte willen, Asakya! Wir müssen fliehen!«
Askayas Augen funkelten zornig, dann schien sie sich jedoch endlich zu besinnen und nickte knapp.
Die vier wandten sich ab und rannten in den Wald, verfolgt von Einaren. Min hinkte, Blut rann an ihrem rechten Bein herab. Alexanders Lungen brannten und auch Anna war schweißgebadet. Auf ihrer Haut hatten sich rote Flecken gebildet. Sie hechteten durch das Unterholz, setzten über einen umgestürzten Baumstamm hinweg und stolperten durch einen Bach. Alexander sah dunkle Schemen im Wald. Die Einaren folgten und sie taten dies erstaunlich leise.
Ein Ast schlug ihm schmerzhaft ins Gesicht, doch er achtete nicht darauf. Die beiden Ananeki-Kriegerinnen sprangen über einen weiteren Baum und in eine Senke. Abrupt hielt Askaya an, wandte sich um und legte sich auf den Bauch. Sie bedeutete den anderen, es ihr gleichzutun. Sofort hielten Askaya und Min ihre Blasrohre in den Händen und spähten in den Wald. Schon tauchten zwei Einaren auf und die Ananeki schossen die Pfeile ab. Die Krieger taumelten, doch die Geschosse fügten ihnen kaum Schaden zu.
»Lauft weiter, ich lenke sie ab«, rief Askaya. »Wir haben keine andere Wahl. Geht und bringt die Gläser in Sicherheit!« Sie stieß Min an, als diese etwas erwidern wollte. Dann sprang sie auf, packte ihren Stock und stürmte den Einaren entgegen.
Min presste die Lippen aufeinander und sah Askaya hinterher. Kurz schien sie zu überlegen, ob sie ihrer Gefährtin folgen sollte.
»Los«, rief sie schließlich und rannte mit Alexander und Anna weiter durch den Wald.





























