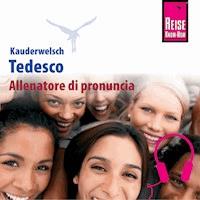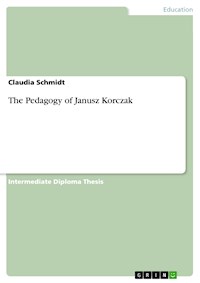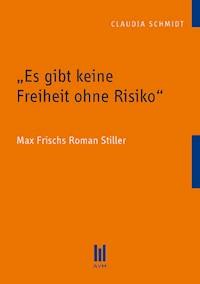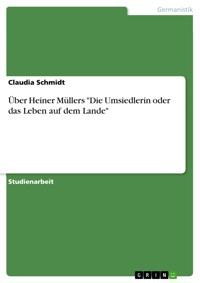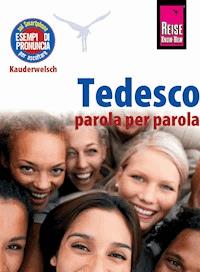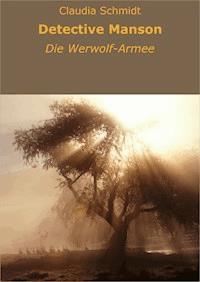Die Figur der Lucretia in der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts E-Book
Claudia Schmidt
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit bietet eine umfassende Analyse der Rezeption des Lucretia-Stoffes in der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. Im ersten Teil wird hierzu auf die antiken Quellen sowie die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Überlieferungen eingegangen. Der Hauptteil der Arbeit setzt sich u.a. mit den Fragen auseinander, welche Quellen die Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts nutzten und welcher Art von Interpretation sie folgten oder inwiefern sie den Stoff neu deuteten. Bemerkenswert ist vor allem die signifikante Verstärkung der Beschäftigung mit Lucretia in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Zu nennen sind hier insbesondere die Lucretia-Tragödien von Hans Sachs und Heinrich Bullinger, deren literarische Gestaltung ausführlich analysiert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Gliederung
1. Forschungsstand und Vorgehensweise
2. Lucretia in der Antike
2.1. Früheste Quellen und die Frage nach der Historizität der Lucretia-Geschichte
2.2. Livius
2.3. Ovid
2.4. Dionysios von Halikarnass
2.5. Weitere antike Quellen
2.6. Interpretationsansätze
2.6.1. Die Bewertung von Vergewaltigungen innerhalb der römischen Gesellschaft
2.6.2. Vergewaltigung als Bestandteil der römischen Frühgeschichte
2.6.3. Lucretia als Exemplum weiblicher Tugend
2.6.4. Brutus als Begründer der römischen Republik
2.6.5. Collatinus als „dummer Junge“
3. Lucretia in Spätantike und Mittelalter
3.1. Christliche Umdeutungen: Augustinus und die Gesta Romanorum
3.2. Die Lucretia-Novelle in der Kaiserchronik
3.3. Lucretia und die Humanisten – das Wiederaufleben der antiken Erzählung
4. Lucretia in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: das 16. Jahrhundert
4.1. Bernhard Schöfferlins „Römische Historie“ (1505)
4.2. Ludwig Binder „Diß Lied sagt Von Lucretia“ (zwischen 1520 und 1530)
4.3. Der Lucretia-Stoff im Werk des Hans Sachs
4.3.1. Die „Tragedia. Von der Lucretia“ (1.1.1527)
4.3.2. „Die keusch Römerin Lucrecia erstach sich selber, ir er zw retten“ (22.10.1548)
4.3.3. Spruchgedicht: Die Klagerede Lucretias (ohne Datierung)
4.4. Lucretia, Tell und die Revolution: Schweizer Besonderheiten
4.4.1. Das Urner Tellenspiel (1512)
4.4.2. Heinrich Bullingers Lucretia-Tragödie (1533)
4.5. Jakob Ayrer: „Tragedi. Vierter Theil; von Servii Tulii Regiment vnnd Sterben, darinnen der Schönen Lucretia Hystori begriffen“ (1598)
4.6. Die neulateinischen Lucretia-Tragödien: Friedrich Balduin (1597), Samuel Junius (1599) und Joachim Jungius (1602)
4.6.1. Friedrich Balduin: Lucretia (1597)
4.6.2. Samuel Junius: Lucretia (1599)
4.6.3. Joachim Jungius: Lucretia (1602)
4.7. Zusammenfassung des 4. Kapitels
5. Lucretia in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: das 17. Jahrhundert
5.1. Wolfgang (Marianus) Rot: Lucretia. Ein kurtze Tragoedi (wahrscheinlich zwischen 1625 und 1637)
5.2. Johann Peter Titz: Lucretia (zwischen 1642 und 1647)
6. Schlussbetrachtungen
7. Bibliographie
7.1. Quellen / Quellenkommentare / Repertorien:
7.2. Darstellungen
1. Forschungsstand und Vorgehensweise
Es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass Lucretias Bekanntheit in den letzten hundert Jahren rapide abgenommen hat. Die Geschichte ihrer Vergewaltigung, der darauf folgenden Auflehnung gegen das Herrschaftsgeschlecht der Tarquinier, deren Absetzung und der Beginn der römischen Republik war während der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit jedem bekannt. Sie besaß für die Römer eine enorme politische und moralische Bedeutung.[1] Später wurde sie in Literatur, Musik[2] und bildender Kunst[3] dargestellt und war ein häufig genutztes Exemplum[4]. So wurde Lucretia im Mittelalter zu einem „nahezu unangefochtenen Vorbild“ weiblicher Tugendhaftigkeit.[5] Nur vereinzelt äußerte sich christliche Kritik am Selbstmord Lucretias. Der Umstand der Vertreibung der Tarquinier wiederum wurde in Fürstenspiegeln u.ä. als Mahnung an die Herrschenden verwendet, sich nicht in gleicher Weise zu verhalten.[6]
Hieran sieht man bereits, dass sich der Lucretia-Stoff durch seine Mehrdimensionalität auszeichnet. Es geht nicht allein darum zu zeigen, wie sich eine vorbildliche Frau verhält, sondern auch darum, wie sich ein vorbildlicher Mann oder ein vorbildlicher Politiker verhalten sollte. Zu diesem Zweck wird mit dem Gegensatz von positivem und negativem Muster gearbeitet. Den positiven, nachahmenswerten Vorbildern (Lucretia, Brutus) werden die negativen, nicht zu befolgenden Vorbilder (die Frauen der Königssöhne, Tarquinius, Sextus) zur Seite gestellt. Neben diesen moralischen und politischen Aspekten der Geschichte war es natürlich vor allem die erotische Komponente, die den Schriftstellern und Dichtern immer wieder Anlass bot, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Es ist in diesem Zusammenhang besonders bemerkenswert, dass der Stoff besonders häufig für jüngere Literaten von Interesse war. Von den in dieser Arbeit betrachteten deutschen Autoren ist die Mehrheit jünger als 30 Jahre und z.T. stellt ihre Lucretia-Bearbeitung ihr Erstlingswerk dar.[7] Galinsky mutmaßt, dass es der „erschütternde erotische Inhalt“ und „die revolutionäre Tendenz“, ebenso aber auch die Zugehörigkeit zum „antiken Kulturgut der Schul- und Universitätsbildung“ gewesen seien, die den Lucretia-Stoff gerade für junge Schriftsteller so reizvoll machte und einen beliebten Gegenstand für erste dichterische Versuche abgab.[8]
Versucht man nun, sich dieser Tradition – und handelt es sich auch „nur“ um zwei Jahrhunderte innerhalb eines geographisch begrenzten Rahmens – zu nähern, so ist es unumgänglich, die Ursprünge und Entwicklungslinien nachzuvollziehen.
In den Bereich der klassischen Philologie aber auch der Alten Geschichte fällt die Beschäftigung mit den antiken Quellen. Insbesondere der Geschichtsschreibung des Livius und dessen Darstellung der römischen Frühzeit wurde in den vergangenen Jahrzehnten große Beachtung geschenkt.[9] Seine Lucretia-Geschichte war häufig Ausgangspunkt feministischer Untersuchungen.[10]
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Rezeption der Lucretiageschichte in der neuzeitlichen Literatur beschränkt sich in den meisten Fällen auf Einzelntersuchungen zu den Werken bzw. Autoren.[11]
Ausnahmen bilden Darstellungen, die sich mit der Stoffgeschichte befassen oder versuchen, die Lucretia-Literatur einzelner Epochen oder Länder zusammenhängend darzulegen.[12]
Einen besonders wertvollen Beitrag in dieser Hinsicht leistete Hans Galinsky mit seinem 1932 erschienenen Buch „Der Lucretia-Stoff in der Weltliteratur“.[13] Es bietet den vollständigsten Überblick zu diesem Thema, der bis heute in deutscher Sprache erschienen ist. Bemerkenswert ist die Vorgehensweise Galinskys, der sich mit Hilfe von verschiedenen Komponenten dem Lucretia-Stoff chronologisch nähert. Bei diesen von ihm ausgemachten Komponenten handelt es sich um folgende: 1. die historische Komponente; 2. die römische Komponente; 3. die erotische Komponente; 4. die sozial-politische Komponente; 5. die sittlich-lehrhafte Komponente; 6. die sittlich-widerchristliche Komponente; 7. die elegisch / tragische Komponente und schließlich 8. die Stimmungskomponente. Für Galinsky sind diese Komponenten die Einzelzüge, welche die Struktur des Stoffes in seiner jeweiligen dichterischen Realisation bilden.[14] Sie sind gleichsam die „Ansatzflächen der vom Stoff angezogenen Zeitkräfte“ und weisen somit auf die Gegebenheiten des betreffenden geistesgeschichtlichen Zeitalters zurück.[15]
Galinsky stellt also weniger die Wandlungen des Lucretia-Stoffes dar, als vielmehr die Wandlungen des Zeitgeistes, indem er diesen mit Hilfe der jeweiligen Lucretia-Dichtungen aufzudecken versucht.
Was kann die folgende Arbeit im Vergleich zu dem umfassenden Werk Galinskys leisten? Einige der in den von mir betrachteten Zeitraum fallenden Tragödien galten für Galinsky als verschollen,[16] so dass er sie nicht einbeziehen konnte. Diese wurden inzwischen jedoch wieder entdeckt und z.T. in jüngster Zeit veröffentlicht.
Außerdem musste sich Galinsky aufgrund seines universellen Anspruchs auf eine ökonomische Darstellung beschränken, wobei den meisten Texten nur wenig Platz eingeräumt werden konnte. Der zeitliche Rahmen meiner Arbeit ist enger gesteckt und kann daher stärker ins Detail gehen.
Aufgrund der Beschränkung auf zwei Jahrhunderte der deutschen Literatur erschien es mir ratsam, die Lucretia-Dichtungen nicht entsprechend der von Galinsky dargestellten Komponenten zu gliedern[17], sondern sie strenger chronologisch anzuordnen. Auf diese Weise können nicht nur eventuelle Abhängigkeiten sondern auch zeitliche Koexistenzen völlig verschiedener Ansätze zur literarischen Umsetzung des Lucretia-Stoffes deutlicher gemacht werden. Zudem fällt es leichter, die Veränderungen der historischen Rahmenbedingungen übersichtlicher darzulegen. Diese sollen einbezogen werden, insofern sie Auswirkungen auf die jeweilige Dichtung hatten.
Wie bereits angemerkt, kann jedoch die deutsche Lucretia-Dichtung des 16. und 17. Jahrhunderts nicht isoliert betrachtet werden. Besonders wichtig erschien es mir, die bedeutendsten antiken Quellen einzubeziehen. Dies geschieht recht ausführlich, um bei der Besprechung der jüngeren Texte mit kurzen Bemerkungen die Parallelen zu den ursprünglichen Texten deutlich zu machen, ohne jeweils stückweise einzelne Passagen wiedergeben zu müssen.
Zudem ist die Interpretationslage hinsichtlich der ältesten Quellen recht gut und bietet eine Art Grundstock möglicher Perspektiven der Geschichte. In dem Kapitel, das sich mit diesen verschiedenen Interpretationen auseinandersetzt, bin ich zwei Vorgehensweisen gefolgt.
Einerseits geht es darum, den antiken Verstehenshintergrund herauszuarbeiten. In diesem Rahmen wird gefragt, welche Bedeutung Vergewaltigungen innerhalb der antiken Gesellschaft und innerhalb der römischen Geschichtsschreibung besaßen.
Andererseits soll in einem zweiten Teil das Markante oder aber Widersprüchliche einzelner Figuren herausgearbeitet werden. Hierbei beschränke ich mich auf Lucretia, Brutus und Collatinus.[18] Diese Charakterisierungen, die wiederum anhand der antiken Texte erfolgen, sollen als Vergleichsmaterial für die späteren Lucretia-Bearbeitungen genutzt werden: Inwieweit bleiben die Charaktere die gleichen bzw. werden den jeweiligen historischen Lebenswelten angeglichen?
Der Abschnitt zu den Interpretationen der antiken Lucretia-Geschichte dient also in erster Linie dazu, deren Vielschichtigkeit an den Ursprungstexten zusammenfassend darzulegen, um davon ausgehend an den späteren Rezeptionen zu zeigen, inwiefern diese Vielschichtigkeit erkannt bzw. ignoriert wurde. Letztendlich ähnelt diese Vorgehensweise der von Galinsky befolgten, doch soll der Verzicht auf die Strukturierung durch die verschiedenen Komponenten vor allem den Trugschluss vermeiden, dass z.B. die „moralische Komponente“ dasselbe für die Antike wie für die Frühe Neuzeit bedeute.[19]
Nach der Beschäftigung mit den antiken Quellen und deren Interpretationen, folgt ein Kapitel zur Spätantike und zum Mittelalter. Augustinus ist dabei der einzige Vertreter der spätantiken Lucretia-Überlieferung. Er wird gemeinsam mit den mittelalterlichen Gesta Romanorum betrachtet, da beide Texte als bedeutende Beispiele für die christliche Perspektive auf die Lucretia-Geschichte gelten können. Es ist m.E. notwendig, diese Brechung des positiven Lucretia-Bildes aufgrund des christlichen Wertekanons, der den Selbstmord verurteilt, in meine Arbeit aufzunehmen. Allerdings tat die von Augustinus geäußerte Kritik der Vorbildwirkung der Lucretia in den folgenden Jahrhunderten keinen Abbruch.
Neben den Gesta Romanorum soll als zweites Beispiel für die Rezeptionsgeschichte innerhalb des Mittelalters die Lucretia-Novelle in der Kaiserchronik betrachtet werden, welche als erste deutschsprachige Bearbeitung des Stoffes eine außergewöhnliche Position innerhalb der Tradition einnimmt.
Daran anschließend soll die Zeit des Humanismus und die damit verbundene Hinwendung zur antiken Literatur hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Lucretia-Stoff in den Blick genommen werden. Diese Wiederentdeckung der antiken Literatur und die in jener Zeit geleisteten Übersetzungsarbeiten waren schließlich Grundstein für die Beschäftigung mit der Lucretia-Geschichte im 16. und 17. Jahrhundert.
Im 4. Kapitel folgt der Hauptteil der Arbeit: Lucretia in der Frühen Neuzeit.
Diese chronologische Vorgehensweise versucht die deutschen Lucretia-Bearbeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts in die Tradition der Überlieferung einzuordnen, wobei sich auf die wichtigsten Stufen beschränkt wurde (Antike, christliche Umdeutungen, humanistische Wiederentdeckung der Antike). Auf eine Einordnung innerhalb der nicht-deutschen Bearbeitungen der Frühen Neuzeit wird verzichtet. Einige der zu jener Zeit außerhalb des deutschen Sprachraums entstandenen Lucretia-Texte, wie etwa die englischen Lucretia-Texte Shakespeares oder Heywoods, werden an gegebener Stelle erwähnt. Allerdings zeigte sich in der Auseinandersetzung mit der deutschen Lucretia-Tradition, dass selten konkrete Verbindungen zu jenen Lucretia-Übertragungen vorliegen.
Auf diese Weise soll ein möglichst konkretes Bild der Besonderheiten wie auch der Normalitäten der Beschäftigung mit dem Lucretia-Stoff innerhalb der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts nachgezeichnet werden.
2. Lucretia in der Antike
2.1. Früheste Quellen und die Frage nach der Historizität der Lucretia-Geschichte
Die ältesten, uns überlieferten Quellen stammen aus der Zeit des Augustus. Die Historiker Dionysios von Halikarnass, Diodorus Siculus und Livius sowie der Dichter Ovid berichten beinahe zeitgleich von der Geschichte Lucretias. Die Überlieferungstradition reicht jedoch über diese Autoren hinaus zurück in die Zeit der Republik. Doch fehlen uns die älteren Quellen, da gerade die bedeutenden Schriftwerke der augusteischen Zeit diese verdrängten.[20]
Es steht fest, dass Livius und Dionysios am Ende einer langen Reihe von Annalisten stehen, die in ihren Werken jeweils die Geschichte Roms von Beginn an darzustellen versuchten.[21] Dementsprechend vielfach muss auch die Lucretia-Geschichte überliefert worden sein.
Dionysios von Halikarnass nutzte Fabius Pictor als Quelle. So nennt er ihn auch konkret bei seinen Überlegungen hinsichtlich der Abstammung des Collatinus.[22] Dies läßt darauf schließen, dass bereits Fabius Pictor über Lucretia geschrieben haben könnte. Jedoch muss die Frage nach der Funktion und Gestaltung der Lucretia-Geschichte bei Fabius Pictor ebenso wie die Frage, „ob er sie schon in der mündlichen oder schriftlichen Tradition vorgefunden hat, [...] ungeklärt bleiben“.[23]
Die Forschung geht davon aus, dass die Lucretia-Legende im zweiten Jahrhundert v.Chr. allgemein verbreitet war[24], so soll sie z.B. auch von Accius (ca. 170-90 v.Chr.) in einem uns nicht erhaltenen Brutus-Drama dargestellt worden sein.[25]
Harald Geldner beschäftigt sich in seiner Studie zur Lucretia- und Verginia-Sage[26] ausführlich mit den Belegstellen und vor allem mit den Parallelen zu Motiven aus der griechischen Literatur. Er kommt bezüglich der Tradierung des Stoffes zu dem Schluss, dass es sicherlich bereits „vor der eigentlichen römischen Literatur eine mündliche Überlieferung und die Annalen [gab C.S.], die vielleicht schon einzelne Züge aus den Sagen der Königszeit und Republik kannten.“[27] Diesen Stoff wiederum benutzten die ältesten römischen Geschichtsschreiber, fügten Elemente aus dem griechischen Bereich hinzu und schufen auf diese Weise eine Geschichte des frühen Roms, die der Griechenlands ebenbürtig war. Daran anschließend gestalteten die römischen Tragiker, wie z.B. Accius, den von den Historikern vorgegebenen Stoff dramatisch aus. Diesen folgend nutzten dann jüngere Geschichtsschreiber wie Livius sowohl die Texte der älteren Historiographen als auch die der Tragiker, wodurch „die römische dramatische Geschichtsschreibung ihren Höhepunkt“ in der augusteischen Zeit fand.[28]
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Geschichtlichkeit der beschriebenen Ereignisse. Geldner führt die verschiedenen Meinungen der Geschichtsforschung des 19. und 20. Jahrhunderts auf und stellt fest, dass seit dem Historismus ein Zweifel bzw. eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der Historizität der Lucretia-Geschichte vorherrscht.[29] Allenfalls hielt man den historischen Hintergrund nicht aber die Lucretiasage selbst für glaubwürdig. Ausnahmen bilden A. Schwegler[30] sowie der Livius-Kommentator R.M. Ogilvie[31]. Letzterer beantwortet die Frage recht nachdrücklich: „In any case the tradition is too well established to be doubted seriously and speculations which endeavour to make the stories of Lucretia and Virginia mere late elaborations of legends related to the cults of Ardea, transplanted to Rome at the end of the fourth century, or aetiological myths associated with the shrine of Venus Cloacina, can be discounted.“[32]
Obwohl Ogilvie den Selbstmord als historisches Faktum ansieht, nimmt er an, dass verschiedene unhistorische Personen in den Stoff eingewoben wurden und deutliche Anklänge griechischer Vorlagen vorhanden sind.[33]
Cornell ist der Meinung, dass man die Vergewaltigung der Lucretia nicht als Fiktion abtun könne, insofern man keine Möglichkeiten besitzt, diese Ansicht zu belegen.[34] Stattdessen plädiert er dafür, die Revolte als innerdynastische Auseinandersetzung anzusehen. Für ihn ist der Umstand bemerkenswert, dass Brutus und Collatinus, als Anführer der Auflehnung, so eng mit den Tarquiniern verwandt sind.[35] Doch daraus ergeben sich neue Fragen. Warum ging es ihnen dann nicht einfach nur darum, selbst König zu werden? Weshalb kam es zu einem Verfassungswechsel? Und wieso musste Collatinus aufgrund seiner Verwandtschaft mit den Tarquiniern sein Konsulamt aufgeben und Brutus nicht? Diese Fragen wurden schon von Livius nicht beantwortet – oder aber von ihm zum ersten Mal ausgespart. Bei Dionysios wird man sehen, dass er die politischen Umstände genauer darstellt. Ob daher seiner Version des Geschehens mehr Glauben zu schenken ist, kann nicht mit Sicherheit bejaht werden. Doch wurde diese Problematik in späterer Zeit selten erkannt, so dass die neuzeitlichen Dichter recht einheitlich auf Livius und dessen Verehrung des Brutus als Vertreiber des Tyrannen zurückgriffen.
Hinsichtlich der Historizität des Lucretia-Stoffes kann man zusammenfassen, dass sowohl die Skeptiker als auch die wenigen Befürworter einen mehr oder minder großen „historischen Kern“ annehmen. Welche Partien der Lucretia-Geschichte von den einzelnen Forschern als wahr und welche als erdacht angesehen werden, kann im Einzelnen an dieser Stelle nicht erläutert werden, zumal sich das Zugeständnis in den meisten Fällen nur auf die lapidare Aussage des Vorhandenseins eines solchen „Kerns“ beschränkt, ohne selbigen weiter auszuführen.
In den folgenden Kapiteln sollen die wichtigsten antiken Quellen zur Lucretia-Geschichte zu Wort kommen. Der bereits genannte Diodorus Siculus wird hierbei ausgespart, da er in der späteren Rezeption keine Beachtung fand. Die wichtigsten beiden Quellen für die nachfolgenden Generationen waren Livius und Ovid. Die Darstellung der Lucretia-Geschichte bei Livius wird am ausführlichsten zu untersuchen sein, da sie die Nachwelt aufgrund der „schönen und schwungvollen“ Erzählweise am stärksten prägte.[36] Bei dem anschließenden Kapitel zu Ovid wird es in erster Linie um die Unterschiede im Vergleich zur livianischen Gestaltung gehen. Dionysios von Halikarnass wurde erst seit dem 16. Jahrhundert rezipiert. Seine Umsetzung der Geschichte soll als drittes betrachtet werden, da sie z.T. sehr auffallende Abweichungen enthält. Schließlich sollen noch einige weitere antike Versionen der Lucretia-Geschichte benannt werden, insofern sie über die einfache Wiederholung der Darstellung bei den drei bereits genannten Autoren hinausgehen oder in späteren Epochen stark rezipiert wurden.
2.2. Livius
Das erste Buch des livianischen Geschichtswerkes „Ab urbe condita“ beginnt mit der Ankunft des Aeneas in Italien und endet mit der Vertreibung der Tarquinier und der Einsetzung der ersten Konsuln (509 v.Chr.).
Den Anfang macht die „Vorgeschichte“: all jene Ereignisse die der Gründung der Stadt Rom vorausgingen, so z.B. die Gründung der Städte Lavinium und Longa Alba durch Aeneas bzw. seinen Sohn Askanius, eine kurze Zusammenfassung aller danach herrschenden Könige und schließlich die Geschichte von Rhea Silvia – der Mutter der Zwillinge Romulus und Remus, womit Livius unmittelbar am Ausgangspunkt seines „eigentlichen“ Anliegens angekommen ist. Viele Passagen, sowohl der Vorgeschichte wie auch der Gründung Roms, gehören in den Bereich des Sagenhaften. Livius selbst erwähnt in seiner Vorrede: „Was vor der Gründung der Stadt oder dem Plan zu ihrer Gründung mehr mit dichterischen Erzählungen ausgeschmückt als in unverfälschten Zeugnissen der Ereignisse überliefert wird, das möchte ich weder als richtig hinstellen noch zurückweisen.“[37]
Daraus lässt sich schließen, dass Livius diese ganz frühen Ereignisse als nicht gesicherte Fakten ansieht. Die von ihm dargestellten Ereignisse nach der Gründung Roms, also auch den Lucretia-Stoff, müsste er jedoch entsprechend dieser Aussage als historische Tatsachen betrachten. Zumindest hält er diese nicht für erdachte Geschichten, die jeglicher Realität entbehren, denn eine solche Einschränkung der Glaubwürdigkeit teilt er uns weder in der Vorrede noch bei der Schilderung der Lucretia-Geschichte mit.
Ohnehin ist es schwer vorstellbar, dass Livius an den überlieferten Geschehnissen, welche eine so bedeutende Umwälzung wie den Wandel von der Königsherrschaft zur Republik zur Folge hatten, grundsätzliche Zweifel hegte. Er stellt die Ereignisse folgendermaßen dar:
Tarquinius Superbus regierte seit 534 v.Chr. Er war der siebte König Roms, der seinen Beinamen nicht ohne Grund trug, denn er verhielt sich tyrannisch und selbstherrlich gegenüber seinen Feinden innerhalb und außerhalb Roms.
Livius: „Denn außer der Gewalt besaß er nichts, was ihm das Recht zum Herrschen gegeben hätte; regierte er doch, ohne vom Volk gewählt und ohne vom Senat bestätigt zu sein. Dazu kam, dass er sich keine Hoffnung auf die Liebe seiner Mitbürger machen konnte und seine Herrschaft durch Schrecken sichern musste. Um diesen noch mehr Menschen einzujagen, führte er die Untersuchungen in den Kapitalprozessen ganz allein ohne Beisitzer und konnte unter diesem Vorwand Todesurteile, Verbannungen und Vermögensstrafen verhängen, nicht nur gegen die, die ihm verdächtig oder verhasst waren, sondern auch da, wo er auf nichts anderes als auf persönliche Bereicherung aus war.“[38]
Durch List oder Gewalt bemächtigte er sich auch mehrerer Nachbarstädte. So verhalf ihm Sextus, der jüngste seiner drei Söhne, durch eine Tücke zur Einnahme der Stadt Gabii.[39] Er gab sich als Überläufer aus, der – vor der Gewalt seines Vaters nicht mehr sicher – Schutz bei dessen Feinden finden wollte. Die Einwohner glaubten ihm und gingen damit in die Falle.
Die Auseinandersetzung mit einer anderen Nachbarstadt ist der Ausgangspunkt für die Lucretia-Geschichte.[40]
Als sich die Belagerung der rutulischen Stadt Ardea hinzog, verkürzten sich die Königssöhne die Zeit mit abendlichen Trinkgelagen. Bei einem solchen Gelage gemeinsam mit ihrem Verwandten L. Tarquinius Collatinus kam es zum Streit darüber, wer von den Anwesenden die tugendhafteste Frau besäße. Collatinus selbst machte den Vorschlag, sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, wer im Recht sei und nach Hause zu reiten, um ihre Frauen zu überraschen.[41] Die Anwesenden stimmten dem Vorschlag begeistert zu und ritten zunächst nach Rom. Livius führt nicht aus, was sie dort zu sehen bekamen. Stattdessen klärt er den Leser erst im Nachhinein auf, indem er das Verhalten Lucretias als Gegensatz zu dem der königlichen Schwiegertöchter darstellt. Er schreibt: „Als sie dort [in Rom C.S.] eintrafen, brach bereits die Dunkelheit herein; sie ritten dann noch weiter nach Collatia, wo sie Lucretia keineswegs so vorfanden wie die Schwiegertöchter des Königs – diese hatten sie angetroffen, wie sie sich bei Gelage und Spiel mit Gleichaltrigen die Zeit vertrieben –, sondern sie saß noch spät in der Nacht mit der Wolle beschäftigt, im Inneren des Hauses unter ihren bei Lampenlicht arbeitenden Mägden.“[42]
Gleich zwei Sachen müssen in diesem Zusammenhang auffallen: zum einen vertrieben sich die Frauen der Königssöhne mit nichts anderem die Zeit als ihre Männer, doch war ihnen (im Gegensatz zu den Männern) der Weingenuss verboten.[43] Zum anderen entspricht das Bild, das Livius von Lucretia zeichnet, dem Ideal der römischen Matrona.[44] Nach der Begrüßung lädt Collatinus als Sieger der Wette die Königssöhne ein. Bei diesem Beisammensein „ergriff Sex. Tarquinius das böse Verlangen, Lucretia Gewalt anzutun“, da ihn ihre Schönheit, „aber mehr noch ihre erwiesene Sittsamkeit“ reizte.[45]
Noch in derselben Nacht ritten die Männer wieder ins Lager, Sextus jedoch kehrte einige Tage später mit nur einem Begleiter nach Collatia zurück, wo man ihn gastfreundlich aufnahm. Als nun alle schliefen, schlich er sich „glühend vor Verlangen“ in das Gemach Lucretias, drückte sie nieder und bedrohte sie mit seinem Schwert. Livius verdeutlicht die Atemlosigkeit und Aufregung des Sextus durch die abgehackt wirkende Rede, die er ihm in den Mund legt: „Tace, Lucretia, Sex. Tarquinius sum; ferrum in manu est; moriere, si emiseris vocem.“[46] Er gesteht ihr seine Liebe, bettelt, droht und versucht, „mit den verschiedensten Mitteln auf das Herz der Frau einzuwirken“.[47] Doch nichts konnte sie dazu bringen, ihm nachzugeben. Erfolg brachte ihm erst die Drohung, dass er zunächst sie und dann einen Sklaven töten würde. Diesen wiederum würde er entkleidet zu ihr ins Bett legen und daraufhin behaupten, er hätte die beiden beim Ehebruch ertappt und – wie es ihm als Verwandten rechtlich zustand[48] – umgebracht. Diese Aussicht bewog Lucretia schließlich dazu, Sextus gewähren zu lassen, der „außer sich vor Freude“ war, die Ehre der Frau bezwungen zu haben.[49]
Nachdem der Übeltäter Collatia verlassen hatte, schickte Lucretia einen Boten zu ihrem Vater und ihrem Ehemann. Beide sollten jeweils mit einem treuen Freund möglichst schnell zu ihr kommen. Lucretias Vater Spurius Lucretius brachte Publius Valerius mit, während Collatinus zusammen mit Lucius Junius Brutus eintraf.[50]
Die gesamte anschließende Szene steht bereits unter dem Zeichen des Racheschwurs. Im Gegensatz zu Ovid legt Livius nicht viel Wert darauf, die verzweifelte Stimmung der Lucretia eindrucksvoll darzustellen. Stattdessen lässt er Lucretia einen längeren Monolog halten, in dem sie sehr entschlossen, rational und beinahe gefühlskalt wirkt. Auf die Frage ihres Mannes „Ist alles gut?“ beginnt sie mit ihrer Rede, die gerade wegen des ausgefeilten Stils eher aufgesetzt wirkt. Hinzu kommt, dass dies der Moment ist, in dem Lucretia zum ersten Mal spricht. Sowohl beim unverhofften Eintreffen der Männer infolge der Frauenwette als auch bei der Schlafzimmer- bzw. Vergewaltigungsszene lässt Livius sie kein einziges Wort sagen. Umso erstaunlicher wirkt die überlegte, wohl strukturierte Ansprache an ihre Verwandten, die nicht recht in das Bild der sittsam-keuschen Hausfrau passen will.
Lucretia antwortet: „Keineswegs! Denn wie kann es gut bestellt sein um eine Frau, die ihre Ehre verloren hat. Du findest die Spuren eines fremden Mannes in deinem Bett, Collatinus. Aber nur mein Leib ist befleckt, mein Herz ist frei von Schuld; mein Tod wird es beweisen. Doch versprecht mir in die Hand, dass der Ehebrecher nicht ungestraft davonkommt. Es ist Sex. Tarquinius, der, aus einem Gastfreund zum Feind geworden, sich letzte Nacht bewaffnet mit Gewalt hier einen Genuss verschafft hat, der mir und – wenn ihr Männer seid – auch ihm Verderben bringen wird.“[51] Die Männer versuchen sie zu trösten und von ihrem Vorhaben abzubringen, indem sie ihr zu denken geben, dass der Geist und nicht der Leib sündige und es keine Schuld gäbe, wo keine Absicht vorliegt. Doch ungerührt führt sie ihre Rede fort: „Seht ihr zu, was jener verdient. Ich kann mich zwar von der Sünde freisprechen, der Strafe aber will ich mich nicht entziehen; und es soll künftig keine Frau, die ihre Ehre verloren hat, unter Berufung auf Lucretia weiterleben.“[52]
Sie zieht ein Messer aus ihrem Gewand und ersticht sich. Vater und Ehemann werden hierauf von ihrer Trauer überwältigt. Brutus aber zieht das Messer aus der Wunde, hält es zum Himmel und schwört Rache, und zwar nicht allein an Sextus sondern an der gesamten Königsfamilie: „...ich rufe euch, ihr Götter, zu Zeugen, dass ich L. Tarquinius Superbus mitsamt seinem verruchten Weib und seiner ganzen Nachkommenschaft mit Schwert und Feuer und jeder möglichen Gewalt verfolgen und nicht zulassen werde, dass diese oder jemand anders in Rom als Könige herrschen.“[53]
Das Erstaunliche an dieser Szene ist, dass sich gerade Brutus zum Anführer der Rache bzw. der Revolution aufschwingt. Ebenfalls ein Angehöriger des Königsgeschlechts[54] hatte er sich zuvor als dumm ausgegeben. Auf diese Weise wollte er dem Schicksal seines Vaters und seines Bruders entgehen, denn diese waren von Tarquinius Superbus umgebracht worden.[55] Und so hatte er beschlossen, dem König „weder in seiner Gesinnung Anlass zur Furcht zu geben noch in seinen Vermögensumständen Anlass zur Begehrlichkeit, um dadurch, dass man ihn verachtete, sicher zu sein“.[56] Nicht nur Tarquinius Superbus sondern die gesamte Bürgerschaft hielt Brutus für geistig zurückgeblieben, wodurch das Erstaunen bei den Verwandten Lucretias umso größer war, als plötzlich ausgerechnet Brutus mit allem Nachdruck zur Vertreibung der Tarquinier aufrief.
Sie sprachen ihm den Schwur nach und setzten ihr Vorhaben sogleich in die Tat um. Die Leiche der Lucretia wurde zum Marktplatz gebracht und auf diese Weise der Vorfall öffentlich gemacht. Der Schmerz des Vaters beeindruckte die Menschen sehr, doch es ist wiederum Brutus, der „ihre Tränen und müßigen Klagen tadelte“ und sie zum Kampf gegen die Übeltäter aufrief.[57]
Die kampfbereiten Männer zogen von Collatia aus nach Rom, wo die tragischen Ereignisse die dortige Bevölkerung ebenfalls empörten. Vor allem aber brachte die Rede des Brutus, der nicht nur die Tat des Sextus anklagte, sondern auch die Verbrechen des regierenden Königs aufzählte, das römische Volk dazu, Tarquinius Superbus die Herrschaft abzuerkennen und ihn mit seiner Frau und seinen Kindern in die Verbannung zu schicken.
Interessant ist in diesem Zusammenhang folgende Passage: Livius berichtet, dass sich Brutus in das Lager nach Ardea aufmachte, wo bis zu diesem Zeitpunkt noch der König und dessen Söhne verweilt waren. Als Tarquinius Superbus jedoch von den Unruhen in Rom hörte, brach er dorthin auf. Brutus schlug, als er dessen Herankommen bemerkte, einen anderen Weg ein, „um ihm nicht zu begegnen“.[58] Während Tarquinius in Rom vor verschlossenen Toren stand und ihm die Verbannung verkündet wurde, feierte man den in Ardea ankommenden Brutus als „Befreier der Stadt“.[59] Die bis dahin im Lager verbliebenen Söhne flohen. Sextus, der in die einstmals durch ihn verratene Stadt Gabii floh, wurde dort „von alten Feinden, die er sich selbst durch Morde und Räubereien gemacht hatte“, umgebracht.[60]
Auffällig ist, dass Brutus, der noch beim Leichnam der Lucretia geschworen hatte, die Königsfamilie „mit Schwert und Feuer und jeder möglichen Gewalt“ zu verfolgen, weder den König angreift (ja, ihm sogar ausweicht), noch die Tat des Sextus mit eigener Hand an selbigem rächt. Stattdessen wird Sextus für seine früheren Verbrechen von nicht näher bezeichneten „alten Feinden“ und nicht, wie man es erwarten könnte, in unmittelbarer Konsequenz der begangenen Vergewaltigung getötet.
Brutus hatte also zunächst ohne selbst Gewalt anzuwenden, die Königsfamilie – immerhin handelte es sich um seinen Onkel und seine Cousins – aus Rom vertrieben. Doch wenig später wendet sich dieser Umstand gegen ihn, und er muss seine eigenen Söhne zum Tode verurteilen. Sie sind zugleich die ersten „Opfer“ der durch Brutus vorangetriebenen Revolution.
Brutus bildete nämlich zunächst gemeinsam mit Collatinus das erste römische Konsulkollegium. Collatinus jedoch legte auf Drängen des Brutus, sowie seines Schwiegervaters und mehrerer anderer angesehener Bürger sein Amt bald darauf nieder.[61] Da er in männlicher Linie zur Familie der Tarquinier gehörte, trug er auch deren Namen. Und gerade der Name war es, an dem die Bürgerschaft – laut Livius – Anstoß nahm, obwohl sonst nichts gegen ihn sprach.[62] Schließlich war ihm durch die Vergewaltigung seiner Frau eine große Schmach durch die Königsfamilie zuteilgeworden. Doch dies half nichts: solange „ein Mann aus der Sippe des Königs, mit dem Namen des Königs“ nicht nur in der Bürgerschaft, sondern sogar an der Macht sei, beeinträchtige dies die Freiheit der Stadt.[63] Gerade diese Worte aus dem Munde des Brutus zu hören, kann erstaunen. Immerhin war er der Neffe des Königs. Er stand ihm – nach modernen Maßstäben – verwandtschaftlich viel näher, wenn er auch nicht den Namen Tarquinius trug, da seine Mutter das „Verbindungsglied“ zur Königsfamilie war.
Collatinus hingegen entstammte gewissermaßen dem „unglücklichen Zweig“[64] der Tarquinier und seine Verdrängung aus dem Konsulat scheint diesen Umstand nur noch deutlicher zu machen. Aus Angst auch noch sein Vermögen zu verlieren, lässt er sich in Lavinium nieder.[65]
Die vertriebene tarquinische Königsfamilie hingegen wollte sich nicht mit dem Verlust ihres Besitzes und ihrer Stellung abfinden. Sie schickten Gesandte, um die Herausgabe ihrer Güter einzufordern. Im Geheimen jedoch waren diese damit beauftragt worden, die Stimmung unter den jungen Adligen zu erkunden und mit ihnen eine Verschwörung zur Rückgewinnung der Herrschaft zu initiieren.[66] Unter diesen jungen Adligen waren auch die beiden Söhne des Brutus. Doch die Verschwörung wurde aufgedeckt. In dieser Situation war es nun an Brutus, seine Vaterliebe seiner Pflicht als Konsul unterzuordnen und seine Söhne zum Tode zu verurteilen.[67] Die Hinrichtungsszene wird von Livius sehr ausführlich geschildert, vor allem aber der Zwiespalt zwischen Gefühl und Ratio bei Brutus. Gerade dieser Umstand wird auch von den anwesenden Zuschauern als eigentlicher tragischer Akt bzw. als hauptsächliches Schauspiel erlebt, so dass „die ganze Zeit über der Vater, seine Miene und sein Gesicht die Blicke auf sich zog; denn bei dem Akt des staatlichen Strafvollzugs wurden die Gefühle des Vaters sichtbar“.[68]
Insgesamt ist festzustellen, dass bei Livius der Charakter und die Handlungen des Brutus detaillierter dargestellt werden, als die der Lucretia. Dies ist vor allem auf seine führende Rolle beim Umsturz der tarquinischen Tyrannis zurückzuführen. Darauf wird im Abschnitt zu den Interpretationsansätzen zurückzukommen sein.
Brutus stirbt noch während seiner Amtszeit. Arruns, einer der Söhne des Tarquinius Superbus, tötet ihn. Doch auch hier kann man nicht behaupten, dass es darum gegangen wäre, Lucretia zu rächen. Schließlich ist es Arruns, der sich zur Rückgewinnung der Königsherrschaft auf dem Weg nach Rom befindet. Als er sieht, dass ihm Brutus mit einem Heer entgegenkommt, geht er zornentbrannt zum Angriff über.[69] Arruns ist also der Angreifer. Doch auch Brutus, als er erkannte, dass der Angriff ihm galt, scheute sich nicht. Und in dieser Kampfeswut war bereits der erste Schlag beider so kräftig, dass sie starben.[70]
Bei der Darstellung des Livius besticht vor allem die ökonomische Darstellung des Geschehens. Er zeichnet sich als Historiker vor allem dadurch aus, dass er sich der Wirkung der dramatischen Elemente bewusst ist, sie jedoch sparsam und wohlüberlegt benutzt.[71] Allzu emotionale oder pathetische Szenen werden bei ihm vermieden und stattdessen die Rationalität als Handlungsantrieb der Protagonisten betont.
2.3. Ovid
Ovid hat die Ereignisse um Lucretia in seinen Fasti unter dem Datum des 24. Februar vermerkt. Bei ihm liegt ein weitaus größeres Gewicht auf der Darstellung der Gründe, sowie der Umstände und Enthüllung der Vergewaltigung. Hingegen wird der Racheschwur, vor allem jedoch der Verfassungsumsturz nur sehr kurz genannt. Offensichtlich interessierten Ovid die erotische und die tragische Komponente weitaus mehr als die politische.
Grundsätzlich entspricht die Abfolge des Geschehens dem bei Livius. Auch Ovid beginnt mit der Frauenwette und verwendet nur zwei Zeilen für die zügellosen Ehefrauen der Königssöhne. Im Gegensatz zu Livius zeichnet er jedoch ein sehr viel genaueres Bild von Lucretia. Sie ist bei Ovid eindeutig die wichtigste Person.
Um sie vorzustellen und dem Leser einen Einblick in ihr Seelenleben zu gewähren, bedient er sich der Außenschau, wobei er zunächst allerdings keineswegs ihre Schönheit schildert. Unbemerkt beobachten die Männer Lucretia bei ihrer Wollarbeit und belauschen ihren Monolog, der ihr Innerstes zu erkennen gibt. Sie sorgt sich um ihren Mann. Es scheint kein anderes Thema für sie zu geben. Auch der Mantel an dem sie mit ihren Mägden gerade arbeitet, ist für ihn bestimmt. Ihre Sorge scheint begründet, denn „allzu verwegen“ sei Collatinus, und stürme „mit gezücktem Schwert ohne zu fragen wohin“.[72]
Das Bild, das hier von Collatinus gezeichnet wird, ist kein allzu gutes. Offensichtlich fehlt es ihm zwar nicht an Tapferkeit, doch fehlt es ihm an Weitsicht und Überlegung, die seine Tapferkeit erst wertvoll machen würden. Ebenso unbedacht wie im Kampf, war er selbst der Initiator der Frauenprobe. Dadurch wird er zum Auslöser des ganzen Unglücks.
Ovid schließt den Monolog der Lucretia mit den Worten: „Ganz von Sinnen bin ich und vergehe, so oft ich mir denke, wie er so kämpft, und wie Eis legt es sich mir dann ums Herz!“[73] Diese Worte ahnen bereits das tragische Geschick voraus, denn die Verwendung des Wortes „morior“ (in der obigen Version mit „ich vergehe“ übersetzt) lässt einen im Zusammenhang mit der Metapher des Eises, das sich um ihr Herz legt, schon an dieser Stelle an den tödlichen Stich mit der kalten Messerklinge denken.
Lucretia verstummt und beginnt zu weinen, wobei Ovid die Bemerkung macht, dass ihr selbst die Tränen gut standen.[74] Doch zunächst einmal wird ihr Kummer aufgelöst, denn endlich geben sich die Beobachter zu erkennen. Collatinus begrüßt sie mit den Worten „pone metum, veni!“, die umso tragischer im Hinblick auf das bevorstehende Unheil wirken, welches eben erst durch sein Kommen ins Werk gesetzt wird.
Sextus entbrennt in rasender Liebe. Nun erst schildert Ovid die Gestalt der Lucretia – und zwar durch die Augen des Verliebten. Insbesondere die „schneeweiße Farbe“ ihrer Haut und das Blond ihrer Haare verstärken das Bild der Unschuld, die bereits im Tun und Sprechen offenkundig geworden ist.[75]
Ovids psychologisches Gespür wird in der Schilderung der Gefühle des Sextus deutlich. Zurück im Lager führt er sich immer wieder einzelne Details vor Augen, wodurch er sich in einen rauschhaften Zustand versetzt.[76] Es ist jedoch nicht nur das Aussehen und der tugendhafte Charakter Lucretias, es ist vor allem die Unmöglichkeit eben dies in seinen Besitz zu bringen, die seine Leidenschaft verstärkt.[77] Die Liebe zur verheirateten Lucretia ist vollkommen hoffnungslos, doch gerade die Sehnsucht nach der Unerreichbaren macht sein Empfinden noch intensiver.
Das Problem besteht darin, dass Lucretia in dem Moment, in dem sie für Sextus „erreichbar“ wäre und er bekäme, was er wollte, ihre Unschuld und damit auch ihren Reiz verlieren würde. Diese tragische Spannung von Wollen und Nicht-erreichen-können aufrechtzuerhalten, läuft hier zwangsläufig auf die Vergewaltigung hinaus. Dies soll nicht heißen, dass diese Spannung damit aufgelöst würde – im Gegenteil: sie besteht fort. Sogar der Selbstmord ist nur eine andere Verdeutlichung dieser Spannung. Lucretia entzieht sich im Nachhinein dem Wollen des Sextus und macht sich auf diese Weise zu einem absolut unerreichbaren Objekt seiner (und jeglicher) Begierde.