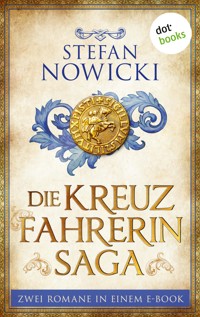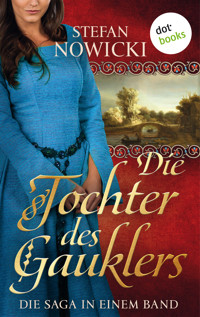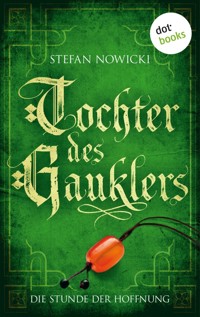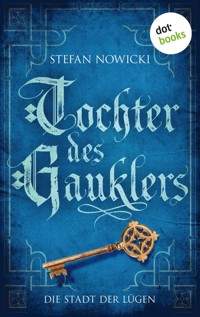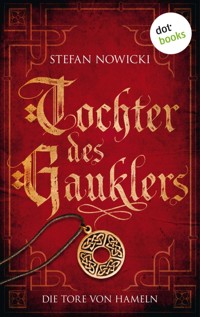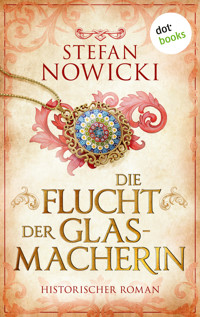
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Keine Heimkehr sondern Flucht in die Fremde 1291: Nach dem grausamen Tod ihrer Eltern bei dem Mameluckensturm auf Akkon, hat die junge Sofia Ziani keine Wahl, als mit den Waffenknechten Hug und Tomas aus dem Heiligen Land zu fliehen. Nichts ist ihr geblieben als ein Korb voller Glaswerke, die Aufzeichnungen ihres Vaters und der Wunsch, sein Erbe als Glasmacherin fortzuführen. In ihrer venezianischen Heimat muss sie jedoch feststellen, dass ihr einstiger Verlobter Marco den Besitz der Zianis an sich gerissen hat. Durch seine Intrigen werden Sofia und ihre Gefährten des Mordes beschuldigt und eine abenteuerliche Flucht über die Alpen gen Norden beginnt. Doch die Männer des Dogen sind Ihnen dicht auf den Fersen, denn Sofia trägt ein Dokument von unschätzbarem Wert bei sich: die erste Rezeptur für reines Glas ... Der mitreißende Auftakt der neuen historischen Saga von Stefan Nowicki – für alle Fans von Sabine Weiß und Peter Dempf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
1291: Nach dem grausamen Tod ihrer Eltern bei dem Mameluckensturm auf Akkon, hat die junge Sofia Ziani keine Wahl, als mit den Waffenknechten Hug und Tomas aus dem Heiligen Land zu fliehen. Nichts ist ihr geblieben als ein Korb voller Glaswerke, die Aufzeichnungen ihres Vaters und der Wunsch, sein Erbe als Glasmacherin fortzuführen. In ihrer venezianischen Heimat muss sie jedoch feststellen, dass ihr einstiger Verlobter Marco den Besitz der Zianis an sich gerissen hat. Durch seine Intrigen werden Sofia und ihre Gefährten des Mordes beschuldigt und eine abenteuerliche Flucht über die Alpen gen Norden beginnt. Doch die Männer des Dogen sind Ihnen dicht auf den Fersen, denn Sofia trägt ein Dokument von unschätzbarem Wert bei sich: die erste Rezeptur für reines Glas ...
Über den Autor:
Stefan Nowicki, geboren 1963, studierte Germanistik, Politik, Kunstgeschichte, Philosophie und Theologie. Er arbeitet unter anderem als freier Kulturjournalist für verschiedene Zeitungen und lebt in der Nähe von Augsburg.
Der Autor im Internet: stefannowicki.deDer Autor auf Facebook: facebook.com/stefannowicki.w.u.t
Stefan Nowicki veröffentlichte bei dotbooks bereits den Bestseller »Die Kreuzfahrerin«, in dem er die abenteuerliche Lebensgeschichte der jungen Deutschen Ursula erzählt, und »Der Sohn der Kreuzfahrerin«, in dem er sich Ursulas Sohn Shakib widmet. Beide Romane sind auch in dem Sammelband »Die Kreuzfahrerin-Saga« erschienen.
Außerdem veröffentlichte der Autor bei dotbooks seine Trilogie »Tochter des Gauklers« mit den Einzelbänden »Die Tore von Hameln«, »Die Stadt der Lügen« und »Die Stunde der Hoffnung« – auch als Sammelband erhältlich unter dem Titel »Die Tochter des Gauklers«.
Des weiteren erschien bei dotbooks Stefan Nowickis historischer Roman »Die Flucht der Glasmacherin«, der erste Band seiner »Glasmacherin«-Saga. Eine Fortsetzung ist in Arbeit.
***
Originalausgabe Dezember 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Renata Sedmakova, Acant Studio, HiSunnySky, Tesa K.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-454-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Stefan Nowicki
Die Flucht der Glasmacherin
Historischer Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Hafenstadt Akkon, 18. Mai 1291
»Sofia! Sofia, wo bleibst du?«
Bei der schrillen Stimme der Mutter schoben sich ihre Augenbrauen zusammen, und zwischen ihnen entstand eine tiefe Furche des Unwillens und des Zorns. Tagelang hatte sie auf die Eltern eingeredet, ihnen die Neuigkeiten von den Gassen zugetragen, sie auf die Feuer in den Vierteln hingewiesen und zum Aufbruch gedrängt. Und jetzt konnte es auf einmal nicht schnell genug gehen.
Hastig zog sie das mit Perlen verzierte Netz von ihrem Hinterkopf, und die dunklen Locken ergossen sich über ihre Schultern. Sie sah sich im Zimmer.
»Sofia!«
»Ja doch! Ich komme!«
Mit finsterem Blick nahm sie das auf dem Tisch liegende, schmucklose Tuch auf und musterte es angewidert. Ein Seufzen entfuhr ihr, als sie sich daran machte, die Fülle ihrer Locken damit erneut zu bändigen und sie darunter zu verbergen. Es war von eben solcher Schlichtheit wie das Gewand, das der Vater ihr besorgt hatte.
»Es ist sicherer. Wir müssen wie einfache Leute aussehen, sonst wollen alle nur an unser Geld, ganz zu schweigen vom Feind.« Das waren seine Worte gewesen. Sofia sah sehnsüchtig auf ihre Kleider, die über den Rändern der geöffneten Truhen lagen. Sie hatte nicht alle einpacken dürfen. Es waren teure Stoffe, verziert mit Stickereien und von leuchtenden Farben.
»Sofia!« Diesmal war es die mahnende Stimme des Vaters.
Noch einmal überflog sie die Unordnung. Hatte sie etwas vergessen? Sie schüttelte heftig den Kopf, wie um diesen Gedanken abzuschütteln, dann lief sie aus dem Zimmer und die Treppe hinab.
Die Haustür stand offen, Mutter und Vater standen wartend neben dem hoch bepackten Handkarren, Brandgeruch lag in der Luft. Der Wind trieb dunkle Rauchschwaden über den Ausschnitt des Himmels, den sie vom Hof aus sehen konnte. Am Karren angekommen. nahm sie die aus dünnen Zweigen geflochtene Kraxe auf. Sie war nicht schwer. Vater hatte nur die schönsten und wichtigsten Stücke eingepackt. Einen Moment lang schob sich ihre Erinnerung vor das Chaos um sie herum, und sie sah sich mit Mutter und den anderen Fasserinnen zwischen unzähligen Körben die zerbrechlichen Gläser in feuchtes Stroh packen. Der Handel mit dem edlen Produkt Venedigs, aber auch seine Herstellung waren einer der Gründe für den Wohlstand ihrer Familie hier im Outremer, aber auch in der Lagunenstadt. Das friedliche Bild entglitt ihr.
Vater hatte das Tor schon geöffnet. Sie sah Leute vorbeieilen, alle mit geöffneten Mündern, doch der Lärm von den Mauern der Stadt überdeckte alles, auch die Rufe der Flüchtenden; es war ohrenbetäubend. Von überall her kamen die Schreie und Rufe. Von den Mauern drang das schrille Kampfgeschrei aus unzähligen Mamelukenkehlen herüber, dazwischen das Klirren der Waffen und immer wieder das Zischen und Rauschen der Wolken tausender Pfeile, die über die Stadtbefestigung hinweg zwischen die Häuser prasselten. Aber das Allerschlimmste waren die dumpfen Einschläge der von Katapulten gegen die Mauern geschleuderten Felsbrocken. Hunderte der sogenannten schwarzen Ochsen schossen Steine und Feuertöpfe durch die Luft. Ihre Einschläge waren kaum einzeln wahrnehmbar. Es war, als trommelten alle Dämonen der Unterwelt mit Fäusten gegen die Tore der Hölle, begleitet vom Donnern hunderter Kriegstrommeln. Lautlos wie Monde zogen Felsbrocken, groß wie Ochsen, ihre Bahn durch die Luft, geschleudert von den mächtigsten aller Wurfmaschinen. Ihre Namen, »Der Siegreiche« und »Der Wütende«, waren allen bekannt. Ein jeder hatte gesehen, wie viel Zerstörung allein eines ihrer Geschosse bewirkte, wenn es gegen die Wehrgänge und Türme, aber auch bis ins Innerste der Stadt flog.
Es war einen Monat her, da hatten die Tapfersten der Tempelritter versucht, in einem Überraschungsangriff bei Nacht zu den Maschinen vorzudringen, um sie zu zerstören. Doch das Schicksal war gegen sie gewesen, und sie konnten ihr Ziel nicht erreichen.
Sofia und ihre Eltern zogen unwillkürlich die Köpfe ein, als das unheilvolle, wütende Fauchen eines gewaltigen Feuertopfs aufbrauste und die Luft über ihnen erfüllte. Der Flugbahn folgend schätzte Sofia, dass die mannsgroße, mit Pech und griechischem Feuer gefüllte Amphore nur wenige Gassen entfernt einschlagen würde. Die Brände, die von diesen Geschossen verursacht wurden, waren kaum zu löschen. Die schwarzen Löcher, die in fast jedes Viertel gerissen worden waren, zeugten davon. Ihre Mutter bekreuzigte sich. Sofia meinte die Erde beben zu spüren.
Vor drei Tagen war der äußere der beiden Mauerringe, die die Stadt schützen sollten, aufgegeben worden. Der ständige Beschuss, aber besonders die von tausenden feindlichen Arbeitern geschwächten Fundamente brachten Mauern und Türme zum Einsturz. Zahlreich wie Ameisen hatten sie sich, in Gräben vor den Blicken und Pfeilen der Verteidiger durch Schilde und Matten geschützt, an die Befestigungen vorgewagt und die Bollwerke untergraben. Nur den Rittern und ihren treuen Soldaten war es zu verdanken, dass der Feind nicht sogleich in die Stadt eindrang. Doch wie Wellen am Strand warfen sich die Mameluken unablässig gegen den letzten Schutzwall.
Der Vater ergriff die Deichsel des Karrens und forderte sie mit einem Blick auf anzupacken. Sie zogen gemeinsam an, und die Mutter schob. Der Karren ächzte, knirschend malmten die Räder durch den Staub des Hofes.
Wieso war es plötzlich so still, dass sie in der Lage war, dies überhaupt zu hören? Sofia sah auf, und sofort war der grausame Lärm wieder allgegenwärtig. Sie zogen auf die Gasse und wurden sogleich vom Strom der Flüchtenden erfasst. Niemand nahm mehr Rücksicht. Es wurde gestoßen, gerempelt und vorwärts gedrängt. Es war nicht einfach mit dem Handkarren. Immer wieder drängten sich Leute an ihnen vorbei und drohten dabei das hochbepackte Wägelchen umzustoßen. Vater schritt kräftig aus, und Sofia hatte Mühe, Schritt zu halten. Kurz schien es ihr, als wollte sich Wehmut wegen des Abschieds in ihrem Kopf ausbreiten, doch der derbe Stoß einer sich vordrängelnden beleibten Frau leerte ihren Geist, und sie war wieder voll und ganz mit dem Ziehen des Wagens und allem um sie herum beschäftigt. Das rücksichtslose Weib kam nicht recht vorwärts, schnaufend und nassgeschwitzt stampfte es neben Sofia her, der säuerliche Geruch ihrer Ausdünstungen stach der jungen Frau in die Nase. Sie trug einen Korb auf dem Rücken und hielt die Arme nach vorne gestreckt, bereit, jeden, der ihr zu nahe kam, zur Seite zu schieben. Ein bisschen sah es so aus, als suchten ihre Hände etwas, woran sie sich klammern konnte, um sich dann mitziehen zu lassen. Sofias Blick glitt von ihr ab, auf den Boden direkt vor ihr und zu den Säumen der Kleider jener, die ihr den Blick in die Gasse versperrten.
In ihrem Rücken hörte sie schrille Angst, Schreie von Entsetzen und Schmerz gemischt mit dem Kampfgebrüll fremder Zungen.
»Der verdammte Turm ist gefallen!«, rief jemand.
»Welcher Turm?«
»Sie sind am Turm der Verdammnis durchgebrochen!«
Ein Ruck schien durch alle zu gehen, und sie beschleunigten ihre Schritte. Der Turm der Verdammnis war Teil der inneren Mauer, dort, wo sie einen Knick nach Westen machte, und hatte schon immer als eine der Schwachstellen der Befestigung gegolten. Wenn der Feind nun diesen Mauerabschnitt erobert hatte, war ihm der Weg in die Stadt offen.
Sofia wagte nicht, über die Schulter nach hinten zu schauen. Mit der Rechten hielt sie den Griff der Deichsel fest umklammert und zog aus Leibeskräften; mit dem linken Ellenbogen hielt sie sich Vorbeidrängende vom Leib. Vor sich die Füße und Säume von Gewändern, konzentrierte sie sich darauf, Schritt zu halten. Schon nach kurzer Zeit klebte ihr die Zunge am Gaumen. Die Luft war staubig und ließ sie den Geruch der Brände regelrecht schmecken. Das Gedränge wurde immer dichter, sie kamen kaum noch voran.
»Lasst den Karren stehen«, rief einer, der sich vorbeidrängte, »nehmt die Beine in die Hand und lauft!«
Unsicher warf Sofia einen Blick auf ihren Vater. Der zog mit verbissener Miene weiter, die Lippen zusammengepresst, Schweißperlen auf der Stirn. »Den Teufel werden wir tun«, raunte er, als er den Blick der Tochter bemerkte. »Das ist alles, was wir noch haben, und für das Gepäck musste ich den Kapitän der Galeere zusätzlich bezahlen.«
Vor ihnen stolperte eine alte Frau, suchte nach Halt und riss zwei weitere mit sich in den Staub. Helfende Hände versuchten sie aufzurichten, andere sie aus dem Weg zu räumen. Es entstand eine Lücke, und mit einem drohenden Aufschrei legte sich der Vater, all seine Kräfte mobilisierend, ins Zeug. Sofia bemühte sich, Schritt zu halten, und sie kamen ein gutes Stück vorwärts. Die Schreie hinter ihnen wurden immer lauter, dringlicher, voller Schmerz und Qualen. Sie scheute sich, nach hinten zu sehen. Die Gesichter all jener vor ihr reichten aus. Aufgerissene Augen in verbissenen Mienen, in Panik geöffnete Münder. Sie versuchte noch vehementer, nach vorne zu stürmen. Ihr Vater wagte einen Blick über die Schulter und stemmte sich daraufhin noch mächtiger gegen den Zugriemen, den er sich über den Oberkörper gelegt hatte und der noch tiefer in den Stoff seiner Kleider und in seine Muskeln schnitt. Sofia unterstützte ihn, so gut sie konnte. Nicht umsehen. Nicht umsehen!, mahnte sie sich innerlich. Auf einmal kam ihr die Gasse wie eine Schlucht vor, ein enger Durchlass mit schroffen, unbezwingbaren Wänden. Dabei hatte sie doch als Kind hier zwischen den Häusern gespielt, war ohne jegliche Angst den sonnenerhellten Weg bis hinunter zum Hafen spaziert. Jetzt gab es weder Sonne noch sorgloses, freies Herumhüpfen. Sie fühlte sich eingezwängt zwischen den Häusern, deren Mauern sich immer weiter zusammenzuschieben schienen. Es gab kein Entrinnen, vor ihnen die Wand all jener, die wie sie zum Hafen, der letzten Hoffnung, drängten, und hinter ihnen die schreckliche Flutwelle aus Schreien, Bedrohung und Todesangst.
Der gellende Schrei der Mutter ließ sie erstarren. Der Vater fuhr herum, riss sich den Riemen über den Kopf und versuchte sein Schwert zu ziehen. Sofia blieb keine Zeit zu begreifen. War es ein Lufthauch – der Wind, den der herabsausende Arm verursachte –, der Geruch nach Schweiß, schlechtem Atem und Blut oder ein Schatten? Was es auch war, Sofia spürte sein Herankommen und duckte sich instinktiv, gerade noch rechtzeitig, um dem wuchtigen Schlag der Keule zu entkommen. Ihre eisernen Spitzen krachten in das Gepäck auf dem Karren und brachten das Geflecht eines der Körbe zum Bersten. Sofia sprang nach vorne, wollte weglaufen, doch der Mann erwischte sie am Arm, griff schmerzhaft zu und riss sie herum. Seine Keule hatte er losgelassen und schlug ihr nun mit der freien Hand ins Gesicht. Die Faust traf sie hart auf die Wange und schleuderte sie zu Boden. Sogleich war er über ihr und setzte sich auf sie, eine Hand an ihrer Kehle, die andere holte zu einem erneuten Schlag aus. Sofia strampelte mit den Beinen, schlug wild um sich, versuchte den Mann abzuwerfen, doch ihre Gegenwehr beeindruckte ihn nicht im Geringsten. Erneut traf er sie im Gesicht, diesmal mit der flachen Hand. Es brannte auf der Haut und warf ihren Kopf herum. Für einen Wimpernschlag sah sie unter dem Karren hindurch und nahm das Geschehen auf der anderen Seite wahr. Sie sah zwei Angreifer, die einen Frauenleib zu Boden drückten. Ihre Köpfe konnte sie nicht sehen, sehr wohl aber das schmerzverzerrte Gesicht der Mutter im Staub und ihre nackten grellweißen Schenkel, zwischen die sich einer der beiden Männer nun mit entblößtem Hinterteil zwängte. Sie wollte schreien, doch ihr fehlte Luft, und das brachte sie zurück in die eigene Not. Mit beiden Händen krallte sie sich um die Finger der würgenden Hand und versuchte deren Griff zu lockern. Ihr Peiniger hielt plötzlich einen Dolch in der Hand, mit aufgerissenen Augen sah sie das Blut daran und ebenso den gierigen, geilen, siegessicheren Blick des Mameluken. Er hob den Arm und erstarrte mit verwirrtem Blick. Etwas hatte ihn getroffen. Sofia sah einen Stein von seiner Stirn abprallen. Die würgende Hand ließ von ihr ab und fuhr zum Schmerz am Kopf. Sogleich rann Blut zwischen den Fingern hervor, über das Auge und entlang der Nase, und tropfte auf Sofia herab. Der Getroffene sah auf in die Richtung, aus der das Geschoss herangeflogen war, da drang der kurze, fingerdicke Bolzen einer Armbrust in seine Schulter und warf ihn herum. Er brüllte auf, voller Zorn und Schmerz, und bäumte sich auf. Den Dolch noch immer in der Hand, wollte er sich erneut auf Sofia stürzen, als ein brauner Schatten ihn ansprang und sich mit einem bedrohlichen Knurren in den klingenführenden Arm verbiss. Erneut schrie der Mann auf, wurde von Körpergewicht des Hundes umgeworfen. Sofia war von seiner Last befreit und versuchte panisch mit den Beinen strampelnd rückwärts von ihm weg zu kommen. Ein Mann sprang heran, mit ledernem Schuhwerk und einem Kettenhemd. »Aus! Fang, aus!«, befahl er dem Hund und schlug mit einem Schwert nach dem Hals des Gegners, traf dessen Schulter und stieß ihm schließlich die Klinge in die Brust. Er drehte sich zu Sofia um, ergriff ihren Arm und zog sie auf die Beine.
»Los, wir müssen weg hier. Lauf!«, herrschte er sie an. Sie riss sich los und stürzte um die Deichsel des Karrens herum zu dem auf dem Rücken liegenden Körper ihres Vaters. Er presste beide Hände auf seine Mitte, zwischen Bauch und Brust, das Gewand darunter war dunkel und blutdurchtränkt. Als Sofia seinen Kopf anhob, huschte ein freudenvoller Schimmer über seine Augen.
»Vater, Vater!«, schluchzte Sofia und versuchte ihn weiter aufzurichten. »Komm, steh auf! Wir müssen weg hier und deine Wunden versorgen.«
Der Vater stöhnte auf, sein Gesicht war schmerzverzerrt und blutleer. Eine Hand krallte sich in ihre Schulter. »Nein, Sofia.« Seine Augenlider flatterten. »Lauf, Tochter! Schnell. Bring dich in Sicherheit.« Seine Augen begannen wild in alle Richtungen zu schauen. Dann ließ er ihre Schulter los, zog die große, lederne Tasche, die neben ihm im Staub lag, heran und presste sie der Tochter an die Brust. »Hier, nimm! Pass gut darauf auf. Es ist alles, was wir haben.«
»Nein, Vater, nein! Komm hoch, ich stütze dich.«
Der Vater drückte ihr die Tasche nur noch fester an die Brust. Sofia versuchte ihm unter die Arme zu greifen, da fiel sein Kopf nach hinten und aus dem offenen Mund trat Blut hervor. Sie hatte nicht die Kraft, den leblosen Körper aufzuheben, und musste loslassen. Hilfesuchend sah sie sich um. Panik stieg in ihr empor. Ein Soldat mit einem Eisenhut trat auf sie zu. Zuerst versuchte er ihr mit dem Körper des Vaters zu helfen, doch er ließ sogleich wieder ab. »Er ist tot. Du musst ihn liegen lassen. Komm, wir müssen hier weg!«, forderte er sie auf. Sofia sah sich um, der andere Soldat stand ungeduldig in der Nähe. Zögerlich die große Ledertasche umklammernd, erhob sie sich, aber nicht, um ihren Rettern zu folgen. Sie stürzte hinüber zum Körper ihrer Mutter. Neben ihr lagen drei tote Mameluken. Doch auch im Leib der Mutter war kein Leben mehr. Sofia versuchte die entblößten Stellen des Körpers mit den Resten des zerfetzten Kleides zu bedecken. Überall war Blut. Jemand legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Komm, hier kannst du nichts mehr machen. Wir müssen hier weg. Rasch, wir haben keine Zeit.« Ruhig, aber eindringlich redete der mit dem Eisenhut auf sie ein. Der andere hatte sich bereits abgewandt und rief nun: »Hug, komm! Lass sie, wenn sie sterben will. Das ist nicht unser Bier.«
Sofia spürte, wie die Hand von ihrer Schulter glitt und ihr unter die Achsel fasste. »Komm.« Er zog sie hoch. Am ganzen Leib zitternd stand Sofia da und sah sich außer Stande, auch nur einen Schritt zu machen. »Hier.« Der Soldat reichte ihr Vaters Tasche, die sie neben dem Leichnam der Mutter hatte fallen lassen. Sie riss sie ihm aus der Hand, und mit einem Mal war sie hellwach. Wo waren all die anderen Menschen? Die Gasse war übersät mit reglos daliegenden Körpern. Sie bekam es mit der Angst zu tun, in der Nähe ertönte erneut das Kampfgebrüll heranstürmender Feinde. Hastig warf sie sich den Lederriemen der Tasche über, griff sich ihre Kiepe erst, als sie auch noch ihr Bündel vom Karren ergriffen hatte, und ließ sich von dem Mann mitziehen. Erst langsam, Schritt für Schritt, dann immer schneller, und schließlich rannte sie hinter ihnen her, so schnell sie mit den Lasten konnte. Der Hund wich ihr dabei nicht von der Seite.
Vor ihnen sah sie Menschen rennen. Der Soldat ließ ihre Hand nicht los. Die Gasse gabelte sich, und sie hielten an. In der Enge zwischen den Häusern zu ihrer Linken drängten sich die Menschen, die eben noch gelaufen waren, und versuchten weiter voranzukommen.
»Hier lang«, rief der Größere ihrer beiden Retter.
Sofia rührte sich nicht. »Nein, wir müssen zum Hafen. Es geht da lang.«
»Da kommen wir nicht durch. Du siehst es doch.«
»Aber wo wollt ihr hin?«
»Zur Eisenburg, dem Hauptquartier der Templer. Dort sind wir in Sicherheit.«
»Nein, ich muss auf das Schiff. Mein Vater hat dafür bezahlt.«
»Glaubst du, irgendjemand von denen macht dir deswegen Platz? Mach, was du willst. Hug, komm jetzt, wir haben keine Zeit mehr.«
»Komm mit.« Hug hielt noch immer ihre Hand. »Tomas hat recht. Zwischen uns und dem Hafen ist alles, was in Akkon noch laufen kann. Da kommen wir nie durch, und die Heiden werden sich auf uns stürzen.«
Sie spürte, wie er ihre Hand fester drückte, und seine Augen waren wie die des Hundes, der sie von unten herauf erwartungsvoll ansah. Er machte einen Schritt und zog sie sanft mit sich. Sofia gab sich einen Ruck und folgte ihm. Auch auf dem neu gewählten Weg war nur schwer durchzukommen. Die Menschen rannten kopflos voran, jede Lücke, jeden Freiraum nutzend, voller Angst vor dem immer lauter werdenden Gebrüll in den Gassen hinter ihnen.
Vor den Mauern der Templerfestung drängte sich bereits eine unüberschaubare Menschenmenge, und alle wollten sie durch das Nadelöhr des letzten offenen Tors. Es schien unmöglich, auch noch in die Burg zu kommen, da kam ihnen ein Zufall zur Hilfe. Ein Trupp Ritter eilte heran, in der Mitte trugen Soldaten eine Bahre. »Aus dem Weg!«, brüllten die Vorderen. »Zur Seite, macht Platz für Johannes von Grailly!«
Der Respekt vor den Rittern sorgte dafür, dass sich eine Gasse zwischen den Flüchtenden öffnete. Tomas ergriff die Gelegenheit, fasste Sofia an der anderen Hand, und mit ihr in der Mitte drängten sie sich zwischen die anderen Soldaten. Bevor irgendjemand Einspruch erheben konnte, griff sich Hug einen Holm der Bahre und löste den sichtlich erschöpften Träger ab. Tomas folgte rasch seinem Beispiel, und so gelangten sie durch das Tor. Im Hof dahinter herrschte dichtes Gedränge. Die Templer stießen die Menschen rüde beiseite und drangen weiter in die Burg vor. Tomas, Sofia und Hug mussten ihnen zwangsläufig folgen. Schließlich gelangten sie in einen Saal, und man wies sie an, die Bahre mit dem vor Schmerzen stöhnenden Oberen abzusetzen. Einer der Ritter machte Meldung beim Befehlshaber der Burg. »Das ist Otto von Grandson«, raunte Tomas ehrfurchtsvoll Hug ins Ohr, als sich dieser dem Verwundeten näherte. Hug zupfte Sofia daraufhin am Ärmel, um sich unauffällig mit kleinen Schritten zu verkrümeln, da fiel der Blick des Heerführers auf die junge Frau.
»Sofia?«
Alle drehten sich zu ihr um. Sie blieb wie angewurzelt stehen.
»Sofia, was machst du hier?« Otto von Grandson trat auf sie zu. »Wo sind deine Eltern? Ich dachte, ihr seid längst in Sicherheit.« Er erklärte den Anwesenden: »Das ist Sofia, die Tochter des venezianischen Kaufmanns und Glasmachers, mit dem mich seit Jahren eine enge Freundschaft verbindet. Sprich, Tochter, was ist geschehen?«
»Wir wollten weg«, stammelte Sofia. »Es ging alles so schnell. Vater hat nie die Hoffnung in Euch aufgegeben.« Tränen stiegen ihr in die Augen.
Der Ritter ergriff ihre Hand. »Und wo ist er jetzt? Wo ist deine Mutter?«
»Sie sind beide tot. Erschlagen von den Heiden. Dass mich nicht das gleiche Schicksal ereilte, habe ich diesen beiden tapferen Männern zu verdanken. Sie retteten mich und brachten mich hierher.«
Otto nahm Sofia, der die Tränen übers Gesicht liefen, in die Arme und wandte sich Hug und Tomas zu. »So bin ich euch zu Dank verpflichtet. Wer ist es, der die Tochter meines Freundes rettete, und von wo kommt ihr?«
»Wir sind einfache Krieger des Herrn. Das ist Hug, und ich heiße Tomas. Wir kamen vor über fünf Jahren mit einem Mönch nach Outremer, um der heiligen Sache zu dienen. Wir wurden hier den Franzosen und Deutschrittern zugeteilt. Als der Turm der Verdammnis fiel, gab man uns den Befehl zum Rückzug, um die Straßen der Stadt zu sichern. Das haben wir gemacht. Aber es sind so viele gefallen, und auf jeden getöteten Mameluken scheinen zehn neue und ausgeruhte zu kommen.«
»So hat euch unser Herrgott zu Sofia geführt, um sie zu retten und zu uns zu bringen. Die Stadt braucht jeden Kämpfer, aber gegen die Übermacht werden wir ohne ein Wunder nicht bestehen. Der verwundete Herr von Grailly und ich müssen überleben. Auch wenn wir uns noch so sehr danach sehnen, uns den Heiden entgegenzustellen, unser Opfer würde niemandem nützen. Es wartet noch eine venezianische Galeere, und ihr werdet Sofia und den Verwundeten begleiten. Ihr seid für ihren Schutz verantwortlich. Die Verteidigung der Eisenburg habe ich in die Hände des getreuen Marschalls Peter von Sevrey gelegt. Mit Gottes Hilfe gelangen wir noch hinaus und folgen König Heinrich und seinem Bruder Amalrich nach Zypern. Auf, bereitet alles vor. Holt den Wundarzt und versorgt meinen getreuen Johannes von Grailly.« Er löste sich von Sofia, die sich etwas beruhigt hatte. »Du, mein Kind, nimm deine Retter und besorgt euch in der Küche etwas zu essen.«
»Aber wie sollen wir von hier in den Hafen und auf ein Schiff gelangen? Ganz Akkon steht in den Gassen und auf der Mole, es ist kein Durchkommen, und die Feinde kommen auch noch hinzu.«
»Keine Angst, Tochter, die Erbauer dieser Festung haben auch für solche Not eine Lösung erdacht. Nun geht, stärkt euch und lasst euch auch etwas für die Reise mitgeben.«
Hug nahm Sofia wieder bei der Hand, da sie sich nicht sofort rührte, und gemeinsam fragten sie sich zur Küche der Festung durch.
»Wie hat er das gemeint, die Erbauer der Burg hätten eine Lösung erdacht?«, fragte Hug wenig später mit vollen Backen.
»Nun, die Burg ragt hinaus ins Meer, vielleicht gibt es so etwas wie eine geheime Anlegestelle«, mutmaßte Tomas.
Sofia schwieg. Sie musste sich zwingen, etwas Fladenbrot zu essen, noch immer zitterten ihr die Hände, und ihr Kopf war zu keinem klaren Gedanken fähig. Sie starrte vor sich hin, hörte nicht, was geredet wurde, und als sie zum Aufbruch gerufen wurden, folgte sie Hug.
Kapitel 2
18. Mai 1291, Akkon, Ordenshaus der Tempelritter
In der Küche der Burg herrschte reges Treiben. Die schon seit Monaten währende Belagerung war hier kaum zu spüren. Sofia hatte weder Hunger noch Appetit, lustlos knabberte sie an einem Stück Brot und starrte vor sich auf die Tischplatte. Ihre beiden Retter hingegen ließen es sich schmecken. Der, der sie die ganze Zeit mit sich gezogen hatte, stand auf, drängelte sich zwischen all den Mägden und Soldaten hindurch und sammelte ein, was er kriegen konnte. Mit Brot, Datteln, gebratenem Fleisch und zwei Trinkschläuchen kehrte er zurück und versuchte sogleich alles in Sofias Korb, den sie die ganze Zeit nicht vom Rücken genommen hatte, zu verstauen.
»Was hast du da eigentlich drinnen?«, fragte er neugierig angesichts des feuchten Strohs, das den Inhalt der Kiepe verbarg.
»Lass das! Finger weg!«, herrschte sie ihn an und drehte sich auf der Bank ihm zu, so dass der Korb auf ihrem Rücken außerhalb seiner Reichweite war. Mit zusammengezogenen Augenbrauen stierte sie ihn angriffslustig an.
»Ich wollte doch bloß …«
»Es geht dich nichts an. Es ist meins!«
»Aber«, Hug gab nicht auf, »wenn wir etwas von dem Stroh entfernen, können wir mehr Essen mitnehmen. Die Überfahrt dauert mehrere Tage.«
»Dann pack es woanders hin. Die Kraxe ist nicht für eure Vorräte da.«
»Hier.« Er reichte ihr einen der Schläuche und legte einen Teil seiner Beute neben sie auf den Tisch. »Das ist dein Teil, verstaue es, wo du willst. Du wirst es brauchen.« Er ließ sie zurück, um weitere Vorräte zu ergattern.
Sofia tat es leid, ihn so angegangen zu haben, aber der Korb auf ihrem Rücken und sein Inhalt bedeuteten ihr jetzt alles. Sie sah sich im von Rauchschwaden gedämpften Licht der großen Küche um. An den Herdfeuern loderten Flammen an Töpfen und Kesseln empor, überall auf den Tischen lag Essen: Brot, gerupfte Vögel, Früchte und Krüge mit Getränken. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Ritter in voller Rüstung schepperten zwischen den Tischen hindurch und griffen sich im Vorbeigehen einen Becher oder einen Bissen. Knappen, Fußvolk und Bogenschützen drückten sich an einem Ritter vorbei, der nun auf sie zu kam. Sein grimmiger Blick und der schwarze Bart flößten Respekt ein. Das Gesicht und der Stoff seines Umhangs waren mit Blut bespritzt. Direkt vor Sofia blieb er stehen, sah auf sie herab und musterte, was ihre Begleiter zusammengerafft hatten.
»Steht auf!«, befahl er. »Es wird Zeit. Nehmt euer Zeug und geht runter in den Hof. Haltet euch rechts an der Mauer und nehmt dann die zweite Tür. Geht so, dass ihr kein Aufsehen erregt, es gibt viele, die nicht euer Glück haben. Folgt dem Gang hinter der Tür bis zu seinem Ende, dort wird man bereits auf euch warten. Los jetzt!«
Ungeduldig wartete der Ritter, bis sie ihre Sachen zusammengepackt hatten. Sofia stand schon abmarschbereit da, als ihre Begleiter noch damit beschäftigt waren, alles, was auf dem Tisch vor ihnen gelegen hatte, in einen Sack zu stopfen. Der Größere von beiden warf ihn sich über den Rücken, und nun waren auch sie bereit zu gehen.
»Hier lang!« Der Ritter ging vor, die Leute wichen ihm respektvoll aus. Vor dem offenen Tor zur Küche blieb er stehen, drehte sich zu den Dreien um und wies ihnen den Weg: »Geht da runter, so kommt ihr in den Hof.« Er selbst eilte in die entgegengesetzte Richtung und verschwand hinter der nächsten Ecke.
»Los, wir müssen uns beeilen. Ihr habt es gehört, sie warten bereits auf uns.« Tomas schob Hug und Sofia vor sich her, die Treppe hinunter. Am Fuß der Treppe drang Tageslicht durch einen Torbogen. Sie traten hinaus, und sogleich umfing sie ein Höllenlärm. Der Hof war voller Menschen; dicht gedrängt fluchten, schimpften, weinten und flehten sie. Innerhalb der Burg, zwischen ihren massiven Mauern, war von all dem kaum etwas zu hören gewesen. Tomas, Hug und Sofia drängten sich zwischen die Leute, die so dicht standen, dass es kaum möglich war, aus der Tür hinauszutreten. Hug ergriff einen der Tragegurte an Sofias Korb und zog sie daran hinter sich her. Mit der anderen Hand schob er die Körper der Umherstehenden beiseite.
»He! Was soll das!« Er erntete unwillige Blicke und verärgerte Beschimpfungen, als er ihnen so den Weg bahnte. Sie quälten sich zwischen verschwitzten Leibern hindurch. Überall erfüllte Klagen die Luft. Verletzte ächzten vor Schmerzen, Offiziere brüllten Befehle und versuchten Ordnung in das ganze Chaos zu bringen. Greise und Frauen mit Kindern, auf dem Boden hockend, blickten Sofia mit Augen voller Angst und Verzweiflung entgegen. Sie erreichten die Mauer, doch es dauerte, bis sie endlich die empfohlene Pforte erreichten. Um dem Gedränge zu entkommen, wollte Tomas gleich nach dem Riegel greifen, doch Hug hielt ihn zurück. Sie stellten sich vor das Türblatt, stemmten sich gegen das Schieben all der Leiber und warteten ab. Die Körper waren wie ein zäher Teig, der in alle Richtungen drückte und nach Öffnungen suchte, in die er hineinquellen könnte. Hug und Tomas mussten alle Kraft aufbringen, damit sie mit Sofia in ihrer Mitte an Ort und Stelle stehenbleiben konnten. Panische Schreie fesselten plötzlich die Menge. Alle fuhren herum, um zu sehen, was geschah. Pfeile prasselten über die Mauern in den Hof. Für einen Wimpernschlag erstarrten alle im Begreifen. Diesen Augenblick nutzte Hug, die Tür etwas zu öffnen und durch den Spalt zu schlüpfen. Sofia und Tomas folgten ihm gerade noch rechtzeitig, bevor der Mob schutzsuchend an die Mauern und weg von der Fläche des Hofs drängte. Mit aller Kraft stemmten sich die drei von innen gegen das Holz der Tür, und Tomas gelang es, den Riegel vorzuschieben. Sie atmeten durch und warteten ab, bis sich ihre Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, dann stolperten sie voran. Nicht lange und sie erreichten das Ende des Gangs. Dort standen einige Soldaten, die ihnen streng und mit gezogenen Schwertern entgegensahen. »Da seid ihr ja endlich«, vernahmen sie die Stimme des Kommandanten, und die Truppe ließ die Klingen sinken. Eine Tür wurde geöffnet, und weitere Männer kamen hinzu. Zwei Ritter trugen die Bahre mit dem verletzten Johannes von Grailly, dahinter erschien Otto von Grandson. Auf sein Zeichen hin setzten sich alle sofort in Bewegung. Zuerst ging es einen leicht abfallenden Flur entlang und dann einige Treppen hinunter. An ihrem Ende wurden Fackeln entzündet, und es ging durch fensterlose Gewölbe über Stufen noch weiter runter. Die Luft wurde kühler und die Wände feucht. Unwillkürlich verstummten alle Gespräche. Hug musste Fang an einer Schnur hinter sich herziehen. Das Keuchen und Hecheln des Hundes schien Sofia nun überlaut, da die vielen Leiber das Klappern und Klirren der Waffen und Rüstungen und die schlurfenden Schritte dämpften. Ihr Weg wurde immer enger. Zuletzt konnten sie nur noch einer hinter dem anderen im Gänsemarsch vorwärts eilen. Als der Zug unversehens stehen blieb, prallte nicht nur Sofia gegen den Mann vor sich. Im Licht der Fackeln gelang ihr ein Blick über die Schultern der Männer nach vorne. Sie hatten eine mit einem schweren Gitter verschlossene Treppe erreicht. Sofia erspähte die ersten Stufen, die wieder nach oben zu führen schienen.
»Löscht die Fackeln!« Der gezischte Befehl wurde nach hinten weitergegeben, und alles versank im Dunkel. Sofia versuchte vorne etwas zu sehen, es schien ihr, als fiele auf die Stufen hinter dem Gitter Licht. Doch Männerkörper versperrten ihr immer wieder die Sicht. Sie lauschte, ein paar der Soldaten atmeten schwer. Es waren aber nicht die Träger des Verwundeten, sondern diejenigen, die sich mit dem Gitter abmühten. Die schwere Pforte war wohl lange nicht mehr bewegt worden.
»Gleich nochmal! Kräftiger!«, hörte sie jemanden ungeduldig befehlen. Den Geräuschen nach gelang es, die Sperre zu öffnen. »Zieht eure Klingen!« Die Aufforderung schnitt ihr durch Mark und Bein. »Zwei Mann vor. Gebt ein Zeichen, wenn der Weg frei ist!« Schritte die Stufen hinauf waren zu hören. Fang wurde unruhig, und Hug musste ihm die Schnauze zuhalten, damit er nicht anschlug. So war nur ein Winseln zu hören, bis endlich Bewegung in den Zug kam.
»Da bekommen wir die Trage nicht durch.« Alle, die hinter Johannes von Grailly waren, mussten erneut warten. Ächzen und Stöhnen des Verwundeten war zu hören, als einer der Soldaten ihn kurzerhand auf den Rücken nahm. Mit dieser Last nahm der Mann schwerfällig Stufen um Stufe und entschwand ihren Blicken. Die anderen rückten nach. Schließlich stand auch Sofia an der ersten Stufe und setzte zögerlich einen Fuß darauf. Was mochte sie dort oben erwarten? Wohin hatte sie der Gang geführt?
Stufe um Stufe wurde es heller, und von oben drang immer deutlicher das Lärmen unzähliger Stimmen an ihre Ohren. Mit jedem Schritt wurde es lauter, und zuletzt waren kaum noch einzelne Schreie oder Rufe zu unterscheiden.
Sofia trat hinaus unter den bewölkten Himmel an die von Rauchschwaden und Qualm geschwängerte Luft. Den Soldaten war es mit Klingen und Lanzen gelungen, etwas Platz zu schaffen, gerade genug, um den Verletzten zurück auf die Bahre zu legen. Sie versuchte sich zu orientieren. Unzählige, dichtgedrängte Menschen versperrten ihr den Blick, und es dauerte, bis ihr klar wurde, wohin der geheime Gang sie geführt hatte. Sie standen auf der Hafenmole. Zwischen Körpern hindurch gelang ihr ein Blick auf das Hafenbecken. Sie konnte kein Schiff sehen; das Wasser schäumte aufgewühlt von wild um sich schlagenden Menschen, den Rudern kleiner Boote und all jener, die hinter ihnen herschwammen. Schrille Schreie derer, die im Gedränge vom Kai gestoßen ins Wasser fielen, übertönten immer wieder das allgemeine Gebrüll.
Panisch griff sie nach Hugs Arm. »O Gott! Wir kommen hier nicht weg. Es ist kein Schiff mehr da!«
Hug drehte sich zu ihr um und schrie zurück: »Dort draußen!« Er wies in die entgegengesetzte Richtung hinaus aufs Meer. »Dort liegt die Galeere.«
Sofia blieb keine Zeit, das Rettung verheißende Schiff zu erkennen. Mit Schwertschlägen und Lanzenstößen bahnten sich die Soldaten einen Weg weiter vor zu einer Stelle, an der ein schmaler Steig auf der Meerseite hinunter zum Wasser führte. Dort standen weitere Bewaffnete und hinderten die Menschen daran, nach unten zu stürmen. Im Wasser lag ein größeres Ruderboot zum Ablegen bereit, und mit der letzten Leine in der Hand brüllte ein Mann: »Na endlich! Los, kommt! Wir können nicht mehr länger warten!« Hug zog Sofia mit sich. Der Lärm, die vielen Menschen – sie hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten und die Augen verschlossen. Gesichter, schmerzverzerrt, weit aufgerissene Münder; Flehen, Verwünschungen und Zorn drangen auf sie ein. Männer, die den Soldaten pralle lederne Geldbeutel entgegenstreckten, riefen: »Nehmt mich mit! Ich zahle euch ein Vermögen!«, »Habt Erbarmen!« Jemand krallte sich in ihre Kleidung, riss sie herum. »Hier!« Schrill und hysterisch war die Stimme der Frau. »Hier, nimm mein Kind. Rettet wenigstens mein Kind!« Mit der anderen Hand hob sie ein Bündel, aus dem das hochrote Antlitz eines brüllenden Säuglings hervorstach. Sofia starrte sie nur fassungslos an, unfähig zu handeln. Ein Soldat stieß die Frau weg und schob Hug, den Hund und sie voran. Die Trage mit Johannes von Grailly lag bereits in der Mitte des Bootes. Sofia blieb keine Zeit zu überlegen, mehrere Hände ergriffen sie und zogen sie hinüber. Hug sprang hinterher, den aufjaulenden Hund fest am Nackenfell gepackt. Auch der Mann mit der Leine sprang, und sogleich stießen die Ruderer das Boot von der Hafenmauer ab. Noch hatten sie nicht zu rudern begonnen, da sprangen bereits erste Menschen ihnen von der Mole nach. Die Soldaten mussten mit ihren Lanzen dafür sorgen, dass die im Wasser nicht den Rand des Bootes ergreifen konnten. Sie schlugen auf Hände, die sich ins Holz krallten, und die Ruderer stemmten sich in die Riemen.
»Schneller! Rudert um euer Leben!«, trieb der Befehlshaber der Barke die Männer an. »Wenn die uns zum Kentern bringen, ist alles verloren!« Bei den Worten schlug er mit seinem Schwert nach einem Mann, der sich an der Bordwand hochzuziehen versuchte. Der fiel zurück ins Wasser, das sich um ihn herum rot färbte.
Die Ruderer gaben alles, doch nur langsam gewann das Boot an Fahrt. Es lag zu tief im Wasser, und immer wieder schwappten kleine Wellen über die Bordwände. Die Soldaten erkannten die Gefahr, rissen sich die Helme von den Köpfen und begannen das Wasser, in dem sie bereits knöcheltief standen, nach draußen zu schöpfen. Tomas und Hug folgten ihrem Beispiel. Sofia stand wie gelähmt und blickte zurück auf die Stadt, von der sie sich nun langsam entfernten. Überall stieg schwarzer Rauch auf. Noch immer flogen Felsbrocken und Feuertöpfe durch die Luft. Sie sah die kleiner werdenden Menschen auf der Hafenmauer. Der Lärm von dort wurde längst durch die aufgeregten Stimmen an Bord überdeckt. Das Boot wurde von den Wellen auf und ab geworfen, gleichzeitig schwankte es bedrohlich zu den Seiten. Sofia konnte sich nur schwer auf den Beinen halten. Ich darf nicht ins Wasser fallen!, schoss es ihr durch den Kopf, und sie krallte die Hände in die Kleidung der Menschen, die so wie sie dichtgedrängt zwischen den rudernden und wasserschöpfenden Männern standen. Gerne hätte sie sich hingesetzt, doch das war bei dem Gedränge unmöglich. Sie warf den Kopf herum und konnte nun die langsam größer werdende Galeere sehen. Um das mächtige Schiff herum dümpelten ein paar kleine Boote im Meer, und auch ihre Schaluppe wurde von zwei weiteren kleinen, überladenen Nachen verfolgt. Ihr Kommandant hatte das ebenfalls bemerkt. Mit rauer Stimme brüllte er die Ruderer an: »Rudert! Schneller! Oder muss ich euch die Peitsche geben? Schneller!«
Sie wurden wirklich schneller. Lag es daran, dass es den Soldaten gelungen war, das meiste Wasser zurück ins Meer zu schöpfen, und nun nicht mehr so viel über die Bordwände schwappte, oder weil sie einfach mit zehn Rudern mehr Fahrt machen konnten. Der Abstand zu den folgenden kleinen Booten wurde größer. Die stehenden Menschen rückten enger zusammen und krallten sich alle aneinander fest.
Als sie endlich längsseits gingen, brach fast Panik aus, da alle sofort auf die Galeere gelangen wollten. Die Besatzung hieb mit Fäusten auf die Drängelnden ein. »Zurück!«, brüllte ihr Befehlshaber. »Oder ich werfe euch eigenhändig ins Wasser! Zuerst der verwundete Herr! Und ihr da! Passt auf! Nehmt die Lanzen!«, befahl er den Soldaten, die auf der Meerseite des Kahns standen, und wies auf die langsam herankommenden anderen Boote.
Oben von der Reling der Galeere wurden Stricke hinuntergeworfen und in Windeseile an der Bahre des verletzten Ritters befestigt. Er wurde angehoben und an Bord gezogen. Dann durften auch alle anderen die hilfreich entgegengestreckten Hände ergreifen und auf das Schiff klettern. Sofia streckte die Arme aus, ihre Begleiter, beladen mit ihrer Habe, griffen in die Gurte ihrer Kiepe und zogen sie mit sich. Erschöpft landete sie auf alle vieren an Deck. Sie musste Platz für die Nachfolgenden schaffen und kroch auf Händen und Knien blindlings vorwärts, so weit es möglich war. Auch hier standen die Menschen dichtgedrängt, und als sie nicht mehr weiterkriechen konnte, richtete sie sich auf, und irgendwer half ihr auf die Beine. Sofia versuchte dem Gedränge zu entkommen. Wild sah sie sich nach ihren Begleitern um. Vaters Ledertasche hatte sie, der Riemen schnitt ihr in die Schulter und quer über die Brust. Die Kiepe noch immer auf dem Rücken, tat sie sich schwer, sich zwischen all den Leibern hindurchzuzwängen. Sie blieb an Kleidung hängen, unwillig wurde sie beiseite geschubst, und so gelangte sie schließlich etwas abseits an die Reling. Sie sah hinunter. Der Kahn, der sie hergebracht hatte, war leer und wurde nun sich selbst überlassen. Kaum war der letzte Mann mit einem Sprung in die Seile der Galeere raus aus dem Boot, wurden an Bord Befehle gebrüllt. Unzählige Ruder tauchten an der Seite auf, tauchten sogleich ins Wasser und verwandelten es in ein brodelndes Chaos. Die Sklaven unter Deck stemmten sich mit aller Kraft dagegen, Menschen aus den herangekommenen Booten versuchten sie zu ergreifen. Die Ruderer wehrten sich, einige schwangen die langen Holme über dem Wasser und fegten damit Menschen ins Meer. Über Sofia knatterte das große Segel, als es sich im Wind ausbreitete. Der Wind blähte den Stoff, der Mast ächzte, und das Schiff gewann, sich leicht neigend, an Fahrt. Die Ruder waren frei und tauchten in gleichmäßigem Takt ein. Rasch vergrößerte sich der Abstand zu den Flüchtlingsbooten. Jetzt gab es kein Zurück.
Sofia schaute auf die Stadt. Überall türmten sich schwarze Rauchsäulen auf, wurden vom Wind schräg nach oben getrieben, vereinten sich und verschwammen schließlich im Grau der niedrig hängenden Wolkendecke. Abgesehen von den vielen kleinen Booten der Verzweifelten lagen nur noch zwei Galeeren in sicherer Entfernung vorm Hafen – weit genug draußen, dass niemand sie erreichen konnte. Die Menschenmenge auf der Hafenmole wirkte auf Sofia wie ein zitternder Strick, eine Borte am Rand des dunklen, graublauen Stoffs der See. Der Turm der Fliegen und die Felsenfestung der Templer hoben sich vom helleren Gelbgrau der Stadt ab. Sofia stand da wie versteinert, mit beiden Händen an der Reling Halt suchend, den Blick auf die sich entfernende Stadt gerichtet.
Ruder und Segel trieben das Schiff voran. Was sich angesichts der Lage an Land als gutes Schicksal anbot, wurde auf offener See rasch zur Bedrohung. Es begann zu regnen, und der Kapitän ließ die Segel verkleinern. Gerade noch rechtzeitig, bevor die erste Sturmbö heranrauschte, den Regen übers Deck peitschte und eine Flut an Befehlen, aber auch Panik und Angstschreie hervorrief.
Noch immer standen die meisten Menschen dichtgedrängt in der Mitte des Schiffes. Die Herren und Templer waren nicht zu sehen, sie hatten wohl Schutz im Aufbau am hinteren Ende der Galeere gefunden. Die Soldaten hingegen hatten sich so wie die meisten anderen Plätze gesucht, wo sie nicht im Weg waren, hatten ihre Bündel fallen gelassen und sich dazugesetzt. Einige saßen allein für sich, anscheinend in Gedanken versunken, andere hatten sich zusammengesetzt, unterhielten sich oder hatten damit begonnen, gegenseitig ihre Blessuren zu verarzten. Dazwischen huschte die Besatzung umher, behände, barfuß und jeden Befehl sofort umsetzend. Wer im Weg stand, wurde einfach zur Seite gestoßen.
»Räumt das Deck!« Der Befehl des Kapitäns wurde weitergetragen, gebrüllt von Mann zu Mann. Nicht wissend, was zu tun war, schauten die Menschen fragend in die Runde. Einige erhoben sich, und schon begannen Matrosen, die Passagiere zusammenzutreiben, sie wie Schafe vor sich her zu schubsen und ihnen den Weg unter Deck zu zeigen. Andere erschienen mit Seilen, die sie zwischen den Masten und der Reling spannten. Sofia nahm von all dem keine Notiz. Ihr Blick war aufs Meer gerichtet, dorthin, wo sie zuletzt Land gesehen hatte.
Die Wolken wurden dunkler und standen bedrohlich tief, Blitze zuckten zwischen ihnen und dem Meer, der Regen wurde stärker. Gerade noch rechtzeitig ließ der Kapitän die Segelflächen weiter verkleinern. Kurz wurde ihre Aufmerksamkeit von dem Manöver und den Seeleuten, die mit der riesigen Stoffbahn kämpften, gefesselt. Dann war da auf einmal dieses Sausen in ihren Ohren, und sie sah hinaus auf das wogende Meer. Sie konnte die Sturmbö herankommen sehen, wusste allerdings zuerst nicht, was es war. Das Meer hatte dort eine andere Farbe, und es kam ihr vor wie eine immer näher kommende, in Panik geratene Tierherde. Es sah aus wie ein mächtiger Schatten, eine riesige, dunkle Hand, die unaufhaltsam nach ihr und dem Schiff greifen wollte. Für einen Lidschlag erschlafften die Segel, und dann fühlte sie mit einem Mal, was sie da gesehen hatte. Es riss an ihren Haaren und Kleidern, mit einem Knall blähten sich die Segel bis zum Zerreißen auf, die Masten knurrten wie angriffslustige Wölfe, das ganze Schiff wurde niedergedrückt, neigte sich stark zur Seite, und jede einzelne Planke schien zu erzittern. Die Menschen schrien, wurden durcheinander geworfen, fielen übereinander, rollten hinab zum Rand des Schiffes, an dem das Meer leckte.
Kann es nicht einfach vorbei sein?, dachte Sofia. Waren die Flutwellen der Fliehenden in den Gassen nicht genug gewesen? Die Wellen der Angreifer, die sie vor sich hergetrieben hatten, der Geschosshagel der Katapulte, die zischenden und prasselnden Pfeilwolken, die auf die Stadt und ihre Menschen herniedergegangen waren? Welcher Gott ließ hier seinem Zorn freien Lauf?
Gischt spritzte ihr ins Gesicht. Kalt und wie kleine Nadeln stachen Regen und Meer in ihre Wangen. Sie schmeckte das salzige Wasser auf den Lippen, klammerte sich an die Bordwand und schaute trotzig auf die immer gewaltiger werdenden schwarzen Wellen. Auf einmal lag all ihr Hoffen in dem Wunsch, das Schiff würde kentern, auseinanderbrechen und untergehen. Zitternd spürte sie, wie aller Lebenswille von ihr wich, ihre Beine kraftlos nachgaben. Angst, Verzweiflung und der Schrecken drückten sie nieder. Die Wucht, mit der eine mächtige Woge gegen den Schiffsrumpf prallte, riss ihr die Hände von der Reling und warf sie zu Boden. Tosend schlug das Meer über den Rand der Galeere. Sie spürte den Sog, rang nach Luft, schluckte Wasser und suchte panisch nach Halt. Das Wasser warf sie gegen die Bordwand, sie stemmte die Füße gegen das Holz der Planken und drückte sich mit aller Kraft in eine Nische zwischen der Wand und einem mächtigen Sparren. Als das Wasser abfloss, war sie durch und durch nass, zog die Beine an und umklammerte am ganzen Leib zitternd ihre Knie. Es war, als versuchte sie sich selbst zusammenzuhalten, noch kleiner zu machen, unbedeutend für die See, versteckt in dieser Nische. Doch es gab kein Entrinnen. Sie konnte sich vor dem Meer nicht verstecken. Die nächste Woge brach über ihr zusammen, zog an ihr, drückte sie im nächsten Augenblick wieder gegen die Bordwand, nahm ihr vor allen Dingen die Luft zum Atmen. Sie spürte die Kälte und den Sog des Wassers, schnappte nach Luft, schluckte aber nur salziges Wasser, musste husten und versuchte verzweifelt den Atem anzuhalten. Es brannte in ihrer Brust. Das Wasser musste doch ablaufen, oder war sie bereits über Bord gespült worden? Sie traute sich nicht, die Augen zu öffnen, konnte aber deutlich die Kante des Balkens in ihrem Rücken spüren. Ihre Hände suchten fahrig nach etwas zum Festhalten, als plötzlich der Griff einer fremden Hand um ihr Handgelenk alles um sie herum vergessen machte. Die Faust um ihren Unterarm griff hart zu, der Schmerz zwang sie zur Gegenwehr. Sie riss die Augen auf, doch mehr als einen Schatten konnte sie nicht erkennen. Der Schrei, den sie ausstieß, wurde sogleich vom Meer erstickt. Erneut schluckte sie Wasser. Verzweifelt nach Luft schnappend, gelang es ihr nicht, sich weiter zur Wehr zu setzen. In ihrem Kopf blitzte das Bild des Feindes auf, der sich auf sie geworfen hatte. Sie riss an ihrem Arm und strampelte mit den Beinen. Die fremde Hand ließ nicht los und zog sie von der Reling weg. Reflexartig krallte sie die freie Hand um die Ledertasche und den Riemen des Korbes. Der Schatten zerrte sie über Deck, stellte sie auf die eigenen Füße, doch schon die nächste Woge, die über das Schiff brach, zog ihr die zitternden Beine unter dem Körper wieder weg. Dem Fremden schien das Meer nichts anhaben zu können. Er stand fest auf den Beinen und setzte seinen Weg fort. Sofia erkannte in ihm einen der Besatzung, der ihr kurz aufgrund seiner Größe und des kraftvollen Auftretens aufgefallen war. Etwa in der Mitte des Schiffes beugte er sich herunter, öffnete eine Luke im Deck, schubste sie über das Loch und ließ sie hineinfallen. Er hielt sie aber nach wie vor fest, bremste ihren Fall, und erst als er spürte, dass sie Boden unter den Füßen hatte, ließ er los. Mit einem dumpfen Knall schloss sich die Luke wieder. Sofia verlor das Gleichgewicht und fiel zwischen andere Körper.
»He, pass auf!«, herrschte sie jemand an. Sie wollte sich entschuldigen, schnappte nach Luft, es war stickig und feucht, und die Mischung aus Schweiß, nassen Kleidern und Erbrochenem stach ihr in der Nase. Sie spürte Schwindel, dumpfen Druck im Bauch und musste sich sofort übergeben. Immer wieder aufs Neue verkrampfte sich ihr Inneres und zwang sie zum Spucken und Würgen auf allen vieren. Eiskalter Schweiß stand ihr auf der Stirn. Das Tosen des Sturms, der Wind und das Schlagen der Wogen drangen nur gedämpft in den Raum. Lauter waren das Ächzen und Knarren des Holzes und die Menschen um sie herum. Kinder weinten, Frauen gaben hysterische Schreie von sich, Männer brüllten um Hilfe, andere beteten lauthals, und einige fluchten vernehmlich Gott. Ohne jegliche Orientierung wusste sie gerade mal, wo oben und unten war. Sie kämpfte mit den unvorhersehbaren Bewegungen des Schiffes, spürte das Rollen des Schiffsrumpfs, stemmte sich gegen das entstehende Gefälle, als eine Woge den Bug hob, und verlor beinahe den Halt, als sich das Schiff über den Wellenkamm, Bug voran, wieder in die Tiefe stürzte. Ihr Magen rebellierte erneut, alles in ihrer Mitte zog sich krampfhaft zusammen, und der Würgereiz erstickte ihren Aufschrei, als sie über die Planken zu rutschen drohte. Wellenartig kamen die Krämpfe. Sie übergab sich in einem Schwall, noch einmal und immer wieder, bis nichts mehr übrig zu sein schien. Doch ihre Muskeln krampften weiter. Sie spürte den Schweiß auf ihrer Haut, und gleichzeitig fror sie in den nassen Kleidern. Wieder und wieder musste sie würgen. Unbeherrscht zitternd rannen ihr Spucke und Galle aus dem Mund. Sie schluckte, holte vorsichtig Luft und suchte nach einem Hoffnungsschimmer. Ihre Augen hatten sich nun an die Dunkelheit gewöhnt. Von dem mittleren Balken über ihrem Kopf hingen zwei Laternen und gaben durch die dünngeschabten Tierhäute ein jämmerliches gelbes Licht ab, in dem kaum Einzelheiten zu erkennen waren. Ihr Körper zog sich erneut zusammen. Vor Anstrengung rauschte ihr das Blut in den Ohren, und dazwischen drang nur das Husten und Würgen der anderen zu ihr. Das Knarren und Ächzen der Balken und des Mastes übertönten die Geräusche des Sturms. Doch die unvorhersehbaren Bewegungen des Bodens unter ihr und das Wasser, das durch ein paar Ritzen und an der Luke jedes Mal, wenn eine Woge über das Schiff brach, zu ihr heruntertropfte, stellten klar, dass der Sturm nach wie vor mit unverminderter Kraft wütete. In der Gefahr an Deck war ihr Geist fast leer gewesen, doch jetzt meldete er sich und flüsterte ihr ein, dass sie sich in einer Vorhölle befand, in einem nassen Grab, einem Sarg, der in einem Wasserloch versenkt wurde. Das Holz um sie herum schrie wie der Teufel, und sie, so wie alle Seelen um sie herum, stöhnte, schrie auf und brabbelte Gebete ob der ihr bereiteten Qualen. Sie kniete mit gespreizten Beinen, um sich gegen die seitlichen Bewegungen abzustützen, vornüber auf den Ellenbogen, die Stirn in die kalten, nassen Hände gelegt, übergab sich erneut. Die Wellen der Krämpfe nahmen ihr jegliche Kraft, die Geräusche und der Gestank drohten ihr den Verstand zu rauben. Ich muss hier raus! Dieser impulsive Gedanke schien alles, was ihr an Stärke verblieben war, zu mobilisieren. Mit einem Ruck richtete sie sich auf, kniete aufrecht, suchte mit einer Hand Halt an dem Balken über sich und wollte sich gerade auf die Füße stellen, als ein schwerer Brecher das Schiff traf. Der gesamte Schiffskörper erbebte, die Galeere neigte sich krängend zur Seite, die Menschen ohne Halt stürzten durcheinander und wurden in eine Richtung geworfen. Auch Sofia taumelte ins Dunkel, schlug mit dem Kopf hart gegen die Bordwand und verlor das Bewusstsein.
Kapitel 3
19. Mai 1291, Überfahrt nach Zypern
Polternde Schritte, ein Scharren und Bewegungen ganz in ihrer Nähe holten sie aus der Bewusstlosigkeit heraus. Hinter den geschlossenen Augenlidern war es nicht mehr schwarz. Dann kam stechend der Schmerz, bohrend im Kopf, dumpf in allen Gliedern. Sie verzog das Gesicht. Es kostete sie Anstrengung, die Augen zu öffnen. Das Erste, was sie sah, war das Holz der Planken und die Wasserlache, in der ihre Wange lag. Dann aufdringlich hell das Viereck der Luke. Mühsam richtete sie sich auf. Der Schmerz hämmerte in ihrem Schädel, ihr war schwindelig. Sie schluckte, die Zunge schien ihr am Gaumen zu kleben, und sie verspürte unbändigen Durst. Sie sah Schatten, Leute, die sich bewegten, zur Leiter hin, zum Licht, und mit jedem Körper, der durch das helle Viereck ihren Blicken entschwand, wuchs in ihr der Wunsch, es ihnen gleichzutun. Vorsichtig setzte sie sich auf. Ihr Schädel drohte schier zu zerspringen. Sie rappelte sich auf, stützte sich an der nahen Bordwand ab und kam auf die Beine. Ihr ganzer Körper schmerzte, als habe man sie verprügelt, das Stechen im Kopf ließ etwas nach. Sie fühlte sich kaum in der Lage, einen Fuß zu heben. Immer noch bewegte sich der Boden unter ihr und ließ sie schwanken. Und wieder war da das flaue Gefühl im Magen – der Vorbote neuer Übelkeit. Stückweise schob sie einen Fuß über die Planken und zog den anderen nach. Ein Balken über dem Kopf bot ihr Halt, und sie schlurfte weiter. Schon beinahe am Fuß der Leiter angekommen, erinnerte sie sich an ihre Habe. Suchend sah sie sich um. Als erstes entdeckte sie die Kiepe. Zusammen mit anderen Bündeln klemmte sie zwischen zwei mit dicken Tauen gesicherten Fässern. Überall zwischen der Ladung konnte sie Körbe und nasse Kleidung erspähen. Sie wankte hin zu ihrer Trage, zog sie hervor und lehnte sie an die Bordwand. Die lederne Tasche des Vaters war nicht dabei. Verzweifelt versuchte sie im Halbdunkel das heillose Durcheinander zu erfassen. Sie spähte hinter die Fässer, hob das ein oder andere von Nässe triefende Kleidungsstück hoch und arbeitete sich an der Bordwand entlang, da sie ohne Halt nicht stehen konnte. Auch andere waren dabei, ihr Hab und Gut einzusammeln, oder waren es Diebe? Panik ergriff sie, und als sie jemanden bemerkte, der an einem ledernen Riemen zog, vergaß sie Schmerz, Schwindel und Unwohlsein. Mit wenigen Schritten war sie bei dem Mann und griff zu, und als ihr Ruck wirklich die gesuchte Tasche zum Vorschein brachte, riss sie diese ungestüm an sich.
»Das ist meine!«, zischte sie mit rauer Stimme. »Gib her!« Verdattert ließ der Fremde los. Sofia hörte nicht mehr, was er erwiderte. Fest presste sie die Tasche des Vaters mit einem Arm an ihre Brust, torkelte zu ihrem Korb, legte sich den Riemen der Tasche über die Schulter und zog die Kiepe mit zur Leiter. Das Licht blendete sie, und die Stiche im Kopf wurden wieder stärker. Mit Mühe kletterte sie an Deck, kroch auf allen vieren ein Stückchen weiter und ließ sich bei ein paar anderen, mit einer Kiste im Rücken, auf ein von der Sonne erhelltes Plätzchen fallen. Tief sog sie die frische Luft ein. Ihre spröden Lippen und die Trockenheit im Mund brannten. Die Leute neben ihr reichten einen Krug herum. Sie musterte die Gesichter. Keines kam ihr bekannt vor.
»Habt ihr für mich auch etwas?«, fragte sie und deutete auf den Krug. Die anderen sahen sie an. »Bitte, trinken«, stammelte sie verzweifelt, und man reichte ihr das Gefäß. Sie griff zu, setzte es ungeduldig an die Lippen, das Wasser füllte ihren Mund, doch sie fühlte sich unfähig zu schlucken. Es lief ihr zu den Mundwinkeln heraus. Sie musste absetzen, zwang sich zu schlucken und hob den Krug erneut. Vorsichtig und langsam sog sie die Flüssigkeit ein, spürte die Kühle auf der Zunge, schmeckte Salz und trank. Nach mehreren Schlucken musste sie erschöpft innehalten. Ein Mann streckte die Hand aus, und sie ließ sich willenlos von der Labsal trennen. Angst, die Übelkeit könnte sich wieder ihrer bemächtigen, breitete sich in ihr aus. Kraftlos sank sie zur Seite, zog die Beine an und schloss resignierend die Augen. Die Bewegung des Schiffes, das Rauschen des Wassers und die allgemeine Unruhe an Bord drangen nur noch wie aus weiter Ferne zu ihr. Deutlicher spürte sie da schon den sanften Wind auf ihrer Haut und die Wärme der Sonne. Ein Schatten fiel auf sie, und sie spürte, wie jemand eine Decke über sie legte; sie war allerdings außerstande, die Augen zu öffnen. Es war nicht einfach Müdigkeit, sie fühlte sich wie noch nie in ihrem Leben vollkommen kraftlos, nicht mal mehr in der Lage, einen Finger zu krümmen. Sie sehnte sich danach, dass alles um sie herum einfach verschwinden würde, dass alles, was sie umfing, und erst recht alles, was geschehen war, nicht mehr existieren würde. Verzweiflung breitete sich wieder in ihr aus, als das Gefühl einer unerwarteten Nähe sich ihrer bemächtigte. Es gelang ihr, die Augenlider ein wenig zu öffnen. Der Hund war zu ihr gekommen, schnupperte an der Decke, und mit einem Mal drehte er sich tänzelnd mehrmals um die eigene Achse und ließ sich dann direkt neben ihr nieder. Noch einmal richtete er sich etwas auf, schob seinen Körper an den ihren und legte mit einem Schnaufen den Kopf auf seinen Vorderläufen ab. Die Nähe des warmen Tierkörpers vermochte in ihr ein angenehmes Gefühl zu wecken. Mit einer matten Bewegung hob sie einen Zipfel der Decke und legte sie zusammen mit ihrem Arm über Fangs Rücken. Die Erschöpfung spülte sie aus dem späten Vormittag des Tages nach dem Sturm, und eine willkommene Dunkelheit schlug wie eine Welle über ihrem Geist zusammen.