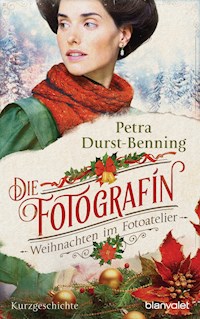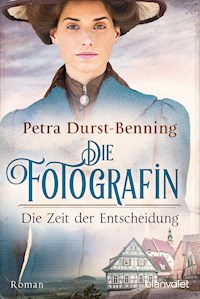9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fotografinnen-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Wanderfotografin macht sich auf nach Hollywood – der perfekte Schmökerstoff von der Königin des historischen Romans.
Gerade erst haben sich Mimi Reventlow und ihr langjähriger Geschäftspartner Anton ihre Liebe gestanden. Und dennoch entscheidet sich die Wanderfotografin wie vor vielen Jahren schon einmal gegen den sicheren Hafen der Ehe und bricht stattdessen zu neuen Ufern auf! An der Westküste Amerikas – genauer gesagt in Hollywood – wartet ein spannender Auftrag auf sie. Für einen großen Bildband soll Mimi den derzeit größten weiblichen Stummfilmstar der Vereinigten Staaten fotografieren. Was Mimi nicht weiß: Die berühmte Schauspielerin »Chrystal Kahla« ist niemand anderes als Christel Merkle, das Mädchen, das seit einem kalten Wintertag im Jahr 1911 in Laichingen als spurlos verschwunden gilt ...
Die SPIEGEL-Bestsellersaga um Fotografin Mimi bei Blanvalet:
1. Am Anfang des Weges
2. Zeit der Entscheidung
3. Die Welt von morgen
4. Die Stunde der Sehnsucht
5. Das Ende der Stille
Jeder Band kann auch unabhängig von den anderen gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Gerade erst haben sich Mimi Reventlow und ihr langjähriger Geschäftspartner Anton ihre Liebe gestanden. Und dennoch entscheidet sich die Wanderfotografin wie vor vielen Jahren schon einmal gegen den sicheren Hafen der Ehe und bricht stattdessen zu neuen Ufern auf! An der Westküste Amerikas – genauer gesagt in Hollywood – wartet ein spannender Auftrag auf sie. Für einen großen Bildband soll Mimi den derzeit größten weiblichen Stummfilmstar der Vereinigten Staaten fotografieren. Was Mimi nicht weiß: Die berühmte Schauspielerin »Chrystal Kahla« ist niemand anderes als Christel Merkle, das Mädchen, das seit einem kalten Wintertag im Jahr 1911 in Laichingen als spurlos verschwunden gilt …
Autorin
Petra Durst-Benning wurde 1965 in Baden-Württemberg geboren. Seit über zwanzig Jahren schreibt sie historische und zeitgenössische Romane. Fast all ihre Bücher sind SPIEGEL-Bestseller und wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. In Amerika ist Petra Durst-Benning ebenfalls eine gefeierte Bestsellerautorin. Sie lebt und schreibt abwechselnd im Süden Deutschlands und in Südfrankreich.
Mehr Informationen zur Autorin und ihren Büchern finden Sie auf ihrer Homepage www.durst-benning.de oder in der App von Petra Durst-Benning.Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlagund www.facebook.com/blanvalet.
Band 5
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Abdruck des Zitats von Henri Cartier-Bresson mit freundlicher Genehmigung der Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris.»Stufen«, aus: Hermann Hesse, Sämtliche Werke in 20 Bänden. Herausgegeben von Volker Michels.Band 10: Die Gedichte. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2002. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.
Copyright © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gisela Klemt
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Cory Seamer, antoniradso, Petra Christen, PhuchayHYBRID, MarkauMark, Vasya Kobelev), photocase.de (kemai) und Richard Jenkins Photography
Die Bilder im Anhang stammen aus dem Privatarchiv von Petra Durst-Benning
KW · Herstellung: Sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23082-1V004www.blanvalet.de
»Of course it’s all luck!«
Henri Cartier-Bresson (1908–2004)
1. Kapitel
April 1919
Es gab Momente im Leben, in denen Mimi immer noch Angst vor der eigenen Courage bekam. Und das, obwohl sie als Wanderfotografin und Unternehmerin bisher noch vor keinem Abenteuer zurückgeschreckt war.
Doch nun war solch ein Moment.
Nach einer sechstägigen Atlantik-Überfahrt auf dem Schnelldampfer Viktoria erschien vor ihr, nur noch ein paar Hundert Meter entfernt, auf einer kleinen Insel die berühmteste Statue der Welt, die Freiheitsstatue.
Mimis Herz klopfte bis zum Hals, und fast kamen ihr die Tränen. Was für ein bewegender Moment!
Wie stolz die Freiheitsstatue ihren rechten Arm mit der Fackel in der Hand in die Höhe reckte! Und dann die riesige Krone mit den sieben Zacken, von denen jeder für einen der sieben Kontinente stand. Der Anblick war so beeindruckend, dass er Mimi fast körperlich schmerzte.
Gustav Rühmann, ein älterer Herr, mit dem sie mehrmals im großen Speisesaal zu Abend gegessen hatte, hatte ihr erzählt, dass ein Franzose – Frédéric-Auguste Bartholdi – die Statue entworfen hatte und dass sie Libertas, die römische Göttin der Freiheit darstellte.
Freiheit – genau das empfand Mimi hier und jetzt, als das Schiff in die Upper Bay einfuhr.
Hätte ihr Anfang des Jahres jemand erzählt, dass sie noch in diesem Frühjahr auf dem Weg nach Amerika sein würde – sie hätte denjenigen für verrückt erklärt! Und doch hatte sie sich die Freiheit genommen, alle bisherigen Pläne über den Haufen zu werfen und diese Reise anzutreten.
Freiheit. Verführerisch süß und gefährlich bitter zugleich.
Während der Schnelldampfer von Hamburg über Southampton und Cherbourg nach New York unterwegs gewesen war, war Mimi dieses große Wort immer wieder begegnet.
»Ich nehme mir die Freiheit, am Ende meines Lebens meinen großen Lebenstraum wahrzumachen – den ›wilden Westen‹ zu sehen, über den ich in Karl Mays Romanen so viel gelesen habe!«, hatte beispielsweise Gustav Rühmann gleich bei ihrem ersten Abendessen verkündet. Und angefügt, dass es für ihn zu Hause nach dem Tod seiner geliebten Frau außer Einsamkeit und Langeweile nichts mehr gegeben hatte. »Sollte ich darauf warten, bis Gevatter Tod mich zu sich holt? Da schaue ich mir doch lieber an, wo Winnetou den Schatz im Silbersee entdeckt hat!«
Dass sie mit ihren vierzig Jahren das »Abenteuer Amerika« wagte, fand Mimi schon äußerst aufregend. Aber mit siebzig auch noch so viel Unternehmungs- und Abenteuerlust an den Tag zu legen – darüber konnte sie nur staunen. Genauso staunte sie über die Hartnäckigkeit, mit der der alte Herr Englisch büffelte und sie ebenfalls dazu animierte! Als Bankdirektor in Hamburg hatte er des Öfteren mit englischen Kunden zu tun gehabt, und so verfügte er schon über einen leidlich guten Wortschatz. Doch das reichte dem Senior nicht. Und so verbrachten Mimi und er mindestens vier Stunden mit dem Lernen von Vokabeln und versuchten gleich, diese in kurzen Sätzen zu verwenden. »Hello, my name is Mimi Reventlow, I’m a german photographer!« Mimi war erstaunt, wie schnell ihr Schulenglisch, das sie einst auf dem Berliner Gymnasium gelernt hatte, wieder präsent war. Sich in der Landessprache einigermaßen verständigen zu können – auch darin lag eine große Freiheit, befanden Gustav Rühmann und sie.
Doch nicht nur im eleganten Ambiente der ersten Klasse war von Freiheit die Rede gewesen. Wann immer Mimi vor dem Abendessen auf Deck gegangen war, um den Sonnenuntergang zu bewundern, hatte sich dort zur selben Zeit ein Grüppchen von Männern eingefunden, die bei einer Zigarette über die großen Chancen sprachen, die sie sich allesamt in Amerika erhofften. Sie nahmen sich die Freiheit, mehr vom Leben zu wollen als das, was ihnen bisher zuteilgeworden war.
Im Grunde saßen sie hier alle sprichwörtlich im »selben Boot«, dachte Mimi, während vor ihnen Manhattan mit seinen berühmten Wolkenkratzern immer besser zu sehen war. Der Witwer und sie, die Auswanderer mit ihren vielfältigen Schicksalen und Geschichten – sie waren allesamt Menschen, die voller Abenteuerlust einen Neuanfang wagten.
Du lieber Himmel, worauf habe ich mich hier schon wieder eingelassen, dachte Mimi und kämpfte plötzlich gegen ein flaues Gefühl in ihrer Magengegend an, während es um sie herum immer geschäftiger wurde – sowohl die Crew als auch die Passagiere bereiteten sich auf die Ankunft in Ellis Island vor. Da Mimi schon am frühen Morgen alles gepackt hatte, konnte sie den Blick auf die berühmte »Skyline« von Manhattan noch ein bisschen länger genießen. Bald würde sie zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten – was da wohl alles auf sie zukam?
Abschiede und Neuanfänge. Die Aufregung beim Gedanken, nicht zu wissen, was einen erwartete – für sie, die Wanderfotografin, war dies nichts Neues. Und dennoch war die Reise nach Amerika das vielleicht größte Abenteuer ihres Lebens, vor allem vor dem Hintergrund, dass eigentlich alles ganz anders geplant gewesen war.
Aber wie hatte sie zu Anton gesagt, als er sie nach Hamburg begleitet hatte? »Manchmal muss man gehen, um zurückkommen zu können.«
Mimis Entscheidung, diese Reise anzutreten, war ausgerechnet am Hochzeitstag ihrer Freundin Bernadette gefallen. Nie in ihrem ganzen Leben würde sie diesen verrückten Tag vergessen, dachte Mimi und wickelte ihren Schal enger um sich. Obwohl der Dampfer sich nun schon in der schützenden Bucht von Manhattan befand, war eine frische Brise aufgekommen, und Mimi kam es so vor, als würden ihre Gedanken vom Wind nochmals gen Heimat geweht …
So viel war an diesem 22. März 1919 geschehen! Es war ein Samstag gewesen, Mimi erinnerte sich noch ganz genau. Was für ein schöner Tag zum Heiraten!, hatte sie gedacht, während sie sich vor ihrer Schlafzimmerkommode hübsch machte. Draußen vor dem Fenster hatten Meisen, Amseln und Spatzen im Nussbaum um die Wette gezwitschert. Im Garten lugten schon die ersten Krokusse aus dem Boden, und Mimi war sich sicher gewesen, dass die Sonne es an diesem besonderen Tag auch noch durch die dünne Wolkendecke schaffte. Kein Märzenwinter in diesem Jahr!
Fast wehmütig, dachte Mimi daran zurück, mit wie viel Freude sie sich zur Feier des Tages eine besonders aufwendige Hochsteckfrisur gemacht hatte. Nachdem es endlich wieder eine ordentliche Seife zu kaufen gab, hatten ihre Haare den alten Glanz zurückbekommen und strahlten mit den kleinen Diamantohrringen, die Mimi angelegt hatte, um die Wette. Clara vom Bodensee hatte Rosencreme geschickt und ein winziges Fläschchen Parfüm. Endlich konnte sie sich wieder als Frau fühlen und nicht nur als Arbeitsbiene, war ihr durch den Kopf gegangen, während sie einen Tropfen des edlen Duftes auf den Zeigefinger ihrer rechten Hand tupfte und ihn dann hinter ihren Ohren verrieb.
Das erste Frühjahr ohne Krieg – sie alle hatten es so sehr genossen. Und die Hochzeit von Bernadette und Lutz setzte all dem noch die Krone auf.
Der Mut der Schafbaronin, zum dritten Mal »Ja« zu sagen, wo sie schon zweimal kurz vor dem Traualtar von ihren Verlobten sitzen gelassen wurde, war bewundernswert. So lautete die einhellige Meinung im ganzen Dorf. Und nun wurde der Mut durch eine große Liebe belohnt. Mimi wusste, dass Bernadette aus lauter Angst, dass doch noch etwas schiefging, seit Wochen nicht mehr schlief. Wahrscheinlich würde die Braut in der Hochzeitsnacht erschöpft in die Laken sinken und eine Woche lang durchschlafen! Schmunzelnd rückte Mimi den kleinen Spitzenkragen zurecht, mit dem sie ihr altes, blaues Ausgehkostüm geschmückt hatte.
Anfang Februar, noch im tiefsten Winter, waren Bernadette und sie nach Reutlingen gefahren – sie, Mimi, hatte sich ein neues Kostüm schneidern lassen wollen. Doch die Stoffe, die die Schneiderin ihnen vorgelegt hatte, waren allesamt ein wenig verblichen gewesen und hatten muffig gerochen – Überbleibsel aus Vorkriegszeiten, welche die Schneiderin so lange gehütet hatte, dass sie nun zu nichts mehr zu gebrauchen waren. Mimi, die für aufgewärmten Kaffee noch nie etwas übrig gehabt hatte, hatte dankend abgelehnt. Wenn schon, dann wollte sie etwas Frisches, Schönes zum Anziehen! Und so hatte sie sich lediglich ein kleines Spitzenkrägelchen gegönnt. Bestimmt gab es bald wieder die schönsten Stoffe zu kaufen, bis dahin würde sie sich gedulden.
Auch Bernadette musste sich bescheiden – aufwendige Spitzenstoffe gab es nirgendwo zu kaufen, und so bestand ihr Brautkleid aus einem schlichten, wenn auch schweren Satinstoff, der sogar für eine lange Schleppe gereicht hatte.
Für Lutz würde Bernadette sowieso die schönste Braut sein, dachte Mimi. Dass der gut aussehende Chef des Truppenübungsplatzes die Schafbaronin liebte, hatte sie erstaunlicherweise schon bei ihrem allerersten Treffen geahnt, damals im Herbst 1913, noch lange bevor die beiden selbst es wussten.
So viele Jahre waren Bernadette und Lutz gute Freunde gewesen, die ganzen schrecklichen Kriegsjahre hatten sie gemeinsam durchgestanden. Immer wieder hatte Lutz in seiner Funktion als oberster Chef des Soldatenlagers Bernadette, der Bürgermeisterin, unauffällig, aber effektiv geholfen, das schlimmste Unheil vom Dorf abzuwenden. Und dann …
Dass aus Freunden Liebende wurden, war gar nicht so ungewöhnlich, man musste ja nur Anton und sie anschauen, dachte Mimi nun, während ein mitreisender Passagier ihr einen auffordernden Blick zuwarf. Doch sie hatte keine Lust auf Konversation, stattdessen ließ sie ihren Gedanken wieder freien Lauf in Richtung Schwäbische Alb …
Ohne dass Anton und sie je darüber gesprochen hatten, hatte nach seiner Rückkehr aus dem Krieg festgestanden, dass sie ein Paar waren. Anstatt seine Wohnung im Seitentrakt des Hauses zu nutzen, war er gleich zu Mimi gezogen. Nachts, wenn sie zusammenlagen und sie seinen wunderbar warmen Duft einatmete, dann waren ihre beiden Welten in Ordnung.
Der Altersunterschied, dazu die wilde Ehe – wahrscheinlich hatte das halbe Dorf hinter vorgehaltener Hand über sie getuschelt. Mimi zog eine Grimasse. Oder waren die Leute durch den Krieg offener geworden? Waren jetzt andere Dinge als der sogenannte »gute Ruf« wichtiger? Anständig konnte man auch sein, wenn man wie sie unverheiratet zusammenlebte. Dafür war Anton mit seinen Krücken und Prothesen, die er auf eigene Kosten für die kriegsversehrten Heimkehrer des Dorfes herstellte, doch das beste Beispiel!
Bei dem Gedanken an die verwundeten Soldaten verdüsterte sich Mimis Miene, und das hatte nicht allein mit dem Mitleid zu tun, das sie für die Männer empfand. An Bernadettes Hochzeitstag, als sie, Mimi, schon ausgehfertig parat gestanden hatte, werkelte Anton noch immer in seiner Werkstatt herum. Noch nicht mal den Wagen hatte er aus der Garage geholt, erkannte sie mit einem Blick aus dem Fenster in Richtung Hof.
Als Trauzeugen mussten sie früher als die Hochzeitsgesellschaft in der Kirche erscheinen. Letzte Absprachen, noch einmal den Ablauf durchgehen – Mimi wäre auch ohne all das sehr daran gelegen gewesen, so früh wie möglich dort zu sein, denn Bernadette war höchstwahrscheinlich nur noch ein Nervenbündel.
Wie nicht anders erwartet, hatte sie Anton in der Werkstatt vorgefunden, die er sich in seiner ehemaligen Wohnung eingerichtet hatte. Mit konzentrierter Miene stand er an einer riesigen Werkbank, auf der alle möglichen Werkzeuge für die Holzbearbeitung lagen, und feilte an einem kegelförmigen Stück Holz herum, dass die Späne nur so flogen.
Mimi glaubte nicht richtig zu sehen.
»Ist es schon Zeit?«, fragte er, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen.
»Das ist es in der Tat«, sagte sie und zwang sich, tief durchzuatmen. Jetzt bloß kein Streit! »Kannst du mir verraten, was du hier tust?«, wollte sie mit erzwungener Freundlichkeit wissen. Kam er eigentlich überhaupt noch von seiner Werkbank weg? »Wir werden in einer Stunde in der Kirche erwartet!«
»Oh«, sagte er und zog erstaunt die Brauen in die Höhe.
Es fehlte nicht viel, und Mimi hätte ihm einen ordentlichen Knuff in die Seite verpasst.
»Ja, oh!«, zischte sie.
Mit einem abgrundtiefen Seufzer des Bedauerns legte er sein Werkstück samt Feile aus der Hand. »Das soll eine Prothese für Konrad werden. Stell dir mal die Frechheit vor: Er hat einen Brief von der Oberpostdirektion erhalten, in dem steht, dass er mit nur einem Arm den vielseitigen Dienstverrichtungen eines Landbriefträgers nicht mehr gewachsen sei und dass sie ihn deswegen entlassen würden.«
Heute war es Konrad, der Briefträger, der eine Prothese benötigte. Morgen war es der Bürgermeister aus dem Nachbarort, der neue Krücken brauchte. Und übermorgen gab es ganz bestimmt auch einen Invaliden, der Antons Hilfe in Anspruch nahm. »Der Staat wird schon dafür sorgen, dass Konrad und die anderen Invaliden ihre Kriegsversehrtenrenten bekommen«, sagte Mimi gepresst.
»Genau das wollen die feinen Herren in Berlin der Öffentlichkeit weismachen, aber in Wahrheit ist das Einzige, was unsere tapferen Kriegsversehrten vom Staat bekommen, ein Tritt in den Hintern!« Wie so oft, wenn er über sein Lieblingsthema sprach, begann Anton wie ein eingesperrter Tiger hin und her zu rennen. »Schau mich nicht an, als wäre ich verrückt! Ich weiß ganz genau, dass du mein Engagement für übertrieben hältst«, sagte er und sprach genau das aus, was Mimi dieser Tage so oft durch den Kopf ging. »Aber ich kann einfach nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Ein Mann, dem im Krieg ein Arm, beide Beine oder das Gesicht weggeschossen wurden, kann das nämlich auch nicht!«
Wie oft hatten sie Gespräche dieser Art geführt, dachte Mimi traurig, den Blick auf die beeindruckende Kulisse gerichtet. Und jedes Mal stellte er sie dabei hin, als wären ihr all die schlimmen Schicksale egal.
»Anton, mir tun diese Leute auch leid. Aber du kannst doch nicht die ganze Welt retten!«, hatte sie verzweifelt, und den Tränen nahe, zu ihm gesagt. »Hat nicht jeder an seinem Platz seine eigene Verantwortung? Unsere Aufgabe ist es nun mal zu schauen, dass unser Laden läuft!«
Er hatte nur abgewunken. »Die Druckerei läuft auch ohne mich, das haben du und Siegfried Hauser in den Kriegsjahren ja bewiesen. Mimi, wenn es mir gelingt, für unseren Briefträger eine Prothese zu bauen, hat er vielleicht eine Chance auf ein einigermaßen normales Leben! Und da soll ich mich hinstellen und Prospekte für einen Urlaub am Gardasee drucken?« Anton schaute sie halb aggressiv, halb flehentlich an. »Der Krieg hat alles verändert. In der Politik, der Wirtschaft, in unseren Köpfen, im sozialen Gefüge. Acht Millionen Tote, über zwanzig Millionen Schwerverletzte – da kann ich doch nicht einfach so tun, als hätte es das alles nicht gegeben«, wiederholte er.
»Keiner tut so, als hätte es den Krieg nicht gegeben«, sagte Mimi müde. »Aber heute ist Bernadettes und Lutz’ großer Tag, und ich will, dass alles wie am Schnürchen klappt! Dazu gehört, dass wir in einer Viertelstunde zur Kirche aufbrechen. Ich will unbedingt ein paar Fotografien von den beiden machen, bevor die Trauung beginnt.«
»Das schaffen wir leicht, gib mir nur noch fünf Minuten!« Schon wieder über sein Werkstück gebeugt fuhr Anton fort: »Konrad hat vorhin übrigens einen Brief für dich gebracht. Aus Laichingen …« Er nickte in Richtung eines Büfetts, das links von der Tür stand.
Ein Brief aus Laichingen? Mimi runzelte die Stirn. »Und warum hat er ihn nicht bei mir im Haus eingeworfen?«
Doch Anton hörte schon nicht mehr zu.
Das war wieder einmal typisch, dachte sie und riss den Brief mit einer ruckartigen Bewegung an sich. Sie und ihre Belange zählten rein gar nicht mehr für Anton!
Traurig lächelnd, erinnerte Mimi sich daran, wie ihre Hand vor innerer Aufregung gezittert hatte, als sie im Haus am Küchentisch den Brief vorsichtig aufgeritzt hatte. Er stammte von dem Maler, der einst Onkel Josefs Haus und Atelier gekauft hatte. In dem Umschlag befanden sich eine kleine handschriftliche Notiz des Malers sowie ein weiterer Brief.
Liebe Frau Reventlow, wie vereinbart sende ich Post, die für Sie bestimmt ist, hochachtungsvoll an Sie weiter, stand auf dem Zettel.
Wer wusste nach all den Jahren immer noch nicht, dass sie Laichingen längst verlassen hatte? Stirnrunzelnd betrachtete Mimi den cremefarbenen Brief, der mit fast militärisch geraden Lettern an die alte Anschrift ihres Onkels adressiert worden war. Auf der Suche nach einem Absender drehte sie den Brief um, und im nächsten Moment stieß sie einen leisen Schrei aus. Was war denn das?
Will Schneider.
Mountain Vista, Los Angeles, Kalifornien, Amerika.
Amerika? Von wegen »der Brief stammt aus Laichingen«!
Krampfhaft überlegte sie, was sie mit dem Namen Will Schneider verband. Nichts, stellte sie fest. Sie kannte niemanden mit diesem Namen.
Stirnrunzelnd ritzte sie den Brief vorsichtig auf. Das Erste, was ihr ins Auge fiel, war ein riesiges Wappen. Es bestand aus zwei verschlungenen Engeln, die eine Art Schild zwischen sich hielten. »Dream Factory« stand auf dem Schild.
Das wurde ja immer kurioser! Mimi überflog eilig die wenigen Zeilen, die zu ihrer Erleichterung in Deutsch gehalten waren. »Das gibt’s doch nicht …«, murmelte sie und lachte erneut auf, diesmal leicht hysterisch. Eine Einladung nach Amerika? Mister Will Schneider wollte, dass sie für ihn einen Bildband mit Fotografien einer Schauspielerin namens Chrystal Kahla erstellte. Da er selbst auch Deutscher war, wenn auch seit etlichen Jahren in Amerika ansässig, sei es ihm wichtig, eine Landsmännin für diesen Auftrag zu bekommen. Ihr guter Ruf als herausragende Fotografin habe sich über verschlungene Wege bis nach Amerika herumgesprochen, sie sei somit perfekt geeignet.
In Amerika wusste man von ihr, Mimi Reventlow? »Das gibt’s doch nicht«, wiederholte Mimi verdutzt. Ein ganzer Bildband über eine einzige Schauspielerin? Die Frau musste sehr berühmt sein! Im Gegensatz zu den meisten Leuten, die Mimi kannte, hatte sie nie viel fürs Lichtspielhaus übrig gehabt, und so wusste sie weder, welche Schauspieler derzeit berühmt waren, noch welcher Film ein Kassenschlager war. Wie kam der Mann also ausgerechnet auf sie?
Benommen ließ Mimi den Brief sinken. So etwas gab es vielleicht in einem spannenden Roman, aber doch nicht im wahren Leben!
Dann las sie den Brief erneut. Will Schneider, Inhaber der im Briefkopf genannten Firma Dream Factory, wollte ihre sämtlichen Reisekosten übernehmen. Sobald er ihre Zusage hatte, wollte er ihr sogleich ein Erste-Klasse-Ticket für eine Überseepassage schicken, es sei von immenser Bedeutung, dass sie noch dieses Frühjahr käme. Was ihr Honorar anging, so solle sie einfach ihre Vorstellungen nennen, fügte er an. Und dass Geld keine Rolle spiele.
Genau so stellte man sich einen erfolgreichen deutschen Auswanderer vor, dachte Mimi. Forsch, gleich auf den Punkt kommend …
Dream Factory – hieß das nicht Traumfabrik? Mimi hatte zwar einst auf dem Berliner Gymnasium Englischunterricht gehabt. Doch dies war Jahrzehnte her, und sie hatte seitdem die Sprache nie gesprochen. Was diese Dream Factory wohl herstellte? War es eine Lichtspielproduktionsgesellschaft? Wenn es um eine Schauspielerin ging, lag die Vermutung nahe.
Fragen über Fragen.
Sie schaute noch einmal auf den Brief, als könne sie immer noch nicht glauben, dass er real war. Dann steckte sie ihn nachdenklich wieder in seinen Umschlag.
Normalerweise wäre sie jetzt damit sofort zu Anton gerannt. Doch jetzt hatten sie Wichtigeres zu tun. Vielleicht würde sie ihm heute Abend davon erzählen. Wenn sie von der Hochzeit zurück waren …
Die Münsinger Kirche war mit Efeuranken geschmückt. Und auf dem Altar standen zwei Kerzen, die die Namen der Brautleute trugen. Mehr Schmuck gab es nicht.
War Efeu nicht ein Symbol für die ewige Treue?, fragte sich Mimi, während die ersten leisen Takte des Hochzeitsmarsches erklangen. Sämtliche Köpfe drehten sich mehr oder weniger unauffällig um, keiner wollte den Anblick der Schafbaronin verpassen, wie sie am Arm von Wolframs Vater Wilhelm in Richtung Altar schritt. Dort wartete, in einer schlichten Uniformjacke ohne jegliche Orden und Abzeichen, Lutz Staigerwald auf seine Braut, deren klassischer Zopfkranz zur Feier des Tages mit Perlennadeln geschmückt war.
»Bestimmt fühlt sich Lutz ohne seine Rangabzeichen ganz nackt«, raunte Anton Mimi zu.
Nach der Demobilisierung hatte Generalmajor Lutz Staigerwald zwar seinen Dienstgrad als Offizier verloren, aber er war immer noch der Verantwortliche für das Lager. Mit einer Handvoll Männer hielt er den Truppenübungsplatz instand und bewachte die noch vorhandenen Waffen. Wie es mit der ganzen Anlage weiterging, wusste keiner. Deutschland hatte den Krieg verloren, schon jetzt wurden viele Kasernen geschlossen. Dennoch hoffte nicht nur Lutz, sondern ganz Münsingen darauf, dass nach Abschluss der Friedensverhandlungen auf der Schwäbischen Alb wieder Soldaten ausgebildet werden durften, wenn auch in geringerem Maß als früher.
»Es sind doch nicht die Orden, die einen Mann ausmachen«, raunte Mimi zurück. »Die beiden sind so ein schönes Paar!«
»Du wirst noch viel schöner aussehen«, flüsterte Anton und zwinkerte ihr dabei zu.
Mimi hob die Brauen. War das ein versteckter Heiratsantrag? Die Tränen, die ihr vor lauter Rührung in die Augen gestiegen waren, versiegten abrupt, ein diffuses Gefühl innerer Unruhe stieg in ihr auf.
So schlicht die Münsinger Kirche geschmückt gewesen war, so schlicht waren auch die Tische im »Fuchsen« dekoriert. Auch hier zierten lediglich ein paar Efeuranken die lange, u-förmig aufgestellte Festtafel.
Mimi wandte sich Bernadette zu und nahm ihre Hand. »Und – bist du glücklich?«
»Mehr als das – überglücklich!«, sagte die Schafbaronin und strahlte übers ganze Gesicht.
Mimi nickte. »Dein Leben wird von nun an ein völlig anderes sein …«
Bernadette lachte auf. »Hätte mir jemand vor ein paar Monaten gesagt, dass ich die Schäferei doch noch eines Tages loswerde, hätte ich zu ihm gesagt, dass er weiterträumen soll! Doch nun kann ich mich völlig dem Amt der Bürgermeisterin widmen. Jetzt, wo der verdammte Krieg vorbei ist, habe ich im Rathaus endlich ein wenig Gestaltungsspielraum. Noch fehlt es hier und da an Ressourcen und Geldern, dennoch habe ich einiges vor mit Münsingen!« Sie seufzte zufrieden auf.
Nun war es Mimi, die lachte. »Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel!« So traurig es war, dass Otto Baumann sich dem Amt nicht mehr gewachsen fühlte, so empfand sie es dennoch als einen Segen, dass Bernadette nun die Belange des Ortes steuerte.
»Und wem haben wir all das zu verdanken?«, sagte Mimi grinsend. »Unserer neuen Schafbaronin!« Sie prostete Corinne zu, die zusammen mit Raffa an einer der Längsseiten der Tafel saß. Die beiden strahlten und hielten unter dem Tisch immer dann Händchen, wenn sie glaubten, niemand würde es bemerken.
Neben Corinne saßen ihre Schwiegereltern. Als Raffa bei ihnen auf dem Hof auftauchte, nachdem er aus deutscher Kriegsgefangenschaft entlassen worden war, hatten beide das als einen Wink des Schicksals betrachtet. Niemand würde zwar jemals den Platz ihres gefallenen Sohns Wolfram einnehmen – aber dass Wolframs Witwe Corinne, die so fleißig und tapfer die Schäferei führte, nun wieder einen Gefährten an ihrer Seite hatte, dafür galt es dankbar zu sein. Da Corinne den französischen Hirten seit ihrer Kindheit kannte, konnte er kein schlechter Kerl sein, hatten sie gemeint und Raffa, zum Erstaunen aller, aufgenommen wie einen Sohn.
Bernadette erhob ihr Glas ebenfalls in Corinnes und Raffas Richtung. »Ich werde Corinne ewig für ihren Geistesblitz dankbar sein, ihren alten Chef, den Marquis de Forretière, zu fragen, ob er nicht eine deutsche Dependance besitzen möchte. Dass er mir meine Anteile der Schäferei abgekauft und Corinne als seine Verwalterin hier auf der Schwäbischen Alb eingesetzt hat, ist meine Rettung.« Sie hob ihr Glas und prostete diesmal Mimi zu. »Wehe, es nennt mich noch mal jemand hinter meinem Rücken Schafbaronin!«
Die Freundinnen lachten.
»Ach Mimi, ich glaube, du hast gar keine Vorstellung davon, wie viel mir eure Freundschaft bedeutet! Danke, dass ihr immer für mich da wart.«
»Das gilt umgekehrt ebenso«, sagte Mimi gerührt. »Wenn ich heute zurückschaue, denke ich oft, dass wir es ohne unsere Freundschaft in den Kriegsjahren nicht geschafft hätten zu überleben. Wir sind schon ein tolles Kleeblatt, was?«
Dieses Mal war es das große Glück einer Frauenfreundschaft, das ihr Lachen durchdrang.
Einen Moment lang war Mimi versucht, Bernadette von dem Brief aus Amerika zu erzählen, doch dann verwarf sie den Gedanken wieder. Heute war Bernadettes großer Tag – dass es auch in ihrem Leben Aufregendes gab, musste hintanstehen, beschloss sie, als im selben Moment Antons laute Stimme zu ihnen herüberdröhnte.
»Es reicht doch nicht, dass man den Kriegsversehrten beibringt, wie sie mit nur einem Arm fortan einen Regenschirm aufspannen oder ihr Brot buttern können! Die Männer brauchen auch eine finanzielle und moralische Unterstützung von dem Staat, für den sie im Krieg ihren Kopf hingehalten haben!« Er schlug mit der Faust so heftig auf den Tisch, dass die Sektgläser klirrten.
Mimi und Bernadette schauten sich an.
»Nicht heute, oder?«, sagte Bernadette leise.
Mimis Miene verdüsterte sich. Eher legte sich der Hund einen Wurstvorrat an, als dass Anton einmal von seinem Lieblingsthema abließ. »Nicht, wenn ich es verhindern kann«, raunte sie dennoch grimmig. Sie erhob ihr Glas erneut, schwenkte es über Bernadette und Lutz hinweg in Antons Richtung.
»Anton, Lieber, wie wäre es mit einem Toast auf das Brautpaar?«, sagte sie so laut, dass er es hören konnte. Anton war ein geborener Redner, ihm fielen die passenden Worte einfach so zu – eine Gabe, die Mimi schon immer an ihm bewundert hatte.
Unwirsch fuhr Antons Kopf zu ihr herum. »Ein Toast? Natürlich wünsche ich unserem Brautpaar nur das Beste, aber wie soll mir ein lockerer Trinkspruch über die Lippen kommen, wenn so viele unserer Kriegsbeschädigten nicht einmal ein Wasserglas halten können? Es ist eine Schande, dass …«
»Anton, es reicht!«, fuhr Lutz leise, aber bestimmt dazwischen. Er gab den livrierten Rekruten, die an diesem Tag als Kellner fungierten, einen Wink. »Die Suppe, bitte!«
Mimi hätte später nicht sagen können, warum es genau dieser Moment war, in dem etwas in ihr in lauter kleine Fragmente zerbrach. War es Bernadettes Aufbruchstimmung, die sich auf sie übertrug? War es Antons gedankenloser Eifer, mit dem er den schönsten Tag im Leben ihrer Freunde zu verderben drohte?
Wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem. Und dennoch hatte Mimi nicht das Gefühl, vor einem Scherbenhaufen zu stehen, im Gegenteil! Vielmehr erschien vor ihrem inneren Auge ein neues Bild – wie bei einem Kaleidoskop, das man so lange drehte, bis es einem gefiel.
Es war verrückt, aber genau in diesem Moment hatte sie gewusst, was sie tun musste, dachte Mimi, während das Treiben auf Deck hektischer wurde.
»Ich werde Münsingen verlassen«, hatte sie zu Anton gesagt, als sie spätnachts noch bei einem Glas Schlehenlikör in der Küche zusammensaßen. »Schon bald.«
Es war zwei Uhr in der Früh gewesen. Nach ihrer Ankunft daheim hatte Anton – müde und beschwipst – gleich ins Bett gehen wollen, doch Mimi hatte darauf bestanden, dass sie noch gemeinsam einen Schlummertrunk nahmen.
»Du wirst was?« Er schaute sie über den Rand seines Likörglases an.
Sie nickte, als wollte sie sich selbst stärken für das, was kam. Dann erzählte sie ihm kurz und knapp von Will Schneiders Einladung. Mit einem entschuldigenden Schulterzucken endete sie: »Auch ich kann nicht übergangslos an alte Zeiten anknüpfen, das ist mir inzwischen klar geworden. Der Krieg hat uns alle verändert, Anton, nicht nur dich. Ich bin Fotografin, ich möchte endlich wieder fotografieren! Mehr noch, ich möchte dabei noch mal völlig neue Wege gehen. Schöne Frauenporträts habe ich schon immer gern gemacht, aber eine berühmte Schauspielerin hatte ich dabei bisher noch nie vor der Linse. Dir mag das banal vorkommen, doch ich freue mich wahnsinnig über diese Chance.«
»Aber … ich … ich dachte, wir sind die Nächsten, die heiraten! Ich überlege schon die ganze Zeit, wo und wie ich dir einen romantischen Antrag machen kann«, sagte Anton und kippte sein Glas in einem Zug herunter. Ruckartig stellte er es ab und schenkte Likör nach.
Gott sei dank ist es dazu noch nicht gekommen, dachte Mimi schuldbewusst. »Die Schauspielerin heißt Chrystal Kahla und ist wohl sehr berühmt«, versuchte sie vom Thema abzulenken.
»Christel?« Wie von der Tarantel gestochen, sprang Anton auf. »Du hast Christel gefunden?« Hektische rote Flecken zeigten sich auf seinen Wangen, Mimi kam es so vor, als könne sie seinen Herzschlag regelrecht hören.
»Nein Chrystal mit einem Ypsilon und hinten einem A«, antwortete sie gereizt. Hegte er etwa immer noch Gefühle für seine Jugendliebe Christel Merkle, die im Oktober 1912 spurlos aus Laichingen verschwunden war? Mimi spürte, wie Eifersucht in ihr aufwallte. Wenn die junge Frau auch nur einen Hauch Gefühle für ihn gehegt hätte, dann hätte sie sich doch irgendwann einmal gemeldet!
»Anton, so eine Chance bekomme ich nie wieder in meinem Leben«, wiederholte sie.
Er lachte schrill auf. »Eine Chance? Du weißt doch gar nichts über diesen Mister Schneider! Das alles könnte eine Finte sein, auch ein übler Scherz! Woher kennt er dich eigentlich?«
»Er meint, er hätte schon von mir als Fotografin gehört«, antwortete Mimi leicht trotzig. »Vielleicht über jemanden, den ich irgendwann mal fotografiert habe und der dann ausgewandert ist? Ist ja auch egal, auf mich macht dieses erste Schreiben jedenfalls einen sehr seriösen Eindruck. Aber natürlich werde ich dem Mann erst schreiben, um mehr zu erfahren.« Für wie naiv hielt Anton sie eigentlich?
Für einen langen Moment starrte Anton auf die dunkle Flüssigkeit in seinem Glas, als läge darin eine Antwort verborgen.
»Du willst mich verlassen«, sagte er schließlich dumpf. »Ich dachte, du liebst mich mindestens so sehr, wie ich dich liebe.«
»Das tue ich ja auch«, antwortete Mimi gequält. »Aber Anton, wenn wir ehrlich sind – sehr viele Gemeinsamkeiten haben wir nicht mehr … Vielleicht tut uns eine Trennung für eine gewisse Zeit ganz gut?«
»Und was soll aus der Druckerei werden? Die ist auf einmal nicht mehr so wichtig, ja?« Er schnaubte. »Vorhin noch hast du mir vorgeworfen, mich nicht ausreichend ums Geschäft zu kümmern, und jetzt verkündest du so mir nichts, dir nichts, dass du gehst. Mimi, du drehst dir die Dinge hin, wie sie dir gefallen!«
»Wenn das deine Sichtweise ist, dann bitteschön«, erwiderte sie seufzend. »Wie du selbst richtig angemerkt hast, läuft das Alltagsgeschäft dank unserer guten Belegschaft ganz manierlich. Wenn du nicht bereit bist, meine Anteile an der Druckerei in meiner Abwesenheit für mich zu verwalten, dann könnte ich Josefine darum bitten. Als unsere stille Teilhaberin kennt sie sich aus, und zur Not könnte sie die wichtigsten Dinge bestimmt auch irgendwie von Berlin aus regeln.«
Er schaute sie an, erschrocken über die Bestimmtheit, die in ihrer Stimme lag. »Mimi, ich liebe dich doch! Und natürlich kümmere ich mich um alles. Wenn es dich mal wieder hinauszieht in die weite Welt, werde ich dich gewiss nicht davon abhalten. Einen freien Vogel kann man nicht für immer in einen Käfig sperren.« Er versuchte sich an einem Lachen, doch für Mimi sah es danach aus, als wäre er den Tränen nahe. »Und ich Narr dachte, wir zwei werden die Nächsten sein, die zum Traualtar schreiten …«
Sie ging zu ihm hinüber, setzte sich auf seinen Schoß, legte beide Arme um ihn. »Anton, ich bin doch nicht für immer weg. Wir reden über ein paar Wochen, Monate höchstens!« Wollte sie, dass er sie begleitete?, fragte sie sich und atmete tief seinen Duft ein. Sie zwei unterwegs, so wie früher … Sie hätte gewiss nur ein Wort sagen müssen. Nein, erkannte sie im selben Moment, dieses Abenteuer sollte ausnahmsweise nur ihr allein gehören. »Ich werde dich schrecklich vermissen«, flüsterte sie in sein Ohr. »Aber manchmal muss man erst gehen, um zurückkehren zu können …«
Anton hielt sie so fest, als könne er dadurch für immer ihre Seelen zusammenfügen. »Adieu, mon amour!« Seine Worte verfingen sich in ihrem Haar. »Und auf ein Wiedersehen.«
Dann weinten sie beide.
2. Kapitel
Es war seltsam, dachte Mimi, während vor ihnen am Kai immer mehr Matrosen erschienen, um dem Dampfer beim Anlegen zu helfen. Damals, 1905, als Heinrich ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte, war sie aufgebrochen, um ihren Traum von der Wanderfotografie zu verwirklichen. Und nun, wo Anton ihr fast einen Heiratsantrag gemacht hatte, brach sie abermals zu neuen Ufern auf! Und wieder …
Mimis Gedankengänge wurden jäh unterbrochen, als jemand ihr von hinten auf die Schulter tippte.
»Entschuldigen Sie, gnädige Frau, gleich kommen die Offiziere der Einreisebehörde an Bord. Nur wenn alle Passagiere auf der Liste ihre Einreiseformulare korrekt ausgefüllt haben, erhalten wir die Erlaubnis, sie von Bord gehen zu lassen. Darf ich bitte deshalb einen Blick auf Ihre Formulare werfen?«
Mimi und ihre Mitreisenden hatten Glück – ihr Schnelldampfer war an diesem Vormittag der Einzige, der anlegte, und so war die Schlange bei der Einwanderungsbehörde nicht allzu lang.
Ein Arzt schaute Mimi kurz in den Hals und fragte sie, ob sie Fieber habe oder an einer ansteckenden Krankheit leide. Nachdem sie beides verneint hatte, schickte er sie in den nächsten Raum, wo sie einem Beamten verschiedene Fragen, die den Grund ihrer Reise betrafen, beantworten musste. Sie legte dem Mann eine von Will Schneider extra für diesen Zweck verfasste Einladung in Englisch vor, der Beamte nickte, dann wollte er lediglich noch wissen, wie viel Geld sie bei sich trug. Sein Blick wanderte währenddessen zu der großen, runden Wanduhr – es war kurz vor zwölf, die Mittagspause nahte. Und so waren sämtliche Einreiseformalitäten sowie die Gesundheitsprüfungen schnell erledigt.
Es war gerade erst ein Uhr am Mittag, als Mimi, mit ihrem Koffer in der Hand, die Fähre von Ellis Island nach Manhattan betrat.
»Sieht das nicht grandios aus? Die obersten Stockwerke der Hochhäuser verschmelzen regelrecht mit dem Himmel! Und so schwindelerregend hoch, wie die Häuser sind, so hoch sind auch die Summen der Wertpapiere, die auf der New Yorker Börse täglich gehandelt werden.« Gustav Rühmann, der, seit sie das Schiff verlassen hatten, immer in Mimis Nähe geblieben war, zeigte mit glänzenden Augen auf das New Yorker Börsenviertel. »Vielleicht überlege ich es mir noch mal und bleibe ein, zwei Tage länger in New York. Zu gern würde ich mir die Börse einmal von innen ansehen.«
Mimi schaute ihn erstaunt an. »Ich dachte, Sie können es kaum erwarten, nach Wyoming zu kommen?«
»So ist es auch! Aber hier interessiert mich halt auch so vieles, besonders die Börse …« Es hätte nicht viel gefehlt, und der rüstige Rentner hätte voller Tatkraft in die Hände gespuckt.
Mimi lächelte vage. Sie wusste nicht, warum, aber angesichts des Getümmels, das im Hafen vor ihnen herrschte, war ihr auf einmal ziemlich flau. Was, wenn sie nicht mal ihr Hotel fand? Adrian Neumann, ein Freund und zugleich stiller Teilhaber der Druckerei, hatte zwar gemeint, dass sie sich in dem rasterförmigen New Yorker System aus Avenues und Streets gut zurechtfinden würde, mehr noch, er hatte ihr sogar aufgezeichnet, wo das von ihm empfohlene Hotel lag. Aber was, wenn sich seit Adrians Amerikabesuch vor Jahren alles geändert hatte?
»Wo genau liegt Ihr Hotel? Vielleicht könnten wir ein Stück gemeinsam mit der U-Bahn fahren?«, sagte Gustav Rühmann, und Mimi hätte ihn dafür am liebsten umarmt.
Am Kai erwartete sie ein so wildes Durcheinander, wie Mimi noch keins gesehen hatte. Schilder wurden ihnen vor die Nase gehalten mit Aufschriften wie »Central Pacific Railroad« und »British American Tobacco«, ein Mann wedelte sogar mit einem schmuddeligen Packen Dollarnoten vor ihrer Nase herum.
»Do you want a job?«
»Good work, good money!«
»Näherinnen gesucht!«
»Deutsche bevorzugt, mitkommen, Frau, mitkommen!«
»Come here!«
Mit einer Hand den Griff ihres Koffers, mit der anderen einen Zipfel von Gustav Rühmanns Jackett festhaltend, trippelte Mimi dem alten Herrn hinterher, der sich mit seinem Spazierstock tapfer einen Weg durch die Menge bahnte. Dagegen waren ja die Marktschreier auf Antons Märkten Waisenknaben, dachte sie und schlug halb angstvoll, halb wütend die Hand des Mannes weg, der »Mitkommen, Frau, mitkommen, good work!«, rief und sie am Arm packen wollte.
»Du lieber Himmel! Was ist denn das für ein Irrenhaus?«, schrie sie über den Lärm hinweg Gustav Rühmann zu.
Erst, als es etwas ruhiger war, blieb dieser stehen und zupfte sich seine verrutschte Krawatte zurecht. »Das wäre schon mal geschafft. Gleich da vorn ist auch schon die U-Bahn-Station, schauen wir, dass wir hier wegkommen«, sagte er. »So lästig die Situation für uns beide auch war – die Auswanderer, die mit uns auf dem Schiff waren, werden sich freuen, so schnell Arbeit zu finden! Durch den Krieg ist die Immigration jahrelang unterbrochen gewesen, die Arbeitgeber konnten also nicht mehr genügend Leute einstellen, und das, obwohl die amerikanische Industrie immer weiter anwuchs. Deshalb ist den Unternehmern derzeit jeder Neuankömmling willkommen!«
Mimi, noch immer etwas benommen, nickte. Im nächsten Moment hellte sich ihre Miene jedoch auf.
»Eine Kirche!« Sie zeigte auf ein sehr europäisch anmutendes Gotteshaus, das zwischen ein paar heruntergekommenen Bars und Tanzschuppen wie ein seltsamer Fremdkörper wirkte. »Wann immer ich irgendwo ankomme, besuche ich als Erstes eine Kirche.«
»Dann machen wir das auch jetzt, junge Frau. Gottes Segen für unser beider Unterfangen kann nie schaden«, sagte Gustav Rühmann und marschierte los.
Mimis Hotel lag in einer Seitenstraße abseits einer der großen Avenuen, nur eine U-Bahn-Haltestelle entfernt und nicht weit weg von Gustav Rühmanns Unterkunft. Deshalb beschlossen sie, sich nach einer kleinen Ruhepause auf einen gemeinsamen Stadtbummel und ein frühes Abendessen wiederzutreffen.
Die vielen Geschäfte! Die Gerüche! Theater! Tanzhallen! Museen! Auch hier war das Leben betriebsam, aber bei Weitem nicht so hektisch wie unten im Hafen. Ein Restaurant reihte sich ans andere, sodass Mimi und Gustav Rühmann zuerst gar nicht wussten, wo sie einkehren sollten. Am Ende gingen sie in ein Lokal, das ausgerechnet deutsche Speisen auf der Karte hatte. Mimi war von den neuen Eindrücken so erschöpft, dass sie über dem Dessert – einem Apfelstrudel mit Sahne – fast einschlief.
Das, was man in der ersten Nacht in einem fremden Bett träumte, wurde wahr, hatte Mimi einmal gehört. Statt zu träumen, schlief sie jedoch wie ein Stein. Hungrig und frohen Mutes, ging sie gegen neun in den kleinen Speisesaal ihres Hotels und bestellte ein Frühstück. Am liebsten hätte sie ein Fenster geöffnet, so muffig war die Luft, doch der Lärm, der von draußen zu ihnen hereindrang, war auch so schon laut genug. Wie es Gustav Rühmann wohl erging?, fragte sie sich und stocherte lustlos in dem Rührei, das ebenfalls ein wenig muffig schmeckte. Es hätte nicht viel gefehlt, und sie wäre die paar Straßen zu seinem Hotel gegangen, nur um ihm einen schönen Tag zu wünschen. Der alte Herr, der sie immer ein wenig an ihren Onkel Josef erinnerte, fehlte ihr schon jetzt. Es war seltsam, wie sehr sie ihn in der kurzen Zeit liebgewonnen hatte, und entsprechend emotional war ihr Abschied gestern gewesen. Würden sie sich je wiedersehen oder wenigstens erfahren, wie es dem andern ergangen war?
Genug der Sentimentalitäten, am besten lenkte sie sich ein wenig ab. Mimi atmete tief durch, dann schnappte sie sich die Tageszeitung, die auf ihrem Tisch gelegen hatte. »I have always detested the Germans!«, says President Wilson, lautete die Schlagzeile auf dem Titelblatt. Der amerikanische Präsident hat die Deutschen schon immer verabscheut? Er kannte sie doch gar nicht! Wurden sie nun, nach dem Krieg, alle in einen Topf geworfen, so, wie es im Krieg auch der Fall gewesen war? Mimi runzelte wütend die Stirn. Scheinbar waren die Politiker in Amerika auch nicht klüger als die Kriegstreiber in Europa, wenn sie so daherredeten. Mimi sparte sich das Interview mit dem Präsidenten und blätterte um. Auf der zweiten Seite ging es um ein feiges Briefbombenattentat auf einen Politiker, linke Anarchisten wurden verdächtigt.
Bei den Kleinanzeigen hielt Mimi inne. Jemand offerierte seine Esszimmermöbel – Mahagoni, gut erhalten. Ein Geschäftspartner für eine Eisdiele im Stadtteil Brooklyn wurde gesucht. Eine Wahrsagerin versprach, für nur drei Dollar in die Zukunft zu sehen. Theater buhlten um Zuschauer, Wäschereien priesen ihren schnellen Service an, ein Vergnügungspark neueste Attraktionen.
Schmunzelnd ließ Mimi die Zeitung sinken. Wenigstens die Welt der kleinen Leute schien sich nicht allzu sehr von der in Europa zu unterscheiden. Ihr Blick fiel auf die Anzeige einer Druckerei, die Postkarten im Angebot hatte, und sofort musste Mimi an Anton denken. Ob er sie vermisste? Sie hatte umgekehrt dafür bisher kaum Zeit gehabt, und auch heute würde es nicht klappen, dass sie ihm einen längeren Brief schrieb. Aber wenigstens eine Postkarte würde sie auf den Weg bringen, bevor sie morgen ihre mehrtägige Zugreise quer durch Amerika, von der Ost- hinüber zur Westküste, antrat. Damit es dazu kam, musste sie jedoch zuerst dringend zum nächstgrößeren Bahnhof gehen und sich über die Zugverbindungen schlaumachen. Laut Adrian Neumann waren Zugreisen in den USA völlig problemlos – im Gegensatz zum Straßennetz sei das Schienennetz hier perfekt ausgebaut. Er hatte ihr dennoch geraten, einen kleinen Vorrat an Getränken und Lebensmitteln mitzunehmen, denn es konnte schon einmal vorkommen, dass ein Zug wegen eines Maschinenschadens oder sonstiger Probleme mitten auf dem Land liegen blieb.
Mimi trank einen letzten Schluck Kaffee, dann stand sie auf und strich ihr Ausgehkostüm glatt. Wie hieß es so schön? »Time is money!« Sie hatte viel vor, am besten packte sie es gleich an.
Es war später Nachmittag, als Mimi, bepackt mit ihrem Reiseproviant und den Kopf voller neuer Eindrücke, wieder in Richtung ihres Hotels ging. Adrian hatte recht gehabt – das New Yorker Straßensystem war wirklich kinderleicht zu durchschauen. Und New York war eine mitreißende Stadt! Das bunte Leben, die freundlichen Menschen, die allesamt so … hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken schienen! Außerdem kam Mimi mit ihrem aufgefrischten Schulenglisch wesentlich besser zurecht, als angenommen. Ihre Laune war so prickelnd wie schon lange nicht mehr. Wie Champagner mit Brausepulver, dachte sie vergnügt, während sie innehielt, um die Auslagen eines Strumpfladens zu bewundern. Seidenstrümpfe … Sie hatte längst vergessen, wie sie sich anfühlten. Sollte sie in ein Paar investieren? Sie hatte zwar für Hollywood ihre allerbeste Garderobe eingepackt, doch das hieß nach den langen, entbehrungsreichen Kriegsjahren nicht viel. Alles, was sie an Kleidung besaß, war abgewetzt und altmodisch noch dazu! Vielleicht würde sie sich mit ein paar neuen Strümpfen nicht ganz so ärmlich vorkommen, wenn sie die Schauspielerin traf und …
Mimis Gedankengänge wurden abrupt unterbrochen, als an der Kreuzung vor ihr eine größere Menschenmenge laute Jubelrufe ausstieß. Unwillkürlich wandte sie ihren Blick von den Strümpfen ab. Was war da los?
Die Menge schien gebannt einem Mann zuzuhören, der von einem Podest herab zu ihnen sprach.
»Die Demokratie, die unser Präsident im Sinn hat, ist eine in Handschellen gelegte Demokratie! Eine Demokratie, die ihres Namens nicht würdig ist, weil sie all jenen ein Sprechverbot auferlegt, die es wagen, an eine neue Zeit zu glauben, ach was, auch nur von einer neuen Zeit zu träumen! Dabei ist unser Landreif für eine neue Zeit. Wir alle sind es! Denn …«
»Recht hat er«, murmelte ein Mann mit dunkler Haut und schwarzen Locken neben Mimi. »Wir wollen das alte Amerika nicht mehr!«
»Träumen darf man doch wohl noch …«, sagte eine junge Frau neben Mimi und schaute den Redner sehnsuchtsvoll an.
»… und so können wir nicht zulassen, dass die feinen Herren Politiker auf unseren Grundrechten herumtreten wie auf einem Stück Dreck! Männer und Frauen, ich sage euch, die Zeit ist reif für einen Aufstand!«
Der Mann hatte sein Publikum gut im Griff. Mimi musste unwillkürlich an Hannes Merkle denken, ihre einstige große Liebe. Ziemlich genau vor acht Jahren hatte sie den Gewerkschaftsvertreter zum ersten Mal auf dem Marktplatz von Ulm reden hören. So wie der Redner hier – Mimi schätzte ihn auf Mitte vierzig –, der Männer und Frauen in seinen Bann zog, so hatte auch Hannes die Menschen fasziniert – und sie ebenfalls! So sehr, dass sie sich sogar in ihn verliebt hatte …
Der Mann auf dem Podium war ziemlich gut aussehend. Mimi stellte sich unwillkürlich auf Zehenspitzen, um ihn noch besser sehen zu können. Er hatte dicke, blonde Locken und trug keinen Bart, was seinem Gesicht fast eine kindliche Anmutung verlieh. Seine Augenfarbe konnte Mimi von ihrem Platz aus nicht erkennen. Bestimmt waren sie blau!
»Wenn Amerika in den Krieg einträte, würde es auch zu den dringend nötigen Veränderungen kommen, hatte Wilson uns versprochen. Doch was ist stattdessen geschehen?« Mit fragendem Blick schaute der Mann in die Menge. Für einen kurzen Moment trafen sich sein und Mimis Blick, und fast unmerklich zwinkerte er ihr zu. Mimi spürte ein leises Kribbeln. Statt in den Strumpfladen zu gehen, blieb sie stehen und hörte weiter zu.
»Anstatt die Kluft zwischen Arm und Reich endlich zu schließen, wurde sie durch den Krieg noch größer!«, rief der Mann jetzt.
»Das stimmt! Die Herren Unternehmer haben sich die Taschen vollgemacht wie noch nie!«, schrie ein untersetzter Mann mit verbissener Miene. »Und wir haben uns in den Munitions- und Waffenfabriken für einen Hungerlohn den Buckel krumm gemacht!«
Mimi hob die Brauen. Dass sich die ganzen Waffen- und Munitionsfabrikbesitzer in den letzten Jahren eine goldene Nase verdient haben mussten – der Gedanke war ihr auch schon gekommen.
Der Redner nickte zustimmend. »Und deshalb, Genossen und Genossinnen, ist die Zeit reif für die Revolution des kleinen Mannes!«
Genossen – genau dieses Wort hatte Hannes früher auch öfter verwendet, ging es Mimi durch den Sinn.
»Pff«, knurrte eine Frau neben ihr. »Die feinen Herren scheren sich einen Dreck um uns, die kleinen Leute! Wie sollte so eine Revolution also aussehen?«
»Ihr seid skeptisch, das glaube ich wohl! Aber dass die Stimme des kleinen Mannes Gewicht hat, habe ich selbst bei der Revolution in Russland erlebt.«
Der Mann war rhetorisch gut geschult, dachte Mimi anerkennend. Und in Russland war er anscheinend auch …
»Wenn Reichtum nichts mehr zählt und jeder Mensch gleich viel wert ist …« Von einem Moment auf den andern kam unter den Menschen Unruhe auf, und der Sprecher brach jäh ab. Er schaute hektisch über seine Schulter, kurz zeigte sich Verunsicherung in seiner Miene. Doch gleich darauf grinste er entschuldigend ins Publikum, sprang von seinem Podest und verschwand in der Menge.
»Was ist denn los?«, entfuhr es Mimi.
Ein Mann, der neben ihr stand, raunte ihr zu: »So ist das in letzter Zeit immer – sobald einer es wagt, den Mund aufzumachen und die Wahrheit zu sagen, kommen irgendwelche Schergen vom Geheimdienst daher und verhaften ihn.«
Schergen? Geheimdienst? Dank Gustav Rühmanns Englischunterricht verstand sie ziemlich viel, aber hier hatte sie sich doch sicher verhört, oder? Aber die aufgeregten, teils wütenden und teils ängstlichen Mienen der Leute um sie herum verhießen nichts Gutes, so viel stand fest. Ein Schuss ertönte, Mimi zuckte angstvoll zusammen, und eine Männerstimme schrie in scharfem Ton »Stand still!« Danach ging alles schnell: Wie aus dem Nichts tauchte der blond gelockte Redner vor Mimi auf, nahm ihre rechte Hand und riss mit seiner freien Hand die Tür des Strumpfladens auf. Bevor Mimi wusste, wie ihr geschah, standen sie in dem Geschäft, die Gesichter einem Regal zugewandt, in dem auf Beinattrappen die feinsten Seidenstrümpfe aufgezogen waren, die Mimi je gesehen hatte. Import from Paris, las Mimi auf dem Schild, während sie aus dem Augenwinkel heraus sah, wie zwei schwarz gekleidete Männer vor dem Ladenfenster erschienen und sich hektisch umschauten. Einer hatte eine Pistole in der Hand. Mimis Herz schlug heftig. Sie schmiegte sich eng an den Fremden, zeigte auf die Strümpfe. »Liebling, findest du nicht auch, dass die französischen Strümpfe immer noch die schönsten sind?«, sagte sie in leicht affektiertem Ton. Welcher Teufel ritt sie nun schon wieder?, dachte sie im selben Moment. Hatte sie immer noch nicht gelernt, sich aus fremder Leute Angelegenheiten herauszuhalten? Andererseits: Wenn sie so dem Mann aus der Patsche helfen konnte …
Er blinzelte einmal kurz, dann ging er ohne weiteres Zögern auf ihre Farce ein. »Darling, ich stimme dir voll und ganz zu. Vielleicht hat die Lady die Freundlichkeit, uns diverse besonders schöne Paare vorzulegen? Lady, Bedienung bitte!« Er zwinkerte Mimi verschwörerisch zu, während er gleichzeitig ihren Arm drückte, als wollte er damit »Danke« sagen.
Während die Verkäuferin, die von ihrem Tresen aus unsicher das Geschehen vor dem Laden verfolgt hatte, diverse Strümpfe aus dem Regal nahm, warfen die beiden schwarz gekleideten Männer durch das Schaufenster einen grimmigen Blick in den Laden. Sie sahen ein turtelndes Liebespaar beim Strumpfkauf. Dann gingen sie davon.
3. Kapitel
Rheinhessen, Kreuznach, Ende April 1919
»Möchte der gnädige Herr noch ein Stück Toast? Oder ein feines Dessert?« Die Bedienung des kleinen Cafés im Kurpark, ein junges, hübsches Ding mit kräftigen Oberarmen und drallem Busen, schaute Alexander erwartungsvoll an. »Ou peut-être ein Glas … Sekt?«
»Sekt? Mais oui«, antwortete Alexander.
Die junge Frau nahm seinen Teller, deutete einen Knicks an, dann ging sie davon.
Alexander schüttelte fast unmerklich den Kopf. Wie verrückt war das Leben! Da saß er, Alexander Schubert aus Laichingen – als Maler besser bekannt unter dem Künstlernamen Paon –, im Kurpark von Kreuznach, aß französischen Toast Melba und bestellte in deutsch-französischem Kauderwelsch ein Glas Sekt.
Noch vor einem Jahr um diese Zeit hatten sich nicht weit von hier Franzosen und Deutsche auf den Schlachtfeldern der Westfront massakriert. Inzwischen standen weite Teile des Rheingebiets unter französischer Besatzungsregierung, auch Kreuznach. Und so flanierten französische Offiziere in Paradeuniform ebenso über die Uferpromenade der Nahe wie verliebte junge Paare und ältere Damen, die ihr Schoßhündchen ausführten. Zumindest tagsüber lebten die Besatzer und die Kreuznacher Bürger einträchtig nebeneinander – nach der allabendlichen Sperrstunde jedoch war den Deutschen das Ausgehen verboten, was gerade jetzt im Frühling, wenn die Abende länger und die Nächte lauer wurden, für einigen Unmut sorgte.
Hätte er, Alexander, gewusst, dass das Heilbad Kreuznach schon seit Dezember 1918 eine besetzte Stadt war, hätte er sich vielleicht einen anderen Zufluchtsort ausgesucht. Aber als er am Neujahrstag so überhastet seine Zelte in Stuttgart abgebrochen hatte, war ihm alles andere als hohe Politik in den Sinn gekommen.
Weg, nur weg von hier, war sein einziger Gedanke gewesen. Weg von dem Mann, der ihn jahrelang betrogen, der ihm Freundschaft, ja sogar Liebe vorgespielt hatte, der sich als sein großer Förderer ausgegeben hatte. Dass er in Wahrheit ein ganz anderer war, als er vorgab zu sein – diese Kleinigkeit hatte Mylo leider in all den Jahren vergessen zu erwähnen.
Während sich auf dem Stuhl ihm gegenüber ein kleiner Spatz, in der Hoffnung auf ein paar Kuchenkrumen, niederließ, spürte Alexander, wie sich ein eiserner Ring um seine Brust legte, sobald er auch nur an den Januar zurückdachte. Doch statt die quälenden Gedanken wegzuscheuchen, ließ er sie zu. Nie mehr in seinem Leben wollte er sich etwas vormachen! Von nun an wollte er wahrhaftig leben und ehrlich sein, sich und anderen gegenüber. Und dazu gehörte, dass er sich auch seiner Vergangenheit stellte …
Aufgebracht, wie er war, hatte er nur eine Handvoll Dinge eingepackt – Kleidung, ein paar Fotografien und die Collage mit den alten Weggefährten, die Mimi Reventlow ihm einst angefertigt hatte. Mylos Flehen und Betteln, er solle bleiben, hatte er überhört. Regelrecht geflohen war er, nachdem er erfahren hatte, in wessen Haus er da eigentlich wohnte.
Ohne Ziel war er mit seinem Koffer durch Stuttgart geirrt. Ein paar Mal war er angesprochen worden – der attraktive junge Maler Paon war stadtbekannt, seine Gemälde hingen nicht nur in reichen Bürgerhäusern, sondern sogar im Stuttgarter Schloss! Verletzt und verwirrt wie noch nie, hatte Alexander seine Bewunderer einfach stehen lassen, er wollte mit niemandem sprechen. Wahrscheinlich hatten die Leute geglaubt, er sei betrunken.
Am ersten Abend hatte er dann ausgerechnet in einer Kirche Zuflucht gesucht. Warum er sich kein Pensionszimmer genommen hatte, ob die Kirche immer offen stand oder ob der Küster an diesem Abend vergessen hatte, die Tür abzuschließen – all das wusste Alexander bis heute nicht. Jedenfalls war er hineingegangen, hatte ewig lang nach vorn auf das Kreuz geschaut. Gebetet hatte er nicht – für wen oder was?, hatte er sich gefragt, als ihm der Gedanke gekommen war. Mit dem Kopf auf seinem Koffer, hatte er sich schließlich auf einer Kirchenbank zur Nachtruhe gelegt. Die bunten Kirchenfenster erinnerten ihn an den Vorfall in seinem ersten Jahr in der Kunstschule, wo er wegen eines blau gemalten Kreuzes fast davongejagt worden war. Blasphemie hatte die Schulleitung ihm vorgeworfen. Damals war es Mylo gewesen, der ihn gerettet hatte, damals hatte auch ihre »Freundschaft« begonnen. Ohne Mylo wäre sein Maltalent vielleicht nie so weit gediehen, das musste Alexander sich eingestehen. Aber der Preis, den er für seinen Erfolg, seine Berühmtheit und seine Einkünfte hatte zahlen müssen, war hoch gewesen: Über acht Jahre lang hatte er seinen eigenen Willen abgelegt und brav nach Mylos Pfeife getanzt.
Als Alexander am nächsten Morgen mit lahmem Kreuz aufwachte, war ihm eins klar: Wenn er einen echten Neuanfang wollte, musste er Stuttgart verlassen! Die Frage war nur, wohin sollte er gehen? An den Bodensee, wo er sich so wohl fühlte, aber allerdings auch kein Unbekannter war? Auf die Schwäbische Alb zu Mimi Reventlow? Heim nach Laichingen? Nie und nimmer!
Plötzlich war ihm Kreuznach eingefallen. Er kannte die Stadt an der Nahe von seinem Frontbesuch im Jahr 1915, als sie für eine Nacht dort Halt gemacht hatten. Doch die Kreuznacher kannten ihn nicht! Die gepflegten Weinberge rund um die Stadt, der Kurpark, die vielen schönen Restaurants und Geschäfte – sogar im Krieg hatte Kreuznach sich eine gewisse Lebendigkeit bewahrt, Alexander hatte sich dort sehr wohl gefühlt.
Je länger er darüber nachgedacht hatte, desto überzeugter war er gewesen, dass Kreuznach für seinen Neuanfang das perfekte Ziel war. Dass die Stadt unter französischer Besatzung stehen könnte, wäre ihm im Traum nicht eingefallen, aber …
Alexanders Gedankengänge brachen ab, als die Bedienung sein Glas Sekt brachte. Sie war in Plauderlaune, erzählte von einem Benefizkonzert, das am Sonntag zugunsten von Kriegswitwen stattfinden sollte. Während er mit höflicher Miene zuhörte, kam ihm die unsägliche Reise an die Front in den Sinn, damals, im März 1915, und ihm wurde heiß vor Scham.
Es war Mylos Idee gewesen, dass er sich für seine Schlachtengemälde vom realen Krieg inspirieren lassen sollte. »Andere Maler fahren ans Meer oder in die Berge, du fährst eben an die Front«, hatte er gesagt, und er, Alexander, war wie ein Lämmchen gefolgt.
Pfui Teufel!, dachte er nun, angewidert von sich selbst. Warum hatte er ihre Beziehung und vor allem auch Mylos Motivation, ihn zu fördern, nicht viel mehr hinterfragt? Allein die fünfzigprozentige Provision, die Mylo beim Verkauf jedes Bildes kassiert hatte, war doch höchst zweifelhaft gewesen. Keine andere Galerie, kein Agent strich solch einen hohen Anteil ein!
Mehr als einmal hatte Alexander mit dem Gedanken gespielt, sich von Mylo zu trennen, doch nie war etwas daraus geworden. War es Naivität gewesen, die ihm im Wege stand? Angst?
Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, dachte Alexander und nahm einen Schluck Sekt. Was für ein Segen, dass das Schicksal selbst an jenem Neujahrstag die Entscheidung für ihn getroffen hatte!
Sie waren bei einem Empfang im Stuttgarter Schloss gewesen. Zu seinem großen Erstaunen – fast Entsetzen – war ihm auf dem Weg zur Getränkebar Herrmann Gehringer begegnet, der Webereibesitzer aus Laichingen, den er, Alexander, für den Tod seines Vaters verantwortlich machte. Am liebsten hätte er den alten Menschenschinder einfach stehen gelassen, doch dann war ihm ein anderer Gedanke gekommen: Mehr als einmal hatte er Mylo von den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in den Webereien erzählt – und jedes Mal hatte sein Gefährte sich wütend entrüstet. Warum nur legte niemand diesen Weberbaronen das Handwerk? Warum war Männern wie diesem Gehringer erlaubt, sich wie mittelalterliche Fronherren aufzuführen?, hatte Mylo stets räsoniert. Alexander hatte sich dann immer verstanden gefühlt. Wenn sein Gefährte nun auf einen dieser verhassten Weberbarone traf, würde er – eloquent und rhetorisch versiert, wie er war – dem Mann bestimmt ordentlich den Marsch blasen!
»Ich würde Ihnen gern jemanden vorstellen«, hatte Alexander also zu Herrmann Gehringer gesagt und ihn durch den Saal zu Mylo geführt. Was dann geschah, ließ selbst jetzt in der Erinnerung noch ein schwindelartiges Gefühl in Alexander aufsteigen.
»Michael, mein Sohn!«, hatte Herrmann Gehringer beim Anblick von Mylo gerufen, und Tränen hatten in seinen Augen gestanden. »Und ich habe geglaubt, du bist tot!«
Alexander schnaubte so laut, dass der kleine Spatz ihm gegenüber erschrocken davonflog. Dass Mylo in Wahrheit Herrmann Gehringers verschollener Sohn Michael war – nie wäre er, Alexander, auf diesen Gedanken gekommen. Dass Mylo sich so gut in das Laichinger Lebensgefühl hineindenken konnte, hatte ihn zwar mehr als einmal gewundert, aber dass sein Förderer selbst auch aus Laichingen stammte … So etwas Verrücktes konnte man sich doch nicht ausdenken, oder?
Genug Trübsal geblasen! Alexander atmete tief ein. Die Luft war erfüllt von der Süße der vielen blühenden Bäume. Wie weit die Natur hier schon war, dachte er nicht zum ersten Mal. Um diese Zeit gab es auf der Schwäbischen Alb noch Nachtfröste – in der klimatisch so begünstigten Lage des Nahetals hingegen blühten derweil schon die Obstbäume, und in der weitläufigen Parkanlage buhlten die Narzissen und andere Frühblüher um die Gunst der Spaziergänger. Während die Bedienung zum Nachbarstisch ging, schweifte Alexanders Blick in das hellgrüne Blätterwerk der Bäume, und wie immer, wenn er eine außergewöhnliche Farbe sah, mischte er sie im Geist auf seiner Farbpalette nach – ein Kadmiumgelb mit etwas hellem Kobaltblau. Oder würde er eher ein Zitronengelb nehmen?
Seltsam, dass er seine Ölfarben, Pinsel und Leinwände bisher nicht vermisste. Wie sehr hatte er seine Malutensilien geliebt und gehegt – nach jeder Sitzung an der Leinwand hatte er seine Pinsel so gründlich in Benzin gereinigt, dass ihm ganz schwindlig von den Dämpfen wurde. Und doch hatte er bis auf ein Mäppchen mit Stiften alle Utensilien in Stuttgart zurückgelassen, so wie alles andere, was sein Leben mit Mylo ausgemacht hatte. Würde er jemals wieder an einer Staffelei stehen?, fragte er sich, und seltsamerweise ängstigte ihn die Frage nicht sonderlich. Dabei tat sich im Bereich der Kunst gerade so viel Spannendes! Künstler wagten es endlich, Werke frei von Abhängigkeiten, fern jeglicher Doktrin und Tradition zu erschaffen. Etwas, was ihm nie gelungen war. Plötzlich kam Alexander die Fotografin Mimi Reventlow in den Sinn – sie hatte schon immer das getan, was ihr beliebte. Bei ihrem letzten Treffen – es lag über drei Jahre zurück – hatte sie ihn ermutigt, sich doch auch mehr künstlerische Freiheiten zu nehmen. Damals – unter Mylos Fittichen – war ihm dieser Gedanke unmöglich erschienen. Und nun, wo er frei war und sich künstlerisch hätte austoben können, verspürte er nicht die geringste Lust dazu.
Einen Zeichenblock und ein paar Stifte hatte er hingegen immer dabei. Der Kurpark, die mäandernde Nahe, die Häuser mit ihren schmiedeeisernen Balkonen, Weinbauern bei der Arbeit im Weinberg – ganz beiläufig entstanden während seiner Spaziergänge durch die Stadt und das Umland hübsche kleine Bleistiftzeichnungen, die er abends mit Aquarellfarben, die er bald nach seiner Ankunft in Kreuznach in einem Geschäft für Künstlerbedarf gekauft hatte, ein wenig kolorierte. Wann immer er eine kleine Auswahl kolorierter Zeichnungen fertig hatte, brachte er sie zu einer Galerie, wo sie sich verkauften wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Felix Hessweiler, der Inhaber der Galerie, wusste nicht, dass er den großen Maler Paon vor sich hatte, die Zeichnungen waren mit den Großbuchstaben AS für Alexander Schubert signiert. Keine Geschichten rankten sich um die Zeichnungen, keine Pfauen stolzierten durch die Bilder. Sie waren solide Handwerkskunst, mehr nicht. Alexander war es recht. Er verdiente kein Vermögen, doch das Geld reichte für die Miete des kleinen Zimmers, in dem er am Stadtrand wohnte, sowie für seinen weiteren Lebensunterhalt.