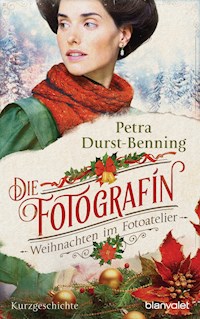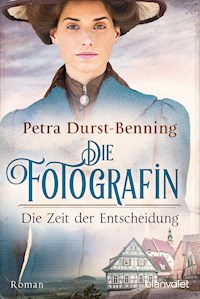9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fotografinnen-Saga
- Sprache: Deutsch
Anstatt der Vergangenheit nachzutrauern, möchte Wanderfotografin Mimi die Welt von morgen mitgestalten.
1912: Nach dem Tod ihres Onkels Josef hat Mimi Reventlow Laichingen verlassen und ihre Arbeit als Wanderfotografin wiederaufgenommen. Sie ist nicht mehr allein unterwegs, denn der Gastwirtsohn Anton hat sich Mimi angeschlossen. Während ihres Aufenthalts in Berlin gelingt es Anton, einen florierenden Postkartenhandel aufzubauen – Mimi dagegen hat immer öfter Schwierigkeiten, eine Gastanstellung zu finden. Doch anstatt der Vergangenheit nachzutrauern, möchte sie lieber die Welt von morgen mitgestalten. So wagt sie es, sich neu zu erfinden und sich dennoch treu zu bleiben. Auf ihrem Weg begegnen ihr alte Bekannte, wie Bernadette, die von der großen Liebe träumt. Was beide Frauen nicht wissen: Ihnen steht bald die größte Herausforderung ihres Lebens bevor …
Die SPIEGEL-Bestsellersaga um Fotografin Mimi bei Blanvalet:
1. Am Anfang des Weges
2. Zeit der Entscheidung
3. Die Welt von morgen
4. Die Stunde der Sehnsucht
5. Das Ende der Stille
Jeder Band kann auch unabhängig von den anderen gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Nach dem Tod ihres Onkels Josef hat Mimi Reventlow Laichingen verlassen und ihre Arbeit als Wanderfotografin wiederaufgenommen. Sie ist nicht mehr allein unterwegs, denn der Gastwirtsohn Anton hat sich Mimi angeschlossen. Gemeinsam bereisen die beiden das Land und wollen nach der dörflichen Enge Laichingens endlich großstädtischen Trubel erleben. Während ihres Aufenthalts in Berlin gelingt es Anton, einen florierenden Postkartenhandel aufzubauen – Mimi dagegen hat immer öfter Schwierigkeiten, eine Gastanstellung zu finden. Doch anstatt der Vergangenheit nachzutrauern möchte Mimi lieber die Welt von morgen mitgestalten! So wagt sie es, sich neu zu erfinden und dennoch treu zu bleiben. Auf ihrem Weg begegnen ihr auch alte Bekannte, wie Bernadette, die von der großen Liebe träumt. Was beide Frauen noch nicht wissen: Ihnen steht bald die größte Herausforderung ihres Lebens bevor …
Autorin
Petra Durst-Benning wurde 1965 in Baden-Württemberg geboren. Seit über zwanzig Jahren schreibt sie historische und zeitgenössische Romane. Fast all ihre Bücher sind SPIEGEL-Bestseller und wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. In Amerika ist Petra Durst-Benning ebenfalls eine gefeierte Bestsellerautorin. Sie lebt und schreibt abwechselnd im Süden Deutschlands und in Südfrankreich.
Mehr Informationen zur Autorin und ihren Büchern finden Sie auf ihrer Homepage www.durst-benning.de oder in der App von Petra Durst-Benning.Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Band 3
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Abdruck des Zitats von Henri Cartier-Bresson mit freundlicher Genehmigung der Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris.
© 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gisela Klemt
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Richard Jenkins Photography, Shutterstock.com (orientaly; Jan Martin Will; fokke baarssen), kemai/photocase.de und Dietrich Krieger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Münsingen-6359.jpg), »Münsingen-6359«, Covercollage von punchdesign, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
Die Bilder im Anhang stammen aus dem Privatarchiv von Petra Durst-Benning
JF · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22948-1V004www.blanvalet.de
»Das Handwerk hängt stark von den Beziehungen ab, die man mit den Menschen herstellen kann. Ein Wort kann alles verderben, alle verkrampfen und machen dicht.«
Henri Cartier-Bresson (1908–2004)
1. Kapitel
Im Hochschwarzwald, 3. Januar 1912
»Bitte ein Stück nach links, wir wollen doch den Skilift auch aufs Bild bekommen. Sehr gut, bitte nicht mehr bewegen!« Die Stirn in konzentrierte Falten gelegt, verschwand Mimi Reventlow unter dem Schwarztuch ihrer Kamera. »Und jetzt bitte lächeln, die Herren!«
Es war ein herrlicher Wintertag. Die Luft war glasklar, die verschneiten Berghöhen des Hochschwarzwalds glitzerten im Sonnenlicht, und die Holzschindeln des malerisch auf einer Hochebene gelegenen Hotels Tonihof glänzten wie der Tannenhonig, den es bei jedem Frühstück gab. Die Gruppe Skifahrer – Frankfurter Geschäftsleute mittleren Alters –, die Mimi vor der Linse hatte, war nach etlichen rasanten Talabfahrten und zwei Runden Obstler bestens aufgelegt. Statt nur zu lächeln, wie Mimi sie gebeten hatte, machten sie Faxen wie Lausbuben!
Wenn es nur immer so leicht wäre, die Leute aus der Reserve zu locken, dachte die Fotografin und genoss den Moment. Schon war das »Klick« ihrer Kamera zu hören. Anschließend verstaute sie die Glasplatte in der dazugehörigen Hülle, dann tauchte sie unter dem Schwarztuch auf und sagte freundlich: »Vielen Dank, meine Herren! Ich gebe die Glasplatten heute noch dem örtlichen Fotografen zum Entwickeln, so dass Sie Ihre Fotografien in drei Tagen an der Hotelrezeption abholen und dort auch bezahlen können – so habe ich es mit Hotelchef Herrn Wimmer abgesprochen. Verraten Sie mir bitte noch, wie viele Abzüge ich für Sie machen soll?«
Jeder der Herren wollte gleich zwei. »Dürfen wir Sie auf einen Kaffee einladen, gnädige Frau?«, fragte einer der Skifahrer dann forsch.
»Oder gar auf ein Glas Sekt?«, fügte ein zweiter hinzu. »Es kommt selten vor, dass man eine Wanderfotografin trifft. Vielleicht würden Sie uns die Ehre erweisen, ein wenig aus Ihrem Leben zu erzählen?«
»Heute ist mein letzter Tag hier, ich muss schauen, dass ich mit meiner Arbeit fertig werde«, sagte Mimi mit gespieltem Bedauern. Wenn sie jeder Einladung folgen würde, die sie im Laufe eines Tages bekam, verbrächte sie die Zeit nur noch mit Essen und Trinken!
*
Wie Mimi Reventlow in ihrem Element war!, dachte Anton Schaufler lächelnd, der die Szene durch eins der vielen Restaurantfenster beobachtet hatte. Und wie sich die Leute um sie scharten, und das vom ersten Tag an! Kein Wunder – mit ihren kastanienbraunen Haaren, ihren vor Lebensfreude funkelnden Augen und dem klaren Teint war die stets elegant gekleidete Wanderfotografin äußerst attraktiv. Und als hätte das nicht gereicht, verfügte Mimi zudem über eine Ausstrahlung, die die Menschen unwillkürlich in ihren Bann zog, dachte Anton bewundernd.
Seit Anfang Dezember waren sie nun schon auf Einladung des Hotelwirts in diesem Hotel. Die Fotografin wohnte luxuriös in einem großen Gästezimmer mit Blick ins Tal, er selbst teilte sich ein Hinterzimmer mit einem der Köche, einem netten Kerl, mit dem er gut auskam. Zufrieden mit sich und seiner neuen Welt deckte Anton weiter die Tische fürs Abendessen ein – die Gabeln auf die linke Seite, die Messer und Löffel nach rechts. Wenn seine Mutter sehen würde, wie versiert er für jeden Gang das jeweilige Besteck platzierte, würde sie Augen machen, dachte er. Doch so schnell der Gedanke gekommen war, so schnell war er auch wieder verschwunden. Er weinte seinem Heimatort Laichingen und der Arbeit im elterlichen Gasthof keine Träne nach!
Als Mimi Reventlow Laichingen Ende November plötzlich verlassen hatte, hatte er sich ihr angeschlossen. Da er kein eigenes Ziel vor Augen gehabt hatte, war es ihm sehr recht gewesen, dass sie ihm erlaubte, sie hierher in den Schwarzwald zu begleiten.
Es war ein großer Auftrag: In der ersten Woche hatte Mimi Reventlow nur Aufnahmen vom Hotel gemacht, danach hatte sie den Weihnachtsbaum und die Gäste in Szene gesetzt und die große Weihnachtsfeier fotografisch dokumentiert. Zwischen den Jahren hatte sie dann mit den Skifahrer-Fotografien begonnen. Zum Jahreswechsel baute sie eine kleine Kulisse auf und machte Bilder mit lauter fröhlich dreinschauenden Menschen. Jeder Gast wollte von Mimi Reventlow abgelichtet werden, mehr als einmal war es dabei fast zu kleinen Streitereien darüber gekommen, wer wann an der Reihe war.
Dass Mimi Reventlow eine ganz besondere Frau war, hatte Anton schon bei ihrer ersten Begegnung erkannt, damals, als sie im vergangenen Jahr in seinem Heimatort auf der Schwäbischen Alb eintraf, um nach ihrem kranken Onkel zu sehen. Als sie dann auch noch seinem besten Freund Alexander zu einem Platz an der Stuttgarter Kunstschule verholfen hatte, war seine Bewunderung für sie noch weiter gewachsen. Auch bei den anderen Bewohnern von Laichingen war die Fotografin beliebt gewesen, aber die Wertschätzung, die man ihr hier entgegenbrachte, war doch etwas ganz anderes. Ob vom Hotelier Antonius Wimmer oder von den Gästen – Mimi wurde hofiert wie eine Berühmtheit. Und sie schien es sichtlich zu genießen …
Hier zu sein war wirklich ein Genuss, dachte Anton beschwingt, und sein Blick schweifte durch das Hotelrestaurant, in dem er seit ihrer Ankunft kellnerte. Die weiß gedeckten Tische, die schweren Kerzenständer aus echtem Silber, das Kristall, in dem Wein und Wasser ausgeschenkt wurden, die riesigen Servierplatten aus blütenweißem Porzellan – und hier roch es nicht nach altem Fett und Fleischbrühe, hier wehte der Duft der großen weiten Welt.
»Na, junger Mann – Sie verlieren sich wohl in Tagträumen!«
Anton zuckte zusammen. Er hatte nicht mitbekommen, dass Antonius Wimmer in den Gastraum getreten war.
»Ich habe nur kurz die schöne Atmosphäre genossen«, sagte Anton verlegen. Seine Mutter hätte ihm ordentlich zugesetzt, wenn sie ihn beim Nichtstun erwischt hätte, ging es ihm durch den Sinn. In ihren Augen war er sowieso ein Faulpelz.
Antonius Wimmer hingegen schaute Anton wohlwollend an. »Also sind Sie nicht nur äußerst fleißig und zuverlässig, sondern es gefällt Ihnen hier oben auf dem Berg?«
»Sehr gut sogar«, sagte Anton. »Die Arbeit ist das reinste Vergnügen.« Nicht wie die Schinderei im Gasthof Ochsen zu Hause. Hier musste er keine schweren Bierfässer in den Keller hieven, der Boden wurde von einer Magd geputzt, das Geschirr von einer anderen gespült. Die Gäste mochten ihn und seine schlagfertige Art, und so bekam er von fast jedem ein gutes Trinkgeld zugesteckt.
»Es macht Spaß, ständig neue Gäste kennenzulernen«, fügte er hinzu. Von weit her kamen die Leute in den Schwarzwald, manche blieben für eine Woche im Hotel, andere nur für eine Brotzeit. Kaum betrat eine Gruppe Skifahrer oder Schneeschuhwanderer das Haus, hielt Anton seine Augen offen. Er sah täglich neue Gesichter, nur das eine war nicht dabei …
Der Hotelier klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. »Dass Sie uns im Weihnachtsgeschäft ausgeholfen haben, war ein wahrer Segen! Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir ohne Sie gemacht hätten – wer rechnet schon damit, dass sich der Chefkellner beim Adventskegeln den Arm bricht?« Der Hotelier zuckte in gespielter Verzweiflung mit den Schultern.
Des einen Leid, des andern Freud, dachte Anton. Da war er wohl ausnahmsweise mal zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. »Ich freue mich, wenn ich ein wenig helfen konnte«, sagte er bescheiden.
»Ein wenig helfen – ohne Sie wären wir verloren gewesen! Und die Gäste mögen Sie, ich habe viele lobende Worte gehört, Herr Schaufler.«
Herr Schaufler – noch immer war Anton irritiert, wenn ihn jemand so ansprach. Mit seiner großen Statur, seinen breiten Schultern und seiner selbstbewussten Miene wirkte er zwar älter als neunzehn Jahre, dennoch hatte ihn bis zu seiner Abreise aus Laichingen noch nie jemand mit »Sie« angesprochen. Daheim war er immer nur der vorlaute Gastwirtsohn gewesen – dass auch er gewisse Qualitäten hatte, hatte keiner erkannt. Keiner, außer seinem Freund Alexander und Mimi Reventlow …
Einen Moment lang war Anton so in seine Gedanken vertieft, dass er gar nicht mitbekommen hatte, was der Hotelier sagte. Nur bei seinen letzten Worten horchte er auf.
»… so frag ich Sie jetzt frei heraus: Wollen Sie nicht bleiben und den Posten des Serveur Chef übernehmen?«
*
»Kannst du uns bitte erklären, was du dir dabei gedacht hast?« Mit unbeweglicher Miene und nur mühsam unterdrückter Wut zeigte Wilhelm Hahnemann, Direktor der Stuttgarter Kunstschule, auf die Staffelei neben sich.
Alexander stand mit gesenktem Kopf da. Er brauchte nicht aufzuschauen, um zu wissen, um welches Bild es ging. Mehr noch, er fühlte das Aquarellgemälde – jeden Pinselstrich, jedes bisschen Farbe, das er auf die Leinwand aufgebracht hatte!
»Hat’s dir jetzt auch noch die Sprache verschlagen angesichts deiner unsäglichen Blasphemie?«, fuhr Gottlob Steinbeiß, der künstlerische Hauptlehrer der Kunstschule, ihn an, und sein Kaiser-Wilhelm-Bart bebte indigniert.
»Meine Herren, ich bitte Sie«, sagte Mylo, ebenfalls Lehrer der Kunstschule. »Alexander Schubert weiß doch noch nicht einmal, was unter dem Begriff Blasphemie zu verstehen ist. Er hat seine künstlerische Freiheit ausgelebt, mehr nicht!«
Alexander warf dem Kunstlehrer, der hauptberuflich Architekt war und den alle nur Mylo nannten, einen dankbaren Blick zu. Er wusste zwar nicht, warum, aber vom ersten Tag an hatte der Architekt ihn unterstützt. Normalerweise wog Mylos Wort viel im Kollegium der Kunstschule, doch heute schien sein Einsatz für seinen Zögling vergeblich zu sein.
»Die künstlerische Freiheit kann mir in dem Moment gestohlen bleiben, wenn unsere Kunstschule im Mittelpunkt eines kirchlichen Skandals steht. Und nichts weniger hat diese … diese Schmiererei hier ausgelöst!«, fuhr der Schuldirektor auf. »Das Kreuz ist das wichtigste Symbol des Christentums, der vertikale Balken symbolisiert die Beziehung Gottes zu den Menschen – wie kann man nur darauf verfallen, dieses Symbol der Liebe in eisigem Blau zu malen? Und als wäre das noch nicht genug, schmilzt das Eis und sammelt sich in einer riesigen Lache unterhalb des Kreuzes! Selbst wenn diese Lache das Blut Christi darstellen …«
Alexander schaute zum ersten Mal, seit er ins Büro des Direktors gerufen worden war, auf und rief, bevor er sich besinnen konnte: »Das ist nicht das Blut Christi!«
O Gott, warum hielt er nicht einfach den Mund?, dachte er im selben Moment. Er machte die Sache nur noch schlimmer, falls das überhaupt möglich war.
»Hättest du dann die Freundlichkeit, mich darüber aufzuklären, was sich der Herr Künstler sonst dabei gedacht hat? Du musst verzeihen, wenn unsereiner nicht gleich darauf kommt, was verstehen wir schon von der Kunst?«, sagte der Schuldirektor mit unverhohlenem Spott.
»Das Kreuz steht für die Kälte der Kirche den Menschen gegenüber«, flüsterte Alexander.
Gottlob Steinbeiß gab einen schrillen Laut von sich.
»Der Webersohn aus Laichingen ist ein verkappter Kirchenkritiker! Wer hätte das gedacht?« Kopfschüttelnd schaute er von Alexander zu dem Gemälde und wieder zurück. »Undank ist der Welten Lohn, sage ich da nur. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich jemals ein Stipendiat einen derartigen Affront geleistet hat.«
»Die Kälte der Kirche, aha«, wiederholte Wilhelm Hahnemann, ohne auf den Einwurf des künstlerischen Hauptlehrers einzugehen. Der Blick, den er Alexander zuwarf, war vernichtend. »Darf ich dich daran erinnern, dass diese ach so kalte Kirche unserer Schule sehr nahesteht? So nahe, dass sie uns jährlich mit einer großzügigen Summe unterstützt, damit wir … Leuten wie dir die bestmögliche Ausbildung bieten können?« Noch nie hatte sich das Wort »Leute« in Alexanders Ohren mehr wie ein Schimpfwort angehört.
Er biss sich auf die Unterlippe und rang um Worte, die ihn hätten entlasten können – vergeblich.
Sie hatten sich eines bekannten Symbols annehmen und es auf ungewöhnliche Art auf die Leinwand bringen sollen – diese Aufgabe hatte Gottlob Steinbeiß ihnen zwei Wochen vor Weihnachten gestellt. Die Schule wollte die Aquarellgemälde an einen Wohltätigkeitsverein weitergeben, der wiederum eine weihnachtliche Tombola veranstaltete, deren Erlös einem Kinderheim zugutekam.
Während seine Schulkameraden ein Herz, einen Stern oder die Sonne als Symbol gewählt hatten, war ihm spontan das Kreuz eingefallen. Und genauso spontan hatte er daran denken müssen, wie der Laichinger Pfarrer seiner Familie nach dem Tod seines Vaters selbst die kleinste Hilfe verwehrt hatte. Am Ende hatten alle im Dorf – die Nachbarn, Mimi Reventlow, sein Freund Anton – zusammengeholfen, um die Familie über die Runden zu bringen und ihm, Alexander, zu ermöglichen, das Stipendium an der Stuttgarter Kunstschule anzunehmen. Alle, außer dem Gottesmann … Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hatte er sich an die Staffelei gestellt, danach war jeder Pinselstrich nur so aus ihm herausgeflossen. Zugegeben, ein bisschen verwegen war ihm das eisige Blau als Farbe für ein Kreuz auch vorgekommen, aber nie hätte er gedacht, dass er deswegen einen solchen Ärger bekommen würde! Gottlob Steinbeiß, in Gedanken wahrscheinlich schon in den wohlverdienten Weihnachtsferien, hatte die kleinen Aquarelle eingesammelt und, ohne sie vorher einer näheren Betrachtung zu unterziehen, an die Vorsitzende des Wohltätigkeitsvereins weitergegeben. Und die Dame hatte, glücklich über die vielen Gaben für ihre Tombola, sämtliche Bilder aufgestellt, wo sie am nächsten Tag die spendenfreudigen Gönner des Kinderheims zu Gesicht bekamen.
Wer am Ende sein eisiges Kreuz derart moniert hatte, wusste Alexander nicht, aber eins wusste er: Dieser Eklat hier bedeutete das Ende. Kunststudium adieu, und das nach nur drei Monaten. Wie er die Sache seiner Mutter, die wie eine Löwin gekämpft hatte, um ihm diese Chance zu ermöglichen, beibringen sollte, war ihm schleierhaft. Und was sollte er nur seinem Freund Anton im nächsten Brief schreiben? Anton hielt so große Stücke auf ihn …
Er wollte Mylo gerade einen letzten verzweifelten Blick zuwerfen, als der Kunstlehrer sich an seine Kollegen wandte. »Meine Herren, wir sollten das neue Jahr nicht mit vorschnellen Beschlüssen beginnen, immerhin geht es hier um den Lebensentwurf eines jungen Menschen. Lassen Sie uns nochmal in Ruhe konferieren, ehe wir Alexander unsere Entscheidung bekannt geben.«
Bevor Alexander wusste, wie ihm geschah, schob Mylo ihn sanft, aber bestimmt in Richtung Tür. »Ich tue für dich, was ich kann«, flüsterte er, und sein Atem verfing sich warm in Alexanders Haar.
2. Kapitel
Es war der vierte Januar 1912, und wieder einmal war der Tag der Abreise gekommen. Mimi schaute nachdenklich aus dem Fenster des Speisesaals. Über Nacht hatte es geschneit, der frische Schnee, noch unbefleckt vom Ruß der Kamine, glitzerte jungfräulich weiß. Von den neu angereisten Gästen wusste sie, dass unten im Tal ebenfalls viel Schnee lag. Würde womöglich ihr Zug nach Würzburg gar nicht fahren? Und wenn schon, dann blieb sie eben ein paar Tage in Freiburg! So schön es hier im Tonihof auch war, so konnte sie es doch kaum erwarten, wieder weiterzukommen – zumal mit dem Wissen, dass in Würzburg ein besonders interessanter Auftrag auf sie wartete.
Wie hieß es so schön? Neues Jahr, neues Glück! Lächelnd trank Mimi einen Schluck Kaffee. Sie war und blieb nun einmal eine Wanderfotografin. Von wegen Wurzeln schlagen! Ihr Zuhause fand sie in sich, ihre Wurzeln wollten nirgendwo anwachsen, auch in Laichingen nicht, obwohl sie das eine Zeitlang geglaubt hatte.
Wie jeden Morgen hatte sie sich eine der Tageszeitungen, die am Eingang des Speisesaals für die Gäste auslagen, mit an den Tisch genommen. Den heißen Kaffee genießend blätterte sie die Freiburger Zeitung durch, während sie auf Anton wartete. Der Wirt hatte sie gestern Abend gefragt, ob sie nicht an ihrem letzten Tag gemeinsam frühstücken wollten. Ein Frühstück lang könne er Anton gewiss entbehren, hatte Herr Wimmer noch lächelnd hinzugefügt. Was für ein netter Mann!, dachte Mimi nicht zum ersten Mal. Sie schlug gedankenverloren eine Seite um. Im nächsten Moment setzte ihr Herz für einen Schlag aus. Düstere Zustände verbergen sich hinter der blütenweißen Kulisse der berühmten Laichinger Leinenweberei, stand in großen, fettgedruckten Lettern über einem fast seitenlangen Artikel. Unterhalb der drei Textspalten waren drei ihrer Fotografien abgedruckt. Wie um alles in der Welt kamen siein die Freiburger Zeitung?
Die Fotografien gehörten zu einer Serie, die sie bei ihrem ersten Besuch in Herrmann Gehringers Weberei gemacht hatte, heimlich, ohne sein Wissen. Mimi erinnerte sich noch genau – sie hatte einen Termin bei dem Unternehmer gehabt, da sie den Großauftrag, den er ihr in Aussicht gestellt hatte, besprechen wollten. Doch in seinem Büro hatte sie Gehringer nicht angetroffen. Unsicher, ob sie dort auf ihn warten oder ihn suchen sollte, war sie schließlich durch die Gänge gelaufen und just in dem Moment in der Weberei angekommen, als einer der älteren Weber einen Unfall gehabt hatte. Das Schiffchen seines Webstuhls war aus der Halterung gesprungen und dem Mann direkt ins Auge geschossen. Fast wahnsinnig vor Schmerz war er auf dem Boden zusammengesackt, hatte beide Hände auf das tränende Auge gepresst … Während Hannes Merkle sich um den Mann gekümmert hatte, hatte sie – bis ins Mark erschüttert – die sichere Distanz gesucht, die ihr der Blick durch die Linse bescherte. Ohne darüber nachzudenken hatte sie fotografisch alles dokumentiert: den verletzten Weber, aber auch die eng stehenden Webstühle, die Staubflusen, die in der Luft tanzten, die müden Gesichter … Bis heute konnte sie nicht genau sagen, warum sie das getan hatte, es war instinktiv geschehen. Als sie die Fotografien entwickelt hatte, war sie über deren Grausamkeit und das Düstere so erschrocken, dass sie sie eilig in die Schublade vom Küchentisch gestopft und nicht mehr herausgeholt hatte. Kritische Fotografien waren unbestritten sehr wichtig, aber sie wollte den Menschen Schönheit schenken, dank ihrer Fotografien sollten sie ihren oft sehr anstrengenden Alltag für einen Moment vergessen können!
Erst kurz bevor sie Laichingen verließ, hatte sie sich an die Bilder erinnert und sie Johann bei ihrem letzten Gespräch wütend und enttäuscht in die Hand gedrückt. Sie sollten ihm als Gedankenstütze dienen, hatte sie zornig gesagt, damit er vor lauter Liebesgeschichten nicht seine eigentliche Aufgabe – den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen – vergaß.
Und nun las sie hier, dass es in Laichingen tatsächlich zu einem Arbeitskampf gekommen war. Und dass Johann ihre Fotografien für seine Zwecke verwendet hatte.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Leinenweberei sind Laichinger Weber in den Ausstand getreten. Angeführt von Gewerkschafter Johann Merkle kämpfen sie für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und für eine Begrenzung der täglichen Arbeitszeit. Die Forderungen der Weber sind offenbar nicht unbegründet, zeigen uns doch die vorliegenden Fotografien auf sehr drastische Weise, wie schlecht die Arbeitsbedingungen der Weber zu sein scheinen …
Die vorliegenden Fotografien … Mit klopfendem Herzen suchte Mimi den Artikel nach ihrem Namen ab, doch sie wurde weder unter den Fotografien noch am Ende des Artikels genannt. Während sie noch überlegte, ob sie das gut oder schlecht fand, sah sie, dass Anton sich ihrem Tisch näherte. Wie die weiblichen Gäste ihm mehr oder weniger unverhohlen nachstarrten! Aber war es denn ein Wunder, so breitschultrig und gut aussehend, wie ihr junger Begleiter war?, dachte Mimi schmunzelnd, einen Moment lang aus ihren Gedanken gerissen.
Mit einem Plumps ließ er sich ihr gegenüber nieder. »Guten Morgen! Na, gut geschlafen in der letzten Nacht? Sie sind etwas blass um die Nase, wenn ich das sagen darf.«
Wortlos reichte sie ihm die Zeitung. Während er mit hochgezogenen Brauen den Artikel las, führte sie mit zitternder Hand ihre Kaffeetasse an den Mund. Doch die aromatische Würze war verflogen, der Kaffee schmeckte nur noch bitter.
»Sieh einmal an, hat unser Gewerkschafter Johann Merkle doch noch einen Aufstand auf die Beine gestellt«, sagte Anton, nachdem er zum Ende gekommen war.
Obwohl er Johanns Namen ironisch betonte, klopfte Mimis Herz eine Spur schneller, wie immer, wenn die Sprache auf ihn kam.
Anton tippte auf die Fotografien. »Wenn ich mich richtig erinnere, waren Sie an dem Tag des Unfalls in der Fabrik. Ich schätze mal, das sind dann Ihre Fotografien, nicht wahr?«
Mimi nickte stumm.
»Und wieso wird nirgendwo Ihr Name genannt? Wahrscheinlich hat der alte Haderlump Merkle gegenüber den Zeitungsleuten noch behauptet, die Fotos selbst geschossen zu haben!« Anton schnaubte. »Aber wer weiß, wofür es gut ist. Als Werbung kann man diese düsteren Bilder nicht gerade betrachten, womöglich wären sie mit Ihrem Namen versehen sogar geschäftsschädigend. Sie wollen den Menschen schließlich Schönheit schenken, nicht wahr?«
»Mehr fällt dir dazu nicht ein?«, fragte Mimi heftig. »In deinem Heimatdorf herrscht der Ausnahmezustand, Gehringers Leute haben es gewagt, in einen Streik zu treten! Das ist ganz schön mutig. Hier geht es um die Menschen, mit denen du aufgewachsen bist!«
Anton nahm sich ungerührt ein Brötchen und schnitt es auf. »Na und? Natürlich finde ich es gut, dass die Weber sich nicht mehr alles gefallen lassen. Aber dass mir vor lauter Mitgefühl die Tränen kommen, kann ich nicht behaupten. Jeder ist schließlich seines eigenen Glückes Schmied!«
Während er sein Brötchen butterte, schwieg Mimi nachdenklich. Monatelang war sie Johanns Vertraute gewesen, er hatte sie in all seine Gedanken und Pläne eingeweiht. In ihrer Verliebtheit hatte sie allerdings nicht realisiert, dass es ihm nicht um sie als Frau gegangen war – oder zumindest nicht ernsthaft. Er hatte den intellektuellen Austausch mit ihr geschätzt, mehr nicht. Sie jedoch hatte an die große Liebe geglaubt … Wie naiv und dumm sie gewesen war.
»Was meinst du – soll ich nach Laichingen fahren? Vielleicht könnten die Menschen ein wenig Unterstützung von außen brauchen?«, sagte sie dennoch nach einem langen Moment des Schweigens.
Anton schaute sie entgeistert an. »Haben Sie etwa vergessen, wie Johann Sie abserviert hat? Und wie Ihre Freundin Eveline Sie hintergangen hat? Wie schamlos sie, als frisch gebackene Witwe obendrein, hinter Ihrem Rücken etwas mit Johann angefangen hat! Die Laichinger wussten Sie doch gar nicht zu schätzen, wie können Sie da nur auf den Gedanken kommen, den Leuten irgendetwas schuldig zu sein?«
Mimi runzelte die Stirn. Die Leute wussten sie nicht zu schätzen? Das mochte für den einen oder anderen zutreffen, aber sie hatte durchaus auch sehr intensive, zu Herzen gehende Erlebnisse in Laichingen gehabt. Wenn sie nur an ihre hilfsbereite Nachbarin Luise dachte! Oder an die gemeinschaftliche Hilfe für Evelines Sohn Alexander, um ihm den Besuch der Stuttgarter Kunstschule zu ermöglichen …
Anton schien ihre innere Zerrissenheit zu spüren. Stirnrunzelnd tippte er auf den Zeitungsartikel. »Ihre Fotografien sorgen für so viel Aufmerksamkeit, dass Gehringer wahrscheinlich am Ende gar nicht anders kann, als auf die Forderungen seiner Arbeiter einzugehen. So gesehen haben Sie die Leute mehr als genug unterstützt.« Mimi biss sich auf die Unterlippe. »Vielleicht hast du recht. War nur so eine Idee … Ehrlich gesagt, will ich gar nicht zurück nach Laichingen. Ich will reisen! Ich will als Gastfotografin in schönen Ateliers arbeiten, ich will den einen oder anderen Markt besuchen …« Resolut faltete sie die Zeitung zusammen und legte sie weg. Anton hatte recht – jeder war seines eigenen Glückes Schmied! Lächelnd hielt sie ihm den Brotkorb hin. »Nimm doch noch eins!«
Doch statt eins der frischen Brötchen zu ergreifen, schaute der Gastwirtsohn sie an.
»Herr Wimmer hat mir Arbeit angeboten. Er will mich als erste Servicekraft anstellen.« Er wies mit dem Kopf über ihre Schulter in Richtung Küche, aus der Antonius Wimmers Stimme zu hören war, der mit einem Lieferanten sprach.
Augenblicklich hellte sich Mimis Miene auf. »Das ist ja wunderbar! Gratulation! Aber wenn ich ehrlich bin, wundert es mich nicht – so versiert, wie du hier den Laden geschmissen hast.« Wie gut sich alles fügte, dachte sie frohgemut. Mit zurückgekehrtem Appetit griff sie nach einem Brötchen. »Anton auf dem Tonihof – das passt irgendwie.«
»Wer sagt denn, dass ich hierbleibe? Ich habe für den Rest meines Lebens genug gekellnert, jetzt möchte ich die Welt kennenlernen! Und …« – er biss sich auf die Unterlippe – »ich möchte Christel suchen.«
Wie gequält er auf einmal aussah! »Das kann ich gut verstehen«, sagte Mimi leise. »Auch ich muss oft an Christel denken. Nicht zu wissen, was aus ihr geworden ist, ist unerträglich.«
Christel Merkle war Antons Freundin gewesen, seine große Liebe. Doch von einem Tag auf den andern war sie spurlos verschwunden. Tage-, nein wochenlang hatten Suchtrupps das ganze Dorf und die Umgebung nach Christel durchkämmt – vergeblich. War sie aus Laichingen weggelaufen? Hatte sie einen tödlichen Unfall gehabt? War sie gar entführt worden? Auf diese quälenden Fragen gab es keine Antworten.
Antons Miene verdüsterte sich einen Moment lang. Doch als er zu sprechen anhob, klang er wieder ganz normal. »Alexander will ich auch in Stuttgart besuchen, schon aus diesem Grund kann ich nicht im Schwarzwald bleiben. Es ist nun schon Wochen her, dass er etwas von sich hat hören lassen, nicht mal zu Weihnachten hat er geschrieben! Das gefällt mir nicht. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht.«
Mimi schwieg betroffen. Tief drinnen hatte Anton die Menschen, die seinem Herzen nahstanden, keinesfalls vergessen. Und ihr war vorhin nichts anderes eingefallen, als ihn wegen seiner vermeintlich kühlen Reaktion auf den Weberaufstand so anzublaffen!
»Und deshalb, liebe Frau Reventlow, wollte ich Sie fragen, ob ich nicht weiter mit Ihnen reisen kann. Wir zwei sind ein gutes Gespann, finden Sie nicht?«
Mimi, schlagartig aus ihren Gedanken gerissen, schaute ihn entgeistert an. »Wie stellst du dir das vor? Nicht überall wird sich so eine gute Chance zum Arbeiten für dich ergeben wie hier. Und ich kann keinesfalls für zwei das Geld erwirtschaften.«
»Wo denken Sie hin, nie und nimmer würde ich das wollen!«, erwiderte Anton entsetzt. »Das Gegenteil wäre der Fall, ich würde Ihnen sogar helfen.«
»Bisher habe ich alles ganz gut allein geschafft. Und einen männlichen Beschützer brauche ich auch nicht«, sagte Mimi ein wenig kratzbürstig. Eigentlich schade, dachte sie im selben Moment. Es hatte Spaß gemacht, mit Anton unterwegs zu sein. Obwohl sie bei ihrem Aufbruch alles andere als frohen Mutes gewesen war, hatten sie dennoch viel zu lachen gehabt. Anton hatte es sich nie nehmen lassen, das ganze Gepäck zu tragen, und als in Rottenburg kein Fremdenzimmer zu bekommen war, weil die Diözese gerade einen größeren Kongress abhielt, hatte Anton in einem der Nachbarorte zwei Kammern aufgetrieben. Schon in Laichingen, als sie ihren Onkel gepflegt hatte, war er mehr als einmal ihr Retter in der Not gewesen, dachte sie jetzt.
»So, wie Sie sich in den letzten Wochen jeden Ihrer Verehrer vom Leib gehalten haben, besteht für mich kein Zweifel, dass Sie sehr gut allein zurechtkommen. Nein, dafür brauchen Sie mich wirklich nicht«, sagte Anton mit einem verschmitzten Grinsen. »Ich habe eine ganz andere Idee …«
»Aha«, erwiderte sie spröde und lehnte sich instinktiv ein wenig zurück. Es hatte ihr noch nie gefallen, wenn andere über sie verfügen wollten.
Anton, bemüht, die Distanz zwischen ihnen wieder zu verringern, beugte sich ihr über den Frühstückstisch entgegen. »Wissen Sie, was mir unheimlich viel Spaß machen würde?«
Mimi schüttelte den Kopf.
»Ich würde gern Markthändler werden!«
»Aber dafür brauchst du mich doch nicht«, sagte sie stirnrunzelnd. Dass Anton einen guten Verkäufer abgeben würde, daran zweifelte sie nicht. Er war fleißig und scheute auch harte Arbeit nicht, und, was genauso wichtig war: Er konnte gut mit Menschen umgehen, seine forsche, sympathische Art kam an.
»Jetzt hören Sie mir doch erst mal zu«, sagte er. »Also, ich habe mir das so gedacht: Ich reise mit Ihnen immer dahin, wo Sie in ein Fotoatelier, in ein Hotel oder von einem Bürgermeister eingeladen werden. Im Vorfeld Ihres Auftrags machen Sie jedoch privat ein paar schöne Aufnahmen des Ortes. Sie haben den Blick fürs Außergewöhnliche! Und dass Sie eine Meisterin darin sind, alles und jeden ins rechte Licht zu setzen, habe ich inzwischen zu Genüge mitbekommen.«
Wie konnte ein so junger Mann ein solcher Charmeur sein?, dachte Mimi schmunzelnd. Noch immer war ihr nicht klar, worauf Anton eigentlich hinauswollte. Auffordernd nickte sie ihm zu. »Und?«
Anton lächelte. Er schien sichtlich zu genießen, dass er sie wie einen Fisch an der Angel hatte. Doch im nächsten Moment erlöste er sie. »Um es kurz zu machen – ich würde gern von Ihren Fotografien Postkarten drucken lassen und diese dann auf den Märkten verkaufen! Warum sollen nur die ansässigen Touristengeschäfte und Hotels mit den schönen Ansichten ihres Ortes den großen Reibach machen? Das können die noch lange genug, wenn wir wieder weg sind. Märkte gibt es zu jeder Zeit und fast überall, es kann höchstens sein, dass ich mal ein paar Dörfer weiter reisen muss als Sie. Ein oder zwei Postkarten kann sich jeder leisten! Und wenn ich daran denke, wie die Leute daheim Ihnen Ihre ›Laichinger Ansichten‹ aus den Händen gerissen haben, lässt mich das auf ein gutes Geschäft hoffen. Den Umsatz teilen wir uns dann nach Abzug meiner Kosten, das würde Ihnen ein gutes Zubrot sichern. Und sollte mein Plan aus irgendwelchen Gründen doch nicht aufgehen oder einer von uns beiden keine Lust mehr darauf haben, können wir uns immer noch trennen. Aber ich bin sehr zuversichtlich!«
Mimi war sprachlos. Mit allem hatte sie gerechnet, aber nicht mit einem so ausgeklügelten Plan. Wo war der Haken an der Geschichte?, fragte sie sich und fand doch keinen.
Während sie noch überlegte, was sie Anton antworten sollte, sprang er auf und rannte zu der Theke, von der er in den letzten Wochen so viele Teller mit Speisen abgeholt und an die Tische der Gäste gebracht hatte. Doch als er nun zurückkam, hatte er kein Wiener Schnitzel und auch keine Suppe dabei, sondern zwei Gläser Sekt.
Fröhlich reichte er Mimi eins davon, schaute sie an und sagte: »Liebe Mimi, was meinen Sie – sollen wir es wagen?«
Einen Moment lang fühlte Mimi sich um sieben Jahre zurückversetzt. Damals in Esslingen, als sie von Heinrich einen Heiratsantrag bekommen hatte, hatte dieser sie genauso eindringlich angeschaut. Doch während sie einst gezögert hatte und am Ende sogar davongerannt war, ohne eine Antwort zu geben, sagte sie nun: »Ja!« Und das kleine Wort kam aus ihrem Bauch und ihrem Herzen zugleich.
Anton hob sein Glas und prostete ihr mit einem erleichterten Strahlen zu. »Auf uns! Auf das neue Jahr! Es wird bestimmt wunderbar.«
Lachend stieß Mimi mit ihm an.
Anton räusperte sich. »Da wäre nur noch eine Kleinigkeit.«
»Ja?«, sagte Mimi erwartungsvoll.
»Könnten Sie mir vielleicht ein wenig Geld leihen, als Startkapital sozusagen?«
3. Kapitel
So betrübt der Toniwirt war, sein vermeintlich neues bestes Pferd im Stall davontraben zu sehen, so frohgemut waren Mimi und Anton, als sie aufbrachen.
»Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder?«, sagte Mimi, nachdem sie sich für den großen Auftrag nochmals bedankt hatte. »Es wäre mir eine Ehre, wieder für Sie arbeiten zu dürfen.«
»Und mir wäre es eine Ehre, Sie als Gast begrüßen zu dürfen«, erwiderte der Toniwirt. »Allerdings …« – er sah leicht verlegen drein – »werde ich Ihre fotografischen Dienste wahrscheinlich nicht mehr benötigen.«
»Verzeihen Sie, ich wollte mich keinesfalls aufdrängen«, sagte Mimi erschrocken. Ihr kam ein schrecklicher Gedanke, und sie fragte vorsichtig: »Oder … waren Sie etwa doch nicht mit meiner Arbeit zufrieden?«
Der Hotelier winkte ab. »Um Gottes willen, doch, alles war ganz wunderbar! Es ist nur so – ich habe mir selbst eine Kamera zugelegt. Sobald die Skisaison zu Ende ist und ich ein wenig Zeit habe, werde ich den Umgang damit lernen. Zukünftig kann ich dann jedes Ereignis auf dem Tonihof selbst fotografieren!«
»Wie schön«, sagte Mimi und lächelte säuerlich.
Die Reise nach Würzburg verlief trotz winterlicher Verhältnisse problemlos. Während Mimi in dem Fotoatelier vorstellig wurde, das sie als Gastfotografin eingeladen hatte, suchte Anton einen Tischler auf und legte ihm die Zeichnung vor, die er auf der Fahrt angefertigt hatte. Darauf zu sehen war ein Klapptisch. Diesen wollte er für seine zukünftige Reisetätigkeit bauen lassen, damit er nicht auf jedem Markt umständlich einen Stand mieten musste. Dementsprechend leicht sollte das Möbelstück sein.
Der Schreiner, ein junger Bursche mit einem Bart, der ihm fast bis zum Bauchnabel reichte, hörte Anton aufmerksam zu. Nach einem kurzen Blick auf die Zeichnung ging er nach hinten in sein Holzlager. Als er zurückkam, hatte er ein paar Bretter dabei, die so golden glänzten wie Honig. Dies sei Erlenholz, es sei leicht, hart und wasserbeständig, also ideal für diesen Auftrag, stellte der Tischler fest, und seine Augen glänzten dabei mindestens so sehr wie das polierte Holz.
Ohne zu zögern willigte Anton ein. Auf seinem zukünftigen Verkaufstisch würden Mimis Fotopostkarten perfekt zur Geltung kommen!
Am dritten Sonntag im Januar besuchte Anton seinen ersten Markt in der Nähe von Würzburg. Auf dem neuen Klapptisch lagen fächerförmig ausgebreitet fünf verschiedene Stadtansichten. Bei einer kleinen, am Main gelegenen Druckerei hatte er so lange gebettelt und gebeten, bis diese ihm kurzfristig von jeder Ansicht je hundert Postkarten gedruckt hatte.
Als er nun mit eiskalten Füßen hinter seinem Tisch auf die ersten Kunden wartete, schlotterten seine Knie, und seine Kehle war vor lauter Aufregung so trocken, dass er befürchtete, kein Wort herauszubekommen. Resolut bat er seinen Standnachbarn, kurz auf den Klapptisch und die Ware aufzupassen, dann ging er in eins der nahegelegenen Wirtshäuser und stürzte ein Bier hinunter. Was, wenn das alles nur eine Schnapsidee war?, fragte er sich, während er sich den Schaum von den Lippen wischte.
Seine Sorge war unbegründet. Als er auf den Markt zurückkam, stand schon eine kleine Traube Menschen um seinen Tisch herum. Die berühmte Festung Marienberg im fahlen Winterlicht, die Alte Mainbrücke, eine Ansicht der Stadt von der Festung aus, von Mimi kunstvoll versehen mit einem Schriftzug »Mein geliebtes Würzburg« – die Würzburger rissen Anton die Postkarten-Ansichten ihrer Stadt geradezu aus der Hand.
»Die Hälfte meines Darlehens kann ich schon heute zurückzahlen!« Stolz hielt Anton Mimi eine Handvoll Münzen entgegen.
»So viel hast du an einem einzigen Tag verdient?« Die Fotografin, die gleichzeitig mit ihm in der kleinen Pension am Main angekommen war, schaute fassungslos von dem Geld zu ihm und wieder zurück. »Dafür muss ich eine gute Weile in Herrn Marquards Atelier arbeiten! Und das ist nicht der größte Spaß – der Herr hat nämlich schrecklichen Mundgeruch«, fügte sie flüsternd und mit einer kleinen Grimasse hinzu.
Anton lachte. »Dann hoffen wir, dass ein gutes Essen Ihnen den Abend ein wenig versüßt! Es gibt hier ein kleines Gasthaus, in dem ein ordentlicher Rehbraten serviert werden soll, erzählte mir mein Standnachbar.« Er reichte Mimi den Arm. »Da lassen wir es uns jetzt gut gehen!«
Von Würzburg aus ging Mimis und Antons Reise weiter nach Regensburg. Zu Antons Begeisterung wurde dort just zu dieser Zeit ebenfalls ein großer Krämermarkt abgehalten. Wie in Würzburg fanden seine Postkarten reißenden Absatz. Auf der Rückreise nach Württemberg stand Antons Mund deshalb vor lauter Überschwang fast keine Minute still. Er hatte seine wahre Bestimmung gefunden, so viel stand fest!
Gewärmt von seinen ersten Erfolgen konnte er es verschmerzen, dass es rund um Bad Mergentheim, wo ein neuer Auftrag auf Mimi wartete, weit und breit keinen Markt gab. Sollte er die Zeit nutzen, um Alexander in Stuttgart zu besuchen?, fragte er sich. Doch als Mimi ihm erzählte, dass sie Ende März anlässlich des Geburtstags ihres Vaters einen Überraschungsbesuch in Esslingen geplant hatte, entschied er sich, mit Mimi im Hohenlohischen zu bleiben. Jetzt hatte er den Freund so lange nicht gesehen, da machten ein paar Wochen mehr oder weniger auch nicht viel aus. Außerdem fand er Mimis derzeitigen Auftrag ungemein spannend. Die Fotografin war nämlich im Auftrag der Württembergischen Armee tätig. Er, der als Junge immer davon geträumt hatte, als Marinesoldat zur See zu fahren, schaute der Fotografin fasziniert dabei zu, wie sie die Kaserne, als welche das Schloss diente, und ihre Soldaten so heroisch wie möglich in Szene setzte. Auch Mimi war angetan – einen Auftrag dieser Art hatte sie noch nie bekommen.
Und so war es schließlich Ende März, als Anton endlich nach Stuttgart kam.
»Du?« Ungläubig schaute Alexander Anton an.
»Mir blieb ja nichts anderes übrig, als dich zu besuchen – von dir hört man ja nichts«, sagte Anton mit gespielter Verzweiflung. Dann breitete er seine Arme aus. »Komm her, du untreuer Kerl!«
Halb lachend, halb weinend fielen sie sich in die Arme.
»Muss doch gucken, ob es dir gut geht«, raunte Anton seinem Kumpel ins Ohr, während die Schulsekretärin, die Alexander extra aus dem Unterricht geholt hatte, die Begrüßung argwöhnisch beäugte.
Anton warf ihr seinen einnehmendsten Blick zu. »Gnädige Frau, ich habe wichtige Nachrichten für Alexander, von seiner Familie und so. Darf ich ihn für eine Stunde vom Unterricht entführen?« Noch während er sprach, gab er Alexander einen Stups in die Seite, so wie früher, wenn er vor Erwachsenen geflunkert hatte.
Die Schulsekretärin überlegte kurz. »Aber zu Beginn der nächsten Stunde bist du wieder da, in Ordnung?«, sagte sie schließlich so streng, dass Alexander unter ihrem Blick regelrecht zu schrumpfen schien. Sein »Ja« war nicht mehr als ein Flüstern.
Eilig zog Anton den Freund nach draußen, bevor die Frau es sich anders überlegen konnte. Was war er froh, dass ihm niemand mehr solche Vorschriften machte!, dachte er erleichtert.
»Gibt’s hier in der Nähe eine gute Wirtschaft, wo wir zu Mittag essen könnten? Ich lade dich ein!«
Alexander zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, ich war noch nie auswärts essen. Außerdem habe ich nur vierzig Minuten Zeit, du hast ja Frau Unmuth gehört«, sagte er bedauernd.
»Ja sollen wir jetzt etwa die ganze Zeit hier herumstehen?« Anton verzog den Mund, während er seinen Blick durch die Straße schweifen ließ. Außer grauen Häuserfassaden und der Schule gab es nicht viel zu sehen. »Dann setzen wir uns wenigstens dort auf eine Bank!«, sagte er und zeigte auf einen kleinen, düsteren Park. Genau wie früher in Laichingen, ging es ihm missmutig durch den Sinn.
Ihr ganzes Leben lang hatten sie sich in irgendwelchen düsteren Ecken getroffen – am Gleis vom zugigen Bahnhof, im elterlichen Bierkeller, in dunklen Gassen –, um sich einander, geschützt vor dem Zugriff ihrer Eltern, wenigstens kurz gegenseitig ihr Leid zu klagen.
»Frau Reventlow ist nicht mitgekommen?«, fragte Alexander, der ihm in den Park folgte.
»Mimi ist bei ihren Eltern in Esslingen, ihr Vater hat Geburtstag, und sie wollte ihn mit ihrem Besuch überraschen. Wir treffen uns morgen wieder«, sagte Anton. »Ich soll dich herzlich von ihr grüßen!«
»Mimi …«, sagte Alexander. »Ihr duzt euch also?«
Anton winkte beiläufig ab. »Wir sind ja schließlich Geschäftspartner.« Die Wahrheit war, dass er Mimi zwar bei ihrem Vornamen nannte, jedoch weiterhin »Sie« zu ihr sagte.
»Dann bist du jetzt also ein erfolgreicher Unternehmer, Gratulation!«, sagte Alexander und klopfte Anton auf die Schulter.
Anton stutzte. »Wenn du meine Briefe gelesen hast, warum hast du mir dann nie geantwortet?«, fragte er aufbrausend. Doch als er sah, wie Alexander sich sogleich duckte, als erwarte er einen Schlag in den Nacken, verflog sein Unmut so schnell, wie er gekommen war. »Bisher läuft es ganz gut«, sagte er ausweichend.
Auf der Zugfahrt hierher hatte er sich ausgemalt, wie er Alexander sein neues Leben in den buntesten und aufregendsten Farben schildern würde. Mit seiner neuen Charivari-Kette, die er sich in Würzburg gekauft hatte, hatte er ihn wie ein vornehmer Herr beeindrucken wollen. Doch nun verspürte er auf einmal keine Lust mehr, über sich zu reden oder gar mit seinen Erfolgen zu prahlen. Irgendetwas stimmte nicht …
Auf den ersten Blick machte Alexander einen guten Eindruck. Er war nicht mehr so mager wie einst, er trug auch keine Hochwasserhosen mehr wie in Laichingen. Aber eine große Anspannung, eine innere Unruhe ging von ihm aus. Und dann dieses Lodern in seinen Augen! Der Freund wirkte, als würde er bei einer unachtsamen Bewegung wie ein Glas in tausend Scherben zerspringen. Was war los mit dem Freund?, fragte Anton sich und hatte gleichzeitig Angst vor der Antwort.
»Und? Wie geht es dir so?«, wollte er betont fröhlich wissen. Noch während er sprach, hielt er den Atem an.
Ungelenk kickte Alexander mit dem rechten Fuß ein paar Kieselsteine weg. »Das verdammte Bein macht Probleme. Es gibt Tage, da schaffe ich es kaum zum Bahnhof. Und wenn ich nach ein, zwei Stunden Zeichenunterricht wieder aufstehe, ist es so taub, dass ich mich fast nicht traue, es zu belasten. Ein paar Mal bin ich schon gestolpert und hingefallen.«
Anton presste die Lippen aufeinander. Es gab Geschichten, an die er sich nur ungern erinnerte – und die von Alexanders Bein gehörte dazu.
Als Mimi Reventlow Alexander letztes Jahr freudestrahlend eröffnet hatte, dass er zur Stuttgarter Kunstschule eingeladen sei, hatte Alex’ Vater sich quergestellt – sein Sohn sollte Weber werden, so wie er einer war! Alexander und seine Mutter hatten alles versucht, um Klaus Schubert umzustimmen, aber kein Bitten und Betteln hatte geholfen. Heute konnte Anton nicht mehr nachvollziehen, wie er auf die Schnapsidee mit der Selbstverletzung gekommen war, aber eines Tages hatte er den Freund bedeutungsvoll gefragt: »Was, wenn du für die Arbeit am Webstuhl körperlich nicht mehr geeignet wärst?« Kreidebleich war Alexander geworden! Doch am Ende hatte er keinen anderen Weg gesehen, seinen Traum zu verwirklichen, als den, den Anton vorschlug: Mit der Axt von Josef Stöckle hatte er sich beim Holzhacken »versehentlich« in den Unterschenkel gehackt. Es war eine schwere Verletzung geworden – Sehnen, Gefäße und der Knochen waren durchtrennt, zerstört, angebrochen. Er würde zwar wieder gehen können, hatte der Laichinger Arzt gesagt, aber den Beruf des Webers würde er nicht ausüben können. Trotz der Schmerzen hatte Alexander aufgeatmet. Seine Rechnung ging also auf! Die Freude hatte jedoch nicht lange gewährt: Noch während er im Krankenzimmer des Arztes lag, hatte sich sein Vater das Leben genommen. Und Alexanders Opfer war umsonst gewesen.
Was für eine traurige Ironie des Schicksals, dachte Anton nun. »Wenn es wärmer wird, tut das deinem Bein bestimmt gut«, sagte er tröstend. »Und sonst so? Wie ist es in der Kunstschule? Hast du schon dein erstes Kunstwerk gemalt?«
Statt auf seinen Scherz einzugehen, verdüsterte sich Alexanders Miene. »Es gibt da eine Clique – sie nennen sich Lupi – die Wölfe –, bei denen wäre ich gern dabei. Sie kommen alle aus reichem Elternhaus, aus der so genannten feinen Gesellschaft. Die haben bei uns das Sagen. Die machen nur, was sie wollen, ob außerhalb der Schule oder im Kunstunterricht. Und wenn ihnen jemand querkommt, dann scheren sie sich einen feuchten Kehricht drum! An die reicht unsereiner nie heran …«
Mitschüler, die sich »Wölfe« nannten? Was für ein Quatsch, dachte Anton. Laut sagte er: »Wenn dir etwas an den Jungs liegt, dann mach doch mit bei denen!«
Alexander fuhr herum wie ein gereiztes Tier. »Mach doch mit!«, wiederholte er höhnisch. »Dass von dir so ein Spruch kommt, hätte ich mir ja denken können. Du hast ja keine Ahnung! Als ob die ein Landei wie mich in ihren Kreis aufnehmen würden!« Doch sofort wurde seine Miene wieder mutlos. »Die hassen mich, Anton«, sagte er leise und mit so zittriger Stimme, dass Anton das Schlimmste befürchtete. Der Freund würde doch nicht zu weinen beginnen?
»Die äffen bei mir alles nach – meinen Dialekt, meine Lahmheit. Jeden Tag lassen sie mich spüren, dass ich der dumme, arme Älbler bin. Alles, was ich male oder zeichne, ziehen sie in den Dreck. Und als es Anfang des Jahres danach aussah, dass ich wegen eines Affronts die Schule verlassen muss, köpften die Wölfe im Unterricht eine Flasche Sekt, so ergötzte sie der Gedanke, mich bald los zu sein.«
Ein Affront zu Jahresbeginn? Ein drohender Schulausschluss? Warum wusste er von all dem nichts?, fragte sich Anton. Verflixt, warum war er nicht früher nach Stuttgart gefahren? Tief drinnen hatte er doch geahnt, dass etwas nicht stimmte mit Alexander …
»Diese Wölfe scheinen ziemliche Lackaffen zu sein«, sagte er heftig. »Mensch, Alex, lass dir von denen doch nicht den Schneid abkaufen!« Er versetzte dem Freund einen spielerischen Stoß. Doch statt ihn durch seine Worte aufzurichten, wie er es erhofft hatte, sank der Webersohn noch mehr in sich zusammen.
So sehr der jämmerliche Anblick seines Freundes ihn auch verstörte, so spürte Anton im selben Moment Wut in sich aufsteigen. »Jetzt lass dich nicht so hängen!«, sagte er heftig. »Du darfst denen erst gar keine Angriffsfläche bieten! Wenn die spüren, dass sie Erfolg haben mit ihren Gemeinheiten, dann quälen sie dich immer weiter. Schau durch diese Typen einfach hindurch, die können dir doch egal sein! Du bist wegen deines Könnens in dieser Schule – sie nur wegen des Geldes ihrer Väter!« Er spuckte verächtlich auf den Boden. Als Alexander noch immer nicht reagierte, sagte er: »Wenn du willst, verprügle ich den Oberwolf für dich. Ich warte heute Abend am Schultor, und du gibst mir ein Zeichen, wer der Anführer ist!«
Unwillkürlich musste Alexander lachen. »Ach Anton, ich hab dich so vermisst!«, sagte er dann und klang schon ein wenig frohgemuter.
»Dann folge meinem Rat!«, knurrte Anton und beschloss, den frohen Moment zu nutzen. Er zog ein kleines Notizbuch und einen Bleistift aus der Tasche – beides hatte er zuvor gekauft – und hielt es dem Freund hin. »Ich habe eine Bitte – könntest du mir ein Porträt von Christel zeichnen? Du weißt ja, ich suche sie noch immer. Wenn ich den Leuten ein Bild von ihr zeigen könnte, wäre alles einfacher.«
*
Wie immer, wenn Alexander einen Stift oder Pinsel in der Hand hatte, war er wie in einer anderen Welt. Vergessen war sein schmerzendes Bein, vergessen war auch Anton, der ungeduldig neben ihm auf der Bank hin und her rutschte. Christels Porträt machte ihm keine Mühe, er hätte fast jeden Laichinger aus der Erinnerung malen können. Dass jedes Gesicht anders aussah, obwohl doch jeder Mensch eine Nase, zwei Augen und einen Mund besaß, hatte ihn schon als kleinen Jungen fasziniert. »Starr die Leute nicht so an, das ist unhöflich!« oder »So viel, wie du durch die Gegend schaust, fallen dir noch mal die Augen aus!«, hatte er von seiner Mutter immer wieder zu hören bekommen. Aber ihm, dem stillen, zurückgezogenen Jungen, war das Schauen nun einmal leichter gefallen als das ungezwungene Miteinander, das seine Schulkameraden pflegten. Einzig mit Anton hatte er immer schon reden können.
Nach ungefähr zehn Minuten gab er Anton das Notizbuch zurück. »Hier hast du deinen Schatz.«
Anton, der eine Zigarette geraucht hatte, stieß einen leisen Pfiff aus. »Alle Achtung! Das ist Christel, wie sie leibt und lebt.«
Während Alexander sich noch in Antons Bewunderung aalte, schaute dieser Christels Porträt weiter an.
»Gefällt es dir doch nicht?«, fragte Alexander unsicher.
»Doch, sehr sogar! Mir kommt da nur gerade ein Gedanke …« Antons Augen funkelten unternehmungslustig, als er den Freund anschaute. »Mit solchen Zeichnungen könntest du auf den Märkten, die ich besuche, viel Geld verdienen. Die Leute würden Schlange stehen, um sich von dir porträtieren zu lassen! Mensch, das ist doch die Idee, warum vergisst du die Kunstschule nicht einfach und kommst mit Mimi und mir mit?«
»Ich soll … was?« Fast erschrocken rückte Alexander von Anton ab. War der Freund verrückt geworden? »Das … das geht nicht!«
»Alles geht, wenn man nur will«, sagte Anton bestimmt. »Nur weil du ein Stipendium bekommen hast, bist du denen noch lange nichts schuldig.«
Alexander schwieg. Ja, er hasste die Schule und das ganze Drumherum. Doch die Vorstellung, nicht weiter lernen zu dürfen, war unerträglicher als der Gedanke an alle noch kommenden Hänseleien der Wölfe.
Anton, der sein Schweigen als Zustimmung deutete, kam nun erst recht in Fahrt. »Ich weiß, du wolltest die ›große Kunst‹ lernen. Aber glaube mir, Geld verdienen ist auch eine Kunst! Außerdem – sind die größten Kunstwerke nicht eh schon alle gemalt? Da Vincis Mona Lisa, die Rubensgemälde, die Malereien von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle … Was willst du da noch großartig hinzufügen?«
Alexander glaubte, nicht richtig zu hören. »Kunst ist doch nichts, was nur in Museen und in italienischen Kapellen zu finden ist! Kunst ist allgegenwärtig! Diese Häuserfront hier, der Lichteinfall in jedem einzelnen Fenster, der Schattenwurf der kahlen Bäume, du, ich, einfach alles ist Kunst, wenn man es mit dem entsprechenden Blick betrachtet. Der Umgang mit Farbe, das Entschlüsseln von Formen, dreidimensionales Denken und Malen – es gibt so vieles, von dem ich noch lange nicht genug weiß! Ich will nicht reich oder berühmt werden, ich will einfach lernen, verstehst du? Der Rest ist zweitrangig«, sagte er tapfer.
Anton, der wusste, wann er sich geschlagen geben musste, lachte gutmütig auf. »Nur nicht unterkriegen lassen – so gefällst du mir schon besser.« Er klopfte Alexander auf die Schulter. »Falls du es dir je anders überlegst – an meinem Marktstand bist du immer willkommen.« Er stand auf, und Alexander tat es ihm gleich. »Wann bist du heute Abend fertig? Lass uns ein paar Bier trinken, und vielleicht passiert sogar noch mehr. Es heißt doch immer, die Stuttgarter Mädchen seien die schönsten.«
»Und was ist mit Christel?« Alexander runzelte die Stirn.
Anton schnaubte. »Was soll mit der schon sein?«
»Aber … Ich dachte, du liebst sie …«
»Liebe? Das war einmal! Das verlogene Miststück hat mich verraten und verkauft. Wir wollten gemeinsam weggehen aus Laichingen, stattdessen hat sie sich mit meinem Geld auf und davon gemacht. Ich sag dir, wenn ich sie jemals finde, dann gnade ihr Gott …«
Christel hatte sich mit Antons Geld auf und davon gemacht? Wann hatte Anton je Geld besessen?, fragte sich Alexander verwirrt. Scheinbar gab es einiges, was er über den Freund nicht wusste.
»Jetzt schau nicht wie ein Schaf. Das war ein Scherz, eine Redewendung, mehr nicht«, sagte Anton, der sein Unwohlsein zu spüren schien. »Für mich ist es völlig in Ordnung, dass Christel ihrer Wege gegangen ist, wir beide tun ja nichts anderes. Ich würde mich lediglich gern einmal mit ihr unterhalten, Erfahrungen austauschen und so … Wie wir zwei es gerade tun …«
Alexander nickte vage, dann verabschiedeten sie sich. Wann immer er im Südwesten des Kaiserreichs unterwegs wäre, würde er bei Alexander vorbeischauen, versprach Anton. Wer’s glaubt, wird selig, dachte Alex bei sich. Allem Anschein nach gab es ja jetzt in Antons Leben sehr viel wichtigere Dinge als ihre alte Freundschaft.
4. Kapitel
Anton hatte keinen Scherz gemacht, er schien Christel wirklich zu hassen, dachte Alexander beklommen, während er mit pochendem Bein zur Schule zurückhumpelte. Dass sein Freund auch eine zweite, dunklere Seite besaß, hatte er schon immer gespürt. Doch er hatte diesem Umstand nie weitere Beachtung geschenkt, im Gegenteil – irgendwie hatte er Anton dafür stets ein wenig bewundert. Vielleicht musste man so abgebrüht sein, um gut durchs Leben zu kommen, dachte er. Oder war es eher die Kombination von mehreren Eigenschaften, die Anton so stark und unantastbar erscheinen ließ? Während er mit seiner schmächtigen Statur noch daherkam wie ein Bub, wirkte Anton mit seinen breiten Schultern, seinem hohen Wuchs und dem charmanten Auftreten wie ein Mann Mitte oder Ende zwanzig! Warum nur konnte er nicht ein wenig mehr wie Anton sein?, dachte Alexander traurig. Dann würde er leicht seine Tipps umsetzen und den Wölfen Paroli bieten können.
Am Nachmittag hatten sie Unterricht im Aktzeichnen. Er hörte schon jetzt die geflüsterten Hänseleien seiner Schulkameraden darüber, dass es bei ihm als Nacktmodell bestimmt nichts zu malen gäbe … Verflixt, warum konnte man nicht die Ohren schließen wie die Augen?
Unvermittelt hatte Alexander einen Kloß im Hals, und er schluckte hart gegen die Tränen an. Du bist und bleibst eine Memme! Kein Wunder, dass die andern dich hänseln, fuhr er sich stumm an. Im selben Moment sah er, wie Mylo aus dem Schulgebäude kam. Er trug seine abgewetzte Ledertasche bei sich und wirkte gehetzt, als habe er einen Termin.
Alexanders Herz schlug einen Takt schneller. Mylo war sein Lieblingslehrer. Hätte er sich nicht so für ihn, Alexander, eingesetzt, wäre er nach der Geschichte mit dem eisigen Kreuz im Januar von der Schule geflogen. Und als wäre das nicht schon genug, lobte Mylo ihn immer wieder für seine Fortschritte im Malen und Zeichnen, wo andere ihn tadelten. Allem Anschein nach hielt Mylo ihn für talentiert.
Ohne Mylo hätte er wahrscheinlich längst die Segel gestrichen, dachte Alexander und duckte sich in den Schatten eines Hauses. Er wollte nicht, dass Mylo ihn so geknickt sah, bestimmt hielt er ihn auch längst für einen Schwächling.
Warum ein so berühmter Mann sich überhaupt für ihn einsetzte, war ihm schleierhaft. Mylo, dessen wahren Namen niemand kannte, war ein gefeierter Architekt! Seine Bauwerke waren im ganzen Kaiserreich bekannt – dass er trotz seiner Berühmtheit und seines Reichtums an der Stuttgarter Kunstschule lehrte, zeugte nur davon, was für einen feinen Charakter er hatte.
Im nächsten Moment hob Mylo den Blick, und Alexander sah, wie sich die Miene des Lehrers aufhellte.
»Alexander! Gut, dass ich dich treffe, die Stunde Aktzeichnen fällt aus, weil …« Er brach stirnrunzelnd ab. »Ist alles in Ordnung?« Sanft legte er Alexander die Hand auf die Schulter.
Es war diese kleine Geste der Zuneigung, die Alexanders Dämme endgültig einstürzen ließ. »Nichts ist in Ordnung!«, krächzte er, und bevor er etwas dagegen tun konnte, liefen ihm die Tränen über die Wangen.
Mylo schaute sich eilig um, dann zog er Alexander in den Park.
»Warum weinst du, um Himmels willen? Nun mal der Reihe nach, mein junger Freund, was ist denn los?«, fragte er, als sie just auf der Bank saßen, auf der Alexander gerade noch mit Anton gesessen hatte. Ein Rabe hatte sich daneben niedergelassen und pickte in Seelenruhe ein Stück altes Brot.
O Gott, wie peinlich! Alexander wischte sich mit der Hand die Tränen fort. »Mein bester Freund Anton war da, wir kennen uns von früher. Er sagt, ich dürfe den Lupi-Burschen keine Angriffsfläche bieten. Ich soll stark sein und mich wehren. Aber ich bin nicht so kraftstrotzend wie er! Und wie die andern bin ich auch nicht. Irgendwie fühle ich mich … nirgendwo zugehörig.« Er schluckte. »›Schuster, bleib bei deinen Leisten‹, heißt es nicht umsonst. Vielleicht ist es wirklich so, dass einer da hingehört, wo der liebe Gott ihn hingesetzt hat«, sagte er bitter. Der Rabe flog mit weit ausgebreiteten Schwingen davon.
»Was redest du für einen Unsinn! Nach Laichingen gehörst du ganz gewiss nicht«, sagte Mylo so heftig, dass Alexander erschrocken aufschaute.
»Dass du an deinem Können zweifelst, gehört zum Wesen eines Künstlers, es zeugt nur von deiner Feinfühligkeit und deiner inneren Zerrissenheit«, fuhr Mylo sanfter fort. »Davon könnten sich die von dir ach so bewunderten Wölfe eine Scheibe abschneiden, sie leiden nämlich alle an grenzenloser Selbstüberschätzung, wenn du mich fragst.«
Alexander spürte, wie er sich ein wenig entspannte. Das Wesen eines Künstlers – das hörte sich ziemlich gut an.
»Dein Bein …«, sagte Mylo unvermittelt. »Was ist eigentlich damit?«
Alexander biss sich auf die Unterlippe. Außer Anton wusste niemand Bescheid, und das sollte auch so bleiben, hatte er sich vorgenommen. Andererseits – Mylo war so gut zu ihm, warum sollte er seine Frage nicht ehrlich beantworten? Ohne noch weiter darüber nachzudenken, begann er zu erzählen, wie er sich selbst verletzt hatte, um zur Kunstschule gehen zu können.
»Was für eine Leidenschaft, was für eine Hingabe!«, sagte Mylo voller Bewunderung.
»Vor lauter Hingabe komm ich aber bald am Krückstock daher«, erwiderte Alexander mit einem Anflug von Galgenhumor.
Mylo schaute ihn düster an. »Und daran ist dann niemand anderes schuld als dein Heimatort! Dieses verdammte Weberdorf lässt die Menschen zu Verzweiflungstaten schreiten. Und es hält die Leute klein! Schau dir deine Stuttgarter Schulkameraden an, wie viel selbstbewusster sie sind – genau das musst du auch werden.«
»Aber wie soll mir das gelingen? Gibt’s dieses Selbstbewusstsein irgendwo zu kaufen?«, sagte Alexander halb lachend, halb verzweifelt. Es war wirklich erstaunlich, wie gut Mylo sich in das Leben in Laichingen einfühlen konnte, dachte er.
Mylo breitete die Arme in einer dramatisch wirkenden Geste aus, die Stuttgart, die Kunstschule und sie beide einschloss. »Nur das Hier und Jetzt zählt! Wie eine Pflanze Nährstoffe aus dem Boden saugt, kannst du Kraft aus dem Hier und Jetzt schöpfen. Vergiss die Vergangenheit, sie macht dich nur schwach.«
Dass nur das Hier und Jetzt zähle, sagte seine Mutter auch immer, dachte Alexander. Das war ja alles schön und gut, aber wie lebte man nach dieser Maßgabe? Dass er so gar keine Ahnung von dem hatte, was Mylo meinte, zeigte doch nur, wie dumm er war.
»Ich wüsste ganz genau, was ich dir raten würde«, sagte Mylo, und eine warme Atemböe traf Alexander. »Die Frage ist nur – vertraust du mir?«
Verwirrt nickte er. »Ja, natürlich!«, sagte er eifrig.
Mylo sah ihn zufrieden an. »Du sagst, du bist anders als die andern – ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass dies eine gute Sache ist? Mehr noch, dass du zu den wenigen Auserkorenen gehören könntest?«
Alexander stutzte. Zu welchen Auserkorenen?
»Schau mich an!«, sagte Mylo. »Bin ich wie die andern? Oder anders gefragt – wäre ich so erfolgreich, wenn ich wie die andern wäre?«
»Wahrscheinlich nicht«, sagte Alexander unsicher. Es tat gut, Mylo zuzuhören. Irgendwie erinnerte er ihn ein wenig an Mimi Reventlow. Auch sie hatte stets gewagt, neue, unangepasste Gedanken zu äußern.
»Mein Rat lautet: Kultiviere dein Anderssein! Du brauchst einen Krückstock? Dann geh auf den Markt und kauf dir einen. Verziere ihn mit Silber, Edelsteinen oder was immer dir gefällt! Stehe zu deinem kaputten Bein, es ist dein besonderes Merkmal, es gehört zu dir, so wie ein Muttermal oder eine hohe Stirn oder eine zu lange Nase. Schäme dich nicht wegen deines hinkenden Ganges, sondern tu so, als wäre Humpeln der neueste Modetrend! Und du wirst sehen, bald werden die Leute zu dir aufschauen und dich wegen deiner Besonderheit bewundern, das verspreche ich dir.«
Gebannt hatte Alexander zugehört. Doch er war schon zu lange gefangen in seinem Netz aus Selbstmitleid, Unsicherheit und Angst, als dass er diese neuen Ideen offen hätte annehmen können. »Ich weiß nicht … Ist es nicht schöner, irgendwo dazuzugehören, akzeptiert zu werden? Wer will schon ein Außenseiter sein?«, sagte er skeptisch.
Mylo lachte auf. »Ein Außenseiter! Ersetze dieses dumme Wort durch eins wie Vordenker, Wegbereiter oder … Genie, dann wird ein Schuh draus! Die meisten Menschen sind wie Lämmer – statt ihren eigenen Weg zu gehen, trotten sie brav mit der Herde mit. Und was die von dir so bewunderten Wölfe angeht – ihr gepflegtes Rebellendasein hört spätestens dann auf, wenn ihre Herren Väter die monatliche Zahlung einstellen«, sagte er spöttisch. Gleich darauf wurde er wieder ernst. »Du wirst hart arbeiten müssen, um der zu werden, der du tief drinnen bist. Aber eins kann ich dir versprechen – wenn du meinen Ratschlägen folgst, dann sorge ich dafür, dass du dich entfalten wirst wie ein Pfau, wunderschön und farbig …«
»Ein Pfau?« Alexander grinste schief. Er hatte noch nie einen Pfau in natura gesehen, nur die eine oder andere Abbildung. Es hieß, in der Stuttgarter Wilhelma gäbe es Pfaue …
»Diese Tiere sind wunderschön«, sagte er, »wie kommen Sie darauf, mich ausgerechnet mit einem Pfau zu vergleichen?«
»Wahrscheinlich sehe ich viel mehr in dir, als du selbst es tust«, sagte Mylo. »Wie wäre es übrigens, wenn du dich ab sofort Pfau nennst? Ein Künstlername schadet nicht, schau mich an!«
»Ich und ein Künstlername?« Alexander schüttelte den Kopf. »Da würden die Wölfe Augen machen, wo sie sich auf den Namen ihrer Gruppe so viel einbilden! Und ich weiß nicht … Pfau hört sich irgendwie komisch an.«
Mylo verzog den Mund. »Du hast recht. Wie wäre es mit Peacock? Das ist Englisch. Oder nein, warte, noch besser wäre das französische Wort für Pfau: Paon.«