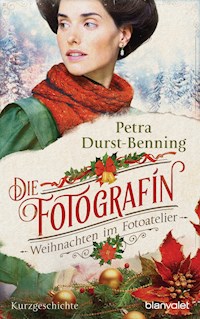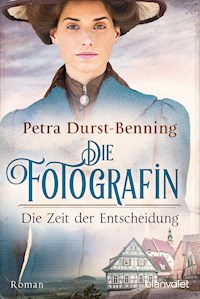
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fotografinnen-Saga
- Sprache: Deutsch
Protagonistin Mimi Reventlow ist eine ungewöhnliche Frau für ihre Zeit: Sie ist stark, unabhängig, leidenschaftlich und hat das Herz am rechten Fleck ...
Die Wanderfotografin Mimi Reventlow lebt seit einiger Zeit in der kleinen Leinenweberstadt Laichingen und kümmert sich um ihren kranken Onkel Josef. Durch ihre offene Art ist es ihr gelungen, die Herzen der Dorfbewohner zu erobern und Freundschaften zu knüpfen. Als eine Katastrophe das Dorf erschüttert, wird sie mit ihren wunderschönen Fotografien für viele der Bewohner gar zum einzigen Rettungsanker. Doch nach einer schweren menschlichen Enttäuschung muss Mimi erkennen, dass sie sich nicht nur in ihrem Foto-Atelier dem schönen Schein hingegeben hat, sondern auch im wahren Leben. Für Mimi ist die Zeit der Entscheidung gekommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Die Wanderfotografin Mimi Reventlow lebt seit einiger Zeit in der kleinen Leinenweberstadt Laichingen und kümmert sich um ihren kranken Onkel Josef. Durch ihre offene Art ist es ihr gelungen, die Herzen der Dorfbewohner zu erobern und Freundschaften zu knüpfen, und als eine Katastrophe das Dorf erschüttert, wird sie mit ihren wunderschönen Fotografien für viele der Bewohner gar zum einzigen Rettungsanker. Dabei hat Mimi genug eigene Schwierigkeiten: Ihre Liebe zu einem der Weber muss geheim bleiben, die Pflege ihres Onkels fordert sie, und der Besitzer der Weberei intrigiert weiter gegen sie. Als die Weber gegen ihr hartes Los aufbegehren, steht Mimi plötzlich auch beruflich vor einer Herausforderung. Wird sie es wagen, den schönen Schein aufzugeben und auf ihren Fotografien den entbehrungsreichen Alltag der Weber abzubilden?
Autorin
Petra Durst-Benning wurde 1965 in Baden-Württemberg geboren. Seit über zwanzig Jahren schreibt sie historische und zeitgenössische Romane. Fast all ihre Bücher sind SPIEGEL-Bestseller und wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. In Amerika ist Petra Durst-Benning ebenfalls eine gefeierte Bestsellerautorin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Hunden südlich von Stuttgart auf dem Land.
Von Petra Durst-Benning bei Blanvalet bereits erschienen:
Die Fotografin. Am Anfang des Weges. Band 1
Die Maierhofen-Reihe:
Kräuter der Provinz – Das Weihnachtsdorf – Die Blütensammlerin – SpätsommerliebeBesuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Band 2
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gisela Klemt
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (MarkauMark; Vasya Kobelev; struvictory) und Richard Jenkins Photography
Die Bilder am Schluss stammen
aus dem Privatarchiv von Petra Durst-Benning
NG · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23081-4V002www.blanvalet.de
»In der Fotografie können die kleinsten Dinge das größte Thema sein.«
Henri Cartier-Bresson (1908–2004)
1. Kapitel
Laichingen auf der Schwäbischen Alb, Pfingstmontag 1911
Wie auf Wolken schwebte Mimi ins Haus ihres Onkels. Doch es waren nicht ihre guten Umsätze auf dem gerade zu Ende gegangenen Pfingstmarkt, die sie strahlen ließen, sondern der Gedanke an Hannes. Der Mann, der ihr seit ihrer ersten Begegnung vor einigen Wochen in Ulm nicht mehr aus dem Kopf gegangen war. Der Mann, der sich nicht nur einmal in ihre Träume geschlichen hatte.
Mimi konnte immer noch nicht glauben, dass er ihr nachgereist war. Als er vorhin wie aus dem Nichts auf dem Markt auftauchte, war sie fast in Ohnmacht gefallen vor unbändiger Freude. Angesichts aller widrigen Umstände hatte sie nämlich die Hoffnung schon fast aufgegeben, ihn jemals wiederzusehen.
Doch nun war er hier, in Laichingen. Wegen ihr. Dabei hatte er in Ulm mit voller Überzeugung verkündet: »Mein Heimatdorf kann mir gestohlen bleiben! Nie mehr werde ich einen Fuß dorthin setzen.« Dass Hannes aus Laichingen stammte, hatte sie damals nicht gewusst. Ihr zuliebe hatte er offenbar seine Vorsätze über den Haufen geworfen, dachte sie jetzt glücklich. Noch nie war sie einem Mann so wichtig gewesen …
Lächelnd versorgte Mimi ihren Onkel, der, müde vom Markttag, gleich ins Bett wollte, dann machte auch sie sich fertig für die Nacht. Hannes wolle sobald wie möglich zu ihr kommen, hatte er gesagt. Wann war »bald«, fragte sich Mimi, als sie im Bett lag. Nun, da sie ihn in ihrer Nähe wusste, hielt sie es vor Sehnsucht kaum mehr aus. Sie seufzte und kuschelte sich tiefer unter ihre Bettdecke.
Schon ihre Begegnung in Ulm war ihr schicksalhaft vorgekommen. Der Abend und die halbe Nacht, die sie miteinander verbracht hatten, waren geprägt gewesen von einer Intensität und Vertrautheit, die Mimi in dieser Form nicht kannte. Zweisamkeit oder Freiheit? Für Mimi war immer die Freiheit wichtiger gewesen als alles andere.
Doch nun, mit Hannes, konnte sie sich alles vorstellen.
Es war acht Uhr am Morgen – Onkel Josef schlief noch –, als es leise an der Tür klopfte. Mimi, seit zwei Stunden rastlos auf den Beinen, wusste sofort, dass er es war.
»Hannes …« Ihre Stimme war nur ein Flüstern. »Du bist gekommen.« Ihre Augen tasteten ihn ab, vorsichtig, als könnten sie immer noch nicht glauben, dass er wirklich hier war. Die braunen Augen, warm wie verglühendes Holz. Der Mund, eine Spur zu groß, aber für einen Mann, der so viel zu sagen hatte, genau richtig. Die dunkelbraunen widerspenstigen Locken … Die große, kräftige Statur, die breiten Schultern zum Anlehnen. Mimi vermochte sich nicht zu erinnern, wann ihr ein Mann jemals so gut gefallen hatte.
Im hellen Licht des Junimorgens erwiderte Hannes ihren Blick, prüfend fast, als wollte er sichergehen, dass seine Entscheidung, hierher zurückzukommen, auch wirklich richtig war. »Leicht ist es mir nicht gefallen, aber du bist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass etwas, was noch nicht einmal angefangen hatte, schon wieder zu Ende sein sollte.«
Was für eine Liebeserklärung! Mimi hatte noch nie schönere Worte gehört. »Du bist mir auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen«, gab sie flüsternd zu. Sie wollte sich an ihn schmiegen, doch Hannes nahm ihre Hand und zog sie nach hinten in den Garten, wo niemand sie von der Straße oder den umliegenden Häusern aus sehen konnte. Im Schatten des Fotoateliers schloss er sie endlich in die Arme.
Für einen langen Moment verweilten sie eng umschlungen, die Wärme und Nähe des anderen genießend.
»Wie hast du mich eigentlich gefunden?«, flüsterte sie.
Er grinste. »Ich wusste ja, in welcher Pension du übernachtet hast. Auf gut Glück bin ich also zu dem Wirt und hab ihn gefragt, ob er zufällig wisse, wo du als Nächstes hinwolltest. Erst hat er gezögert, aber als ich ihm klarmachte, wie wichtig mir die Angelegenheit ist, ist er mit deiner Adresse doch herausgerückt. Du kannst dir vorstellen, dass mich fast der Schlag getroffen hat, als ich hörte, dass du ausgerechnet in mein Heimatdorf gereist bist!«
»Und trotzdem bist du mir nachgekommen. Ach Hannes …«
Er löste sich von ihr, schaute ihr fragend in die Augen. »Darf ich dich um etwas bitten?«
Mimi nickte. Um alles durfte er sie bitten!
»Kannst du mich zukünftig Johann nennen? Hannes habe ich mich auf der Reise genannt. Wann immer jemand in Amerika meinen Namen ausgesprochen hatte, klang er wie der eines Mädchens – ›Joanne‹. ›Hannes‹ fiel den Amerikanern wesentlich leichter. Aber die Leute hier im Dorf würden sich nur wundern, wenn du diesen Namen verwendest.«
»Kein Problem«, sagte Mimi lächelnd. Namen waren Schall und Rauch. »Solange du mich nicht Minna nennst! So rief mich meine Mutter immer dann, wenn ich als Kind etwas ausgefressen hatte.«
»Und – warst du denn brav in den letzten Wochen? Oder hast du schon einem Weberburschen den Kopf verdreht?«
»Das würdest du gern wissen, was?« Als ob einer von den blassen, übermüdeten Webern, die von früh bis spät in den Fabriken schufteten, auch nur annähernd so attraktiv war wie Johann, dachte sie bei sich.
Er ergriff eine braune Haarsträhne, die sich aus ihrer eleganten Hochsteckfrisur gelöst hatte, und wickelte sie um den Zeigefinger seiner rechten Hand. »So, wie dein Stand auf dem Pfingstmarkt belagert war, scheinst du bei den Leuten jedenfalls sehr gut anzukommen.«
Mimi grinste. »Gott sei Dank, sonst könnte ich einpacken! Ich muss jetzt schließlich für zwei Geld verdienen, für mich und meinen pflegebedürftigen Onkel.« Sie zeigte auf das Haus hinter sich.
Hannes schaute sie bewundernd an. »Du bist so stark und schön«, flüsterte er. »Ich kann es kaum erwarten, dich endlich näher kennenzulernen. Du und ich …« Er zog sie erneut an sich.
Mimi schloss die Augen in süßer Erwartung seines Kusses. Einen Wimpernschlag lang schien die Welt stillzustehen, dann endlich fanden seine Lippen die ihren. Mimis Knie wurden weich, ein wohlig warmes Beben erfasste sie, und mit einer für sie ungewohnten Hingabe öffnete sie ihre Lippen.
*
Am Morgen nach dem Pfingstmarkt war Anton ein anderer Mann. Frohgemut stand er in der Küche der elterlichen Gaststätte am Waschbecken und spülte die unzähligen benutzten Bierkrüge, als würde er stattdessen Goldmünzen zählen.
Wie gut, dass Alexander und er sich gestern Abend noch getroffen hatten, dachte er, während er die Krüge mit einem sauberen Tuch nachpolierte.
Noch immer war er erstaunt über die Intensität, mit der sein bester Freund geschworen hatte, alles dafür zu tun, um an der Aufnahmeprüfung der Stuttgarter Kunstschule, die die Fotografin Mimi Reventlow für ihn organisiert hatte, teilnehmen zu können. Solch ein inneres Feuer hätte er in dem blassen Webersohn nicht vermutet. Ihm, Anton, war während Alexanders glühender Rede eines klar geworden: Es reichte nicht aus, dass er selbst sich ständig über die Arbeit im Gasthaus beklagte. Über die Küchengerüche, die er so hasste. Über die Monotonie und die immer gleichen Gesichter, die er sah! Jammern war im Grunde genommen nichts anderes, als es sich in einem Schaukelstuhl bequem zu machen: Man bewegte sich zwar, aber von der Stelle kam man dabei nicht! In seinem Fall bedeutete diese Erkenntnis: Wenn er wie Alexander Laichingen den Rücken kehren wollte, dann musste er etwas tun. Und genau das hatte er von heute an vor. Mehr noch, er hatte schon eine ziemlich gute Idee, wie ihm das gelingen konnte! Er musste so schnell wie möglich mit seinem Schatz darüber sprechen, dachte er im selben Moment. Christel tat sich nach wie vor schwer mit dem Gedanken, ihren Heimatort zu verlassen, dabei erging es ihr im Haus ihrer Eltern noch schlechter als ihm hier in der Wirtschaft! Während er immerhin Lohn für seine Arbeit bekam, war Christel nur die kostenlose Magd für Paul und Sonja Merkle. Christel hatte genau wie er mehr verdient, dachte er mit grimmiger Bestimmung.
»Ich bin mal kurz weg!«, rief er seiner Mutter zu, die an einem der Tische in der Wirtsstube saß und das Münzgeld der vergangenen zwei Tage in kleine Stapel sortierte.
Was für ein herrlicher Morgen, dachte Anton, als er vor den Ochsen getreten war. Der Himmel war wie blank geputzt, das Kopfsteinpflaster des Marktplatzes leuchtete im Sonnenlicht wie Anthrazit, in den Bäumen vor der Kirche zwitscherten die Vögel, als würden sie an einem Gesangswettbewerb teilnehmen. Wie gut würde es sich anfühlen, sein Bündel zu packen und an einem Tag wie diesem auf die Reise zu gehen! Bald, mahnte er sich, bald.
Ob die Fotografin schon wach war? Ganz bestimmt, dachte Anton, während er mit forschem Schritt auf das Haus auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes zuging. Mimi Reventlow war geschäftstüchtig, klug und fleißig. Zeit war Geld – sagte man nicht so? Anton lachte.
Mimi Reventlow wusste es noch nicht, aber wenn sie Laichingen verließ, würde er an ihrer Seite sein. Für eine Weile musste er sich weiterhin gedulden – solange ihr Onkel am Leben war, würde sie hierbleiben und ihn pflegen, das war Anton klar. Aber träumen konnte er schon jetzt, oder etwa nicht? Dass die Fotografin und er gut miteinander auskamen, hatte er vor Kurzem schon bei ihrem Ausflug nach Ulm festgestellt. Sie und ihre fotografischen Künste, er und sein Geschick in allen möglichen Belangen – gemeinsam würden sie die Welt erobern! Sehr lange würde es sicher nicht mehr dauern, dachte er, als sein Blick auf die geschlossenen Fensterläden des oberen Stockwerks fiel, wo Josef Stöckle allem Anschein nach noch schlief. Der alte Fotograf war schwer krank, gewiss holte ihn der liebe Gott bald zu sich. Nicht, dass er, Anton, Mimis Onkel den Tod wünschte, im Gegenteil! Er würde die Wochen oder Monate, die Mimi Reventlow wegen ihres Onkels in Laichingen blieb, zu seinem Vorteil nutzen. Eine kleine Hilfestellung da, ein Gefallen hier – im Laufe der Zeit würde er sich immer unentbehrlicher machen. Und war der Tag der Abreise dann gekommen, würde Mimi Reventlow gar nicht anders können, als ihn als Begleiter mitzunehmen! Das war sein Plan.
Schwungvoll öffnete Anton das Gartentor. Er war schon an der Haustür angelangt, als er hinten am Fotoatelier einen Schatten sah, der sich bewegte. Ein Einbrecher? Die Fotografin hatte auf dem Markt gute Umsätze gemacht, das hatten viele mitbekommen. Wollte jemand an ihr Geld? Mit geballten Fäusten und klopfendem Herzen schlich Anton sich an, bereit, sich gleich hier und jetzt hilfreich für Mimi Reventlow einzusetzen. Doch als er um die Ecke des Holzschuppens lugte, sah er keinen Einbrecher, sondern Mimi Reventlow – in einer heftigen Umarmung mit Johann Merkle.
Anton blieb wie vom Donner gerührt stehen.
»Da ist noch etwas«, hörte er Johann sagen, als die beiden sich wieder voneinander lösten. »Es ist besser, wenn wir vorerst … nun ja, wenn wir vorerst nicht zusammen gesehen werden. Und dass wir uns schon aus Ulm kennen, braucht auch niemand zu wissen.«
Die beiden kannten sich? Anton glaubte seinen Ohren nicht zu trauen.
»Warum diese Heimlichtuerei?« Die Fotografin klang verständnislos.
Anton wagte es, erneut um die Ecke des Holzschuppens herumzuspähen. Johann Merkle wirkte leicht ungeduldig, als er sagte: »Hast du in den Wochen, in denen du nun schon hier bist, etwa noch nicht bemerkt, dass die Uhren in Laichingen ein wenig anders ticken? Jeder bekommt alles von jedem mit! Ich will nicht, dass die Leute über dich tratschen. Als Geschäftsfrau muss dein Ruf untadelig sein, da kann es nicht angehen, dass dir eine Affäre mit einem wie mir angehängt wird.«
»Mit einem wie dir!« Lächelnd fuhr Mimi durch Johanns lockiges Haar. »Was soll denn das heißen?«
Eine Affäre? Die beiden hatten eine Affäre? Was hatte das alles zu bedeuten? In Antons Kopf schwirrte es so sehr, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte.
»Einem Auswanderer. Einem Herumtreiber. Einem, dem man nicht über den Weg trauen kann«, sagte Johann Merkle.
»Einem … Gewerkschafter?«, erwiderte die Fotografin neckisch.
»Dass ich für die Gewerkschaften arbeite, braucht erst mal niemand zu erfahren, sonst bekomme ich keinen Fuß mehr in irgendeine Tür.«
Johann Merkle war Gewerkschafter? Erst kürzlich hatte Anton in der Zeitung einen Bericht über einen Arbeiteraufstand in Berlin gelesen, anscheinend hatten Gewerkschafter die Männer derart aufgestachelt, dass sogar die Gendarmerie die aufgebrachte Menge nicht zur Raison hatte bringen können. Das wurde ja immer spannender … Anton wagte kaum mehr zu atmen, um nur ja kein Wort zu überhören.
»Aber daran ist doch nichts Unehrenhaftes«, sagte Mimi, noch immer eng an Johann geschmiegt. »Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Weber für ein bisschen Unterstützung dankbar wären. Dieses ungeschriebene Gesetz, dass der Sohn eines Webers auch Weber werden muss, finde ich unmöglich. Und dann die vielen Arbeitsstunden! Viel zu verdienen scheinen die Leute auch nicht, mein Onkel erzählt mir ständig, wie arm hier alle sind. Es ist höchste Zeit, dass jemand den Webereibesitzern klarmacht, dass sie die Leute nicht ewig so ausbeuten können!«
»Mimi, Mimi«, sagte Johann schmunzelnd. »Genau das liebe ich an dir! Das Feuer in deinen Augen, wenn du eine deiner Überzeugungen vorträgst. So etwas kenne ich sonst nur von Männern, nicht aber von einer Frau.«
»Und was ist daran verkehrt?«, erwiderte Josef Stöckles Nichte. »Du stehst doch auch für deine Überzeugungen ein, oder nicht?«
Johann nickte. »Aber so einfach mit der Tür ins Haus zu fallen, wäre hier in Laichingen das Verkehrteste, was ich machen könnte. Ich war viele Jahre fort, warum sollten die Leute mir vertrauen?«
Ganz genau!, dachte Anton heftig. All die Jahre hatte es Johann Merkle doch auch nicht geschert, was hier los war.
Doch Mimi Reventlow nickte verständnisvoll.
»Ich muss erst wieder heimisch werden und den Leuten zeigen, dass ich einer von ihnen bin. Mein erster Eindruck sagt mir jedoch schon jetzt, dass sich die Bedingungen, unter denen die Weber arbeiten, in den Jahren meiner Abwesenheit nicht gerade zum Besseren gewandt haben.«
War es nicht unglaublich? Da kam dieser Johann Merkle nach Jahren daherspaziert und bildete sich ein, über alles und jeden Bescheid zu wissen!, dachte Anton wütend. Was für ein arroganter Angeber!
»Mein Vertrauen hast du längst. Und wenn die Leute dich nur einmal so reden hören, wie ich es in Ulm auf dem Marktplatz getan habe, dann werden sie dir wie Lämmchen folgen«, sagte Mimi Reventlow und klang so voller Bewunderung, dass Anton sich auf die Lippe beißen musste, um nicht vor Entsetzen laut aufzuschreien. Die Fotografin war verliebt! Und wie!
»Dein Wort in Gottes Ohr.« Johann grinste. »Aber hier in Laichingen kann ich mich nicht so einfach auf den Marktplatz stellen und von Arbeiterschutzgesetzen und besseren Löhnen erzählen. Vielmehr werde ich als Weber anfangen, wahrscheinlich bei Herrmann Gehringer. Nur in der Höhle des Löwen erfahre ich aus erster Hand, wie die Dinge stehen.«
»Ausgerechnet bei dem Ekel willst du arbeiten?« Mimi Reventlow klang mehr als erstaunt.
»Was hast du denn mit Gehringer zu schaffen? Sag bloß, du hast dich mit dem schon angelegt?«
»Wie man es nimmt …« In kurzen Worten schilderte die Fotografin dem Heimkehrer ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Webereibaron. In Antons Augen hatte sie sich dabei gut geschlagen! Besser als die meisten Männer, die vor Gehringer nur katzbuckelten, dachte er.
Auch Johann Merkle schien von Mimis Verhalten angetan, jedenfalls klang sein Lachen anerkennend.
»Du und ich – immerhin sind wir schon zwei, die es wagen, Gehringer mutig entgegenzutreten! Aber dass ich bei Gehringer anfange, hat übrigens noch einen anderen Effekt …« Er hielt kurz inne, ehe er fortfuhr: »Mein Bruder wird deswegen Gift und Galle spucken. Als ich damals ging, war er unendlich froh. Dass ich mich ständig mit Gehringer anlegte, schadete in seinen Augen wohl seiner Karriere.«
Vertrautes Lachen ertönte, gerade so, als kannten die beiden sich schon ewig.
»So, und jetzt muss ich gehen, ich habe heute viel vor. Ich wohne übrigens bei meiner Mutter Edelgard, du kennst sie vielleicht, sie ist Näherin.«
»Wann sehen wir uns wieder?«, fragte die Fotografin und klang ein wenig traurig.
»Sobald wie möglich, versprochen! Aber wie sich die nächsten Tage gestalten, weiß ich einfach noch nicht.« Er hob ihr Kinn an, schaute sie aufmunternd an. »Ab jetzt haben wir doch alle Zeit der Welt, oder?«
Verwirrt und zornig zugleich schlich Anton davon. Dass Johann Merkle ausgerechnet jetzt, zur Unzeit, hier aufgetaucht war, war mehr als ärgerlich. Wie es aussah, hatte der Amerika-Heimkehrer die Fotografin schon ganz schön um den Finger gewickelt, dachte er und kickte wütend ein kleines Steinchen über den Marktplatz. Mimi Reventlow hatte sich angehört, als würde sie schon vom Traualtar träumen! Verflixt, sie sollte hier im Ort keine Wurzeln schlagen, sondern sich spätestens nach dem Tod ihres Onkels mit ihm an ihrer Seite wieder auf den Weg machen!
Einen Moment lang überlegte er, ob er Alexander aufsuchen und ihm von Johann und Mimi erzählen sollte. Doch dann entschied er sich dagegen – sein Freund war in Frauendingen sowieso nicht bewandert. Und vielleicht war es von Vorteil, wenn erst einmal nur er Bescheid wusste über diese seltsame Liaison.
Anton blieb stehen, atmete tief durch. Er musste jetzt einen kühlen Kopf bewahren, in Ruhe über die veränderte Situation nachdenken und nichts Unkluges tun. Die Zeit würde ihm schon zeigen, wie er mit der neuen Situation umzugehen hatte. Eins stand fest: An seinem Plan gab es nichts zu rütteln!
*
Eveline, die am Brunnen stand und Wasser schöpfte, hielt genießerisch ihr Gesicht in die Sonne. Genau so hatte auch gestern die Sonne geschienen, als sie Johann auf dem Pfingstmarkt gegenübergestanden hatte! Wie er sie angeschaut hatte, so intensiv und gefühlvoll …
Sie konnte es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Bestimmt nahm Edelgard ihren Sohn voll in Beschlag, und nicht nur sie!, dachte Eve zornig. Gestern auf dem Markt hatte sich das halbe Dorf um Johann geschart, sogar die Fotografin, dabei kannte sie ihn nicht einmal. Gönnten die Leute ihm nicht das kleinste bisschen Ruhe? Am liebsten hätte sie sich beschützend vor ihn gestellt, doch mehr als ein paar hastig dahingeflüsterte Worte waren ihnen nicht vergönnt gewesen. Doch sie hatten gereicht, um ihr neuen Lebensmut zu schenken.
Eveline lächelte. Noch konnte sie nur von Johann träumen, aber spätestens auf dem Heumondfest würden sie sich wiedersehen. Ganz bestimmt würde Johann sie zum Tanz auffordern, so wie einst … Sie würde in seinen Armen liegen und die Welt um sich herum vergessen, und wenn es nur für einen Moment war. Er würde ihr zuflüstern, wie schön sie sei und wie sehr sie ihn faszinierte, genau wie damals, vor seiner Abreise, als sie sich mehrmals heimlich getroffen hatten.
Eine Zeitlang hatte sie wirklich geglaubt, Johann würde sie aus ihrem Elend herausholen. Was, wenn sie noch einmal mit einem Mann durchbrannte? Dieses Mal mit Johann?
Als er dann von einem Tag auf den anderen verschwunden war, um in der Fremde sein Glück zu finden, war sie wie vor den Kopf geschlagen gewesen. Es hatte sie viel Kraft gekostet, sich immer wieder klarzumachen, dass sie verheiratet war und dankbar sein sollte, dass das Schicksal sie nicht zum Ehebruch oder Schlimmerem verführt hatte.
Aber nun war er zurückgekommen. Also hatte der liebe Gott doch noch etwas mit ihnen beiden vor. Eins stand für sie fest: Wenn Johann erfuhr, wie schrecklich es ihr ergangen war in den letzten Jahren, würde er bestimmt entsetzt sein und alles daran setzen, ihr zu helfen!
Leises Weinen riss Eveline aus ihren Gedanken. Sie wandte sich Marianne und Erika zu, die wie zwei kleine Häufchen Elend auf dem nackten Boden saßen.
Erika lief eine dicke Träne über die Wange. »Mein Bauch tut so weh, Mama«, schluchzte sie.
»Ach, Kinder«, sagte Eveline sanft. Auch ihr Magen knurrte, sehr sogar, aber Eveline tat so, als hörte sie es nicht. »Bis zum Abendessen sind es doch nur noch wenige Stunden, dann gibt’s eine gute Brotsuppe.« Einen halben Brotlaib hatten sie noch, der Rest war aus unerfindlichen Gründen über Nacht verschimmelt. Ihre Vorratskammer war leergefegt, auf dem Acker wuchs noch lange nichts Essbares, und in ihrem Geldbeutel herrschte Ebbe, seit Klaus am vergangenen Samstag seinen Lohn im Ochsen angelegt hatte.
Sie hievte den schweren Wassereimer auf den Leiterwagen. Die kleinen Pflanzen auf dem Acker brauchten dringend Feuchtigkeit, damit sie gut anwuchsen und im Herbst eine reiche Ernte bescherten.
»Wenn wir vom Acker heimgehen, sammeln wir nebenher leckeren Löwenzahn. Aus dem mache ich einen Salat, in Ordnung?«, sagte Eveline so aufmunternd wie möglich.
Marianne hielt sich den Bauch und sagte: »Kann ich meine Scheibe Brot nicht jetzt essen? Heute Abend mag ich vielleicht gar nichts.«
Eveline kämpfte gegen die Tränen an, die plötzlich in ihr aufsteigen wollten. Johann würde sicher wollen, dass sie stark war – gerade weil ihr Mann Klaus es nicht war!
»Wisst ihr was? Jetzt gehen wir erst mal in den Hühnerstall, und dann braten wir jedem von uns ein Ei!«
Sogleich hellten sich die blassen Kindergesichter ein wenig auf.
Die Hühner waren alt. Mit gerade einmal zwei kläglichen Eiern in der Hand ging Eve kurz darauf ins Haus, die Kinder folgten wie Lämmer.
Im Ofen glühte noch ein kleines Feuer, es würde reichen, um zwei Eier zu braten. Eveline stellte die schwere, gusseiserne Pfanne auf den Herd, dann nahm sie sich den Brotlaib vor. In weiser Voraussicht – oder Verzweiflung – hatte sie das verschimmelte Ende noch nicht weggeworfen. Resolut begann sie, den Schimmel so gut es ging von der Kruste abzukratzen. Den Hühnern wagte sie das verschimmelte Brot nicht mehr zu geben, nachdem ihr vor Jahren dabei alle Tiere gestorben waren.
»Schimmel macht schön, sagen die alten Leute hier im Ort«, behauptete sie und gab jedem Kind ein Stück Brot.
»Willst du nichts?«, fragte Marianne, als Eveline ihren Töchtern je einen Teller mit Ei vorsetzte.
»Ich bin noch satt vom Morgenbrei«, log Eveline. Allein beim Anblick der knusprig gebratenen Eier lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Um sich abzulenken, schaute sie sich die Zeichnungen an, die ihr Sohn Alexander auf altem Karton oder Einwickelpapier aus Helenes Laden angefertigt hatte. Eine Eule. Ein Schwalbennest, in dem eine Mutter ihre Jungen fütterte – jedes Grashälmchen hatte er gezeichnet, so fein, so genau …
War es nicht typisch, dass Alexander dieses Motiv gewählt hatte? Er hätte auch den Hahn vorn in der Straße malen können oder irgendetwas anderes. Aber nein, Alexander hatte eine fürsorgliche Schwalbenmutter gemalt. Der Gedanke verlieh Eveline neue Kraft. Und wenn es sie alles kostete – sie würde nichts unversucht lassen, Klaus doch noch die Erlaubnis abzuringen, dass Alexander an der Aufnahmeprüfung der Kunstschule teilnehmen durfte. Und wenn ihr das gelang, hatte Johann bestimmt ein paar hilfreiche Ratschläge für ihren Sohn parat.
Ein Sonnenstrahl drängte sich durch die enge Öffnung zwischen dem Nachbarhaus und ihrem und tauchte den dunklen Hof in goldenes Licht.
Eveline lächelte.
2. Kapitel
Am liebsten hätte sich Mimi auf die Bank vor Onkel Josefs Haus gesetzt und den ganzen Tag von Johann geträumt. Doch sie riss sich zusammen. Nun, da dank der guten Umsätze auf dem Pfingstmarkt endlich wieder Geld in ihrem Portemonnaie war, wollte sie einen Großeinkauf machen. Onkel Josef brauchte gute Speisen, wenn er seiner Lungenkrankheit etwas entgegensetzen wollte!
Sie trat gerade mit ihrem Einkaufskorb über dem Arm aus dem Haus, als sie am hinteren Gartentor Josefs Nachbarin Luise winken sah.
Notgedrungen ging Mimi auf sie zu. »Guten Morgen, auch schon so früh auf den Beinen?«
»Genau wie Sie«, sagte die alte Frau und lächelte anerkennend. »Und, sind Sie zufrieden mit dem Pfingstmarkt?«
»Sehr zufrieden«, erwiderte Mimi stolz. »Zur Belohnung werden wir uns heute ein paar Salzheringe gönnen – Onkel Josef meinte, dass Helene anlässlich des Pfingstmarktes immer ein Fass aufmacht. Bevor alle weg sind, gehe ich rasch in den Laden.« Vielleicht würde ihr dabei rein zufällig Johann über den Weg laufen?, dachte sie hoffnungsvoll.
»Und was ist damit?« Luise zeigte über den Gartenzaun streng auf ein brach liegendes Beet in Onkel Josefs Garten. »Wollen Sie hier eigentlich nichts anpflanzen? Wenn man seine eigenen Rüben, Kohlrabi und Zwiebeln hat, braucht man nicht drei Mal die Woche einkaufen gehen. Die Eisheiligen sind schon lange vorbei, es ist also höchste Zeit!«
Einen Moment lang war Mimi so konsterniert, dass ihr die Sprache wegblieb. Was ging es die Nachbarin an, wie oft sie einkaufte?
»Ich wüsste gar nicht, wo ich Setzlinge herbekommen sollte«, verteidigte Mimi sich schließlich. »Wahrscheinlich hätte ich die schon vor Wochen aus irgendwelchen Sämereien heranziehen müssen, aber damals …« Sie zuckte mit den Schultern. Damals hatte sie noch geglaubt, ihr Besuch hier sei eine kurze Angelegenheit. Dass ihr Onkel fast schon im Sterben lag, hatte jedoch alles verändert. Nachdenklich schaute sie auf das Gemüsebeet, in dem Löwenzahn und anderes Unkraut wucherten. »Wahrscheinlich würde es mir sogar Spaß machen, solch ein Gärtchen zu pflegen …«
»Das ist kein Hexenwerk, ich zeige Ihnen gern, wie’s geht«, sagte Luise sanfter als zuvor. »Die Hausarbeit meistern Sie doch auch schon ganz gut, da werden Sie den Garten gewiss ebenfalls bestellen können. Ich habe bei mir noch etliche Töpfe mit Setzlingen stehen, die auf meinem Acker keinen Platz mehr hatten. Wenn sie mögen, schenke ich sie Ihnen. Ein paar Rüben, Kraut und Kohlrabi – wenn der Herbst kommt, soll Josefs Speisekammer schließlich voll sein, oder?«
Wenn er den Herbst überhaupt noch erlebt, dachte Mimi sorgenvoll. Daran, dass er von der Schwindsucht nochmals genesen würde, glaubte sie inzwischen nicht mehr. Aber der Gedanke, dass in dem Beet junge Pflänzchen wuchsen, hatte etwas Tröstliches. Gemüse aus dem eigenen Garten, mit Liebe geerntet und gekocht – das würde Josef bestimmt guttun!
Mimi schaute die Nachbarin energisch an.
»Was muss ich tun?«
»Keine Heringe?«, sagte der Onkel enttäuscht, als Mimi Brot und Butter auf den Mittagstisch stellte.
»Das hast du deiner Nachbarin zu verdanken«, antwortete Mimi und schnitt jedem eine Scheibe Brot ab. »Luise hat mir heute früh eine ganze Menge Gemüsesetzlinge geschenkt. Danach habe ich den Vormittag damit verbracht, das Gemüsebeet in Schuss zu bringen, und schließlich blieb keine Zeit mehr, zu Helene zu gehen. Immerhin – die Pflänzchen stehen nun wie Soldaten in Reih und Glied«, sagte sie mit einer Spur Stolz in der Stimme. »Ich habe zwar keine Ahnung, was aus denen mal wird, aber wir lassen uns einfach überraschen, nicht wahr?« Mimi lachte. Wie ihre Hände aussahen!, dachte sie gleichzeitig entsetzt. Die Erde hatte sich so hartnäckig in jede Hautfalte gegraben, dass weder Kernseife noch Bürste dagegen helfen würden. Und so sollte sie später hinter der Kamera stehen?
»Das Gemüsegärtchen war immer Traudels ganzer Stolz. Sie würde sich freuen, wenn sie wüsste, dass du nun diese Aufgabe übernommen hast! Ach Mimi, es ist so schön, dich hierzuhaben …« Der Onkel lächelte wehmütig. »Trotzdem – wenn ich daran denke, dass du wegen mir deine Karriere aufgegeben hast, habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Du bist eine gefragte Wanderfotografin! Statt in feinen Kurbädern und Touristenorten gutes Geld zu verdienen, schaust du mir beim Sterben zu! Kind, das ist mir gar nicht recht …«
Entsetzt sah Mimi, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. »Ich bin gern hier«, sagte sie sanft. Zurück auf die Straße, einem Auftrag nach dem andern hinterherhetzen? Nie und nimmer, dachte sie.
Was sie in all ihren Jahren als Wanderfotografin niemals für möglich gehalten hatte, war eingetroffen: Sie fühlte sich als »ansässige Fotografin« sehr wohl. Wie oft hatte sie es in früheren Zeiten bedauert, Menschen immer nur flüchtig kennenzulernen! Ein paar freundliche Sätze, ein Klick ihres Auslösers und dann »Adieu«. Hier im Ort jedoch begann sie zum ersten Mal zaghafte Freundschaften zu knüpfen, sei es mit ihrer etwas naseweisen Nachbarin Luise oder auch mit dem patenten Wirtshaussohn Anton. Und dann war da noch ihr geliebter Onkel Josef – sie würde für ihn da sein bis an sein Lebensende. Das hatte sie sich geschworen und daran gab es nichts zu rütteln. Und jetzt, wo Johann gekommen war, gab es sowieso keinen Grund mehr für sie wegzugehen.
Einer Laune folgend schnitt sie das Butterbrot, das sie für Josef geschmiert hatte, in der Form eines Fisches zurecht. »Da, dein Hering!«, sagte sie grinsend und stellte dem Onkel den Teller hin. Zu ihrer Freude erschien ein kleines Lächeln auf seinem Gesicht.
»Im Ernst – ich genieße es gerade sehr, nicht ständig im Aufbruch begriffen zu sein. In deinem Atelier kann ich schalten und walten, wie ich möchte. Endlich muss ich keine Kompromisse mehr eingehen, das ist ein ganz neues Gefühl für mich!«
Der alte Fotograf nickte zufrieden. »Es geht doch nichts über ein eigenes Atelier – sage ich dir das nicht seit Ewigkeiten?«
Mimi lachte. »Aber weißt du, was mich dennoch ein wenig stört? Ich fühle mich so beobachtet! Die Leute achten darauf, wie oft ich einkaufen gehe, wie sauber die Wäsche ist, die ich draußen aufhänge. Es wird geschaut, ob ich vor der Tür ordentlich gefegt habe, ob ich schon Unkraut im Gärtchen gejätet habe … Und wehe, ich wage es, mich einmal ein halbes Stündchen auf die Bank zu setzen und das Gesicht in die Sonne zu halten! Dann bekomme ich über den Gartenzaun vorwurfsvolle Blicke zugeworfen, als wäre ich das faulste Luder überhaupt. Hier bekommt wirklich jeder alles mit.« Und wegen dieser allgemeinen Neugierde mussten Hannes und sie nun auch noch ihre Beziehung geheim halten, dachte sie.
»Das sagt ja gerade die Richtige! Deinem scharfen Fotografenblick entgeht doch auch nichts«, sagte der Onkel lachend. »So wie gestern, als dieser junge Bursche eine Postkarte einstecken wollte, ohne sie zu bezahlen. Oder als du mitten im Marktgetümmel gleich den Heimkehrer, Johann Merkle, entdeckt hast. Richtige Stielaugen hast du da gemacht!«
Mimi schaute peinlich berührt zur Seite. »Das kam nur davon, weil die Leute so einen Trubel um ihn veranstaltet haben. Fast hätte man meinen können, der Messias sei erschienen. Was hat es mit diesem Johann Merkle eigentlich auf sich?« So beiläufig sie tat, so sehr zitterte ihre Stimme plötzlich.
»Der Johann Merkle …« Der Onkel lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Viel weiß ich nicht von ihm. Ein Jahr nach meiner Ankunft hier ist er nach Amerika ausgewandert, seitdem hat man von ihm nichts mehr gehört oder gesehen. Kurz zuvor war sein Vater gestorben. Man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber allem Anschein nach war Robert Merkle ein ziemlich gewalttätiger Mann. Traudel hat mir mal erzählt, dass man ziemlich oft Edelgards Jammern gehört hat, da gab es wohl oft Schläge.«
»Wie bitte? Und keiner hat der Frau beigestanden?« So was hätte ihre Mutter mitbekommen sollen! Pfarrersgattin Amelie Reventlow hätte dem Mann den Marsch geblasen, aber wie, dachte Mimi erzürnt.
»Was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, ist Privatsache. Und in Ehestreitigkeiten mischt sich sowieso niemand gern ein. Traudel meinte, der Johann habe wohl von klein auf versucht, die Mutter zu schützen, indem er den Groll des Vaters auf sich zog und dann die Prügel kassierte.«
Mimi schaute ihren Onkel fassungslos an.
»Nun, als Johann erwachsen und dem Vater körperlich ebenbürtig war, wird er sich schon zu wehren gewusst haben.« Josef Stöckle zuckte mit den Schultern. »Kaum war der Vater tot, ging der Johann fort. Dabei hatte jeder geglaubt, er würde der Mutter weiterhin beistehen. Aber allem Anschein nach sah er seine Pflicht mit dem Tod des brutalen Vaters als erledigt an. Und irgendwie hatte Johann recht! Schon in ihrem Trauerjahr wurde Edelgard zu einer völlig anderen Frau. Fröhlich, dem Leben zugewandt, immer ums Wohl anderer bemüht … Natürlich beklagte sie öfter den Weggang von Johann, aber vor allem schien sie erleichtert, ihren Peiniger los zu sein.« Der Onkel schaute nachdenklich drein. »Ich frage mich, was es zu bedeuten hat, dass Edelgards Sohn ausgerechnet jetzt zurückgekommen ist …«
Das ist Schicksal, dachte Mimi verträumt.
»Ich wette mit dir, dass Johann beim Gehringer anfangen wird!«
Mimi hob erstaunt die Brauen – ihr Onkel hatte ein ziemlich gutes Gespür für das, was im Dorf vor sich ging, stellte sie nicht zum ersten Mal fest. »Nach dem unverschämt niedrigen Angebot, das Gehringer dir für deinen Laden gemacht hat, schätze ich, dass er auch nur äußerst mickrige Löhne zahlt. Ein kluger Mann wie dieser Johann wird doch wohl auch noch eine andere Stelle finden«, sagte sie, während sie Johanns Aussage vom Morgen verdrängte.
»Du und deine Abneigung gegen den Gehringer! Mimi, ich will dir nicht dreinreden, aber wenn du noch eine Zeitlang hier in Laichingen bleiben willst, dann bist du gut beraten, dir nicht ausgerechnet den Gehringer zum Feind zu machen. Du bist ihm gegenüber eh schon sehr forsch aufgetreten. Wenn Herrmann Gehringer jemanden nicht leiden kann, hat derjenige kein leichtes Leben, das sag ich dir.«
»Vor dem habe ich keine Angst«, wehrte Mimi schnippisch ab. »Wir sind schließlich nicht mehr im Mittelalter, wo der Fronherr mit seinen Untertanen machen kann, was er will. Ich bin ein freier Mensch!«
»Und davon abgesehen – Gehringer hatte es auch nicht leicht im Leben«, sagte Josef, als habe er ihren Einwurf nicht gehört. »Seine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben, woran, weiß eigentlich keiner so genau. Und sein einziger Sohn gilt nach einer Italienreise seit über zehn Jahren als verschollen. Die Leute sagen, der junge Mann sei immer ein wenig seltsam gewesen …«
Das ist ja kein Wunder bei dem Vater!, dachte Mimi.
»Jedenfalls – Gehringer wird Johann mit Handkuss nehmen. Es gibt nicht genügend Fachleute, da kommt es auf jeden Einzelnen an. Das Weben muss einem im Blut liegen, da kannst du nicht irgendjemanden von weiter her holen. Johann Merkle stammt aus einer alten Weberfamilie, ihm liegt das Weben im Blut!« Der Onkel hustete.
Unauffällig warf Mimi einen Blick auf das Taschentuch, das er sich vor den Mund hielt. Kein Blut, dachte sie erleichtert. »Und mir liegt das Fotografieren im Blut, weshalb ich auch gleich in den Laden muss. Gestern nach dem Markt habe ich meine ganzen Waren einfach nur noch abgestellt, dementsprechend sieht es drüben aus wie Kraut und Rüben. Wenn Leute durchs Schaufenster blicken, heißt es gleich wieder, ich sei zu schlampig zum Aufräumen«, sagte Mimi mit einem schrägen Grinsen. Spontan schlang sie ihre Arme um den Onkel. Wie mager er war, dachte sie erschrocken. Und gegessen hatte er auch wieder einmal nichts, das von ihr so liebevoll geschnittene Butterbrot lag unberührt auf seinem Teller. Kein Wunder, dass er jede Woche weniger wurde …
»Leg dich doch einfach ein bisschen hin und ruhe dich aus«, sagte sie sanft. »Und gegen Abend geh ich doch noch zu Helene und hole einen echten fetten Hering für dich, einverstanden?«
Der Onkel schaute sie mit seinen durchsichtigen Augen dankbar an.
3. Kapitel
Mimi wollte gerade die Tür zum Laden aufschließen, als sie sah, wie zwei junge Männer über den Marktplatz auf sie zukamen. Es waren Anton Schaufler, der Gastwirtsohn, und Fritz Braun, einer der Konfirmanden, die sie fotografiert hatte. Unter dem Arm trug Anton einen hölzernen Ständer. Alle paar Schritte warf er einen Blick über seine Schulter, als befürchtete er, von seiner Mutter, der Wirtin des Ochsen, auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes zurückgerufen zu werden.
»Hier ist Ihr Fotografienständer! Tut mir leid, dass er nicht rechtzeitig für den Pfingstmarkt fertig geworden ist, aber bestimmt kommt er Ihnen in der nächsten Zeit auch noch zupass.« Stolz stellte er den Ständer vor Mimi ab.
Mimi schaute den Gastwirtsohn ungläubig an. »Du hast dein Versprechen tatsächlich wahr gemacht?« Eigentlich hätte der Wagner – einen Schreiner gab es derzeit nicht im Ort – ihr einen solchen Ständer bauen sollen. Sogar eine Zeichnung hatte sie für ihn angefertigt! Doch der Mann hatte keine Zeit gehabt. Anton, der diesen Wortwechsel seinerzeit zufällig mitbekommen hatte, hatte ihr spontan versprochen, einen solchen Ständer für sie anzufertigen. Ehrlich gesagt hatte Mimi keinen Pfifferling darauf gegeben. Anton war zwar schon mehrmals ihr »Helfer in der Not« gewesen, gleichzeitig aber war der attraktive Junge auch jemand, bei dem man besser nicht alles für bare Münze nahm, hatte sie inzwischen gelernt.
Anton grinste. »Sagen wir mal so – es war eine Gemeinschaftsarbeit! Der Fritz hat den Ständer gebaut, ich habe das Material dafür organisiert. Wie finden Sie ihn? Sowohl Postkarten als auch Fotografien passen von der Höhe her genau auf die Leisten, das haben wir extra ausprobiert.«
Mimi ging in die Hocke, um den Holzständer genauer zu begutachten. Die linke Seitenwange des Regals war anders geformt als die rechte. Durch die ebenmäßigen Leisten, welche die beiden unterschiedlichen Teile verbanden, wirkte der Ständer dennoch gefällig. In der Mitte der obersten Leiste war ein geschnitztes hölzernes Element angebracht, das aussah wie eine große Blüte. Die einzelnen Blütenblätter waren so fein, dass man jede Ader sehen konnte.
»Was für eine kunstvolle Schnitzerei!«, sagte Mimi. »Und der Ständer wird mir eine große Hilfe sein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll … Den hast wirklich du gebaut?« Sie schaute Fritz Braun an.
Der Webersohn nickte stolz. »Das Holz hat der Anton besorgt, gebaut habe ich ihn. Schnitzen ist meine große Leidenschaft, das könnte ich von früh bis spät tun!«
Mimi lächelte. »Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, solch ein Talent ist ein Gottesgeschenk.«
Statt sich über ihr Lob zu freuen, verfinsterte sich Fritz’ Miene.
Was habe ich nun schon wieder Falsches gesagt?, fragte sich Mimi.
»Sollen wir den Ständer in den Laden tragen?«, wollte Anton eifrig wissen.
Mimi schaute gen Himmel. Keine Wolken, Regen war nicht zu befürchten, und wenn, dann würde sie den Ständer auch rasch selbst hereinholen können.
»Lass ihn ruhig hier stehen. Ein bisschen Werbung kann nicht schaden. Jeder, der über den Marktplatz in Richtung Kirche will, kommt zwangsläufig hier vorbei.« Noch während sie sprach, sprang sie die drei Stufen nach oben, schloss den Laden auf und holte ein paar der Laichinger Ansichtskarten, die sie auch am Tag zuvor auf dem Markt angeboten hatte. Die Laichinger Ansichten standen bald darauf akkurat auf den Leisten des Ständers.
Mimi strahlte die beiden jungen Handwerker an. »Dieser Ständer ist perfekt! Was bin ich euch schuldig?«
Anton und Fritz tauschten einen Blick. Fritz nickte dem Gastwirtsohn dabei unmerklich zu.
»Wir wollen kein Geld«, sagte Anton gedehnt.
Mimi runzelte die Stirn. »Aha.«
»Der Fritz hat ein Anliegen. Wir wollten fragen, ob Sie … Also … was ich meine … Sie haben ja inzwischen mitbekommen, wie die Dinge bei uns in Laichingen liegen. Der Fritz soll Weber beim Gehringer werden, nur weil sein Vater dort auch schafft. Aber der Fritz würde viel lieber Schreiner werden! Und da dachten wir … Wo Sie sich doch so für den Alexander eingesetzt haben und er allein wegen Ihnen zu dieser Aufnahmeprüfung der Stuttgarter Kunstschule darf … Könnten Sie sich nicht auch was für den Fritz überlegen?«
Mimi lachte leise auf. »Überlegen kann ich mir einiges! Aber ob ich damit auch etwas erreiche, steht auf einem anderen Blatt, das bekommt ihr bei eurem Freund Alexander ja haargenau mit. Wenn Klaus Schubert seinem Sohn weiterhin verbietet, nach Stuttgart zu fahren, waren meine Bemühungen umsonst. Davon abgesehen – ich kenne gar keinen Schreiner«, sagte sie. Trotzdem konnte sie nicht verhindern, dass es in ihrem Kopf ratterte. Der Laichinger Schreiner war im letzten Jahr verstorben, seitdem gingen die Leute mit ihren Holzarbeiten alle zu Herrn Meindl, dem Wagner, der sich seitdem vor Arbeit nicht mehr retten konnte.
Sie schaute in die beiden jungen Gesichter, die sie so hoffnungsvoll anschauten, als könne sie zaubern. »Misch dich nicht ein, Kind!«, hörte sie im Geiste die Stimme ihres Onkels. »Der Herr Gehringer braucht jeden Weber, den er kriegen kann.«
Einen Moment noch zögerte sie, dann sagte sie: »Vielleicht könnte Herr Meindl einen Lehrjungen gut gebrauchen? Warum sprichst du nicht mal mit ihm?«
»Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wenn das mein Vater erfahren würde, dann wäre die Hölle los«, sagte Fritz, und Röte stieg in seine Wangen. »Außerdem … das wird bestimmt eh nichts.«
»Und du, Anton? Du bist doch nicht gerade schüchtern – warum redest du nicht mit eurem Wagner?«
Anton winkte ab. »Was ich zu sagen hab, interessiert doch eh niemanden.«
»Warum diese Schwarzmalerei? Wenn ihr nicht mal versucht, euer Glück zu erlangen, dann werdet ihr nie herausfinden, ob es nicht doch möglich gewesen wäre.«
»Sie haben gut reden!«, sagte Anton. »Sie kennen sich aus in der Welt, Sie sind unabhängig, verdienen Ihr eigenes Geld … Da wagt man es vielleicht, nach den Sternen zu greifen. Unsereinem hingegen wird von klein auf klargemacht, dass es sich nicht schickt, jemals den von Gott angewiesenen Platz zu verlassen. Wir sind ärmer dran als Sklaven auf einer Galeere!«
»Na, so dramatisch ist es ja wohl nicht«, sagte Mimi belustigt, doch ihr Herz wurde angesichts der jugendlichen Verzweiflung unwillkürlich weich. »Also gut, ich rede mit dem Mann.«
Fritz’ Adamsapfel hüpfte aufgeregt auf und ab. »Das würden Sie für mich tun?«
Anton gab ihm einen Schubs in die Seite. »Hab ich’s dir nicht gesagt?«, sagte er triumphierend.
Mimi lachte. »Immer langsam mit den Pferden! Ich kann zwar mit Herrn Meindl sprechen, aber selbst wenn er die Idee gut findet, sind es immer noch deine Eltern, die Ja sagen müssen.« Streng schaute sie den Jugendlichen an.
Doch Fritz schien sie gar nicht zu hören. »Ich und eine Lehre beim Wagner … damit würden all meine Träume in Erfüllung gehen.« Im nächsten Moment verabschiedete er sich eilig – die Eltern warteten.
»Kann ich Ihnen noch bei irgendetwas helfen?«, sagte Anton.
»Hast du nichts zu tun?«, sagte Mimi erstaunt.
»Doch, ich muss gleich rüber in den Ochsen,« sagte der Gastwirtsohn. »Da wäre nur noch was …«
»Ja?«, Mimi verdrehte innerlich ein wenig die Augen.
»Es geht um Alexander! Falls er doch noch zu dieser Aufnahmeprüfung dürfte – wie würden Sie seine Chancen einschätzen?«
Mimi zuckte mit den Schultern. »Mein Gefühl sagt mir, dass er sehr gute Chancen auf ein Stipendium hätte.«
Nachdem ihre Mutter sich schon so wenig um ihren Bruder Josef kümmerte, konnte sie wenigstens etwas für Alexander tun, hatte Mimi vor ein paar Wochen in einem Anfall von Wut und Entrüstung gedacht. In einem Brief, dem sie ein paar Zeichnungen von Alexander beigelegt hatte, hatte sie ihre Mutter gefragt, ob sie – die Pfarrersgattin mit ihren vielen guten Beziehungen – sich nicht für den begabten Webersohn einsetzen könnte? Tatsächlich war Amelie Reventlow mit Alexanders Zeichnungen nach Stuttgart gefahren, um in der Stuttgarter Kunstschule vorzusprechen. In ihrem letzten Brief hatte die Mutter nun geschrieben, dass es in diesem Jahr anscheinend nicht sehr rosig aussähe mit heranwachsenden künstlerischen Talenten, dementsprechend größer waren Alexanders Chancen. Aber das behielt Mimi lieber für sich.
»Sind Sie sich da ganz sicher?«, hakte Anton stirnrunzelnd nach.
»Warum willst du das so genau wissen?«, fragte Mimi, während sie die verschiedenen Postkartenansichten sortierte. Der Schwanenteich. Die Laichinger Ansicht eins, die Laichinger Ansicht zwei …
»Nur so.«
»Du hast doch hoffentlich nicht irgendetwas Unrechtes vor, oder?« Sie schaute Anton scharf an.
»Was sollte ich denn vorhaben?«, fragte er gleichmütig zurück. »Alexanders Vater lässt seinen Sohn niemals auf eine Kunstschule – so viel steht fest!«
»Und wenn ich mal mit dem Mann reden würde?«
»Das können Sie sich sparen«, sagte Anton verächtlich. »Klaus Schubert ist ein Weber wie aus dem Bilderbuch. Der würde am liebsten noch auf seinem Webstuhl schlafen. Dass man sein Leben auch noch mit etwas anderem verbringen kann als nur mit Schuss und Faden, wird nie in seinen Kopf gehen. Die einzige Möglichkeit wäre …« Er brach abrupt ab.
»Ja?«
»Nichts. Ich geh dann mal besser!«
Mimi war gerade dabei, ihren neuen Ständer vor dem Ladengeschäft mit allen möglichen Fotografien und Bilderrahmen zu bestücken, als eine Frau stehen blieb. Allem Anschein nach war sie auf dem Weg zu ihren Äckern, denn sie trug Hacke und Forke über der Schulter.
»Das sind doch Evelines Kinder!«, rief sie und zeigte auf die Fotografien, die Mimi zuletzt aufgestellt hatte.
»Genau. Frau Schubert hat nicht nur ein Konfirmandenbild von Alexander, sondern auch noch Erinnerungsfotos von ihren Mädchen machen lassen. Für Buben habe ich übrigens auch sehr hübsche Requisiten! Matrosenanzüge, ein kleines hölzernes Segelboot, einen Kreisel. Und wer mag, darf auch auf dem Schaukelpferd sitzen.«
»Ich habe auch zwei Buben daheim – aber ob ich mir so was leisten könnte? Dafür müsste ich bestimmt lange sparen«, sagte die Frau.
Mimi nannte den Preis für eine Fotografie, und die Frau versprach, darüber nachzudenken. Mimi frohlockte. Durch den Holzständer kam sie immerhin mit den Leuten ins Gespräch!
»Stimmt es, dass Sie jetzt auch sonntags geöffnet haben?«, ertönte plötzlich Luises Stimme. Mimi zuckte zusammen. Wieder einmal hatte sie die Nachbarin auf ihren leisen Sohlen nicht kommen gehört.
»Ja, gleich am elften Juni fange ich damit an. Das war die Idee meines Onkels. Sonntags haben die Leute Zeit, sich fotografieren zu lassen, unter der Woche arbeiten alle so viel«, sagte Mimi lächelnd. Sie brauchte dringend neue Kundschaft. Dass es für einen sesshaften Fotografen so schwer war, ein Auskommen zu haben, hatte sie in all den Jahren ihrer Wanderschaft noch nie erlebt. Im Gegenteil – die Ateliers, in denen sie als Gastfotografin tätig gewesen war, waren alle sehr erfolgreich gewesen, und über einen Mangel an Kundschaft hatte sich keiner beschwert. Aber hier auf der kargen Schwäbischen Alb waren andere Dinge wichtiger als ein Besuch beim Fotografen.
»Der Georg und ich haben bald unseren vierzigsten Hochzeitstag. Da gehört es sich, ein Erinnerungsfoto zu machen. Und Sie sagten doch, Sie würden uns einmal umsonst fotografieren. Weil ich Ihnen das Kochen beigebracht habe … Und wenn meine Berta demnächst heiratet, möchte sie bestimmt auch ein Hochzeitsfoto gemacht bekommen. Gegen Bezahlung natürlich.«
Allem Anschein nach war der Holzständer ihr Glücksbringer, dachte Mimi froh. »Kommen Sie einfach vorbei und …« Sie brach ab, da Eveline Schubert just in diesem Moment über den Marktplatz hinweg auf sie zuhastete.
Entsetzt starrte die Weberfrau auf den Ständer. »Wie kommen Sie dazu, diese Fotografien öffentlich auszustellen? Was, wenn mein Mann die hier entdeckt hätte?« Eilig nahm sie die Fotografien ab. »Ich habe wegen Ihnen schon genug Ärger daheim.«
Luise, die daneben stand, machte riesengroße Ohren.
»Verzeihung«, sagte Mimi zähneknirschend. »Aber die Laichinger Frauen verdienen doch alle ihr eigenes Geld – können Sie da nicht selbst entscheiden, wofür sie es ausgeben?«, fügte sie herausfordernd hinzu.
Luise lachte. »Junge Frau, Sie haben noch viel zu lernen«, sagte sie, dann verabschiedete sie sich.
»Gefallen Ihnen die Fotografien denn wenigstens?«, fragte Mimi zerknirscht, als sie allein waren.
Andächtig strich Eveline über die Bilder. Marianne hielt eine Porzellanpuppe im Arm und lächelte selig. Erika saß auf dem Schaukelpferd und strahlte übers ganze Gesicht.
Mimi, erleichtert darüber, dass Evelines Ärger allem Anschein nach schon wieder verflogen war, sagte: »In vielen Ateliers werden Kinder immer noch wie kleine, gestrenge Erwachsene fotografiert. Kein Lächeln, keinerlei Mienenspiel ist auf diesen altmodischen Fotografien zu sehen. Dabei ist ein Kinderlächeln doch wirklich ein Gottesgeschenk!«
»Sie haben völlig recht«, sagte Eveline. Bevor Mimi wusste, wie ihr geschah, ergriff Eveline Mimis Hände und sagte mit bewegter Stimme: »Die Fotografien sind wunderschön. Danke! Sobald ich mal wieder Geld habe, kaufe ich passende Bilderrahmen dazu.« Geschäftig zückte sie dann ihre Geldbörse. »Was bin ich Ihnen für die Fotografien schuldig?«
Mimi nannte den Betrag. Der Anblick, wie Eveline mühevoll Pfennig für Pfennig abzählte, brach Mimi fast das Herz. Alexanders Mutter schien sich das Geld wirklich vom Munde abgespart zu haben, mehr noch – wahrscheinlich hatte sie einige Entbehrungen auf sich genommen, um diese Fotografien machen lassen zu können.
»Sie sind eine wunderbare Frau!« In einer spontanen Geste strich Mimi Eveline über den Arm.
Die Weberfrau schnaubte ironisch. »So wundervoll, dass mein Mann und ich uns nur noch streiten. Wenn er hören würde, dass sie ein Kinderlächeln als Gottesgeschenk bezeichnen, würde er sagen, dass bei Ihnen im Haus wohl auch der Teufel tanzt! Lachen ist nämlich verboten, müssen Sie wissen.« Ihre Stimme triefte vor bitterer Ironie. »Klaus wird immer freudloser und erwartet dasselbe von uns. Und dass Alexanders Talent ebenfalls eine Gottesgabe ist, will er auch nicht einsehen«, sagte sie bitter. »Die verdammte Laichinger Krankheit!«
Mimi lachte irritiert auf. Diesen Ausdruck hatte sie noch nie gehört. »Was soll das sein? Die Schwindsucht?«
Eveline schüttelte den Kopf. »Schwermut. Klaus ist schwermütig. Es fing vor ein paar Jahren an und wurde immer schlimmer. Ich erkenne den Mann nicht mehr, den ich einst geheiratet habe …« Die Weberfrau holte tief Luft. »Aber ich lasse mich nicht unterkriegen! Irgendwie geht es immer weiter. Und gleich heute Abend spreche ich nochmal mit ihm, ich will unbedingt, dass Alexander die Chance mit der Kunstschule bekommt.«
Mimi schwieg betroffen. Damit hatte sie nicht gerechnet. War die Schwermut womöglich auch der Grund, warum Alexanders Vater sich so querstellte, wenn es um Stuttgart ging? Mit schwermütigen Menschen hatte sie keinerlei Erfahrung, umso mehr bewunderte sie Eveline um ihre Art, mit der Krankheit ihres Mannes umzugehen.
»Weiß denn Ihr Arzt keinen Rat …« Sie brach ab, da Karolina Schaufler gerade den Marktplatz überquerte. Sie hatte Mimis Ladengeschäft noch nicht ganz erreicht, als ihr Blick auf den Holzständer fiel.
»Das ist doch … Das …« Die Wirtsfrau trat näher an den Ständer heran, inspizierte ihn genau, dann fuhr sie mit dem Zeigefinger über die ungleichen Seitenwangen. Die Falte auf ihrer Stirn wurde tiefer, ihre Miene immer grimmiger.
»Ja?«, sagte Mimi gedehnt. »Den Ständer hat Fritz Braun gebaut, Ihr Sohn hat ihm das Material dafür besorgt. Ich bin den Jungen sehr dankbar dafür.«
Antons Mutter zeigte anklagend auf den Ständer und sagte: »Das war mal meine alte Sitzbank! Ich hatte sie in der Scheune gelagert und wollte sie herrichten lassen, sobald der Wagner Zeit hat. Und nun hat der Kerl sie zersägt!«
Dieser kleine Gauner! Einen Moment lang wusste Mimi nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. »Das wusste ich nicht … Ich nahm natürlich an, das Holz sei übrig gewesen. Wie kann ich das nur wiedergutmachen?«
Neben ihr stieß Eveline einen unterdrückten Laut aus. Mimi wagte es nicht, zu der Weberfrau hinüberzuschauen, aus Angst laut loszuprusten.
»Der Anton bekommt eine Tracht Prügel, die sich gewaschen hat und wenn er zehn Mal einen Kopf größer ist als ich!« Grimmig schaute Karolina Schaufler über den Marktplatz in Richtung Ochsen, als könne sie es kaum erwarten, ihren Sohn in die Hände zu bekommen.
»Ich hätte eine andere Idee«, sagte Mimi eilig. »Wie wäre es mit einer schönen Fotografie von Ihrem Gasthof? Wenn der Tag klar ist und ich mich links von Ihrem Haus platziere, bekomme ich vielleicht sogar eine Spiegelung in der Hüle hin. Sie und Ihr Mann könnten sich davor aufstellen. Einen Rahmen spendiere ich auch. Als Gegenleistung für das Holz. Aber nur, wenn Sie die Tracht Prügel bitte vergessen, Ihr Sohn hat es wirklich nur gut gemeint.«
Kaum war die besänftigte Wirtin gegangen, stieß Mimi die angehaltene Luft raus. »Da bin ich ja gerade nochmal mit einem blauen Auge davongekommen«, sagte sie lachend.
Eveline lächelte ebenfalls. »Der Anton ist ein Lausbub, wie er im Buche steht. Da lobe ich mir meinen Alexander, er ist so ein braver Kerl.«
»Dass ausgerechnet die beiden so gute Freunde sind …« Mimi schüttelte lachend den Kopf.
»Und das seit frühester Kindheit«, sagte Eveline. »Der Alexander würde für Anton durchs Feuer gehen. Und umgekehrt.«
Mimi lächelte, doch ganz wohl war ihr nicht. Wie beharrlich Anton nach Alexanders Chancen bei der Aufnahmeprüfung der Kunstschule gefragt hatte … Der Gastwirtsohn würde doch nicht wieder irgendeinen Unsinn im Kopfhaben, um seinem Freund zu helfen?
4. Kapitel
Wie vom Schlag getroffen blieb Herrmann Gehringer am Webstuhl von Benno Klein stehen. »Du putzt den Webstuhl mit der bloßen Hand?« Er zeigte auf die Wollflusen, die bei jedem Kett- oder Artikelwechsel entfernt werden mussten. »Da hängt noch eine Unmenge Staub drin, dafür brauchst du einen Handfeger!«
Der Weber kratzte sich verlegen am Kopf. »Mein Handfeger ist leider spurlos verschwunden.«
Gehringer glaubte nicht richtig zu hören. Waren heute alle von den guten Geistern verlassen? Wohin er bei seinem morgendlichen Rundgang auch kam – überall war der Schlendrian schon vor ihm dagewesen!
»Arbeitsmaterial hast du also auch noch verschlampt? Ich hoffe sehr für dich, dass du den Handfeger wiederfindest, sonst zieh ich dir den von deinem Lohn ab!«, schrie er über den Lärm der Webstühle hinweg, dann ging er kopfschüttelnd weiter.
Der nächste Webstuhl war der von Klaus Schubert. Von ihm war bestimmt auch nichts Gutes zu erwarten, dachte Herrmann Gehringer verdrießlich, während er in die Liste schaute, die sein Assistent Paul Merkle ihm zu Beginn des Kontrollgangs überreicht hatte. Darin wurden die täglichen Schusszahlen jedes Webers und jedes Webstuhls festgehalten. Bei fast allen Webern lagen die gestrigen Schusszahlen unter den von ihm als Durchschnitt festgelegten 60 000 Schuss am Tag. Doch bei keinem war das Ergebnis so schlecht wie bei Klaus Schubert.
»Nur 53 000 Schuss? Hast du dir einen halben Tag Urlaub genommen, oder was?«, fuhr Herrmann Gehringer den Weber an. »Sechstausend Schuss pro Stunde müssen bei unseren guten Webstühlen doch wirklich drin sein!«
Klaus Schubert trat schutzsuchend einen Schritt hinter seinen riesigen Webstuhl. »Mein Magen – mir war nicht wohl, ich musste mehrmals auf den Abort.« Seine Augen flackerten unruhig.
Herrmann Gehringer seufzte. Der Schubert war einer, dem alles auf den Magen schlug. Er bezweifelte, dass er den Mann heute noch einmal einstellen würde. »Entweder du reißt dich zusammen, oder du kannst dir bald eine neue Arbeit suchen! Jemand mit schwachen Nerven ist hier fehl am Platz.«
Ohne ein weiteres Wort ging Gehringer davon. »Kannst du mir mal sagen, was hier los ist?«, fuhr er seinen Assistenten an. »Kettenbrüche, Schützenlöcher, niedrige Schusszahlen – beim Weben muss man sein Tagwerk mit höchster Konzentration verrichten! Allem Anschein nach haben die Leute alles Mögliche im Sinn, nur nicht die Arbeit.«
»Wenn Sie das sagen«, erwiderte Paul Merkle säuerlich und in einem Ton, als ginge ihn das alles nichts an.
Herrmann Gehringer warf ihm einen unauffälligen Blick zu. Konnte es sein, dass seine rechte Hand schmollte?, dachte er. Dabei hatte er Paul offiziell doch noch gar nicht gesagt, dass sein Bruder bei ihnen anfangen würde.
Im Büro angekommen nahm der Webereibesitzer hinter seinem wuchtigen Schreibtisch Platz. Wie jeden Tag hatte Merkle die Eingangspost schon fein säuberlich in Aufträge, Rechnungen und anderen Schriftverkehr getrennt gestapelt. Gleich drei neue Aufträge, sehr gut! Gehringers Freude hielt jedoch nicht lange an, als er sah, welche Notiz sein langjähriger – und guter – Berliner Kunde Alfred Stoll seinem Auftrag angefügt hatte. Achtung! Wichtig!, hatte er mit roter Tinte geschrieben. Die Order über je hundert Unterröcke, Nachthemden und Unterkleider wird nur dann gültig, wenn Sie zu einem Preisnachlass von zehn Prozent bereit sind. Ansonsten muss sich das Modehaus Stoll nach einem Weißzeug-Lieferanten umsehen, der Baumwolle verarbeitet. Ich erwarte Ihre umgehende Rückantwort, ob Sie dazu bereit sind. Ansonsten …
Ansonsten? War es schon so weit, dass seine Kunden ihm drohten? Gehringer ließ den Brief sinken. Auf einmal kam ihm die Luft im Raum stickig und abgestanden vor. Abrupt stand er vom Schreibtisch auf, ging zum Fenster und öffnete es. Tief ein- und ausatmend ließ er den Blick über sein weitläufiges Firmengelände schweifen. Normalerweise erfreute ihn die Aussicht über die geziegelten Gebäude. Und das gleichmäßige Klopfen der Webstühle war wie Musik in seinen Ohren. Doch heute waren seine Gedanken düster, und sein Kopf dröhnte noch immer vom Lärm in der Weberei. Und dazu die frechen Forderungen seiner Kunden! Der eine beschwerte sich über altmodische Modelle, der nächste verlangte horrende Preisnachlässe, der übernächste wollte die Ware am liebsten schon vorgestern haben – wie lange würde es ihm noch gelingen, unter diesen Umständen sein Lebenswerk zu erhalten?
Die verdammte Baumwolle, dachte er nicht zum ersten Mal. Nie hätte er angenommen, dass sich das Garn aus den britischen Kolonien einmal derart auf dem europäischen Markt durchsetzen würde. Jahrhundertelang waren Tischdecken und Bettwäsche aus Laichinger Leinen mindestens solch ein Qualitätsbegriff gewesen wie Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald oder Messer aus Solingen. Die Leute waren bereit, einen entsprechenden Preis zu zahlen. Und dass das Weben feiner Leinenstoffe eben dauerte, war auch selbstverständlich gewesen. Doch seit einigen Jahren lief ihnen das Baumwollgewebe immer mehr den Rang ab. Es war günstiger, weicher als Leinen und allem Anschein nach auch einfacher herzustellen.
Noch waren seine Auftragsbücher voll, übervoll sogar. Doch das Gros der Bestellungen bestand aus einfachen Modellen, bei denen die Gewinnmarge noch nie hoch gewesen war. Würde er jetzt noch weitere Preisnachlässe gewähren müssen, ginge sein Gewinn bald gegen null.
Gehringer kniff die Augen zusammen, während er hinüber zur Fabrik schaute. Täuschte er sich oder stand da einer und rauchte eine Zigarette, was auf dem gesamten Gelände strengstens verboten war? Unglaublich! Als wäre der Druck, den die Kundschaft auf ihn ausübte, noch nicht genug, waren seine Weber faul und nachlässig geworden! Am liebsten wäre er hinübergerannt und hätte den Burschen zur Rechenschaft gezogen. Aber dafür war keine Zeit. Er schloss das Fenster wieder und ging zurück an seinen Arbeitsplatz. »Paul!«
Als habe er nur auf das Kommando seines Chefs gewartet, stand sein Assistent in der Tür. Gehringer winkte ihn zu sich her. »Nimm Block und Stift! Es gibt viel Arbeit. Wenn wir nächstes Jahr unser Jubiläum noch erleben wollen, müssen wir jetzt aktiv werden. Der Konkurrenzdruck durch die Baumwollproduzenten wird immer heftiger, sie machen uns mit ihrer Billigware systematisch die Preise kaputt. Inzwischen scheint es bei unseren Kunden zur Mode zu werden, nach immer neuen Preisnachlässen zu fragen. Bei meinen Kollegen hier im Ort sieht es auch nicht anders aus, zumindest ist das der Tenor am Unternehmerstammtisch. Manch einer mag nun resignieren, aber ich nehme den Kampf auf!« Herausfordernd schaute er seinen Assistenten an.
»Welchen Kampf genau?«, fragte Paul Merkle mit hochgezogenen Brauen, und sein Ton klang schon wieder äußerst hochnäsig.
Gehringer schaute seinen Assistenten an. Wollte der Mann ihn veräppeln? »Ich lasse mir von niemandem in die Suppe spucken, weder von unserer verehrten Kundschaft noch von meinen Leuten! Es brechen neue Zeiten an, und die Maßnahmen, die ich fortan ergreifen werde, werden nicht jedem schmecken … Also schreib: Punkt eins – die Arbeitszeit wird ab nächsten Monat um zwei Stunden täglich heraufgesetzt, ohne Lohnausgleich. Allein dadurch kann ich schon gewisse Preisnachlässe, zu denen ich genötigt werde, hereinholen.«
»Soll ich eine Mitarbeiterversammlung einberufen?«
»Das reicht noch nächste Woche. Je kurzfristiger wir das bekanntgeben, desto besser. Es tut nicht not, dass die Leute zu viel Zeit haben, im Vorfeld schon über die Mehrarbeit nachzudenken«, winkte Gehringer ab. »Punkt zwei – bei der Auswahl der Lehrlinge werde ich zukünftig die Spreu vom Weizen trennen. Nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Verfassung ist wichtig. Wenn ich den Trauerkloß Schubert sehe, vergeht mir jeden Tag die gute Laune!«
»Bei der Frau wäre wohl jeder schwermütig«, sagte Merkle spöttisch. »Solche Moden wie Eveline Schubert legt keine andere Frau an den Tag, da gäbe es einiges zu erzählen. Meine Sonja ist ja immer bestens informiert über alles, was im Dorf vor sich geht.«