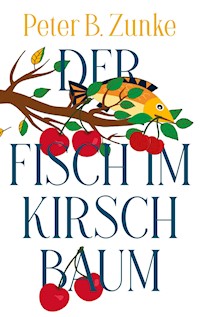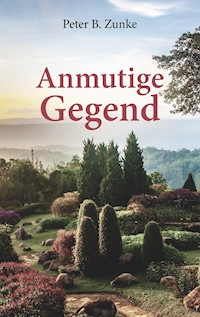Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichten in diesem Buch zeigen Menschen in den unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklungen, den verschiedenen Verwicklungen, denen sie durch Zeit, Mitmenschen und Gefühle ausgesetzt sind und die Versuche und Bemühungen, ihrer Probleme und Konflikte zu lösen. Die Lösungen glücken oder scheitern, wie es im Leben nun einmal geschieht, und so zeigen diese Erzählungen eigentlich nur das Leben in manchen seiner Facetten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
DIE FREUNDIN MEINES GROSSVATERS
DER SCHATZ
DER SOMMER MIT AISHE
DIE FRAU AUF DEM DACH
DIE FREUNDIN MEINES GROSSVATERS
1
Das erste Mal hörte ich ihren Namen beim Mittagessen. Wir saßen wie immer im Esszimmer mit den grünen Seidentapeten auf den hohen dunklen Eichenstühlen mit den Lederpolstern, nur Opas Stuhl hatte bequeme Armlehnen. Mein Großvater saß mit dem Rücken zu der reich geschnitzten Anrichte mit den Gläsern und Kelchen im Aufsatz, zu seiner linken saß meine Mutter, sie hatte an dem Tag ein helles Kleid an. Gegenüber von Opa war Vaters Platz, er hatte immer das große Fenster im Rücken, das war ihm nur lieb, weil er zu helles Licht wegen seiner Kopfschmerzen nicht gut vertragen konnte. Und gegenüber von Mama an Opas rechter Seite saß ich.
Es muss im Frühling gewesen sein, denn auf dem kleinen Tisch unter dem Bleiglasfenster mit dem Bild einer dunkelhaarigen Frau – als ich kleiner war, hat dieser Frauenkopf mir Angst gemacht, ich dachte immer, die kann alles hören, was in meinem Kopf an Gedanken herumtollt - stand eine chinesische Vase voll gelber und weißer Osterglocken, die in der Mittagssonne richtig strahlten.
Und dann erzählte Opa etwas und da fiel erstmals der Name dieser Frau, Hannah Burgdorf. Aber er ging durch meine Ohren, ohne sich im Hirn festzusetzen. Denn ich dachte mittags eher an die Spiele am Nachmittag, die ich fest mit Karlchen verabredet hatte, oder an das Wettpinkeln mit Kättgen und Rudi quer über den Schulgraben, auf jeden Fall hörte ich selten zu, wenn die Erwachsenen etwas beredeten. Meist ging es ja auch um Schwierigkeiten mit dem Personal oder Beschwerden von Patienten oder Ärger mit den Lieferanten, kurz, für mich als Zehnjährigen war das alles nur Erwachsenenkram, uninteressant und nicht beachtenswert. Es sei denn, es ging um Ferienziele oder um den Ausflug oder ein Fest. Denn wir machten zur damaligen Zeit...Aber am besten beginne ich wohl ganz von vorn.
Also, bei diesem Mittagessen erklärte mein Großvater, dass er unser Hausmädchen Ursel damit beauftragt habe, den gelben Salon fertig zu machen, denn er erwarte zum Wochenende diese Frau Burgdorf; er habe sie auf der letzten Kur in Bad Nenndorf kennen gelernt und dann eingeladen und jetzt sei es soweit, sie habe ihm geschrieben, dass sie seine Einladung annehme und gern komme.
Mein Vater schaute etwas unglücklich drein und aß langsam weiter, für mich machte er also nur das, was er ohnehin immer mittags tat, er aß zur Nahrungsaufnahme, aber ohne sichtlichen Appetit, das Essen war für ihn eine reine Zweckmäßigkeit, um den Körper zu erhalten. Meine Mutter hingegen, die gern aß – und auch gern selber kochte, wenn auch selten, die oft etwas Neues ausprobierte - schaute wie ungläubig den Opa, ihren Vater, an und fragte, ob er sich das auch gut überlegt habe. Opa schnitt seine Frikadelle klein und sagte, ohne Mutter anzuschauen, dass er schon wisse, was er tue. Und außerdem sei ihm diese nette Frau so sympathisch und sie habe es im Leben so schwer gehabt, er wolle ihr einfach etwas gutes tun. Und wenn sie dann hier sei, wolle er ihr nach ein paar Tagen Eingewöhnung das Kloster zeigen und vielleicht auch zum Steinhuder Meer fahren und er hoffe, dass die ganz Familie ihn in dem Bemühen tatkräftig unterstützen werde, dieser Frau ein paar wundervolle Tage zu bereiten.
Vater trank von seinem Mineralwasser und Mutter presste ihre Serviette an den Mund und meinte mit großen Augen, dass es vielleicht einige Schwierigkeiten geben könne, denn in der nächsten Woche seien die Abrechnungen für das Quartal vorzubereiten und außerdem müsse sie die neuen Mädchen aussuchen, die sich vorstellen wollten, um dann in der Heilstätte zu arbeiten. Und dann wäre ja auch noch...
Mit einer eindeutigen Handbewegung schnitt Opa ihr das Wort ab und sagte nur, dass er jetzt wohl seine Wünsche klar gemacht habe und es darüber keine Diskussionen geben würde. Er knüllte seine Serviette zusammen, stand auf und ging ins Herrenzimmer zu seinem hohen Ledersessel, auf seinen Mittagsschlaf mochte er nie verzichten.
Mutter schaute Vater an, dann Opas leeren Stuhl, sie atmete ein paar Mal tief durch und meinte nach einem kurzen Blick auf mich zu meinem Vater, dass sie sich mit der ungewohnten Situation schon arrangieren würden, es sei eben ein hartnäckiger Kurschatten, und vielleicht würde es dem Opa sogar gut tun, wenn er sich nach Omas Tod wieder um eine Frau kümmern könne. Vater nickte nur und sagte, dass er alles erst in Ruhe überdenken müsse, aber im Grunde sei die ganze Angelegenheit doch nicht von Wichtigkeit.
Ursel brachte dann den Nachtisch, Vanillepudding mit Obstsauce. Ich löffelte schnell meine Schüssel aus, schaute die Eltern bittend an und leerte dann auch Opas Glasschüssel.
Die Schulaufgaben waren rasch gemacht, so viel war es ja auch nicht, -ich war ein guter Schüler, jedenfalls in der Volksschule noch, das sollte sich erst später auf dem Gymnasium ändern, die Erwachsenen nannten das dann »Auswirkungen der Pubertät« oder so –und ich zog mich um für den Wald. Mit Karlchen Drebber wollten wir zur Lärchenlichtung fahren, dort trafen sich oft an sonnigen Nachmittagen Liebespaare, die sich in den lauschigen Plätzen, versteckt in den jungen Schonungen auf dem sprießenden Gras küssten und wälzten und anderes mehr taten, was wir nur zu gern beobachtet hätten, besonders dieses andere mehr, von dem Kättgen uns erzählt hatte.
Wir wollten uns in dem Lärchenring verstecken, das war unser geheimes Waldquartier, da waren aus Zufall oder vom Förster so gewollt acht Lärchenbäume ringförmig um einen freien weichen Platz gewachsen. Wir hatten es im vorigen Jahr entdeckt und ihn den »Ring des Todes« getauft. Immer wieder hatten wir alte Äste und Buschwerk zwischen die einzelnen Stämme gesteckt und tief eingegraben, so dass es von außen keinen Einblick mehr gab. Wir lagen dann gern auf weichem Moos und trockenen Nadeln und alten Armeedecken, die wir beim Umherstreifen in den Wäldern gefunden und mitgenommen hatten und schauten hinaus auf die lichte Schonung. Gelegentlich sahen wir einsame Patienten der Lungenheilstätten spazieren gehen, mitunter auch ein Liebespaar, aber leider hatten wir bisher noch nicht das Glück gehabt, das zu sehen, was uns Kättgen wie selbstverständlich als »Liebe machen« oder »Ficken«, je nach seiner Tagesform, benannt hatte und er erzählte einfach Unerhörtes darüber, das wir ihm kaum glauben konnten.
Ich hatte das Wort ficken einmal in Gegenwart meines Vaters gebraucht und von ihm eine heftige Ohrfeige erhalten und eine ernste Ermahnung, ich möge solche Worte nicht in den Mund nehmen, das sei unter unserer Würde, und außerdem sollte ich nicht immer all den Unsinn nachäffen, den manche Erwachsene von sich gäben. Ich hielt mir die Wange und schlich in mein Zimmer. Mit diesem »Ficken« war etwas besonderes los, das war mir klar. In den nächsten Tagen fragte ich meinen Opa, was das denn sei, und der begann laut aufzulachen, freute sich sichtlich, klopfte mir auf die Schulter und meinte nur, das würde ich noch früh genug herausbekommen, ich solle meine eigenen Erfahrungen sammeln, er wolle und könne mir jetzt dazu keinen heißen Tipp geben, aber wenn ich erst einmal Bescheid wisse, dann wäre er gern bereit, all meine Fragen zu beantworten, jetzt sei das aber noch viel zu früh.
So fuhr ich denn mit meinem Fahrrad zu Karlchen Drebber, dem Sohn des Tischlers. Er hatte ganz helle blonde Haare ohne Scheitel und blitzende blaue Augen; er war zwar in meiner Klasse, aber deutlich kleiner als wir anderen alle, aber äußerst gelenkig, wir mochten ihn alle sehr, denn er konnte uns aus der Werkstatt seines Vaters den Rohstoff für unsere Holzschwerter besorgen, mit denen wir dann Attilas Hunnen und Kampf um Rom oder Karl der Große und die Heiden oder Sigurd nachspielen konnten. Diese Geschichten, vor allem die klassischen alten Heldensagen der Germanen, hörten wir in der Schule, wenn der Lehrer, der davon sehr begeistert schien, den höheren Klassen aus dem dicken Sagenbuch etwas vorlas.
Mit unseren Rädern fuhren Karlchen –so nannte ihn seine Mutter immer und wir hatten keinen Grund, daran etwas zu ändern – und ich vorbei am Tränenteich zu den Feldern von Aderholt und bogen in den scharfen Knick zu der Schonung. Wir traten mächtig in die Pedale, so etwas wie eine Gangschaltung hatten wir nicht, auch Lampen fehlten an unseren etwas kleineren Kinderrädern. Immerhin waren sie wendig und robust, sie mussten ja auch so manchen Stoß und häufiges Hinschmeißen aushalten.
Der Sandweg wurde schmaler und kurviger, das Unterholz dichter, die Reifen summten lautlos, Karlchen fuhr voraus und schrie plötzlich laut auf; ich bog um die Kurve und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr hinein in ein Liebespaar, das es sich auf dem warmen Sandweg gemütlich gemacht hatte. Karlchen war in hohem Bogen samt Fahrrad über sie hinweg in ein Erlengestrüpp geflogen, ich purzelbaumte ohne Rad in eine Brennesselansiedlung, der Mann, ein roter Kopf, ein Karohemd ohne Schlips, bis zum Gürtel geöffnet, er zerrte an seinem Hosenreißverschluss und fluchte und drohte uns mit der Faust, die Frau, eine üppige Blondine, knöpfte ihre bunte Bluse zu und warf nur hin und wieder scharfe und vielleicht belustigte Blicke zu uns herüber.
Der Mann stand etwas mühsam auf, klopfte sich Erde und Blätter von Hemd und Hose und schimpfte laut, drohte auch mal mit den Fäusten und trat ein paar Mal gegen mein Fahrrad; die Frau konnte sich nur mühsam ein lautes Loslachen verkneifen. Ich humpelte zu Karlchen Drebber hinüber, der sich den Kopf rieb und etwas benommen in den Himmel starrte. Aber er war weiter nicht verletzt, ich konnte kein Blut sehen. Dafür hatte ich einen tiefen Kratzer am rechten Knie, der blutete schon nicht mehr, die Wunde begann sich zu verschorfen, und es tat überhaupt nicht weh. Jedenfalls spürte ich keinen Schmerz. Da noch nicht, am Abend zu Hause konnte ich nicht einmal die Bettdecke auf dem Knie ertragen, es wurde auch etwas dick und die Wunde brannte wie Feuer, obwohl Ursel mir ein Pflaster vorsichtig darauf geklebt hatte. Aber jetzt und hier auf dem Rain von Aderholts Feld schauten Karlchen und ich den beiden Erwachsenen zu, wie sie langsam den Weg zurück zum Dorf gingen, die Blondine schaute sich noch einmal um und winkte uns verstohlen zu, der Mann gestikulierte mit beiden Armen und schimpfte weiter laut vor sich hin. Karlchen und ich nahmen unsere Räder, zum Glück waren sie beide noch intakt, wir fuhren langsam weiter zum Lärchenring, wo wir uns in die Sonne legten und in Ruhe über unser Abenteuer nachdachten und redeten.
Karlchen seufzte: »Wenn wir nur ein bisschen später um die Kurve gekommen wären, dann hätte diese Frau sicher schon die Bluse ganz aufgeknöpft und vielleicht auch den Busenhalter abgenommen und dann hätten wir ihre Brust gesehen, was meinst du?«
»Aber sicher. Ich hab vor lauter Aufregung gar nicht richtig hingeschaut, vom Busen hab ich nicht viel gesehen. Ich hatte nur die Fäuste des Mannes vor Augen.«
»Aaaach, als ich da über die beiden geflogen bin, da war ich ihren beiden Brüsten so nahe... Der war ganz rosa, dieser Busenhalter, weißt du, so mit Spitze verziert, wie das Taschentuch meiner Oma.«
»Und der Mann, der hatte so viele Haare auf der Brust, der sah fast aus wie ein Affe.«
»Das war sicher einer von den Neandertalern. Lehrer Lange hat uns doch letzte Woche von denen erzählt.«
»Ein Neandertaler! Der hat sich in unsere Welt gerettet. Der ist aus der Steinzeit übriggeblieben. Durch eine Granate ist er wieder ausgebuddelt worden und dann hierher geschleudert und nun will er es sich gut gehen lassen, er sucht sich die schönsten Frauen, er hat ja auch mindestens tausend Jahre geschlafen oder so, jetzt will er das alles nachholen.«
Und so spannen wir die Geschichte vom Neandertaler und seinen Wünschen nach vielen blonden Frauen weiter und allmählich ließ die Anspannung nach und es blieben von diesem Ausflug nur die Phantasien vom rosa Büstenhalter und die tiefe Schramme an meinem Knie.
2
Im Laufe der Woche wurden meine Eltern zunehmend unruhiger. Ich dachte mir, dass es wohl wie häufig am Betrieb läge, denn es gab dort immer wieder Probleme, mal hatte eine Putzfrau etwas gestohlen, mal war eine Krankenschwester mit einem Patienten in inniger Umarmung erwischt worden, einmal war auch ein Patient richtig verrückt geworden und mit einem Küchenmesser bewaffnet durch die Heilstätte gelaufen, er schrie ganz laut und schrill und wollte allen die Hälse durchschneiden. Mein Vater musste die Polizei holen, und die beiden Dorfpolizisten haben es dann zusammen mit einigen kräftigen Pflegern geschafft, den rasenden verwirrten Mann zu überwältigen und gefesselt in einer grünen Minna abzutransportieren.
Jetzt aber war es wohl diese Hannah, die meinen Eltern Sorgen machten. Mein Großvater ging am Donnerstag extra zum Frisör Bartels und am Freitagnachmittag kam sie dann endlich an, die neue Freundin meines Opas. Hannah Burgdorf. Ich sah sie erstmals bei uns im Garten bei den Johannisbeerbüschen stehen, zusammen mit Opa und meiner Mutter.
Sie war etwa so alt wie Mama, aber viel schlanker, sehr groß und hielt sich sehr gerade. sie hatte braune Haare, die in leichten Wellen auf ihre Schultern fielen; sie trug einen Tweedrock und eine leichte Bluse mit Rosen und anderen Blumen, ich mochte ihre Stimme, sie klang so tief, sie erinnerte mich an diese Schwedin, Vater hörte so gern ihre Platten, ja, Zarah Leander. So ähnlich klang Hannah Burgdorf auch. Opa strahlte richtig, wenn er sie ansah, und Mama, nun ja, sie war höflich wie zu allen Leuten.
Weil es ein schöner warmer Maientag war, hatte Ursel für uns im Garten gedeckt unter dem Kirschbaum. Ich weiß noch, es gab Aprikosentorte mit Sahne und frischen Butterkuchen. Ich genoss den Kuchen und hörte dem Gespräch zu; diese Frau Burgdorf erzählte von ihren beiden Töchtern, die seien auf dem Gymnasium und sehr ehrgeizig, weil sie einmal nach dem Abitur studieren wollten. Oder sollten, so klang es mir jedenfalls. Ich mochte ehrgeizige Mädchen nicht besonders, aber ich kannte auch keine. In unserer Dorfschule gab es natürlich auch kluge Mädchen, Dorlein oder Carola, aber die waren genau wie wir auch zu Streichen bereit und machten unsere Spiele mit, sie gehörten eben dazu. Dieses Wort »Streber« hab ich erst viel später in der Stadt gelernt und gehört.
Und dann erzählte mein Opa von fremden Ländern, die er als Matrose bereist hatte und Hannah Burgdorf berichtete von ihren Reisen nach Russland und Frankreich. Mama goss Kaffee nach, nickte hier und da und schien ganz interessiert. Ich hörte auch ganz gespannt zu, denn ich mochte es sehr, wenn Opa von fremden Küsten erzählte. Ich stellte mir dann vor, dass ich auch eines Tages wie ein großer Forscher in fremde Gestade eintauchen und neue Ländereien erforschen würde. Und diese Frau Burgdorf hatte offensichtlich ähnliches gemacht, war ganz allein mit dem Auto durch die Wüste Gobi gefahren und hatte dort mit wilden Stämmen Tee getrunken und wer weiß was erlebt. Ich konnte jetzt gut verstehen, warum mein Großvater sie zu seiner neuen Freundin gemacht hatte. Und mir schien es, als ob meine Mutter auch langsam warm mit der Burgdorf wurde. Der Nachmittag im Garten war für mich ganz gemütlich, und dann gab es auch schon Abendbrot, da war mein Vater auch wieder aus dem Büro zurück und dann musste ich ins Bett.
Am nächsten Tag fuhren Mama, Opa und Frau Burgdorf nach Steinhude, Opa wollte ihr unbedingt den heiligen Stein auf der Insel dort zeigen und mittags wollten sie dort Aal essen. Vater hatte in der Heilstätte zu tun und ich war mit Dorlein zum Spielen verabredet.
Mama fuhr den dunklen Mercedes, Opa hatte seinen Führerschein schon vor Jahren abgegeben, es waren wohl seine Augen gewesen, die nicht mehr so gut funktionierten, er brauchte jetzt auch zum Lesen eine starke Brille. Im Auto saß er auch lieber hinten und schaute sich die Gegend an. Wenn wir alle zusammen unterwegs waren, saß ich meist neben ihm und er erzählte dann einige seiner merkwürdigen Geschichten. Ich wusste nicht immer, wann sie wahr waren oder ob er wieder sein Seemannsgarn spann, er kannte viele Anekdoten und Sagen aus unserer Gegend und las auch gern und viel, und so manches aus den Büchern bekam ich dann als selbst erlebtes Abenteuer mit vielen Details ausgeschmückt geschildert.
Am Abend saßen meine Eltern mit Opa und der Frau Burgdorf noch recht lange im großen Zimmer und sie tranken Wein; ich sah die leeren Flaschen am nächsten Tag im Kücheneimer. Am Mittag musste Frau Burgdorf schon wieder abfahren, ihr Zug ging um zwei; Opa brachte sie mit Mutter im Auto zum Bahnhof. Als sie zurückkamen, sah Opa ganz zufrieden aus, und auch Mutter gab Vater einen Kuss und meinte, dass dieser Besuch an sich doch sehr erfreulich gewesen sei.
Der Heizer Albrecht hat die wohl treffendste Bemerkung über meinen Großvater abgegeben. Er sagte an einem schönen Maiennachmittag, als wir unter den Linden am Tränenteich saßen und Albrecht seinen gläsernen Bierseidel fast geleert hatte, dass mein Großvater wohl ein bemerkenswerter Herr sei. Und Albrecht musste es eigentlich wissen, denn die beiden kannten sich schon lange vor dem Krieg, dem letzten Weltkrieg, ich meine den von 1939 bis 45.
Ja, ein bemerkenswerter Herr, das war er in der Tat. Ich erinnere mich noch genau, wie er aus dem Kurpark aus dem Schatten der Kastanien in das Sonnenlicht trat, hellgrauer Anzug mit Weste natürlich, an der die goldene Uhrkette mit dem chinesischen Geldstück schimmerte, der schwarze Stock mit dem Silbergriff, den Rücken hoch aufgereckt und den doch ziemlichen Bauch stolz vorgeschoben. Immer trug er ein weißes Hemd und einen dunkelblauen Binder; das Gesicht etwas gerötet, ein Oberlippenbart und ein dreieckiger Kinnbart, ziemlich kurz. Bart und auch die Haare waren schon silbergrau. Seine hellblauen Augen blitzten frisch und neugierig umher, wenn sie sich dann auf mich richteten und er mit seiner oft dröhnenden Stimme fragte:
»Na, was hast du denn da in deiner Tasche?«
Dann fühlte ich mich ertappt, und oft musste ich die Dinge, die ich »gefunden« oder ergriffen hatte, den gestrengen Blicken präsentieren. Fanden diese Objekte dann Gnade vor den großväterlichen Augen, dann durfte ich sie wieder einstecken und damit weiterspielen, wenn aber die vorgezeigten Dinge seinen Unwillen erzeugten, weil etwa es sich um eine `mitgenommene` Schachtel Stumpen aus dem kleinen Tabakladen von Witte handelte oder einen noch lebenden Frosch aus dem Teich des Apothekers oder gar ein kleines Töpfchen scharfer Senf, den ich aus dem Speisesaal der Anstalt hatte, dann kannte mein Großvater keinen Pardon.
Bei sogenannten mitgenommenen Dingen schob er mich mit seinem Spazierstock in die jeweiligen Läden und ich musste den entwendeten Gegenstand auf die Ladentheke stellen und meine Schuld eingestehen. Oft waren ein rotes Gesicht und das schlimme Gefühl des ertappten Diebes das Ergebnis dieser großväterlichen Erziehung, aber ein paar Mal ist es auch vorgekommen, dass der Ladenbesitzer mit Erlaubnis meines Großvaters mir eine schallende Ohrfeige geben durfte. Das wog sehr viel schwerer, denn es machte mir wieder einmal klar, wie sehr ich in dem kleinen Ort vom Wohlwollen des Großvaters abhängig war.
Was auf der positiven Seite allerdings auch dazu führen konnte - denn mich kannten ja alle, so wie ich auch jeden kannte, - dass ich in einen Laden gehen und etwas aussuchen konnte, dem Inhaber oder Verkäufer dann ein hochnäsiges »Schreiben Sie es bitte auf das Konto für meinen Großvater!« zuzuwerfen und dann mit dem Gegenstand meiner Begierde unterm Arm hinausspazierte.
Vielleicht sollte ich etwas näher erklären, wo ich wir denn damals gelebt haben. Es war ein kleiner Ort, ein richtiges Dorf nahe dem Steinhuder Meer in Niedersachsen, also eine, wie es bei dem großen Dichter heißt: »anmutige Gegend« mit vielen Wäldern und Hügeln, ein paar Seen und Mooren dazwischen. Dieser Ort war ein sogenanntes Straßendorf, in Ortsmitte kreuzten sich zwei Landstraßen, und just an dieser Kreuzung besaß mein Großvater sein Kurhaus für Lungenkranke. Das war ein hohes vierstöckiges weißgestrichenes Gebäude, dort wohnten über hundert Patienten, sie wurden dort untersucht und behandelt, es gab einen großen Speisesaal und Räume für die Ärzte, lange Holzveranden mit Liegestühlen, nach Süden ausgerichtet, denn die Patienten mussten ja in der Sonne liegen, stundenlang. Es gab in diesem Ort insgesamt fünf solcher Anstalten, aber nur zwei davon waren in privater Hand. Die eine gehörte einem Arzt, der sich gleich nach dem Krieg mit der Witwe seines Vorgängers eingelassen hatte, die andere hatte mein Großvater schon Mitte der dreißiger Jahre gekauft. Nun war er aber kein Arzt, er war von Beruf Koch. Schiffskoch, um es genauer zu sagen. Er war seinerzeit bei der kaiserlichen Marine in Diensten gewesen und hatte abenteuerliche Reisen auf der S.M.S. «Derflinger« und »Moltke« unternommen, dann war der erste Weltkrieg gekommen. Opa hatte ihn unverletzt überstanden, seine Abenteuerlust war jetzt aber gestillt, er wollte irgendwo zur Ruhe kommen. Also suchte er sich eine Frau und heiratete, und durch glückliche Erbschaften bekam er eine stattliche Summe auf sein Konto, mit diesem hatte er dann die Lungenheilstätte kaufen können. Seine Frau war die erste Prokuristin in Deutschland, und ihr Geschäftssinn hatte wohl auch mit dazu beigetragen, dass er sich auf solch ein Unternehmen eingelassen hatte. Opa und Oma zusammen, das war schon ein gutes Team. Sie stellten Ärzte ein und Personal, Opa hatte natürlich die Oberaufsicht in der Küche und überwachte den Einkauf der Lebensmittel, Oma machte die Buchführung und alles Finanzielle, sie hatten einen Geschäftführer eingestellt und alles lief bis zum Ausbruch des zweiten Krieges ziemlich gut. Dann kamen die Ärzte an die Front, es gab nur noch Hilfsärzte und an Personal nur Fremdarbeiter, die Zahl der Tuberkulosepatienten wurde zwar größer, aber die ganze Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln wurde im Verlaufe des Krieges immer schlechter. Dann überrollten die alliierten Truppen Deutschland und auch in diesem kleinen Ort wurde eine englische Besatzung eingerichtet, natürlich im besten Haus des ganzen Dorfes, in der an der Hauptstraße günstig gelegenen schönen großen Villa meines Großvaters. Der hatte die Villa extra nach den Wünschen meiner Großmutter bauen lassen nach eigenen Entwürfen mit einem kleinen Türmchen, vielen Balkonen und einem enormen Vorratskeller. In dieser hochherrschaftlichen Villa wurde nun der Besatzungskommandant mit seinem Stab einquartiert und meine Großeltern mussten zusammen mit meinen Eltern, die in Hamburg ausgebombt worden waren, sowie drei fremden Flüchtlingsfamilien im sogenannten Arzthaus leben. Die Heilstätte wurde umfunktioniert zu einer Art Durchgangshotel für Fremdarbeiter, die auf dem Weg zurück in ihre jeweilige Heimat waren. In jenen Monaten und Jahren nach dem Krieg bis Anfang der Fünfziger Jahre waren die beiden Dorfstrassen voller polnischen, ungarischen, russischen und französischen Laute. Dann endlich nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland bekamen alle neues Geld und eine Weile später erhielt auch mein Opa erst seine Villa und dann die Heilstätte zurück. Der Zustand der Gebäude war vor allem in der Heilstätte desolat, und in den nächsten beiden Jahren waren viele Handwerker dabei, die Zimmer und großen Säle wieder instand zu setzen, und das war letztlich auch die Zeit, in der mein agiler Großvater seine guten Ruf als korrekter Geschäftsmann und vertrauenswürdiger Partner aufgebaut hat.
Er beschäftigte vorwiegend Handwerker aus der Umgebung, und als die Heilstätte dann langsam wieder ihren Betrieb aufnahm, kaufte er die notwendigen Lebensmittel bei den Bauern der umliegenden Dörfer ein. Mein Vater wurde Geschäftsführer und machte die Büroarbeit, meine Mutter war für das Personalwesen zuständig.
Meine Eltern waren im Krieg ausgebombt worden, all ihre Habe war in einer Bombennacht in Hamburg vernichtet worden; zu der Zeit lag mein Vater noch im Lazarett in Göttingen und meine Mutter hatte nur ein paar wichtige Familienpapiere und einen kleinen Koffer Kinderkleidung für mich retten können. Seitdem wohnten sie hier bei meinen Großeltern.
Von der Nachkriegszeit mit den Eiswintern und vielen Hungertoten weiß ich nichts mehr, ich erinnere mich nur noch dunkel an die Enge des Hauses, in dem wir damals wohnen mussten, Großeltern, Mutter und ich und später kam Vater noch dazu, alles in einem engen Zimmer, und nur ein kleiner Ofen in der Küche, die wir mit fünf anderen Familien teilen mussten. Ich erinnere ich an kratzende lange Strümpfe, die an einem Leibchen festgemacht wurden mit hellen Knöpfen, an endlos lange Wege nach Münchehagen an Mutters Hand, Vater war dann weg, auf Hamstertour, erzählten die Erwachsenen, und ich dachte noch, wie kann ein so großer Mann in ein so kleines Hamsterloch nur hineinkommen. Mutter ging mit mir gelegentlich durch den Wald in das Nachbardorf zu den Wesemanns, die Frau Wesemann war schon lange vor dem Kriege die Schneiderin für unsere Familie gewesen, und dort wurden mir Hosen und Mäntel aus abgelegten Kleidungsstücken buchstäblich auf den Leib genäht. Das dauerte oft den ganzen Tag, denn auch Mutter brauchte neue Kleidung. Sie hatte einen grünen Rucksack, in dem sie ihre Tauschware zu den Wesemanns trug, auf dem Rückweg lagen darin sorgsam verpackt die umgearbeiteten neuen Kleider. Wir gingen morgens los und kehrten abends wieder zurück, mittags aßen wir in der großen Küche mit allen Wesemanns zusammen; meist gab es eine Art Eintopf, aber ich erinnere mich auch an so etwas wie eine köstliche Sahnetorte, die gab es, als die Tochter Astrid Geburtstag hatte.
Auf den Rückwegen schleppte meine Mutter sich ganz schön ab mit dem schweren Rucksack, in dem die erworbenen Kleider steckten. Ich weiß noch, ich musste die alten Anzüge meines Onkels auftragen, natürlich auf meine Größe umgeändert, aber es war mir irgendwie peinlich. Die anderen hatten alle Trainingsanzüge, in braun oder dunkelblau, in denen liefen sie außerhalb der Schulzeit rum, und ich musste immerzu diese umgeänderten Anzüge tragen, und Vater sagte, ich solle froh sein, das sei ein so guter Stoff, so etwas bekäme man heute nicht mehr. Er selbst trug gern Anzüge, schon vor dem Kriege hatte er sich immer welche machen lassen, und jetzt, er war ja auch ziemlich abgemagert wie die meisten Erwachsenen, da schlotterten ihm besonders die Jacketts um die Schultern. Ich wusste, dass ich trotz meiner sonderbaren Anzüge von den anderen in der Klasse gemocht wurde. Meistens zog ich auch das Jackett schon im Garten aus und versteckte es im kleinen Schuppen hinter dem Feuerholz, das Hemd auch, dann lief ich im Unterhemd zu den anderen; so konnten keine Dreckspuren oder Risse in meine Sachen kommen, wenn wir durch Feld und Flur streiften oder im Wald nach Überresten des Krieges suchten. Knochen lagen dort in einer Senke, viele Knochen, auch Schädel, vor denen gruselte es uns ein wenig; gelegentlich fanden wir Koppel mit Hakenkreuz am Schloss und manchmal einen Dolch, wie neu, noch eingefettet in der Scheide, oder einen Karabiner, der Kolben zersplittert und das Schloss angerostet. Wir hofften dann, dass noch eine Kugel im Lauf stecken möge und versuchten, das Gewehr abzuschießen. Wenn aber alles zu verrostet war, was meist der Fall war, zum Glück für uns, dann machten wir ein Feuerchen und legten das Gewehr dort hinein, oft genug gab es dann nach einer Weile einen Knall und dann wussten wir, es war noch Munition im Karabiner gewesen. Überall im Wald fanden wir noch Spuren des Krieges.
Merkwürdigerweise aber wurde bei uns zu Hause nie über den Krieg gesprochen, meine Eltern schwiegen und meine Großeltern auch, und wie ich von den anderen Spielkameraden hörte, war es in den anderen Familien auch so. Niemand redete über den gerade beendeten Krieg. Ich dachte mir, das es vermutlich daran liege, dass Deutschland den Krieg verloren hatte; und ich kannte das ja aus unserer Bande und vor allem von mir selbst, dass man über irgendwelche Niederlagen nicht gern redet und diese am liebsten verschweigen möchte. Ich gab mich daher mit dem Schweigen der Erwachsenen zufrieden und lauschte um so begieriger den Erzählungen meines Großvaters über die Geschehnisse im ersten Weltkrieg. Der Krieg war für mich, für uns Kinder so etwas wie unser Indianerspielen, nur eben für Erwachsene und »im richtigen Leben«. Wir stellten uns das so vor wie bei Lederstrumpf oder Winnetou.
So bin ich also auf dem Lande aufgewachsen und war alles in allem dort ziemlich fröhlich und hatte eine glückliche Zeit.
3
Die Tage und Wochen nach Frau Burgdorfs Abfahrt hielt die gute Laune meines Großvaters an. Er bekam auch einmal in der Woche Post von dieser Frau, er nahm dann den Brief und zog sich in sein Arbeitszimmer in seinen schweren Ledersessel zurück. Meine Eltern redeten nicht weiter über Hannah Burgdorf, jedenfalls nicht, wenn ich dabei war, also beim Essen, und dann saß ja auch noch Opa mit am Tisch. Ich war meist mit meinen Gedanken schon bei einem der wichtigsten Ereignisse im Jahresablauf, dem Schützenfest.
Wie überall in Niedersachsen wurde die Tradition der Schützen auch hier hochgehalten, und wer immer im Ort etwas galt oder Anerkennung suchte, der musste in den Schützenverein eintreten. Dies war fast noch wichtiger als die Mitgliedschaft in der Feuerwehr, denn in der Schützengilde wurden neben der Dorfpolitik auch die großen Geschäfte abgeschlossen; ob es um eine neue Asphaltierung der Straße ging oder die Umwidmung von Brachland zu Baugelände, um den Verkauf eines Zuchtstieres oder die Verlegung von Telefonkabeln, alles wurde meist am Sonntag beim Schoppen im Schützensaal beschlossen. Der alte Bürgermeister, er selbst war schon zweimal Schützenkönig gewesen, pflegte dort mit dem Glas in der Hand gründlich zuzuhören und aus den vielen Vorschlägen und Meinungen kristallisierte er die Einstellung der wichtigen Einwohner heraus, diese Ansicht wurden dann in der nächsten Gemeinderatssitzung als Beschluss verkündet. So erfolgreich fuhr der Bürgermeister damit, dass er zwanzig Jahre lang immer wieder gewählt wurde, obwohl er in keiner Partei Mitglied war.
Mein Großvater war natürlich auch Mitglied in der Schützengilde, und beim großen Umzug am Schützensonntag ging er stramm in der vierten Reihe mit in seiner grünen Jacke und dem aus meiner Sicht lustigen Jägerhütchen. Für mich sah er wie verkleidet aus, besonders, wenn er statt einer Flinte seinen Spazierstock geschultert hatte. Den größten Eindruck auf mich damals aber machte jedes Jahr der Gärtner Aderholt, der als Hauptmann der Garde auf einem Pferd gleich hinter der Kapelle ritt; er trug einen blauen Dreispitz und reckte einen blitzenden Säbel in die Luft. Wir Kinder begleiteten den Umzug durch den ganzen Ort und warteten gespannt darauf, wann der Hauptmann Aderholt vom Pferd fiel. Denn der Zug der Schützen hielt an jedem Haus, in dem ein ehemaliger Schützenkönig wohnte, dort gab es Schnaps für alle und Flaschenbier zum Herunterspülen, und der Schützenhauptmann hielt sich für sehr trinkfest. Aber in jedem Jahr kam der Moment, wo er sich nicht mehr im Sattel halten konnte und meist stumm zur Seite herabsank.
Einmal allerdings war es richtig spannend, da hatte nämlich eine Bremse das Pferd gestochen, dieses sprang wiehernd hoch und galoppierte dann querfeldein. Hauptmann Aderholt schwankte hin und her wie eine Kasperlepuppe, bis er schließlich in einem Schlehenbusch landete und mit zerkratztem Antlitz mühselig humpelnd den Weg heimwärts suchte, schwer auf seinen Säbel gestützt, den Dreispitz hatte er verloren. Albrecht, unser Heizer, fand ihn wenig später in einer Ackerfurche und brachte ihn dann zum Haus, dort gab ihm die verärgert dreinblickende Frau Aderholt eine ganze Flasche Rum aus der Vorratskammer. Die nächsten Tage beklagten sich meine Eltern immer wieder bei Tisch über Albrechts miserable Arbeitshaltung.
Der Schützenumzug durch den ganzen Ort war für die meisten Männer der Höhepunkt des Festes, denn da gab es den Schnaps umsonst. Für die Frauen war der anschließende Tanz im Festzelt der Höhepunkt. Auf der Festwiese von Bäcker Linsenhoff wurde jedes Jahr ein großes Zelt aufgestellt, in dem eine Tanzkapelle aufspielte. Der Spielmannszug trat erst gegen Mitternacht auf das Podium, wenn die etwas schiefen Töne der Querflöten die Ohren der Angetrunkenen nicht mehr so quälen konnten.
Für uns Kinder aber waren die Höhepunkte des Schützenfestes die Fahrgeschäfte und Buden mit türkischem Honig, Büchsenwerfen und die Losbude. Allein schon dieser verführerische Duft von Fischbrötchen, Räucheraal, gegrillten Würstchen, verbranntem Fett, Schmalzgebäck, gebrannten Mandeln und Erdnüssen ließ uns das Wasser im Munde zusammenlaufen. Diese großen Schaugeschäfte wie Autoscooter oder Geisterbahn oder Riesenrad und Achterbahn, die gab es damals noch nicht. Das wenn auch kleine Kettenkarussell war die Attraktion für alle Heranwachsenden, die Mädchen in züchtigen Kleidern juchzten und schrieen, wenn sie an den Ketten fast waagerecht durch die Luft flogen. Die Jungen versuchten im Fluge die Ketten der Mädchensitze zu ergreifen, sie an sich zu ziehen und den ganz mutigen gelang es sogar, ganz kurz ihre Lippen auf Haar oder Kragen des jeweiligen kreischenden Mädchens zu pressen.
Meist schlenderte ich mit Dorlein Behre und Henning über den Festplatz. Dorlein war des Apothekers Töchterchen, sie hatte lange dunkle Zöpfe und braune Augen und für mich besonders spannend ein Planschbecken im Garten. (Heute nennt man so etwas wohl Swimming Pool, wir sagten damals dazu Planschbecken.) Es war zwar groß, aber nicht tief, und im Sommer lagen wir meist darin und darum und spielten im Wasser. Es war sehr praktisch, dass Dorlein unsere Nachbarin war und in die gleiche Klasse ging wie ich.
Ich weiß noch, wie sehr wir gekichert hatten, als wir zusammen unter dem Gebüsch lagen und die Zwiebeln gegessen haben. Dorleins Vater, der Apotheker, war ein großer Blumenfreund und hatte sorgfältig Zwiebeln in die Erde gesteckt, und zwar den ganzen Zaun entlang, der unsere beiden Grundstücke trennen sollte. Dorlein und ich waren gerade bei uns und spielten mit den Indianerfiguren im Gras. Als wir den eifrigen Freizeitgärtner so beobachteten, kam uns die Idee, dass im allgemeinen Zwiebeln ja sehr gut essbar sind und manche, vor allem die großen roten, ganz schön süß schmecken können. Wir warteten also ab, bis der Herr Apotheker wieder im Hause war. Dann schoben wir uns unter dem Zaun hindurch und buddelten eine ganze Menge von den Zwiebeln wieder aus. es war sehr praktisch, dass das Planschbecken gleich zur Hand war, wir wuschen die Erde ab und legten uns unter einen dichten Busch; ich zerteilte die Zwiebeln mit meinem Fahrtenmesser. Sie schmeckten uns köstlich, wenn wir auch immer wieder den Blick zum Haus wandten, um zu schauen, ob Dorleins Vater wiederkäme. Wir waren richtig gesättigt und fühlten uns gut. Erst als der Apotheker beim Abendbrot voller Stolz erzählte, dass er heute an die fünfzig Tulpen in die Erde gesetzt habe, wurde Dorlein etwas übel. Ich hatte keinerlei Beschwerden, auch nicht am nächsten Tag, als Dorlein mir das von den Tulpen mitteilte. Vielleicht ist es ja so eingerichtet, dass schöne Blumen auch gut schmecken.
Mit Henning war es etwas anderes, er war erst vor einigen Jahren in den Ort gezogen als einziger Sohn unseres Zahnarztes, er hatte rote Haare, viele Sommersprossen und eine empfindliche Haut. Immer musste er sich eincremen oder in den Schatten setzen, wenn er einen Sonnenbrand bekam, wurde seine Haut fast so rot wie die einer Tomate. Aber er war ein prima Kumpel, konnte gut schlittschuhlaufen und er hatte als einziger von uns eine elektrische Eisenbahn, mit der wir vor allem im Winter hin und wieder spielten konnten.
Wir teilten uns die Riesenportion der weißen duftigen Zuckerwatte, die auf der Zunge sich in nichts auflöste und so angenehm im Gesicht kleben blieb, kauften vom Rest des angesparten Taschengeldes –und das muss ich sagen, mein Opa gab mir immer zum Schützenfest drei Mark zum »sinnvollen Verprassen«, wie er mit einem Lächeln dazu sagte, - ein paar Lose und gewannen eine Lakritzschnecke oder eine große Tüte Schaumwaffeln. Dann schlichen wir uns an die Rückseite des Festzeltes und lugten unter der gelockerten Zeltplane hindurch;– vorne kostete es nämlich Eintritt, und wir Kinder wurden gar nicht erst hereingelassen; erst nach der Konfirmation durfte man in den Schützenverein eintreten und hatte dann auch die Gewähr, an den Feierlichkeiten im Festzelt teilnehmen zu dürfen. Wir freuten uns jedes Jahr, wenn schon am frühen Nachmittag die ersten bleichen Jünglinge sich aus dem Zelt schlichen und bei Aderholt in die Büsche kotzten. Einmal war einer fast im Bach ertrunken, er war ohnmächtig geworden oder vom vielen Schnaps bewusstlos, er hing mit dem Kopf halb im Wasser. Kättgen fand ihn, als er pinkeln ging, und zog ihn auf die Wiese. Dort lag der arme Junge in seiner nagelneuen Uniform, bis seine Eltern ihn in einen Schubkarren hievten und nach Hause schoben.
Mein Großvater saß am Eldertisch, bei den Honoratioren. -Ich hab mich lange gewundert, was das wohl zu bedeuten habe, Honoratioren; erst dachte ich, es käme von den Hortensien, Mutter besorgte immer wieder welche bei Gärtner Aderholt. Dann dachte ich, es müsse sich um eine Art Geheimbund handeln, ich las gerade voll Begeisterung den »Grafen von Monte Christo« und war in meinen Phantasien oft in Degenduelle verwickelt und in die Rettung schreiender schöner Witwen und Waisen. Dann wieder meinte ich, Honoratioren sei einfach die Bezeichnung für Menschen über sechzig, wenn man höflich sein und das Wort Greise vermeiden wollte. Als aber dann der neue praktische Arzt, Doktor Claasen, in den Ort zog und auch schon bald zu den Honoratioren gerechnet wurde, dabei war er nicht viel älter als fünfunddreißig, da brach meine Theorie zusammen und ich fragte eines Nachmittags meine Mutter, was denn Honoratioren seien. Mutter wunderte sich zuerst, wie ich auf so etwas käme, aber dann erklärte sie mir ausführlich, dass in einer Gemeinschaft, und auch unser Dorf sei eben auch eine Gemeinde, da bemesse man die Unterschiede der Menschen nicht nur nach arm und reich, alt und jung, gesund und krank, sondern auch nach Bildung und Stand. Das käme sicher noch von früher her, wo es in allen Ländern deutlichere Klassenunterschiede gegeben habe, ich soll mal nur an die Ritter und freien Bauern und Tagelöhner und Freisassen und Sklaven denken. Im Allgemeinen sei es bei uns jetzt so, dass Leute wie der Pastor, der Arzt und der Bürgermeister zu den sogenannten Honoratioren zählten. Eventuell der Schulleiter oder Lehrer sei noch mit dabei. In unserem Dorf aber seien die Vorstände von Kirche, Feuerwehr und Schützenverein auf jeden Fall dazu zu zählen, und ein paar verdiente Bürger ebenfalls. Und zu der letzten Gruppe gehörte auch mein Großvater, denn er habe sehr viel für den Ort getan, all die Jahre immer wieder Spenden gegeben für die Armen, für den Straßenbau, für die Vereine oder den Schulausbau. Kurz und gut, sagte mir meine Mutter, die Honoratioren seien eben die Leute, auf die es ankäme, die etwas darstellten, die von allen anderen geachtet würden. Aha, jetzt wusste ich Bescheid.
Wenn wir Schulkinder dann später am Nachmittag unter der schweren Zeltplane hindurchlugten und das fröhliche Treiben des Schützenvolks betrachteten, dann waren viele der Honoratioren genau so betrunken wie das normale Volk. Natürlich nicht mein Großvater, der pflegte nach etwa zwei Stunden sein Glas Bier zu leeren, dann bestellte er beim Wirt an der Theke noch eine Runde Klaren für den Seniorentisch und entschuldigte sich bei den Umhersitzenden. Er wusste ja, wenn er erst einmal das Zelt verlassen hatte, dann vergaßen ihn die anderen so schnell wie sie ihre Schnäpse herunterkippen konnten.
Ich versuchte oft, meinen Opa dann zu erwischen, denn er war meist nach Verlassen des Festzelts in Spendierlaune, wie er es nannte. Oder er hatte die Spendierhosen an, so nannte mein Vater dieses Verhalten, wenn Opa seine Geldbörse zückte und mir ein Fünfmarkstück reichte. Überglücklich lief ich damit dann zu Rudi, Dorlein und Hennig und wir tranken davon erst mal eine gelbe Brause. Damals gab es eine Zeitlang diese Brauseflaschen mit einer Kugel in der Öffnung, dadurch floss der Inhalt ruhiger und sanfter, wir zerschlugen manchmal die Flaschen, nur um an diese hellen Glaskugeln zu kommen. Wir konnten sie gut beim Murmelspielen gebrauchen, ich weiß noch, für eine solche Glaskugel gab es zehn bunte Tonkugeln.
Nach der gelben Brause kauften wir meist für jeden Zuckerwatte, die zerging so prickelnd auf der Zunge und klebte an den Fingern. Und dann gab es da noch diese halbmondförmigen Membranen, die man auf den Gaumen legen musste und dann konnte man zwitschern wie ein Vogel. Ich kaufte gleich mehrere, denn ich wusste ja, dass spätestens nach ein zwei Wochen die zarte Membran durch Speichel und Kinderhand in Fetzen hing, dann konnte ich von den Ersatzvogelstimmen eine nehmen. Wir hatten nach kurzer Übungszeit ein wahres Vogelkonzert zusammen, die Erwachsenen hielten sich schon die Ohren zu und drängten uns, damit aufzuhören. Wenn Lehrer Lange einen damit in der Schule erwischte, gab es mit dem Rohrstock einige Schläge.
4
Mai muss es wohl gewesen sein, ein recht sonniger Maitag, wir trafen uns am Nachmittag am Schulgarten, Henning, Rudi und ich und wollten eigentlich zum kleinen See hoch, da kam Kättgen um die Ecke in seinem Blaumann. Kättgen war schon sechzehn und konfirmiert, daher durfte er schon lange Hosen tragen; wir hatten meist unsere Lederhosen an, ich hatte meine –endlich! – zum Geburtstag bekommen, und zwar so eine richtige, mit der eingearbeiteten Tasche für ein Fahrtenmesser an der rechten Seite. Das Messer schenkte mir dann Onkel Erich, es war in einer braunen Lederscheide, oben war es mit einem Lederbändchen befestigt, die Klinge war etwa fünfzehn Zentimeter lang und der Griff aus Plastik einem Geweih nachgebildet; ich war sehr stolz darauf, zumal ich der zweite Junge mit solch einem Fahrtenmesser war. Teddy hatte schon eins, das lag sicher daran, dass sein Vater diese Messer in seinem Laden verkaufte.
Kättgen überragte uns Zehnjährige mindestens um einen Kopf hoch, aber er war unser Freund; er ging schon in die Lehre beim Tischler Drebber und er gab uns auch immer wieder einmal von seinen Zigaretten ab.
Wir fühlten uns dann sehr erwachsen. Meist rauchten wir hinter der Liegehalle im Gras oder in den ge