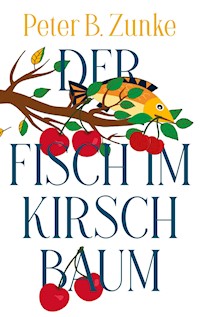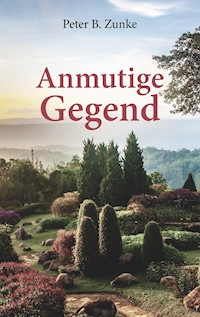Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese beiden Geschichten geschahen zur Zeit der großen Corona-Pandemie. Diese Epidemie betraf alle Menschen, aber nicht alle reagierten auf die gleiche Art und Weise. Die Reaktionen auf Ereignisse im Leben sind bei uns allen sehr ähnlich, wir erleben Angst, Wut, Hass und Ärger, Verzweiflung und Grauen sowie Liebe und Zuneigung alle, aber das Umgehen mit diesen tiefen Emotionen ist doch ziemlich unterschiedlich und abhängig nicht nur von der jeweiligen Situation, sondern auch von alten Erfahrungen, ererbten und genetisch verankerten Strukturen und nicht zuletzt der Möglichkeit, anderen zu vertrauen. Die Personen dieser beiden Geschichten handeln sowohl vertraut wie auch befremdlich im Vergleich mit unseren eigenen Erfahrungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
KURZSCHLUSS
LANGE LEITUNG
KURZSCHLUSS
Überall war es dunkel.
Susanne holte aus der Kommode die Blechkiste, in der sie die Kerzenreste und verschiedene lange Kerzen aufbewahrte. Sie nahm eine weiße Stearinkerze und entzündete sie. Ein warmes Licht, fast wie früher.
Früher, da gab es häufig diese Dunkelheit, das Abschalten der Stromversorgung war ein beliebter Kniff der Verwaltung gewesen; begründet wurde es oft mit der lapidaren Feststellung, es habe wohl in der Umspannstation einen Kurzschluss gegeben und man sei bemüht, durch neue und bessere Arbeiten für das Wohl der Bevölkerung ein solches Ereignis in Zukunft verhindern zu können. Falls sich Derartiges noch einmal wiederhole, solle man Ruhe bewahren und in Küche oder Wohnzimmer stets Kerzen und Streichhölzer bereithalten.
Susanne stellte die brennende Kerze auf die Kommode und schaute aus dem Fenster. Überall nur tiefe Nacht in der Stadt, alle Fenster dunkel, keine Straße erleuchtet, die sonst oft so störenden bunten Reklamelichter von Geschäften und auch die hellen Schaufenster von Modehäusern und Buchläden waren still und erloschen. Sie konnte auch keinen Radfahrer sehen oder die Scheinwerfer eines Autos, alles war einfach nur dunkel.
Ein plötzlicher Schreck durchfuhr sie und ließ sie erstarren. Kein Strom! Das würde ja auch bedeuten, dass es im Krankenhaus keinen Strom mehr gab, und auch auf der Intensivstation, wo ihr Henry lag …
Sie setzte sich langsam auf das Sofa. Kein Strom in der Klinik. Kein Beatmungsgerät funktionierte mehr. Henry würde ersticken, oder …??? Aber dann sagte sie sich: Nur mit der Ruhe, die haben doch vorgesorgt, schon seit Jahren, das weiß man doch, die haben gewiss eine gute Notversorgung, nicht erst seit der Pandemie! Nein, das war doch schon immer so, wenn überall der Strom ausfiel, dann gab es noch immer genug in der Klinik, denn wenn bei einer Operation auf einmal die Lampen im Operationssaal ausgehen würden, dann ständen die Ärzte mit dem Skalpell in der Hand am Tisch um den Patienten herum und konnten nicht mehr weitermachen. Also, das gab es nicht, da würden dann rechtzeitig die Notstromaggregate einspringen, nein, im Krankenhaus gab es immer Strom, und zwar genügend! Das konnte sich die Stadt nicht leisten, das Land auch nicht, nein. Sie war sich sicher, im ganzen Lande gab es für solche Notfälle genug Strom in allen Kliniken, sie fühlte sich erleichtert.
Der Fernseher war ebenfalls stumm, dabei wollte sie heute Abend doch eine ihrer Lieblingssendungen sehen, mit dem, wie hieß er denn nur noch, sie kannte jetzt im Moment nur den Namen der Figur, den der Schauspieler in der Serie spielte, da hieß er Herr Vandenberg. Und letzte Woche sollte er von seinem Onkel um den Betrieb betrogen werden, und dann wartete noch diese nette dunkelhaarige Köchin auf ihn mit selbstgebackenem Apfelkuchen, den er so gern mochte. Das hatte sie in der letzten Folge doch genau gesehen, er mochte Apfelkuchen, aber auch die Dunkelhaarige.
Susanne zog die Gardine wieder vor das Fenster. Hoffentlich dauerte es diesmal nicht wieder so lange. Sie hatte noch etwas von dem Cassoulet im Eisfach, und überhaupt, wenn der Strom zu lange ausfiel, dann würde ja alles verdorben sein, was sie eingefroren hatte. Zum Glück waren da noch die anderen Vorräte, Nudeln, Kartoffeln, Reis, und die Dosen mit Thunfisch, Erbsen und Würstchen. Jetzt, wo sie allein war, bekochte sie sich nur mit den einfachen Dingen. Sie mochte ungern allein essen, sie ging dann lieber kurz zum Imbiss und nahm dort eine Currywurst oder holte sich einen halben Hahn.
Susanne setzte sich auf ihr helles Sofa und hüllte die Füße in ihre braune Lieblingsdecke. Kein Radio, kein Fernsehen, ihr blieb nur das Telefon. Aber wen sollte sie anrufen? Und was sollte sie denen erzählen? Alle anderen hier in der Stadt waren ja ebenfalls im Dunkeln, und die Freunde im Süden, was sollte sie denen schon sagen. Dass sie hier im Dunkeln sitzen musste und wartete, bis Hunger und Frost sie ins Grab gebracht hätten ….
Sie musste lachen. Sie übertrieb mal wieder in ihrer Fantasie. Hunger und Frost, dabei, war die Heizung nicht auch abhängig von der elektrischen Versorgung? Und alles nur wegen der Wahlen, da war sie sich sicher. Irgendwem würde es schon nützen, dass jetzt der Strom ausgefallen war. Wenn er oder sie, die Partei nämlich, oder die Parteigenossen nicht sogar dafür verantwortlich waren, die hatten sicher diesen Ausfall programmiert, weil im Fernsehen heute Abend diese politische Sendung kam und da wäre dann auch ganz bestimmt etwas über die Nebeneinkünfte von dem neuen Bewerber für das Amt des Bausenators über die Bildschirme geflimmert, also hatte man lieber den Strom abgestellt, dann konnte der Sender im fernen Berlin noch so schlimme Dinge in die Welt schicken, hier würde sie keiner sehen können.
Ja, jetzt war sie sich sicher, das war eine abgekartete Sache, dieser Stromausfall. Das hatte einen politischen Hintergrund, da war sie sich sicher. Sie kuschelte sich in ihre Decke ein, ganz fest, und lächelte grimmig vor sich hin. Aber da haben sich die verrechnet, sie würde einfach nicht hingehen, sie würde die Wahl verweigern. Jedenfalls diesmal. Susanne ging sonst immer zur Wahl, jedes Mal, gleichgültig, ob Kommunalwahl, Landtagswahlen oder die zum Bundestag, sie kam ihrer Wahlpflicht nach. Nicht nur als brave Wählerin oder als gute Staatsbürgerin, sondern auch, weil sie es als ihr Recht sah, als Pflicht und Recht. Zu wählen war jedes Mal ihre eigene Möglichkeit, die da oben so zu beeinflussen, wie sie es sich vorstellte. Erst aus vielen Tropfen wird ein Meer, das war der Spruch von Onkel Würde immer gewesen. Und Henry hatte sie darin bestärkt und gemeint, wenn sie schon sich tagtäglich so über die Politik aufrege, dann müsse sie doch bei den Gelegenheiten, die man ihre gebe, auch ihr Kreuz dort machen, von deren Wahlversprechen sie sich etwas erhoffen würde.
Ach Henry.
Susanne seufzte leise. Der lag immer noch im Koma auf der Intensivabteilung, und sie durfte ihn nicht einmal besuchen. Corona. Es hatte ihn schwer erwischt. Erst hatte er noch gelacht und nur leicht gehustet, war dann zum Hausarzt gegangen und der hatte ihn sofort in die Klinik geschickt, per Taxi, und dann war er sofort auf die Isolierstation gebracht worden, Susanne hatte noch mit ihm reden können durch die Plexiglasscheiben in der Besucherstation, dann ging es rapide abwärts mit ihm, bereits am Abend kam der Zusammenbruch und Henry wurde auf die Intensivstation verlegt, und am nächsten Tag musste er erst beatmet werden, dann am späten Vormittag wurde er in ein künstliches Koma gebracht und beatmet und der langwierige Teil der klinischen Behandlung mit täglichen Umlagerungen zur Lungenentlastung und Infusionen und und und begann.
Für Susanne wurde es dann zur Routine, dass alle drei Tage einer der Ärzte sie anrief, um im Grunde nur mitzuteilen, dass es nichts Neues gäbe, aber der Allgemeinzustand nicht so schlecht aussähe. So wartete sie also seitdem Tag für Tag in aller Untätigkeit.
*
Die Tage wurden wieder länger, und als Susanne beim Edeka auf Tante Irmi traf, wurde sie gleich am Abend eingeladen:
»Denn langsam wird es fast schon ungemütlich. Man kann ja keine Leute mehr treffen, und selbst unsere Doppelkopfrunde darf nicht mehr zusammenkommen, die Traudel hat sich auch infiziert. Sie ist schon seit drei Wochen zu Hause in Quarantäne, am Telefon klagt sie immer noch über Müdigkeit und sie sagt, sie könne sich nicht recht konzentrieren, da habe das Kartenspielen wohl keinen Zweck. Ich hoffe ja nur, dass wir diesmal verschont bleiben. Du weißt ja, Onkel Erich mögen die Viren besonders gern. Jedes Jahr bekommt er Husten und Schnupfen und dann die Grippe, auch wenn er sich jedes Jahr immer wieder impfen lässt. Ich glaube manchmal, dass es vielleicht doch am Impfen liegt. Aber der Arzt sagt nein, er sei eben so empfindlich auf diese Art von Grippeviren. Zum Glück hat ihn bisher das Corona verschont. Na ja, ich muss dann mal wieder.«
Sie schulterte das offenkundig schwere Netz über die rechte Schulter und ging. Susanne kaufte ihr Gemüse und eine Putenoberkeule und ging schnell wieder heim. Diese Masken waren doch ziemlich lästig. Obwohl sie den Ärzten zufolge und nach Ansicht der Medien insgesamt sehr hilfreich waren und gut vor einer neuen oder erneuten Ansteckung schützen konnten, sofern man nicht einem der Erkrankten zu nahe kam. Aber sie verbargen doch ein Gutteil des Gesichtes, so dass sie oft auch gute Bekannte nicht gleich erkennen konnte. Onkel Würde hatte am Sonntag gesagt:
»Ich würde mal so sagen, dass früher, wenn man da mit einer Maske in die Sparkasse kam, da ging gleich der Alarm los. Heutzutage kommt der Alarm, wenn man ohne Maske den Schalterraum betritt. Ich würde meinen, dass diese Zeit so ihre ganz eigenen Spielregeln hat und wer weiß, welche davon wir dann später beibehalten werden. An sich ist das mit den Masken ja nicht schlecht, ich mag so manch ein Gesicht einfach nicht mehr sehen, aber leider nehmen die im Fernsehen ja immer die Masken ab, wenn sie interviewt werden. Schade.«
Susanne freute sich nicht sehr auf den Abend. Na gut, es waren schließlich ihre Verwandten, aber ihr schien das alles so langweilig zu sein, was da wieder erzählt werden würde und zum Schluss würde es wieder eine der Konserven geben. Onkel Würde, wie sie ihn auch nannte, wie die meisten jugendlichen Neffen und die Kinder der Umgebung, die mit ihm zu tun hatten, denn fast jeder seiner Sätze begann mit »ich würde mal sagen, dass..« oder »man würde das so nicht sagen dürfen« oder »mancher würde glauben …« Es gab wohl keine Unterhaltung, in der Onkel Dieter, wie er eigentlich hieß, nicht ein paar Mal seine Würde-sätze von sich gab; also dieser Onkel hatte eine Vorliebe für alte deutsche Filme und eine beträchtliche Sammlung davon auf DVD, und die zeigte er gern dem Familienkreis. Susanne konnte bei einigen schon den Text auswendig.
Einmal war dem Vetter Alfred der Kragen geplatzt und er hatte den Onkel fast angebrüllt:
»Wozu zeigst Du uns immer wieder diesen alten Schwachsinn?! Wir leben nicht mehr in der guten alten Kaiserzeit und Hans Albers ist schon so lange tot. Und überhaupt! Die Zeiten sind vorüber! Wenn du schon über solchen Unsinn reden musst, dann steh doch auch dazu. Sag nicht, ich würde das ja tun, mach es endlich! Würde würde würde, deine Generation ist ja ziemlich weit gekommen mit dem Konjunktiv. Alles würde sie tun, für den Fortschritt würden wir dies machen und jenes lassen. Wir würden so gar das Würden lassen, oder? Würdest du lieber sein oder würden??!!«
Der Onkel war ganz still geworden und hatte sich stumm in seinen Sessel gesetzt und dann den ganzen Abend nichts mehr gesagt. Er war schlicht beleidigt, und wie er am nächsten Morgen beim Frühstück zu seiner Frau gesagt hatte:
»Schau doch, Irmi, würdest du nicht auch meinen, dass sich der Alfred daneben benommen hat?«
Und Irmi hatte ihm zugestimmt und seitdem hatten sie den Alfred nicht mehr eingeladen.
*
Dabei war Alfred ihr einziger noch lebender Verwandter von Irmis Seite. Er hatte lange Jahre in der Chemieindustrie gearbeitet und auch ein oder zwei Patente erworben, war verheiratet gewesen, aber sein Frau hatte sich scheiden lassen, weil er doch zu sehr den gehlen Korn geliebt hatte. Erst durch die Scheidung von Lieselotte, die er aber nur Lilo nannte, war Alfred klar geworden, dass er so nicht mehr weiterleben konnte, wollte und durfte. Er hatte sich dann in eine spezielle Klinik in der Nähe von Bremen begeben und war später zu den Anonymen Alkoholikern gegangen. Dort besuchte er regelmäßig die Treffen und wurde im Laufe der Zeit immer vertrauter mit deren Gepflogenheiten; er wurde schließlich sogar Leiter einer Gruppe. Unter den Trockengebliebenen hatte er auch erste Freunde gefunden. Früher waren ihm Arbeitskollegen und Ehefrau genug Menschen in seinem Leben gewesen. Nun konnte er sich auch um eigene Belange von anderen helfen lassen. Das war für ihn eine ganz neue Erfahrung gewesen und er war zutiefst dankbar dafür.
Die Arbeit mit den anderen ehemaligen Trinkern und vor allem seine eigene Abstinenz hatte ihm wieder die Zuneigung seiner Exfrau gebracht und sie verstanden sich jetzt besser als jemals zuvor, konnten wieder gemeinsam in Urlaub fahren und zusammen ins Kino gehen oder ins Theater. Aber sie wollten nicht wieder zusammenziehen, selbst dann nicht, als Lilo schwer erkrankte und nach diversen Klinikaufenthalten und Operationen von Alfred gepflegt werden musste, weil sie allein kaum noch aus dem Bett kam, da wurde ihre Beziehung immer inniger und die Zuneigung wuchs und erstmals erlebte Alfred, dass so etwas wie Liebe sich nicht unbedingt nur in den körperlichen Begehrlichkeiten niederschlagen musste, sondern dass es eine andere Form von Zuneigung, Zärtlichkeit und Vertrautheit gab, die das Zusammensein mit Lilo fast auf eine andere Stufe erhoben. Er hatte dann begonnen, ihr vorzulesen, erst nur die tägliche Zeitung, dann auch verschiedene Bücher; einige, die Lilo schon immer hatte lesen wollen, andere, die ihm die nette Buchhändlerin empfahl.
Alfred wurde so täglich mit Lilos körperlichem Zerfall konfrontiert, und als er mit der Arbeit der Pflegerin vom Arbeitersamariterbund nicht mehr zufrieden war, ließ er sich kurzerhand frühberenten und kümmerte sich nun ganztags um seine Exfrau, bis diese dann friedlich in einer Nacht für immer die Augen schloss.
Es war ein sehr langer Abschied gewesen; sie hatten an vielen Tagen über Gott und die Welt geredet, hatten all das nachgeholt, was sie innerhalb ihrer Ehezeit nicht hatten machen können, bereden können, besprechen wollten, weil sie sich füreinander nicht die Zeit gelassen hatten, die nun, wo alle beide die gemeinsamen Stunden schwinden sahen, so kostbar geworden war. Sie wuchsen aneinander und Alfred konnte so ein Großteil seiner Trauer vorweg gemeinsam mit Lilo abarbeiten, wie es im Neudeutsch heißt.
Es war eine kleine Trauergemeinde auf dem Friedhof gewesen, aber die Sonne hatte hell und freundlich auf die wenigen Kränze geleuchtet und der Pastor hatte wie besprochen seine Sargpredigt kurz gehalten.
Alfred hatte dann Lilos Wohnung aufgelöst, ihre Sachen zur Diakonie gebracht und weiterhin einmal wöchentlich eine Sitzung der AA geleitet. Ansonsten hatte er die Literatur für sich entdeckt und las und las und las. Nicht nur die modernen Sachen von Siegfried Lenz und Juli Zeh, die in der Zeitung angepriesen wurden oder im Feuilleton als besonders lesenswert besprochen wurden, sondern auch die Klassiker, die er bisher zu lesen versäumt hatte, von Dickens und Jean Paul bis zu Hemingway und Mark Twain.
Für ihn tat sich sozusagen eine neue Welt auf und er erlebte eine Art von Weite, die er sich nie hatte vorstellen können. In der Schule war das Fach Deutsch immer mit dem mürrischen Ton des Lehrers verbunden gewesen, der ihm einfach zu trocken nur von Hölderlin und Goethe hatte reden wollen. Jetzt suchte er sogar in den Kursen der Volkshochschule nach Vorträgen über literarische Themen, moderne amerikanische Romane oder eine ganze Reihe über die Bronte-schwestern, er kam auch in Berührung mit Philosophen, aber Nietzsche oder Herder waren ihm dann doch etwas zu hoch, zu schwer oder wie Alfred es verstand, einfach zu langweilig. Dann schon lieber Fontane oder Kästner, da spürte man so richtig das Leben.
Alfred schaute auch jetzt das Fernsehprogramm ganz anders an, er suchte mit Bedacht nach Spielfilmen, besonders von ausländischen Regisseuren. Leider musste er feststellen, dass die allermeisten Filme im Fernsehen Kriminalfilme waren; er nahm einmal das TV-Programm einer Woche und zählte allein im ZDF dreiundsiebzig Krimis, die Vorabendserien mitgerechnet. Als er diese Auswertung einer Woche Fernsehen bei Onkel Würde erzählte, meinte dieser:
»Ich würde mal so sagen, dass die allermeisten Menschen, die vor dem Fernseher sitzen, sich nur unterhalten lassen wollen. Die wollen nicht mehr schwere Dinge denken oder ihr Köpfchen anstrengen müssen, die wollen sich nur noch berieseln lassen nach der Arbeit. Ich würde sogar so weit gehen, dass unsere Unterhaltungsbranche sicher ein gutes Werk tut, sie gibt den Arbeitern von Kopf und Hand eine Ruhepause, eine verdiente, würde ich sagen. Die Füße hoch und eine warme Suppe im Bauch und dann ein gut gespielter Mord, was will man noch mehr.«
»Aber vergiss nicht den Sport,« sagte Tante Irmi, »du weißt, besonders Tennis, die Männerduelle, ich liebe das Wimbledon wie sonst nichts auf der Welt.«
Ja ja, ich würde dir deinen heiß geliebten Sport ja lassen, auch wenn ich Fernsehdirektor wäre, sagte Onkel Würde. Aber ich würde doch auch versuchen, zumindest einmal jeden Tag, dem Publikum etwas von Bildung und Wissen zu vermitteln, ich würde etwas für die Jugend tun wollen, nicht immer nur Mord und Totschlag oder Politik.
Diese Politiker reden und reden und labern doch nur, warf Alfred ein, sie reden immer dasselbe und sagen dabei gar nichts.
Aber ich würde meinen, die machen doch das, wofür wir sie gewählt haben. Die halten doch ihren Kopf hin, wenn es schwierig wird und müssen dann gehen.
Aber dafür erhalten sie eine ganz gute Pension, nicht wahr?
Alfred war sauer auf die Politiker. Er hatte seinerzeit versucht, für ein paar Obdachlose in seiner Gemeinde richtige feste Wohnplätze in einem Altbau, der abgerissen werden sollte, zu erhalten und hatte deshalb mit einigen der zuständigen Menschen vom Magistrat und im Landratsamt und in den Parteibüros zu reden versucht, aber es war vergebens gewesen. Denn Obdachlose waren zwar für den Normalbürger ein Graus, wenn der sie des Nachts in den Eingängen von Geschäften liegen sah oder unter einer Brücke, besonders in den langen Wintermonaten, aber das Problem zu lösen, das war viel zu teuer; und außerdem, die meisten von denen haben keine festen Wohnort, die sind ja als Wähler nicht registriert und zudem eine insgesamt so kleine Gruppe, die kann man als Politiker vernachlässigen, die protestieren nur ganz selten und machen äußerst wenig Schwierigkeiten. Für diese Armen Worte und bei bestimmten Feiertagen denen eine Mahlzeit aufzutischen, das kommt bei den richtigen Wählern gut an. Aber sonst? Das lohnt sich nicht, sich darum wirklich zu kümmern; das war der Eindruck, den Alfred insgesamt von den Politikern nach seinen Bittgängen bekommen hatte.
Also machte er das, was ihm seine Möglichkeiten boten: er unternahm mit seinen Freunden und den vielen, die wie er zu den AAs gehörten, über Telefon und E-mail die Suche nach geeigneten Möglichkeiten, die Obdachlosen unterzubringen, Woche für Woche. Es war anfangs etwas zäh, aber dann kamen doch die Erfolge. Denn viele der ehemaligen Alkoholiker kannten das Leben ohne Wohnsitz aus eigenem Wissen und Erleben. Und es war wirklich so, das hatte Alfred immer wieder erleben müssen, wer selber im Dreck hatte sitzen müssen, der half auch schneller und vor allem effektiver anderen, auch aus dem Dreck herauszukommen. Wer aber immer nur an sauberer Tafel gegessen hatte, der tat sich ziemlich schwer mit dem Gut-Mensch-Sein bei all denen, denen man ihre Armut schon an der Kleidung ansehen konnte.
Susanne setzte sich ans Fenster und legte ihre Füße auf den Besuchersessel. Wenn Henry das sehen könnte! Aber irgendwie tat sie das ja für Henry auch mit, sie hatte die kleine gemütliche Wohnung gründlich gesäubert, denn zum Wochenende erwartete sie Besuch, hohen Besuch. Der uralte Freund von Henry, Richard der Vierte, wie sie ihn wegen seiner Liebe für Shakespeare nannten, ein langjähriger Studienfreund von Henry, kam aus England zu Besuch. Er wollte einen Kongressbesuch in Hamburg verbinden mit einem anschließenden Kurzurlaub bei ihnen und auch Henry in der Klinik besuchen. Zwar würde auch er nichts ändern können an Henrys Zustand. Da konnte man nur abwarten und hoffen, dass irgendwann das Hirn von Henry wieder so richtig lebendig wurde und ihn erwachen ließ, aber Richard war es seinem alten Freund schuldig, dass er sich um ihn kümmerte, zumal dann, wenn er doch schon einmal in seiner Nähe war.
So hatte Susanne also jetzt die Wohnung, wie man so sagt, auf Vordermann gebracht, und sie fühlte sich entsprechend erschöpft und dachte voll Mitleid und auch Ehrfurcht an die Damen der Reinigungsfirmen, die so etwas jeden Tag machten und das als Beruf ausübten. Anderen den Dreck wegmachen, das wäre für Susanne einfach nicht genug gewesen. Wie ihr Vater nicht müde wurde zu erzählen, hatten alle Büroangestellten früher selbst ihren Arbeitsplatz reinigen müssen. Früher, ja, da gab es in den sogenannten gutbürgerlichen Familien auch noch viele Angestellte und Bedienstete, da gab es in den Villen der besser betuchten die Köchin samt Beiköchin, den Diener oder auch die Lohndiener, eine Zofe für die Gnädigste und ein Fräulein für die Kinder; das war entweder ein Kindermädchen, das solange dort bei der Familie blieb, bis entweder die Kinder mit der Schule fertig waren oder ein junger Mann sie wegheiratete, ein Geselle etwa aus einem der Geschäfte in der Straße, oder ein Schornsteinfeger oder ein lächelnder junger Kerl aus einem der vielen Handwerksbetriebe, auf jeden Fall oft einer, der sein Glück machen wollte; und wenn er fleißig war und der Verdienst genügte, dann gab es Kinder und genug Wohnraum und im Laufe der Jahre auch genügend Geld zum Leben und für Kleider und Schuhe und Hüte.
*
Susanne lächelte und seufzte zugleich. Das war schon etwas; selbst ihre eigene Mutter war bei Hüten immer schwach geworden. Und wenn sie so überlegte, diese Zeit früher, als sie selbst noch Schulmädchen gewesen war. Da hatten die meisten Männer noch Hüte getragen. Und in den alten Wochenschauen und Kinofilmen bis in die neuzehnhundertachtziger Jahre hinein, da trugen die meisten der männlichen Darsteller noch Hüte. Und heute?
Die jungen Männer trugen, wenn sie überhaupt noch etwas auf ihren Köpfen duldeten, weil entweder die Frisuren so gegelt waren, dass sie wie Kunstwerke in der Sonne glitzerten, oder der gesamte Schädel wurde kahlrasiert und nur mit vereinzelten kleinen Tätowierungen geziert oder man ließ seine Haare zu Rasterlocken drehen. Die ganz Trägen ließen sie einfach so wachsen wie sie wollten, und als Schmuck und Zierde oder Ausdruck einer bestimmten Lebensart wurden diese bunten Kappen aus den USA übernommen, oft mit Reklameaufdruck an der Front und so liefen die Jungen für alle möglichen Firmen oder Klubs als kostenlose Werbung herum. Gewiss, alte Männer trugen gelegentlich einen Hut, man sah auch gelegentlich Schiebermützen oder zumindest hier an der See die Elbsegler und dunkelblauen Arbeitsmützen der Werftarbeiter, hin und wieder auch eine grüne Schirmmütze, wie sie in der Landwirtschaft oder bei Waldarbeitern getragen wurden.
Die Damen trugen nur selten noch Hüte, zum Fasching natürlich, oder bei Hochzeiten, in weiß und cremefarben; auf dem Friedhof in schwarz, ansonsten gelegentlich trug man als Frau oder Mädchen eine Baskenmütze, natürlich schräg und in grün oder rot, aber beliebt waren auch bunte Tücher. Nicht so kunstvoll um den Kopf und Hals geschlungen wie früher zu Susannes Schulzeit noch, wobei Audrey Hepburn als Vorbild diente, sondern mehr locker und fließend, zumindest die bürgerlichen Mädchen und Jugendliche wollten nicht mit den muslimischen Frauen verwechselt werden. Die etwas älteren Frauen hingegen bevorzugten eine Kapuze am Mantel oder Anorak und trugen ihr Haar eher offen und halblang, mit genügend Spray in der vom Friseur mit kundiger Hand geordneten Wellen nun fixiert und oft starr wie Beton. Bei den unabhängigen Damen oder den zumindest so erscheinen wollenden ließen diese ihre Haare oft einfach wachsen und flattern, aber häufig war doch offensichtlich auch eine Menge Chemie mit im Spiel, im Haar, denn der Alterungsprozess setzte bei allen ein, auch bei ganz linken, ganz rechten oder einfach auch bei den Unangepassten, den aufmüpfigen Frauen, und davon gab es immer mehr. Von vielen als Feministinnen erst beschimpft, dann beachtet und zuletzt auch gefürchtet waren im Laufe der Jahre auch die Frauen immer innerlich freier geworden. Ja, es hatte sich sogar herausgestellt und war von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt worden, dass Frauen oft vieles gleichzeitig tun, denken und planen konnten, die Multifunktionalität eben. Bei Männern war es oft nur die Alltagsroutine, in der sie eingeübt waren und daher oft scheinbar schneller sein konnten als Frauen und so die besserbezahlten Posten in Büro und Betrieb erhielten. Man munkelte aber, und das nicht nur unter der Hand, dass so mancher Mann nur deshalb auf seinem jeweiligen Posten saß, weil sein Vorgesetzter oder der Inhaber des Betriebes selbst als Mann zu viele Ängste vor den Frauen oder der viel gepriesenen Frauenpower hatte und sich daher als Verbündeten einen Mann oder viele Männer als Hilfe geholt habe.
Auch sehr typisch für unsere Zeit, dachte Susanne, dieses Wort Frauenpower. Diese mitunter auch merkwürdige Mischung aus englisch und deutsch, das Denglische in der Umgangssprache hatte deutlich zugenommen und fiel niemandem mehr auf. Besonders in Büros bei denjenigen Firmen, die auch viel mit ausländischen Partnern zu tun hatten, war die Mischung von englischen Anhängseln an deutsche Worte sehr beliebt, allüberall wurde gedenglischt:
Sommer-sale, Theater-event, Businesskleidung, er wurde outgesourced, meine To-Do-Liste, man sollte es ganz easy handlen, ich bin so geflashed heute, hast du auch an der Challenge teilgenommen ….
*
Über dem Land lag ein heller Nebel. Die hohe Luftfeuchtigkeit schlug sich an Regenrinnen, Autofenstern, Papierkörben und auf den wärmenden Mützen von vorüber eilenden Fußgängern nieder. Burckhard fegte unentwegt die Einfahrt und sammelte das Papier, meist weggeworfene Taschentücher und geleerte Kaffee–to-go-becher, in den letzten Wochen auch zunehmend Coronaschutzmasken mit abgerissenen Bändern, er schaufelte diesen Abfall in die Mülltonne. Früher hatte man auf den Strassen und Wegen nur selten jemanden gesehen, der ein Getränk in einer Flasche oder Pappkarton mit sich führte, auch in der Schule war es nicht üblich, dass die Schulkinder ihre Getränke auf den Pulten stehen hatten; da gab es höchstens in der großen Pause eine Milch oder einen Kakao in kleinen Gläsern beim Hausmeister zu kaufen und nicht alle konnten sich das leisten. Heute hatten viele, die in der Stadt herumliefen, in der einen Hand ihr Handy, in der anderen einen Kaffeebecher oder eine Flasche mit einem Smoothie oder Saft oder sonst einem Getränk. Als ob sie nie genug bekommen würden, wie in den Restaurants oder Lokalen, wenn man dort die Kundschaft beobachtete, dann gab es viele, die mit vollem Mund kauend schon den nächsten vollen Löffel oder die gefüllte Gabel essbereit in der Hand hielten. So als ob sie Angst hätten, nicht genug zu bekommen oder sich zu wenig Zeit zum Genießen lassen durften. Einfach nur gierig, dachte Burckhard. Ja, diese Gesellschaft ist hektisch und voll von Gierigen geworden, alle hatten Sorgen und Ängste, sie könnten nicht genug von allem abbekommen, sie müssen höllisch aufpassen, um nur nicht zu kurz zu kommen. Keiner gönnte dem anderen sein kleines bisschen Mehr; was ist schon das große Glück des anderen gegen das eigenen kleine Glück!?
Man will es aber dem mal so richtig gezeigt haben, und doch: dieses eine an Mehr zu haben als der Nachbar, ja, es war eine Ellbogengesellschaft, geizig und gierig, fast wie in den alten Märchen, wo mit Hilfe eines bösen Geistes der eine immer mächtiger werden wollte.
Und daneben gab es die anderen, die Samariter, die den Hilfsbedürftigen unterstützten, bei Naturkatastrophen oder Autounfällen, bei Kriegshandlungen oder wenn der Blitz eingeschlagen war und doch das Nachbarhaus getroffen hatte. Dann war die Hilfsbereitschaft groß. Wenn Dämme brachen oder Flüsse über die Ufer traten und die ganze Welt im Regen versank oder ein Erdbeben Geröllmassen durch einen Ort schob, dann zeigte sich die andere Seite vom Menschen, da wurden sie hilfsbereiter, und tatkräftiger, da wurden religiöse oder politische Überzeugungen zur Nebensache, da wurde dem Mitmenschen geholfen. Schließlich konnte man selber in eine solche Lage oder Situation kommen und würde dann ebenfalls auf Hilfe angewiesen sein.
Burckhard stützte sich auf seinen Besen und drehte sich eine neue Zigarette. Er schaute der eleganten Dame nach, die im schweren dunkelblauen Mantel über die Kreuzung schritt. Ja, sie ging nicht einfach so, sie schritt, als lauere hinter der nächsten Hausfassade schon ein Reporter mit Blitzlicht und wartete nur auf einen Fehltritt von ihr. Burckhard genoss seine Tagträume sehr, er las auch jede Woche all die bunten Illustrierten, die Kunden achtlos liegen ließen oder in den Papierkorb geworfen hatten. Er mochte seine Arbeit sehr, er war zwar nur ein kleiner Parkwächter und musste bei Problemen mit Einlass oder Ausfahrten die automatische Schranke am Parkhaus warten, war ansonsten für die Reinigung von Papierkörben, Fahrstuhl, vom gesamten Areal zuständig und wohnte ganz in der Nähe. Er war sehr froh, sein Auskommen zu haben mit einem solchen Arbeitsverhältnis; den guten Freunden am Stammtisch in seiner Kneipe gleich um die Ecke hatte er damals noch gesagt, er sei einer der fröhlichsten Menschen in der Stadt, seit er nach langer Arbeitslosigkeit diesen Job habe, denn er sei zwar angestellt, aber sein Chef käme nur alle paar Wochen vorbei und ließe ihn schalten und walten, er sei fast sein eigenen Herr und der einzige, der alle Schlüssel habe. Die Menschen dort, die Kunden, seien meist sehr freundlich und höflich, denn er versorge sie ja mit dem, was sie am Allernötigsten bräuchten, nämlich einen Platz zum Abstellen ihrer oft teuren Wagen. Natürlich machte er sich so seine Gedanken, wenn er mitbekam, wie einer der Männer, meist im feinen Anzug, sein Auto besser behandelte als seine weibliche Begleiterin. Dies bestätigte ihn in seiner eigenen Meinung, weiterhin Junggeselle bleiben zu wollen.
Dann hat man weniger Schwierigkeiten und mehr von seinem Geld! War sein Spruch am Stammtisch, und außerdem, in meinem Alter, da ist das mit dem Sex auch nicht mehr so wichtig. Da geht es doch eher darum, dass die Wohnung warm ist und es nicht mehr zieht, dass genügend zu essen da ist und auch ein gelegentlicher Weinbrand nicht verübelt wird.
Und wenn er im Sommer mit lockerem bunten Hawaiihemd in seinem leichten Campingstühlchen vor der Schranke saß und die Grüße der Vorübergehenden freundlich entgegennahm, wurde er von kichernden Jugendlichen oft als eine Art Talisman betrachtet; die fragten dann solche Sachen wie:
»Wissen Sie nicht, wo man hier am besten noch was trinken kann?«
und wenn die meist grinsenden Halbwüchsigen dann davon schlenderten und sich immer wieder nach ihm umschauten und halblaut sicher etwas Witziges oder Lächerliches über ihn flüsterten, dann winkte Burckhard ihnen fröhlich nach. Er fühlte sich dann bemerkt und beachtet und das war oft mehr, als er bei anderen Kunden im Laufe des Jahres so zu sehen bekam.
Diese Frau im dunkelblauen warmen Mantel, die gerade um die Ecke bog und dann die Strasse überquerte, die kannte er. Oft schon hatte er sie gesehen, aber noch nie war sie ihm so elegant erschienen, dieser Mantel, er sah aus wie neu, dazu die blauen Stiefeletten, eine dunkelbraune ziemlich große Umhängetasche, vermutlich aus Leder oder Kunstleder unter dem Arm, und sie ging sehr schnell, ihr Haar flog fast, obwohl es windstill war. Burckhard kannte sie seit Jahren, nur vom Sehen, meist trug sie einen hellen Anorak und Jeans oder im Sommer ein leichtes buntes T-shirt. Wenn sie direkt an seinem Arbeitsplatz vorbei kam, dann grüßte sie mit einem Lächeln. Aber seit der Pandemie trug sie diese grünen Mund-Nasen-Masken wie fast alle, er selber auch; diese weißen FFP2-masken waren ihm zu dicht, darunter konnte er kaum Luft bekommen. Anfangs hatten viele ja selbstgefertigte Masken getragen, manche sahen aus wie Viehräuber in den Westernfilmen, andere wie früher die Bankräuber; es hatte sich im Laufe der Monate herausgestellt, dass die meisten diese grünen OP-masken bevorzugten, denn die waren lockerer und man bekam besser Luft.
Inzwischen waren die Vorschriften gelockert und nur in einigen Schulen je nach Inzidenzgrad oder Anzahl der infizierten Schüler und/oder Lehrer trugen die Schüler Masken oder eben nicht mehr. In der Zeitung wurde jeden Tag die Anzahl der Neuinfizierten angezeigt und auf das Impfen hingewiesen.
Burckhard hatte sich auch impfen lassen, zweimal schon, er wollte auf keinen Fall an dieser plötzlich einsetzenden Lungenkrankheit leiden und dann, wie er es bei seinem Kollegen Andreas gesehen hatte, als körperliches Wrack zurück aus der Klinik kommen. Dieser Andreas konnte kaum noch etwas machen, er schlurfte nur ein paar Schritte von der Wohnung zum Kanal und zu einer Bank; dort saß er dann ein paar Stunden und schöpfte Kraft, bis er sich wieder soweit stark fühlte, dass er zurück in seine Wohnung gehen konnte. Es war erbärmlich, Burckhard besuchte ihn hin und wieder und brachte ihm Obstkuchen, den Andreas dann mümmelte. Früher war er ziemlich stark gewesen und konnte fünf volle Bierkästen stemmen, jetzt war es damit vorbei. Er war nur ein Schatten seiner selbst.