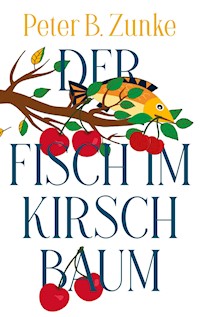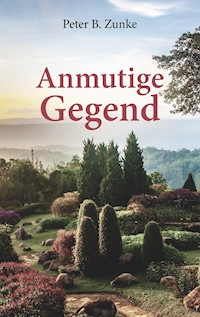
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erst brennt in Harmshausen die kleine Pension von Werner Schubert, dann wird ein Zuchthengst nachts auf der Weide abgeschlachtet. In der Gaststube der Dorfkneipe prallen die Meinungen der Bauern aufeinander. Zumal sich alle auf das große Hauptmannsfest vorbereiten. Unter den Dächern der Fachwerkhäuser breiten sich Neid und Habgier, Liebe und Lust, Angst und Sehnen weiter aus, als so mancher gedacht. In diesem Mikrokosmos in der Heide spiegelt sich das weite gesellschaftliche Spektrum des Landes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Schubert frühstückte im Souterrain, als die ersten Flammen oben im vorderen Gästezimmer die Gardinen erreichten und dann rasend emporzüngelten, wild und ungezwungen, wie entfesselt alles ergriffen, was vorhanden war: die frische Tapete, die beiden alten Ölbilder, den abgewetzten Perserteppich, das schon etwas morsche ausgetrocknete Fensterbrett, von dort aus das verdörrte Rosenspalier; schließlich brannte auch der Dachstuhl und die ersten rotbraunen Dachpfannen fielen auf den Hof.
Werner las den Landesteil der Ortszeitung und blätterte weiter zu den Todesanzeigen, dann erst roch er den Rauch. Er schaute hoch, vor dem Fenster schlug eine Dachschindel in dem kleinen Beet auf und zerbarst. Er stand langsam auf, ging wie im Traum zur Hoftür und öffnete. Das Tal lag friedlich da, die abgegrasten Pferdeweiden mit den windschiefen Heuschuppen, den maschendrahtgezäunten Pferchen unter dem hellen grauweißen Himmel. Ein Knistern, ein leises Krachen, da erst spürte er die Hitze und eilte auf den Hof, schaute sich um zum Haus und sah die lodernden Flammen gierig alles verschlingen, was er und Lena sich in den letzten Jahren aufgebaut hatten.
Er schüttelte hilflos den Kopf, dann nahm er sein Handy und wählte die 112. Die zentrale Meldestelle für Notdienste und Feuerwehr in Lüneburg meldete sich und Werner, mit trockener Kehle, sagte nach kurzem Räuspern:
»Hier spricht Werner Schubert, ich bin in Harmshausen, im oberen Harmshausen, es brennt, mein Haus, Waldweg Nummer drei.«
Er schaltete das Handy aus und ließ sich zu Boden sinken, schaute dem Feuer zu, ganz fasziniert von der Vielfalt der Flammen, die gelegentlich auch blau oder grün aufleuchteten. Werner hatte im Chemieunterricht in der Schule nie besonders aufgepasst, aber er wusste, dass verschiedene Substanzen mit verschiedenen Flammenfarben verbrannten. Er wollte nicht herumrätseln, was nun gerade bei ihm verbrannte, er konnte auch nichts tun, er schaute nur zu, wie sich die hohe schwarze Qualmsäule in die Luft erhob.
Sein Haus. Lenas Pension. Lenas Traum.
Als ihre Tante Martha verstarb und Lena das Häuschen vererbt hatte, war diese gleich Feuer und Flamme, – Flamme, das war es also, gleich zu Anfang schon war die Flamme da, oder nicht? – Lena auf jeden Fall wollte sofort in das gemütliche kleine Haus einziehen, es lag im Oberen Harmshausen im Waldweg, und es war groß genug für Lenas mutige Pläne, sie wollte unbedingt aus Tante Marthas Haus eine Pension machen.
»Weißt du,« hatte sie Werner erklärt, »das Haus liegt doch ideal: oben am Tal, mit Blick über die Pferdewiesen, sanfte Hügel, dann links der große Wald mit den breiten Sandwegen zum Wandern, der Rundweg über Karkenfelde und Vosshagen führt an den Gasthäusern vorbei, die Autobahn ist in der Nähe, also das ideale Naherholungsgebiet, und zumal am Wochenende kommen viele in die Natur, und wenn wir dort eine Pension haben, nur mit Frühstück, keine große Küche, das wird laufen, du wirst schon sehen, dann haben wir fürs Erste ausgesorgt. Dann brauchen wir uns nicht mehr wie früher auf der Arbeit um Container oder Handtaschen zu kümmern, wir haben immer neue Gäste, lernen also immer wieder neue Menschen kennen, es wird nicht langweilig, und dann sind ja auch noch die Dörfler da. Du kennst doch schon ein paar vom letzten Schützenfest. Und wir können endlich aus dieser nassen Wohnung raus und der Meier, der miese Vermieter, der nie etwas an den Wänden macht, der kann uns mal! Wir sind endlich unsere eigenen Herren und können tun und lassen, was wir wollen.«
Und so waren sie mit Sack und Pack in die Heide gezogen in das kleine aber gemütliche Haus, sie hatten gründlich renoviert und im ersten Stock vier Gästezimmer ausgebaut und oben unter dem Dach noch eine Art Atelier, mit Dusche und kleinem Balkon. Im Souterrain wurde die Küche mit Esszimmer eingerichtet und auch ihre eigenen beiden Zimmer, etwas kleiner als in der Stadt, aber schnuckelig, wie Lena es jedem Besucher erklärte.
Anfangs war vieles ungewohnt für Werner, zumal sie das Frühstück gemeinsam mit den jeweiligen Hausgästen einnehmen mussten. Er war nämlich eigentlich ein Morgenmuffel, jetzt aber sollte er schon früh lächeln und nett sein, nun denn, für Lena tat er ja fast alles.
Und sie hatte recht behalten, es kamen erst zögernd, dann immer öfter die Gäste, viele hatten ihre Pferde bei den Bauern untergebracht und waren nur am Wochenende da, manche kamen Freitags und fuhren Montag ganz früh wieder ab, das wurden häufig Stammgäste; es kamen aber auch Besucher von Pferdebesitzern, oft Verwandte oder Kinder.
Sehr häufig meldeten sich Mädchen an, auch ohne ihre Eltern, so ab zwölf, die waren richtige Pferdenarren, manche kamen die ganzen Ferien, Herbst und Sommer und Ostern, das war Lena sehr recht, da brauchte sie nicht so viel Bettwäsche zu wechseln. Werner kümmerte sich um kleinere Reparaturen, machte die Buchhaltung und gemeinsam fuhren sie zum Einkaufen nach Haidwitz in den Supermarkt.
Mit großem Getöse brach der Dachstuhl unter dem Gewicht der Ziegel zusammen, zerschlug mit die Bodendielen des ersten Stockes und sauste mit den zerbrochenen Resten ins Erdgeschoss. Der heftige Knall und die zerrenden Geräusche der Zersplitterung, das helle hohe Kreischen der Rohrleitungen und das Zirren der Drähte rissen Werner Schubert hoch. Ringsumher in der Luft schwirrten glühende Holzteilchen, Reste von brennbaren Stoffen und Mauerstückchen, wie dichte Schwärme von Glühwürmchen schimmerten Tausende durch das Sonnenlicht, ein Teil versengte Werners kariertes Hemd. Er merkte es nicht.
Nur gut, dass sein Auto in der Werkstatt war, der Anlasser war kaputt. Hier auf dem platten Lande war er auf den Wagen angewiesen, wenn er einkaufen wollte oder zum Arzt musste oder Besucher von der kleinen Bahnstation abholen sollte.
Er hörte jetzt die Sirene der Feuerwehr, lange bevor der rote Wagen die staubige Strasse entlang kam und in der Einfahrt bremste.
Achim Knesebeck stieg aus dem Führerhaus, den blauen Rock und den schweren Helm hatte er auf, aber seine grünen Drillichhosen zeigten, dass er vom Feld gekommen war.
»Das ist aber mal ein schönes Feuer, au weih, au weih!« grüßte er und gab Werner die Hand.
»Meine Jungs kommen gleich, sind schon an der Arbeit, sie haben da hinten am Hasenacker schon den Anschluss gefunden. Wie gut, dass Blohms Fidi seine Beregnung ausgebaut hat, sonst hätten wir hier kein Wasser. Aber wir sollten uns noch ein wenig gedulden, die Männer brauchen ihre Zeit, es soll ja auch alles richtig gemacht werden. Und wundere dich nicht, dass es nicht so viele sind, die meisten sind jetzt im Frühling auf den Feldern, jetzt ist ja die Zeit für Zuckerrüben und Kartoffeln, aber das weißt du ja sicher.«
Am Straßenrand rollten die anderen Männer der freiwilligen Feuerwehr vom Anschlussstutzen am Feldrand bis zu Werners brennender Pension die Schläuche aus, sortierten die verschiedenen Spritzen und legten alle Gerätschaften bereit, dann meldeten sie ihrem Führer Knesebeck »Klar an den Rohren«
Werner fand seine Stimme wieder.
»Wenn ihr vor allem das Souterrain retten könnt, da sind alle Papiere und Unterlagen.«
»Das lass man deine geringste Sorge sein.«
Achim klopfte ihm beruhigend auf die Schulter.
»Wir setzen alles unter Wasser, und wenn dann alles wieder trocken ist, dann kannst du jedes Blatt Papier wieder nutzen, das ist dann wie neu. Und was dann weg ist, dafür gibt es ja die Behörden, und bei so einem Brandschaden, da sind die sehr kulant, da wird es auch nicht so teuer, wenn du einen neuen Ausweis brauchst. Oder so. Und versichert bist du ja, oder?«
» Na klar. Ich bin gegen Brand versichert.«
»Und wo hat das Feuer angefangen?«
»Das Feuer? Ich weiß nicht. Ich war noch unten beim Frühstück, als es losging. Ich roch erst den Rauch und bin dann raus in den Hof und da hab ich die ganze Bescherung gesehen.«
» Jaja, ist schon eindrucksvoll, so ein Feuer.«
»Und warum legt ihr nicht gleich los, ich meine, die Leitungen liegen doch schon, eure Leute haben doch schon die Schläuche ausgerollt und die Spritzen hingelegt.«
»Aber sie müssen sie erst richtig anschließen. Und dann, das weißt du vielleicht gar nicht, wenn so ein Haus abbrennt und zwar total, also bis runter in den Keller, dann zahlt die Versicherung alles, also den ganzen Neubau. Wenn aber das Haus nur halb abgebrannt ist, dann zahlen die auch nur die Hälfte, also nur den Wiederaufbau. Auch wenn man alles abreißen muss, um wieder ein ordentliches Haus zu haben.«
»Also, nein, das habe ich nicht gewusst.«
»Eben. Das wissen die wenigsten, und daher, wenn du einverstanden bist, dann fangen wir erst an zu löschen, wenn der Vollbrand die Grundmauern erreicht hat. Dann kannst du nämlich das gesamte Geld bekommen und dir einen schönen Neubau hinstellen.«
»Also gut. Wenn das so üblich ist.«
Ein neues Auto kam und hielt hinter dem Feuerwehrauto; als der Fahrer ausstieg, zeigte Achim Knesebeck auf ihn und sagte zu Werner:
»Da kommt unser Dorfsheriff, der Erich. Der muss sich auch erst mal ein Bild machen. Schließlich muss er doch alles wissen, was sich so im Dorf tut, oder?«
Als der hochgewaschene etwa fünfzigjährige Polizist in seiner Uniform bei ihnen angekommen war, stellte Achim ihn vor:
»Das hier ist Erich Möller, unser Hüter des Gesetzes, und das hier ist der nicht mehr so stolze Besitzer der Brandstelle, Werner Schubert.«
Die beiden Männer reichten sich die Hände und der Polizist meinte, dass er Werner vom Sehen her schon kenne, vor allem aber habe er seine Frau Lena gekannt.
»Wir haben uns öfters beim Bäcker Lange in Karkenfelde getroffen, wissen Sie, da hat sie oft bei einer Tasse Kaffee gesessen und mit Heide Meiners geplaudert. Schade, dass sie nicht mehr da ist.«
Werner konnte nur nicken. Seine Kehle war auf einmal ganz trocken. Mit der Heide Meiners waren sie gut befreundet gewesen und auch heute noch war sie ihm eine gute und treue Freundin. Da standen die drei Männer und schauten auf das Feuer, das eine hohe dunkle Qualmwolke in die klare Luft sandte.
»Wir machen einen kontrollierten Vollbrand,« sagte Achim, »alles nur wegen der Versicherung.«
Erich Möller nickte. Er kannte so etwas, aber noch besser kannte er den sogenannten »warmen Abriss«, den machten mitunter Landwirte, die in finanziellen Schwierigkeiten steckten und dringend Geld brauchten. Aber meist kam so etwas ans Licht und dann gab es weder Geld von der Versicherung noch eine andere Anerkennung, sondern zusätzlich eine Strafe vom Gericht, und wenn diese dann auch noch in einer Geldbuße bestand, kam es häufig zu einer Zwangsversteigerung, und da hielten sich die Gläubiger dann schadlos und so mancher Bauer konnte auf diese Weise seinen Hof deutlich vergrößern.
Die anderen Männer der Freiwilligen Feuerwehr kamen dann auch dazu, die meisten hatten nur den dunklen Helm auf und trugen noch die üblichen Kleider ihrer alltäglichen Arbeit, Drillichhosen mit großen Taschen und weite karierte Hemden; sie hatten alle Schläuche verlegt und die Spritzen griffbereit. Jetzt warteten sie, bis Achim Knesebeck das Zeichen gab.
Unter der Wasserflut aus den beiden Rohren der Feuerwehr brachen die Flammen bald zusammen. Schon gegen Mittag waren auch die letzten Glutnester gelöscht und die Wehr zog wieder ab, nicht ohne Werners Versprechen, am Abend im Dorfgasthof einen auszugeben.
Wie der erfahrene Gutachter der Versicherung, der eine Woche später die Brandruine begutachtete, dann feststellte, war der Brand durch ein verschmortes Kabel in einer Verteilerdose im vorderen Gästezimmer der ersten Etage ausgelöst worden. Die Versicherung zahlte dann zügig und anstandslos, aber Werner war sich noch unschlüssig, ob er das Haus wieder aufbauen sollte oder nicht.
***
Sie hatte genug gesehen. Lissie stellte das Fernrohr auf die Fensterbank und schlurfte in die kleine Küche. Sie setzte sich an den Tisch mit der Wachstuchdecke und goss sich Kaffee nach. Irgendetwas störte sie. Sie hatte draußen eine Sache oder ein Ding oder einen Menschen gesehen, der war dort, wo er nicht hatte sein sollen. Oder dürfen. Und er benahm sich so, so heimlich. Sie trank nachdenklich. Da war der abgebrannte Hof von dem Schubert, nein, die ausgeräucherte Pension, so hatte er es genannt. Pension. Das klang doch so nobel und vornehm und solide. Dabei wusste jeder hier im Dorf, dass Marthas altes Haus vormals zum Hakenhof gehört hatte und nur wegen der Steuerschulden damals an die Martha verkauft worden war. Und dann hatten die Erben nicht lange warten können, als Martha gestorben war, und hatten rasch eine Pension daraus gemacht. Das brachte auch wieder nur neue Fremde ins Dorf. Der Einzige, der sich gefreut hatte, war Herbert gewesen, Herbert Buthmann, der Kröger vom Dorfkrug. Der verdiente sicher nicht schlecht an den Gästen.
Die meisten der Gäste kamen wegen der Pferde hierher. Seit die übliche Landwirtschaft wegen der hohen Nitratbelastung des Grundwassers und durch die Klimaveränderungen für viele Bauern nicht mehr attraktiv erschien, zumal die Preise für Schweinefleisch oder Getreide in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand mehr standen, hatten viele Landwirte nach Erreichen der Altersgrenze einfach aufgegeben; die Kinder wollten oft andere Berufe ergreifen, die mehr Einkommen versprachen und weniger körperlich anstrengend waren, was ja heutzutage fast verrückt erschien, denn wie viele der im Büro Tätigen ergriffen in ihrer Freizeit schwere Hanteln oder andere Körpertrainer in den sogenannten Fitness-studios, übten für den Marathon in ihrer Stadt oder rannten sich die Seele aus dem Leib in städtischen Parkanlagen, bis der Schweiß die Augen verklebte, also alles Aktivitäten, die ein Bauer jeden Tag in seinem Arbeitsprogramm erlebte. Diese Vorstellung allerdings, am Feierabend mit verschwitztem Hemd und dreckigen Händen ins Haus zu kommen, war den meisten unangenehm, sie wollten lieber in einem klimatisierten Büro sitzen und sich nicht häufig herumärgern müssen mit einer oft nachts leckenden Beregnungsanlage, zerrissenen Weidezäunen oder zu trockenen oder zu nassen Ackerböden; kurz gesagt, sie wollten nicht von Dingen abhängig sein, die sie nicht beeinflussen konnten, wie es das Wetter nun einmal ist. Dass sie sich statt dessen von den Launen einer Konzernleitung oder dem Auf und Ab des Marktes abhängig machten in einer unselbständigen Stellung, das war den meisten nicht bewusst oder auch gleichgültig, denn so erging es doch den meisten Menschen hier und überall. Und so schauten die Bauernkinder schon während der Pubertät sehnsüchtig auf die Städter und deren vermeintlich unendliche Möglichkeiten, und wenn sie dann größer geworden waren, zogen sie vom Dorf weg in die Stadt; wenn die Altvorderen dann wegstarben, wurde häufig das Land verkauft oder verpachtet, in dieser Gegend oft an die große Pferdezucht von Wilkening. So war aus Ackerland dann Wiese geworden oder Pferdeweiden.
Sie konnte schon wieder einen der großen Trecker hören, die Bauern mähten das Gras ab, sie brauchten ja später im Jahr als Zufütterung das Heu, und es gab sogar einige, die sich auf Heu so spezialisiert hatten, dass sie auf ihren Höfen das Heu trockneten und dann in Plastiktüten verpackten, später transportieren dann große Lastwagen die verpackten Behälter in die Städte zu den verschiedenen Tierhandlungen, wo das Gras oder Heu dann als Streu oder Futter für Katzen, Goldhamster oder Meerschweinchen verkauft wurde.
Lissie war nicht traurig darüber, denn eines hatte sich dadurch auch für sie zum Besseren geändert, der intensive Güllegestank, der früher wie dichter Nebel über allen Dörfern gehangen hatte, der war verschwunden. Jetzt gab es nur noch einen großen Schweinemäster in Karkenfelde, den reichen Reinhold Lahmann, und Lissie fand, es reichte auch, bei starkem Südwind konnte selbst sie hier in Harmshausen die intensive Gülle riechen. Nein, sie fand es insgesamt jetzt viel besser eingerichtet, und sie mochte Pferde, diese eleganten Tiere, und nützlich waren sie auch noch. Natürlich hatten alle Gemeinden in der Heide seit Jahren immer mehr Reiterwege anlegen müssen oder wollen, um die zahlenden Touristen und Freizeitsportler zu halten und anzulocken. Nicht zu vernachlässigen waren uralte Traditionen wie in Lohmühlen, wo alljährlich das große Reiterfest mit den hochdotierten und internationalen Turnieren stattfand. Und jetzt im Frühjahr konnte der Blick aus ihrem Fenster auf die weiten grünen geschwungenen Wiesen und Weiden nach dem Grau und Braun des Winters nur hoffnungsfroh und positiv anregend auf sie einwirken.
Lissie Cordes trank den Kaffee aus und wusch die Tasse ab.
Aus ihrem kleinen Küchenfenster konnte sie die Dorfstrasse bis zur Kurve sehen, und so bemerkte sie auch den Mann mit der Schubkarre. Der Werner Schubert. Was der nun wohl wieder macht. Wo sein Hof, nein, seine Pension abgebrannt ist. Erst das mit seiner Frau vor ein paar Jahren, und jetzt sein Heim. Er hatte sich ja in all den Jahren allmählich an die meisten Dorfgewohnheiten angepasst und trug jetzt auch wie fast alle Männer hier die grüne Arbeitsjacke, Drillichhosen und eine grüne Schirmmütze. Aber hatte sie ihn nicht gerade bei seiner Brandstelle gesehen? Das war es, was ihr nicht aus dem Kopf gegangen war. An der zerstörten Pension hatte sich jemand zu schaffen gemacht, und sie hatte den für Werner Schubert gehalten. Aber jener Mann war deutlich kleiner gewesen, oder? Lissie schlurfte zurück ins Wohnzimmer und blickte durch den Feldstecher. Richtig, da war ein Mann an der Brandruine, auch mit grüner Jacke, aber er hatte keine Mütze auf und trug blaue Jeans. Er schaufelte Schutt und Ziegel vorsichtig beiseite, es sah aus, als suche er etwas Bestimmtes.
Lissie ging in den Flur und zog die Gummistiefel an, dann stellte sie sich an den Zaun und wartete auf Werner Schubert, der soeben die kleine Steigung mit der Schubkarre bewältigt hatte und in kurzer Zeit auf Lissies Höhe war.
»Moin ok, Herr Schubert, wo wollen Sie denn hin mit all den Sachen?«
Lissie hatte in der Schubkarre ein Durcheinander von bunten Kisten, Aktenordnern, Wollsachen und Plastiktüten erspäht.
Werner Schubert setzte die Karre ab und wischte sich über die Stirn:
»Moin. Tja, ich muss jetzt wohl oder übel all meine Habseligkeiten sortieren, ich bringe sie in mein Zimmer, ich hab mich bei Buthmann einquartiert, irgendwo muss ich ja schlafen. Und da ist es meist schon recht ruhig. Jetzt muss ich all die Überreste, die ich noch finden kann, sortieren, und zum Ordnen muss ich meine Ruhe haben. Ist auch nicht so einfach, ich hoffe nur, dass es trocken bleibt, wenn auch noch jetzt Regen kommt, dann kann ich nicht mehr weitersuchen. Ich bin nur froh, dass manches vom Löschwasser nicht viel abbekommen hat.«
»Dann passen Sie nur auf, dass Ihnen kein Ziegel auf den Kopf fällt, wenn Sie so allein da in der Ruine herumgraben.«
»Ach, wissen Sie, ich bin da ganz vorsichtig. Und zum Glück hat ja auch die Decke gehalten. Zumindest die nach vorn raus. Hinten sieht alles aus wie nach einem Bombenangriff. Jedenfalls kann ich einigermaßen im Souterrain herumkriechen. Nur der Staub und Dreck, manchmal will ich was wegschmeißen und dann, wenn ich die Schmutzschicht abwische, dann ist das doch noch wichtig. Nur die Wäsche, die ist wohl hin. Und ich sehne mich nach meinem bequemen Bett.«
»Das kann ich gut verstehen, ich kann auch in fremden Betten schlecht einschlafen.«
»Das Bett im Dorfkrug geht aber, vielleicht etwas weich, haben ja sicher schon viele drin gelegen. Ja, es wird wohl eine ganze Weile dauern, bis ich wieder ein eigenes Haus haben kann.«
»Wollen Sie denn alles wieder so aufbauen und dann weitermachen, ich meine mit der Pension und so?«
»Mal sehen, genau weiß ich das noch nicht. Erst mal muss ich abwarten, wann der Bescheid von der Feuerversicherung kommt, wieviel das sein wird, und dann muss ich Pläne machen. Der Horst Hartmann hier, der Architekt, der hat mich vor ein paar Tagen schon gefragt, was ich mir denn so denke, und mal sehen, was der so vorschlägt. Das will alles doch gut überlegt sein, denn noch mal so richtig bauen, also, das werde ich wohl nie wieder. Aber jetzt war genug Pause, Sie entschuldigen, ich muss.«
Und Werner nahm beherzt die Griffe in die Hände und schob die Karre weiter zum Dorfkrug.
Lissie ging wieder ins Haus, stellte die Gummistiefel an ihren Platz im Flur und schaute in der Wohnstube durch das Fernglas zur abgebrannten Pension. Der Mann dort hatte jetzt einen langen Ast, mit dem stocherte er in dem Schutt herum. Sie stellte das 0kular schärfer: Nein, sie kannte ihn nicht. Ein ihr vollkommen unbekannter Mann. Er war nicht aus dem Dorf, auch nicht aus den umliegenden Ortschaften, denn dann hätte sie ihn auf einem der Schützenfeste oder dem großen Erntedankfest mit anschließendem Festbankett sicher schon einmal gesehen. Ein völlig Fremder. Und der schaute sich immer wieder um, als ob er befürchtete, dass Werner Schubert zurückkommen könnte und ihn überraschen würde. Also trieb sich dieser Fremde da unberechtigterweise herum. Sollte sie im Dorfkrug anrufen und dem Schubert Bescheid geben? Oder besser die Polizei anrufen, weil ja sicher Einsturzgefahr bestand, so war zu vermuten, und ehe ein noch größeres Unglück geschehen konnte, und überhaupt:
Das Plündern von ausgebrannten Häusern hatte zwar hier in der Heide Tradition, überall schon im dreißigjährigen Krieg war hier geplündert und gebranntschatzt worden, so mancher Ausspannplatz war dem Erdboden gleich gemacht worden, auch hier in Harmshausen waren alle Höfe bis auf die Grundmauern niedergebrannt worden. Das waren damals die kaiserlichen Truppen unter Tilly gewesen, seitdem hatte sich kein Katholischer mehr hier ansiedeln können oder dürfen. Das galt noch heute. Hier hielt man noch auf Tradition. Auf Tradition und Ehre.
Wie Lissie wusste, stahlen sich sogar bis ins letzte Jahr hinein etliche am zwanzigsten April an den Rand der Sandkuhle und gingen zu dem grauen Granitblock, der seit 1934 dort mit der eingehauenen Inschrift »Unserem Führer« versehen war. Aber das waren nur wenige, doch immerhin, es gab sie noch. Die hatten das mit der Tradition noch nicht so recht verstanden. Aber insgesamt fielen die in der Dorfgemeinschaft nicht ins Gewicht, und wenn gelegentlich einer der Ewiggestrigen am Stammtisch einen der alten Sprüche von sich gab, über die vielen Flüchtlinge und was mit denen geschehen sollte, dann wiesen ihn die anderen schon zurecht, diese waren jetzt zum Glück in der Überzahl.
Lissie stellte das Fernrohr wieder hin. Das war nicht ihr Problem. Und wer weiß, vielleicht hatte der Schubert ja diesen Fremden auch angestellt, der sollte beim Aufräumen helfen. Dann würde sie ja schön aussehen, wenn sie nun die Polizei auf den Mann hetzen würde. Und wenn der nun ein Räuber wäre, ein Dieb, der nach irgendwelchen wertvollen Sachen in der Brandruine suchte, tja, damit musste der Schubert eben rechnen, heutzutage. Man sollte ja immer aufpassen, keine Wertsachen ins Auto legen, keine offenen Einkaufsbeutel, und die Haustür auch stets abschließen.
Ja früher, Lissie kannte das noch, da waren im Dorf alle Türen offen gewesen, man ging zu den Nachbarn und borgte sich Salz oder Mehl, der eine hatte gute Hühner, der andere kochte Marmelade, der dritte schlachtete ein Schwein, da gab und nahm man untereinander, jeder hatte ein Auge auf den anderen. Wenn einer krank wurde, dann kochten die Nachbarn für ihn mit oder ernteten und droschen auch bei ihm, und dann kamen in der Nachkriegszeit viele, die nur durchzogen, und da fehlte dann mal hier ein Sack Mehl und dort ein Stück Speck, da wuchs das gesunde Misstrauen der Heidjer wieder an.
Und heute, wenn nachts Motorenlärm am Waldrande zu hören war, dann kam kein Dörfler zu spät vom Geburtstag oder einer der Jagdpächter hatte sich festgefahren, nein, dann versteckten die Autodiebe aus der Stadt ihre Beute in den Tannen, dort wurden sie dann ausgeschlachtet, und am nächsten Tag fuhr der Bauer auf seine Koppel und fand dann nur den weggeworfenen Autorumpf; Instrumente, Reifen, Kotflügel, Lampen und Airbags waren ausgebaut und, wie Erich Möller, der Dorfpolizist vermutete, alles steckte in flinken Kleinlastern auf dem Weg nach Polen und war damit für immer verschwunden.
Früher. Das war einmal. Lissy seufzte leise auf. Damals, als Jan noch gelebt hatte, als die Nächte noch warm gewesen waren und das Heu so herrlich geduftet hatte, sie hatte sich extra ein neues französisches Parfum gekauft in Vosshagen in der Drogerie, und Ende Mai war es, die Sonne stand schon fast über den Bäumen, als sie nach Hause gegangen waren. Ja, der Jan! Es war ein wunderbarer Sommer gewesen, und fast keiner hatte es gewusst. Und dann im Herbst diese Treibjagd, diese verfluchten Stadtjäger, die hatten nur ihre Trophäen im Kopf und wer den besten Bock schießen würde, und dann dieser dämliche Anwalt, noch grün hinter den Ohren, vor Gericht sagte er aus, dass er ganz deutlich einen Bock gesehen hätte. Jan hatte auf Blohms Leiterwagen gelegen und sie konnte nicht anders, sie hatte sich über ihn geworfen und geheult, Anke Petersen und Wiebke Feldmann hatten sie schließlich wegzerren können. Ja, der Jan. Lissy schaute die leere Straße entlang, drehte sich um und ging zurück ins Haus.
***
Werner Schubert saß auf der Eckbank in Buthmanns Dorfkrug vor einem großen Teller mit leckerem Schweinebraten mit Kartoffeln und Rotkohl und kaute bedächtig. Vom Stammtisch unter dem schweren schmiedeeisernen Leuchter rollte Gelächter zu ihm, es ging um die Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Karkenfelde, die sich am gestrigen Abend im Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt hatten und viel Freibier ausgegeben hatten, ja ausgeben mussten: sie wollten ja gewählt werden von den immer durstigen Landfrauen und –männern. Achim Knesebeck führte das große Wort, wie häufig, wenn er etwas zu viel Schwarzbier getrunken hatte. Noch zwei, drei Gläser, dann würde er zusammensinken und wie ein alter Kartoffelsack in der Ecke liegen und schnarchen.
Werner kannte das inzwischen; er aß jetzt jeden Abend hier, seit er oben in dem kleinen Gastzimmer wohnte; zum einen brauchte er so nicht selbst zu kochen, tagsüber räumte er noch immer in seinem abgebrannten Haus umher und suchte nach Brauchbarem, zum Anderen kochte Frau Buthmann ziemlich gut. Sie war eine imposante Erscheinung mit klarer harter Stimmlage und beinahe die einzige, die ihren Mann Herbert zum Schweigen bringen konnte.
Am Stammtisch saßen fünf, sechs Landwirte zusammen mit dem Förster Harry Brodersen, dessen Jagdhund schon einen ganzen Blechnapf Malzbier ausgeschlürft hatte, er lag nun unter der Holzbank und schlief. Die Männer tranken gemächlich. Sie redeten nicht allzu viel, meist über Rapsanbau und Kartoffelpreise, oder den unerwarteten Frosteinbruch Ende März; es hatte vor allem die Obstbauern getroffen, die meisten Blüten waren angefroren oder gar erfroren. Also würde es mit der ertragreichen Ernte nichts werden in diesem Jahr, die Äpfel würden wieder teurer werden, und es war sicher zweifelhaft, ob es genügend Birnen und Kirschen geben würde. Einige Bauern hatten mit brennenden Ölfässern zwischen den Reihen der Obstbäume versucht, gegen den Frost anzuarbeiten, aber es war nicht sicher, ob sie es geschafft hatten, wenigstens einen Teil der Ernte zu sichern. Die Getreidebauern hingegen grübelten über die erhebliche Nässe ihrer Felder, der Boden wurde dadurch so schwer, dass sie mit ihren schweren Geräten nicht auf die Äcker kamen, bei vielen stand das Wasser in großen Pfützen und ließ die Wintersaat verfaulen.
Werner hörte nicht richtig hin. Im Laufe der Jahre hier in Harmshausen hatte er gemerkt, dass die Bauern immer etwas zu beklagen hatten, was auch immer. Erst als der alte Lüders mit seiner etwas krächzenden Stimme von dem Pferdeschlächter zu erzählen begann, lauschte Werner aufmerksam. Denn er mochte die schnellen Tiere mit den weichen Schnauzen und den großen dunklen Augen.
»Ich war selbst dabei, das könnt ihr mir glauben, das war kein schöner Anblick. Dieses stolze Ross, ein hoher kräftiger Hengst, er hatte nur einen weißen Huf, alles andere war dunkelbraun, das war Wilkenings ganzer Stolz gewesen. Und er wollte mit ihm nach Lohmühlen zur Military fahren. Da lag es nun, das arme Tier. Der Unhold hatte ihm den Hals aufgeschlitzt. Ich sage euch, das ist ein richtiger Schlächter, ein Tierschänder, ein wahrer Unmensch!«
»So einer darf nicht mehr rumlaufen hier.«
»So einfach den Hals durchgeschnitten …«
»Ja, wie mit einer Sense. Eine scharfe Sense, der Kopf war fast ab. Der hing nur noch an ein paar Knochen. Und all das Blut im Gras. Ich hab sofort die Polizei angerufen, Wilkening konnte ja nicht. Der kniete nur vor dem toten Tier und heulte und jammerte. Mein Gott, ich hab einen Mann selten so weinen sehen!«
»Ein verdammter Saukerl, der das gemacht hat.«
»Der kann nicht von hier sein. Von allen Leuten hier, und auch aus Vosshagen oder Karkenfelde, das traue ich keinem zu.«
»Aber warum nur? Wer hat denn ein Interesse daran, einfach Pferde abzuschlachten. Oder wollte jemand den Wilkening treffen?«
»Das glaub ich nicht. Dann hätte der gewartet, bis der Hengst das Rennen gewonnen hat, dann hätte es Wilkening noch tiefer getroffen.«
»Oder er hätte das Pferd einfach mitgenommen und verkauft. Man weiß ja, dass die Polen nicht immer auf gültigen Papieren bestehen.«
»Ob echt oder nachgemacht, das ist denen doch egal.«
»Und einen guten Preis hätten sie allemal für so ein Tier bekommen.«
Und so wandte sich das Gespräch dann den polnischen Eigenschaften zu. Die Bauern hier hatten alle schon mit Polen gearbeitet, jeden Frühling holten sie sich eine Mannschaft aus Polen für die Arbeit auf den weiten Erdbeerfeldern, die blieben dann meist bis zum Herbst; oben am Fluss zur Apfel- und Birnenernte und auch auf dem Kartoffelroder oder bei der Gurkenernte waren die polnischen und tschechischen Arbeiter sehr gern gesehen und wurden auch, zumindest in den meisten Betrieben hier im Landkreis, anständig bezahlt. Sonst würden sie in der nächsten Saison ja nicht wiederkommen. Das war die eine Seite, die unentbehrlichen Arbeiter aus Polen, die sich nicht scheuten, die Hände dreckig zu machen, die jede Form von Arbeit verrichteten, fleißig waren und achtsam mit den Früchten.
Aber es gab auch die professionellen Diebesbanden aus dem Ostblock, aus Rumänien oder dem ehemaligen Jugoslawien, die vor allem Autos der oberen Preisklasse stahlen und im Wald zerlegten und ausraubten, und da gab es wohl noch rumänische Banden oder junge Männer aus der Ukraine und Russland, nur selten waren auch Polen unter denjenigen, die von der Polizei gefasst wurden. Daher schauten die Landwirte hier in der Gegend sich alle Fremden genauer an, und so manch einer schlief seit geraumer Zeit stets nur noch mit seinem Gewehr neben dem Bett: »Das ist nur für den Fall der Fälle, nicht dass du etwas glaubst, ich würde einen erschießen, aber wenn ich so einen von den Gaunern hören sollte oder gar zusehe, wie er in meinen Geräteschuppen einbricht und sich an den teuren Werkzeugen vergreifen will, dann brenne ich ihm doch eine gehörige Ladung Schrot auf den Pelz, sollst mal sehen, wie der dann hüpfen kann und abhaut. Und ich kann dir sagen, wenn einer erst meine Schrotkugeln im Hintern hat, so einer kommt dann erst mal nicht wieder.«
Werner Schubert beendete seine Mahlzeit und trank sein Glas aus. Das war schon was, ein Pferdemord. Und keines der eingestellten Pferde von reichen Hamburgern oder Fabrikanten aus dem Ruhrgebiet war auf der Weide hingeschlachtet worden, nein, ein hiesiges Tier, ein Hengst vom Wilkening, den er vermutlich zur Züchtung vorgesehen hatte. Wilkening war ja dafür bekannt, dass er gutes Zuchtmaterial hatte, er bildete seine Pferde auch selbst aus, springen, Geländeritte und sogar Dressur, seit die Heide Meiners bei ihm als Pferdewirtin angestellt war.
Ja, die Heide. Werner mochte sie. Sie war eine der besten Freundinnen von Lena gewesen. Oft waren sie in den Jahren vorbeigekommen, wenn Heide auf dem abgezäunten Pferch im festen Sand geübt hatte, Piaffe, Querungen, Antraben, Schritt halten, verhalten. Sie hatten sich gut unterhalten, denn auch die Heide las gern und viel.
Sie waren auch einmal gemeinsam nach Worpswede gefahren, Lena und Heide Meiners und ihr Mann Günter, allerdings auch mit den anderen vom Reiterverein, hatten dort die Museen und das berühmte Cafe besucht und waren sich über Paula Moderson-Becker einig gewesen, Werner mochte deren Bilder noch mehr als die von dem Vogeler. Für ihn waren sie ehrlicher, direkter, sie zeigten die Menschen so wie die Landschaft hier war, verwurzelt, schwermütig, da war immer etwas Unergründliches in der Tiefe, wie beim Moor, dachte er. Die Bilder vom Vogeler kamen alle sehr viel leichter daher, eher etwas vornehmer, gediegener, idealer, wie der weite hellblaue Himmel mit ein paar zarten Schleierwolken. Der grandiose Unterschied zwischen den beiden, der Sog in die Tiefe einerseits und das sich Erhebende, aufwärts Strebende andererseits, dieser Kontrast zwischen den beiden, das gab in ihm eine kreative Spannung, das regte ihn an zu weiten hochfliegenden Gedanken und gleichzeitig gab es festen Halt, machte ihn bescheidener und bodenständiger. Und beides in sich zu spüren und auszuhalten, das erzeugte schon ein tiefes, warmes Gefühl, lebendig zu sein.
Der Worpswedeausflug war für Heide Meiners auch eine Hommage an Rilke gewesen, und Werner und Lena hatten ihr dann zu Weihnachten das Buch von Modick über Rilke in Worpswede geschenkt, welches den verehrten Dichter in einem anderen, vermutlich ehrlicheren Lichte zeigte. Heide war erst von dem Buch begeistert, aber je weiter sie las, desto düsterer wurde ihre Stimmung, und am Schluss war sie regelrecht wütig gewesen und hatte den Autor laut und zornig beschimpft. Allerdings nach etwa einer Woche, da konnte sie schon wieder lächeln und hatte zu Werner gesagt, dass sie das Buch »Konzert ohne Dichter« alles in allem doch ziemlich gut fände; sie habe sich erst von ihrer Jungmädchenschwärmerei für den großen Lyriker trennen müssen, jetzt als erwachsene Frau könne sie, so wie es in dem gut geschriebenen Buch dargestellt worden war, neben dem großen Dichter auch den Menschen, den Mann sehen, der wie eben alle Menschen auch so seine Fehler gehabt habe.
» Na, war alles nach Wunsch?«
Ortrud Buthmann, die Gastwirtin, stand auf einmal vor Werner und wollte den abgegessenen Teller abräumen.
«Noch ein Bier vielleicht?«
»Ach ja, noch eins für den Weg, Das geht klar.«
Auf dem Weg zum Tresen klingelte ihr Handy und sie redete eine Weile, den Kopf in Schieflage, das kleine Telefon ans Ohr gepresst, mit den Händen zapfte sie das Bier für Werner. Er wunderte sich immer wieder über diese Fertigkeit bei Frauen, wie nannte man das auf neudeutsch: die Fähigkeit des Multitasking, weil Frauen ja viele Dinge zur gleichen Zeit erledigen konnten. So schrieben sie es immer wieder in den Zeitungen. Als ob das eine ganz neue und ungeheuer wichtige Erkenntnis sei. Als ob in früheren Zeiten die Frauen immer nur die Hände in den Schoß gelegt hätten. Dabei waren die Anforderungen an Frauen schon immer durch alle Zeiten hinweg ziemlich hoch gewesen, nicht nur die von der Gemeinschaft für selbstverständlich gehaltenen Dinge wie Sorgfalt bei der Kinderaufzucht, Essen kochen und das Haus in Ordnung halten, für Wärme sorgen, Kleidung herstellen, Hilfe bei der Feldbestellung und Ernte oder Nahrungssuche, und dann sollten dazu noch die so wichtigen Erwartungen der Männer hinsichtlich Schönheit, Treue und Gehorsam erfüllt werden.
Alles in allem, fand Werner, hat es doch ziemlich lange gedauert, bis im Laufe der Jahrhunderte eine vorsichtige Emanzipation sich durchsetzen konnte; denn auch heute, wo fast jede Frau über Handy und einen Beruf verfügte, bestimmten das Zusammenleben immer noch diese alten eingeübten Verhaltensweisen der Männer oder einiger Gesellschaftsteile, die das Etikett: Küche Kinder Kirche für Frauen, insbesondere für Ehefrauen, als angemessen erachteten.
Werner setzte sich besser zurecht. Am Stammtisch leerten sie die Gläser und die Ersten gingen schon. Werner wusste, dass manche der Ehefrauen streng darauf achteten, dass ihre Männer ja rechtzeitig zum Abendbrot am Tisch saßen, sonst würde es großen Ärger geben. Manch einer hatte schon, ob Sonne oder Regen, vor der verschlossenen Tür gehockt. Aber zum Glück für die Bauern hatten sie regendichte Ställe und auch meist genug Heu, für eine Nacht ging es schon mal. Aber am nächsten Morgen kam dann das erwartete Donnerwetter um so heftiger. In Vosshagen hatte eine zornige Ehefrau ihren Mann, der zu spät nachts auf den Hof gekommen war und sich noch erleichtern wollte, auf dem Plumpsklo eingesperrt. Er hatte sich dort in aller Ruhe hingesetzt, um seine Geschäfte zu verrichten, da hatte sie mit dem Wäscheseil die Türe fest verzurrt und ihn bis zum nächsten Mittag in der kleinen Holzhütte schmoren lassen. Das ganze Dorf hatte laut gelacht, als er mit hochrotem Kopf dann befreit herausgekommen war und in all die grinsenden Gesichter sehen musste.
Frau Buthmann brachte das Bier:
»Das war eben meine Tochter Karo. Sie muss heute länger arbeiten, sie ist bei dem Anwalt Schultze in Vosshagen als Notargehilfin, und da ist sie die erste Kraft, seit Jahren schon, und manchmal kommt es eben so, da muss sie länger im Büro bleiben, weil einer eben später kommt, oder wenn ein Gerichtstermin länger dauert. Aber ich bin sehr stolz auf sie, sie hat es geschafft, erst die Oberschule und dann die lange Ausbildung. Jetzt hat sie erst mal eine kleine Wohnung in Vosshagen, schön möbliert gemietet, Sie wissen ja, wenn sie mal heiratet, dann kann sie sich etwas richtiges kaufen, zusammen mit dem Zukünftigen. Wissen Sie, hier auf dem Lande gibt es für ein kluges Mädchen nicht so viele Möglichkeiten, jedenfalls wenn sie hier in der Gegend bleiben will. Ja, wenn eine in die Stadt gehen will, dort kann sie dann ja ziemlich viel machen. Aber meine Karo ist nicht so, sie mag die Stadt nicht, das ist ihr viel zu viel. Sie sagt immer, dass sie hier die Leute kennt und versteht und alle mögen sie und sie fühlt sich hier wohl. Denn Harmshausen hier ist ihr wahres Zuhause, ist Heimat, verstehen Sie, Heimat! Ja, das ist es, was wir alle hier wohl meinen, na, Sie kennen das ja, von unseren Festen her, und warten Sie nur ab, noch zwei, drei Jahre, und Sie wollen auch nicht mehr weg hier.«
»Das will ich jetzt schon nicht, Frau Buthmann.«
Frau Buthmann griente über das ganze Gesicht, wischte wie beiläufig auf dem Tisch herum, schaute dann zum Stammtisch und sagte:
» Ist ganz schön derbe, das mit dem Hengst von Wilkening, finden Sie nicht?«
»Ja, wie kann man aber auch einfach hingehen und so ein treues Tier abstechen.«
»Wissen Sie, Herr Schubert,« sie beugte sich vertraulich über ihn, »ich denke mir ja, das war ein Warnzeichen. Das hat dem alten Wilkening gegolten. Der will ja immer nicht hören. Damals mit dem Kirchacker auch, da