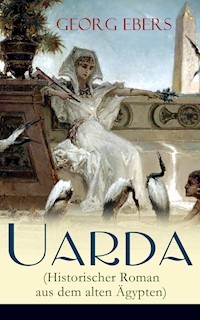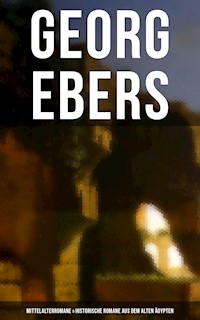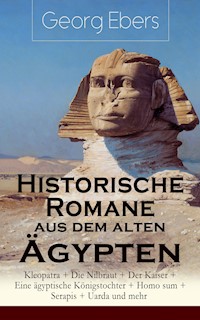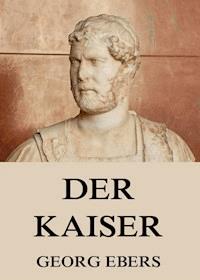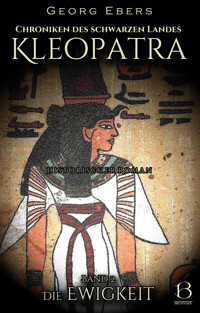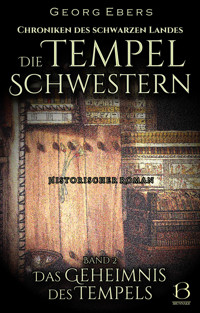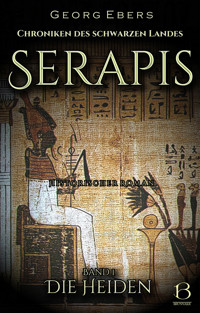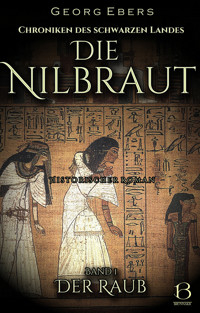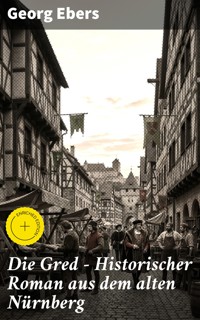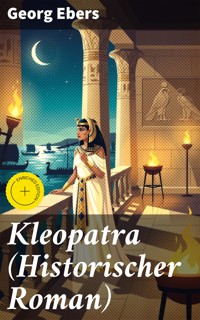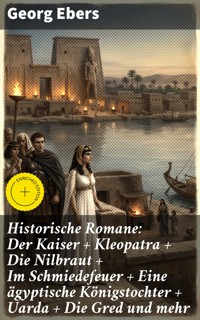1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Die Frau Bürgemeisterin" entführt Georg Ebers seinen Lesern in die facettenreiche Welt des Mittelalters, wo Machtspiele, Intrigen und die Forderungen einer patriarchalischen Gesellschaft aufeinandertreffen. Die fesselnde Erzählung fokussiert sich auf das Leben einer starken Protagonistin, die sich gegen gesellschaftliche Erwartungen behauptet und trotz der Widrigkeiten ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Ebers' stilistische Eleganz und sein tiefes Verständnis für die historischen Gegebenheiten der Zeit verleihen dem Werk einen authentischen und lebendigen Charakter. Mit präzisen Beschreibungen und einem reichhaltigen Vokabular schafft er ein eindrucksvolles Bild der damaligen Lebensverhältnisse und der Rolle der Frauen in einer von Männern dominierten Welt. Georg Ebers, ein angesehener deutscher Schriftsteller und Begründer des historischen Romans, zeigte schon früh ein Interesse an der Antike und dem Mittelalter, was sich unverkennbar in seinen Werken widerspiegelt. Ebers, der auch als Ägyptologe tätig war, kombinierte seine Leidenschaft für die Geschichte mit einem ausgeprägten Talent zum Geschichtenerzählen. Seine persönliche Lebensgeschichte, geprägt von den Kämpfen um soziale Gerechtigkeit und dem Streben nach Bildung, bildete die Grundlage für seine bedeutenden literarischen Beiträge und seine Faszination für starke Frauenfiguren. "Die Frau Bürgemeisterin" ist ein Must-Read für Liebhaber historischer Literatur und alle, die sich für die Komplexität der menschlichen Beziehungen und die Herausforderungen, denen Frauen im Mittelalter gegenüberstanden, interessieren. Das Buch regt nicht nur zum Nachdenken über die Rolle der Geschlechter zu jener Zeit an, sondern ist auch ein eindringliches Porträt einer außergewöhnlichen Frau, die den Mut hat, ihr Leben zu gestalten. Ebers gelingt es, eine fesselnde Geschichte zu erzählen, die den Leser bis zur letzten Seite in ihren Bann zieht. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Frau Bürgemeisterin (Mittelalter-Roman)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen öffentlicher Pflicht und privater Selbstbehauptung entfaltet sich der still glühende Konflikt, der Die Frau Bürgermeisterin trägt. Georg Ebers widmet sich in diesem historischen Roman einer Lebenslage, deren Brisanz im Verborgenen wirkt: Die Position an der Seite der städtischen Obrigkeit verleiht Ansehen und Bindungen, sie fordert aber zugleich Takt, Haltung und Mut. Ohne auf dramatische Effekte zu setzen, führt der Roman schrittweise in ein Milieu ein, in dem Entscheidungen Gewicht bekommen, weil sie Familien, Nachbarschaften und ganze Gemeinwesen betreffen. So entsteht ein Panorama, dessen Spannung aus Verantwortung, Nähe und Konsequenz erwächst.
Als Mittelalter-Roman verankert, entfaltet das Buch seine Handlung in einem städtischen Umfeld, das durch Rat, Zünfte und Handel geprägt ist; die konkrete Topografie bleibt im Dienst der Figurenzeichnung. Verfasst von Georg Ebers, einem der prägenden Autoren des deutschsprachigen historischen Erzählens, erschien die Geschichte im späten neunzehnten Jahrhundert, einer Zeit, die das Mittelalter mit neuem Quelleninteresse betrachtete. Dieser Publikationskontext spiegelt sich in der sorgfältigen Recherche und im Bemühen, soziale Strukturen sichtbar zu machen. Der Schauplatz wirkt so nicht folkloristisch, sondern als lebendige Ordnung, in der Rollen, Rechte und Pflichten fortwährend verhandelt werden.
Im Mittelpunkt steht eine Frau, die als Gattin des Bürgermeisters zugleich Nähe zur Macht und Distanz zum offiziellen Entscheidungsraum erlebt. Ihre Tage sind bestimmt von der Organisation eines bedeutenden Haushalts, von Fürsorge, Netzwerken und diskretem Einfluss, der nicht in Ratsprotokollen erscheint. Aus dieser Position heraus öffnet sich der Blick auf die Stadt: auf Markt und Kirche, auf Werkstätten, auf das Geflecht aus Bündnissen und Rivalitäten. Früh spürt man, dass Gewohnheiten unter Spannung geraten und dass private Entscheidungen öffentliche Schatten werfen können. Mehr muss man anfangs nicht wissen, um der leisen Eskalation zu folgen.
Ebers erzählt mit ruhiger, souveräner Stimme, die sich Zeit für Beobachtungen nimmt und Menschen nicht auf Funktionen reduziert. Die Sprache ist gedrungen und anschaulich, reich an konkreten Details, ohne den Fluss zu verlangsamen; Dialoge treten gezielt auf, um Beziehungen hörbar zu machen. Die Atmosphäre entsteht aus genau gesetzten Requisiten, Liebhaberei für Handwerk und bürgerliche Rituale, und aus der Aufmerksamkeit für psychologische Nuancen. Statt greller Wendungen dominiert ein tragfähiger Grundton von Ernsthaftigkeit und Maß. So entsteht ein Lesetempo, das zur Reflexion einlädt und dennoch stetig voranträgt, getragen vom Gewicht kleiner Entscheidungen.
Im Zentrum stehen Fragen nach Verantwortung, Gemeinsinn und der Macht sozialer Erwartungen. Die Rolle der Bürgermeisterin verweist auf weibliche Handlungsräume, die jenseits formaler Ämter liegen: Pflege von Vertrauensbeziehungen, Vermittlung im Konflikt, Organisation von Hilfe und Repräsentation. Aus solchen Tätigkeiten erwächst Einfluss, der dauerhaft ist, weil er Bindungen stiftet. Zugleich zeigt der Roman, wie Ruf, Ehre und Recht ineinandergreifen und wie fragile Ordnung entsteht, wenn ökonomische Interessen, religiöse Haltungen und persönliche Loyalitäten aufeinandertreffen. Es geht um das Kräftefeld zwischen Moral und Nutzen, um Mut zur Haltung, und um das Ethos des städtischen Zusammenlebens.
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch relevant, weil es die Aushandlung von Verantwortung im Nahbereich beleuchtet – dort, wo Institutionen auf private Beziehungen treffen. Leadership zeigt sich nicht als heroische Ausnahme, sondern als tägliche Praxis des Abwägens, Helfens und Grenzensetzens. Die Erzählung sensibilisiert für die Bedingungen von Vertrauen, ohne Moral zu predigen, und macht nachvollziehbar, wie soziale Kohäsion entsteht oder brüchig wird. Wer sich für Fragen von Geschlechterrollen, lokaler Politik, Nachbarschaft und Resilienz interessiert, findet hier eine historische Fallstudie, die erstaunlich modern wirkt, gerade weil sie auf laute Thesen verzichtet.
Die Frau Bürgermeisterin empfiehlt sich als atmosphärisch dichtes, gelassen komponiertes Leseerlebnis, das Binnenräume, Plätze und Rituale mit leiser Präzision ausleuchtet. Wer sich darauf einlässt, begegnet einer Geschichte, die nicht von Sensationen lebt, sondern von der Kunst, Alltag zu dramatisieren, ohne ihn zu verzerren. Die Spannung speist sich aus feinen Verschiebungen von Loyalität und Einfluss, aus der Geduld des Erzählens und aus dem Ernst der Konsequenzen. Gerade darin liegt der Reiz: Man liest sich in eine Vergangenheit ein, die nach Vertrautem klingt, und entdeckt dabei Fragen, die das eigene Heute betreffen.
Synopsis
Georg Ebers’ historische Erzählung Die Frau Bürgermeisterin siedelt ihre Handlung in einer niederländischen Stadt an, die in den Wirren des Aufstands gegen die spanische Krone belagert wird. Im Mittelpunkt steht die Ehefrau des Stadtoberhaupts, deren Alltag zwischen häuslicher Verantwortung und öffentlicher Erwartung zerrieben wird. Ebers entfaltet das Panorama einer Gemeinschaft, die zwischen Glaubensüberzeugungen, politischer Loyalität und nacktem Überleben zerrissen ist. Früh etabliert der Roman Fragen nach Pflicht und persönlichem Glück, nach Treue, Mitgefühl und Standhaftigkeit. Ohne sich in reiner Chronik zu verlieren, führt die Erzählung in die sozialen, religiösen und wirtschaftlichen Spannungen ein, die das folgende Geschehen antreiben.
Zu Beginn zeichnet der Roman ein lebendiges Bild der wohlhabenden, handwerklich geprägten Stadt, in der Handel und Zunftwesen Sicherheit versprechen, während Gerüchte über heranrückende Truppen und religiöse Repression die Runde machen. Die Titelgestalt wirkt als Vermittlerin zwischen dem nüchternen Pflichtbewusstsein ihres Mannes und den Bedürfnissen von Nachbarn, Gesinde und Verwandten. Freundschaften und alte Zuneigungen aus früheren Jahren geben ihrer inneren Stimme Kontur und sorgen für Reibungen, sobald die Stadtpolitik vor der Haustür steht. Zugleich wird sichtbar, wie unterschiedlich die Bürgerschaft auf den heraufziehenden Konflikt reagiert: vom kompromissbereiten Händler bis zur unbeirrbaren, von Glaubenseifer getriebenen Aktivistin.
Mit Beginn der Belagerung verschärft sich der Druck. Die Versorgung reißt ab, Tore bleiben geschlossen, und die Stadtwachen teilen die Kräfte ein. Der Bürgermeister wird zum sichtbaren Symbol des Widerstands; seine Frau übernimmt still, aber beharrlich Aufgaben, die das soziale Gefüge zusammenhalten: die Sorge um Kranke, die Organisation knapper Vorräte, die Beruhigung der Verängstigten. Ebers zeigt, wie rasch moralische Gewissheiten ins Wanken geraten, sobald Hunger und Angst an der Tür klopfen. Zugleich kursieren Anschuldigungen wegen Verrats und Spionage, die alte Feindschaften befeuern und neue Risse öffnen. Die Heldin muss zwischen Loyalität, Gerechtigkeitsempfinden und Bedacht eine Linie finden, die Schlimmeres verhindert.
Je länger die Blockade dauert, desto deutlicher treten Klassengegensätze und konfessionelle Spannungen zutage. Wohlhabende sichern sich Restbestände, während einfache Familien darben; Prediger schüren Durchhaltewillen oder Misstrauen, je nach Lager. Die Frau des Bürgermeisters wird zur moralischen Instanz, ohne offizielles Amt: Sie vermittelt zwischen Rat und Bevölkerung, verschafft Verwundeten Gehör und versucht, Not zu lindern, wo Regeln sonst nur Härte kennen. Ein persönliches Dilemma spitzt sich zu, als jemand aus ihrem Umfeld unter Verdacht gerät. Ihr Bemühen, Barmherzigkeit und Ordnung zu versöhnen, macht sie zugleich angreifbar und unverzichtbar und führt zu Entscheidungen, deren Folgen die Stadtgemeinschaft prägen.
Als der Mangel lebensbedrohlich wird, entlädt sich die Wut in offener Unruhe. Teile der Bürgerschaft fordern Kapitulation, andere bestehen auf Widerstand bis zum Letzten. Der Bürgermeister hält an der Pflicht zum Ausharren fest, doch die Eskalation droht Kontrolle und Ansehen zu kosten. Hier greift die Frau gestaltend ein: Sie sucht das Gespräch mit Widersachern, verhindert überstürzte Schritte und öffnet Kommunikationswege, die Vertrauen zurückgewinnen. Gerüchte über eine mögliche Entsatzaktion von Verbündeten dringen in die Stadt und nähren Hoffnung, aber auch Zweifel, ob Hilfe rechtzeitig kommt. Dieser Zwischenzustand aus Erwartung und Erschöpfung verschärft jedes Zögern zur existenziellen Frage.
Mit den ersten Anzeichen, dass draußen riskante Pläne zur Rettung umgesetzt werden könnten, wächst die Gefahr im Inneren: Fanatiker und Opportunisten nutzen die Verwirrung, um eigene Ziele durchzusetzen. Die Frau des Bürgermeisters gerät zwischen Fronten, schützt Schwache vor Vergeltung und mahnt zur Einheit, während sie selbst eine schmerzhafte Grenze zwischen persönlicher Bindung und öffentlicher Pflicht ziehen muss. Ein konfrontatives Aufeinandertreffen mit einem hartleibigen Gegenspieler zwingt sie, Haltung und Herz gleichermaßen zu beweisen. In dieser Zuspitzung kulminieren die Leitfragen des Romans: Was hat Vorrang – Leben oder Ehre, Recht oder Gnade, Gemeinschaft oder individuelles Glück?
Die Erzählung steuert auf eine Entscheidungssituation zu, in der Standhaftigkeit, Vertrauen und Opferbereitschaft über den weiteren Weg bestimmen, ohne dass der Text seine Spannungsbögen vorschnell auflöst. Ebers hinterlässt das Bild einer Stadt als moralischem Prüfstein und einer Frau, die im Schatten der offiziellen Macht wirksam wird. Das Werk beeindruckt durch die Verbindung aus anschaulicher Zeitfarbe und psychologischer Genauigkeit und stellt Fragen, die über den historischen Rahmen hinausreichen: Wie führen wir in Krisen, wie viel Solidarität ist zumutbar, und wer trägt Verantwortung für die Schwächsten? So wirkt der Roman als Plädoyer für menschliche Größe unter extremen Bedingungen.
Historischer Kontext
Georg Ebers’ Mittelalter-Roman Die Frau Bürgermeisterin siedelt seine Handlung in der Welt der deutschsprachigen Städte des Spätmittelalters an, wo Stadtrat und Bürgermeister, Zünfte und Bruderschaften, Pfarrkirchen und Klöster den Alltag prägten. Reichsstädte besaßen weitgehende Selbstverwaltung unter dem Kaiser, mit eigenem Stadtrecht, Gericht und Stadtmiliz. Das Bürgerrecht regelte Teilhabe, Pflichten und Schutz. Märkte, Zölle und Maße wurden durch den Rat beaufsichtigt, und die städtische Repräsentation zeigte sich in Rathaus, Kirchen und Spitälern. In diesem institutionellen Gefüge entstand eine bürgerliche Kultur aus Kaufleuten, Handwerkern und Patriziern, deren Familien, Netzwerke und Ehrbegriffe den sozialen Rahmen des Romangeschehens bilden.
Die spätmittelalterliche Stadt war ökonomisch durch Handwerk und Fernhandel verbunden. Zünfte regulierten Ausbildung, Qualität und Preise; Meisterrechte und Gesellenordnungen schufen Aufstiegswege, aber auch Schranken. Oberdeutsche Kaufleute aus Städten wie Nürnberg und Augsburg erschlossen Märkte in Italien und am Oberrhein; Messen, etwa in Frankfurt oder Leipzig, bündelten Kapital und Information. Handelsnetzwerke im Norden wurden von der Hanse geprägt, im Süden von Familienfirmen und Faktoreien. Wohlhabende Bürger investierten in Häuser, Lager und Stiftungen. Diese Strukturen erklären bürgerliche Wohlstandsambitionen, Konkurrenz und Solidarität, die Ebers’ Figurenkonstellationen spiegeln, ohne den Rahmen städtischer Ordnung – Gebühren, Zunftzwang, Marktaufsicht – zu verlassen.
Vor der Reformation prägte die römisch-katholische Kirche das urbane Leben. Pfarrkirchen, Frauen- und Männerklöster, Bettelorden wie Dominikaner und Franziskaner sowie fromme Bruderschaften organisierten Gottesdienst, Bildung, Beichte und Armenfürsorge. Spitäler wie Heilig-Geist-Häuser verbanden Seelsorge mit Pflege. Prozessionen, Heiligenkulte und das Kirchenjahr strukturierten Zeit und Öffentlichkeit. Städte förderten Altäre und Kapellen, zugleich regulierten Räte Predigt und Stiftungen, um Konflikte zu vermeiden. Laienfrömmigkeit und Stifterwesen gaben besonders städtischen Frauen Handlungsspielräume im Bereich der Caritas. Solche religiösen Praktiken und Institutionen bilden den Hintergrund für Motive wie Gewissenskonflikte, Buße, Gelübde und Wohltätigkeit, die in einer Bürgermeisterfamilie gesellschaftlich sichtbar wurden.
Das Stadtrecht, oft von Vorbildern wie dem Magdeburger oder Lübecker Recht abgeleitet, regelte Handel, Erbrecht, Vormundschaft und Strafverfolgung. Räte führten die niedere Gerichtsbarkeit; Schöffen urteilten nach Gewohnheitsrecht und Statuten. Eherecht und Gütergemeinschaft beschränkten die Verfügungsgewalt verheirateter Frauen, doch als Witwen konnten sie Betriebe weiterführen oder Verträge schließen. Mitgift, Morgengabe und Erbfolge bestimmten Vermögen und Bündnisse zwischen Familien. Stadtfrieden, Nachtwächterwesen und Zunftdisziplin sollten Gewalt begrenzen, während Fehden und Ehrenhändel dennoch vorkamen. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen erklären, wie Haushalte geführt, Geschäfte abgeschlossen und Konflikte geschlichtet wurden – zentrale Voraussetzungen für die Handlung um eine einflussreiche bürgerliche Familie.
Spätmittelalterliche Städte kannten Machtkonflikte zwischen patrizischen Ratsfamilien und zünftig organisierten Handwerkern. In mehreren Reichsstädten führten Spannungen zu Umstürzen oder Reformen, etwa in Köln 1396, in Augsburg und Konstanz im 14. Jahrhundert oder in Nürnberg zu wiederkehrenden Handwerkerunruhen. Themen waren Ratszugang, Steuerlast, Marktregeln und Rechtsschutz. Solche Auseinandersetzungen blieben häufig in einem rechtlich gefassten Rahmen – Eide, Schlichtungen, neue Ordnungen – konnten aber eskalieren. Die Position des Bürgermeisters hing von Mehrheiten, Bündnissen und der Befolgung des Stadtfriedens ab. Der Roman spiegelt diesen Streit der Ordnungen, indem er Loyalitäten, Klientel und bürgerliche Tugenden gegen persönliche Rivalitäten ausspielt.
Die spätmittelalterliche Stadt stand unter Druck durch Seuchen, Versorgungskrisen und äußere Kriegslasten. Die Pestwellen seit der Mitte des 14. Jahrhunderts kehrten wieder und belasteten Bevölkerung und Finanzen. Brandschutz, Vorratspolitik und Almosenwesen waren kommunale Antworten. Politisch band die Reichsreform von 1495 die Reichsstädte stärker in Friedenssicherung und Rechtsprechung (Ewiger Landfriede, Reichskammergericht) ein; Städtebünde und der Schwäbische Bund stabilisierten Regionen, forderten aber Abgaben und Truppen. Solche Belastungen verlangten verlässliche Verwaltung und Integrationskraft der Rathäuser. In diesem Umfeld gewinnen Motive wie Verantwortung, Amtsmoral und Gemeinsinn Plausibilität, die die Erzählung um städtische Führung und ihre familiären Stützen rahmen.
Frauen agierten im städtischen Rahmen zwischen Norm und Praxis. Verhaltenslehren und Kleiderordnungen setzten Grenzen, doch in der Realität arbeiteten Frauen in Hausgewerben, im Textil- und Lebensmittelbereich, führten Läden oder Gasthäuser und traten als Wohltäterinnen auf. Als Gattin eines Bürgermeisters verband eine Frau Haushaltsführung, Repräsentation, Netzpflege und Armenfürsorge, oft über Bruderschaften und Stiftungen. Witwenrechte erlaubten Kontinuität von Betrieben und Verträgen. Bildung blieb ungleich verteilt, doch Lese- und Schreibkenntnisse nahmen in Städten zu. Der Roman nutzt diese historischen Spielräume, um weibliche Handlungsfähigkeit innerhalb der städtischen Ordnung sichtbar zu machen – ohne die patriarchalen Rahmenbedingungen zu verklären.
Georg Ebers, ein historisch arbeitender Romancier des 19. Jahrhunderts, nutzt die spätmittelalterliche Stadt als Spiegel bürgerlicher Werte: Pflichterfüllung, Maß, Frömmigkeit und Gemeinsinn. Die Figur einer Bürgermeisterin – hier als Gattin an der Schnittstelle von Haus, Markt und Rathaus – erlaubt es, Amtsführung als Familien- und Gemeinwesenaufgabe zu zeigen. Ohne das Ende vorwegzunehmen, dient die Handlung als Kommentar zur Fragilität städtischer Autonomie unter äußeren und inneren Spannungen. Zugleich vermittelt der Roman, im Geist des historischen Realismus seiner Zeit, die Bedeutung von Institutionen und Rechtsformen dafür, dass persönliches Ethos politisch wirksam wird.
Die Frau Bürgemeisterin (Mittelalter-Roman)
Erstes Kapitel
Im Jahre 1574 nach der Geburt Jesu Christi hatte der Lenz frühzeitig seinen fröhlichen Einzug in die Niederlande gehalten.
Der Himmel war blau, Mücken spielten im Sonnenlicht, weiße Falter hefteten sich an neuerblühte goldgelbe Blumen, und neben einem der vielen die weite Ebene durchschneidenden Wassergraben stand ein Storch und schnappte nach einem stattlichen Frosch; da zappelte der arme Gesell in dem rothen Schnabel des Feindes. Ein Schluck: – der muntere Springer war verschwunden und sein Mörder regte die Flügel und schwang sich hoch auf. Ueber Gärten und Gärtchen mit blühenden Obstbäumen, zierlich abgezirkelten Beeten und bunt bemalten Lauben, über den unfreundlichen Kranz der die Stadt umgürtenden Festungsmauern und Thürme, über schmale Häuser mit hohen zackigen Giebeln, über saubere Straßen, an deren Seiten Ulmen, Pappeln, Linden und Weiden im frischen Schmuck des Frühlings grünten, flog der Vogel dahin. Endlich ließ er sich auf einem Ziegeldache nieder. Hier stand auf dem First sein wohlbefestigtes Nest. Nachdem er seinen Fang großmüthig dem brütenden Weibchen überlassen, stellte er sich auf das rechte Bein und schaute nachdenklich auf die Stadt hernieder, die dort unter ihm auf dem grünen Sammetteppich der Wiesen in leuchtendem Ziegelroth blink und blank aufgebaut stand. Er kannte sein schönes Leyden[1], die Zierde Hollands, seit manchem Jahre. Mit all' den Armen und Aermchen des Rheins, die den stattlichen Ort in zahlreiche Eilande zerlegten und über die sich so viele steinerne Brücken schwangen, als fünf Monate des Jahres Tage zählen, war er vertraut, aber freilich, seit seinem letzten Aufbruch nach Süden hatte sich hier doch gar Manches verändert.
Wo waren die bunten Lusthäuser und Obsthaine der Bürger, wo die hölzernen Rahmen geblieben, auf denen sonst die Weber ihre dunklen und farbigen Tuche auszuspannen pflegten?
Welches Menschenwerk, welches Gewächs auch immer die Einförmigkeit der Ebene unterbrechend sich außerhalb der Stadtmauern und Festungsthürme bis zur Brusthöhe eines Mannes erhoben hatte, Alles war von der Erde verschwunden, und weiterhin, auf den besten Jagdplätzen des Vogels, zeigten sich im Grün der Wiesen bräunliche, von schwarzen Kreisen besäte Stellen.
Am letzten Oktober des vergangenen Jahres, kurz nachdem die Störche das Land verlassen, hatte hier ein spanisches Heer sein Lager aufgeschlagen, und wenige Stunden vor der Heimkehr der geflügelten Wanderer, am Tage des Frühlingsanfangs, waren die Belagerer unverrichteter Sache von dannen gezogen.
Mißwachs inmitten des üppigen Wuchses bezeichnete ihre Lagerstätten, das Schwarz der erloschenen Kohlen ihre Feuerplätze.
Die schwer bedrohten Bürger der erretteten Stadt athmeten dankbar auf. Das fleißige, leichtlebige Volk hatte schnell die erduldeten Leiden vergessen, denn der frühe Lenz ist so schön, und niemals will das gerettete Dasein so kostbar erscheinen, als wenn uns die Wonnen des Frühlings umgeben.
Eine neue, bessere Zeit schien nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschen begonnen zu haben. Das Kriegsvolk, welches in der belagerten Stadt gelegen und mancherlei Unerfreuliches verübt hatte, war vorgestern mit Sang und Klang verabschiedet worden. Die Axt des Zimmermanns blitzte vor den rothen Mauern, Thürmen und Thoren in der Frühlingsonne und biß schneidig in die Balken, aus denen neue Gerüste und Rahmen zusammengefügt werden sollten; stattliche Rinder weideten friedlich und unbeängstigt rings um die Stadt her, in den verwüsteten Gärtchen ward fleißig umgegraben, gesät und gepflanzt. Auf den Straßen und in den Häusern regten sich tausend Hände, die noch jüngst auf den Wällen und Thürmen Arkebusen und Spieße geführt hatten, zu nützlicher Arbeit, und alte Leute saßen ruhig vor den Thüren und ließen sich den Rücken von der Sonne des warmen Lenztages bescheinen.
An diesem 18. April sah man in Leyden nur wenig unzufriedene Gesichter. An ungeduldigen fehlte es freilich nicht, und wer sie aufsuchen wollte, der brauchte nur in die Hauptschule zu gehen, wo jetzt der Mittag sich nahte und viele Buben weit eifriger durch die geöffneten Fenster des Schulzimmers, als auf den Mund des Lehrers schauten.
Nur an derjenigen Stelle des weiten Saales, an der die größeren Knaben Unterricht empfingen, machte sich keine Unruhe geltend. Auch auf ihre Bücher und Hefte schien die Frühlingssonne, auch sie rief der Lenz in's Freie, aber mächtiger noch als seine berückende Stimme schien das, was sie jetzt vernahmen, auf die jungen Gemüther zu wirken.
Vierzig leuchtende Augen waren gespannt auf den bärtigen Mann gerichtet, welcher mit tiefer Stimme zu ihnen sprach.
Selbst der wilde Jan Mulder hatte das Messer, mit dem er das wohlgetroffene Bild eines Schinkens in den Schultisch zu schneiden begonnen, sinken lassen und hörte aufmerksam zu.
Jetzt ließ sich das Mittagsgeläut von der nahen Peterskirche und bald darauf auch vom Rathhausthurme hören, die kleinen Buben verließen lärmend den Saal, aber – wunderbar – die Geduld der größeren hielt immer noch Stand; sie mußten doch wohl Dinge zu hören bekommen, welche nicht eigentlich in den Unterricht gehören. Der Mann, welcher da vor ihnen stand, war kein Lehrer der Schule, sondern der Stadtsekretarius van Hout, welcher seinen erkrankten Freund, den Magister und Prediger Verstroot, heute an dieser Stelle vertrat. Während des Geläutes hatte er das Buch zugeschlagen und sagte nun:
»Suspendo lectionem. He, Jan Mulder, wie würdest Du mein »suspendere« übersetzen?«
»Hängen,« entgegnete der Knabe.
»Hängen!« lachte van Hout. »Dich vielleicht an den Haken, aber wohin hängt man eine Lektion? Adrian van der Werff–«
Der Aufgerufene erhob sich schnell und sagte:
»Suspendere lectionem« heißt die Stunde abbrechen.«
»Gut; und wenn wir den Jan Mulder aufhängen wollten, so würde es heißen?«
»Patibulare, – ad patibulum!« riefen die Schüler durcheinander.
Die Züge des Stadtsekretarius, welche eben noch gelächelt hatten, wurden ernst. Er holte tief Athem und sagte dann:
»Patibulo ist ein schlechtes lateinisches Wort, und eure Väter, welche hier saßen, verstanden weniger gut als ihr seine Bedeutung. Jetzt kennt es ein jedes Kind in den Niederlanden, denn Alba[2] hat es uns eingeschärft. Mehr als achtzehntausend brave Bürger sind durch sein »ad patibulum« an den Galgen gekommen.«
Bei diesen Worten zog er das kurze schwarze Wamms durch den Gürtel, trat dem vordersten Tische näher, neigte den stämmigen Oberkörper weit vor und sagte mit stetig zunehmender innerer Erregung:
»Für heute soll es genug sein, ihr Buben. Es wird nicht viel schaden, wenn ihr die Namen später vergeßt, die wir hier lernten. Aber das Eine behaltet im Sinne: Das Vaterland über Alles![1q] Leonidas und seine dreihundert Spartaner sind nicht vergebens gestorben, so lange es Männer gibt, die ihrem Beispiel zu folgen bereit sind. Auch an euch kommt die Reihe. Prahlen ist nicht meine Sache, aber was wahr ist, bleibt wahr. Wir Holländer haben fünfzigmal dreihundert Märtyrer für die Freiheit des heimischen Bodens gestellt. In solcher Sturmzeit gibt's feste Männer; auch Knaben haben sich tüchtig bewährt. Der Ulrich dort an eurer Spitze darf seinen Spitznamen Löwing mit Ehren tragen. ›Hie Perser – hie Griechen!‹ hieß es vor Zeiten, – wir aber rufen: ›Hie Niederland und hie Spanien!‹ Und wahrlich, der stolze Darius hat in Hellas nie so gewüthet wie König Philipp in Holland. Ja, ihr Buben. Viele Blumen blühen in des Menschen Brust. Unter ihnen ist der Haß der giftige Schierling. Spanien hat ihn in unseren Garten gesät. Ich fühl' ihn hier drinnen wachsen, und ihr empfindet ihn auch und sollt ihn empfinden. Aber versteht mich nicht falsch! ›Hie Spanien – hie Niederland!‹ heißt das Geschrei und nicht: ›Hie römisch und hie reformirt!‹ Dem Herrn mag wohl jeder Glaube recht sein, wenn der Mensch nur ernstlich bestrebt ist, auf Christi Wegen zu wandeln. Am Himmelsthrone wird nicht gefragt: Papistisch, kalvinisch oder lutherisch? sondern: Wie warst du gesinnt, und wie hast du gehandelt? Achtet Jedermanns Glauben; aber den, der gegen die Freiheit des Vaterlandes mit dem Zwingherrn gemeinsame Sache macht, den mögt ihr verachten. Nun betet still. So. Und nun gehet nach Hause!«
Die Schüler erhoben sich; van Hout wischte den Schweiß von der hohen Stirn und sagte dann, während die Knaben die Bücher, Stifte und Federn zusammennahmen, zögernd und als habe er sich wegen des Gesagten vor sich selbst zu entschuldigen:
»Was ich euch da mit auf den Weg gab, das gehört vielleicht nicht in die Schule; aber, ihr Buben, dieser Kampf ist noch lange nicht am Ende, und ihr habt die Schulbank zwar noch ein Weilchen zu drücken, aber ihr seid doch auch künftige Kämpfer. Löwing, bleib' zurück, ich möchte Dir etwas sagen.«
Der Magister wandte den Buben langsam den Rücken und diese stürzten in's Freie.
In einem Winkel des Petrikirchplatzes, der hinter dem Gotteshause lag und von wenigen Vorübergehenden berührt ward, blieben sie stehen, und aus ihrem wilden Durcheinanderrufen entstand eine Art von Berathung, zu welcher sich der aus der Kirche dringende Orgelton gar sonderbar ausnahm.
Es galt, sich über das am Nachmittag vorzunehmende gemeinsame Spiel zu verständigen.
Daß es nach der Rede des Stadtsekretärs eine Schlacht geben mußte, verstand sich von selbst, das war auch von Keinem vorgeschlagen worden, sondern die Voraussetzung, von der die nun folgende Verhandlung ausging.
Bald hatte sich's entschieden, daß nicht Griechen und Perser, sondern Patrioten und Spanier gegeneinander in die Schranken treten sollten; als aber der vierzehnjährige Bürgemeisterssohn Adrian van der Werff vorschlug, schon jetzt die Parteien zu bilden, und mit der ihm eigenen gebieterischen Art Paul van Swieten und Klaus Dirkson zu Spaniern zu machen versuchte, stieß er auf heftigen Widerspruch, und es ergab sich der bedenkliche Umstand, daß sich Niemand entschließen wollte, einen wälschen Soldaten vorzustellen.
Jeder Knabe wollte den andern zum Kastilianer machen und selbst unter Niederlands Fahnen kämpfen. Aber Freund und Feind gehören nun einmal zum Kriege, und Hollands Heldenmuth brauchte Spanier, um sich bethätigen zu können. Die jungen Geister erhitzten sich, die Wangen der Streitenden begannen zu glühen, hie und da erhoben sich schon geballte Fäuste und Alles deutete darauf hin, daß der dem Landesfeinde zu liefernden Schlacht ein gräßlicher Bürgerkrieg vorangehen werde.
Freilich waren diese munteren Burschen wenig geschickt, die Rolle der finsteren, steifnackigen Krieger des Königs Philipp zu spielen. Unter lauter Blondköpfen sah man nur wenig Knaben mit braunem und einen einzigen mit schwarzem Haar und dunklen Augen. Das war Adam Baersdorp, dessen Vater wie der van der Werff's zu den Führern der Bürgerschaft gehörte. Als auch er sich weigerte, einen Spanier zu spielen, rief einer der Knaben:
»Du willst nicht? Und mein Vater sagt doch, Deiner wäre auch so ein halber Glipper und dabei ein ganzer Papist.«
Der junge Baersdorp warf bei diesen Worten die Bücher zur Erde und drang mit erhobenen Fäusten auf seinen Gegner ein, – Adrian van der Werff trat aber schnell zwischen die Streitenden und rief:
»Schäme Dich, Cornelius . . . Wer hier noch einmal so schimpft, dem stopf' ich das Maul. Katholiken sind Christen wie wir. Ihr habt's von dem Stadtsekretarius gehört, und mein Vater sagt's auch! Willst Du Spanier sein, Adam, ja oder nein?«
»Nein!« rief dieser entschieden. »Und wenn Jemand noch einmal...«
»Nachher mögt ihr raufen,« unterbrach Adrian van der Werff den erregten Genossen und fuhr dann, indem er die Bücher, welche Baersdorp zu Boden geworfen, gutmüthig aufhob und sie ihm reichte, entschieden fort: »Ich bin heute Spanier. Wer noch?«
»Ich, ich, meinetwegen ich auch,« riefen mehrere Schüler und die Bildung der Parteien würde in bester Ordnung zu Ende geführt worden sein, wenn nicht die Aufmerksamkeit der Knaben durch etwas Neues von ihrem Vorhaben abgelenkt worden wäre.
Ein junger Herr, dem ein schwarzer Diener folgte, kam die Straße herauf und gerade auf sie zu. Er war auch ein Niederländer, aber er hatte wenig mehr mit den Schülern gemein als das Alter, ein weiß und rothes Gesicht, blondes Haar und blaue, hell und übermüthig in's Leben schauende Augen. – Jeder seiner Schritte gab Zeugniß, daß er sich als etwas Besonderes fühlte, und der Mohrenjunge in bunter Tracht, welcher ihm einige neu eingekaufte Gegenstände nachtrug, ahmte in komischer Weise seine Haltung nach. Der Kopf des Negers war noch tiefer nach rückwärts geneigt, als der des Junkers, den eine steife spanische Halskrause hinderte, sein hübsches Haupt so frei wie andere Menschenkinder zu tragen.
»Der Aff', der Wibisma,« sagte einer der Schüler und zeigte mit dem Finger auf den immer näher herankommenden Junker.
Die Augen aller Knaben wandten sich diesem zu und musterten höhnisch seinen kleinen mit einer Feder geschmückten Sammethut, sein rothes gestepptes und an Brust und Aermeln aufgepolstertes Atlaßgewand, die weiten Puffen seiner kurzen bräunlichen Hosen und den leuchtenden Scharlach des seidenen Strumpfwerks, das sich eng an das wohlgebaute Bein schmiegte.
»Der Aff',« wiederholte Paul van Swieten. »Er ist kardinal'sch, drum geht er so roth.«
»Und so spanisch, als käme er geradewegs aus Madrid,« rief ein anderer Knabe, und ein dritter fügte hinzu:
»Hier gewesen sind die Wibisma wenigstens nicht, so lange das Brod bei uns knapp war.«
»Die Wibisma sind allesammt Glipper.«
»Und das stolzirt hier am Alltag in Sammet und Seide herum,« sagte Adrian. »Seht nur den schwarzen Buben, den der rothbeinige Storch mit nach Leyden gebracht hat.«
Die Schüler erhoben ein lautes Gelächter, und sobald der Junker sie völlig erreicht hatte, schnarrte Paul van Swieten ihm mit näselnder Stimme zu:
»Wie ist euch das Ausreißen bekommen? Wie geht es in Spanien, Herr Glipper?«
Der Junker warf den Kopf weiter zurück, der Neger hinter ihm that das Gleiche, und Beide gingen ruhig weiter, auch noch als Adrian ihm in's Ohr rief:
»Glipperchen! Sage mir doch, um wie viel Silberlinge hat Judas den Heiland verschachert?«
Der junge Matenesse van Wibisma machte eine unwillige Bewegung, hielt aber immer noch an sich, bis ihm Jan Mulder in den Weg trat, ihm sein kleines Baret von Tuch, an dem eine Hahnenfeder steckte, wie ein Bettler unter das Kinn hielt und demüthig bat:
»Schenkt mir einen Ablaßgroschen für unsern Kater, Herr Grande; er hat gestern dem Metzger ein Kalbsbein gestohlen.«
»Aus dem Weg!« sagte nun der Junker stolz und entschieden und versuchte es, Mulder mit der Rückseite der Hand bei Seite zu drängen.
»Nicht anfassen, Glipper!« rief jetzt der Schüler und erhob drohend die Faust.
»So laßt mich in Ruh',« entgegnete Wibisma. »Ich suche keine Händel und am letzten mit euch.«
»Warum denn nicht mit uns?« fragte Adrian van der Werff, den der kühl-hochmüthige Ton der letzten Worte verdroß.
Der Junker zuckte wegwerfend die Achseln. Adrian aber rief: »Weil Dein spanisch Gewand Dir besser gefällt als unsere Wämmser von Leydener Tuch.«
Hier schwieg Adrian, denn Jan Mulder schlich sich hinter den Junker, schlug ihm mit einem Buch auf den Hut und rief, während Nicolas van Wibisma die Augen von der sie beschattenden Kopfbedeckung zu befreien suchte: »So, Herr Grande, nun sitzt das Hütlein fest. Du darfst es ja aufbehalten, auch vor dem König.«
Der Neger konnte seinem Herrn nicht beispringen, denn auf seinen beiden Armen ruhten Pakete und Düten. Der junge Edelmann rief ihn auch nicht, denn er wußte, wie feig sein schwarzer Diener war, und er fühlte sich stark genug, um sich selbst zu helfen.
An seinem Hute hielt eine kostbare Agraffe, die er erst neulich an seinem siebenzehnten Geburtstage zum Geschenk erhalten hatte, eine stolze Straußenfeder fest; aber er dachte nicht an sie, warf den Hut von sich, streckte die Arme wie zum Ringkampfe aus und fragte mit glühenden Wangen laut und entschieden: »Wer hat das gethan?«
Jan Mulder war rasch in den Kreis seiner Genossen zurückgewichen, und statt hervorzutreten und seinen Namen zu nennen, rief er lachend:
»Suche den Hutwalker, Glipper! Wir wollen Blindekuh spielen.«
Der Junker wiederholte nun dringender und außer sich vor Zorn seine Frage.
Als statt jeder andern Antwort die Schüler auf Jan Mulder's Scherz eingingen und munter durcheinander schrieen: »Blindekuh spielen! Den Hutwalker suchen! Glipperchen, mach' Du den Anfang!« da hielt sich Nicolas nicht länger und rief wüthend in die lachende Schaar hinein: »Feiges Lumpengesindel!«
Kaum war dieß Wort verklungen, als Paul van Swieten seine in Schweinsleder gebundene kleine Grammatik erhob und sie Wibisma vor die Brust warf. Unter lautem Geschrei folgten dem Donatus andere Bücher nach und schlugen dem Edelknaben an die Schultern und Beine. Verwirrt und sein Antlitz mit den Händen schützend, zog er sich an die Mauer der Kirche zurück. Dort blieb er stehen und schickte sich an, sich auf seine Feinde zu stürzen.
Die steife und modisch hohe spanische Krause beengte nun nicht mehr seinen schönen, von goldenen Locken umwallten Kopf. Frei und kühn schaute er seinen Gegnern in's Antlitz, streckte die durch manche ritterliche Uebung gestählten sechzehnjährigen Glieder und stürzte sich dann mit einem echt niederländischen Fluche auf den ihm am nächsten stehenden Adrian van der Werff.
Nach kurzem Ringen lag der seinem Gegner an Alter und Kraft nachstehende Bürgemeisterssohn am Boden; aber nun legten die anderen Schüler, welche dabei nicht aufhörten, »Glipper« und wieder »Glipper« zu schreien, Hand an den Junker, welcher auf dem Ueberwundenen kniete.
Nicolas wehrte sich tapfer, aber die Uebermacht seiner Gegner war zu groß. Außer sich, seiner selbst vor Ingrimm und Scham nicht mehr mächtig, riß er den Dolch aus dem Gürtel.
Jetzt erhoben die Knaben ein furchtbares Gezeter, und zwei von ihnen warfen sich auf Nicolas, um ihm die Waffe zu entwinden. Dies gelang ihnen schnell; der Dolch flog auf das Pflaster, aber Paul van Swieten sprang klagend zurück, denn die scharfe Klinge hatte seinen Arm getroffen, und helles Blut floß auf den Boden.
Minutenlang übertönte das Geschrei der Knaben und das Jammergeheul des Schwarzen das schöne Orgelspiel, welches aus den Fenstern der Kirche drang. Plötzlich verstummte die Musik: statt der kunstvoll vorgetragenen Weise ließ sich nur noch der langsam ausklingende Klageton einer einzelnen Pfeife vernehmen, und ein junger Mann stürzte aus der Sakristeipforte des Gotteshauses hervor. Schnell überblickte er die Ursache des wilden Getöses, welches ihn in seiner Uebung gestört hatte. Sein hübsches, von einem kurzen Vollbart umrahmtes Gesicht, welches eben noch erschreckt genug dreingeschaut hatte, begann zu lächeln, aber die Scheltworte und Handbewegungen, mit denen er die ergrimmten Burschen auseinandertrieb, waren doch ernstlich genug und verfehlten keineswegs ihre Wirkung.
Die Schüler kannten den Musiker Wilhelm Corneliussohn und setzten ihm keinen Widerstand entgegen, denn sie mochten ihn leiden, und das Dutzend Jahre, welches er vor ihnen voraus hatte, verlieh ihm ihnen gegenüber ein unbestrittenes Ansehen. Keine Hand rührte sich mehr gegen den Junker, aber die Buben umringten nun den Orgelspieler, um durcheinander redend und schreiend Nicolas anzuklagen und sich selbst zu vertheidigen.
Paul van Swieten's Wunde war leicht. Er stand außerhalb des Kreises seiner Kameraden und stützte den verletzten linken Arm mit der rechten Hand. Manchmal blies er auf die mit einem Tüchlein umwickelte brennende Stelle im Fleische, aber die Neugier auf den Ausgang dieses unterhaltenden Streites war stärker als der Wunsch, sich verbinden und heilen zu lassen.
Als das Werk des Friedensstifters sich bereits dem Abschluß näherte, rief der Verwundete plötzlich, indem er mit der gesunden Hand nach der Richtung der Schule hinwies, seinen Kameraden warnend zu:
»Da kommt der Herr von Nordwyk! Laßt den Glipper, sonst wird's etwas setzen!«
Paul van Swieten nahm seinen wunden Arm wieder in die Rechte, und lief schnell um die Kirche herum. Mehrere andere Knaben folgten ihm, aber der neue Ankömmling, vor dem ihnen bangte, hatte junge, kaum dreißigjährige Beine von beträchtlicher Höhe und wußte sie wacker zu brauchen.
»Halt, ihr Buben!« rief er mit weithin tönender Kommandostimme. »Halt! Was hat's da gegeben?«
Jedermann in Leyden zollte dem hochgelehrten und tapfern jungen Edelmanne große Achtung, und so blieben denn sämmtliche Knaben, welche den Warnruf des Verwundeten nicht sogleich beachtet hatten, stehen, bis der Herr von Nordwyk sie erreicht hatte.
Ein sonderbar lebhaftes Leuchten flackerte aus den klugen Augen, und ein feines Lächeln umspielte den schnurrbärtigen Mund dieses Mannes, als er dem Musiker zurief:
»Was hat's hier gegeben, Meister Wilhelm? Ist das Geschrei der Jünger Minerva's mit Eurem Orgelspiel nicht in Harmonie zu bringen gewesen, oder hat – aber bei allen Farben der Iris, das ist ja Nico Matenesse, der junge Wibisma! Und wie sieht der Junker aus! Rauferei im Schatten der Kirche, und Du dabei, Adrian, und Ihr dabei, Meister Wilhelm?«
»Ich brachte sie auseinander,« entgegnete der Angeredete gelassen und strich die verschobenen Manschetten zurecht.
»Mit aller Ruhe, aber mit Nachdruck, wie beim Orgelspiele,« lachte der Kommandant. »Wer hat den Streit begonnen? Ihr, Junker? Oder die Anderen?«
Nicolas fand vor Erregung, Scham und Ingrimm keine zusammenhängenden Worte. Adrian aber trat vor und sagte: »Wir haben mit einander gerungen. Haltet es uns zugute, Herr Janus!«
Nicolas warf seinem Gegner einen freundlichen Blick zu.
Der Herr von Nordwyk, Jan van der Does, oder, wie er sich als Gelehrter selbst zu nennen liebte, Janus Dousa, war aber keineswegs mit dieser Auskunft zufrieden, sondern rief: »Geduld, Geduld! Du siehst verdächtig genug aus, Meister Adrian; tritt einmal hieher und erzähle mir, »atrekos«, der Wahrheit gemäß, was hier vorging.«
Der Schüler folgte diesem Geheiß und that es ehrlich, ohne etwas von dem Geschehenen zu verschweigen oder zu beschönigen.
»Hm,« machte Dousa, nachdem der Knabe seinen Bericht geschlossen. »Ein schwerer Fall. Freizusprechen ist Keiner. Eure Sache wäre die bessere ohne das Messer, mein feiner Herr Junker, aber Du, Adrian, und ihr, ihr pausbäckigen Lümmel, die eure ... Da hinten kommt der Herr Rektor ... Wenn er euch einfängt, so bekommt ihr an diesem schönen Tage gewiß nicht mehr als vier Wände zu sehen. Das sollte mir leid thun.«
Die pausbäckigen Lümmel und Adrian mit ihnen verstanden diesen Wink und jagten ohne Abschied wie eine vom Habicht verfolgte Taubenschaar um die Kirche herum.
Sobald sie verschwunden waren, näherte sich der Kommandant dem jungen Nicolas und sagte:
»Aergerliche Geschichten! Was Denen da recht war, ist Euch billig. Macht, daß Ihr nach Haus kommt! Seid Ihr bei Eurer Base zu Gast?«
»Ja, Herr,« entgegnete der Junker.
»Ist Euer Vater auch in der Stadt?«
Der Junker schwieg.
»Er will nicht gesehen sein?«
Nicolas nickte bejahend, und Dousa fuhr fort:
»Leyden steht jedem Holländer offen, auch Euch. Wenn Ihr freilich wie der Page des Königs Philipp einhergeht und denen, die Euresgleichen sind, Mißachtung erweist, so habt Ihr die Folgen selbst zu tragen. Da liegt Euer Dolch, junger Freund, und da Euer Hut. Hebt beide auf und laßt Euch bedeuten, daß solche Waffe kein Spielzeug ist. Manchem hat ein Augenblick, in dem er sie unbesonnen brauchte, ein ganzes Leben verdorben. Die Uebermacht, die Euch bedrängte, mag Euch entschuldigen. Aber wie kommt Ihr mit diesem zerfetzten Wamms ohne Schande bis zum Haus Eurer Base?«
»Mein Mantel ist in der Kirche,« sagte der Musiker, »ich geb' ihn dem Junker.«
»Brav, Meister Wilhelm!« entgegnete Dousa. »Wartet hier, Herrlein, und geht dann nach Hause. Ich wollte, die Zeit käme wieder, in der Euer Vater sich aus meinem Gruß etwas machte. Wißt Ihr auch, weßwegen er ihm nicht mehr genehm ist?«
»Nein, Herr.«
»So will ich es Euch sagen. Weil er gern Spanisch hört und ich beim Niederländischen bleibe.«
»Wir sind Holländer wie Ihr,« entgegnete Nicolas mit erglühenden Wangen.
»Kaum,« gab Dousa gelassen zurück, legte die Hand an das hagere Kinn und gedachte zu dem scharfen ein freundlicheres Wort zu fügen, als der Junker heftig ausrief:
»Herr von Nordwyk, dies »Kaum« nehmt Ihr zurück!«
Dousa schaute erstaunt dem kühnen Knaben in's Antlitz, und wieder zuckte es heiter um seinen Mund. Dann sagte er freundlich:
»Mein Herr Nicolas, Ihr gefallt mir; und wenn Ihr ein rechter Holländer werden wollt, so soll es mich freuen. Da kommt Meister Wilhelm mit seinem Mantel. Gebt mir die Hand. Nein, nicht diese, die andere!«
Nicolas zögerte; Janus aber erfaßte mit beiden Händen des Knaben Rechte, beugte die hohe Gestalt zu dem Ohre desselben hernieder und sagte so leise, daß der Musiker ihn nicht verstehen konnte: »Bevor wir scheiden, nehmt von Einem, der es gut meint, dies Wort mit auf den Weg: Ketten, auch goldene, ziehen herab, aber die Freiheit gibt Flügel. Ihr spiegelt Euch in dem gleißenden Prunk, wir aber schlagen mit dem Schwert auf die spanischen Fesseln, und ich lobe mir unsere Arbeit. – Denkt an dies Wort, und wenn's Euch beliebt, so kündet es auch Eurem Vater.«
Janus Dousa wandte dem Knaben den Rücken, winkte dem Musiker grüßend zu und ging von dannen.
Zweites Kapitel
Der junge Adrian eilte den Werffsteg hinab, welcher seinem Geschlecht den Namen gegeben. Er beachtete weder die Linden zu beiden Seiten, in deren Kronen die ersten grünen Blättchen sich aus den spitzen Knospenhüllen hervordrängten, noch die Vögel, welche Nester bauend und zwitschernd in den gastlichen Zweigen der stattlichen Bäume hin und her flogen, denn er hatte nichts im Sinne, als möglichst schnell nach Hause zu kommen.
Jenseits der die Achtergracht überspannenden Brücke blieb er unschlüssig vor einem großen Gebäude stehen.
An der Mittelthür desselben hing der Klopfer, aber er wagte nicht sogleich ihn zu heben und ihn auf die glänzende Platte unter dem Schlosse fallen zu lassen, denn er hatte bei den Seinen keinen frohen Empfang zu erwarten.
Sein Wämmschen[3] war beim Ringen mit dem stärkeren Gegner übel zugerichtet worden. Die zerrissene Halskrause hatte ihren rechtmäßigen Platz eingebüßt und sich's gefallen lassen müssen, in eine Tasche zu wandern, und das neue violette Strumpfwerk an seinem rechten Beine, dies unglückselige Strumpfwerk, war auf dem Pflaster völlig durchgerieben worden, und die große klaffende Wunde in demselben zeigte weit mehr von Adrian's weißem Knie, als ihm lieb war.
Die Pfauenfeder an dem sammetnen Mützlein ließ sich leicht ersetzen, aber das Wamms war nicht an der Naht, sondern im Tuche zerrissen und das Strumpfwerk kaum mehr zu stopfen.
Das that dem Knaben aufrichtig leid, denn der Vater hatte befohlen, das Zeug gut zu halten, um die Pfennige zu sparen; ging es doch in dieser Zeit knapp her in dem großen Hause, das mit drei Thüren, ebenso vielen mit schön geschwungenen Voluten geschmückten Giebeln und sechs Fenstern im untern und obern Stock gar stolz und stattlich dem Werffsteg zugewandt war.
Die Bürgemeisterei trug nicht viel ein, und das großväterliche Gewerbe der Sämischlederbereitung, sowie der Handel mit Fellen gingen rückwärts, denn dem Vater lagen andere Dinge im Sinne, Dinge, die nicht nur seinen Geist, seine Kraft und Zeit, sondern auch jeden überflüssigen Heller in Anspruch nahmen.
Adrian hatte zu Hause nichts Gutes zu erwarten, – gewiß nicht vom Vater und noch weniger von Frau Barbara, seiner Base.
Aber der Knabe fürchtete sich doch noch weniger vor dem Zorne dieser beiden, als vor einem unzufriedenen Blicke aus den Augen der jungen Frau, welche er seit kaum zwölf Monaten »Mutter« nannte und die nur sechs Jahre mehr als er selber zählte.
Sie sagte ihm niemals ein unfreundliches Wort, aber vor ihrer Schönheit, ihrem stillen, vornehmen Wesen zerschmolzen sein Trotz und seine Wildheit. Ob er sie lieb hatte, wußte er selbst nicht recht, aber sie kam ihm vor wie die gute Fee, von der die Märchen erzählten, und es wollte ihm oft scheinen, als ob sie viel zu zart und fein und holdselig für ihr einfach bürgerlich Haus wäre. Sie lächeln zu sehen machte ihn glücklich, und wenn sie traurig dreinschaute – und das kam nicht eben selten vor – so that ihm das Herz weh. Gütiger Himmel! Freundlich konnte sie ihn gewiß nicht empfangen, wenn sie dies Wamms anschaute und die Krause da in der Tasche und das unglückselige Strumpfwerk!
Und dann!
Da läutete es wieder!
Die Essenszeit war längst vorbei, und der Vater wartete auf Keinen. Wer zu spät kam, der hatte das Nachsehen, wenn sich seiner nicht Base Barbara in der Küche erbarmte.
Aber was half das Bedenken und Zaudern?
Adrian raffte sich auf, biß die Zähne zusammen, preßte die Linke fester um die zerrissene Halskrause in der Tasche und ließ den Klopfer kräftig auf die Stahlplatte schlagen.
Trautchen, die alte Magd, öffnete die Thür und bemerkte in der weiten, halbdunklen Hausflur, in welcher dicht aneinandergereiht die Lederballen lagerten, nichts von der Verwahrlosung seines äußern Menschen.
Schnell eilte er die Stiege hinauf.
Das Speisezimmer stand offen, und – oWunder! – der gedeckte Tisch war noch unberührt – der Vater mußte länger als sonst auf dem Rathhause geblieben sein.
In großen Sätzen sprang Adrian auf sein Giebelstübchen, kleidete sich säuberlich um und trat, bevor der Hausherr den Segen gesprochen, zu den Seinen. In einer gelegenen Stunde konnten Wamms und Strumpfwerk den bessernden Händen der Base Barbara oder Trautchen's übergeben werden.
Adrian griff wacker in die dampfende Schüssel; aber bald ward ihm schwül um's Herz, denn der Vater sprach kein Wort und blickte so ernst und besorgt vor sich hin wie damals, als die Noth in der belagerten Stadt stieg.
Des Knaben junge Stiefmutter saß ihrem Gatten gegenüber und blickte oft in das ernste Antlitz Peter's van der Werff, um einem freundlichen Blick von ihm zu begegnen.
Jedesmal, wenn sie das vergeblich gethan, strich sie das feine, goldblonde Haar von der Stirn, warf den schönen kleinen Kopf zurück oder biß sich leicht in die Lippe und schaute still auf ihren Teller.
Auf der Base Barbara Fragen: »Was gab es im Rath? Kommt das Geld zu der neuen Glocke zusammen? Gebt ihr Jakob van Sloten die Wiese in Pacht?« gab er kurze, halb ablehnende Antworten.
Der feste Mann, der da so schweigsam und mit zusammengezogenen Brauen unter den Seinen saß und einigemal hastig, dann aber gar nicht wieder in die Schüssel griff, sah nicht aus wie Einer, der sich müßigen Launen hingibt.
Noch sprachen alle Anwesenden, nun auch Magd und Knecht, den Speisen zu, als der Hausherr sich plötzlich erhob und, indem er die zusammengefalteten Hände an den stark vorspringenden Hinterkopf preßte, stöhnend ausrief: »Ich kann nicht mehr. Sprich Du das Dankgebet, Maria. Geh' auf's Rathhaus, Janche, und frag', ob noch kein Bote herein ist.«
Der Knecht wischte sich den Mund und gehorchte sogleich. Es war ein großer, breitschultriger Friese, aber er reichte seinem Herrn nur bis an die Stirn.
Ohne die Seinen zu grüßen, wandte Peter van der Werff den Rücken, öffnete die zu seinem Arbeitszimmer führende Thür, zog sie, nachdem er die Schwelle überschritten, scharf in's Schloß und trat dann an den großen, aus Eichenholz festgefügten Schreibtisch, auf dem Papiere und Briefe in hohen, mit rohen Bleiplatten beschwerten Stößen geordnet lagen, und begann in den neu angekommenen Akten zu blättern. Eine Viertelstunde lang suchte er vergebens zu der nöthigen Aufmerksamkeit zu gelangen. Dann ergriff er den Arbeitsstuhl, um die gekreuzten Arme auf seine hohe, durchbrochene Rückenlehne von einfachem Schnitzwerk zu stützen. Dabei schaute er nachdenklich zu dem Holzgetäfel der Zimmerdecke hinauf. Nach einigen Minuten schob er mit dem Fuß den Sessel bei Seite, hob die Hand zum Munde, trennte den Schnurrbart von dem starken braunen Kinnbart und trat an's Fenster. Die kleinen, kreisrunden, mit Bleirahmen verbundenen Scheiben gestatteten, so spiegelblank sie auch geputzt sein mochten, doch nur einen engbegrenzten Theil der Straße zu überblicken, aber der Bürgemeister schien das, wonach er ausschaute, gefunden zu haben; denn er stieß das Fenster hastig auf und rief dem Knechte, welcher sich eilends dem Hause näherte, entgegen:
»Aufgeschaut, Janche; ist er herein?«
Der Friese schüttelte verneinend den Kopf, das Fenster flog wieder zu, und wenige Augenblicke später griff der Bürgemeister nach dem Hute, welcher zwischen einigen Reiterpistolen und einem einfachen derben Degen unter dem Bilde einer jungen Frau an der einzigen nicht völlig nackten Wand seines Zimmers hing.
Die marternde Unruhe, welche ihn erfüllte, duldete ihn nicht länger im Hause.
Er wollte das Pferd satteln lassen und dem erwarteten Boten entgegenreiten.
Ehe er das Zimmer verließ, blieb er sinnend stehen und trat dann noch einmal vor den Schreibtisch, um einige Papiere zu unterschreiben, die für das Rathhaus bestimmt waren; denn es konnte bis zu seiner Heimkehr Nacht werden.
Stehend überflog er die beiden Blätter, welche er vor sich ausgebreitet hatte, und griff nach der Feder. Da öffnete sich leise die Thür des Gemaches, und der frische Sand, mit dem die weißen Dielen bestreut waren, knisterte unter einem zierlichen Fuße. Er hörte es wohl, ließ sich aber nicht stören.
Jetzt stand sein Weib dicht hinter ihm. Vierundzwanzig Jahre jünger als er, glich sie ganz einem schüchternen Mädchen, als sie nun ihren Arm erhob und es doch nicht wagte, die Aufmerksamkeit ihres Gatten von den Geschäften abzulenken.
Ruhig wartete sie, bis er das erste Papier unterzeichnet hatte, dann wandte sie den lieblichen Kopf zur Seite und rief mit gesenkten Augen und leicht erröthend:
»Ich bin es, Peter!«
»Gut, mein Kind,« entgegnete er kurz und näherte die zweite Schrift den Augen.
»Peter!« rief sie zum andern Male, dringender als vorher, aber immer noch schüchtern. »Ich habe Dir etwas zu sagen.«
Van der Werff wandte das Haupt zu ihr hin, warf ihr einen kurzen, freundlichen Blick zu und sagte:
»Jetzt, Kind? Du stehst, ich habe zu thun, und da liegt schon mein Hut.«
»Aber Peter!« entgegnete sie; und es blitzte etwas wie Unwillen aus ihren Augen, während sie mit kaum merklich klagender Stimme fortfuhr: »Wir haben heute noch gar nicht mit einander geredet. Mir ist das Herz so voll, und was ich Dir sagen möchte, das ist, das muß ja...«
»Wenn ich heimkomme, Maria, jetzt nicht,« gab er sie unterbrechend zurück und seine tiefe Stimme klang dabei halb ungeduldig, halb bittend. »Erst die Stadt und das Land, – dann die Minne.«
Maria warf bei diesen Worten das Haupt zurück und sagte mit zuckenden Lippen:
»Das ist Deine Rede seit dem ersten Tag unserer Ehe.«
»Und leider, – leider – sie muß es bleiben, bis wir am Ziel sind,« entgegnete er fest.
Da stieg ihr das Blut in die zarten Wangen und rascher athmend rief sie schnell und entschieden:
»Ja wohl, dies Wort kenne ich seit Deiner Werbung, und ich bin meines Vaters Tochter und war ihm niemals entgegen, aber nun paßt es nicht mehr auf uns Beide und es sollte lauten: »Alles für's Land, und dem Weibe gar nichts«.«
Van der Werff legte die Feder aus der Hand und wandte sich voll seiner jungen Gattin zu.
Ihre schlanke Gestalt schien gewachsen zu sein und ihre in Thränen schwimmenden blauen Augen leuchteten stolz. Wie von Gott für ihn, und eigens für ihn geschaffen war diese Gefährtin. Das Herz ging ihm auf. Freimüthig streckte er dem geliebten Wesen beide Hände entgegen und sagte innig:
»Du weißt, was es gilt! Dies Herz ist unwandelbar, und es kommen andere Zeiten.«
»Wann werden sie kommen?« fragte Maria so dumpf, als glaubte sie nicht an eine bessere Zukunft.
»Bald!« entgegnete ihr Gatte fest. »Bald, wenn jetzt nur ein Jeder willig gibt, was das Vaterland fordert.«
Das junge Weib löste bei diesen Worten die Hände aus denen des Gatten; denn die Thür hatte sich geöffnet, und Frau Barbara rief von der Schwelle her ihrem Bruder entgegen:
»Herr Matenesse van Wibisma, der Glipper, steht in der Hausflur und will Dich sprechen.«
»Führ' ihn herauf,« sagte der Bürgemeister verdrossen.
Als er mit seiner Gattin wieder allein war, fragte er schnell:
»Willst Du Nachsicht üben, und willst Du mir helfen?«
Sie nickte bejahend und versuchte dabei zu lächeln.
Er merkte, daß sie nicht froh war, und weil ihm das wehe that, streckte er ihr nochmals die Hand entgegen und sagte:
»Es kommen bessere Tage, in denen ich Dir mehr sein darf als heute. Was wolltest Du mir vorhin sagen?«
»Ob Du es weißt oder nicht weißt, – für den Staat hat es nichts zu bedeuten.«
»Aber für Dich. So hebe nur wieder den Kopf und schaue mich an. Mach' schnell, Liebe, denn da sind sie schon auf der Treppe.«
»Es ist der Rede nicht werth. – Heute vor einem Jahre, – heute könnten wir unsern Hochzeitstag feiern.«
»Unsern Hochzeitstag!« rief er und schlug laut in die Hände. »Ja, richtig, wir schreiben den siebenzehnten Aprilis, und das, das hab' ich vergessen!« Liebreich zog er sie an sich, da ging schon die Thür, und Adrian führte den Baron in das Zimmer.
Van der Werff verneigte sich höflich vor dem seltenen Gast, dann rief er seiner Gattin, die sich erröthend entfernte, herzlich nach:
»Meinen Glückwunsch also! Ich komme nachher. Adrian, wir feiern heut ein schönes Fest, unsern Hochzeitstag, daß Du's weißt.«
Der Knabe schlüpfte schnell aus der Thür, die er noch in der Hand hielt; denn ihm ahnte, daß der vornehme Besuch auch für ihn nichts Gutes bedeute.
In der Hausflur blieb er sinnend stehen. Dann eilte er schnell die Treppe hinauf, holte sein federloses Mützlein und eilte hinaus vor das Thor.
Draußen sah er seine Kameraden, die sich mit Stöcken und Stangen in Schlachtordnung stellten.
Wohl hätte er sich gern an dem Kriegsspiel betheiligt; aber eben deswegen wollte er in diesem Augenblick das Rufen der Streiter lieber gar nicht hören und lief dem Zylhofe zu, bis er aus dem Bereich ihrer Stimmen war.
Nun hemmte er den Schritt und folgte in gebückter Haltung, manchmal auf den Knieen, einem kleinen, in den alten Rhein mündenden Graben.
Sobald seine Mütze von den weißen, blauen und gelben Frühlingsblumen, die er gepflückt hatte, übervoll war, setzte er sich auf einen Grenzstein, vereinte jene mit leuchtenden Augen zu einem schönen bunten Strauß und lief mit ihm nach Hause.