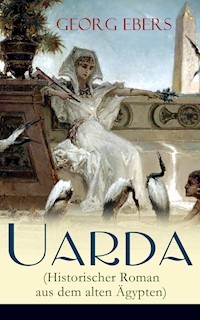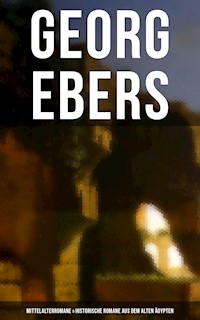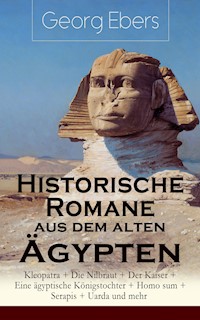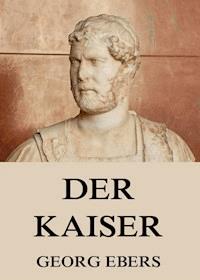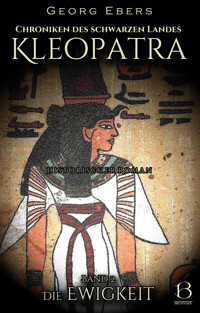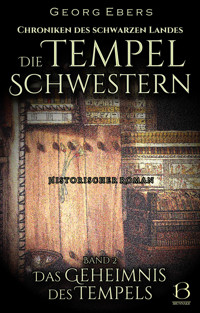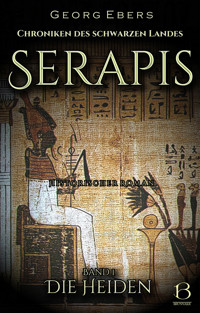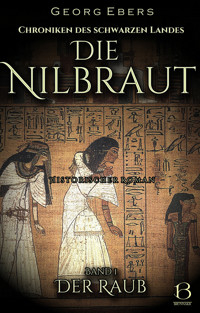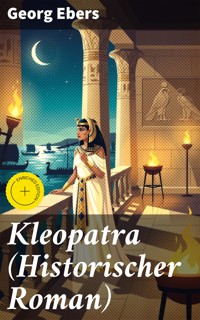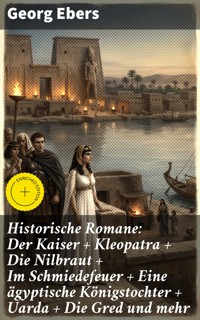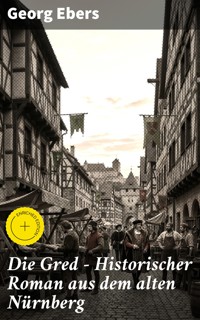
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Die Gred - Historischer Roman aus dem alten Nürnberg" entführt Georg Ebers den Leser in eine faszinierende Welt des 15. Jahrhunderts. Ebers schildert in einem lebendigen und detailreichen Stil die politischen und sozialen Verhältnisse Nürnbergs zur Zeit des späten Mittelalters. Durch geschickte Charakterzeichnung und einen spannenden Plot gelingt es ihm, die Konflikte zwischen Zünften, Bürgern und Adel anschaulich darzustellen, während er gleichzeitig das alltägliche Leben und die Bräuche der damaligen Zeit einfängt. Die Mischung aus fiktiven und historischen Figuren verleiht dem Roman eine authentische Tiefe und macht die historisch verankerten Ereignisse nachvollziehbar und greifbar. Georg Ebers, ein renommierter deutscher Schriftsteller und Ägyptologe, war bekannt für seine intensive Forschung und seine Leidenschaft für die Geschichte. Seine tief verwurzelte Neigung zur Geschichtsschreibung, gepaart mit seinem Interesse an der Kultur und den sozialen Strukturen vergangener Epochen, hat ihn dazu inspiriert, historische Romane zu verfassen. Ebers' interdisziplinärer Zugang und seine profunden Kenntnisse der Geschichte lassen seine Werke stets einen Anklang von Authentizität und Detailgenauigkeit aufweisen. "Die Gred" ist nicht nur ein unterhaltsamer Roman, sondern auch ein bereicherndes Zeitzeugnis, das den Leser sowohl emotional als auch intellektuell anregt. Es wird jedem empfohlen, der sich für Geschichte, Gesellschaft und die Dynamiken des menschlichen Verhaltens interessiert. Ebers' fesselnde Erzählweise und die gut recherchierte historische Kulisse machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Teil der deutschen Literatur und einem Muss für historische Romantiker. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Gred - Historischer Roman aus dem alten Nürnberg
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen Bürgerehre und privater Leidenschaft, zwischen der stummen Sprache alter Mauern und den drängenden Wünschen der Lebenden entfaltet sich in Die Gred die Spannung eines Gemeinwesens, das seine Identität im Wechselspiel von Tradition und Erneuerung behaupten muss, während unterschiedliche Lebenswege sich kreuzen, soziale Regeln Verlässlichkeit versprechen und doch beengen, die Erinnerung der Stadt in Werkstätten, Gassen und Häusern eingeschrieben ist, und die Frage nach Recht, Zugehörigkeit und Mitgefühl immer wieder neu verhandelt wird, so dass persönliches Glück und öffentliches Wohl unauflöslich ineinander greifen und das Vergangene als Echo in jede Entscheidung hineinreicht.
Georg Ebers, bekannt als deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts mit Sinn für historische Genauigkeit, legt mit Die Gred einen historischen Roman vor, der in der Stadt Nürnberg verankert ist und den Untertitel Historischer Roman aus dem alten Nürnberg trägt. Das Buch gehört zu seinen Werken, in denen er detaillierte Milieuschilderung mit erzählerischem Gespür verbindet. Statt exotischer Ferne richtet sich der Blick hier auf das urbane Herz des deutschsprachigen Raums, auf eine Stadt, deren Selbstverständnis durch Handwerk, Handel und bürgerliche Ordnung geprägt wurde. Die erzählte Vergangenheit dient nicht als bloße Kulisse, sondern als formende Kraft der Figuren.
Zu Beginn öffnet der Roman den Blick auf ein lebendiges Stadtgebilde, dessen Alltagsrhythmen, Feste und Geschäfte den Ton angeben und den Raum für Begegnungen schaffen, aus denen sich Beziehungen und Konflikte entwickeln. Ohne hastige Zuspitzung entfaltet sich ein Panorama, in dem Menschen aus unterschiedlichen Kreisen einander beobachten, beurteilen und zuweilen missverstehen. Der Einstieg bleibt nah am Stoff und lässt die Zeit aus den Dingen sprechen: aus Kleidung, Werkstücken, Sitten und Räumen. Leserinnen und Leser erleben eine erzählerische Annäherung, die in ruhigen Bewegungen Spannung aufbaut und die Eigenlogik des historischen Alltags spürbar macht, ohne mit Effekten zu drängen.
Die Erzählstimme verbindet eine ruhige, weit ausholende Anlage mit der Nähe zu Gestik, Geräuschen und kleinen Regungen, sodass sich die Figuren nicht als Illustrationen, sondern als handelnde Menschen zeigen. Ebers’ Sprache ist bildhaft, doch kontrolliert; sie verweilt bei Oberflächen, Werkzeugen und Lichtverhältnissen und ergibt daraus eine Atmosphäre, die die Handlung trägt. Der Ton bleibt respektvoll und ernst, ohne in Schwere zu erstarren, und lässt Ironie nur sparsam aufscheinen. Spürbar ist die Sorgfalt des Autors im Umgang mit Quellen und Details, die nie belehrend ausgestellt werden, sondern organisch aus Szenen, Dialogfärbungen und räumlichen Arrangements hervortreten.
Zentrale Themen treten früh hervor: die Spannung zwischen persönlicher Freiheit und der Macht sozialer Erwartungen, die Frage nach Recht und Gerechtigkeit im Gefüge einer Stadt, die von Regeln zusammengehalten wird, und die Wirkung wirtschaftlicher Zwänge auf Nähe und Vertrauen. Herkunft, Handwerk und Bildung formen dabei Identitäten, die nicht starr sind, sondern in Begegnungen und Prüfungen neu austariert werden. Der Stadtraum erscheint als Speicher von Geschichten, in dem jede Schwelle, jedes Werkzeug, jedes Gewand Bedeutung trägt. Liebe, Loyalität und Verantwortung erweisen sich als Haltungen, die sich erst im Angesicht von Risiko und Öffentlichkeit bewähren.
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch relevant, weil es grundlegende Fragen städtischen Zusammenlebens stellt: Wie entsteht Zugehörigkeit, wer trägt Verantwortung, und was geschieht, wenn ökonomische Interessen moralische Maßstäbe verschieben? Die sorgfältige Darstellung von Alltag und Institutionen sensibilisiert dafür, wie Regeln, Rituale und Räume Verhalten lenken. Zugleich lädt die Lektüre dazu ein, eigene Vorstellungen von Herkunft, Leistung und Anerkennung zu prüfen. Indem Geschichte als gelebte Erfahrung erfahrbar wird, öffnet der Roman einen Resonanzraum für aktuelle Debatten über Gemeinsinn, Rechtsstaatlichkeit und Erinnerungskultur, ohne vereinfachende Parallelen zu ziehen oder die Vergangenheit zu romantisieren.
Die Gred empfiehlt sich als Lektüre für Leserinnen und Leser, die historische Romane nicht nur als Kulisse für Abenteuer, sondern als Erkundung sozialer Wirklichkeiten verstehen. Die teils weit geschwungenen Sätze und die reiche Dingwelt erfordern Aufmerksamkeit, belohnen jedoch mit dichter Anschaulichkeit und einem nachhaltigen Gefühl für Zeit und Ort. Wer sich auf das gemessene Tempo einlässt, entdeckt eine Kunst des Erzählens, die Spannung nicht aus Zufallsketten, sondern aus charakterlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Reibung gewinnt. So zeigt der Roman exemplarisch, wie historische Literatur Empathie stiften und Gegenwart mit erinnerter Erfahrung ins Gespräch bringen kann.
Synopsis
Georg Ebers’ historischer Roman Die Gred – Historischer Roman aus dem alten Nürnberg führt in eine dicht recherchierte Welt städtischen Lebens, in der Sitte, Handel und Handwerk den Takt vorgeben. Gleich zu Beginn betont die Erzählung die Bedeutung gemeinschaftlicher Ordnungen und den Klang öffentlicher Räume, wobei die namensgebende Gred als markanter Schauplatz für Begegnungen und Auseinandersetzungen dient. Ohne große Vorrede verknüpft der Text private Lebenswege mit dem Gefüge einer freien Reichsstadt. Leitend sind Fragen nach Ehre, Zugehörigkeit und Verantwortung, die früh angelegt werden und den weiteren Verlauf strukturieren, noch bevor einzelne Konflikte sichtbar eskalieren.
Die ersten Kapitel entfalten das Alltagsbild zwischen Zunftwerkstatt, Kaufmannsstube und Ratsstube und zeigen, wie Regeln des Handwerks, Preis und Maß, Lehrjahre und Bürgereid das Miteinander formen. An der Gred kreuzen sich Wege: Kaufleute handeln, Handwerker verhandeln, Dienstboten und Gesellen tragen Neuigkeiten, während ehrbare Familien ihre Stellung wahren. Aus kleinen Anlässen – einer strittigen Lieferung, einem verletzten Versprechen, einem missdeuteten Wort – wächst spürbare Spannung. Gleichzeitig treten Wünsche nach sozialem Aufstieg, nach Anerkennung oder nach einer eigenständigen Lebenswahl hervor. So bereitet der Roman die Konfliktlinien vor, die persönliche Bindungen und das Gemeinwohl gleichermaßen betreffen und langfristige Folgen nach sich ziehen.
Im weiteren Verlauf verschärfen sich Gegensätze zwischen patrizischer Selbstbehauptung und zünftischer Solidarität, die sich in Ratsbeschlüssen und Marktordnungen niederschlagen. Ein öffentlich ausgetragener Vorfall auf der Gred wirkt wie ein Brennglas: Gerüchte verdichten sich, ein Fehltritt wird zum Prüfstein für Ruf und Zugehörigkeit. Mehrere Figuren geraten in Entscheidungssituationen, in denen Loyalität zu Familie, Zunft und Glaubensüberzeugung mit persönlicher Lauterkeit ringt. Der Roman verknüpft solche Konflikte mit Fragen gerechter Verfahren, der Bedeutung von Zeugenschaft und dem Gewicht des gesprochenen Wortes. Aus der Verdichtung alltäglicher Reibungen wird ein Wendepunkt, der die Beziehungen neu ordnet und Handlungsräume verengt und Erwartungen verschiebt.
Die mittlere Phase beleuchtet die Mechanik städtischer Rechtsprechung und die Bemühungen um Ausgleich. Älteste, Ratsherren und Vermittler suchen nach Formen, die Ehre wahren und Schaden begrenzen, während Haushalte mit materiellen und seelischen Folgen ringen. Der Roman weitet den Blick auf verborgene Arbeit: Buchführung, Vorratshaltung, die Disziplin in Werkstätten, die Ausbildung junger Leute und die oft übersehene Verantwortung von Frauen in Familie und Geschäft. Eine behutsam angelegte Zuneigung gerät unter Druck, weil Standesgrenzen und lange gepflegte Bündnisse Erwartungen setzen. Zugleich entstehen ungewöhnliche Allianzen, die zeigen, wie pragmatische Klugheit und Menschlichkeit über bloße Standeslogik hinausweisen und Handlungsbereitschaft fördern.
Als sich die Spannungen mit äußeren Belastungen überlagern, wird die Belastbarkeit der Stadtordnung sichtbar. Wirtschaftlicher Druck, verletzte Ehre und das Bedürfnis nach Sühne treffen aufeinander und lassen alte Sicherheiten brüchig erscheinen. Die Gred bleibt Schauplatz, an dem sich Solidarität, Taktik und Gelegenheitssinn mischen: Man hilft, handelt, wartet ab. Entscheidungen im Rat spiegeln sich in stillen häuslichen Abwägungen, während eine Reihe kleiner, aber folgenreicher Gesten den Ton setzt. Ein zweiter Wendepunkt zeichnet sich ab, der nicht nur über einzelne Schicksale, sondern auch über das Verständnis von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit innerhalb der städtischen Gemeinschaft mitbestimmt und nachhaltig weiterwirkt.
Auf dem Weg zur Entspannung der Verhältnisse gewinnen Gespräche, Schuldausgleich und redliche Arbeit die Oberhand. Kein triumphaler Umschwung, eher ein tastender Prozess: Verträge werden angepasst, Versprechen erneuert, Grenzen neu gezogen. Ein öffentliches Ereignis markiert den Willen, aus der Krise zu lernen, ohne das Gesicht zu verlieren. Persönliche Bindungen finden zu einer Form, die dem Regelwerk der Stadt entspricht und zugleich Raum für individuelle Bewährung lässt. So führt der Roman seine Fäden zusammen, ohne alle Widersprüche zu glätten, und verweist auf die Notwendigkeit, Ordnung, Gerechtigkeit und Mitgefühl in einem lebendigen Gemeinwesen immer wieder auszubalancieren und entschlossen zu erneuern.
Im Ergebnis vermittelt Die Gred die nachhaltige Einsicht, dass historische Detailtreue und erzählerische Empathie ein Bild von Stadt und Bürgertum entstehen lassen, das über Einzelfälle hinausweist. Der Roman macht erfahrbar, wie Institutionen, Arbeitsethos und persönliche Gewissen miteinander ringen und einander formen. Er endet nicht mit einer simplen Morallehre, sondern mit der Aufforderung, Verantwortung als gemeinsames Werk zu verstehen, das von vielen Händen und Augen getragen wird. So bleibt weniger die Erinnerung an spektakuläre Ereignisse als der Eindruck einer widerstandsfähigen, lernfähigen Gemeinschaft, deren Werte auf Prüfungen reagieren und gerade dadurch Bestand gewinnen und künftiges Handeln maßvoll orientieren können.
Historischer Kontext
Der Roman spielt im alten Nürnberg, einer seit 1219 als Freie Reichsstadt privilegierten Metropole des Heiligen Römischen Reiches. Zeitlich verortet ist das Milieu im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit, als städtische Autonomie, Handel und Frömmigkeit das Leben prägten. Entscheidende Institutionen waren der von Patriziern dominierte Rat (Innerer und Äußerer Rat), die mächtigen Kaufmannsfamilien wie Tucher, Imhoff und Paumgartner, sowie die wirtschaftlich bedeutsamen, politisch jedoch beschränkten Zünfte. Kirchen wie St. Sebald und St. Lorenz, das Heilig-Geist-Spital und die Kaiserburg setzten geistliche und weltliche Akzente. Lager- und Zollgebäude wie die Mauthalle bündelten den Warentransit entlang der Pegnitz.
Im 15. und frühen 16. Jahrhundert war Nürnberg ein führendes Zentrum für Metallwaren, Waffen, wissenschaftliche Instrumente und feinmechanische Erzeugnisse, die europaweit als „Nürnberger Ware“ begehrt waren. Kaufleute der Stadt unterhielten Handelsbeziehungen nach Venedig, in die Niederlande, nach Polen und in den Donauraum; sie kooperierten und konkurrierten mit Netzwerken aus Augsburg, etwa den Fuggern und Welsern. Der Warenumschlag wurde durch städtische Speicher und Zollstationen wie die zwischen 1498 und 1502 errichtete Mauthalle organisiert. Dem städtischen Innovationsgeist wird u. a. die frühe tragbare Uhr zugeschrieben, die der Nürnberger Schlosser Peter Henlein zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwickelte.
Nürnberg war zugleich ein Knotenpunkt des Humanismus und der Druckkunst. Die Offizin Anton Kobergers verbreitete seit dem späten 15. Jahrhundert theologische und humanistische Werke in ganz Europa; 1493 erschien hier die reich illustrierte Schedelsche Weltchronik. Albrecht Dürer prägte als Künstler und Graphiker das Bild der Stadt und pflegte Austausch mit Gelehrten wie Willibald Pirckheimer. Werkstätten für Holzschnitt und Kupferstich verbanden Kunst, Buchhandel und Wissenschaft. Bildungsinitiativen wie die 1526 begründete Städtische Egidien-Schule (später Egidiengymnasium) institutionalisierten humanistische Bildung. Diese geistige Infrastruktur bildet den Resonanzraum für die im Roman geschilderte bürgerliche Lebenswelt zwischen Kunstsinn, Lesekultur und kaufmännischer Praxis.
Die Reformation veränderte Nürnberg tiefgreifend. Nach intensiven Auseinandersetzungen führte der Rat 1525 die lutherische Ordnung ein und ordnete das Kirchenwesen städtisch; der Prediger Andreas Osiander gewann großen Einfluss. Klöster wurden säkularisiert oder umgewidmet, karitative Aufgaben reorganisiert. Reichstage in Nürnberg berieten früh über die „religiöse Frage“, ehe 1532 der Nürnberger Religionsfrieden einen vorläufigen Ausgleich zwischen katholischen und evangelischen Ständen brachte. Diese Entwicklungen spiegeln sich in Debatten über Gewissen, Autorität und Gemeinwohl, die auch städtische Familien und Handelskreise betrafen. Religiöse Reform, Bildungsreformen und Armenfürsorge veränderten Alltag, Feste und Rechtsgewohnheiten, ohne die städtische Ordnung grundlegend zu destabilisieren.
Als Reichsstadt besaß Nürnberg eine besondere Beziehung zur kaiserlichen Verfassung. Die Goldene Bulle von 1356 bestimmte die Stadt als Ort des ersten Reichstags nach jeder Königswahl. Von 1424 an wurden die Reichskleinodien in Nürnberg verwahrt, traditionell im Heilig-Geist-Spital, und bei Heiltumsweisungen öffentlich gezeigt – eine Praxis, die im Zuge der Reformation beendet wurde. Diese Nähe zu Kaiser, Reichsrecht und symbolischer Autorität stärkte den Selbstanspruch des Rates auf Ordnung, Maß und Verlässlichkeit. Zugleich mussten Stadtherrschaft und Bürgerschaft zwischen kaiserlichen Anforderungen, regionalen Mächten in Franken und den eigenen wirtschaftlichen Interessen balancieren, was rechtliche und fiskalische Feinsteuerung verlangte.
Die soziale Ordnung der Stadt war durch Patriziat, Kaufleute, Handwerksmeister, Gesellen und Dienstboten hierarchisch gegliedert. Ausbildungswege wurden durch Zunftordnungen geregelt; Meisterrechte, Qualitätskontrollen und Exportstandards sollten die Reputation „Nürnberger Ware“ sichern. Kleider- und Prunkordnungen beschränkten Repräsentationslust und dienten der sichtbaren Ständeordnung. Ehe-, Erb- und Vormundschaftsrecht wurden vor Rats- und Stadtgerichten verhandelt; das Stadtrecht kodifizierte Strafen und Verfahren, einschließlich öffentlicher Hinrichtungen als Teil der frühneuzeitlichen Justiz. Seuchen wie die Pest wiederkehrten in Wellen und beeinflussten Demografie, Frömmigkeit und Ökonomie. Diese normativen und materiellen Rahmenbedingungen strukturieren die im Roman gezeigte bürgerliche Welt des Handels, der Pflicht und des Ruhms.
Nürnbergs Wohlstand blieb nicht frei von äußeren Spannungen. Der Landshuter Erbfolgekrieg (1504/05) erschütterte den süddeutschen Raum und tangierte Handelswege. Im Zeitalter konfessioneller Auseinandersetzungen suchte die Stadt wiederholt Ausgleich, beteiligte sich an Bündnispolitik und verhandelte Abgaben, Truppenstellungen und Neutralitätszusicherungen. Der 16. Jahrhundert war von Preis- und Währungsbewegungen geprägt, die auch städtische Münz- und Kreditpolitik herausforderten. Krisen berührten besonders exportorientierte Gewerbe und das Fernhandelskapital. Gleichwohl behauptete Nürnberg seine Rolle als Produktions- und Wissenszentrum. Solche Konjunkturen und Risiken bilden den Hintergrund für Entscheidungen, welche Familienvermögen, Ehre und soziale Mobilität in einer kaufmännischen Stadt ordnen.
Georg Ebers veröffentlichte seinen historischen Roman im späten 19. Jahrhundert und verband literarische Gestaltung mit quellengesättigter Anschaulichkeit. Die Darstellung des alten Nürnberg knüpft an verlässlich dokumentierte Strukturen von Ratsherrschaft, Handelskapital, Kunst und Reform an und nutzt sie als Bühne für private Konflikte und bürgerliche Tugenden. Als Kommentar zur Epoche zeigt das Buch, wie städtische Identität sich aus Recht, Glauben, Arbeitsethos und gelehrter Kultur formte und unter Druck von Umbrüchen standhielt. Dadurch lädt es dazu ein, die Frühneuzeit nicht als Folie von Sensationen, sondern als verregelten, doch dynamischen Raum verantworteter Entscheidungen zu begreifen.
Die Gred - Historischer Roman aus dem alten Nürnberg
Erstes Buch
»Pietro Giustiniani, der Kaufmann von Venedig«, so zeichnete der kleine Antiquar, dem ich in der Markusstadt einige handschriftliche Hefte abgekauft hatte, die Quittung.
Welch ein Name und welch ein Titel!
Mit diesem wollte er gewiß das Deutsche an den Mann bringen, das er als Korporal in der österreichischen Armee erlernt hatte; jener veranlaßte ihn, nachdem ich der Größe seiner Vorfahren gedacht, auf die Tasche zu schlagen und halb stolz, halb kläglich zu rufen: »Ja, sie hatten wohl Geld genug; doch wo ist es geblieben?«
»Und haben Sie nichts von ihren Thaten vernommen?« fragte ich den kleinen Mann, der das Schnurrbärtchen immer noch militärisch zugespitzt trug.
»Thaten?« fragte er verächtlich. »Wären sie nur weniger eifrig hinter dem Ruhme her und dafür bessere Haushälter gewesen! Armes Kind!«
Dabei wies er auf die kleine Marietta, die unter den alten Büchern umherspielte, und mit der ich schon gute Freundschaft geschlossen. Heute trug sie in den Ohrläppchen etwas Wunderliches, worin ich bei näherem Hinsehen zusammengedrehte Zwirnfäden erkannte. Das Kind lehnte den hübschen Schwarzkopf zutraulich an mich, und wie ich seinen seltsamen Schmuck befühlte, rief mir von dem kleinen Pulte hinter dem Ladentische her die helle Stimme seiner Mutter klagend entgegen: »Ja, Herr, es ist eine Schande, in einer Familie, die der Kirche drei hohe Heilige gegeben – den Nikolo, die Anna und Eufemia – alle drei Giustinianis – Sie wissen es, weil Sie die Schriften kennen – in solchem erlauchten Hause, dessen Söhne mehr als einmal den Kardinalshut getragen, muß, Herr, muß die Mutter dem eigenen Kinde... Aber Sie haben Ihre Freude an dem Mädchen, Herr, wie jedermann im ganzen Quartier... He, Marietta! Wenn Dir der Herr nun ein paar Ohrringe schenkte, goldene, echt goldene, mein' ich? Zwirnfäden als Geschmeide im Ohr einer Giustiniani, daß das lächerlich ist, unpassend, unerhört, das steht fest, und ein billig denkender, gelehrter Herr, wie Sie, wird es nicht leugnen!«
Wie hätt' ich solche Mahnung ungehört lassen können, und da ich der Antiquarsfrau den Willen gethan, durft' ich mich mit einigem Stolz für den Wohlthäter einer Familie ansehen, die sich vom Kaiser Justinian abzustammen rühmte, die man die Fabier Venedigs[1] genannt und die weiland der Republik große Feldherren gestellt hatte, weitsichtige Staatsmänner und tüchtige Gelehrte.
Wie ich die Stadt endlich verließ und Abschied von dem Antiquar nahm, drückte er mir ebenso herzlich wie wehmütig die Rechte.
Wenn Frau Giustiniani mich sodann, während sie eine ziemlich lange Reihe von Banknoten einstrich, mit jenem freundlichen Mitleid anschaute, das eine brave Frau übervorteilten Unerfahrenen, zumal wenn sie jung sind, so gern zollt, geschah es wohl, weil die von mir erworbenen Hefte in der That einen recht kläglichen Anblick boten. Mäuse und Insekten hatten den Rand des starken Altnürnberger Papiers zerfressen, und an manchen Stellen fielen aus der Mitte der vergilbten Seiten schwarze Stückchen wie Zunder heraus; ja, viele Zeilen der ursprünglich kräftigen Schrift waren so ganz erloschen, daß ich kaum hoffen durfte, die Kunst der Chemiker zu Hause vermöge sie je wieder kenntlich zu machen; aber das, was diese Hefte enthielten, war so merkwürdig und eigenartig, so kaum erhört in der Zeit ihrer Entstehung, daß es mich mit unwiderstehlicher Gewalt fesselte und ich ihm zu liebe manche halbe Nacht zum Tage machte. Es waren im ganzen neun, und alle zeigten die gleiche Handschrift bis auf das letzte. Deckel und Titelblatt waren verloren gegangen, doch über der ersten Seite des ersten Heftes stand mit großen Lettern geschrieben: »Püchel von meinem Leben.« Dann folgte eine Reihe von Versen, denen ich die folgende, unserem Hochdeutsch nähere Form verleihe:
»Denn was man mit den Augen sicht, Das kann uns nie betrügen nicht. Was du ergreifst mit Aug' und Sinn, Wird Geist und Seele zum Gewinn. Sei du nicht wie die Schneck' im Haus, Nein, schau ins Weite frisch hinaus, Dann wird es dir von Gott geschehen, Verdoppelt groß die Welt zu sehen; Und war dir Geist und Seele klein, Thust du die weite Welt hinein, Dann wachsen sie mit mächt'gem Streben, So großen Dinge Raum zu geben; Und wenn dir groß sind Seel' und Geist, So gleichst du, Mensch, dem Herrgott meist. – Zu ihm schau fleißig himmelan, Nicht auf dich selber, Weib und Mann! Vergiß getrost das eigne Sein, Und sorg für andrer Leut' Gedeihn; Denn was du thust mit frohem Mut Für andre, kommt dir selbst zu gut. Wenn manche drob dich thöricht schelten, – War's Gott genehm, was kann dir's gelten? Selbst Schimpf und Fluch laß dich nicht reu'n, Darfst du dich Gottes Segens freu'n. Dies schrieb für Kind und Eniklein In selbig Püchel emsig ein Mit grauem Haar und jungem Sinn Von Nürnberg die Gred Schopperin.«
Unter diesen Versen begann der eigentliche Text mit den Worten: »Anno domini 1466 do hub ich an zu diesem püchel zu schreiben von mein Leben alz ich ez ervaren hab.«
Erst im zweiundsechzigsten Jahr hat die Verfasserin ihre Erinnerungen aufzuzeichnen begonnen. Dies hebt sie später hervor, doch ergibt es sich auch aus den ersten Zeilen der zweiten Seite, welche also beginnen: »Ich Gred Schopperin ward geboren do man zalt von Krists geburt 1404 jar am eritag noch dem Palmtag in die Nacht zu der firden ora. Mich hub aus der tawff Kristan Pfinzing, mein Ohm, von der Burg. Mein Vater, dem Gott genedig sey, der waz der Franz Schopper, den man nant den Singer. Starb in der montag nacht nach dem Sonntag letare anno 1404 und het zu der e Kristein Peheym, die waz mein Muter. Bei der Frawen hat er meine brüder Herdegen Schopper und Kuncz Schopper. Mein Muter starb an sant Katrein abent anno 1405, also daz ich verlor die Muter also jung, und herticlich krenkte mich Got, als er den Vater zu seinen Gnaden von dieser werlte gefordert, enpfor ich die sunne geschawt.«
Diese Zeilen, die ich zuerst im Laden des Antiquars gelesen, hatten mich ihm in die Hand geliefert; doch es wäre ja über die Menschenkraft gegangen, stumm zu bleiben, als ich hier beim Weiterlesen Dinge fand, die meine kühnsten Erwartungen weit übertrafen. Die Verfasserin dieser Handschrift hatte nicht nur, wie die anderen Chronisten ihrer Zeit und ihrer Heimat Nürnberg, die Ulman Stromer, Endres Tucher und ihresgleichen, denkwürdige Ereignisse ohne inneren Zusammenhang notirt, von Familienverbindungen, dem Münzwesen und den kaufmännischen Maßen ihrer Epoche Mitteilungen gegeben, sondern frisch und frank niedergeschrieben, was ihr in der Jugend bis zu deren Abschluß begegnet.
In acht Tagen hatte ich das Manuskript nicht nur durchgelesen, sondern auch manches, was mir der Erhaltung besonders wert schien – darunter auch die Verse – wörtlich kopirt. Mit welcher Genugtuung erfüllte es mich später, daß ich damals, obzwar auf Reisen, mich dieser Mühewaltung unterzogen; denn ein grausames Mißgeschick traf die Kiste, in der ich die Hefte mit anderen Büchern und einigen Kunstsachen auf dem Seewege in die Heimat entsandt. An der Elbmündung strandete das Schiff, das sie trug, und mit ihm ging mein köstlicher handschriftlicher Schatz kläglich zu Grunde.
Als es nun galt, seinen Inhalt wiederzugeben, unterstützten die geretteten Notizen das Gedächtnis aufs beste; die Einbildungskraft aber füllte willig die Lücken, und wenn es mir auch nicht gelingen konnte, die Mitteilungen der Gred Schopperin Satz für Satz und Wort für Wort wiederzugeben, meine ich doch im ganzen treu nacherzählt zu haben, was sie der Aufzeichnung würdig erachtet. Auch von der Wiedergabe der Ausdrucksweise des fünfzehnten Jahrhunderts, in dem das Deutsche kaum anfing als Schriftsprache in Uebung zu kommen, und der Gelehrte, der Dichter und Literat es noch vorzog, bei jeder größeren und feineren geistigen Arbeit sich des Lateins zu bedienen, hab' ich Abstand genommen. Nur dem Eingeweihten wäre der Erzählerin Redeweise ohne weiteres verständlich gewesen, und ich hätte meiner Gred unrecht gethan, wenn ich den Gedanken und Beschreibungen, deren Sinn und Bedeutung ich völlig begriff, die ungelenke Form gelassen haben würde, die sie ihnen damals gegeben. Die Sprache ihrer Zeit ist ein Spiegel, auf dessen krummer Fläche für uns Neuere auch das schönste Bild leicht ein getrübtes oder verzerrtes Ansehen gewinnt. So faßte ich denn meine Aufgabe dahin auf, den keineswegs des Reizes und der Anmut baren Inhalt meiner alten Hefte mit den fortgeschrittenen Mitteln der Sprache unserer Zeit zur Geltung zu bringen. Ich suchte mich nur in den Geist meiner Gred Schopperin hineinzudenken, und erzählte ihr, hier ergänzend, da ausführend, dort mich einer bezeichnenden Altnürnberger Ausdrucksweise bedienend, die mir im Gedächtnis geblieben, zwanglos und doch in einer der frühen Aufzeichnung unserer Erzählung angemessenen Redeweise nach, was sie lebhaften Geistes und warmen Herzens mit den Sprachmitteln ihrer Zeit und Heimat Kindern und Enkeln mitzuteilen begehrte.
Erstes Kapitel
Ich, die Gred Schopperin, ward geboren im Jahre 1404 nach Christi Geburt, am Eritag nach Palmsonntag. Mein Oheim Kristan Pfinzing von der Burg, ein Witmann, dessen Hausfrau eine Schopperin gewesen, hob mich aus der Taufe.
Mein Vater, dem Gott gnädig sei, war der Franz Schopper, den man den Sänger nannte. Er starb in der Nacht des Montag nach dem Sonntag Lätare anno 1404, und seine Frau, meine Mutter selig, hieß Kristein, war eine geborene Behaim und schenkte ihm auch meine beiden Brüder Herdegen und Kunz Schopper. Sie starb am Sankt Katharinenabend des Jahres 1404, also daß ich schon als Kind die Mutter verlor, und auch damit kränkte mich Gott gar hart, daß er den Vater in seinen Gnaden von hinnen nahm, bevor ich noch die Sonne geschaut.
Statt eines lieben Vaters, wie ihn andere Kinder besaßen, hatte ich nur ein Grab auf dem Friedhof und die freundliche Kunde, die mir solche, die ihn gekannt, von ihm gaben; und ihnen zufolge ist er ein gar fröhlicher, lieber und der eigenen, sowie der Stadt Geschäfte trefflich kundiger Herr gewesen. Der Sänger ward er geheißen, weil er, auch noch, da er im Rat saß, so süß und minniglich zum Saitenspiel zu singen vermochte. Und diese Kunst hatte er im Welschland[2] erworben, wie er daselbst zu Padua sich der Rechtsgelehrsamkeit befleißigt; auch soll ihm die Musika in der weiten Fremde großen und köstlichen Minnelohn von schönen welschen Frauen und Mägeden eingebracht haben. Ein wie weidlicher Mann, von hohem Wuchs und den Augen wohlgefälligen Ansehens er gewesen, des zum Beweis diente mir mein Bruder Herdegen, sein ältester Sohn, von dem es männiglich hieß, er sei das lebendige Widerspiel des Vaters selig, und wenn ich auch ein altes Weibsbild geworden, darf ich doch frei bekennen, daß mir wohl selten ein Mannsbild begegnet, dem das Blauauge heller aus der Stirn geleuchtet und dem das Goldhaar voller niedergequollen wäre auf Kragen und Schulter wie ihm in der Blütenzeit seiner fröhlichen Jugend.
Am Osterfest war er geboren, und der Herrgott schenkte ihm so frohgemuten Sinn, wie er nur Sonntagskindern beschieden. Er wußte die Kunst des Sanges gar hell und zierlich zu üben, und da auch mir und dem andern Bruder, meinem Spielgesellen Kunz, der Sinn nach Gesang und der Musika stund, klang und zwitscherte es in unserem verwaisten, der Eltern baren Hause wie in einem fröhlichen Grasmückenneste, und es herrschte darin mehr golden Kinderglück und tagheller Frohsinn, denn in manchem andern Hause, so sich des Vaters und der Mutter erfreuet. Und dafür bin ich dem Herrgott immer besonders dankbar gewesen; denn ein Kinderleben, dem die Mutterliebe fehlt, das habe ich oft erfahren, ist wie ein Tag mit Regengewölk vor der Sonne. Aber der Allgütige hatte, da er die Hand auf das Herz unserer Mutter legte, in eines andern Weibsbildes Brust einen großen Schatz von Liebe für mich und die Brüder geborgen.
Unsere Base Metz, eine kinderlose Witib, war es, die unsere Wartung auf sich genommen, und da sie als Jungfrau und bevor sie ihrem Seligen die Hand geboten, heimliche Minne für den Vater im Herzen getragen und später zu unserer Mutter aufgeschaut hatte wie zu einer Heiligen des Himmels, wußte sie sich nichts Lieberes, denn uns von den Eltern zu erzählen, und wenn sie es that, wurde ihr der Blick feucht, und weil ihr jedes Wort gerade aus dem Herzen quoll, fand es auch den Weg in die unseren, und saßen wir Drei um sie her und lauschten ihrer Rede, so gab es außer ihren beiden nassen Augen bald noch sechs andere, so des Tüchleins bedurften.
Sie hatte einen schweren, ungefügen Gang und ein Antlitz, wie aus grobem Holze geschnitten, also daß es recht angethan gewesen wäre, Kinder zu ängstigen, und auch in der Jugend, hieß es, sei ihr Ansehen männisch und sonder Liebreiz gewesen, weswegen auch der Vater ihrer heimlichen Minne nimmer geachtet; aber ihre Augen waren wie zwei offene Fenster, aus denen alles, was gut ist und freundlich, lieb und herzig wie Englein heraussah, und diese Augen ließen alles vergessen, was wüst an ihr war, auch die breite Nase mit dem tiefen Eindruck gerade in der Mitten und das Bärtlein am Munde, so ihr mancher junge Gernegroß neiden mochte.
Dannocht hatte der Sebald Kreß wohl gewußt, was er that, wie er die Metz ImHoffin, da er zwischen der sechzig und siebenzig stund, zum Weibe erkor; sie aber war, wie sie mit ihm vor den Altar trat, auf nichts anderes gefaßt gewesen, als nunmehr die Pflegerin eines alten, siechen Griesgrams zu spielen. Doch sich für den Nächsten zu plagen, mutete die Metz just so süß an wie andere, sich auf Händen wiegen zu lassen; auch sollte es ihrer treuen Sorge glücken, den Alten noch volle zehn Jahre dem Tode abspenstig zu machen. Nach seinem Ende blieb sie als wohlbehaltene Witib zurück; doch statt sich zu pflegen, nahm sie alsbald ein neues Leben voll schwerer Plage auf sich, indem sie sich der Pflicht unterzog, bei uns drei Waislein an der Mutter Stelle zu treten.
Wie ich groß wuchs, hat sie mir oft mit ihrer guten Stimme, die so tief war wie die dicke Pfeife an der Orgelei, berichtet, drei Dinge habe sie sich vorgesetzt bei unserer Erziehung: uns zu guten, gottesfürchtigen Menschen zu machen, die Einigkeit unter uns zu pflegen, so daß jedes bereit sei, alles für das andere zu lassen, und uns eine frohe Jugendzeit zu schaffen.
Wie ihr das erstere gelungen, solches zu schätzen, stell' ich anderen anheim; doch einigere Geschwister, denn wir allzeit gewesen, die soll man mir weisen, und weil aus hundert kleinen Anzeichen herfürging, wie fest wir zusammen stunden, nannten uns die Leute das »Schopperkettlein«, sintemal unseres Geschlechtes Wappen drei Ringe weiset, so zu einer Kette verbunden.
Was mich nun angehet, bin ich das jüngste und kleinste unter den Ringlein gewesen, aber das mittelste war ich doch; denn wenn den Herdegen und Kunz dies oder das auseinander trieb, also daß es den einen den andern zu meiden und ihm zu trotzen verlangte, fanden sie sich immerdar bei mir und durch mich wieder zusammen. Aber wenn ich auch bisweilen das Amt der Mittlerin übte, kann mir solches doch nicht zum Ruhm gedeihen, maßen ich sie mit nichten zusammenführte aus Tugend oder löblicher Einsicht, sondern einzig und allein, weil ich es nimmer ertrug, allein zu stehen oder nur mit einem Ringlein zur Seite.
O, wie weit liegt doch die liebe, frohe Jugend hinter mir, von der ich hier berichte! Ich stehe auf der Höhe des Lebensberges, ja ich habe den Gipfel allbereit längst überschritten, und wenn ich nun rückwärts schaue und mir vergegenwärtige, was ich erlebt und erfahren, so geschieht es nicht, um daraus für mich selbst die Lehre zu schöpfen, wie man es später wohl besser mache. Denn mein altes Knochengerüst ist fest und spröde geworden, und es zu biegen, würde nimmer gelingen; nein, ich schreibe dies Büchlein zu meinem Genügen und den Kindern und Eniklein, so hinter mir den Berg ersteigen, zu Nutz und Frommen. Den Stein, an den mein Fuß gestoßen, mögen sie meiden, aber da, wo ich rüstig ausgeschritten, da sollen sie es der Alten frohgemut nachthun, obzwar ich tausendfach gewahret, daß man immer nur durch eigene und nimmermehr durch anderer Erfahrung klug wird.
So will ich denn von vorn beginnen. Aus der frohen Kinderzeit gäb' es viel zu berichten; denn in ihr ist jegliches neu. Aber was männiglich an sich selbst erfährt, taugt minder gut zum Erzählen, und was hätte ein Nürnberger Kind beim Großwerden und in der Schule vor dem andern voraus? Ist doch den Halmen aus demselben Acker und den Bäumen im gleichen Wald ohne sonderlichen Unterschied immerdar das Gleiche beschieden. Freilich hab' ich wohl in manchen Stücken ein sonderbar und den übrigen Kindern ungleich Wesen besessen; denn Base Metz sagte oftmals, von mir sei die Form zerbrochen, und des Herdegen Klage, daß ich kein Bub geworden, klingt mir noch in den Ohren, wenn ich unserer wilden Spiele gedenke. – Wer im ersten Stock unseres Hinterhauses den Erker kennt, von dem ich mit den Brüdern um die Wette in den Hof sprang, der mag sich leicht entsetzen und es ein Wunder heißen, daß ich mit heilen Gliedmaßen ungestraft davon kam; doch es wohnte mir keineswegs immer die Lust bei, mit den Buben zu toben, und ich bin schon im zarten Kindesalter ein gar nachdenklich Geschöpflein gewesen. Es gab aber auch etliches in meinem jungen Leben, so wohl angethan war, das eigene Sinnen zu schärfen.
Wir Schoppers sind nahe verwandt mit all den anderen Geschlechtern der Stadt, so man rats- und wappenfähig heißt und die für Nürnberg dasselbe vorstellen, was für Venedig die Häuser der Signoria, deren Namen im goldenen Buche verzeichnet stehen. Was dort die Barberigo, Foscari, Grimaldi, die Giustiniani und dergleichen, das sind bei uns die Stromer, die Behaim, Ebener, ImHoff, Tucher, Kreß, Paumgartner, Pfinzing, Pirkheimer, Holzschuher und so weiter, und in ihrer Reihe gewiß nicht am untersten Ende stehen die Schopper. In etwelcher Weise sind wir, die wir wappen-, turnier- und stiftsfähig heißen und gerechten Anspruch haben, uns Adlige und Patrizier zu nennen, allsamt miteinander verschwistert, und wo ein stattlich Haus stund in Nürnberg, da gab es für uns Ohm und Muhme, Vetter und Base, oder doch Gevattern und gute Freunde der Eltern selig. Wo uns nun von selbigen eines ersah, und war es auch nur auf der Gasse, hieß es alsbald: »Die armen Waislein. Gott erbarm sich der lieben verlassenen Dinger!«, und manchem barmherzigen Weibsbilde traten dabei helle Thränen ins Auge. Auch die Herren vom Rat – denn zu ihm gehörten die meisten älteren Männer aus unserer Freundschaft – strichen mir mit der Hand über das Blondhaar und schauten dazu drein, als sei ich ein arm Sünderlein, für das es keine Gnade gebe vor dem Blutgericht oder Rugamt.
Warum die Menschen mich wohl für unglücklich hielten, da ich doch keinerlei Kümmernis kannte und mein Herz so fröhlich war wie eine trillernde Lerche? Base Metz konnt' ich nicht fragen; denn es ging ihr schon nahe, wenn mir nur ein Fingerlein weh that. Wie mocht' ich ihr da künden, daß ich ein gar so elend Würmlein sei in den Augen der Leute? Aber bald erkannt' ich selbst, aus was Grund und Ursach sie mich beklagten; denn sieben nannten mich ein vater- oder elternlos, aber siebenzig ein mutterlos Waislein, wenn sie mir ihr Mitleid erwiesen. Daß die Mutter uns mangelte, das war unser Unglück. Aber hatte ich denn nicht die Base Metz, und war sie nicht so gut wie jede andere Mutter? Freilich hieß sie nur die Base, und etwas mußt' ihr dannocht gebrechen, was einer echten Mutter eignet.
Da machte ich, obgleich ich noch ein albernes. dummes Ding war, die Augen auf, und ganz für mich allein begann ich zu forschen. Nur die Brüder zog ich ins Vertrauen, und obgleich mein Aeltester mir solches verwies und mich anhielt, der Base nur Dank zu wissen für all ihre Gutheit, legte ich mich dannocht aufs Suchen.
Bei den Stromers von der güldenen Rose gab es der Kinder genug, und sie freuten sich noch der eigenen Mutter. Die war ein gar fröhlich jung Weibsbild, rund wie eine Kirsche und weiß und rot wie Schnee und Blut, das mich auch nicht wie die anderen anfaßte, als ob ich wund sei, sondern grad aus mit mir scherzte und derb drein fuhr, wenn ich eine Unart begangen. Bei den Muffels dagegen war die Hausfrau gestorben, und der Vater hatte seinen Kleinen bald darauf eine neue Mutter gegeben, die unser Suslein, dem meine Wartung oblag, »die Stiefmutter« nannte; eine solche aber – das hatten mich die Märlein gelehret, denen ich eifrig genug das Ohr geliehen – eine solche war ebensowenig ein recht und echt Mütterlein, wie unsere herzliebe Base. Selbige »Stiefmutter« nun sah ich die kleine Els, ihres Hausherrn jüngstes Töchterlein, so nicht ihr eigen, baden und trocknen, und es auch einlullen, bis der Schlaf es umfing; und solches alles that sie gar freundlich und wie es sein muß.
Wie dann die Els die Augen geschlossen, gab sie ihr auch einen Kuß auf Stirn und Wange; aber die Stromerin von der güldenen Rose hielt es ganz anders; denn wie sie die kleine Klar, die ihr eigen, aus dem Badewasser genommen und in die warmen Tücher auf dem Wickeltisch gestrecket, da drückte sie das ganze Antlitz fest in das junge, frische Fleisch, küßte das ganze Körperlein von oben bis unten, hinten und vorn, als sei es ein süßer rosenroter Mund, und beide fanden des Lachens und ausbündigen Frohmutes kein Ende, wenn die Mutter mit den Lippen auf der weichen, duftenden Haut des Kindes prustete und trompetete, daß es schallte, oder wenn sie den Liebling mit samt den Badetüchern an die weiche Frauenbrust preßte, als lüste es sie, ihn zu zerdrücken. Und dabei brach sie in ein laut und sonderbar Lachen und Kosen aus, und rief ihm inniglich zu: »Du mein Herzblatt, mein Herrgottskäferlein, mein süß, einzig Schatzkind! – Mein, mein, mein! Ich fresse Dich auf!«
Ja, solches hatte die Muffelin der Els, ihres Hausherrn Töchterlein, nimmer erwiesen; doch ich wußte noch recht gut, daß Base Metz es mit mir ganz ähnlich getrieben, wie die Stromerin von der güldenen Rose mit dem eigenen Kindlein, und so unterschied unsere Base eigentlich nichts von einer wirklichen Mutter.
Dergleichen sagt' ich mir auch, wie ich mich zur Schlafenszeit in meinem weißen Bettlein zum Schlummer ausstreckte, und nun kam die Base und faltete mit mir die Hände, und nachdem sie wie alle Abend das Gebet von den Englein mit mir gesprochen, lehnte sie ihr Antlitz an meines und preßte mein Kinderköpfchen an das übergroße Haupt; solches aber that mir baz wohl, und ich flüsterte ihr ins Ohr: »Nicht wahr, Base Metzlein, du bist meine rechte, wirkliche Mutter?«
Da versetzte sie rasch: »Im Herzen gewißlich, und Du bist ein gar glückselig Kind, meine Gred; denn statt einer Mutter hast Du gar deren zwei: mich hier unten, um Dich zu hegen und sorglich zu pflegen, und die andere bei den lieben Englein droben, die auf Dich herabschaut, und die gnadenreiche Jungfrau, der sie so nahe ist, anruft, daß sie Dir das Herzlein rein erhalte und Dich vor Unheil bewahre; ja vielleicht – sieh nur hinauf zu ihrem Bildnis – trägt sie jetzt selbst den Heiligenschein und eine himmlische Krone.«
Hienach erhob sich die Base und hielt das Lämplein hoch, also daß sein Licht das große Gemälde vor mir ganz überstrahlte. Da hefteten sich meine Augen auf das schöne Frauenbild mir gegenüber, und es war mir, als schaue es mich an mit innigen Blicken und als streckten sich mir ein paar leibliche Mutterarme zärtlich entgegen. Da setzte ich mich auf in meinem Bettlein, und das, wovon mein Kinderherz voll gewesen, davon gingen mir die Lippen über, und ich sagte ganz leise: »OBase Metz, mein Mütterlein droben möchte mich sicherlich auch einmal küssen und mit mir kosen wie die Stromerin mit ihrer Klar.«
Da stellte die Base den Leuchter schweigend aus der Hand, hob mich aus dem Bettlein, hielt mich ganz nah' dem Antlitz des Bildes, und ich verstund ihre Meinung. Meine Lippen berührten leise den roten Mund auf der Leinwand, und wenn mir das auch selber gar wohl that, meinte ich dannocht, es sei damit dem Mütterlein im Himmel ein großer Gefallen geschehen.
Hienach murmelte die Base »So, so!« und dergleichen leis vor sich hin, legte mich in die Kissen zurück, stopfte mir die Decke recht fest ein, wie ich's liebte, gab mir noch einen Kuß, wartete, bis ich den Kopf tief in das Kissen gedrückt, und raunte mir zu: »Nun träume mir fein von der Mutter selig.«
Damit verließ sie die Kammer, doch die Lampe blieb darin stehen, und sobald ich allein war, schaute ich wieder auf zu dem Bildnis, so mir die Mutter wies in gar köstlichem Staate. Eine Rose prangte ihr an der Brust, ihr güldener Hauptschmuck sah aus wie das Krönlein der Königin des Himmels, und in ihrem Obergewand von köstlichem steifem Brokat bot sie einer hohen Heiligen Anblick. Aber das Himmlischste an ihr schien mir dannocht das weiß und rote jugendliche Antlitz und der liebe Mund, den ich vorhin mit den Lippen berühret.
O wär' es mir doch vergönnt gewesen, selbigen noch einmal zu küssen! Und plötzlich schoß es mir heiß durchs Herz, und eine innere Stimme sagte mir, daß tausend Küsse der Base einen einzigen von der jungen, liebreizenden Frau da droben nimmer ersetzten, und daß ich mit ihr fast so viel verloren, wie die barmherzigen Gevatterinnen vermeinten. Und nun mußte ich weinen und immer fort weinen, und es war mir, als hätte man mir das Allerbeste und Liebste genommen, und zum erstenmal kam mir die gute Base so wüst vor, wie den anderen Leuten, und mein dumm klein Köpfchen sagte mir, eine echte Mutter sei schön, eine unechte, ja auch die beste, holdselig und anmutsvoll sei sie nimmer.
Darüber entschlief ich, und im Traum trat mir das Bild aus dem Rahmen entgegen und nahm mich auf die Arme, wie die Madonna das Christkind, und schaute mich an mit einem Blick, als habe sich alle Liebe auf Erden darin zusammengefunden. Da schlang ich ihr die Arme um den Hals und wartete, ob sie nicht mit mir kosen und tändeln werde, wie die Stromerin mit ihrer kleinen Klar; sie aber schüttelte nur leise und wehmütiglich das Haupt mit dem blitzenden Krönlein, schritt auf die Base Metz zu und legte mich ihr in den Schoß.
Selbigen Traum hab' ich nimmer vergessen, und so oft ich fürder betete, erhob ich das Herz auch zu der Mutter selig und rief sie an, grad wie die Madonna und heilige Margareta, meine Patronin, und wie oft hat sie mich gehört und aus Not und Fährnis errettet! Was die Base angehet, so ist sie mir immer lieber geworden seit jenem Abend; denn die rechte Mutter hatte mich an sie gewiesen, und wenn sie mich fürder mitleidig anschauten und mein Schicksal beklagten, lachte ich still in mich hinein und dachte: »Wenn ihr nur wüßtet! Euren Kindern eignet nur eine Mutter, wir aber haben deren zwei, und unser recht Mütterlein, das ist unter allen die schönste; die andere aber, mag sie auch wüst sein, das ist die beste.«
Die Barmherzigkeit der Leute war es, die mich auf solche Gedanken gebracht, und es hat mich später dünken wollen, als habe selbige meiner jungen Seele mit nichten gefrommet. Jedem Hiob nahen sich tröstende Freunde, doch unter ihnen sind wenige, die da kommen, um das Leid mit zu tragen, und desto mehr, die es lüstet, das eigene bessere Geschick mit dem schlechten des andern zu wägen. Die Barmherzigkeit, wie möcht' ich es leugnen, sie gehört zu den edelsten und heilkräftigsten Gaben; doch wer sie dem andern bietet, der übe Vorsicht, und absonderlich wenn es ein Kind ist, dem er sie darreicht; denn ein solches ist ein Bäumlein, das Licht braucht, und der versündigt sich gegen sein gedeihlich Wachstum, der ihm die Sonne verfinstert. Statt es zu beklagen, macht es recht fröhlich, das ist der Trost, der ihm zukommt!
Einem großen und wichtigen Geheimnis wähnt' ich dazumal auf die Spur gekommen zu sein, und so wollt' ich denn auch die Brüder hinweisen auf unsere Mutter im Himmel; aber selbige hatten sie allbereit ohne der kleinen Schwester Zuthun gefunden.
Erst diesem, dann jenem teilte ich mit, was mich bewegte, und wie ich zu dem Herdegen, dem älteren, kam, sah ich wohl, daß ich ihm nichts Neues bringe; den Kunz, den jüngeren aber fand ich auf der Schaukel, und wie er sich grade so hoch schwang, daß ich dachte, er werde sich überschlagen, bat ich ihn, ein wenig inne zu halten, doch dieweil er die Stricke fester faßte und sich neu zusammenzog, um sich an das Brettlein zu stemmen, rief er: »Laß mich jetzt, Gredlein. Hoch, hoch muß es gehen! Bis in den Himmel, bis hinauf zu der Mutter!«
Da wußt' ich genug, und von Stund an sprachen wir oft miteinander von der Mutter selig, und Base Metz sorgte dafür, daß wir auch des Vaters gedachten. Wie das der Mutter hatte sie auch sein Bildnis aus dem Festsaal, wo es früher gehangen, in das große Kinderzimmer versetzt, wo sie mit mir schlief. Und auch von des Vaters Konterfei sollte eine eigene Wirkung ausgehen auf mein späteres Leben; denn da ich zum Ruddeln kam[3], und der Meister Paul Rieter, der Stadtphysikus, unser Arzt, mich besuchte, blieb er so lang, als könne er die Trennung nicht finden, vor dem Bildnis stehen, und wie er sich endlich, ganz rot im Gesicht vor innerer Bewegung, da er dem Vater zu Padua ein lieber Kumpan gewesen, mir wieder zuwandte, rief er: »Was wirst Du doch für ein glückselig Menschenkind werden, mein Gredlein!«
Da mag ich ihn wohl verdutzt genug angeschaut haben; denn glücklich hatte mich noch keiner gepriesen, wenn nicht die Base oder die Waldstromerleute im Forste; – und der Meister mußte meine Verwunderung merken, denn er wiederholte: »Ja, ein Glückskind bist Du; denn alle sind es, Mägede und Buben, die zur Welt kommen nach dem Tode des Vaters.«
Wie ich ihm hienach nicht minder erstaunt denn vorhin ins Antlitz schaute, legte er den goldenen Knopf seines Stockes an die Nase und rief: »Bedenke nur, Du Närrlein, der liebe Gott wäre ja nicht der, der er ist, ja – verzeih mir die Sünde – kein Ehrenmann wär' er, wenn er sich eines Kindes, dem er den Vater raubte, bevor es ihn sehen und die erste Wohlthat von ihm empfangen konnte, nicht annehmen wollte als seines besonderen Lieblings. Merk auf, Kind! Ist es ein Kleines, das Mündel zu sein eines Vormunds, der allmächtig ist und dazu der Getreueste aller Getreuen?«
Und diese Rede, sie ist mir nachgegangen durchs ganze Leben bis hieher und zu dieser Stunde.
Zweites Kapitel
So verrann unsere Kindheit, wie ich allbereit vermeldet, in gar fröhlicher Weise, und während die Brüder die Schützen längst hinter sich gelassen und den Donatus traktirten, lehrte Base Metz mich lesen und schreiben, und das unter vielem Lachen und in gar ergötzlicher Weise. So buk sie zum Exempel von jedem Buchstaben deren vier aus süßem Honigteig, und wenn ich sie wohl behalten, gab sie mir die putzigen A-, B- und C-Küchlein, und einen davon aß ich selbst, die anderen aber gab ich den Brüdern, der Sus oder der Base. Oftmals steckte ich auch etliche zu mir, um sie mit in den Wald zu nehmen und sie dort dem Lieblingsrüden oder dem Kreuzschnabel meines Vetters Götz zu bieten, da er selbst das Süße verschmähte. Von ihm und dem Forste hab' ich noch mancherlei zu berichten, und schon früh war es mein bester Lohn, wenn es hieß, daß es in den Wald gehen werde; denn dort hausten von unseren Blutsfreunden die liebsten und treuesten, der Ohm Waldstromer mit den Seinen. Das Stattliche Weidmannshaus, so er als des Reiches und der Stadt Oberforstmeister im Lorenzerwalde bewohnte, bot mir der Freuden mehr denn jedes andere, maßen es dort nicht nur den Wald gab mit all seinem herrlichen Zauber, sondern auch, außer vielen Rüden, mancherlei selten Getier und andere Kurzweil, die den Stadtkindern fremd bleibt.
Aber was mir von alledem das Liebste, das war des Waldstromerpaares einziger Sohn, für dessen Hund ich meine süßen Lettern bewahrte; denn wenn Vetter Götz mir auch an Alter um elf volle Jahre überlegen, so übersah er mich dannocht mit nichten, und bat ich ihn nur, mir dies und das zu zeigen oder mich in den leichteren Künsten des Weidwerkes zu unterweisen, so ließ er um meinetwillen auch ältere stehen.
Seit ich im sechsten Jahre mit einem scharlachnen Sammetmützlein in den Forst gekommen, pflegte er mich sein »Rotkäpplein« zu rufen, und solches hörte ich fast gern, und von allen Knaben und Jünglingen, so mir unter des Bruders Freundschaft und sonst begegnet, schien mir keiner dem Götz nur das Wasser zu reichen; auch war mein unschuldig Kinderherz ihm so treulich zu eigen, daß ich ihn täglich mit einschloß in mein Gebetlein.
Bis dahin war es stets drei- oder viermal im Jahre auf etliche Wochen hinaus in den Forst gegangen; nachdem ich aber das neunte Jahr überschritten, wurde ich in die Schule gegeben, und weil es die Base ernst damit nahm, sintemal sie wußte, daß der Vater selig viel auf ein tüchtig Wissen gehalten, kam es seltener zu solchen Besuchen; auch hätte es die gestrenge Frau, die meinem Unterrichte fürstund, nimmer geduldet, einer Kurzweil zu liebe der Arbeit Ernst zu durchbrechen.
Schwester Margret, oder gemeinhin »die Karthäuserin[4]«, hieß das seltene Weibsbild, so sie mir zur Lehrerin erlesen. Sie war der frömmsten und gelehrtesten eine, stund als Priorin dem Kloster der Karthäuserinnen vor, und hatte zehn große Choralbücher und anderes mehr geschrieben. Obzwar ihres Ordens Regel das Reden verbietet, war es ihr dannocht verstattet, Unterricht zu erteilen.
O, wie hab' ich gezittert, da mich Base Metz in ihr Kloster führte!
Gewöhnlich stund mir das Zünglein nicht still, es sei denn, daß der Herdegen sang oder mir vorträumte, wie er es zu halten gedenke, wenn er sich zum Kanzler oder zum Feldhauptmann des Reichsheeres aufgeschwungen und eines Grafen oder Fürsten Töchterlein in sein hohes Schloß geführt haben werde. Dazu war der freie Wald mir zur zweiten Heimat geworden, und nun führten sie mich in das Kloster, wo das Schweigen ringsum mich drückte wie ein allzu knapp Mieder. In dem weiten Vorsaal, wo ich verblieb, stunden mancherlei Sprüche auf Latein an den Wänden, und am häufigsten unter einem Totenschädel dieser: »So sauer es fällt, als Karthäuser zu leben, so süß ist's, als solcher zu sterben.«
In einer Nische stund der Gekreuzigte, dem so viel licht, scharlachrot Blut von der Dornenkrone und aus den Wunden niedertroff, daß sein heiliger Leib mehr denn zur Hälfte damit bedecket, und mir bei seinem Anblick so angst ward, o, ich kann's nicht beschreiben. Und dabei verblieb es, wie eine Nonne nach der andern durch den Saal huschte, stumm und gesenkten Hauptes, mit auf der Brust gekreuzten Armen, und ohne nur ein Auge auf mich zu werfen.
Es war im Mai, der Tag schön und freundlich, doch mich begann hier zu frieren, und mir wurde zu Sinn, als sei der ganze Lenz verblüht, und als habe ich plötzlich verlernt, zu lachen und mich zu freuen. Da schlich sich eine Katze heran, sprang hart neben mich auf die Bank, krümmte den Buckel und wollte sich an mir reiben; ich aber, die sonst gern mit den Tieren spielte, wich zurück, da sie mich mit den grünen Augen sonderbar anfunkelte, denn plötzlich packte mich die Angst, sie werde sich in einen Werwolf verwandeln und mir ein Leids thun.
Da öffnete sich die Thür, und an der Seite der Base trat eine Frau in Nonnentracht herein, die jene wohl um eines Hauptes Länge überragte. Ein so hoch Frauenbild hatt' ich nimmer geschaut; doch die Nonne war dabei ganz schmal, und ihre Schultern mochten kaum breiter sein denn die meinen. Auch fiel sie bald zusammen, und so, mit krummem Rücken und vorgebeugtem Haupte, hab' ich sie später gewöhnlich gesehen. Sie sagten, ihr Rückgrat sei siech, und beim Schreiben, das sie auch nächtlicherweile betrieb, habe sie die geneigte Haltung gewonnen.
Zuerst wagte ich es nicht, zu ihr auf und ihr ins Antlitz zu schauen; denn die Base hatte mir gesagt, bei ihr gelt' es fleißig sein, und Müßiggang bestehe nimmer vor dem scharfen Blick ihrer Augen; dem Vetter Götz Waldstromer aber war der lateinische Spruch bekannt gewesen, mit dem sie all ihre Schriften begann: »Sieh zu, daß der Satan dich nie müßig finde!« Dies Wort fuhr mir jetzt wieder durch den Sinn, ich fühlte, daß ihr Auge fest auf mir ruhte, und wie schrak ich zusammen, da ihre kalten, spitzen Finder sich wir plötzlich an die Stirn legten und mein gesenktes Haupt nicht unsanft, aber entschieden zwangen, sich in die Höhe zu richten.
Da schlug ich die Augen zu ihr auf, und wie ward mir, als ich in ihr mager und bleich Antlitz schaute und darin nichts fand, denn lauter freundliche Güte.
Und nun fragte sie mich mit einer leisen, fast klanglosen, doch gar sanften Stimme, wie alt ich sei, wie ich heiße und was ich allbereit vermöge. Das that sie in ganz kurzen Sätzen, in denen kein Wort zu wenig oder zu viel, und so hat sie es auch später beim Unterricht gehalten; denn obzwar ihr der Dispens das Reden gestattete, behielt sie doch stets im Gedächtnis, daß am Jüngsten Tage Rechenschaft gefordert werde von jedem Wort, so die Lippe gesprochen.
Zuletzt erwähnte sie auch meiner Eltern selig, aber sie sagte nur: »Vater und Mutter sehen Dich immer, drum sei brav in der Schule, auf daß sie sich an Dir freuen. Morgen und alle Tage um sieben Uhr früh.«
Damit gab sie mir einen ganz leisen Kuß aus den Scheitel, verneigte sich stumm vor der Base und wandte uns beiden den Rücken. Mir aber war es, da ich hienach draußen rüstig fürbaz schritt und den blauen Himmel und das Wiesengrün wieder sah, die Vögel singen und die Kinder jubeln hörte, als sei mir eine Last von der Brust genommen, aber auch als fühle ich noch immer den Kuß der hohen, stillen Nonne und als habe sie mir damit etwas verliehen, so mir zur Ehre gereiche.
Am folgenden Morgen that ich den ersten Schulgang, und während es sonst nur den Pathen obliegt, den Kindern, bevor sie solchen antreten, Zuckerdüten zu senden, bekam ich dergleichen von vielen Gevattern und anderen aus unserer Freundschaft, weil ich doch in ihren Augen nur ein unglücklich Waislein.
So dacht' ich denn mehr an meinen Reichtum und wie ihn verteilen, als an Schule und Lernen, und wie mir die Base, um mich vor Hoffart zu wahren, nur eine Düte ins Ränzlein legte, schob ich eine zweite, besonders kleine, die von der reichen Frau Großin kam und feinere Näscherei enthielt, denn alle anderen, heimlich in das Täschlein, so mir vom Gürtel herabhing.
Unterwegs schaute ich nach den Leuten aus, und ob sie auch bemerkten, wie weit ich schon gediehen, und das kleine Herz schlug mir schneller, da mir vor der Rotschmiede des Meisters Pernhart der Vetter Götz begegnete, der aus dem Forst in die Stadt verzogen, um hier in der Losungsstube das Rechnungswesen zu lernen. Nachdem er uns recht frohgemut begrüßet, zog er mich am Zopfe und ging seiner Wege; mir aber war es, als bedeute mir selbige Begegnung das Beste.
In der Schule sollt' ich freilich dergleichen Thorheit hurtig vergessen; denn unter den sechzehn Schülerinnen der Schwester Margret stund ich hinter vielen zurück, nicht an Wuchs, denn für mein Alter war ich von artiger Größe, wohl aber an Jahren und Wissen; und solches mußt' ich allbereit in der ersten Stunde erfahren.
Fünfzehn von uns gehörten zu den Geschlechtern, und heute am ersten Schultag waren wir alle sonntäglich und gar sauber angethan in seinem florentinischen oder flandrischen Wollstoff und mit schön gezwickelten farbigen Strümpfen. An den Handsäumen der engen Aermel und im viereckigen Ausschnitt am Halse trugen wir geklöppelte Spitzen; keiner fehlte das seidene Band an den Zöpfen, und bei fast allen glänzte im Ohr und an der Brust oder am Gürtel ein gülden Spänglein. Nur eine stach durch Schlichtheit scharf ab von den anderen; denn wenn an ihr auch alles sauber und zierlich, stak sie doch nur in einem Gewande von geringem, grauen heimischen Stoff.
Bei ihrem Anblick mußt' ich alsbald des Aschenbrödels gedenken, doch wie ich ihr dann ins Antlitz und auf die Füße schaute, ob die einen wohl sonderbar klein und das andere so anmutsvoll wie im Märchen, da nahm ich an gar feinen, zarten Knöcheln die artigsten Schühlein wahr, und ein so holdselig und dazu fremdartig Antlitz meint' ich nimmer gesehen zu haben. Ja, sie schien aus einer anderen Welt zu stammen wie wir Schülerinnen alle; denn wir waren sämtlich blonde und braune, blau- und grauäugige Mägede mit gesunden rot und weißen Gesichtern; das Aschenbrödel aber hatte gewaltig große dunkle Augen unter der schmalen Stirn mit sonderbar langen, seidig feinen Wimpern, und volles kohlschwarzes Haar fiel ihr in schweren Zöpfen auf den Rücken.
Die Ursula Tetzelin galt bei den Buben für die schmuckste von uns allen, und es war mir wohl bewußt, daß mein Bruder Herdegen es gewesen, der ihr das Sträußlein am Mieder heut in der Frühe zugesteckt hatte, weil er sie für seine »Dame« und die Schönste erklärte; doch wie ich sie neben der andern sah, wollt' es mich dünken, als sei sie von geringerem Stoffe.
Uebrigens war mir die Neue fremd, während ich die anderen allesamt kannte, und nun mußt' ich mich eine volle Stunde gedulden, bevor es zu fragen anging, wer das holdselige Aschenbrödel sei; denn Schwester Margret hielt uns scharf im Auge, und so lang ich ihre Schülerin war, durfte keine wagen, während des Unterrichts zu plaudern oder andere Kurzweil zu treiben.
Endlich in der Zwischenpause fragte ich die Ursula Tetzelin, die schon ein Jahr zu der Karthäuserin ging. Da warf selbige die rote, volle Unterlippe verächtlich auf und versetzte, die »Neue« sei uns aufgedrängt worden und gehöre mit nichten hieher. Schwester Margret, die doch selbst einem adeligen Hause entstamme, habe vergessen, was sie uns und unseren Sippen schulde, und die graue Fledermaus aus Barmherzigkeit zu uns gesellet. Ihr Vater sei nur Schreiber am Vormundschaftsamt und besorge das Rechnungswesen des Klosters umsonst oder für ein Geringes. Er heiße Veit Spieß, und sie, die Ursula, habe von ihrem Vater vernommen, der Schreiber sei nur eines Lautenisten[5] Sohn und müsse sich kümmerlich nähren. Anfänglich sei er als Handelsknecht zu Venedig gewesen. Dort habe er ein welsches Weib gefreit, von der all die Schreiberskinder, und es seien ihrer viele, die schwarzen Teufelshaare und Augen bekommen. Um ein »Gott lohn's!« sei die Ann uns Töchtern adeliger Geschlechter aufgedrängt worden; »doch wir anderen,« schloß die Ursula, »beißen sie heraus; Du wirst es ja sehen!«
Solches erschreckte mich baz, und ich versetzte, das würde ja bös sein und könne mir nimmer gefallen; die Tetzelin aber erwiderte lachend, ich sei noch gar grün, und wandte sich dabei dem Fensterbrett zu, worauf alle Neuen ihre Düten ausgeschüttet hatten, wie es der Princeps oder die Erste geboten; denn das Zuckerwerk, so die Novizen am ersten Schultage mitbrachten, war an selbigem, gemäß einer alten Sitte, Gemeingut.
Die ganze Schar drängte sich dicht um den wachsenden Berg der Näschereien, und auch ich stund allbereit unter den anderen, wie ich bemerkte, daß des Schreibers Ann, das Aschenbrödel, ganz allein und gesenkten Hauptes neben dem großen Kachelofen im Hintergrunde des Zimmers stund.
Da eilte ich denn ungesäumt an ihre Seite, drückte das Dütlein der Frau Großin, so ich mir heimlich in die Tasche geschoben, ihr verstohlen in die Hand und raunte ihr zu: »Ich hatt' ihrer zwei, Annelein; rasch, rasch, und schütt es mit aus!«
Da schaute sie mich mit den großen Augen fragend an, und wie sie sah, daß ich's treulich meine, nickte sie mir zu, und in ihrem feuchten Blicke lag etwas, so ich nimmer vergesse, und auch das ist mir im Gedächtnis verblieben, daß es mir, wie die Düte aus meiner in ihre Hand überging, war, als sei nicht sie, sondern ich die Beschenkte.
Hienach überreichte sie der Ersten gelassen und schweigend, was sie von mir empfangen, und schien den Spott nicht zu merken, den die Kleinheit der Düte hervorrief. Aber bald ging der Hohn in Genügen und eitel Lobpreisung über; denn aus dem Dütlein des Aschenbrödels fielen so feine Näschereien auf den Haufen nieder, wie sie keine andere gebracht, und darunter sogar ein Fläschlein Rosenöl aus der Levante.
Erst mit einem besorgten Blick auf mich, dann aber völlig gelassen, hatte die Ann all diese Herrlichkeiten erscheinen sehen, wie aber das Rosenöl ans Licht kam, ergriff sie es mit sicherer Hand, um es mir zu reichen.
Da rief die Ursula: »Nein! Was die Neuen da bringen, wird zu gleichen Teilen verteilt!« Doch die Ann legte die Rechte auf meine Hand, die das Glas allbereit ergriffen, und versetzte bestimmt: »Dies Fläschlein geb' ich der Gred, und dem andern entsag' ich.«
Da war denn auch keine, die ihrem Verlangen widersprochen hätte; und wie die Ann sich sträubte, mitzuschmausen, war jede bestrebt, ihr aufzudrängen, was ihr doch zukam.
Wenn Schwester Margret in den Schulraum trat, verlangte sie uns in bester Ordnung und voller Ruhe zu finden, und während wir sie still erwarteten, flüsterte die Ann mir zu, als ob sie sich zu rechtfertigen wünsche: »Ich hatte auch eine Düte, doch bei uns daheim sind noch vier Kleine.«
Vor dem Kloster wartete die Base, um mich nach Haus zu geleiten, und da ich mich anschickte, Hand in Hand mit der neuen Freundin fürbaß zu schreiten, sah sie das schlicht gekleidete Kind von oben bis unten an, und zwar nicht eben freundlich. Hienach trennte sie meine Hand von der ihren, und solches ging vor sich, als ob es durch Zufall geschähe; denn sie trat zwischen uns, wie um mir das Käpplein gerade zu rücken. Endlich machte sie sich auch mit meiner Halskrause zu schaffen und flüsterte mir dabei fragend ins Ohr, wer das sei?
Da versetzte ich: »Das Annelein;« und wie sie weiter nach dem Vater forschte und ich erwiderte, sie sei eines Schreibers Tochter, und dann fortfahren wollte, sie weidlich zu preisen, unterbrach mich die Base, faßte mich bei der Hand, und indem sie der Ann zurief: »Grüß Gott, Kind; ich und die Gred haben Eile,« wollte sie sich rasch mit mir entfernen; ich aber suchte mich von ihr zu befreien und begehrte auf und rief mit dem ungestümen Trotz, der mir damals immerdar eigen, wenn ich glaubte, daß man nicht gelten lasse, was mich recht und billig dünkte: »Das Annelein soll mit uns!«
Doch das Schreiberkind hatte auch seinen Stolz und erwiderte fest: »Sei gehorsam, Gred; ich kann auch allein gehen.«
Da schaute die Base ihr näher ins Antlitz, und alsbald gewannen ihre Augen den schönen, milden Glanz wieder, der mir an ihnen so lieb war, und sie begann nun selbst die Ann nach ihren Leuten zu fragen.
Da erhielt sie denn schnelle und doch bescheidentliche Antwort, und als die Base erfuhr, ihr Vater sei der Schreiber des Vormundschaftsamts, von dem sie viel Rühmliches vernommen, ward sie immer gütiger und sanfter, und wie ich sodann der Ann Händlein von neuem ergriff, ließ sie's geschehen, und weil wir uns trennten, küßte sie ihr die Stirn und gab ihr auch einen Gruß mit an den wackeren Herrn Vater.