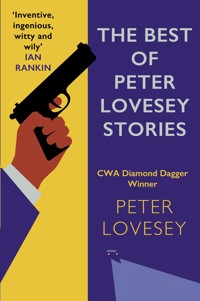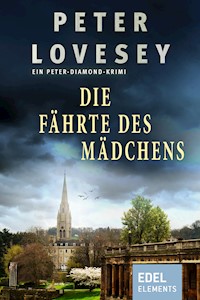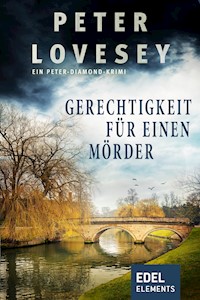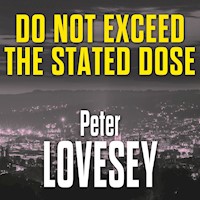3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter-Diamond-Krimi
- Sprache: Deutsch
Peter Diamond ist über vierzig, übergewichtig, überempfindlich, übererfolgreich und vielen ein übergroßes Ärgernis. Als Polizist vertraut er der Intuition mehr als dem Computer. Eine nackte Frauenleiche in einem See fordert seinen Spürsinn und seine ganze berufliche Erfahrung. Doch ehe Diamond den Fall aufklären kann, quittiert er beleidigt den Polizeidienst und ermittelt auf eigene Faust... Erster Band der Peter-Diamond-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Peter Lovesey
Die Frau im See
Ein Peter-Diamond-Krimi
Ins Deutsche übertragen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Edel eBooks
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Copyright der Originalausgabe © 1991 by Peter Lovesey
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THE LAST DETECTIVE.
Ins Deutsche übertragen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Copyright der deutschen Übersetzung © Piper Verlag GmbH, München 1998
First published in Germany under the title DIE FRAU IM SEE by Piper Verlag (1998)
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS
Die Frau im See
1
Ein Mann stand bis über die Knie im Wasser, bewegungslos, geistesabwesend, nicht ahnend, was da auf ihn zutrieb. Er angelte am Nordufer des Chew Valley Lake, einer knapp fünfhundert Hektar großen Talsperre am Fuße der Mendip Hills, südlich von Bristol. Er hatte bereits drei Flußforellen von respektabler Größe gefangen.
Er starrte angestrengt auf die Stelle in dem ruhigen See, wo er den Köder ausgeworfen hatte, und wartete auf einen verräterischen Wirbel im Wasser. Die Bedingungen waren vielversprechend.
Es war ein Abend Ende September, der Himmel bedeckt, und Abermillionen von Fliegen waren soeben in ihrem Dämmerungsflug über ihn hinweggeschwärmt. Sie schwirrten und tanzten über dem See wie eine dichte Masse, die dunkler war als die Wolken, und ihr Summen dröhnte so laut wie eine nahende U-Bahn. Den tagsüber geschlüpften Jungen konnten hungrige Fische nicht widerstehen.
Eine leichte Brise von Südwesten kräuselte die Wasseroberfläche um ihn herum, doch weiter vor ihm war eine Stelle im Wasser, wie sie von Anglern Kolk genannt wird. Dort, so wußte er aus Erfahrung, stiegen die Fische am liebsten.
Der Mann war so konzentriert, daß er das blasse Objekt in seiner unmittelbaren Nähe überhaupt nicht bemerkte. Es trieb, zu mehr als der Hälfte unter Wasser, träge mit der Strömung, die durch den Wind verursacht wurde, und machte dabei eine sanft schaukelnde Bewegung, die mitunter den Anschein von Leben erweckte.
Schließlich berührte es ihn. Eine weiße Hand glitt gegen seinen Oberschenkel. Ein Arm klappte ganz nach außen, als die Leiche gegen ihn stieß und mit der Achselhöhle hängenblieb. Es war eine tote Frau, das Gesicht nach oben, nackt.
Der Angler blickte nach unten. Aus seiner Kehle drang ein kindlich heller, verhaltener Schrei.
Einen Moment lang stand er wie versteinert. Dann riß er sich mit plötzlicher Willensanstrengung zusammen, um sich aus der ungewollten Umarmung zu befreien. Er wollte die Leiche nicht anfassen und benutzte deshalb den Griff seiner Angelrute, den er in die Achselhöhle schob, um den Körper wegzustoßen. Gleichzeitig wandte er sich ab und machte einen Schritt zur Seite, so daß die Leiche mit der Strömung weitertreiben konnte. Nun nahm er sich nicht einmal mehr die Zeit, seine Leine einzuholen, sondern riß sein Netz aus der Befestigung im Schlamm und platschte eilig zum Ufer. Dort angekommen, schaute er sich um. Es war niemand zu sehen.
Der Angler wollte keine Scherereien. Er packte einfach seine Ausrüstung zusammen und begab sich so schnell wie möglich zu seinem Wagen. Aber dann kam ihm noch ein Gedanke. Bevor er abfuhr, öffnete er die Tasche mit seinem Fang und warf die drei Forellen zurück ins Wasser.
2
Kurz nach halb elf an jenem Samstagabend sahen sich Police Constable Harry Sedgemoor und seine Frau Shirley in ihrem Reihenhäuschen in Bishop Sutton am Ostuter des Sees gerade ein Horrorvideo an. PC Sedgemoor war um sechs Uhr vom Dienst gekommen. Sein langer Körper lag ausgestreckt auf dem Sofa, die nackten Füße ragten über das Ende hinaus. An diesem warmen Abend hatte er ein schwarzes ärmelloses Unterhemd und Shorts angezogen. Seine linke Hand hielt eine Dose Malthouse-Bier, während seine rechte Shirleys Kopf streichelte und träge die schwarzen Locken geradezog, nur, um zu spüren, wie sie wieder zurückschnellten. Shirley hatte sich nach dem Duschen bloß ihr weißes Baumwollnachthemd übergezogen und saß jetzt, den Rücken gegen das Sofa gelehnt, auf dem Boden. Sie hatte die Augen geschlossen. Der Film langweilte sie, aber sie hatte nichts dagegen, daß Harry ihn sich ansah, wenn sie darauf hoffen konnte, daß er sich hinterher im Bett eng an sie schmiegte, was er meist tat, nachdem er sich einen Horrorfilm angesehen hatte. Insgeheim hegte sie den Verdacht, daß ihm die Filme mehr Angst einjagten als ihr, aber so etwas sagte man nicht zu seinem Mann, erst recht nicht, wenn der auch noch Polizist war. Also wartete sie geduldig auf das Ende. Die Kassette war fast abgelaufen. Harry hatte mehrmals den schnellen Vorlauf betätigt, um langweilige Dialogstellen zu überspringen.
Die Geigen des Soundtracks arbeiteten sich gerade zu einem durchdringenden Crescendo hoch, als die Sedgemoors beide das Klacken des Gartentors hörten. Shirley sagte gereizt: »Das darf doch wohl nicht wahr sein! Wieviel Uhr haben wir?«
Ihr Mann seufzte, schwang die Beine vom Sofa, stand auf und blickte zum Fenster hinaus. »Irgendeine Frau.« Im Schein der Außenlampe konnte er nicht viel sehen.
Er erkannte die Besucherin erst, als er die Tür öffnete: Miss Trenchard-Smith, die ganz allein in einem der älteren Häuser am anderen Ende des Dorfes wohnte. Eine resolute Siebzigjährige, die nie ohne ihren Tirolerhut gesehen wurde, der im Laufe der Jahre von einem dunklen Braun zu einer Farbe verblaßt war, die sich allmählich an das dunkle Rosa des Gesteins aus der Gegend anzupassen schien.
»Es tut mir leid, Sie so spät noch zu stören, Officer«, sagte sie, während ihr Blick in einer raschen Folge von ruckartigen Augenbewegungen über sein Unterhemd und die Shorts wanderte, »aber ich denke, Sie werden meine Meinung teilen, daß mein Fund von hinreichender Bedeutung ist, um eine solche Aufdringlichkeit zu rechtfertigen.« Ihr unangenehm affektierter Tonfall verlieh jedem Wort übertriebenes Gewicht. Auch wenn sie seit dem Krieg im Dorf lebte, sie würde nie als Einheimische angesehen werden und legte wahrscheinlich auch keinen Wert darauf.
PC Sedgemoor fragte nachsichtig: »Und worum handelt es sich dabei, Miss Trenchard-Smith?«
»Um eine Leiche.«
»Eine Leiche?« Er befingerte sein Kinn und versuchte, gelassen zu wirken, doch sein Puls raste. Trotz der sechs Monate im Dienst war er noch nie zu einer Leiche gerufen worden.
Miss Trenchard-Smith wurde genauer. »Ich habe meine Katzen am See spazierengeführt. Die meisten Menschen glauben ja nicht, daß Katzen gerne ausgeführt werden, aber meine mögen das. Jeden Abend um diese Zeit. Sie bestehen darauf. Sie lassen mich nicht schlafen, bevor sie draußen waren.«
»Eine menschliche Leiche, meinen Sie?«
»Aber natürlich. Eine Frau. Splitternackt, das arme Ding.«
»Am besten, Sie zeigen sie mir. Liegt sie ... liegt diese Frau in der Nähe?«
»Im See, falls sie nicht schon abgetrieben ist.«
Sedgemoor enthielt sich der Bemerkung, daß die Leiche auch dann noch im See läge, wenn sie abgetrieben wäre. Er brauchte Miss Trenchard-Smiths Mitwirkung. Er bat sie einen Moment ins Haus, während er nach oben lief, um sich einen Pullover und sein Funkgerät zu holen.
Shirley war inzwischen aufgestanden und hatte Miss Trenchard-Smith guten Abend gesagt, deren Tonfall, als sie den Gruß erwiderte, keinen Zweifel daran ließ, daß sich ihrer Ansicht nach keine anständige Frau außerhalb des Schlafzimmers nur mit einem Nachthemd bekleidet zeigen sollte.
»Das muß ja ein entsetzliches Erlebnis für Sie gewesen sein!« bemerkte Shirley und meinte damit den Fund am See. »Möchten Sie vielleicht ein Schlückchen zur Beruhigung?«
Miss Trenchard-Smith dankte ihr knapp und verneinte. »Aber vielleicht könnten Sie nach meinen Katzen sehen, solange ich fort bin«, sagte sie, als erwiese sie Shirley damit einen Gefallen. »Sie haben doch nichts gegen Katzen, oder?« Ohne auf eine Antwort zu warten, ging sie zur Tür und rief: »Kommt, kommt, na kommt«, und zwei Siamkatzen kamen aus der Dunkelheit schnurstracks ins Haus gefegt und sprangen auf das vorgewärmte Plätzchen, das Harry auf dem Sofa hinterlassen hatte.
Als Harry wieder herunterkam, musterte ihn Shirley und sagte: »Ich dachte, du wärst hochgegangen, um dir eine Hose anzuziehen.«
Er erwiderte: »Könnte ja schließlich sein, daß ich reinwaten und was rausziehen muß.« Sie schauderte.
Er nahm seine Taschenlampe vom Regal neben der Tür. Es gelang ihm, seine Stimme halbwegs selbstbewußt klingen zu lassen, als er sagte: »Bye, Schatz.« Er gab Shirley einen flüchtigen Kuß und flüsterte, um sie ein wenig zu beruhigen: »Hat sie wahrscheinlich nur geträumt.«
Doch nicht dieser alte Dragoner, dachte Shirley. Wenn die sagt, sie hat eine Leiche gefunden, dann ist da auch eine Leiche.
Harry Sedgemoor war sich da weniger sicher. Während er mit Miss Trenchard-Smith die halbe Meile bis zum Seeufer fuhr, erwog er ernsthaft die Möglichkeit, daß sie alles nur erfunden hatte, um sich in ihrem langweiligen Alltag einen kleinen Kitzel zu verschaffen. Es wäre nicht das erste Mal, daß eine alte, alleinstehende Dame der Polizei mit einem Ammenmärchen die Zeit stahl. Sollte das der Fall sein, würde er ihr die Leviten lesen. Er war sich verdammt sicher, daß Shirley heute nacht keine Lust mehr haben würde, mit ihm zu schlafen. Ganz gleich, was da nun wirklich im See lag, allein die Erwähnung einer Leiche hatte ihre Phantasie bestimmt derart angekurbelt, daß er tun und sagen konnte, was er wollte, sie würde sich nicht mehr entspannen.
Bemüht, den kompetenten Polizisten herauszukehren, fragte er Miss Trenchard-Smith, wo er anhalten solle.
»Wo Sie möchten«, sagte sie mit einer bedenklich unbekümmerten Miene. »Ich habe nicht die blasseste Ahnung, wo wir sind.«
Er stellte den Wagen da ab, wo die Straße endete. Sie stiegen aus und gingen über ein Stück Wiese, wobei er mit der Taschenlampe den Boden vor ihnen ableuchtete. Jenseits der Umzäunung der Talsperre wiegten sich Schilfgrasbüschel in der leichten Brise und schienen im Schein der Taschenlampe zu flackern. Das Ufer war in Abständen flach.
»Wie sind Sie denn bis direkt ans Wasser gekommen?« fragte er.
»Durch eines der Törchen.«
»Die sind aber nur für Angler.«
»Ich störe sie nicht.« Sie lachte auf. »Und ich verrate auch niemandem, daß Sie eine Ordnungswidrigkeit begehen.«
Er öffnete ein Tor im Zaun, und sie gingen vorsichtig bis zum Wasser. »War es hier?«
Sie sagte: »Es sieht jetzt alles auf einmal ganz anders aus.«
Er unterdrückte seinen Ärger und schwenkte den Schein der Taschenlampe langsam in einem weiten Bogen. »Irgendwas müssen Sie doch wiedererkennen. Wie haben Sie die Leiche denn bemerkt?«
»Da war es noch nicht ganz dunkel.«
Fünfzig Meter weiter wuchs das Schilfgras besonders hoch. »Vielleicht da irgendwo?«
»Es kann ja wohl nichts schaden, wenn wir mal nachsehen«, entgegnete sie.
»Deshalb sind wir hier, Miss.« Er machte einen Schritt hinein und spürte, wie sein Fuß in weichem Schlamm versank. »Bleiben Sie lieber, wo Sie sind«, sagte er zu Miss Trenchard-Smith. Dann arbeitete er sich bis zur anderen Seite durch. Nichts, bis auf eine Entenfamilie, die lautstark protestierte.
Er kehrte zum Ufer zurück. Sie sagte: »Wie sehen denn Ihre Turnschuhe aus!«
»Wir suchen nach einer Leiche, Miss«, rief PC Sedgemoor ihr ins Gedächtnis, »und das müssen wir richtig machen.«
»Wenn Sie unbedingt durch jedes Schilfgrasbüschel waten müssen, sind wir morgen früh noch hier«, sagte sie vergnügt.
Nach zwanzig Minuten Suche hatten sie noch nichts erreicht, außer daß Miss Trenchard-Smith respektloser und PC Sedgemoor ungeduldiger wurde. Sie bewegten sich in gleichmäßigem Tempo am Ufer entlang. Er leuchtete mit der Taschenlampe auf seine Uhr und dachte verbittert an Shirley, die allein mit diesen unangenehmen Katzen zu Hause war, während er sich vor dieser überkandidelten alten Jungfer zum Narren machte. Fast halb zwölf. Toller Samstagabend! Mit einer verärgerten Geste ließ er den Lichtstrahl rasch über die offene Wasserfläche gleiten, als ob er die Fruchtlosigkeit ihres Unterfangens demonstrieren wollte. Und absurderweise sagte Miss Trenchard-Smith just in diesem Moment: »Da!«
»Wo?«
»Geben Sie mir die Lampe«, befahl sie.
Er reichte sie ihr und schaute angestrengt, während sie sie mit ausgestrecktem Arm hielt. Der Strahl fiel auf etwas Weißes im Wasser.
PC Sedgemoor schnappte nach Luft. »Wer hätte das gedacht?« flüsterte er. »Sie hatten recht.«
Die Leiche hatte sich kaum drei Meter von ihnen entfernt im Schilf verfangen, an einer Stelle, wo die im Licht chromgrün schillernde Wasserpest besonders dicht wuchs. Zweifellos eine Frau, Gesicht nach oben, das lange Haar im Wasser ausgebreitet, eine Strähne quer über dem Hals. Der blasse Körper war mit Samenkapseln übersät. Verletzungen waren nicht auszumachen. Sedgemoor mußte an ein Gemälde denken, das er einmal auf einem Schulausflug nach London gesehen hatte: eine tote Frau im Schilf, offensichtlich ertrunken. Er war tief beeindruckt gewesen, weil der Lehrer gesagt hatte, daß das Modell im Atelier des Künstlers stundenlang in einer Badewanne hatte liegen müssen, und eines Tages hatte der Künstler vergessen, die Heizlampen zu füllen, die das Wasser warm halten sollten. Als Folge davon hatte die junge Frau sich eine Krankheit zugezogen, an der sie zwar nicht gleich gestorben war, die aber sicher ihr Leben verkürzt hatte. Die Geschichte sollte der Klasse als Beispiel für obsessives Bemühen um möglichst naturgetreue Wiedergabe dienen. Sedgemoor war vor dem Bild stehengeblieben, bis der Lehrer ihn aus dem nächsten Saal scharf mit Namen rief. Es war nämlich die erste Darstellung eines toten Menschen, die er je gesehen hatte, und Kinder sind vom Tod fasziniert. Jetzt, angesichts einer echten Wasserleiche, wurde ihm eindringlich klar, wie idealisiert das präraffaelitische Bild gewesen war. Nicht nur, daß die Frau in dem Gemälde bekleidet gewesen war. Hände und Gesicht waren anmutig auf der Wasseroberfläche getrieben. Das Gesicht der realen Ertrunkenen war unter Wasser, durch das Gewicht des Kopfes nach unten gezogen. Der Bauch ragte heraus, und er war aufgedunsen. Die Haut auf den Brüsten wirkte runzlig. Die Hände hingen so tief, daß sie überhaupt nicht zu sehen waren.
»Es kommt Wind auf«, sagte Miss Trenchard-Smith.
»Ja«, antwortete er geistesabwesend.
»Wenn Sie nichts tun, wird sie wieder abgetrieben.«
Der diensthabende Inspector der F-Division in Yeovil hörte aus PC Sedgemoors Funkmeldung sofort das wichtigste Wort heraus. »Nackt« bedeutete höchste Alarmbereitschaft. Im allgemeinen kann man Unfall oder Selbstmord ausschließen, wenn man eine nackte Leiche in einem See findet. »Und Sie haben sie angefaßt, sagen Sie? War das nötig? Also schön, schon gut. Bleiben Sie, wo Sie sind. Und das meine ich wörtlich. Sie bleiben jetzt wie angewurzelt stehen. Sie zertrampeln den Boden nicht. Sie fassen die Leiche nicht noch einmal an. Sie rauchen nicht, kämmen sich nicht, kratzen sich nicht an den Eiern, Sie tun rein gar nichts.«
Sedgemoor war leider gezwungen, die Anweisung zu mißachten. Er hatte darauf verzichtet, den Inspector darüber aufzuklären, daß er von seinem Wagen aus anrief, wo er sein Funkgerät dummerweise hatte liegenlassen. Er setzte sich in Trab und lief zurück zum See.
Miss Trenchard-Smith stand im Dunkeln neben der Leiche und schien völlig ungerührt. »Ich habe Ihre Taschenlampe ausgemacht, um die Batterie zu schonen.«
Er erklärte, die Kollegen seien schon unterwegs, und er werde dafür sorgen, daß Miss Trenchard-Smith umgehend nach Hause gebracht wurde.
»Ich hoffe nicht«, sagte sie. »Ich wäre gern behilflich.«
»Ihre Hilfsbereitschaft in allen Ehren, Miss«, sagte Sedgemoor. »Aber unsere Kripo wird keine Hilfe brauchen.«
»Sie waren froh drüber, junger Mann.«
»Ja.«
Sie war nicht zu bremsen. Frauen ihres Formats hatten in langen Röcken das Matterhorn bestiegen und sich an Gitter gekettet. »Die werden sie identifizieren wollen«, sagte sie genußvoll. »Ich bin zwar kein Sherlock Holmes, aber ich kann denen jetzt schon einiges erzählen. Sie war verheiratet, stolz auf ihren Körper und hat zu enge Schuhe getragen. Zudem scheint mir, daß sie rotes Haar hat. Als Sie sie rausgezogen haben, sah es zuerst dunkelbraun aus, aber bei genauerer Betrachtung würde ich sagen, daß es ein bezauberndes Kastanienrot ist, finden Sie nicht?« Sie schaltete die Lampe ein und beugte sich bewundernd über das Gesicht, als wäre es durch den langen Aufenthalt im Wasser in keiner Weise entstellt worden. »Kein Wunder, daß sie ihr Haar lang getragen hat.«
»Nicht anfassen!« ermahnte Sedgemoor sie.
Aber sie hatte bereits eine Haarlocke zwischen Finger und Daumen. »Fühlen Sie doch mal, wie weich es ist. Seien Sie nicht so penibel.«
»Das ist nicht der Punkt – so lauten nun mal die Vorschriften. Man darf nichts anfassen.«
Sie blickte lächelnd auf. »Sie haben sie doch eben aus dem Wasser gezogen. Da macht es doch wohl nichts, wenn ich ihr Haar berühre.«
»Ich habe meine Anweisungen«, sagte er förmlich, »und ich muß Sie dringend ersuchen, sich daran zu halten.«
»Wie Sie wünschen.« Sie richtete sich auf und benutzte die Taschenlampe, um ihre Erkenntnisse zu untermauern. »Abdruck eines Eherings an der linken Hand. Spuren von Nagellack auf Zehen- und Fingernägeln. Verbogene Zehen und gerötete Fersen. Weder ein Bauernmädchen noch eine Feministin, mein lieber Watson. Wo bleiben die denn? Sie müßten doch inzwischen da sein.«
Mit spürbarer Erleichterung erspähte Sedgemoor in einiger Entfernung das Blaulicht eines Polizeiwagens. Er schwang die Taschenlampe in einem weiten Bogen über dem Kopf.
Mit verwirrender Schnelligkeit war die einsam gelegene Stelle von hektischer Betriebsamkeit erfüllt, wie es der junge Constable bislang nur von Ausbildungsvideos kannte. Eine Funkstreife, zwei große Mannschaftswagen und ein Minibus fuhren über die Wiese. Als sie anhielten, sprang mindestens ein Dutzend Menschen heraus. Das Gebiet wurde mit weißem Polizeiband abgesperrt und mit Bogenlampen ausgeleuchtet. Zwei Detectives näherten sich der Leiche und blieben einige Zeit neben ihr stehen. Dann rückte die Spurensicherung an, und die Leute von der Gerichtsmedizin trafen ein. Ein Fotograf machte Aufnahmen, und man stellte einen Sichtschutz auf. Miss Trenchard-Smith wurde zu dem Minibus geführt und zum Auffinden der Leiche vernommen. Die Detectives interessierten sich mehr für ihre grünen Gummistiefel als für ihre Erkenntnisse in bezug auf die Leiche. Man fotografierte die Stiefel und machte Gipsabdrücke davon. Danach wurde sie zurück zu PC Sedgemoors Haus gefahren.
Sedgemoor selbst wurde nicht viel länger aufgehalten. Er machte seine Aussage, übergab der Spurensicherung seine schlammigen Joggingschuhe, wartete, bis er sie zurückbekam und fuhr dann nach Hause. Als er wenige Minuten nach Mitternacht dort eintraf, war Miss Trenchard-Smith mit ihren Katzen noch da. Auch um halb zwei war sie noch da, trank Kakao und schwelgte in Erinnerungen an ihre Zeit bei den Sanitätern während des Krieges. Wie sie es drastisch formulierte, waren plötzliche Todesfälle ganz nach ihrem Geschmack. Bei Harry Sedgemoor war das anders. Er lehnte den von Shirley angebotenen Kakao ab und ging nach oben, um nach Magentabletten zu suchen. Am nächsten Morgen um acht Uhr mußte er wieder seinen Dienst antreten.
3
Im städtischen Leichenschauhaus von Bristol lag ein Körper ausgestreckt auf einer Stahlbahre. Im Profil gesehen erinnerte die enorme Wölbung des Bauches geradezu an eine Berglandschaft. Mit etwas mehr Phantasie hätte man sich auch einen Dinosaurier vorstellen können, der in einem kreidezeitlichen Sumpf auf der Lauer liegt, wenn da nicht auf dem kleinen Hügel der braune Filzhut gelegen hätte, ein Hut, wie aus Filmen der vierziger Jahre. Der Körper war mit einem grauen, großkarierten Zweireiher bekleidet, der an den Hauptbelastungspunkten arg zerknittert war und bei der Polizei von Avon und Somerset als die Arbeitskleidung von Detective Superintendent Peter Diamond bekannt war. Sein von silbrigen Fransen gesäumter kahler Kopf ruhte auf einem Gummituch, das er zusammengefaltet auf einem Regal entdeckt hatte. Er atmete gleichmäßig.
Peter Diamond hatte alles Recht der Welt, die Füße hochzulegen. Seitdem das Telefon neben seinem Bett in Bear Flat, einem Vorort von Bath, ihn kurz nach ein Uhr nachts geweckt hatte, war er unermüdlich im Einsatz gewesen. Als er am Chew Valley Lake eintraf, um sich die Leiche anzusehen, hatten die Kripobeamten vor Ort bereits alles veranlaßt, aber noch immer standen Entscheidungen an, die nur Diamond treffen konnte, galt es, Hebel in Bewegung zu setzen, die nur der leitende Ermittler betätigen konnte. Er hatte die Führung übernommen wie ein Dirigent.
Selbstverständlich war eine nackte Leiche im See ein ungeklärter Todesfall, der dazu berechtigte, einen vom Innenministerium offiziell benannten Pathologen hinzuzuziehen. Fest entschlossen, den besten zu bekommen und nicht bloß einen der örtlichen Ärzte, die nur ermächtigt waren festzustellen, daß der Tod eingetreten war, hatte Diamond höchstselbst Dr. Jack Merlin zu Hause in Reading angerufen, immerhin siebzig Meilen entfernt, und ihm die Fakten dargelegt. Auf der Liste des Innenministeriums der forensischen Pathologen für England und Wales standen weniger als dreißig Namen, aber einige davon wohnten näher am Chew Valley Lake als Dr. Merlin. Dennoch hatte Diamond sich auf Jack Merlin versteift. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, sich nur mit dem Besten zufriedenzugeben. Tatsächlich trugen zwei, drei Pathologen die Hauptlast der Arbeit in ganz Südengland, und mitunter mußten sie weite Strecken mit dem Auto zum jeweiligen Tatort zurücklegen. Dr. Merlin war fürchterlich überarbeitet, selbst ohne die Notfälle, weil ihn das System dazu zwang, pro Jahr zahlreiche Routineautopsien durchzuführen, damit sein forensisches Forschungsteam weiterhin Mittel zur Verfügung gestellt bekam. Wenn er zu einer Leiche gerufen wurde, ließ er sich daher von dem leitenden Detective sinnvollerweise versichern, daß seine Anwesenheit unverzichtbar war.
Ohne Diamonds frühmorgendlichem Charme gänzlich zu erliegen, sagte er sofort zu. Um halb vier war er am Fundort der Leiche eingetroffen. Jetzt, zehn Stunden später, führte er gerade im Nebenraum die Autopsie durch.
Der Anblick der leeren Bahre war für Peter Diamond unwiderstehlich gewesen. Eigentlich war er hier, um bei der Autopsie zugegen zu sein. Da in der modernen Polizeiarbeit zunehmend auf wissenschaftliches und technisches Knowhow Wert gelegt wurde, war es mittlerweile üblich geworden, daß die Detectives bei den Ermittlungen in einem ungeklärten Todesfall dem Pathologen bei der Arbeit zusahen. Diamond ergriff die Gelegenheit dazu nicht so bereitwillig wie manche seiner Kollegen; ihm genügte es, wenn er sich auf den Bericht des Pathologen verlassen konnte. Es war nicht das erste Mal, daß er sich auf dem Weg zu einer Autopsie für einen kleinen Umweg entschied und die Geschwindigkeitsbegrenzungen exakt beachtete. Bei seiner Ankunft hatte er eine ganze Weile mit der Suche nach einem Parkplatz verbracht. Als er schließlich das Leichenschauhaus betrat und erfuhr, daß der Pathologe bereits ohne ihn angefangen hatte und Inspector Wigfull, sein verläßlicher Assistent, bereits hineingegangen war, hatte er gegrinst und gesagt: »So ein Pech. Schön für John Wigfull. Ein Päuschen für mich.«
Für den nun schlummernden Detective Superintendent waren jene ersten Stunden so anstrengend gewesen, wie sie es immer waren, wenn er das Chaos, das sich nach dem Fund einer Leiche einstellte, wieder in den Griff bekommen mußte. Jetzt aber surrte das Räderwerk der Kripo, und die üblichen Schritte mit dem Coroner, den Beamten von der Spurensicherung, dem Vermißtenverzeichnis, dem forensischen Labor und der Pressestelle waren eingeleitet. Er konnte sich guten Gewissens ein Nickerchen gönnen, während er darauf wartete, was Jack Merlin ihm zu berichten hatte.
Plötzlich öffnete sich die Tür zum Autopsieraum, und er wachte auf. Ein unangenehmer Geruch lag in der Luft: billiger Blumenduft, den ein übereifriger Techniker aus einer Spraydose versprühte. Diamond blinzelte, reckte sich, griff nach seinem Filzhut und hob ihn zum Gruß.
»Du hättest reinkommen sollen«, hörte er Merlin sagen.
»Zu knapp nach dem Mittagessen.« Diamond hievte sich schwerfällig auf einen Ellbogen. Es stimmte, er war es nicht gewohnt, das Mittagessen zu verpassen. Er hatte sich keine Anzüge mehr von der Stange gekauft, als er mit Rugby anfing und allmählich dicker wurde. Mit Rugby hatte er vor acht Jahren aufgehört, als er dreiunddreißig war. Mit dem Dickerwerden nicht. Es machte ihm nichts aus. »Also, wie lautet dein vorläufiges Urteil – mit den üblichen Einschränkungen?«
Merlin lächelte duldsam. Dieser schmächtige, weißhaarige Mann mit der sanften Stimme und einem West-Country-Akzent, der an blauen Himmel und Schlagsahne denken ließ, verströmte einen solchen Optimismus, daß es ein Jammer war, daß die Menschen, zu denen er gerufen wurde, aufgrund ihres Zustandes nichts davon hatten. »Wenn ich du wäre, Superintendent, wäre ich ganz begeistert.«
Diamond brachte so etwas wie Begeisterung zum Ausdruck, indem er sich in sitzende Position wuchtete, sich seitlich drehte und die Beine über den Rand der Bahre baumeln ließ.
Merlin gab seine Erklärung ab. »Das ist eine Gelegenheit, von der so einer wie du nur träumen kann – eine echte Prüfung deiner kriminalistischen Fähigkeiten. Eine unidentifizierte Leiche. Keine Kleidung, um sie von einer Million anderer Frauen zu unterscheiden. Keinerlei Merkmale von irgendwelcher Bedeutung. Keine Mordwaffe.«
»Was soll das heißen – ›so einer wie du‹?«
»Du weißt ganz genau, was das heißt, Peter. Du bist der Endpunkt einer Ära. Der letzte Detective. Ein echter Schnüffler, nicht bloß irgendein junger Bursche von der Polizeischule mit einem Abschluß in Informatik.«
Diamond ließ sich nicht beirren. »Keine Mordwaffe, hast du gesagt. Heißt das, daß es eindeutig Mord war?«
»Das habe ich nicht gesagt. Würde ich auch nie, oder? In meiner Branche wird seziert, nicht deduziert.«
»Ich möchte bloß, daß du mir hilfst, soweit du kannst«, sagte Diamond, der zu müde war, um sich über berufliche Abgrenzungen zu streiten. »Ist sie ertrunken?«
Merlin stieß Luft zwischen den zusammengepreßten Lippen hervor, als wollte er Zeit schinden. »Gute Frage.«
»Und?«
»Ich will es mal so ausdrücken. Die Leiche läßt ihrem Aussehen nach darauf schließen, daß sie längere Zeit im Wasser gelegen hat.«
»Komm schon, Jack«, drängte Diamond, »du mußt doch wissen, ob sie ertrunken ist. Sogar ich kenne die Anzeichen dafür. Schaum in Mund und Nase, Vergrößerung der Lunge, Schlamm und Schlick in den inneren Organen.«
»Danke«, sagte Merlin ironisch.
»Dann sag’s mir.«
»Kein Schaum, keine übermäßige Lungenaufblähung, kein Schlick. Reicht Ihnen das, Superintendent?« Diamond war es gewohnt, daß er die Fragen stellte, daher ignorierte er an ihn gerichtete meist. Er starrte vor sich hin und sagte nichts.
Jemand kam aus dem Autopsieraum, einen weißen Plastikbeutel in der Hand. Er grüßte, und Diamond erkannte in ihm einen der Männer von der Spurensicherung. Der Beutel, der jetzt zum kriminaltechnischen Labor in Chepstow gebracht wurde, hieß im Fachjargon »Kuttelsack«.
»In der forensischen Pathologie ist Tod durch Ertrinken eine der schwierigsten Diagnosen«, fuhr Merlin fort. »In diesem Fall wird sie durch die fortgeschrittene Verwesung noch mehr zum Glücksspiel. Ich kann Ertrinken nicht ausschließen, bloß weil keines der klassischen Merkmale vorliegt. Schaum und eine aufgeblähte Lunge und so weiter sind etwa dann feststellbar, wenn eine Leiche kurz nach dem Ertrinken aus dem Wasser gezogen wird. Vielleicht aber auch nicht. Und falls nicht, läßt sich Ertrinken trotzdem nicht ausschließen. Die Ertrunkenen, die ich in den letzten Jahren untersucht habe, wiesen in der Mehrzahl keines der sogenannten klassischen Anzeichen auf. Und nach einem längeren Aufenthalt im Wasser ...« Er zuckte die Achseln. »Enttäuscht?«
»Woran könnte sie denn sonst gestorben sein?«
»Kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich sagen. Man wird sie auf Drogen und Alkohol untersuchen.«
»Sonstige Anzeichen hast du nicht festgestellt?«
»Sonstige Anzeichen, wie du es ausdrückst, fehlen auffällig. Vielleicht kann Chepstow uns weiterhelfen. Der Fall ist auch für mich eine Herausforderung.« Merlin ging zwar nicht so weit, sich die Hände zu reiben, aber seine blauen Augen glänzten vor Vorfreude. »Ein echtes Rätsel. Vielleicht ist es hilfreicher, erst einmal festzuhalten, woran sie nicht gestorben ist. Mit Sicherheit wurde sie nicht erschossen, erstochen, zu Tode geprügelt oder erwürgt.«
»Und sie wurde auch nicht von einem Tiger zerfleischt. Komm schon, Jack, womit soll ich weitermachen?«
Merlin ging zu einem Schrank mit der Aufschrift »Gift«, schloß ihn auf und nahm eine Flasche Malt Whisky heraus. Er goß einen kräftigen Schuß in zwei Pappbecher und reichte einen dem Superintendent.
»Womit du weitermachen sollst? Du hast eine weiße Frau Anfang Dreißig, schulterlanges, natürliches rötlichbraunes Haar, einssiebzig groß und zirka fünfundfünfzig Kilo schwer, grüne Augen, durchstochene Ohren, ein besonders schönes Gebiß mit zwei teuren weißen Füllungen, lackierte Finger-und Zehennägel, eine Impfnarbe direkt unter dem Knie, keine Operationsnarben, Abdruck des Eherings auf dem entsprechenden Finger und, ja, sie war sexuell erfahren. Willst du dir keine Notizen machen? Schließlich ist das die Quintessenz von zwanzig Jahren Berufserfahrung mit der Gummischürze.«
»Also nicht schwanger?«
»Nein. Die Schwellung der Unterleibs war ausschließlich auf die Bildung von Fäulnisgasen zurückzuführen.«
»Hast du feststellen können, ob sie schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat?«
»Eher unwahrscheinlich, mehr kann ich nicht sagen.«
»Wie lange hat sie im See gelegen?«
»Was für Wetter hatten wir in der letzten Zeit? Ich war so beschäftigt, daß ich es gar nicht mitbekommen habe.«
»Die letzten vierzehn Tage ziemlich warm.«
»Dann mindestens eine Woche.« Merlin hob abwehrend die Hände. »Und jetzt frag bloß nicht, an welchem Tag sie gestorben ist.«
»Innerhalb der letzten zwei Wochen?«
»Wahrscheinlich. Ich nehme an, ihr seid die Vermißtenmeldungen durchgegangen?«
Diamond nickte. »Da paßt keine.«
Merlin strahlte. »So einfach hättest du es doch auch gar nicht haben wollen, stimmt’s? Jetzt wird sich eure Technologie bewähren müssen. Die vielen sündhaft teuren Computer, von denen ich ständig in der ›Police Review‹ lese.«
Diamond sah ihm die Stichelei nach. Schließlich wußte er, unter welchen Bedingungen Merlin und Kollegen manchmal arbeiten mußten: städtische Leichenhäuser mit mangelhaften Räumlichkeiten, schlechter Beleuchtung und Belüftung, veralteten sanitären Anlagen. Leichenschauhäuser würden bei der Verteilung öffentlicher Gelder nie ganz oben auf der Liste stehen. Diamond hätte zwar durchaus selbst einiges zum Thema Bezahlung und Arbeitsbedingungen bei der Polizei sagen können, aber nicht Jack Merlin gegenüber. Deshalb wiederholte er lediglich in verächtlichem Tonfall: »Computer?«
Merlin grinste. »Du weißt schon, was ich meine. Die Zentraldateien.«
»Zentraldateien, daß ich nicht lache. Gesunder Menschenverstand und Klinkenputzen. So kriegen wir Ergebnisse.«
»Den einen oder anderen Informanten nicht zu vergessen«, meinte Merlin und fügte rasch hinzu: »Also, was wirst du jetzt wegen der Frau unternehmen? Ein Phantombild rausgeben? Ein Foto wird nicht viel bringen, da sie kaum noch so aussieht wie zur Zeit, bevor sie im Wasser gelandet ist.«
»Wahrscheinlich. Aber zuerst warte ich ab, ob wir noch andere Beweismittel finden.«
»Als da wären?«
»Wir suchen natürlich nach ihrer Kleidung.«
»Am Fundort?«
Diamond schüttelte den Kopf. »In unserem Fall ist der Fundort unwichtig. Die Leiche ist dorthin getrieben worden. Nach dem, was du gesagt hast, nehme ich an, daß sie zuerst auf den Grund gesunken und später wieder aufgetaucht ist, wie immer, wenn sie nicht beschwert werden.«
»Korrekt.«
»Sie ist also wieder an die Oberfläche gekommen und dann mit der Brise über den See getrieben. Wir müssen das gesamte Ufer absuchen.«
»Wie viele Meilen sind das?«
»Zehn, um den Dreh.«
»Das heißt ja wohl, jede Menge gestrichener Urlaub.«
»Ist eine Sauarbeit. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Am See wird viel geangelt und gepicknickt. Ich werde einen Aufruf im Fernsehen und im Radio veröffentlichen. Wenn wir die Stelle finden, wo die Leiche ins Wasser geschafft wurde, haben wir schon mal einen Anfang.«
Merlin räusperte sich mißbilligend. »Da ziehst du aber ziemlich voreilige Schlüsse.«
»Wieso voreilig?« sagte Diamond mit funkelndem Blick. »Hör mal, was soll ich denn sonst für Schlüsse ziehen – daß die junge Frau ganz allein rausschwimmen wollte, zuerst ihren Ehering und sämtliche Klamotten abgelegt hat und dann ertrunken ist? Wer hier von einer natürlichen Todesursache ausgeht, muß schon verdammt naiv sein.« Er zerquetschte den Pappbecher in der Hand und warf ihn in einen Papierkorb.
4
Von Sonntagmorgen an arbeitete die Mordkommission von einer mobilen Einsatzzentrale aus: ein großer Wohnwagen, der auf der Wiese ganz in der Nähe von dem Schilfgras geparkt war, wo man die Leiche gefunden hatte. Jedesmal, wenn Peter Diamond mit schweren Schritten den Raum durchquerte, klang es so, als würden Bierfässer entladen. Das Geräusch war bis spät in den Abend hinein zu hören, während er die ersten entscheidenden Phasen der Ermittlung koordinierte. Fünf Telefone waren unablässig im Einsatz, und ein spezielles Team übertrug jede Nachricht und jede Information zuerst auf Laufzettel und dann auf Karteikarten. Das herkömmliche vierreihige drehbare Karteikartenregister für bis zu zwanzigtausend Karten stand ehrfurchtgebietend mitten im Raum. Diamond war ein Verfechter des Karteikartensystems, obwohl einige seiner jüngeren Mitarbeiter ständig irgendwas von der Überlegenheit der Computer vor sich hinmurmelten. Wenn der Fall nicht rasch geklärt werden konnte, würde er nicht darum herumkommen, die verhaßten Monitoren aufstellen zu lassen, und Gott helfe denen, die jammerten, wenn die Dinger abstürzten.
Die Suche nach der Kleidung der Toten konzentrierte sich zunächst auf die Uferabschnitte, die man bequem von den drei Straßen aus erreichen konnte, die rund um den See herumführten. Eine skurrile Sammlung von Fundstücken wurde zusammengetragen, stumme Zeugen der vielfältigen menschlichen Aktivitäten. Die einzelnen Kleidungsstücke wurden sorgfältig etikettiert, in Plastikbeuteln versiegelt, auf der Karte markiert und auf die Laufzettel geschrieben, ohne große Hoffnung, daß irgendeines davon mit dem Fall zu tun hatte.
Man ließ Taucher kommen, die den Bereich des Sees absuchen sollten, wo die Leiche angetrieben war. Es war nicht auszuschließen, daß die Kleidung oder andere Beweismittel dort versenkt worden waren. Das mußte gemacht werden, obwohl die meisten, auch Diamond, davon ausgingen, daß die Leiche von einer weiter entfernt liegenden Stelle, vielleicht sogar von der anderen Seeseite her, angetrieben worden war.
Gleichzeitig wurden die Bewohner der umliegenden Dörfer und der Häuser mit Blick auf den See befragt, ob sie im Monat zuvor irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit irgendwelche ungewöhnlichen Vorgänge am Ufer beobachtet hatten. Bald bestätigte eine Vielzahl von Aussagen das, was die Kommission bereits wußte, nämlich, daß der See gerade nach Sonnenuntergang ein beliebtes Ziel für Angler, Vogelkundler, Hundebesitzer und Liebespärchen war. Nichts, was auch nur im entferntesten darauf schließen ließ, daß eine nackte Leiche zum Wasser geschleppt oder getragen worden war.
Für Peter Diamond war diese Großaktion der notwendige, wenn auch unergiebige Auftakt zu dem, was in seinen Augen die wahre Arbeit eines Detectives ausmachte: das Feststellen und Vernehmen von Verdächtigen. Obwohl man sich alle Mühe gab, das Geschehene als »Vorfall« zu bezeichnen, handelte es sich doch um einen Mordfall. Dessen war er sich so sicher wie der Tatsache, daß ein Tag auf den nächsten folgte. Seit seiner Versetzung zur Mordkommission von Avon und Somerset vor drei Jahren hatte er fünf Ermittlungen geleitet, drei lokale, zwei landesweite, und mit einer Ausnahme hatten sie alle zur Verurteilung des Täters geführt. Bei dem noch offenen Fall war ein Antrag auf Auslieferung gestellt worden, über den noch nicht entschieden war. Es konnte sich wohl noch ein weiteres Jahr hinziehen. Eine beeindruckende Bilanz, die noch beeindruckender hätte sein können, wenn seine Arbeit in Avon nicht immer wieder durch den Wirbel um die Missendale-Affäre unterbrochen worden wäre.
Vier Jahre zuvor war ein junger Schwarzer namens Hedley Missendale für schuldig befunden worden, bei einem Überfall auf eine Bausparkasse im Londoner Stadtteil Hammersmith einen Menschen getötet zu haben. Ein Kunde, ein ehemaliger Hauptfeldwebel, war bei dem Versuch, den Räuber zu überwältigen, in den Kopf geschossen worden und noch am Tatort gestorben. Die Ermittlungen hatte Detective Superintendent Jacob Blaize von der F-Division geleitet. Diamond, damals noch Detective Chief Inspector, war Blaize’ rechte Hand gewesen. Man hatte den einschlägig vorbestraften Missendale schnell gefaßt, und er hatte während eines Verhörs durch Diamond ein Geständnis abgelegt. Doch über zwei Jahre später, nachdem Diamond bereits zum Superintendent bei der Polizei von Avon und Somerset befördert worden war, hatte ein anderer Mann nach einem religiösen Bekehrungserlebnis gestanden, das Verbrechen begangen zu haben, und die Tatwaffe vorgelegt. Ein neues Team von Beamten nahm die Ermittlungen wieder auf, und Ende 1987 wurde Missendale, nachdem er siebenundzwanzig Monate seiner lebenslangen Freiheitsstrafe abgesessen hatte, auf Empfehlung des Innenministeriums begnadigt.
Natürlich hatte die Presse vernichtende Attacken gegen die Polizei geritten. In den Sensationsblättern wurden Blaize und Diamond beschuldigt, einen unschuldigen schwarzen Jugendlichen zum Geständnis geprügelt zu haben. Eine interne Untersuchung war unausweichlich. Jacob Blaize, der dem Druck nicht gewachsen war, hatte die volle Verantwortung für alle Fehler übernommen und sich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen. Daraufhin stürzte sich die Presse auf Diamond. Man verlangte seinen Kopf auf einem Silbertablett, aber er konnte den bohrenden Fragen des Untersuchungsausschusses standhalten. Es war nicht ganz klar, inwieweit er mit seiner dezidierten Zurückweisung der Vorwürfe den Ausschuß überzeugt hatte. Manche behaupteten, daß er nichts zu befürchten habe, denn der Hauptvorwurf lautete, er hätte durch seine einschüchternde Art das falsche Geständnis provoziert, und bei der Anhörung hatte er seinen Standpunkt mit Vehemenz vertreten.
Acht Monate waren seit den Befragungen vergangen, und noch immer hatte der Ausschuß keinen Abschlußbericht vorgelegt. Währenddessen ließ Peter Diamond keinerlei Reue erkennen und war stets bereit, jedem, der so unklug war, ihn herauszufordern, die Korrektheit seines Verhaltens klarzumachen. Was aber niemand tat; die üble Nachrede fand nur in sicherer Entfernung statt. Und so konzentrierte er sich darauf zu beweisen, was für ein guter Detective er war, und das gelang ihm – zwischen seinen Auftritten in London – mit einigem Erfolg. Die Fälle, die er in Avon bearbeitet hatte, waren ohne den geringsten Vorwurf der Einschüchterung abgeschlossen worden.
Noch immer fiel es ihm schwer, sich an seinem neuen Arbeitsplatz einzugewöhnen. Die Kollegen von der Mordkommission akzeptierten ihn zwar beruflich, aber privat sah das anders aus. Er war als der großstadterfahrene Detective von Scotland Yard zu ihnen gekommen, und verständlicherweise hatte das bei den Detectives, die nur den Polizeidienst im West Country kannten, einiges Mißtrauen ausgelöst. Zudem war zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt die Missendale-Geschichte bekanntgeworden.
Trotz aller Widrigkeiten mußte die Arbeit irgendwie weitergehen. Er hatte gelernt, mit Streß zu leben. Bei jeder Mordkommission lagen die Nerven des leitenden Beamten während der ersten Stunden eines neuen Falles blank. Wie bei einem Stellungskrieg, wenn nichts geschah. Der ganze teure Polizeiapparat wurde aufgeboten, mit Beamten, die dringend für andere Aufgaben benötigt wurden. Wie lange konnte man den Einsatz so vieler Kräfte rechtfertigen, wenn nichts dabei herauskam? Natürlich wurden die Kripoleute als die vom Glück Begünstigten betrachtet, die sich im Gegensatz zu den Uniformierten besonderer Arbeitsbedingungen erfreuten, die flexible Dienstzeiten hatten, mobiler waren und nur mit dem Finger zu schnippen brauchten, um Verstärkung anzufordern, wenn jemand vermißt oder eine Leiche gefunden wurde. Ein gewisser Neid war da nur allzu verständlich. Er gehörte zum System und existierte auf allen Ebenen. Vielleicht war er in den höheren Chargen subtiler. Aber es gab ihn. Und man fand sich damit ab.
Diamond hatte gelernt, jeden Gegner so abzuwehren, als spielte er noch immer Rugby. Er war zu einem Mann geworden, der kaum aufzuhalten war, ein stämmiger, schroffer Typ, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hielt. Computertechnologie war ›Spielerei‹, die er als Hilfsmittel für die echte Detective-Arbeit nur widerwillig akzeptierte. Einige karrierebewußte Leute in seiner Umgebung hielten es für ein Wunder oder eine Laune des Schicksals, daß es ein derart undiplomatischer Mann, über dem noch dazu das Damoklesschwert der Missendale-Untersuchung schwebte, bis zum Superintendent gebracht hatte. Sie übersahen dabei, daß seine Unverblümtheit unter so vielen Intriganten ein kostbares Gut darstellte.
Es war noch nicht vorhersehbar, ob er in Avon und Somerset jemals anerkannt werden würde; dazu war es noch zu früh. Seine Kritiker behaupteten, er hätte seine bisherigen Erfolge nur mit Hilfe bezahlter Informanten erzielt. Sie konnten ihm keinen Strick daraus drehen, daß er mit Spitzeln arbeitete, aber sie warteten hämisch darauf, ihn bei einer Ermittlung zu erleben, bei der er ohne bezahlte Hilfe auskommen mußte.
Vielleicht war die Leiche aus dem Chew Valley Lake ja die ersehnte Gelegenheit.
Der Sonntag verlief enttäuschend. Es wurde nichts Wichtiges gefunden. Am Montag wurde Diamond vom BBC-Fernsehen und dem Lokalsender HTV West für die regionalen Nachrichtensendungen, die gleich nach den Sechs-Uhr-Nachrichten kamen, interviewt. Das Phantombild der Toten wurde gezeigt, gefolgt von Diamond, wie er am See stehend um sachdienliche Hinweise zu ihrer Identifizierung bat. Er forderte jeden auf, sich zu melden, der in den letzten drei Wochen etwas Ungewöhnliches bemerkt hatte. Wie er anschließend der Fernseh-Crew gegenüber bemerkte, war das förmlich eine Aufforderung an alle Voyeure im Tal, sich den Beschlag vom Fernglas zu wischen und alle Welt an ihren Vergnügungen teilhaben zu lassen, aber er mußte zugeben, daß es die Mühe wert war. Ein dreißig Sekunden langer Fernsehspot brachte mehr Hinweise ein, als hundert Polizisten in einer Woche zusammengetragen hätten.
Spät am selben Abend, während die Anrufe ausgewertet wurden, rief er Jack Merlin an und erkundigte sich nach den Ergebnissen der Labortests. »Was genau hast du denn erwartet?« fragte der Pathologe in dem freundlichen, aber aufreizenden Tonfall, der sich anhörte, als gehöre er zu einer anderen, intelligenteren Lebensform.
»Vorläufig würde mir die Todesursache reichen.«
»Das, so fürchte ich, wird eine offene Frage bleiben, bis alle Ergebnisse vorliegen, und selbst dann ...«
»Jack, willst du mir etwa erzählen, daß diese verdammten Tests noch immer nicht abgeschlossen sind? Die Autopsie war gestern morgen, vor sechsunddreißig Stunden.«
Zur Strafe für diesen gereizten Ausbruch mußte Diamond sich einen Vortrag über den erforderlichen Zeitrahmen einer histologischen Gewebeuntersuchung anhören, die mindestens eine Woche brauchte, sowie über den Druck, unter dem das forensische Zentrallabor arbeitete. »Derzeit haben die so viel zu tun, daß es unter Umständen noch Wochen dauern kann, bis sie ein Ergebnis vorlegen.«
»Wochen? Hast du denen gesagt, daß die Todesursache ungeklärt ist? Begreifen die denn nicht, wie dringend es ist?« Diamond hatte einen Bleistift aufgehoben und zwischen die Zähne geklemmt. Er biß ins Holz. »Du willst also noch immer nicht bestätigen, daß sie ertrunken ist?«
»Ich kann nur sagen, daß die Todesursache nicht eindeutig ist.« Merlin zog sich hinter die Formulierung zurück, die er bei seinen Zeugenaussagen vor Gericht verwendete.
»Jack, alter Freund«, flötete Diamond. »Mit mir kannst du doch inoffiziell reden. Würdest du mir vielleicht mit einer ungefähren Schätzung des Todestages weiterhelfen?«
»Tut mir leid.«
»Na prima!« Der Bleistift zerbrach in zwei Hälften.
Es trat ein langes Schweigen ein. Dann: »Ich tue mein Bestes unter den gegebenen Umständen, Superintendent. Ich lasse mich nicht überrollen. Du mußt nun mal Rücksicht darauf nehmen, daß wir total unterbesetzt sind.«
»Jack, verschone mich bitte mit der Mitleidstour, ja? Ruf mich einfach an, sobald du was rausgefunden hast.«
»Das war stets meine Absicht.«
Diamond ließ den Hörer fallen, so daß er unterhalb der Arbeitsplatte baumelte. Der Telefonist hob ihn anstandslos auf und sammelte die Überreste des Bleistifts ein. Diamond stapfte quer durch den Raum, um festzustellen, welche Ergebnisse sein Fernsehaufruf bislang gezeitigt hatte, und stieß dabei das Karteikartenregister aus der Halterung.
John Wigfull, sein Stellvertreter, faßte zusammen: »Wir haben sieben Anrufer, die fest davon überzeugt sind, daß es sich bei dem Opfer um Candice Milner handelt.«
Nach einer Bedenkpause, ob die Sache überhaupt einer Erklärung bedurfte, sagte Wigfull: »›The Milners‹ – das ist eine Fernsehserie der BBC. Candice ist schon vor mindestens zwei Jahren aus der Story rausgeschrieben worden.«
»Herr, schenke mir Geduld! Sonst noch was?«
»Zwei sitzengelassene Ehemänner haben angerufen. Im einen Fall hat die Frau eine Nachricht hinterlassen, daß sie eine Woche verreisen wollte, um mal auszuspannen. Der Mann wohnt in Chilcompton. Und das ist sechs Monate her.«
»Sechs Monate. Die müßte längst vermißt gemeldet sein.«
»Ist sie auch. Das Foto ist nicht sehr ähnlich. Wir haben es weitergeleitet.«
»Ich werd’s mir auch mal ansehen. Schicken Sie morgen jemanden zu dem Ehemann. Sonst noch was?«
»Das hier ist ein bißchen vielversprechender. Ein Farmer namens Troop aus Chewton Mendip hatte vor drei Wochen Streit mit seiner Frau, und sie hat sich von dem LKW-Fahrer, der die Milchkannen abholt, mitnehmen lassen. Seitdem hat der Gatte sie nicht mehr gesehen.«
»Hat er es nicht gemeldet?«
»Er wollte ihr Zeit lassen, wieder zur Vernunft zu kommen. Ist wohl nicht das erste Mal, daß sie so abgehauen ist.«
»Und er meint, daß das Bild seiner Frau ähnlich sieht?«
»Er nicht, Sir. Seine Schwägerin denkt das. Sie hat uns auch angerufen.«
Diamonds Augen weiteten sich ein wenig. »Irgendwas in den Akten? Beschwerden wegen Gewalttätigkeit?«
Wigfull nickte. »Eine. Am 27. Dezember 1988 hat Troop seine Frau anscheinend mit Fußtritten aus dem Haus befördert und sie nicht wieder reingelassen. Die Schwester hat das gemeldet. Ein Constable von Bath wurde rausgeschickt und hat die Blutergüsse gesehen. Aber die Frau wollte ihn nicht anzeigen. Sie hat gesagt, es sei schließlich Weihnachten.«
»Und den Menschen ein Wohlgefallen.« Diamond holte tief und mißbilligend Luft und atmete dann langsam wieder aus. »Was will man machen? John, wir beide kümmern uns am besten selbst um die Sache. Chewton Mendip ist kaum mehr als fünf Meilen vom See entfernt. Morgen vormittag unterhalte ich mich mit der Schwägerin – finden Sie den Namen des edlen Ritters von der traurigen Milchkanne raus.«
Wigfull grinste anerkennend. Jedes Anzeichen guter Laune seitens des Superintendent mußte bestärkt werden. Sie waren nicht gerade Busenfreunde. Wigfull war unter ungünstigsten Umständen zu Diamonds Assistent ernannt worden, genau zu dem Zeitpunkt, als der Missendale-Skandal erste Schlagzeilen machte. In den wenigen Monaten zuvor hatte Diamond ein beeindruckendes Debüt bei der Polizei von Avon und Somerset gegeben und zwei Morde aufgeklärt. Sein Assistent war ein Inspector namens Bill Murray gewesen, mit dem er sich gut verstand. Doch nur wenige Stunden nachdem Diamonds Beteiligung am Missendale-Fall bekannt geworden war, hatte man Murray nach Taunton versetzt, wo gerade ein Posten frei geworden war. Statt seiner kam John Wigfull von der Kripo-Verwaltung. Ob zu Recht oder Unrecht, Diamond war der festen Überzeugung, daß Wigfull ein Spitzel war, der der obersten Polizeibehörde jede Übertretung sogleich melden sollte. Anders als Bill Murray hielt Wigfull sich stets streng an die Vorschriften. Er hatte sich nach Kräften bemüht, sich bei seinen Kollegen lieb Kind zu machen. Bei seinem Vorgesetzten war ihm das bislang noch nicht gelungen.
»Sonst noch was?« fragte Diamond.
»Einige Anrufer, die was gesehen haben.«
»Und was, wenn ich fragen darf?«
»Überwiegend Horizontalgymnastik.«
»Keine Meldungen von Gewalttätigkeiten?«
»Bis jetzt noch nichts.«
»Nicht sonderlich viel, was? Möglicherweise muß ich Ende der Woche wieder in den Zeugenstand. Mal sehen, ob wir in Chewton Mendip irgendwas rausfinden. Wohnt da auch die Schwester?«
Es handelte sich um Mrs. Muriel Pietri. Ihr Mann Joe besaß eine Autowerkstatt an der A39, wo ein Schild versprach: »Preiswerte und zuverlässige Reparaturarbeiten. Wir bringen Sie wieder in Fahrt!« Die Polizei kam häufig vorbei, wenn sie Fälle von Fahrerflucht untersuchte. Diamond selbst fuhr früh am nächsten Morgen dorthin. Das Gespräch hätte auch von einem rangniedrigeren Beamten geführt werden können, aber die Aussicht auf ein Frage-und-Antwort-Spiel war sehr viel verlockender als wieder ein Morgen im Wohnwagen.
Der unangenehm süßliche Dunst von Lackfarbe hing in der Luft, als Diamond seinen massigen Körper ungeschickt zwischen beschädigten Fahrzeugen hindurchschob und dabei seinen grauen Anzug mit Rost beschmierte. Er hatte einen Sergeant dabei, der die Aussage zu Protokoll nehmen sollte.
Mrs. Pietri stand in der offenen Tür und trug ein geblümtes Kleid, das sie vermutlich nur anzog, wenn sie Besuch erwartete. Sie hatte sich für den besonderen Anlaß zurechtgemacht – nach allen Regeln der Kunst: Make-up, Lippenstift, Wimperntusche und irgendein billiges Parfüm, im Vergleich mit dem die Lackfarbe einen angenehmen Duft verbreitete. Sie war schlank, dunkelhaarig, sprach langsam und war zutiefst erschüttert von der Ungeheuerlichkeit dessen, was ihrer Meinung nach geschehen war. »Diesmal befürchte ich wirklich das Schlimmste«, sagte sie in ihrem breiten Somerset-Akzent, während sie die beiden Polizisten in ihr penibel aufgeräumtes Wohnzimmer führte. »Was Carl gemacht hat, ist eine richtige Schande. Der hat meine Schwester schlimm verdroschen. Schrecklich. Ich kann Ihnen Fotos zeigen, die mein Mann das letzte Mal gemacht hat, als die arme Elly zu uns gekommen ist. Grün und blau, sag’ ich Ihnen. Ich hoffe bloß, daß Sie mit dem Scheißkerl das gleiche machen, wenn Sie zu ihm fahren. Der hat’s echt nicht besser verdient, kein Stück. Setzen Sie sich doch.«
»Sie haben das Phantombild der tot aufgefundenen Frau gesehen?« fragte Diamond.
»Gestern abend in den Nachrichten. Das war Elly, da können Sie Gift drauf nehmen.«
»Sergeant Boon hat eine Kopie von dem Bild. Sehen Sie es sich bitte in Ruhe an. Und bedenken Sie, daß es sich lediglich um eine Zeichnung handelt.«
Sie reichte es fast sofort wieder zurück. »Ich schwöre, das ist Elly.«
»Was für eine Haarfarbe hat Ihre Schwester, Mrs. Pietri?«
»Rot – ein tolles Feuerrot. Das war das Schönste an ihr, und außerdem war es Natur. Andere Frauen geben ein halbes Vermögen beim Friseur aus, um so eine Farbe zu kriegen, und dann ist es nicht halb so schön, wie es das von Elly war.«
Die Vergangenheitsform untermauerte ihre Überzeugung, daß es sich bei der Toten um ihre Schwester handelte. Diamond machte jedoch deutlich, daß die Sache für ihn alles andere als klar war. »Feuerrot, sagen Sie. Heißt das knallrot?«
»Ich hab doch gesagt, daß es Natur war, oder? Kein Mensch hat knallrotes Haar, außer Punks und Popstars.«
»Ich muß es aber genau wissen.«
Sie deutete auf ein Zierkästchen aus Rosenholz, das auf dem Sideboard stand. »Ungefähr die Farbe.«
»Und die Augen – welche Farbe haben die?«
»Manche haben gesagt, sie seien haselnußfarben. Mir sind sie immer grün vorgekommen.«
»Wie groß ist sie?«
»So wie ich – einssiebzig.«
»Alter?«
»Momentchen – Elly ist zwei Jahre nach mir geboren. Dann muß sie vierunddreißig gewesen sein.«
»Sie sagten, daß Ihr Mann Fotos von ihr gemacht hat.«
»Nicht von ihrem Gesicht, guter Mann. Ihre Beine von hinten, wo sie Striemen hatte. Falls sie Beweise gebraucht hätte für die Scheidung. Ich glaube nicht, daß ich ein Bild von ihrem Gesicht habe, jedenfalls nicht seit der Schulzeit. Bei uns in der Familie haben wir nie viel Fotos gemacht.«
»Aber Sie sagten, daß Ihr Mann eine Kamera besitzt.«
»Fürs Geschäft. Er macht Schadensaufnahmen, falls die Versicherungsfritzen Ärger machen.«
»Ich verstehe.«
»Die Fotos von Ellys Beinen waren seine Idee.«
»Schadensaufnahmen.«
»Wenn Sie wollen, such’ ich sie.«
»Jetzt nicht. Erzählen Sie mir, wie Sie erfahren haben, daß Ihre Schwester vermißt wird.«
»Tja, wo wir doch so nah beieinander wohnen, ist sie jeden Dienstagmorgen auf ein Schwätzchen hier gewesen. Letzten Dienstag ist sie nicht gekommen, und den Dienstag davor auch nicht, also hab ich angerufen und den Dreckskerl von Schwager gefragt, was mit meiner Schwester ist.«
»Und?«
»Der Mistkerl hat mir doch allen Ernstes erzählt, daß Elly mit Mr. Middleton, der immer die Milch abholt, abgehauen ist. Deine Schwester ist eine schamlose Person, hat er zu mir gesagt, schlimmer als die Huren von Babylon. Er hat sich auch noch andere Bezeichnungen für sie einfallen lassen, die nicht in der Bibel stehen. Ich kann Ihnen sagen, der hat von mir was zu hören gekriegt.«
»Wann soll das passiert sein?«
»Montag vor zwei Wochen, hat er gesagt. Ich habe ihm kein Wort geglaubt, und ich hatte recht. Da muß sie schon tot gewesen sein, schwamm schon nackt im Chew Valley See, die Arme. Soll ich mitkommen, um sie zu identifizieren?«
»Das wird vielleicht nicht nötig sein.«
»Fahren Sie jetzt rüber und verhaften den Scheißkerl?«
»Ich möchte, daß Sie Ihre Aussage unterschreiben, Mrs. Pietri. Der Sergeant wird Ihnen zeigen, wo.« Diamond stand auf und ging nach draußen.
Über Funk erreichte er Inspector Wigfull. »Was Neues?«
»Ja«, antwortete Wigfull. »Ich war gerade bei dem Milchmann zu Hause.«
»Middleton?«
»Ja.«
»Und?«
»Elly Troop hat mir die Tür aufgemacht.«
5
Jeder Detective wird bestätigen können, daß ein Mordfall in der modernen Polizeiarbeit so gut wie nie durch messerscharfe Schlußfolgerungen gelöst wird, die weniger geniale Menschen in bewunderndes Staunen versetzen. Ist die Identität des Täters nicht so offensichtlich, daß der Fall innerhalb weniger Stunden geklärt wird, ist fast jede Ermittlung mühsam und erfordert Hunderte von Arbeitsstunden von Polizeibeamten, Labortechnikern und Verwaltungsleuten. Falls die Überführung eines Täters überhaupt als Verdienst bezeichnet werden kann, so muß es einer Vielzahl von Einzelpersonen zugesprochen und zugleich aufgrund von verwaltungstechnischen Verzögerungen, falschen Annahmen und mitunter verhängnisvollen Irrtümern eingeschränkt werden. Heutzutage ist die Arbeit bei der Kriminalpolizei kein Sport für Ruhmsüchtige.
Nach dem unergiebigen Gespräch mit Mrs. Pietri kehrte Diamond in die mobile Einsatzzentrale zurück und tigerte ruhelos auf und ab. Er sah sich erneut die Vermißtenliste von Avon und Somerset und den angrenzenden Counties an und ließ seinen Ärger an einer Sekretärin aus, als er feststellte, daß die Liste seit dem letzten Mal nicht auf den neuesten Stand gebracht worden war. Es herrschte dicke Luft im Wohnwagen, während die junge Frau in Tränen ausbrach, als er ihr auch noch weitere Mängel an der Liste zum Vorwurf machte, für die sie absolut nicht verantwortlich war.
Die Rückkehr von Inspector Wigfull hätte die angespannte Atmosphäre eigentlich auflockern müssen. Wigfull, Sonnenschein der Mordkommission, wie er von Diamond abschätzig genannt wurde, hatte stets für jeden ein aufmunterndes Wort parat, auch für die Verwaltungskräfte, die er allesamt mit Vornamen ansprach. Er war sozusagen die Briefkastentante, bei der man sich ausweinen konnte. Er lächelte viel, und selbst wenn er nicht lächelte, sah er immer noch so aus, als würde er es tun, weil die Spitzen seines prächtigen Schnurrbartes sich keck nach oben bogen. Diesmal jedoch bekam Diamond schon beim ersten Anblick von Wigfull, der die Stufen hochkam und dabei mit seinen Wagenschlüsseln Fangen spielte, einen weiteren Wutanfall.
»Das hat aber gedauert.«
»Tut mir leid, Sir. Mrs. Troop war ziemlich fertig mit den Nerven. Sie hat Rat gebraucht.«
»John, wenn Sie in die Partnerschaftsberatung gehen und weinenden Ehefrauen das Händchen halten wollen, dann tun Sie’s doch, zum Donnerwetter. Es mag Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, aber ich ermittle gerade in einem Mordfall, und falls Ihnen das nicht recht ist, sollten Sie es mir lieber gleich sagen. Dann fordere ich nämlich jemanden an, auf den ich mich verlassen kann.«
»Sie ist von ihrem Mann geschlagen worden, Sir. Ich habe ihr gesagt, daß sie diesmal Anzeige erstatten soll.«
»Sozialarbeit«, sagte Diamond in einem Tonfall, als ob es sich um eine Krankheit handelte, die durch schlechte hygienische Verhältnisse hervorgerufen wird. »Sie sind Detective. Und ich sitze hier die ganze Zeit auf dem trockenen.«
»Hat es irgendwelche neuen Entwicklungen gegeben?«
Diamond winkte mit einer Hand ab und stieß dabei eine Schachtel Büroklammern um. »Natürlich hat es, verdammt noch mal, keine gegeben. Wie denn auch, wenn Sie sich bei einer Tasse Kaffee in Chewton Mendip die Ohren vollweinen lassen? Drei Tage, und ich habe mir bisher nichts als einen Sonnenbrand auf der Glatze geholt. Die Karre sitzt ziemlich im Dreck, solange wir nicht wissen, wer die Leiche ist.«
»Vielleicht sollten wir noch mal die Vermißtenliste durchgehen?« schlug der glücklose Inspector vor.
Der ganze Raum schien den Atem anzuhalten, was sich jedoch als überflüssig erwies. Diamond befand, daß er seinen Blutdruck in gefährliche Höhen getrieben hatte, und sagte in dem milden Tonfall, der, wie er wußte, effektiver war als wildes Gebrüll: »Das versuche ich ja gerade.«
»Aber nur für dieses Gebiet?«
»Und für Wiltshire.« Er grabschte einen Packen dünner Blätter und wedelte damit herum. »Eine verflucht lange Liste, und jede Woche kommen über siebzig dazu.«
Wigfull räusperte sich und sagte: »Der ZPC kann uns bestimmt helfen.«
Diamond mußte einen Augenblick überlegen. Sein Verstand war nicht auf Abkürzungen getrimmt, und alle, die ihn besser kannten, hätten es vermieden, ihn in dieser Situation auch noch auf den zentralen Polizeicomputer anzusprechen. »Ja«, sagte er verächtlich, »indem er uns zwanzigtausend Namen liefert.«
»Die Zahl läßt sich begrenzen, wenn man sämtliche zur Verfügung stehenden Daten eingibt«, erklärte Wigfull. »In diesem Fall: rothaarige Frauen unter Dreißig.«
Tatsächlich wußte Diamond in etwa, wie der ZPC funktionierte; ansonsten hätte er bei der Kripo gar nicht überleben können. Er ärgerte sich bloß über den allgemein verbreiteten Glauben, das Ding sei ein Allheilmittel. »Vorläufig arbeiten wir mit unseren Listen«, entgegnete er. »Ich will die neuesten Informationen zu jedem Namen, den ich markiert habe, und keine dämlichen Daten, wie Sie es nennen. Ich will wissen, was für Menschen das sind. Und zwar bis halb vier heute nachmittag. Dann halte ich eine Konferenz ab.«
»In Ordnung, Mr. Diamond.«
»Das wird sich noch rausstellen. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, daß ich nervlich ein wenig angespannt bin, Mr. Wigfull. Irgendwo da draußen läuft ein Mörder herum. Und wir machen herzlich wenig Fortschritte bei dem Versuch, ihn zu schnappen. Himmel, wir wissen ja noch nicht mal, wie er’s gemacht hat.«
»Sieht ganz so aus, als würden wir den ZPC brauchen«, sagte Wigfull.
Diamond wandte sich leise schimpfend ab, um weitere Meldungen zu überprüfen, die seit seinem Aufruf an die Bevölkerung eingegangen waren. Das Phantombild war in der Montagsausgabe des »Bath Evening Chronicle« und der »Bristol Evening Post« erschienen. »Noch zwei weitere zu Candice Milner«, rief er kurz darauf Wigfull zu. »Das sagt einiges über die Werte unserer Gesellschaft aus, wenn die Leute nicht mehr in der Lage sind, zwischen dem wirklichen Leben und einer bescheuerten Fernsehserie zu unterscheiden.« Damit er aus dieser verbitterten Stimmung herauskam, würde ein Durchbruch von kosmischen Ausmaßen erforderlich sein.
Um von dem ständigen Piepen der Telefone wegzukommen, beschloß er, die Konferenz in dem Minibus abzuhalten, der neben der Einsatzzentrale geparkt war. Und so saßen um drei Uhr dreißig vier leitende Beamte der Mordkommission unbequem zusammengedrängt mit ihm im hinteren Teil des Fahrzeugs und trugen ihre Ergebnisse vor.
Wigfull hatte am Telefon einiges erreicht: Er konnte Genaueres über drei vermißte Frauen berichten, deren Beschreibungen vage mit der Toten aus dem See übereinstimmten. »Janet Hepple ist geschieden, dreiunddreißig, arbeitet gelegentlich als Künstlermodell in Coventry. Rotes Haar, einssiebzig. Vor sieben Wochen hat sie ihre Wohnung verlassen, die Miete war unbezahlt, und seitdem ist sie nicht mehr gesehen worden. Anscheinend paßt das nicht zu ihr. Alle haben sie als ehrlich und verläßlich beschrieben.«
Diamond zeigte sich unbeeindruckt: »Und die zweite?«
»Sally Shepton-Howe aus Manchester, seit dem 21. Mai vermißt. An dem Tag hatte sie Streit mit ihrem Mann und ist weggelaufen. Sie verkauft Kosmetika in einem Kaufhaus in der Stadt. Haarfarbe wurde als kastanienbraun beschrieben, grüne Augen, zweiunddreißig, attraktiv. Eine Frau, auf die ihre Beschreibung paßt, wurde am Abend desselben Tages gesehen, wie sie an einer Ratstätte an der M6 Richtung Süden trampte.«
»Das nenn’ ich das Schicksal herausfordern. Wer noch?«
»Die hier ist was Besonderes. Schriftstellerin aus West-London, Hounslow. Schreibt Liebesromane. Wie heißen noch mal die Bücher, die Frauen überall kaufen?«
»Herz-und-Schmerz-Romane?«
»Nein, ich meine den Verlag.«
»Keine Ahnung. Ich lese nur Science-fiction.«
»Egal, sie schreibt sie jedenfalls. Heißt Meg Zoomer.«
»Zoomer. Ist das ein Pseudonym?«
»Nein, echt, offenbar der Name ihres dritten Mannes.«
»Der dritte?« fragte Diamond. »Wie alt ist die Frau?«
»Vierunddreißig. Anscheinend lebt sie wie eine Figur aus ihren Büchern. Hungrig nach Liebe. Sie trägt einen dunkelgrünen Umhang und läßt sich das Haar lang wachsen. Es ist kastanienrot. Jedenfalls fährt sie in ihrem MG-Sportwagen durch die Gegend und sucht nach Eindrücken, die sie in ihren Büchern verwerten kann.«
»Da nimmt dich jemand auf die Schippe, John«, sagte Keith Halliwell, der Inspector, der die Befragung der Anwohner geleitet hatte.
»Das will ich niemandem geraten haben«, sagte Diamond ernst. »Wir sind hier auf Mörderjagd, nicht auf Zechtour. Also weiter. Wann wurde Mrs. Zoomer zuletzt gesehen?«
»Am 19. Mai, auf einer Party in Richmond. Sie ist kurz nach Mitternacht gegangen, und zwar mit einem Mann, der offenbar gar nicht eingeladen war. Alle sind davon ausgegangen, daß er in Begleitung eines geladenen Gastes gekommen war. Groß, dunkelhaarig, ungefähr dreißig, kräftig gebaut, leichter französischer Akzent.«
»Wie einem ihrer Bücher entsprungen«, meinte Halliwell. »Wie ist er denn gekommen – Porsche oder Vierspänner?«
»Schluß jetzt, verstanden?« fauchte Diamond. Für ihn war Halliwell eine Nervensäge, weshalb er ihn zur Befragung der Anwohner verdonnert hatte. »Wer hat die Sache gemeldet?«
»Die Nachbarin, Sir. Sie hat jeden Morgen die Milch reingeholt, bis sie keinen Platz mehr im Kühlschrank hatte.«
»Hat ihr schon jemand das Phantombild gezeigt?«
»Geschieht gerade. Und Scotland Yard versucht, Mrs. Zoomers Zahnarzt ausfindig zu machen, um die Unterlagen einzusehen.«
»Ein Künstlermodell, eine Verkäuferin und eine Schriftstellerin«, faßte Diamond zusammen und rümpfte die Nase. »Ist das alles?«
»Das sind die als vermißt gemeldeten rothaarigen Frauen, auf die unsere Beschreibung mehr oder weniger zutrifft, Sir.«
»Ich hätte mehr von Ihnen erwartet.«
Wigfull konterte mit der Bemerkung: »Bei allem Respekt, Sir, der ZPC hätte uns mehr liefern können.«
Nach kurzem beklommenem Schweigen sagte Diamond friedlich: »Na schön. Kümmern Sie sich drum.«
Wigfull zog vielsagend eine Augenbraue hoch und sah zu Halliwell hinüber. Das hätte er nicht tun sollen.
»Da wir unser Netz nun weiter auswerfen«, fuhr Diamond sachlich fort, »sollten wir vielleicht auch unsere Datenbank erweitern.«
Dieser Terminus aus dem Munde des »letzten Detectives« verschreckte sie alle. »Was genau meinen Sie damit, Mr. Diamond?« fragte Wigfull arglos.
»Brünette. Viele Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen von rotem Haar. Unsere Frau ist eigentlich nicht fuchsrot, sondern eher rötlich-braun.«
»Eher rot als braun, Sir.«
»Manche würden es vielleicht braun nennen. Lassen Sie auch die Brünetten vom ZPC überprüfen.«
Wigfull verstummte, was sehr angenehm war. Die Konferenz dauerte noch zwanzig Minuten, in denen die entmutigenden Ergebnisse der Haus-zu-Haus-Befragungen, der Suchaktionen und der Medienappelle vorgetragen wurden. Als sie schließlich alle aus dem Minibus geklettert waren und ihre Glieder reckten, trat der stille, ehrgeizige Inspector Croxley – er hielt sich selbst für den aufsteigenden Stern am Himmel – an Diamond heran und sagte: »Ich wollte das drinnen nicht sagen, Sir, aber mir ist da was eingefallen. Wir gehen alle von einem Mord aus, weil sie nackt aufgefunden wurde, aber es gibt nicht den geringsten Hinweis auf Gewalteinwirkung.«
»Bis jetzt. Der Laborbericht liegt noch nicht vor.«
»Falls sich herausstellt, daß es die Schriftstellerin ist, würden Sie dann nicht vielleicht doch Selbstmord als Möglichkeit in Erwägung ziehen, Sir?«
»Was?«