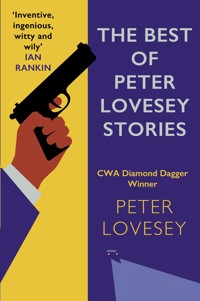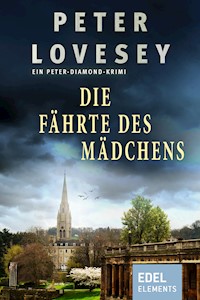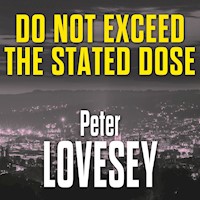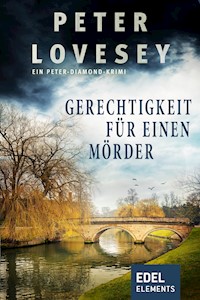
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter-Diamond-Krimi
- Sprache: Deutsch
Peter Diamond, Detektiv und Ex-Polizist, erhält – sehr zu seiner Genugtuung – einen Hilferuf seiner ehemaligen Vorgesetzten: Aus dem Gefängnis von Albany ist Mountjoy, ein von Diamond ehemals überführter Frauenmörder, ausgebrochen. Mountjoy hat die Tochter eines hohen Polizeibeamten entführt und fordert, dass Diamond seinen Fall erneut aufnehmen soll. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt... Dritter Band der Peter-Diamond-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Peter Lovesey
Gerechtigkeit für einen Mörder
Ein Peter-Diamond-Krimi
Ins Deutsche übertragen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Copyright der Originalausgabe © 1995 by Peter Lovesey
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THE SUMMONS.
Ins Deutsche übertragen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Copyright der deutschen Übersetzung © Piper Verlag GmbH, München 1998
First published in Germany under the title GERECHTIGKEIT FÜR EINEN MÖRDER by Piper Verlag (1999)
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
1
Es heißt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Wenn sich im Gefängnis Albany eine Tür öffnet, schließt sich eine andere.
Wirklich entmutigend.
Wenn ein Verurteilter von einem Richter gesagt bekommt, daß lebenslänglich in seinem Fall wahrhaftig bis ans Ende seines Lebens bedeuten soll, und wenn er von jeder Berufungsinstanz abgeschmettert wird, dann wird sich dieser Mann vielleicht andere Möglichkeiten überlegen, um seine Strafe zu verkürzen. John Mountjoy wurde in die Kategorie A eingestuft: große Gefahr für die Öffentlichkeit, die Polizei und die Staatssicherheit. Und er dachte daran, seinen Wohnsitz zu wechseln.
Diese Türen. Sie funktionieren nach einem uralten Prinzip. Man geht durch eine hindurch und steht gleich darauf vor einer anderen, die einem den Weg versperrt. Bevor sich die zweite öffnen kann, muß sich die erste hinter einem schließen. So wurden vor tausend Jahren Burgtore gebaut. Aber im Zeitalter der Elektronik funktioniert der Mechanismus automatisch.
Den Neuankömmlingen in Albany wird mitgeteilt, daß sie nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis sind, sondern in einem Ultrasicherheitsgefängnis. Sämtliche Tore und Türen sind mit einem Computer in einem Kontrollraum voller Monitore verbunden. Wenn sich jemand irgendwo in Albany einer Tür nähert, ist er auf dem Bildschirm zu sehen. Der Kontrollraum ist das Herz der Anstalt. Abgesehen von den Monitoren befinden sich dort die Übersichtstafel, ein Funkverbindungssystem, der Generator und natürlich das Team der diensthabenden Aufsichtsbeamten. Das Paradoxe daran ist, daß diese Wärter sicherer eingesperrt sein müssen als irgend jemand sonst im Gefängnis, ein Umstand, der unter den Insassen immer wieder für Belustigung sorgt. Stahltüren, Hunde, Flutlicht und ein Sicherheitsdrahtzaun rundherum. Bräche jemand in den Kontrollraum ein, würden sich Szenen abspielen wie beim Showdown in einem James-Bond-Film.
Mountjoy saß im D-Trakt, wo die meisten Lebenslänglichen untergebracht waren. Wenn sie vom D-Trakt zu den Werkstätten gingen, wurden sie durch die computergesteuerten Doppeltüren in den Hauptkorridor geschleust, wo sie stets von einer ganzen Reihe von Wärtern beobachtet wurden.
Der D-Trakt hat Glastüren. Lächeln Sie ruhig, aber die Insassen finden es nicht lustig. Das Glas ist bruchsicher und mit Stahlmaschendraht verstärkt. Diese Türen bewegen sich keinen Millimeter, wenn nicht der entsprechende Schalter im Kontrollraum betätigt wird. Zwischen dem Schließen der einen und dem Öffnen der anderen Tür vergehen sieben Sekunden. Wer den D-Trakt betreten oder – was wahrscheinlicher ist – ihn verlassen möchte, steht eingepfercht in dem hermetisch verriegelten Zwischenraum und wird genauestens inspiziert. Wenn das Überwachungsteam auch nur den geringsten Zweifel hat, läßt sich das zeitliche Intervall beliebig verlängern.
Nachdem John Mountjoy diese Prozedur eine Woche lang beobachtet hatte, kam er zu dem Schluß, daß die Elektronik unmöglich auszutricksen war. Einen Menschen kann man vielleicht täuschen. Einen Mikrochip nicht. Das System ist so ausgelegt, daß selbst bei einem Stromausfall eine der Türen stets verschlossen bleibt.
Eine andere Fluchtmöglichkeit gab es nicht. Die Wände sind einen halben Meter dick, die Fenster haben Gitterstäbe aus gehärtetem Stahl, und jede Fensterbank und jeder Mauersims sind mit rasiermesserscharfem Draht bespannt. Einen Tunnel zu graben kam für Mountjoy schon deshalb nicht in Frage, weil Lebenslängliche in Zellen untergebracht werden, die oben und unten und rechts und links jeweils Nachbarzellen haben. Überall sind Überwachungskameras angebracht. Wenn er aus dem Hauptgefängnisblock herauskäme, hätte er immer noch die Hundepatrouillen vor sich, die Bewegungsmelder, einen fünf Meter hohen Maschendrahtzaun und eine gewaltige Mauer, ausgeleuchtet von Flutlichtlampen an hohen Masten. Albany war als Ersatz für Dartmoor erbaut worden. Man nennt es auch das britische Alcatraz, weil es auf der Isle of Wight liegt. Selbst wenn also jemandem der Ausbruch gelänge, müßte er sich noch immer allerhand einfallen lassen.
Mountjoys erster Schritt zur Flucht war ungeplant. In dem Gang vor dem Aufenthaltsraum, wo die Insassen herumhingen, fand er einen Knopf, einen silbernen Knopf mit eingeprägtem Kronmotiv, einen Knopf von einer Wärteruniform. Da man nie wissen kann, wofür etwas gut ist, versteckte er ihn achtzehn Monate lang in seiner Zelle, bevor er sich einen zweiten beschaffen konnte.
Die Gelegenheit bot sich an einem Sommerabend, als die Wärter ihn zum ›Tresor‹ schleppten, einer der Strafzellen für Störenfriede. Mountjoy war in eine Prügelei geraten, einen gerechten Entscheidungskampf, wie die alten Knackis es nannten, und zwar wegen eines Briefes, den irgendein Idiot ihm weggeschnappt hatte, einen Brief von seiner Mutter. Mountjoy fand das gar nicht lustig. Er wehrte sich, als die Wärter ihn auszogen und in die Zelle stießen. Er bekam blaue Flecke und eine blutige Nase ab, aber es hatte sich gelohnt. In der Faust hielt er die Entschädigung, eine glänzende Silbertrophäe, abgerissen von einer schwarzen Baumwoll-Uniform. Als er schließlich wieder in seine Zelle gebracht wurde, steckte er den Knopf zu dem ersten in sein Versteck unter dem Rücken eines Wörterbuchs.
Wärter hassen es, als nachlässig entlarvt zu werden. Die kleinste Charakterschwäche, die jemand im Gefängnis zeigt, wird gleich um ein Vielfaches verstärkt, und die Wärter fürchten jede Bloßstellung genauso wie die Männer, die sie bewachen. Nach dem, was man sich im Gefängnis erzählt, liegt der Gedanke nahe, daß sie noch schlimmer sind als die Insassen, wenn es darum geht, sich gegenseitig zu verpfeifen. Statt zuzugeben, daß er einen Knopf verloren hat, und danach zu suchen, was ja jeder mitbekommen würde, behält ein Wärter den Verlust für sich und läßt sich von seiner Frau einen neuen Knopf annähen. Gefängnisgepflogenheiten funktionieren nicht immer im Interesse des Systems.
Allmählich erkannte Mountjoy darin seine Chance. Er machte sich emsig daran, die Knopfsammlung zu erweitern. Als er ein oder zwei Monate später in der Schneiderei arbeitete, lernte er einen neuen Häftling kennen, einen Achtzehnjährigen, den man von Parkhurst nach Albany verlegt hatte und der ganz wild auf Tabak war. Sie machten ein Geschäft. Im Gefängnis herrschte ein reger Tauschhandel. Mountjoy bot dem Jungen Zigaretten für einen Brusttaschenknopf an und erzählte ihm wahrheitsgemäß, daß er, falls er mit den Wärtern in ein Handgemenge geriet, beim ersten Mal milde behandelt werden würde. Innerhalb eines Monats hatte er den Knopf, und der Junge hatte fünf selbstgedrehte Glimmstengel, ein Streichholz und die Drohung im Kopf, daß er kastriert werden würde, wenn er nicht den Mund hielt.
Geraume Zeit danach bot sich Mountjoy an einem sonnigen Nachmittag eine unverhoffte Gelegenheit. Wieder war es aufgrund einer Fehde zu Handgreiflichkeiten gekommen, und Mountjoy landete gemäß Vorschrift 48 erneut in Isolationshaft. Wenn man im Y-Trakt, wie der Isolationsbereich genannt wird, überhaupt Sport treiben darf, dann nur allein. Der Hof ist in eine Reihe von schmalen Fitneßbereichen unterteilt. Der Wärter, der Mountjoy baufsichtigte, hatte gerade seine Uniformjacke über die Lehne eines Plastikstuhls gehängt, als er zu einem Zwischenfall in der Nähe gerufen wurde. In den wenigen Sekunden, die Mountjoy nur durch eine Kamera überwacht wurde, vervollständigte er seine Knopfkollektion. In den drei Jahren, die er bereits im Gefängnis war, hatte er gelernt, wie man einem Kameraobjektiv ausweicht.
In der Gefängniswelt sind einige Ausbrüche legendär geworden. Noch heute spricht man mit Ehrfurcht davon, wie der Spion George Blake 1966 aus Wormwood Scrubs befreit wurde und wie zwei Insassen in Gartree 1987 mit einem Hubschrauber aus dem Gefängnishof rausgeholt wurden. John McVicars Flucht aus Durham lieferte die Vorlage für einen Film. Auch John Mountjoy wollte sich seinen Platz in dieser Ruhmeshalle verdienen. Viele Leute meinen, es war ein erstaunlich gewagtes Glücksspiel. Ganz und gar nicht. Es war eine nüchterne Kalkulation, der wohlüberlegte Einsatz eines Pokerspielers in einer Partie von unbegrenzter Dauer.
Wie plant man einen Ausbruch, wenn man einen kompletten Satz Knöpfe hat? Mountjoy verwarf das Naheliegende. Er machte sich keine Gefängniswärteruniform in der frommen Hoffnung, mit einem Bluff durch die Türen zu schlüpfen. Wärter mögen zwar nicht gerade für ihren hohen IQ bekannt sein, aber sie sind durchaus imstande, einander zu erkennen und die Mängel an einer selbstgeschneiderten Uniform wahrzunehmen.
Er belegte einen Kunstkurs. Das heißt, er verschaffte sich einen Grund, mit Bleistift und Papier zu arbeiten, wobei er abstrakte Formen zeichnete und sie schattierte. Nichts sonderlich Anspruchsvolles. Wie der Lehrer bemerkte, erinnerte sein Stil eher an Mondrian als an Picasso. Nur schwarzweiße Quadrate. Kleine, von gleichmäßiger Größe. Der Lehrer vermutete, Mountjoy wolle sich ein Miniaturschachbrett anlegen, statt ein abstraktes Bild zu zeichnen, was zwischen ihnen immer wieder zu Witzeleien führte.
Er arbeitete auch mit anderen Materialien. Heimlich experimentierte er damit, wie sich Stoff färben ließ. Er suchte nach einer Methode, um T-Shirts einzuschwärzen. Sein Ziel war reines Schwarz. Es war ein mühseliges Unterfangen, und zunächst gelang ihm nur eine Serie von Grautönen. Er war geduldig. Er hatte reichlich Zeit und einen stattlichen Vorrat an Lumpen, die er entlang des Sicherheitszaunes um den Hof herum einsammelte, wo der Müll landete, der regelmäßig aus den Zellen geworfen und am nächsten Tag von Putzkolonnen beseitigt wurde. Erst als er mit dem Schwarz seiner gefärbten Lumpen zufrieden war, tauchte er zwei T-Shirts aus Gefängnisbeständen ins Färbebad. Dann machte er sich nachts an die schwierige Arbeit – mit Nadeln aus der Schneiderei und einer Klinge, die aus dem an der Zellenwand rasiermesserscharf geschliffenen Griff einer Zahnbürste bestand –, eine passable Uniform zu schneidern und zu nähen. Die Uniform eines Polizeibeamten.
Schwarz hat zwei Vorteile. Erstens läßt es sich leichter färben als das Mitternachtsblau einer Wärteruniform. Zweitens sind die Nähte nicht so auffällig. Die Wirkung ist um so besser, wenn glänzende Knöpfe das Auge ablenken.
Die Polizeimütze war kurioserweise leichter herzustellen als die Jacke, aber schwieriger zu verstecken, deshalb wartete er damit bis zum Schluß. Er bereitete die Materialien vor, ohne sie zusammenzulegen. Aus Streifen kariertem Papier, das er mit Pappe verstärkte, würde er die Krempe formen. Das flache Oberteil würde aus gefärbter Baumwolle bestehen, die er über eine Pappscheibe spannte, und den Schirm wollte er aus dem glänzenden schwarzen Deckel einer Schachtel Schreibmaschinenpapier schneiden, die er aus dem Mülleimer des stellvertretenden Gefängnisdirektors stibitzt hatte.
Blieben nur noch das Mützenabzeichen und die Silberknöpfe und Rangabzeichen an den Epauletten. Als Grundmaterial dafür verwendete er das Staniolpapier einer Tiefkühlpackung aus dem Küchenabfall. Das Abzeichen wurde zu einem kleinen Meisterwerk der Fälscherkunst; er bildete genau das Emblem der Polizei von Hampshire nach, das er von einem Blatt Briefpapier kopierte, das er ebenfalls aus dem Abfalleimer des stellvertretenden Direktors hatte.
Verglichen damit waren Hemd und Krawatte ein Kinderspiel.
Aber natürlich mußte er seine Fluchtausrüstung verstecken. Zellendurchsuchungen finden in der Regel am frühen Abend statt, wenn die Gefangenen noch nicht in ihren Zellen sind. Daher nahm er alles mit, was Verdacht erregen konnte, und trug es unter seiner Anstaltskleidung. Einige Sachen werden von den Wärtern toleriert. Sie melden niemanden wegen des Besitzes von Nadel und Faden oder Stoffstücken. Sie suchen eher nach Drogen.
Nachdem alles bereit war und nur der genaue Zeitpunkt noch nicht feststand, faßte Mountjoy sich in Geduld. Er durfte seine Flucht nicht übereilen. Das Timing würde von äußeren Faktoren abhängen. Acht Monate vergingen, ohne daß ihm irgend etwas zu Ohren kam, das ihm hätte Mut machen können. Damit war er inzwischen drei Jahre und acht Monate in Albany. Dann kam ein neuer Gefangener in den D-Trakt. Manny Stokesay war ein Mörder, was an sich nichts Ungewöhnliches ist; ungewöhnlich war jedoch, daß er angeblich einem Mann mit bloßen Händen das Rückgrat gebrochen hatte. Beeindruckend. Stokesay war Bodybuilder, über ein Meter achtzig groß und zwei Zentner schwer. Und er hatte einen bösen Charakter.
Binnen einer Woche nach Stokesays Einlieferung fing Mountjoy an, sich für die Flucht bereitzumachen. Er hatte schon andere kräftige, gefährliche Gefangene erlebt, hatte beobachtet, wie sie von den Wärtern systematisch fertiggemacht wurden. Stokesay, so vermutete er, würde sich nicht kampflos unterwerfen. Der Ausgang würde blutig sein, wenn nicht sogar tödlich. Für Mountjoys Plan war ein größerer Tumult im D-Trakt unabdingbar, und jetzt vergrößerte sich die Chance, daß es dazu kam, von Tag zu Tag. Er nähte seine schwarze Hose fertig. Er setzte seine Polizeimütze zusammen. Jetzt war er gefährdet. Eine Zellendurchsuchung, und er war erledigt.
Aber er hoffte zuversichtlich, daß etwas passieren würde. Der neue Insasse sorgte für Spannungen unter den Gefangenen. Alte Allianzen waren bedroht, und es bildeten sich neue Bündnisse. Im Gefängnis gibt es keine Bande der Freundschaft, nur der Angst. Einige der alten Hasen fanden, daß Stokesay zu gefährlich war, um es sich mit ihm zu verscherzen, und ließen ihn wissen, daß sie ihn unterstützen würden. Andere, die nur deshalb überlebten, weil sie clever waren, fungierten als Unterhändler. Die Gefängnishierarchie wurde durch soviel Unsicherheit in ihren Grundfesten erschüttert.
Mountjoy war ein Einzelgänger. Er hatte sich nie von der einen oder anderen Gruppe vereinnahmen lassen. Er kam niemandem in die Quere und erledigte unauffällig seine Aufgaben. In drei Jahren, acht Monaten und dreiundzwanzig Tagen hatte er jeden Körperkontakt mit Mitgefangenen ebenso wie mit Wärtern erfolgreich vermieden. Außer in Kampfsituationen.
Eine Reihe kleinerer Streitereien ebnete über mehrere Tage hinweg den Weg zum ganz großen Krach. Dreimal täglich werden die Toiletten in Albany stark frequentiert, das letzte Mal um halb neun Uhr abends, kurz vor der Zellenschließung. Mountjoy sollte nie erfahren, was genau an dem Abend gesagt wurde, weil er sich bereits gewaschen hatte und in seine Zelle gegangen war, aber dem Geschrei nach zu urteilen, das über die Treppen hallte, hatte Stokesay sich beleidigt gefühlt und einen Mann namens Harragin geschlagen. Das geschah in dem Gebäudeteil, wo sich die Toiletten, Waschbecken und Mülleimer befinden. Harragin war Stokesay zwar körperlich nicht gewachsen, aber er war einer von der zähen Sorte, ein westindischer Exboxer, der für seine Aggressivität bekannt war. Und er hatte eine starke Gefolgschaft. Zwei seiner Anhänger waren auch dort und kamen ihm zu Hilfe. Der große Neuling schleuderte einen von ihnen so heftig gegen ein Waschbecken, daß er einen Schädelbruch davontrug. Mountjoy konnte von seiner Zelle aus hören, wie der Knochen brach. Eine karibische Stimme schrie: »Du hast ihn alle gemacht, du weißes Arschloch!«
Mountjoy trat nach draußen auf die umlaufende Rampe vor den Zellen. Irgendwer schleuderte eine Mülltonne, und das Chaos brach aus. Die beiden Wärter, die die Aufsicht hatten, wurden von Harragins Leuten überwältigt. Mindestens ein Dutzend Gefangene preschten aus ihren Zellen; wer nicht mithalf, würde später bestraft.
Mountjoy sagte sich, jetzt oder nie.
Sein Zeitpunkt war gekommen.
Der Alarm wurde ausgelöst, ein schreckliches Geräusch, das alles übertönte. Weitere Wärter eilten herbei, doch ihnen war der Weg durch den Berg Mülltonnen auf dem Gang versperrt. Die Gefangenen wollten ihren Streit ungestört austragen. Und wenn Mountjoy etwas über Gefängnisinsassen gelernt hatte, dann würden sie nach einem blutigen Kampf mit vereinten Kräften die Wärter fernhalten. Es sah ganz nach einer Revolte aus.
Mountjoy hatte nicht viel Zeit. Die Wärter würden bald jeden in seiner Zelle einschließen, der nicht schon hinter der Barrikade war. Sie würden aus allen Teilen des Gefängnisses kommen. Falls nötig, würde man Verstärkung aus dem Nachbargefängnis Parkhurst herbeirufen.
Er trat zurück in seine Zelle, als der Alarm losschrillte, holte seine Polizeiuniform aus den verschiedenen Verstecken und stopfte sie in die Waschschüssel aus Gefängnisbeständen. Er schloß die Zellentür hinter sich. Er würde nicht zurückkommen. Doch kaum hatte er ein paar Schritte auf der Rampe gemacht, rief ihm ein Wärter von unten zu: »Wo zum Teufel willst du hin?«
»In meine Zelle.«
Mountjoy dankte Gott, daß der Wärter normalerweise nicht im D-Trakt arbeitete. Er hatte nicht gesehen, woher Mountjoy gekommen war, und wußte nicht, welches seine Zelle war. Er rief: »Dann aber mal dalli.«
»Ja, Sir.«
Natürlich ging Mountjoy nicht in seine Zelle. Er ging auf das Ende der Rampe zu, das von dem Krawall am weitesten entfernt lag. Die letzte Tür stand offen. Hier war das Büro der Wärter, und dort würde niemand hineinkommen, solange der Tumult im Gange war.
Nachdem er sich mit einem Blick über die Schulter vergewissert hatte, daß niemand ihn beobachtete, betrat er sein Umkleidezimmer. Auf einem Tisch standen zwei Tassen mit noch dampfendem Kaffee. Eine Sexzeitschrift lag aufgeschlagen auf einem Stuhl. Eine Reihe Spinde. Eine Pinnwand voller Zettel mit Gefängnismitteilungen. In der Ecke ein tragbarer Fernseher, in dem gerade eine Folge von »Inspector Morse« wiederholt wurde.
Jetzt wird es verdammt brenzlig, dachte er. Ich kann mich erst raustrauen, wenn sie die Polizei in den Trakt reingelassen haben – was sie zwangsläufig tun werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß ein Gefangener jemanden getötet hat. Ich schätze, ich werde mindestens zwanzig Minuten warten müssen, und kann nur hoffen, daß die Meute da unten so lange durchhält. Die am schwersten erträgliche Zeit meiner Haftstrafe. Bis dahin kann ich nicht riskieren, mich umzuziehen.
Er konnte darauf bauen, daß niemand in den Raum kam, solange der Krawall andauerte. Revolten sind in unseren Gefängnissen mittlerweile an der Tagesordnung, so daß man sie nach einem Routineverfahren behandelt. Dabei gilt es vor allem zu vermeiden, daß jemand vom Gefängnispersonal als Geisel genommen wird, daher spielt heutzutage niemand mehr den Helden. Die Wärter stürmen nicht sofort die Barrikade. Sie schließen sämtliche Zellen, die sie gefahrlos erreichen können, und machen dann ihrem Vorgesetzten vor Ort Meldung. An einige wird die minimale Einsatzausrüstung ausgeteilt: Schutzhelme, braune Overalls, Plexiglasschilde, Schlagstöcke und Tränengas. Genau das passierte vermutlich gerade, dachte Mountjoy.
In der Hosentasche hatte er einen falschen Schnauzer aus eigenen Haaren, die mit Klebeband, das er von einem Brief entfernt hatte, zusammengehalten wurden. Um die Klebefähigkeit zu erhalten, hatte er ihn nicht ein einziges Mal anprobiert. Falls er nicht richtig fest saß, würde er ihn nicht benutzen, was bedauerlich wäre, denn die Attrappe war gut gelungen, ein hübsches dunkles Bärtchen, wie Polizisten es gern trugen. Leider klebte eine Seite nicht. Fluchend steckte er den Schnurrbart wieder in die Tasche.
Ein rhythmisches Schlagen setzte ein. Einen Moment lang dachte Mountjoy entsetzt, die Schilde wären bereits im Einsatz, viel früher, als er erwartet hatte. Dann riß er sich zusammen und kam zu dem Schluß, daß der Krach vom anderen Ende der Rampe kam. Das mußten die tobenden Gefangenen sein. Sie hatten sich wohl inzwischen genug geprügelt und versuchten nun, im Kampf gegen die Autorität vereint, sich Mut zu machen. Bestimmt hatten sie die halbe Installation aus der Wand gerissen und sich mit Schrubberstielen bewaffnet.
Er versuchte es erneut mit dem Schnurrbart. Ein noch kläglicherer Versuch. Zumindest könnte er sich die Koteletten kürzen. Jede noch so geringe Veränderung seines Aussehens war von Vorteil. Er machte sich mit der Zahnbürstenklinge an die Arbeit und hatte dabei das Gefühl, mehr Haare auszureißen als abzuschneiden, aber es war der Mühe wert, und es vertrieb ein wenig die Zeit.
Nach fünfzehn Minuten im Zimmer der Wärter zog er sich die Sachen an. Sie waren so geschneidert, daß sie über sein normales Hemd und die Jeans paßten. Sie hatten keinen Futterstoff. Er zog sie vorsichtig an, aus Angst, daß eine Naht reißen könnte. Sie fühlten sich ungewohnt an. Er rief sich in Erinnerung, daß sie auf einem Kontrollmonitor überzeugend aussehen mußten, mehr nicht. Er mußte Vertrauen in ihre Wirkung haben, sonst war er geliefert. Zuletzt setzte er die Mütze auf. Sie paßte wie angegossen und schien perfekt zu sein. Niemand in Albany hatte ihn je mit einer Mütze gesehen. Er stand aufrecht da, die Schultern nach hinten. Polizeibeamter 121.
Weitere zehn Minuten verstrichen. Zehn leere, entnervende Minuten. Er wünschte, er hätte die Gorillas da hinten dazu bringen können, mit dem Trommeln aufzuhören. Er hatte keine Ahnung, was die Wärter machten. Er wagte nicht, nach draußen zu gehen, bis er einigermaßen sicher war, daß Polizisten im Gebäude waren. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit und lauschte.
Irgend jemand sprach durch ein Megaphon.
Die Meute achtete nicht darauf.
Mountjoy lauschte angestrengt, was gesagt wurde.
»... braucht dringend ärztliche Hilfe. Wenn Sie sich weigern, den Arzt zu ihm zu lassen, könnte das für Sie alle schwerwiegende Konsequenzen haben.«
Damit konnte man einen Haufen Lebenslänglicher nicht beeindrucken.
Er drückte die Tür ein bißchen weiter auf und spürte das T-Shirt kalt auf der Haut. Er konnte sehen, wie ein Stoßtrupp in Kampfausrüstung die Rampe entlang auf die Barrikade zuging. Er zog die Tür zu. Das alles ging schneller, als er erwartet hatte. Sie würden doch wohl nicht da reingehen? Vielleicht wollten sie nur die Lage peilen.
Ein Metallgegenstand klapperte auf der Rampe. Wahrscheinlich war der Stoßtrupp gesichtet worden. Es folgte ein Hagel von Flüchen. Und das Geräusch von weiteren Wurfgeschossen, die das Metallgeländer trafen.
Er mußte unbedingt wissen, was unten vor sich ging. Seit Ausbruch des Krawalls waren bestimmt schon fünfundzwanzig Minuten vergangen – eigentlich doch Zeit genug? Er mußte sich beeilen, ehe es auf der Rampe von Wärtern nur so wimmelte. Die nächste Treppe war etwa vier Schritte von der Tür entfernt. Er hoffte darauf, es bis unten zu schaffen, ohne auf sich aufmerksam zu machen.
Wieder spähte er hinaus. Die Wärter hatten sich offenbar zurückgezogen. Der stellvertretende Direktor – Mountjoy konnte seine Stimme hören – sprach eine Warnung durchs Megaphon. »... Grund zu der Annahme, daß ein Mann schwer verletzt ist, womöglich getötet wurde. Ich habe keine andere Wahl, als diesen Zwischenfall rasch zu beenden. Das Gefängnispersonal wird ab sofort von einigen Polizeibeamten unterstützt...«
Mehr brauchte Mountjoy nicht zu wissen. Nach einem weiteren prüfenden Blick trat er nach draußen und ging rasch auf die Treppe zu. Es war eine Doppeltreppe mit einem kleinen Absatz auf halber Höhe. Acht Stufen bis zum Absatz, eine halbe Drehung und acht Stufen bis nach unten. Und dann war es an der Zeit zu beten.
Die erste Treppenhälfte war teilweise vor Blicken geschützt. Die zweite bot keinerlei Schutz. Er erinnerte sich an eine Szene in dem Film »Der letzte Kaiser«. Wie der kleine Junge aus dem Kaiserpalast trat und sich einer riesigen Menschenmenge gegenübersah. So werde ich mich gleich fühlen, dachte er. Wie auf dem Präsentierteller.
Während er die Treppe hinunterging, verließ ihn sein Selbstvertrauen. Was mache ich hier eigentlich, zum Donnerwetter noch mal, mit Klamotten aus gefärbten Lumpen und Pappe als Polizist verkleidet? Wie konnte ich mir nur einreden, daß dieser Plan gelingen könnte?
Er erreichte den Absatz und ging um die Kehre. Weiter, sagte er sich. Wer auch immer dich da erwartet, geh weiter.
Unten waren zig Beamte in dunkelblauen Uniformen. Zum Glück blickte niemand in seine Richtung. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand die Rampe mit der Barrikade. Ein Scheinwerferstrahl glitt über das Metallgitter. Mountjoy ging weiter nach unten. Links von sich, am Rande seines Gesichtsfeldes, gab jemand der Sondereinsatztruppe Anweisungen. Mountjoy schaute geradeaus, versuchte, Blickkontakt zu vermeiden, rechnete jede Sekunde damit, erkannt zu werden.
Er erreichte den Fuß der Treppe und hoffte, in der Menge untertauchen zu können. Die Lampen hier unten waren zum Teil ausgeschaltet, wohl um die Randalierer zu verwirren, was für ihn von Vorteil sein müßte. Er schätzte, daß es bis zur ersten Sicherheitstür fünfzehn Schritte waren, doch bei dem Gewimmel von Menschen war es unmöglich, in gerader Linie darauf zuzugehen. Es war, als würde er ein Minenfeld überqueren. Gott, dachte er, werde ich einem Wärter über den Weg laufen, der mich kennt?
Rücken geradehalten, sagte er sich. Geh wie ein Cop. Was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre ein Walkie-talkie, um es mir vors Gesicht zu halten und reinzusprechen, falls jemand auf mich zukommt. Für einen solchen Gedanken war es jetzt reichlich spät.
Er war wie betäubt vor Angst. Die Dinge liefen wie in Zeitlupe ab, als wäre er bloß Zuschauer. Das mußte der Zustand sein, bevor eine fürchterliche Panik einsetzt. Obwohl es von Wärtern nur so wimmelte, hatte er noch keinen einzigen Polizisten entdeckt. Er wollte nicht unbedingt einem begegnen, aber zu wissen, daß die Polizei da war, wäre beruhigend gewesen.
Als er gerade um eine Gruppe herumging, ertönte das Megaphon, und er zuckte so heftig zusammen, daß er beinahe seine Pappmütze verlor.
»Zurück unter die Rampe«, sagte der stellvertretende Direktor. »Wir brauchen hier mehr Platz.«
Er sprach nicht nur Mountjoy an. Die Aufmerksamkeit wurde von oben abgelenkt. Alle setzten sich in Bewegung. Jemand neben Mountjoy fragte ihn: »Ist da oben einer getötet worden?«
»Ist noch unklar«, brummte er, während er versuchte, sich gegen den Strom zu bewegen, und von seinem Kurs abgedrängt wurde. Er kam sich allmählich vor wie ein Ertrinkender. Er haßte die Nähe von Leuten, und das hier waren Wärter. Er war mit ihnen Schulter an Schulter, unfähig, sich zu bewegen.
Er konnte bloß noch vor Angst zittern.
Hinter ihm sagte jemand: »Die rücken wieder vor.«
Offenbar war das Einsatzkommando auf genau der Treppe in Stellung gegangen, die Mountjoy gerade heruntergekommen war. Alles drängte vor, um den Stoßtrupp sehen zu können. Das Gedränge löste sich ein wenig auf, und Mountjoy schob sich nach rechts. Er hatte noch immer gut die Hälfte der Strecke bis zur Tür vor sich. Er war so darauf aus voranzukommen, daß er mit jemandem zusammenprallte und ihn beinahe umgestoßen hätte.
Der Wärter drehte sich um und starrte Mountjoy an. Es war Grindley, der in seinem Trakt arbeitete und den er jeden Tag sah. Er war einen Moment lang wie gelähmt, während Grindley die Augen zusammenkniff und ihn zu erkennen schien. Dann blinzelte Grindley zweimal. Es war ihm am Gesicht abzulesen, daß er sich nicht ganz sicher war. Er konnte nicht glauben, was er da sah, und nüchterne Überlegung sagte ihm, daß er sich täuschen mußte. Dann sagte er: »Tschuldigung, Kumpel.«
Mountjoy traute sich nicht, zu sprechen. Er nickte und ging weiter.
Er war jetzt der ersten Tür ganz nahe. Gott steh mir bei, sagte er sich – eine Gruppe Polizisten stand neben der Tür.
Er konnte jetzt unmöglich stehenbleiben. Die Kamera hatte ihn erfaßt, deshalb würde er seine Rolle wie geplant weiterspielen.
Zwei von den Cops drehten sich zu ihm um und blickten überrascht, was kein Wunder war.
Sie erwarteten, daß er etwas sagte, eine Erklärung lieferte, warum er hier war. Er sagte so glaubwürdig, wie er nur konnte: »Da oben hat’s einen Toten gegeben. Der Direktor will, daß wir uns in Bereitschaft halten.« Dann ging er auf die Tür zu und hob eine Hand, um dem Wärter im Kontrollraum ein Zeichen zu geben. Zitternd wartete er.
Einer der Polizisten sagte: »Bist du aus Cowes, Kollege?«
»Shankling«, antwortete er, »Sondereinsatz«, fügte er hinzu.
»Du kamst mir gleich nicht bekannt vor. Wieso bist du vor uns hier gewesen? Wir sind doch gleich um die Ecke.«
»War ein Tip«, antwortete Mountjoy, und dann – Gott sei Dank – öffnete sich die Tür. Er trat in die Kammer.
Dieser Augenblick, der ihm über Jahre hinweg schlaflose Nächte bereitet hatte, war eine Art Antiklimax. Er mußte die sieben Sekunden lang dastehen, während der Beamte im Kontrollraum ihn genau unter die Lupe nahm. Doch nach dem Nervenkitzel, den er soeben durchgemacht hatte, war dieser Ort das reinste Refugium.
Nichts geschah.
Er wartete.
Er zählte im Geiste mit, den Blick starr geradeaus.
Sieben Sekunden waren vergangen. Mußten vergangen sein, dachte er. Der mustert mich aber genau.
Dann öffnete sich die zweite Tür, und er spürte die kältere Luft des Hauptkorridors im Gesicht. Er trat vor.
Er konnte jetzt den ganzen Weg über beobachtet werden, falls er jemandem verdächtig vorkam. Er ging forsch voran, mit erhobenem Kopf, vorbei an dem Eingang zum C-Trakt zu seiner Rechten und der Krankenstation zur Linken. Er kannte den Weg gut, weil er ihn oft gegangen war, wenn er zu den Kursräumen und zur Bibliothek wollte – natürlich stets in Begleitung. Der Haupteingang lag links hinter den Kursräumen.
Er näherte sich dem B-Trakt. Als er an der Tür war, öffnete sie sich, und eine Gruppe Wärter kam heraus. Sie liefen auf Mountjoy zu, und einen gräßlichen Augenblick lang dachte er, sie hätten Anweisung, ihn aufzuhalten. Aber sie rannten an ihm vorbei zu dem Trakt, den er gerade verlassen hatte. Er ging weiter und bog um die Ecke.
Der Haupteingang des Gefängniskomplexes ist durch ein dreifaches System von Schiebetüren abgesichert. Die Beleuchtung hier ist grell, und Mountjoy war überzeugt, daß jeder Stich an seiner zusammengenähten Uniform auf den Monitoren zu sehen war. Es gab einen Klingelknopf, der jedoch, da war er sicher, vollkommen überflüssig war.
Dann ertönte ein Knistern, und eine Stimme sprach ihn an. »Sie gehen schon, Officer?«
Er lieferte die Antwort, die er sich für den Fall zurechtgelegt hatte, daß er gefragt wurde: »Ist die Verstärkung noch nicht da? Ich soll die einweisen.«
Die erste Tür glitt auf.
»Danke.« Er trat vor.
Er wartete.
Die zweite Tür öffnete sich.
Und die dritte.
In der richtigen Welt war es inzwischen dunkel, aber die Flutlichtlampen an den Masten verwandelten den Gefängnishof in eine gleißende Wüste. Von seinen Füßen strahlten mindestens sechs Schatten ab. Vor dem Haupteingang standen zwei Streifenwagen. Da er wußte, daß er unter Videoüberwachung stand, blieb er kurz neben dem nächsten Wagen stehen und stützte sich ein paar Sekunden lang auf den Fensterrahmen, als würde er einen Funkspruch durchgeben. Dann ging er über den Hof auf das Wachhaus am Hauptportal zu.
Ein Hund bellte, und der Hundeführer brüllte etwas, um das Tier von seinem Irrtum abzubringen, daß John Mountjoy ein Ausbrecher sei. Weiteres Bellen. Mindestens zwei Hundepatrouillen kontrollierten den ersten der beiden fünf Meter hohen Umgrenzungszäune vor der Außenmauer. Er mußte noch durch vier Tore hindurch.
Und jetzt glaubte er, daß er es schaffen würde.
2
»Mir ist heute ein Job angeboten worden.«
Stephanie Diamond senkte die Abendzeitung weit genug, um mit einem Blick über den oberen Rand hinweg zu prüfen, ob ihr Mann es ernst meinte. »Ein richtiger Job?«
»Darüber ließe sich streiten.«
Auf dem Küchentisch zwischen ihnen standen eine dreiviertel volle Flasche billiger Rotwein und eine Schüssel, in der Shepherd’s Pie gewesen war. Der Korken war wieder in der Flasche, damit der Wein nicht sauer wurde bis zum nächsten Tag. Stephanie beschränkte ihrer beider Ration auf je ein Glas, nicht aus Gesundheits-, sondern aus Sparsamkeitsgründen. Die Diamonds hatten gelernt, in ihrer Souterrainwohnung an der Addison Road in Kensington bescheiden, ja anspruchslos zu leben.
Das Abendessen war ein kostbarer Einschnitt in ihrem Tagesablauf, die erste Gelegenheit, gemeinsam zu entspannen. Wenn irgend etwas Interessantes passiert war, so erwähnten sie es jetzt. Sie sprachen nicht immer. Stephanie löste gern das Kreuzworträtsel auf der Rückseite des »Evening Standard«. Sie brauchte etwas zum Abschalten, wenn sie am Nachmittag im Dritte-Welt-Laden gearbeitet hatte. Es war schwierig, nicht genervt zu sein, wenn wohlhabende Frauen aus Knightsbridge die Kleiderständer nach Designerklamotten zu Billigpreisen durchwühlten und dann noch einen Rabatt verlangten.
Peter Diamond warf zur Zeit nur selten einen Blick in die Zeitung. Das meiste, was er dort las, deprimierte ihn bloß. Auch im Fernsehen schaute er sich höchstens noch Rugby oder Boxen an. Es kam einfach viel zuviel über die Polizei – zuviel in den Nachrichten und zuviel in den Abendserien. Er versuchte zu vergessen.
»Aber du hast doch schon einen Job«, sagte Stephanie.
Er nickte. »Der wäre ein Abendjob, als Modell.«
Sie starrte ihn an. Sie dachte natürlich an die Modebranche. »Wie bitte?«
»Als Modell. Bei Sainsbury hat mich so ein Typ mit Fliege und Schottenkaroweste angesprochen. Sie sind knapp an männlichen Modellen im Chelsea College.«
Sie legte die Zeitung hin. »Als Künstlermodell?«
»Genau.«
»Bei deiner Figur?«
»Meine Figur schreit einfach danach, mit Zeichenkohle eingefangen zu werden – meint zumindest mein neuer Freund. Ich habe eine Rubensfigur und anspruchsvolle Konturen.«
»Hat er das gesagt?«
»Hast du mich jemals so reden hören?«
»Du willst doch wohl nicht nackt posieren?«
»Wieso nicht?« Das war ein beliebtes Spielchen; er begann mit einer provokanten These, die er dann mit großem Ernst weiterentwickelte. Noch besser war, wenn Stephanie es für bare Münze nahm. »Sie zahlen nicht schlecht.«
»Ich möchte aber nicht, daß mein Mann sich in einem Raum voller Studenten im Adamskostüm präsentiert.«
»Aus deinem Mund klingt das so, als wäre es ein Verbrechen.«
»Ein paar von denen kommen frisch von der Schule. Junge Mädchen.«
»Ich bin sicher, die reißen sich zusammen«, sagte er in dem gleichen vernünftigen Ton. »Mag sein, daß meine anspruchsvollen Konturen ihren Puls zum Rasen bringt, aber es ist ja ein Dozent dabei.«
Er hatte zu hoch gereizt. Stephanie sagte: »Du hast das erfunden.«
»Nein, Ehrenwort. Der Kerl hat mir seine Karte gegeben, und ich soll ihn anrufen.«
Stephanie schwieg einen Moment. Dann sagte sie: »Ein anderes Wort für ›merkwürdig‹ mit elf Buchstaben?«
»Ist das deine Meinung zu meinen Bemühungen, unser Einkommen aufzubessern?«
»Nein, das steht im Kreuzworträtsel.«
»Keine Ahnung. An deiner Stelle würde ich damit nicht meine Zeit vergeuden.«
Sie konterte: »Wenn du es tätest, hättest du vielleicht noch einen guten Job bei der Polizei.«
Er grinste freundlich. »Nein, mit Kreuzworträtseln allein ist es nicht getan. Man muß sich auch Opern im Auto anhören.« Es war fast zwei Jahre her, seit er überstürzt den Dienst als Detective Superintendent bei der Polizei von Avon und Somerset quittiert hatte. Es kam ihm länger vor. Zwischen Phasen ganz ohne Anstellung hatte er sich als Barmann durchgeschlagen, kurzfristig als Weihnachtsmann gearbeitet, als Wachmann bei Harrods, als Aushilfe in einer Schule für Behinderte, als Zeitungsausträger, und zur Zeit sammelte er für einen Supermarkt die Einkaufswagen vom Parkplatz ein. Die Zeiten waren nicht gerade günstig für einen Mann im mittleren Alter, der nach einer festen Anstellung suchte.
Stephanies Stelle als Kontrolleurin von Schulmahlzeiten war wegen Einsparungen in der Lokalverwaltung im Juli ausgelaufen. Seitdem hatte sie wiederholt versucht, einen Job zu finden. Sie sagte nachdenklich: »Da wir gerade von früher sprechen, neulich war nachmittags eine Sendung über den Kennet-Avon-Kanal im Fernsehen.«
Jetzt war er überrascht. »Ich wußte gar nicht, daß du dich für Boote interessierst.«
»Tu ich auch nicht. Sondern für die Landschaft. Den Blick auf Bath. Weißt du noch, wie schön es ausgesehen hat, wenn die Sonne auf diese langgestreckten georgianischen Häuserreihen schien? Dieser honigfarbene Schimmer, den ich nie irgendwo anders gesehen habe?«
Er wählte seine Worte mit Bedacht, denn einer der Gründe, warum er sie liebte, war der, daß sie ihn gelehrt hatte, so vieles zu sehen, das er zuvor nie wahrgenommen hatte. »Ehrlich gesagt, ich erinnere mich, daß ich immer ungeheuer erleichtert war, wenn ich an einem dieser warmen Nachmittage, an denen die Stadt wie eine Ansichtskarte aussah und heiß war wie ein türkisches Bad, aus dem Zentrum herauskam. Ich kann mir nicht vorstellen, daß wir je wieder dorthin zurückkehren, Steph, es sei denn für einen Tagesausflug. Es war eine Phase in unserem Leben, eine recht glückliche. Lassen wir es dabei bewenden.«
Sie sagte: »Es ist harte Arbeit. Härter, als du vielleicht meinst.«
»Was?«
»Als Modell posieren.«
Etwas in ihrer Stimme ließ ihn aufhorchen. »Woher willst du das wissen?«
Sie lächelte schwach. »Als ich noch allein war und was nebenher verdienen mußte, habe ich ab und zu an der Uni Modell gestanden.«
Diesmal hatte sie ihn richtig überrumpelt. Er war entsetzt. Sie sagte immer die Wahrheit.
»Du meinst, nackt?«
»Mhm.«
»Das hast du mir nie erzählt.«
Sie sagte: »So was erwähnt man nun mal nicht einfach so in einem Gespräch. Jedenfalls würde ich es jetzt nicht mehr machen.« Nach einer Pause fügte sie hinzu. »Aber man hat mich ja auch nicht gefragt.«
Er gewann die Fassung soweit zurück, daß er sagte: »Wenn du möchtest, kann ich am Chelsea College ein Wort für dich einlegen.«
»Untersteh dich.« Erneutes Schweigen.
»Befremdlich«, sagte Diamond schließlich.
Sie wurde rot, und ihre Augen verengten sich. »Was?«
»Das Wort mit elf Buchstaben, das du gesucht hast.«
Sehr viel später, als sie schon im Bett lagen, sagte er zu ihr: »Es ist reichlich spät, das zu sagen, Steph, aber es war idiotisch von mir, bei der Polizei aufzuhören. An dem Tag, als ich aus dem Büro des Assistant Chief Constable gestürmt bin, hatte ich keine Ahnung, daß wir einmal so enden würden, in einer schäbigen Souterrainwohnung in einer Seitenstraße.«
»Ich muß doch sehr bitten. Die Wohnung ist nicht schäbig. Ich halte sie sauber.«
»Dann eben bescheiden.«
»Und ich begreife nicht, wie du die Addison Road als Seitenstraße bezeichnen kannst. Hör doch. Ich meine, hör dir den Verkehr an. Es ist nach Mitternacht, und es hört sich noch immer so an wie am Piccadilly.«
Er ließ sich nicht aus seiner Beichtstimmung reißen. »Wenn es nur um mich gegangen wäre, okay, aber es ging auch um dich, und du hattest bei der Entscheidung kein Mitspracherecht. Es war das Egoistischste, was ich je getan habe.«
Sie sagte: »Es ging ums Prinzip.«
»Ja, um meins, nicht um deins.«
»Wenn sie deine Qualitäten als Detective nicht zu schätzen gewußt haben, dann haben sie dich auch nicht verdient.«
Er lachte kurz und hämisch auf. »Die waren doch bloß froh, mich loszuwerden.« Er seufzte, drehte sich auf die Seite und sprach zur Wand. »Ich hatte es auch nicht anders verdient. Ich paßte nicht da rein.«
Stephanie rutschte zu ihm rüber. »Ja, man hält es kaum aus mit dir, du roher Kerl.«
»Rücksichtslos«, sagte er.
»Taktlos«, sagte sie.
»Ungehobelt.«
»Und voller Selbstmitleid.« Sie zog an seiner Pyjamahose und gab ihm einen Klaps aufs nackte Hinterteil. »Fühlst du dich jetzt besser?«
»Eigentlich nicht.«
»Spielverderber.«
»Wieso Spielverderber?«
Sie schmiegte sich an ihn und flüsterte ihm ins Ohr: »Rate mal.«
Offenbar wollte auch das Schicksal mitraten, denn in diesem innigen Moment war das Scharren von Schuhen draußen auf der Betontreppe zu hören.
»Was ist denn jetzt los ...?«
»Betrunkene, würde ich sagen«, murmelte Stephanie.
»Oder Kinder, die sich da rumtreiben. Hört sich an, als wären es mehrere.«
»Kinder um diese Uhrzeit?«
Sie lagen reglos da und warteten.
»Zu doof, die Klingel zu finden«, sagte Diamond.
Wie aufs Stichwort klingelte es.
»Wie spät ist es eigentlich?« brummte Diamond. »Wir haben doch bestimmt schon nach Mitternacht.«
»Ja. Willst du aufmachen?«
»Scheiße. Ich bin für niemanden zu Hause. Ich schau mal durch den Vorhang.« Er stand auf und ging zum Fenster. Zwei jüngere Männer in wattierten Jacken standen da, schwach erhellt von einer Straßenlaterne. Sie sahen nicht betrunken aus. »Das verstehe ein anderer«, sagte Diamond.
Stephanie setzte sich auf und schaltete die Nachttischlampe an.
»Licht aus!« zischelte Diamond.
Aber die Besucher mußten das Licht gesehen haben, denn sie klingelten erneut und betätigten auch den Türklopfer.
»Ich geh lieber mal nachsehen.«
»Meinst du wirklich? Die können doch nichts Gutes im Schilde führen um diese Uhrzeit.«
»Ich lasse die Kette vorgelegt.« Er griff nach seinem Morgenmantel. Das Klopfen hielt an, so laut, daß man es im ganzen Haus hören mußte, deshalb rief er: »Schon gut, ich komme ja.«
Er öffnete die Haustür, soweit es die Sicherheitskette erlaubte, und spähte hinaus.
»Mr. Peter Diamond?«
Er runzelte die Stirn. Zwei betrunkene Passanten würden seinen Namen nicht kennen. »Ja?«
»Ich bin Detective Inspector Smith, und das ist Sergeant Brown. Kripo, Avon und Somerset.«
»Avon und Somerset? Da sind Sie aber weit ab vom Schuß, was?«
»Dürfen wir reinkommen?« Der Mann hielt einen Polizeiausweis nahe an den Türspalt, und Diamond konnte sehen, daß er tatsächlich Smith hieß. Wenn jemand Namen erfinden wollte, würde er sich dann ernsthaft für Smith und Brown entscheiden?
»Es ist verflucht spät, wissen Sie«, beschwerte sich Diamond. »Worum geht’s? Ist jemand gestorben?«
»Nein, Sir.«
»Worum dann?«
»Könnten wir drinnen darüber sprechen, Mr. Diamond?«
Er mußte sich eingestehen, daß es sich um die typische Art und Weise handelte, wie die Kripo mit einem potentiellen Zeugen sprach – oder einen gefährlichen Verdächtigen bei Laune hielt. »Ich war selbst mal bei der Kripo. Ich kenne meine Rechte.«
»Ja, Sir.«
»Wenn ich wegen irgendwas verdächtigt werde, möchte ich wissen, was gegen mich vorliegt.«
»Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, Sir. Wir sind nicht hier, um Sie zu vernehmen.«
»Aber Sie kommen extra aus Somerset, da darf ich wohl annehmen, daß Sie mir keinen privaten Besuch abstatten.«
Diamond löste die Kette, und um Stephanie zu beruhigen, rief er: »Alles in Ordnung, Schatz. Sie sind von der Kripo«, begriff aber im selben Moment, daß seine Worte wohl kaum die beabsichtigte Wirkung haben würden.
Er führte sie ins Wohnzimmer. Beide Beamten sahen sich mit einem Gesichtsausdruck um, der ihre Verwunderung darüber verriet, daß ein ehemaliger Superintendent so tief hatte sinken können.
»Kaffee?«
»Bitte rufen Sie sofort diese Nummer an, Mr. Diamond.« Inspector Smith reichte ihm einen Zettel und fügte nachträglich hinzu: »Sie haben doch ein Telefon?«
Diamond ging zum Apparat.
Er bemerkte, daß Sergeant Brown sich umdrehte und die Tür schloß, und das nicht, weil es zog. Sie wollten nicht, daß Steph mitbekam, was gesagt wurde. Diese Geheimniskrämerei war nervtötend.
Diamond wählte die Nummer.
Es klingelte nur zweimal. Eine Stimme sagte: »Ja?«
»Diamond am Apparat.«
»Ausgezeichnet. Farr-Jones ist mein Name, ich bin Chief Constable von Avon und Somerset. Ich glaube, wir sind uns nie begegnet.«
Falls doch, so hätten sie sicher nicht viel miteinander anfangen können. Farr-Jones’ Stimme klang nach Golfclubs und vornehmen Dinnerpartys, die Diamond gemieden hatte wie die Pest. Aber der Name sagte ihm etwas. Patrick Farr-Jones war achtzehn Monate zuvor zum Chef der Kripo von Avon und Somerset ernannt worden, nachdem er zuvor stellvertretender Leiter der Kripo in Norfolk gewesen war. Der Chief Constable war zu dieser späten Stunde noch auf, um einen Anruf entgegenzunehmen? Die Sache mußte von höchster Wichtigkeit sein.
»Sie können sich wahrscheinlich denken, was der Grund für dieses Telefonat ist, Mr. Diamond«, sprach die Samtstimme.
»Nein«, sagte Diamond.
Die knappe Erwiderung brachte Mr. Farr-Jones ein wenig aus dem Konzept. Er hatte offenbar Kooperationsbereitschaft erwartet, daher versuchte er es nach einer Pause mit einem Kompliment. »Schön gesagt. Ein guter Detective setzt nichts voraus.«
»Ich bin kein Detective mehr, Mr. Farr-Jones.«
»Stimmt, aber ...«
»Und man kann darüber streiten, ob ich je ein guter Detective war.«
»Soviel ich weiß, waren Sie ein sehr guter Detective.«
»Ein Jammer, daß das damals keiner so gesehen hat«, sagte Diamond. »Was müßte ich mir eigentlich denken können? Wenn es in der Zeitung gestanden hat – ich lese keine Zeitung, bis auf die Stellenanzeigen.«
»Dann haben Sie das mit Mountjoy noch gar nicht gehört?«
Ein Bild aus früheren Jahren flackerte vor seinem inneren Auge auf: ein Schlafzimmer, auf dem Bett eine Frauenleiche in einem blaßblauen Pyjama, mit Stichwunden übersät, blutüberströmt. Und es gab eine bizarre Besonderheit, die in allen Zeitungen Schlagzeilen gemacht hatte. In den Mund der Toten gestopft und auf ihrem ganzen Körper verteilt waren die Köpfe von einem Dutzend rotblühender Rosen. Diese an ein Ritual erinnernde Besonderheit des Mordes hatte damals Aufsehen erregt. »Was ist mit Mountjoy?«
»Ich bin überrascht, daß Sie es noch nicht gehört haben. Es stand letzte Woche in allen Zeitungen. Er ist draußen. Er ist aus Albany ausgebrochen.«
»Gütiger Himmel!«
Am 22. Oktober 1990 hatte Diamond John Grainger Mountjoy wegen Mordes, begangen an der Journalistin Britt Strand in ihrer Wohnung in Larkhall, Bath, verhaftet. Mountjoy hatte lebenslänglich bekommen.
Farr-Jones fügte hinzu: »Er hat es bis hierher geschafft. Es ist etwas passiert, etwas sehr Ernstes.«
»Und Sie glauben, es war Mountjoy?«
»Wir wissen es.«
»Was wollen Sie von mir?«
»Wir brauchen Sie hier. Dringend.«
»Moment mal, Mr. Farr-Jones. Ich habe vor zwei Jahren den Dienst quittiert. Ich gehöre nicht mehr dazu.«
»Würden Sie mich bitte ausreden lassen, Mr. Diamond? Wir haben es hier mit einem äußerst gefährlichen Ausbrecher zu tun. Er hat eine Krise heraufbeschworen, eine extreme Krise, und ich kann im Moment am Telefon nicht mehr sagen, als daß wir erfolgreich um ein Presseembargo nachgesucht haben. Als ehemaliger Superintendent wissen Sie, daß wir so etwas nur tun, wenn der Ernst der Lage es erfordert.«
»Und Sie meinen, ich könnte Ihnen helfen?«
»Das ist es nicht allein.«
»Was denn noch?«
»Sagte ich nicht, daß ich jetzt nicht ins Detail gehen kann?«
»Wieso nicht, wenn eine Nachrichtensperre verhängt wurde? Das heißt doch, daß wir gefahrlos reden können.«
»Machen Sie es bitte nicht komplizierter, als es schon ist. Es tut mir leid, Sie zu dieser unchristlichen Zeit zu stören, aber glauben Sie mir, es ist dringend erforderlich, daß Sie kommen.«
»Sie meinen, auf der Stelle?«
»Die Beamten, die bei Ihnen sind, haben Anweisung, Sie hierherzufahren. Sobald Sie hier sind, werden Sie ausführlich informiert.«
»Und wenn ich mich weigere?«
»Würde ich die Beamten auffordern, Sie zu bringen.«
Diamond lag die Frage auf der Zunge, welchen Zweck der Anruf hatte, wenn er ohnehin gegen seinen Willen nach Bath verfrachtet werden sollte, aber er schluckte sie hinunter. »Dann ziehe ich wohl besser rasch was an, aber ich verpflichte mich zu nichts. Sie berücksichtigen doch wohl, daß ich nicht mehr bei der Polizei bin?«
Er zeigte Smith und Brown, wo sie sich einen Kaffee machen konnten, und ging zurück ins Schlafzimmer, um Stephanie die Nachricht von seiner Abreise zu überbringen. Er erzählte ihr alles, was er wußte; schließlich hatte sie ein Anrecht darauf, und er unterlag nicht der Schweigepflicht. Sie konnte sich nur schwer vorstellen, daß die Polizei ihn zurückhaben wollte, nach dem bösen Auftritt, den er bei seiner Kündigung hingelegt hatte. Auf seine rauhe Art war er ein guter Detective gewesen, aber niemand ist unersetzlich. Sie fragte, wie lange er fort sein würde, und er erinnerte sie daran, daß es nach Bath nur zwei Stunden mit dem Auto waren. Er versprach, sie am Morgen anzurufen.
Um die Stimmung etwas aufzuheitern, sagte er: »Na ja, wahrscheinlich immer noch besser, als nackt zu posieren.«
Stephanie sagte: »Da bin ich mir nicht so sicher.«
3
Sergeant Brown fuhr, als wollte er vom Boden abheben.
Vom Rücksitz des roten Montego aus gesehen, unterwegs in Richtung M 4, verschwammen die Straßen von West London. Diamond, der sich in Autos nie wohl fühlte, versuchte wiederholt, ein Gespräch in Gang zu bringen, aber seine Begleiter ließen sich nicht dazu verleiten, etwas über die »extreme Krise« zu verraten, die als Rechtfertigung für den nächtlichen Ausflug herhielt. Kurz vor der Autobahn kam Diamond zu dem Schluß, daß die beiden bloß Handlanger waren und keine Ahnung hatten.
Er wechselte das Thema und fragte, was es auf der Personalebene bei der Kripo von Avon und Somerset Neues gab. Wie sich herausstellte, hatte sich einiges getan, seit der neue Chief Constable da war. Von der einstigen Mordkommission – Diamonds Team – waren nur zwei dienstältere Detectives übriggeblieben. Nicht weniger als sieben waren in andere Abteilungen oder in den Vorruhestand versetzt worden. Die Überlebenden waren Keith Halliwell, charmant, aber ein Leichtgewicht, und John Wigfull, der ehrgeizige Karrierebeamte. Wigfull war zum Chief Inspector und Leiter der Mordkommission befördert worden.
Diamond schloß die Augen und sagte sich, daß er das alles hinter sich hatte. Was spielte es für ihn persönlich noch für eine Rolle, daß so ein Schleimer wie Wigfull jetzt an der Spitze stand?
»Gute Idee«, sagte Smith.
»Was?«
»Ein Nickerchen zu machen, solange Sie noch können.«
»Bei der Geschwindigkeit könnte es ein ewiger Schlaf werden.«
Trotzdem schlummerte Diamond ein.
Als er wach wurde, fest überzeugt, auf der Intensivstation eines Krankenhauses zu liegen, waren sie sechzig Meilen weiter, kurz vor einer Raststätte.
»Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich hätte nichts dagegen, einen Kaffee zu trinken«, schlug er vor.
»Wir sind in knapp einer Stunde da«, sagte Smith.
»Dreiviertelstunde«, sagte Brown. »Trinken Sie einen Kaffee, wenn wir da sind.«
»Bis dahin brauche ich was Stärkeres als Kaffee.«
Das letzte Stück, auf der Landstraße über die Ausläufer der Cotswolds, gab Brown Gelegenheit, die Fahrt zu einem Finale zu steigern, bei dem einem das Herz in die Hose rutschte; unterbrochen von scharfen Bremsmanövern, so daß die Reifen Spuren auf dem Asphalt hinterließen, jagte er die kurvenreiche Straße von Cold Ashton hinab, neben der es, wie Diamond wußte, steil in die Tiefe ging.
Unter anderen Umständen wäre das nächtliche Panorama von Bath mit seinen unzähligen Lichtern, die von der hell erleuchteten Abteikirche abstrahlten, ein willkommener Anblick gewesen. Er sparte sich seine Freude für den Augenblick auf, als sie nach rechts in die ebene London Road einbogen.
»Gut.«
»Gut gefahren oder gut, hier zu sein?« sagte Smith.
»Wie spät ist es?«
»Kurz nach drei.«
»Alles in allem zwei Stunden. Wieso haben wir so lange gebraucht?«
Smith und Brown waren leichte Beute. Er freute sich schon auf härtere Gegner.
»Wen treffe ich im Polizeirevier an? Wer sind die von Schlaflosigkeit Geplagten, die heute nacht Dienst haben?«
Smith wußte es nicht oder hatte keine Lust zu antworten.
Der Wagen fuhr zum Haupteingang des Polizeireviers an der Manvers Street, und Diamond ging, nachdem er die Fahrt überlebt hatte, voller Elan zusammen mit Smith hinein, um Antwort auf seine Frage zu erhalten.
Der öffentliche Eingangsbereich war seit Diamonds Zeiten verändert worden, denn man hatte ihn durch Trennwände drastisch verkleinert. Die Silbertrophäen, die Beamte des Reviers gewonnen hatten, waren noch immer in einer Vitrine ausgestellt, praktisch eine Einladung an die jungen Burschen der Stadt, die gern Schaufenster ausraubten. Ein runder Spiegel war strategisch so angebracht, daß man jeden sehen konnte, der hereinkam. Der diensthabende Sergeant arbeitete hinter Sicherheitsglas, wie ein Bankangestellter. Er war einer von den alten Hasen, und sein Gesicht erstrahlte. »Mr. Diamond! Wie schön, Sie wiederzusehen.« Eine herzlichere Begrüßung, als nach dem Grad ihrer Bekanntschaft zu erwarten war. Diamond ließ sich nicht täuschen: Es sagte mehr über das neue Regime aus als über seine Beliebtheit.
Smith eskortierte ihn die Treppe hinauf zu dem Raum, den die hohen Tiere benutzten, wenn sie zu Besuch kamen. Die Ironie des Schicksals wollte es, daß es just der Raum war, aus dem Diamond bei seinem letzten Auftritt hier herausgestürmt war. An jenem unglückseligen Morgen hatte Mr. Tott, der Assistant Chief Constable, in Uniform, zugeknöpft bis zum Hals, am äußeren Ende des ovalen Mahagonitisches gesessen und Diamond davon in Kenntnis gesetzt, daß er von der gerade laufenden Mordermittlung abgezogen und durch Wigfull ersetzt werden würde. Der Vorwurf? Daß er angeblich einem stürmischen zwölfjährigen Jungen, der ihm in die Weichteile getreten hatte, eine Gehirnerschütterung beigebracht hatte. Dabei hatte er ihn nur beiseite gestoßen, gegen eine Wand. Der kleine Matthew hatte später zugegeben, daß er die Gehirnerschütterung nur vorgetäuscht hatte, aber da war Diamond schon nicht mehr bei der Polizei.
Die Tür stand offen.
»Gehen Sie rein«, sagte Smith. »Mr. Tott wartet schon.«
Diamond schlug mit der Hand gegen den Türrahmen. »Haben Sie gesagt, Tott? Das glaube ich einfach nicht.«
»Der Assistant Chief Constable«, flüsterte Smith ehrfürchtig.
»Ich weiß, wer er ist«, sagte Diamond so laut, daß man es in dem Zimmer hören mußte. »Ich wünsche nicht, mit ihm zu sprechen.« Er wandte sich von der Tür ab und ging den Flur entlang zurück zur Treppe. Er wußte selbst nicht genau, wo er hinwollte, bloß weg von diesem verfluchten Mann, den er haßte. Der Zorn, von dem er geglaubt hatte, daß er sich vor zwei Jahren gelegt hatte, flammte wieder in ihm auf.
Smith kam ihm nach und hielt ihn am Arm fest. »Was ist los? Was habe ich denn gesagt?«
»Gerade genug, um ein Blutbad zu verhindern.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Macht nichts. Es hat nichts mit Ihnen zu tun.«
»Doch. Ich soll Sie in das Zimmer bringen. Sie warten dort, um mit Ihnen zu sprechen. Es ist mitten in der Nacht, zum Donnerwetter noch mal! Wo wollen Sie denn hin?«
»Möglichst weit weg von diesem Mistkerl. Ich bin Zivilist. Ich muß vor niemandem zu Kreuze kriechen.«
Er ging die Treppe hinunter.
»Ich kann Sie nicht gehen lassen, Mr. Diamond«, rief Smith ihm nach. »Sie dürfen das Gebäude nicht verlassen.«
»Versuchen Sie mal, mich aufzuhalten«, rief der Exdetective zurück. »Haben Sie einen Haftbefehl?«
Als er das Erdgeschoß erreicht hatte, ging er forsch in die Eingangshalle, vorbei an seinem Freund, dem diensthabenden Sergeant, den er nicht mal eines Blickes würdigte, durch die Doppeltür und hinaus in die Nachtluft.
Tott.
Er sagte laut: »Für wie blöd halten die mich eigentlich?«
Außer sich vor Wut marschierte er die Manvers Street hoch; sein Blutdruck schoß in die Höhe. Ein Stück die Straße hinauf begriff er, daß Punkte vor den Augen kein gesundes Zeichen waren und er besser daran tat, sich zu beruhigen. Zumindest hatte er den Mumm gehabt zu gehen. Eigentlich müßte er sich besser fühlen, weil er seine Unabhängigkeit bewiesen hatte. Er wollte es im Francis Hotel am Queen Square probieren; ein angenehmer Ort, um sein müdes Haupt bis zum Morgen zu betten, wenn er mit dem Zug nach Hause fahren würde. Früher war er manchmal in der Mittagspause, wenn im Revier alles ruhig war, auf ein Bier in die Roman Bar des Francis gegangen. In einer milderen Stimmung als jetzt hatte er die noble Atmosphäre genossen, die an weniger anstrengende Zeiten denken ließ. Dort konnte man sich ausmalen, wie hochgestellte Persönlichkeiten der Stadt, im Nadelstreifenanzug, mit Weste und Uhrkette, sich in Gesellschaft koketter junger Damen mit runden Hütchen amüsierten.
In der Innenstadt von Bath war es für einen Fußgänger weniger gefährlich als in London. Die einzigen Leute, die er sah, waren eine Gruppe Obdachloser, die sich um den Rost hinter dem Römischen Bad drängten, wo die warme Luft herausströmte. Er fühlte sich zwar sicher, aber die Aussicht, den Rest der Nacht auf der Straße zu verbringen, war nicht eben reizvoll. Wenn er um diese Uhrzeit kein Hotelzimmer mehr bekam, würde er zum Bahnhof gehen und auf den ersten Zug warten.
Vor sich sah er das Eingangsportal des Francis aus Glas und Eisen, gegenüber den imposanten Bäumen und dem unschönen Obelisken auf dem Queen Square. Er war nur noch wenige Schritte von der Drehtür entfernt, als ein Polizeiwagen mit Blaulicht und quietschenden Reifen um die Ecke der Chapel Row bog und auf ihn zukam, gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung.
Auf der Südseite des Queen Square ist nichts, wo man sich verstecken könnte. Keine Sträßchen, keine Passagen oder Geschäftseingänge. Dort ist nur das Geländer vor dem Hotel. Diamond hatte nicht die Statur fürs Laufen oder Springen, und er hatte keine Lust, mit der Polizei auf den Fersen ins Hotel hineinzugehen, also trat er an die Bordsteinkante und wartete.
Der Streifenwagen hielt, jemand in Lederjacke und Jeans öffnete die Beifahrertür und stieg aus. Zunächst registrierte Diamond, daß es eine Frau war, dann erst, daß er sie kannte. Sein Namensgedächtnis war doch nicht so schlecht, wie er befürchtet hatte. Julie Hargreaves war, als sie sich zuletzt gesehen hatten, Sergeant bei der Kripo im Präsidium gewesen. Er hatte sie als fähige und zuverlässige Beamtin in bester Erinnerung.
Er fühlte sich entwaffnet, nahm eine entspanntere Haltung ein und grinste. »Na schön, auf frischer Tat ertappt. Ich leiste keinen Widerstand.«
Sie lächelte zurück. »Ich wäre jede Wette eingegangen, daß Sie zum Francis wollten.«
»Meine alte Stammkneipe.«
»Smithie sucht Sie im Pratt’s.«
»Man muß mich eben kennen«, erwiderte er. »Nehmen Sie mich jetzt in den Schwitzkasten, Julie?«
Sie sagte: »Müßte ich eigentlich. Sie sind der meistgesuchte Mann in Bath.«
Er spürte, daß sie vielleicht bereit war, mit ein paar Informationen herauszurücken, und sagte ernst: »Ich wünschte, irgend jemand würde mir sagen, warum. Mr. Tott scheint zu glauben, daß er noch immer das Recht hat, mich mitten in der Nacht aus dem Bett zu holen, mich hundertzwanzig Meilen mit dem Auto herbringen und vor seinen Thron schleifen zu lassen. Ich habe naiverweise angenommen, die Zeit der absoluten Herrscher sei vorbei.«
Sie sagte: »Entschuldigen Sie, Mr. Diamond. Wir haben hier eine echte Krise.«
»Das hat man mir schon gesagt.«
»Nicht Mr. Tott hat Sie holen lassen.«
»Nein, das stimmt«, räumte er ein. »Es war der große weiße Häuptling, Farr-Jones.«
»Mr. Tott hat in dieser Sache nicht die Fäden in der Hand. Er hat damit zu tun, aber nur als Opfer.«
»Als Opfer?«
»In gewisser Weise, ja. Genauer gesagt, nicht er ist das Opfer.« Zögernd sagte sie schließlich: »Aber seine Tochter.«
»Totts Tochter?«
»Hören Sie, vergessen Sie bitte, daß ich Ihnen das erzählt habe, ja?« Sie blickte über die Schulter zu dem Fahrer. Er sprach gerade ins Funkgerät, also fügte sie hinzu: »Sie wollen Sie selbst über alles informieren. Sie zählen auf Ihre Mitarbeit, absolut.«
»Was kann ich tun, was andere Leute nicht können?«
»Das müssen Sie sich von denen erzählen lassen, Mr. Diamond. Die ganze Sache ist streng geheim.«
Er verkniff sich die Frage: »Was für eine Sache?« Es wäre nicht fair, aus Julie Informationen herauszuholen, die er von offizieller Seite bekommen konnte. Er wußte, was zu tun war. Der Widerwillen, den er bei der Vorstellung verspürte, Tott gegenüberzutreten, war eine persönliche Angelegenheit. Er mußte entscheiden, was wichtiger war: seine Selbstachtung oder das, was der Tochter dieses Mannes widerfahren war, und die Tatsache, daß seine Mitarbeit aus irgendeinem unerfindlichen Grund unabdingbar war.
Julie sagte ohne Umschweife: »Kommen Sie zurück zur Manvers Street und hören sich an, was die Ihnen zu sagen haben?«
»Also gut, Officer. Sie haben gewonnen.«
Im Auto erzählte sie ihm, man habe sie im letzten November zum Inspector befördert. Er sagte, das sei auch an der Zeit gewesen. Und das meinte er ehrlich.
Fünf Minuten später, vor Widerwillen dem Brechreiz nahe, stand er Tott gegenüber, diesem Relikt aus jenen Tagen, da hohe Polizeibeamte von Generälen aus dem Ersten Weltkrieg nicht zu unterscheiden waren. Die anderen an dem ovalen Tisch waren Chief Inspector John Wigfull, Inspector Julie Hargreaves und Inspector Keith Halliwell. Der Empfang, der ihm bereitet wurde, war beängstigend freundlich. Tott stand auf, kam um den Tisch herum und sagte, wie tief sie in seiner Schuld ständen, weil er hergekommen sei. Er ergriff nicht nur Diamonds Hand mit seiner Rechten, sondern hielt mit der Linken dessen Ellbogen und drückte ihn wie ein übereifriger Seelsorger.
Halliwell neigte zur Begrüßung den Kopf und grinste liebenswürdig. Wigfull brachte die Art von Lächeln zustande, das sich ein Tennisspieler abringt, der das Wimbledon-Finale verloren hat.
Diamond bedachte sie alle mit einem Naserümpfen und einem starren Blick.
Tott wandte sich an Wigfull. »Sehen Sie doch bitte nach, wo der Kaffee bleibt, den wir bestellt haben.«
Wigfull lief rot an und verließ den Raum.
Kaum hatte sich die Tür geschlossen, da sagte Tott auch schon: »Mr. Diamond, das hier wird für niemanden von uns leicht. John Wigfull ist jetzt der ranghöchste Beamte und leitet das Revier.«
»Da ich nicht mehr dazugehöre, ist mir das völlig egal«, sagte Diamond.
Tott senkte den Kopf und faltete die Hände unter dem Kinn. Die Körpersprache eines reuigen Sünders. »Ich ... ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Es wäre erstaunlich, wenn Sie keinerlei Groll gegen mich hegten, aus Gründen, die wir hoffentlich heute nacht beiseite lassen können. Ich möchte Ihnen versichern, daß ich gewissermaßen ungebeten hergekommen bin. Aber ich dachte, daß ich hier sein sollte, wenn Sie eintreffen. Das bin ich Ihnen schuldig.«
»Mir? Wieso das?«
»Und meiner ... noch jemandem. Die Polizei von Avon und Somerset bittet Sie um Ihre Mitarbeit. Ich persönlich möchte an Sie appellieren – nein, verdammt – Sie inständig bitten, wohlwollend zuzuhören, und da wir nicht ganz so freundlich auseinandergegangen sind, als wir das letzte Mal in diesem Raum zusammen waren, so ist das mindeste, was ich tun kann ...«
»Schon verstanden, Mr. Tott«, sagte Diamond. »Ich habe damals gesagt, was ich empfunden habe. Ich habe nicht damit gerechnet, noch einmal hierher eingeladen zu werden, aber hier bin ich.«
»Danke.«
»Also, würde mir bitte jemand sagen, warum?«
Tott war überfordert. Seine Stimme zitterte. Er sagte: »Ich denke, ich überlasse das am besten Chief Inspector Wigfull. Er müßte jeden Moment wieder hier sein.«
Tott und Wigfull. Was für ein Team! Diamond konnte sich keine zwei Leute außerhalb eines Gefängnisses vorstellen, denen er lieber aus dem Weg gehen würde.
Ein Polizeischüler brachte Kaffee und Käse-Schinken-Sandwiches. Wigfull schlüpfte hinter ihm ins Zimmer und nahm wieder am Tisch Platz. Diamond registrierte hämisch, daß Wigfulls Beförderung zum Leiter der Mordkommission eine interessante Veränderung bewirkt hatte: sein Schnauzer war gestutzt. Jetzt sah er nicht mehr wie der smarte Kavalier, sondern eher wie der ehemalige Kapitän der englischen Kricket-Mannschaft aus.
»Wie ich höre, sollen Sie mich informieren, John.«
»Sofort.« Wigfull wartete, bis der Polizeischüler gegangen war. Nachdem sich die Tür wieder geschlossen hatte, warf er Tott einen Blick zu, aus Höflichkeit oder um sich bei ihm einzuschmeicheln, je nachdem, wie man es betrachtete, und erntete ein Nicken. »Wie Sie wissen, ist vor zehn Tagen, also am 4. Oktober, John Mountjoy aus Albany entflohen.«
»Sie sagen ›wie Sie wissen‹, aber ich weiß überhaupt nichts«, sagte Diamond.
Wigfull bedachte ihn mit einem ungläubigen Blick. »Es stand in allen Zeitungen.«
»Ich lese keine Zeitung. Ich bin ein freier Mann, John. Ich mache, was ich will.«