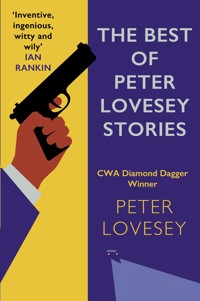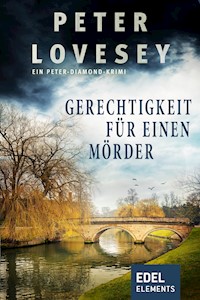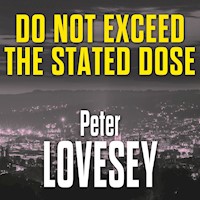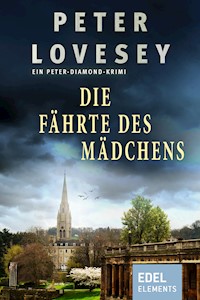
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter-Diamond-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Roman des vielfach preisgekrönten Krimiautors Peter Lovesey! Der liebenswerte Peter Diamond, brummiger Ex-Polizist, übergewichtig und übersensibel, macht sich auf, um auf eigene Faust gegen die Mafia und die korrupte und skrupellose Pharmaindustrie zu ermitteln... Zweiter Band der Peter-Diamond-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Peter Lovesey
Die Fährte des Mädchens
Ein Peter-Diamond-Krimi
Ins Deutsche übertragen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Copyright der Originalausgabe © 1992 by Peter Lovesey
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel DIAMOND SOLITAIRE
First published in Germany under the title DIE FÄHRTE DES MÄDCHENS by Piper Verlag
Übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Deutsche Übersetzung © Piper Verlag GmbH, München 1998
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
Kapitel eins
Der Alarm zerriß die Stille bei Harrods, ein durchdringender, anhaltender Ton. Lionel Kenton, der diensthabende Wachmann im Sicherheitskontrollraum, richtete sich auf seinem Stuhl auf. Seine Hände wanderten zum Hals und zogen den Knoten seiner Krawatte fest. Auf der Schalttafel vor ihm blinkte eine der Leuchtdioden rot. Falls das System ordnungsgemäß funktionierte, hatte irgend jemand – oder irgend etwas – einen Sensor im siebten Stock ausgelöst. Er drückte den Knopf, der die Videoüberwachung für dieses Stockwerk aktivierte. Auf den Bildschirmen war nichts zu sehen.
Kenton war in dieser Nacht der ranghöchste Wachmann. Sein Rang war so hoch, daß er sogar ein eigenes Regalbrett über dem Heizkörper hatte. Darauf standen gerahmte Fotos von seiner Frau, seinen beiden Töchtern, dem Papst und Catherine Deneuve, ein Elefant aus Ebenholz und ein Kassettenhalter mit Opernaufnahmen. Puccini hielt ihn nachts wach, das sagte er jedem Banausen, der Bedenken gegen Opernmusik im Kontrollraum hatte. Nessun dorma. Musikhören war weniger unverantwortlich, als die Zeitung oder ein Taschenbuch zu lesen. Seine Augen ruhten auf der Schalttafel, und seine Ohren nahmen jedes Geräusch wahr, das nicht mit der Musik harmonierte.
Er brachte Pavarotti zum Schweigen und betätigte den Knopf, der ihn direkt mit dem Polizeirevier Knightsbridge verband. Dort mußten sie den Alarm bereits elektronisch empfangen haben. Er nannte seinen Namen und sagte: »Bewegungsmelderalarm. Ich kriege ein Signal aus dem siebten Stock. Möbel. Abteilung neun. Nichts auf dem Bildschirm.«
»Meldung um 22.47 eingegangen.«
»Kommt jemand?«
»Das ist Vorschrift.«
Natürlich war es das. Er verriet Anzeichen von Nervosität. Er verschaffte sich einen erneuten Überblick über den siebten Stock. Nichts Ungewöhnliches zu sehen, aber er hatte ohnehin nicht viel Vertrauen zu der Videoüberwachung. Jeder Terrorist weiß, wie er sich aus dem Kamerabereich heraushält.
Und er mußte annehmen, daß da oben ein Terrorist war.
Zweiundzwanzig Sicherheitsleute im Nachtdienst waren im gesamten Kaufhaus postiert. Er löste Generalalarm aus und ließ ein zweites Mal kontrollieren, daß auch wirklich alle Fahrstühle ausgeschaltet waren. Die Sicherheitstüren zwischen den Abteilungen waren bereits geschlossen, seit die Putzkolonne gegangen war. Bei der Terrorismusbekämpfung durfte man zwar nichts ausschließen, aber es war wirklich unmöglich, bei Harrods einzubrechen. Der Eindringling – falls einer da oben war – mußte sich versteckt haben, als das Kaufhaus geschlossen wurde. Falls dem so war, würde wohl jemand seinen Job verlieren, und zwar derjenige, der Abteilung neun hätte überprüfen müssen. In dieser Branche durfte man sich keinen Fehler erlauben.
Sein Stellvertreter in dieser Nacht, George Bullen, kam hereingestürmt. Er war auf Rundgang gewesen, als der Alarm losging.
»Wo kommt es her?«
»Siebter.«
»Wo auch sonst.«
Die Möbelabteilung war ein Risikobereich, die Kontrollen dort eine Tortur. Garderoben, Schränke, Kommoden und alle möglichen Einbauelemente. Die abendliche Suche nach Bomben war eine ermüdende Aufgabe. Es war verständlich – wenn auch keineswegs verzeihlich –, daß der zuständige Wachmann dort es derart leid war, in Schubladen zu gucken und Schränke zu öffnen, daß er jemanden, der sich hinter den verdammten Dingern versteckt hielt, übersehen hatte.
Ein weiteres Lämpchen auf der Bedienungstafel leuchtete auf, und einer der Monitore zeigte Autoscheinwerfer, die in die Lieferanteneinfahrt einbogen. Die Polizei reagierte tadellos. Kenton wies George Bullen an, alles im Auge zu behalten, und ging nach unten, um sie in Empfang zu nehmen.
Schon drei Streifen- und zwei Mannschaftswagen. Scharfschützen und Hundeführer stiegen aus. Noch mehr Autos fuhren vor, und ihre zuckenden Blaulichter verliehen der Lieferanteneinfahrt einen unheimlichen blauen Schein. Kenton spürte ein Rumoren im Bauch. Die Polizei würde ihn bestimmt nicht zum Wachmann des Jahres wählen, wenn der Alarm durch einen Fehler im System ausgelöst worden war.
Aus einem der Wagen stieg ein Beamter in Zivil und kam auf ihn zu. »Sie sind?«
»Kenton.«
»Sind Sie hier der Chef?«
Er nickte.
»Haben Sie uns angerufen?«
Er bejahte, und sein Magen krampfte sich zusammen.
»Siebter Stock?«
»Möbelabteilung.«
»Zugänge?«
»Zwei Treppen.«
»Nur zwei?«
»Ansonsten ist der Bereich durch Sicherheitstüren abgeschirmt.«
»Keine Aufzüge?«
»Abgeschaltet.«
»Sind Ihre Leute auf den Treppen?«
»Ja. Das ist Routine. Sie bewachen die Treppen ober- und unterhalb von Ebene sieben.«
»Dann zeigen Sie uns mal den Weg.«
Gut dreißig uniformierte Polizisten, Hundeführer und Beamte in Zivil, etliche davon bewaffnet, folgten ihm, als er durch das Erdgeschoß zur ersten Treppe lief. Eine Gruppe von zirka zwölf scherte aus und hetzte diese Treppe hinauf, während er die übrigen zu der anderen führte.
Sieben Stockwerke hochzusteigen, war für Lionel Kenton ein Fitneßtest. Er war froh, als man ihm nach sechseinhalb sagte, er solle stehenbleiben, und noch froher, als er sah, daß seine Sicherheitsleute auf dem Posten waren, wie er behauptet hatte. Nun hatte er Gelegenheit, seine Atmung zu normalisieren, während zu der Gruppe auf der anderen Treppe Funkkontakt hergestellt wurde.
»Wie sieht’s da drin aus?«
Die Scharfschützen wollten vor allem wissen, mit wieviel Deckung sie rechnen konnten. Einer aus Kentons Mannschaft, ein stämmiger Exkripobeamter namens Diamond, zählte rasch die Möbel auf, die der Treppe am nächsten standen. Peter Diamond war der Mann, der heute nacht für diese Abteilung zuständig war. Armes Schwein, dachte Kenton. Du siehst noch kränker aus, als ich mich fühle.
Drei Scharfschützen gingen die letzten Stufen hinauf. Andere bezogen Posten auf der Treppe. Der Rest zog sich auf den unteren Absatz zurück.
Das war das Schlimmste – auf das Unbekannte warten, während andere loszogen, um damit fertigzuwerden. Jemand bot Kenton ein Kaugummi an, und er nahm es dankbar.
Es vergingen vielleicht sechs nervenaufreibende Minuten, ehe das Funkgerät des ranghöchsten Polizisten knackte und eine Stimme meldete: »Bis jetzt negativ.«
Zur Unterstützung wurden zwei Hunde mit ihren Führern reingeschickt.
Wieder trat eine lange Stille ein.
Wachmann Diamönd stand gleich links von Kenton. Er hielt die Hände gefaltet und die Finger verschränkt wie zum Gebet, nur daß die Fingernägel vom Druck ganz weiß waren.
Der letzte Rest von Kentons Zuversicht war im Schwinden begriffen, als jemand über die kratzige Sprechanlage verkündete: »Wir haben euren Eindringling.«
»In Gewahrsam?« fragte der Vorgesetzte.
»Kommt gucken.«
»Seid ihr sicher, daß es bloß einer ist?«
»Positiv.«
Der Ton war beruhigend. Seltsam, als ob die Spannung plötzlich verflogen wäre. Polizisten und Wachmänner liefen die Treppe hinauf.
Der siebte Stock war hell erleuchtet. Die Scharfschützen standen in einer Ecke zusammen, wo Sessel und Zweisitzer ausgestellt waren. Aber sie wirkten nicht mehr wie Revolverhelden. Sie lungerten herum wie auf einer Stehparty. Zwei hatten sich auf Sessellehnen niedergelassen. Von einem Festgenommenen war nichts zu sehen.
Kenton war plötzlich in kaltem Schweiß gebadet, als er mit den anderen näher kam. »Aber ihr habt doch gesagt, ihr hättet jemanden gefunden?«
Einer deutete mit einem Blick nach unten auf ein Sofa.
Es war so ein riesiges, schwarzes Kordding, wie man es im Vorzimmer eines Werbefritzen erwarten würde. An einem Ende lag ein Haufen leuchtendbunter Zierkissen. Das Gesicht, das unter den Kissen hervorschaute, gehörte einem kleinen Mädchen, die Haare schwarz und gefranst, asiatisch geformte Augen. Sonst war nichts von ihm zu sehen.
Kenton starrte es verwirrt an.
»Ach so«, sagte der ranghöchste Polizist.
Kapitel zwei
»Sie schmeißen mich raus.« Peter Diamond, der Wachmann, der in jener Nacht, als das Kind entdeckt wurde, für Abteilung neun zuständig war, sprach ohne Groll. »Ich weiß, wie es steht.«
Es stand sehr schlecht für ihn. Er war nicht jung. Achtundvierzig, stand in seiner Akte. Verheiratet. Wohnhaft in West Kensington. Keine Kinder. Expolizist. Hatte es bis zum Detective Superintendent gebracht und dann wegen eines Streites mit dem stellvertretenden Chief Constable seinen Dienst bei der Polizei von Avon und Somerset quittiert. Ein Mißverständnis, hatte jemand gesagt, jemand, der jemanden kannte. Diamond war zu stolz gewesen, um seine Wiedereinstellung zu bitten. Nachdem er bei der Polizei aufgehört hatte, hatte er eine Reihe von Teilzeitjobs angenommen und war schließlich nach London gezogen, wo er bei Harrods anfing.
»Ich sollte das nicht sagen, Peter«, sagte der Leiter des Sicherheitsdienstes zu ihm, »aber Sie haben wirklich verfluchtes Pech. Bislang waren ihre Leistungen beispielhaft. Sie hätten Aussicht auf eine Beförderung gehabt.«
»Regeln sind nun mal Regeln.«
»Leider ja. Wir werden Ihnen ein vorzügliches Zeugnis ausstellen, aber, äh ...«
»... es gibt so gut wie keine Jobs in der Sicherheitsbranche, stimmt’s?« sagte Diamond. Er war unergründlich. Dicke Menschen – und er war dick – haben oft Gesichter, die sie so wirken lassen, als würden sie gleich wütend oder wären amüsiert. Es kam darauf an, richtig zu tippen.
Der Leiter des Sicherheitsdienstes hatte keine Scheu, sich seine Befangenheit anmerken zu lassen. Er schüttelte den Kopf und breitete hilflos die Hände aus. »Glauben Sie mir, Peter, diese ganze Geschichte geht mir selbst an die Nieren.«
»Das können Sie sich sparen.«
»Ehrlich. Ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich die Kleine entdeckt hätte. Unter den Kissen war sie praktisch unsichtbar.«
»Ich hab’ die Kissen hochgehoben«, gab Diamond zu.
»Ach?«
»Als ich meine Runde gemacht habe, war sie nicht auf dem Sofa. Ich habe da hundertprozentig nachgesehen. Wie immer. Es ist ein Platz, der sich gut als Bombenversteck eignet. Das Kind muß irgendwo anders gewesen sein und ist später da drunter gekrochen.«
»Wie können Sie sie dann übersehen haben?«
»Ich glaube, ich habe sie für das Kind von einer der Putzfrauen gehalten. Sie bringen manchmal ihre Kinder mit. Einige von ihnen sind Vietnamesinnen.«
»Sie ist Japanerin, glaube ich.«
Diamond wurde jäh aus seiner niedergeschlagenen Stimmung gerissen. »Sie glauben? Hat sich denn keiner gemeldet, der sie sucht?«
»Noch nicht.«
»Kann sie ihren Namen nicht nennen?«
»Sie hat noch kein Wort gesprochen, seit sie gefunden wurde. Drüben im Polizeirevier haben sie den ganzen Tag über versucht, mit einer Reihe von Dolmetschern etwas aus ihr herauszulocken. Nicht eine Silbe.«
»Sie ist doch nicht stumm, oder?«
»Scheint nicht so, aber sie sagt nichts Verständliches. Das Kind zeigt so gut wie keine Reaktion.«
»Taub?«
»Nein. Sie reagiert auf Geräusche. Es ist rätselhaft.«
»Das Fernsehen muß was über sie bringen. Irgend jemand wird sie schon kennen. Ein Kind, das nachts bei Harrods gefunden wird – auf solche Geschichten stehen die Medien.«
»Zweifellos.«
»Sie klingen nicht sehr überzeugt.«
»Ich bin überzeugt, Peter, absolut überzeugt. Aber es gibt noch andere Dinge zu berücksichtigen, nicht zuletzt unseren Ruf. Ich lege keinen besonderen Wert darauf, daß die ganze Nation erfährt, daß ein kleines Mädchen all unsere Sicherheitsvorkehrungen unterlaufen konnte. Falls die Presse an Sie herantritt, wäre ich dankbar, wenn Sie keine Stellungnahme abgeben würden.«
»Über die Sicherheitsvorkehrungen? Natürlich nicht.«
»Danke.«
»Aber Sie können die Polizei nicht zum Schweigen zwingen. Die haben kein Interesse daran, die Geschichte vertraulich zu behandeln. Irgendwie wird es an die Öffentlichkeit gelangen, und zwar bald.«
Ein Seufzer vom Leiter des Sicherheitsdienstes, gefolgt von unbehaglichem Schweigen.
»Also, wann soll ich meinen Spind räumen?« fragte Diamond. »Jetzt gleich?«
Kapitel drei
Der Pater blickte in die vertrauensvollen Augen der Witwe und erklärte hastig: »Das ist doch nicht das Ende der Welt.«
Die tröstenden Worte wurden an einem schönen Sommerabend im Wohnzimmer eines Landhauses in der Lombardei, zwischen Mailand und Cremona, gesprochen. Seelsorge nannte Pater Faustini das. Fürsorge für die Trauernden, die heilige Pflicht eines Geistlichen. Zugegeben, in diesem Fall dauerte die Fürsorge länger als üblich, bereits zwei Jahre, um genau zu sein. Aber Claudia Coppi, durch ein grausames Schicksal mit achtundzwanzig Jahren Witwe geworden, war ein ungewöhnlicher Fall.
Giovanni, ihr Gatte, war durch einen absurden Unglücksfall getötet worden, auf dem Fußballplatz vom Blitz erschlagen. »Wieso mußte es denn ausgerechnet mein Mann sein, wo doch noch einundzwanzig andere Spieler, ein Schiedsrichter und zwei Linienrichter dabei waren?« wollte Claudia jedesmal vom Pater wissen, wenn er sie besuchen kam. »Ist das der Wille des Herrn? Von all diesen Männern, warum ausgerechnet mein Giovanni?«
Pater Faustini erinnerte Claudia stets daran, daß die Wege des Herrn unergründlich sind. Sie blickte ihn stets vertrauensvoll aus ihren großen, dunklen, ausdrucksvollen Augen an (sie hatte als Mannequin gearbeitet), und er mahnte sie stets, daß es ein Fehler sei, über die Vergangenheit nachzugrübeln.
Der Geistliche und die junge Witwe saßen auf einem Polsterkissen auf dem Fußboden. Wie üblich hatte Claudia gastfreundlich eine Flasche Barolo entkorkt, einen vollmundigen Jahrgang aus Mascarello, und es gab Käsecracker zu knabbern. Die Sonne war gerade eben untergegangen, aber es wäre jammerschade gewesen, an einem solchen Abend das Licht einzuschalten. Durch die offenen Terrassentüren trug die kühler werdende Luft schweren Levkojenduft herein. Die Villa hatte einen schönen, durch ein Sprinklersystem bewässerten Garten. Giovanni, gut bei Kasse – er war als Modefotograf überaus erfolgreich gewesen –, hatte eigens einen Landschaftsarchitekten engagiert. Für Pater Faustini bedeutete die einsame Lage der Villa eine Fahrt von fast fünf Kilometern auf seinem Moped, aber er beklagte sich nie. Er war vierzig und bei bester Gesundheit. Ein robuster Mann mit dichten, schwarzen Locken und prächtigem Schnurrbart.
»Es scheint Ihnen schon sehr viel besser zu gehen«, bemerkte er zur Witwe Coppi.
»Alles nur Fassade, Pater. Innerlich bin ich noch immer sehr angespannt.«
»Wirklich?« Er runzelte die Stirn, aber nur zum Teil aus Sorge, daß sie unter Anspannung stand. Gut, daß der Raum inzwischen so dämmrig geworden war, daß seine Beunruhigung ihr nicht gleich ins Auge springen konnte.
»Das übliche Problem«, sagte sie. »Streß. Der sich auf die Muskulatur schlägt. Ich spüre es in den Schultern, genau hier oben.«
»Wie neulich?«
»Wie neulich.«
Sie schwiegen beide. Auch Pater Faustini empfand jetzt eine gewisse Anspannung.
Claudia sagte: »Letzte Woche haben Sie meine Muskeln wirklich schön lockern können.«
»Wirklich?« sagte er geistesabwesend.
»Es war wie ein Wunder.«
Er räusperte sich, unglücklich über ihre Wortwahl.
Sie korrigierte sich: »Ich meine, es war herrlich. Ach, was für eine Wohltat! Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wieviel besser es mir danach ging.«
»Hat es angehalten?«
»Ein paar Tage, Pater.« Während er darüber nachdachte, fügte sie kläglich hinzu: »Es gibt doch sonst niemanden, den ich darum bitten könnte.«
Es klang wie ein Flehen um christliche Nächstenliebe. Mitunter erledigte Pater Faustini für ältere Mitglieder seiner Gemeinde Einkäufe. Häufig besorgte er ihnen Medizin gegen ihre Leiden. Man wußte, daß er für arme Seelen in Bedrängnis schon Holz gehackt und Suppe gekocht hatte, warum also sollte er Claudia Coppi nicht die schmerzenden Schultern massieren? Nur weil es ihn selbst in Konflikte stürzte? War es richtig, ihr wegen seiner moralischen und geistigen Schwäche den christlichen Beistand zu versagen?
Schon an den letzten beiden Freitagen hatte er ihr diesen Dienst erwiesen. Liebend gern hätte er statt dessen Holz für sie gehackt, aber die Villa hatte eine Ölheizung. Mit Feuereifer wäre er für sie einkaufen gegangen, doch sie wurde zweimal wöchentlich vom besten Supermarkt in Cremona beliefert. Sie hatte einen Gärtner, eine Köchin und eine Putzfrau. Der einzige praktische Dienst, den Pater Faustini Claudia Coppi erweisen konnte, war also der, um den sie ihn jetzt bat. Die arme junge Frau konnte sich nicht selbst die Schultern massieren. Nicht gut genug, um die verspannte Muskulatur zu lockern.
Und da war noch etwas, das ihn zögern ließ. Einmal die Woche nahm er Claudia Coppi in der Kirche die Beichte ab, und in letzter Zeit – er war nicht sicher, wie oft, und er wollte auch keine Berechnungen anstellen – hatte sie gebeichtet, unreine Gedanken oder fleischliche Gelüste zu haben, jedenfalls so ähnlich hatte sie sich ausgedrückt. Es war nicht seine Art, im Beichtstuhl nach weiteren Details zu fragen, wenn die Art der Sünde bereits feststand, daher wußte er nicht, ob es da einen Zusammenhang mit seinen Besuchen in der Villa gab.
»Ich habe etwas besorgt, das Sie einmassieren könnten, wenn Sie so lieb wären«, sagte sie.
Er hüstelte nervös und schlug die Beine übereinander. Das war etwas Neues. »Ein Mittel zum Einreiben?« erkundigte er sich, redlich bemüht, an nichts als die reine Muskelbehandlung zu denken und sich des penetranten Geruchs einer bestimmten Sorte zu erinnern, die von Fußballspielern bevorzugt wurde. Das Zeug trieb einem Tränen in die Augen.
»Eigentlich eher eine Feuchtigkeitscreme. Das ist besser für meine Haut. Ganz weich. Probieren Sie mal.« Sie streckte den Arm aus und schmierte etwas auf seinen Handrücken.
Er wischte es sofort ab. »Das ist parfümiert.«
»Eine Spur Moschus«, gab sie zu. »Würden Sie bitte den Topf halten, ich ziehe nur schnell meine Bluse aus.«
»Das wird nicht nötig sein«, sagte er rasch.
»Pater, die ist aus Seide. Sie bekommt sonst Flecken.«
»Nein, nein, signora, bitte bedecken Sie sich.«
»Aber ich hab’ sie doch noch nicht mal aufgeknöpft.« Sie lachte und fügte hinzu: »Ist es schon so dunkel?«
»Ich habe nicht hingeschaut«, sagte er.
»Schon gut. Ich habe Ihnen sowieso den Rücken zugedreht.«
Während sie noch sprach, hörte er, wie die Bluse von ihren Schultern glitt. Jetzt steckte er richtig in der Klemme. Sie klang so sachlich, so unbekümmert. Wenn er widersprach, könnte es sein, daß er die ganze Situation zu einer moralischen Krise aufblähte. Es könnte so aussehen, als ließe er sich von Dingen beeinflussen, die sie im Beichtstuhl gesagt hatte.
»Nicht zuviel auf einmal«, warnte sie. »Ein wenig reicht.«
Er unterdrückte seine Zweifel, tauchte einen Finger hinein und verteilte die Creme in der Handfläche.
Claudia hatte ihm tatsächlich den Rücken zugewandt. Er streckte die Hand aus und tupfte ein wenig von der Feuchtigkeitscreme auf ihren Nacken.
Sie sagte: »Ach je, die Träger werden sie stören.«
»Ganz und gar nicht«, widersprach Pater Faustini, doch die BH-Träger wurden trotzdem beiseite geschoben.
Bei seinen früheren Besuchen hatte Claudia ihn überredet, sie ohne Creme durch ihr T-Shirt hindurch zu massieren. Das hier war eine neue Erfahrung. Der Kontakt mit ihrer Haut wühlte ihn mehr auf, als er sich eingestehen mochte. Er strich über ihre sanft geschwungenen Schultern, spürte die Wärme unter seinen Fingern. Diese Weichheit war wie eine Offenbarung. Als seine Hände die runde Wölbung ihrer Schultern umschlossen, mußte er innehalten.
Sie seufzte und sagte: »Himmlisch.«
Einen Augenblick später hatte er sich wieder soweit unter Kontrolle, daß er weitermachen konnte. Er verteilte die Feuchtigkeitscreme großzügig auf den Schulterblättern und entlang des Rückgrats hinauf bis zum Hals. Sie hielt den Kopf gesenkt, so daß ihr langes, dunkelbraunes Haar nach vorn hing. Er widmete den Deltamuskeln einige Aufmerksamkeit, sanft die Form jedes einzelnen abtastend. Obwohl Claudia gesagt hatte, sie sei verspannt, fand er, daß sich alles recht geschmeidig anfühlte, aber er war ja schließlich kein Physiotherapeut.
»Sagen Sie, wenn es Ihnen unangenehm ist«, sagte er.
»Ganz im Gegenteil«, murmelte sie. »Sie haben einfach wunderbare Hände.«
Er übte weiterhin leichten Druck auf ihren Halsansatz aus, bis sie plötzlich den Kopf hob und ihr Haar nach hinten warf.
»Genug?« erkundigte er sich hoffnungsvoll. Das Gefühl, wie ihr Haar über seinen Handrücken glitt, hatte bei ihm eine körperliche Empfindung ausgelöst, die sich nicht mit seinem geistlichen Stand vertrug.
Aber Claudia Coppi war noch nicht zufrieden. Sie erklärte, ihre Oberarme seien noch immer verspannt.
»Hier?«
»Ja. Oh ja, genau da. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich gegen Sie lehne, Pater? Es ist bequemer so.« Sie wartete gar nicht erst auf seine Antwort.
Ihr Hinterkopf lag auf seiner Brust, ihr Haar berührte seine Wange, und mit derselben Bewegung legte sie ihre Hände auf seine und hielt sie fest. Dann schob sie sie nach unten.
Er hatte noch gar nicht bemerkt, daß sie ihre Brüste vollständig entblößt hatte. Sie führte seine Hände dorthin. Erlesen schöne, streng verbotene Brüste boten sich ihm dar, sie zu erkunden. Für einige wenige unvergeßliche Augenblicke der Sünde nahm Pater Faustini das Angebot an. Er hielt Claudia Coppis verbotene Früchte, glitt mit den Händen über sie, unter sie und um sie herum, ergötzte sich an ihrer Fülle und ihrem nicht zu leugnenden Zustand der Erregung.
Ein lasterhaftes Ungeheuer.
Im verzweifelten Bemühen, seine fleischlichen Gedanken zu bannen, stieß er die Worte aus: »Führe uns nicht in Versuchung« und zog die Hände zurück, als hätte er sich verbrannt.
Von Scham erfüllt stand er augenblicklich auf und schritt entschlossen durch die Terrassentür hinaus und um das Haus herum, ohne sich umzusehen. Er reagierte nicht, als Claudia Coppi rief: »Sehe ich Sie nächsten Samstag?« Er wußte, er mußte fort von diesem Ort.
Er meinte zu hören, daß sie hinter ihm herkam, vermutlich noch immer im Oben-ohne-Zustand. So schnell er nur konnte, schob er sein Moped hinaus auf die Straße, warf es an und brauste davon.
»Du zuchtloser Narr«, haderte er mit sich selbst über das Knattern des Motors hinweg. »Du willensschwacher, verkommener, lüsterner, widerwärtiger, erbärmlicher, sexbesessener Kerl. Du elender Sünder.«
Die kleinen Räder trugen ihn gleichmäßig dahin, der Scheinwerfer erhellte die Straße vor ihm, aber er nahm kaum wahr, daß er sich fortbewegte. Seine Gedanken kreisten einzig und allein um sein lasterhaftes Verhalten. Ein Mann Gottes, ein Geistlicher, der sich benommen hatte wie ein Tier, nur schlimmer, weil er mit einem Geist gesegnet war, der ihn eigentlich dazu befähigen sollte, die niederen Instinkte zu überwinden.
Wie soll ich das am Tag des Jüngsten Gerichts rechtfertigen, fragte er sich. Gott sei mir armem Sünder gnädig.
Es ist unmöglich zu sagen, wann genau er während der Fahrt bemerkte, daß da vor ihm etwas war. Bestimmt war er schon einige Zeit unterwegs, ehe er imstande war, etwas anderes wahrzunehmen als die Qualen seiner gemarterten Seele. Es mußte etwas Spektakuläres sein, und das war es auch. Pater Faustini starrte geradeaus und sah eine Feuersäule.
Der Nachthimmel über der lombardischen Ebene wurde von Hunderten lodernden Punkten glitzernd hell erleuchtet. Ihr Ursprung war eine Feuersäule, die in ungefähr drei Kilometern Entfernung hoch über dem Land aufragte. Mit Sicherheit war das kein natürliches Feuer, denn es brannte eher grün als orange, hellsmaragdgrün, mit violetten, blauen und gelben Blitzen, die nach außen zuckten. Pater Faustini wurde von der Gewißheit gepackt, daß der Tag des Gerichts da war. Andernfalls wäre ihm vielleicht der Verdacht gekommen, daß dem Barolo, den er getrunken hatte, irgend etwas beigemengt worden war, denn das, was er da sah, war in seiner ungewöhnlichen Farbkombination ausgesprochen psychedelisch. Er hatte schon große Feuer gesehen und gigantische Feuerwerke, aber nichts davon reichte auch nur annähernd an das hier heran.
Was sonst hätte ein elender Sünder am Jüngsten Tage tun können, als auf die Bremse treten, absteigen, auf die Knie fallen und um Vergebung beten? Er fühlte sich gleichzeitig von Panik erfüllt und von Reue geschüttelt, weil all dies just an dem Abend geschah, an dem er der Sünde anheimgefallen war, nach einem untadeligen (oder praktisch untadeligen) Leben im Dienst der Kirche. Er kniete sich auf das Gras am Straßenrand, die Hände vor dem schmerzverzerrten Gesicht gefaltet, und schrie: »Vergib mir Vater, denn ich habe gesündigt.«
Er konnte die Möglichkeit nicht ausschließen, daß sein Fehltritt mit Claudia Coppi unmittelbar für das jetzige Geschehen verantwortlich war. Anzunehmen, daß seine nur wenige Sekunden währenden Liebkosungen zweier schöner Brüste das Ende der Welt beschleunigt hatten, war vielleicht anmaßend, aber er hatte nun mal ein unheilvolles Gefühl von Ursache und Wirkung.
Durch seine gefaltete Händen hindurch riskierte er erneut einen Blick. Der Zustand des Himmels war unverändert furchteinflößend. Feuerstrahlen zischten wie Raketen nach oben und hinterließen funkensprühende Spuren.
Bis jetzt waren noch keine Racheengel zu sehen, auch kein anderes apokalyptisches Zeichen. Er hörte keine Trompeten, aber jetzt würde ihn ohnehin nichts mehr erstaunen.
Statt dessen sah er zwei helle Lichter, so grell, daß ihm die Augen weh taten. Und zugleich hörte er ein dumpfes Dröhnen, das lauter wurde. Die Quelle dessen war keineswegs übernatürlich. Ein Wagen kam mit aufgeblendeten Scheinwerfern aus der Richtung der Feuersäule über die Straße auf ihn zugerast. Pater Faustini konnte verstehen, daß Menschen vor dem drohenden Zorn Gottes flohen, aber er wußte, daß sie sich etwas vormachten. Es gab kein Entkommen.
Und so war es auch.
Das Motorengeräusch wurde immer lauter und die Lichter immer heller. Normalerweise hätte Pater Faustini gewinkt, um dem Fahrer zu signalisieren, daß er geblendet wurde. Aber er saß ja nicht auf seinem Moped. Er lag auf den Knien am Straßenrand. Er hatte sein Moped beim ersten Anblick der Feuersäule stehenlassen. Genau dort, wo er angehalten hatte, mitten auf der schmalen Straße.
Der Wagen raste darauf zu.
Er schlug die Hände vors Gesicht.
Es war einfach keine Zeit mehr, das Moped von der Straße zu holen. Er konnte nur hoffen, daß der Fahrer das Hindernis rechtzeitig bemerken und umfahren würde. Es mochte eine akademische Frage sein, ob ein Unfall – selbst ein tödlicher – in diesem finalen Stadium der Weltgeschichte noch eine Rolle spielte, doch Pater Faustini war immer ein auf Sicherheit bedachter Mensch gewesen, und der Gedanke, für den Tod eines anderen verantwortlich zu sein, war ihm unerträglich.
Tatsächlich traf den Fahrer des Wagens eine Mitschuld, denn seine Geschwindigkeit war deutlich überhöht.
Was dann geschah, war rasch und verheerend, doch Pater Faustini sah es in der seltsamen Zeitlupe, in die das Gehirn umschaltet, damit es auf Gefahren bei hoher Geschwindigkeit reagieren kann. Der Wagen schoß auf das Moped zu, ohne seine Fahrt zu verlangsamen, bis zum letzten Sekundenbruchteil, als der Fahrer wohl gesehen hatte, was da vor ihm war. Das Rutschen der Reifen auf der Straßendecke, als die Bremse durchgetreten wurde, machte ein Geräusch wie eine aufheulende Sirene. Der Wagen schwenkte nach links, um dem Moped auszuweichen, und es gelang ihm auch. Doch er prallte gegen den Bordstein, geriet außer Kontrolle und schleuderte auf die andere Seite. Pater Faustini sah, daß es eine große, PSstrarke Limousine war. Die weißen Lichter der Scheinwerfer verschwanden aus seinem Blickfeld und verwandelten sich in intensives Rot, als der Wagen mit hell leuchtenden Bremslichtern vorbeischlitterte. Er schoß über den Bordstein und eine Grasböschung hinauf, hinter der ein Feld lag. Die Rücklichter stiegen plötzlich hoch und beschrieben einen Bogen. Der Wagen überschlug sich – nicht einmal, sondern dreimal, und tonnenschweres Metall wirbelte umher wie Kinderspielzeug, krachte durch einen Zaun und rutschte schließlich auf dem Dach über die gepflügte Erde.
Eines der Rücklichter brannte noch. Dann erlosch es funkensprühend. Rauch stieg aus dem Wrack.
Pater Faustinis Beine fühlten sich etwa so standfest an wie frischgekochte Pasta, aber er taumelte hinüber, um nachzusehen, ob er jemanden aus dem Wagen ziehen konnte, bevor das ganze Ding Feuer fing.
Das Gewicht des Chassis hatte den Aufbau zusammengedrückt. Der Pater kniete sich neben den zusammengepreßten Schlitz, der einmal das Fenster auf der Fahrerseite gewesen war. Drinnen war ein Mann, der Kopf in einem unmöglichen Winkel abgeknickt. Zu spät für die letzte Ölung. Auf der anderen Seite lag der Beifahrer halb am Boden. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die andere Hälfte, von der Hüfte abwärts, war noch im Wagen. Die beiden Hälften waren an der Taille durchtrennt.
Der Pater bekreuzigte sich. Eine Welle der Übelkeit stieg in ihm hoch, aber er durfte jetzt nicht die Beherrschung verlieren, denn die Luft roch nach Benzin, und das ganze Wrack konnte sich in wenigen Sekunden in einen Feuerball verwandeln. Aus Sorge, daß noch jemand lebendig dort drinnen gefangen sein konnte, legte er sich auf den Bauch, um einen Blick auf den Rücksitz zu werfen. Es war unnütz. Zwischen der zerfetzten Polsterung und dem eingedrückten Dach war auch nicht ein Zentimeter Luft.
Als er gerade aufstehen wollte, setzte irgendwo rechts von ihm ein Geräusch ein wie das Brausen des gewaltigen Windes beim Pfingstwunder. Das Benzin hatte sich entzündet.
Er sprang auf und rannte weg. Hinter ihm krachte es einige Male, dann kam ein gewaltiger Knall, vermutlich der explodierende Benzintank. Doch inzwischen war Pater Faustini schon zwanzig Meter weiter und lag flach am Boden.
Eine Weile rührte er sich nicht. Seine Nerven verkrafteten einfach nicht mehr. Er schluchzte sogar ein wenig. Es dauerte eine Zeitlang, bis er daran dachte, ein Gebet zu sprechen. In seinem aufgewühlten Kopf hatte der Autounfall das Jüngste Gericht noch übertrumpft.
Endlich setzte er sich auf. Das Autowrack brannte noch, aber das Schlimmste war vorbei. Öliger, schwarzer Qualm breitete sich aus, und der Gestank von brennendem Gummi brannte ihm in Kehle und Nase. Er starrte in die Flammen. Die verkohlten, verbogenen Metallreste hatten kaum noch Ähnlichkeit mit einem Wagen.
Jeder Muskel seines Körpers zitterte. Mühsam kam er auf die Beine und ging an dem brennenden Wrack vorbei zu seinem Moped, das noch immer unversehrt mitten auf der Straße stand, ein Beweis für seine Dummheit und seine Schuld an der Tragödie.
In der Ferne wurde der Nachthimmel noch immer von der riesigen Feuersäule zerrissen, die ihn so aus der Fassung gebracht hatte. Noch immer waren die Farben überirdisch bunt und strahlend. Trotzdem drängte sich Pater Faustini die Frage auf, ob wirklich der Tag des Jüngsten Gerichts gekommen war. Der Schock des Autounfalls hatte seine Wahrnehmung verändert. Das Phänomen war ihm unerklärlich. Es mußte einen Grund dafür geben, aber er hatte nicht mehr die Kraft, darüber nachzudenken.
Kapitel vier
Eine Samstagabendvorstellung in der Metropolitan Opera in New York. Domingo und Freni in Höchstform vor einem vollbesetzten, gebannt lauschenden Haus. Die Begräbnisszene näherte sich ihrem Höhepunkt. Vereint in Verdis zu Tränen rührendem »O terra addio« umarmte sich das tragische Liebespaar Radames und Aida, während sich die schweren Steinplatten, unter denen sie lebendig begraben wurden, qualvoll langsam herabsenkten. Hinter der Bühne sangen die Priester und Priesterinnen ihren unbarmherzigen Chor, und die unglückliche Amneris betete für Radames’ unsterbliche Seele. Es gibt Augenblicke in einer Oper, da stört es niemanden, wenn einige in ihren Sitzen hin und her zappeln, um einen besseren Blick auf die Bühne zu haben oder um ihrem schmerzenden Gesäß etwas Linderung zu verschaffen. Aber wenn Aida ihr ergreifendes Finale erreicht, wenn die Sklavin in Radames’ Armen ihr Leben aushaucht, dann ist die Stille im Publikum mit Händen greifbar, von den Orchestersesseln bis hinauf zum sechsten Rang.
So sollte es zumindest sein.
An diesem Abend gab es eine Störung im vorderen Parkett, den teuersten Plätzen in der Met. Ausgerechnet in diesem herzzerreißenden Augenblick schrillte eine Reihe von elektronischen Piepstönen über die singenden Stimmen hinweg, ein Rufsignal, das erheblich lauter war als die Armbanduhrwecker, die ständig in Kinos und Theatern losgehen. Irgendein Banause hatte seinen Pager mit in die Oper genommen.
»Das darf doch wohl nicht wahr sein!« schimpfte ein Mann in der Reihe dahinter los, ungeachtet der Tatsache, daß er die Störung nur noch verstärkte. Andere machten ihrem Ärger ebenfalls Luft: »Stellen Sie das ab, aber dalli« und noch Eindringlicheres war zu hören.
In der dritten Reihe, aus der das Piepsen kam, öffnete ein graumelierter Mann mit schwarzgeränderter Brille seine Smokingjacke, hakte den Pager aus dem Gürtel und drückte einen Knopf, der ihn verstummen ließ. Der gesamte Zwischenfall hatte nicht länger als sechs Sekunden gedauert, aber der Zeitpunkt hätte nicht unglücklicher gewählt sein können.
Und jetzt war der Vorhang gefallen, die Künstler nahmen den Applaus entgegen, und im mittleren Parkett waren genauso viele Augen auf den Mann in der dritten Reihe gerichtet wie auf Domingo. Unbändige Empörung schlug dem Übeltäter entgegen. So sehr er sich auch bemühte, nicht darauf zu achten, indem er energisch klatschte und stur auf die Bühne blickte, von den verärgerten Musikliebhabern um ihn herum konnte er keine Gnade erwarten. New Yorker sind nicht für ihre Zurückhaltung bekannt.
»Den würde ich gern lebendig begraben.«
»Wieso läßt man solche Trottel eigentlich hier rein?«
»Ich habe Karten für die Oper gekauft und nicht für eine Scheißgeschäftsbesprechung.«
Der Trottel, um den es ging, klatschte auch dann noch mit Vehemenz, als sich der Vorhang zum sechsten- oder siebtenmal hob, bis schließlich die Lichter im Saal angingen. Dann wandte er sich seiner Begleiterin zu, einer attraktiven, dunkelhaarigen Frau, die mindestens zwanzig Jahre jünger war als er, und versuchte, sie in ein so angeregtes Gespräch zu verwickeln, daß das übrige New York ausgeschlossen wurde.
Sie war alles andere als begeistert. Zur Genugtuung der Leute um sie herum, die nun aufstanden und sich in Richtung Ausgang bewegten, war die Lady nicht gewillt, über den Fauxpas hinwegzugehen. Nach wenigen Augenblicken konnte man nur noch sie hören, als sie ihm eine so lautstarke Standpauke erteilte, daß fast die Kronleuchter erbebten. »... noch nie so etwas Peinliches erlebt, und wenn du dir einbildest, ich würde jetzt noch mit dir zu Abend essen und anschließend eine flotte Nummer schieben, dann hast du dich aber geschnitten.«
Jemand rief: »Richtig so! Schick ihn in die Wüste!«
Und das tat sie. Sie stolzierte durch die Sitzreihe davon und ließ ihren Begleiter stehen, der ihr kopfschüttelnd nachsah. Er versuchte nicht, ihr zu folgen. Er blieb sitzen und ließ die Leute, die er gestört hatte, umsichtigerweise vorgehen. Als niemand mehr in seiner Nähe war, nahm er den Pager wieder heraus und tippte einige Nummern ein. Nachdem er eine Anzeige auf dem Display hatte, griff er in die Brusttasche und holte, ungeachtet der Umgebung, ein Handy hervor.
»Sammy, hast du versucht, mich zu erreichen? Wenn ja, hättest du dir wirklich einen besseren Zeitpunkt aussuchen können, Alter.« Während er zuhörte, rutschte er tief in den Sitz und legte die Füße auf die Reihe vor ihm. »Ach, zum Teufel. Ich hoffe für dich, daß diese Neuigkeit bei neun Komma neun auf der Richterskala liegt.«
Was er dann hörte, löste bei Manfred Flexner sichtliche Irritation aus. Er nahm die Füße herunter. Er beugte sich vor, als könnte er so besser hören. Mit der freien Hand fuhr er sich durchs Haar.
Sechs Minuten später wankte er, kopfschüttelnd und um Fassung bemüht, aus der Oper auf den Platz des Lincoln Center und sog ein paarmal tief die frische Luft ein. Um diese Zeit wimmelte es hier von Zobeln und Nerzen, das Publikum aus der Philharmonie und dem Ballett kämpfte mit den Opernbesuchern um die Taxis. Flexner hatte seinen eigenen Chauffeur, der auf der anderen Straßenseite in der Limousine wartete, also mußte er sich nicht beeilen. Nach Hause wollte er aber noch nicht. Eine Weile starrte er in den beleuchteten Brunnen. Während der letzten halben Stunde hatte er eine Oper gestört, seine Begleiterin verloren und war auf dem internationalen Aktienmarkt um vierzig Punkte abgerutscht. Er brauchte einen Drink.
Am nächsten Morgen sah die Welt nicht freundlicher aus. Er betrachtete die Alka-Seltzer, die in dem Glas auf seinem Schreibtisch sprudelten, und grübelte darüber nach, was hätte sein können. Manny Flexner war im Pharmageschäft.
Pharmazeutika.
Und er schluckte das Produkt der Konkurrenz! Sein ganzes Leben hatte er darauf hingearbeitet, irgendwann einmal einen Dauerbrenner wie Alka-Seltzer zu haben, der sich fast von selbst verkaufte. Er war das typische Beispiel für einen geschäftstüchtigen Jungen von der Lower East Side, der sich zunächst mit Taxifahren ein paar Dollar verdient hatte, eine Zeitlang bescheiden lebte und seinen Verdienst investierte. Da er wie alle echten Unternehmer schon in jungen Jahren erkannte, daß man mit Eigenarbeit und Ersparnissen nicht weit kommt, lieh er sich Geld bei einer Bank, um sich in eine kleine Firma einzukaufen, die Apotheken mit Etiketten belieferte. Als selbstklebende Etiketten aufkamen, hatte er schon fast eine marktbeherrschende Stellung und soviel verdient, daß er noch mehr Geld aufnehmen und in die Pharmabranche einsteigen konnte. In den sechziger und siebziger Jahren erlebte die Pharmaindustrie eine Hochkonjunktur. Manny Flexner hatte einige Firmen in den USA übernommen und expandierte international mit geschickten Aufkäufen in Europa und Südamerika. Eines der Manflex-Produkte, das Angina-Medikament Kaprofix, war zu einer lukrativen Einnahmequelle geworden, denn es verkaufte sich gut in Amerika und Europa.
Die Geschichte hatte aber auch ihre negative Seite. Pharmaunternehmen sind darauf angewiesen, neue Medikamente zu entwickeln; ohne umfangreiche Forschungsprogramme können sie nicht überleben. In den frühen achtziger Jahren hatten Wissenschaftler, die für Manflex tätig waren, einen neuen vielversprechenden Histamin-Antagonisten für die Behandlung von Magengeschwüren entdeckt. Er wurde patentiert und erhielt den Markennamen Fidoxin. Die Absatzmöglichkeiten für Medikamente gegen Magengeschwüre sind riesig. Damals beherrschte Tagamet von Smith-Kline den Markt und machte einen Umsatz von schätzungsweise über einer Milliarde Dollar. Glaxo entwickelte ein Konkurrenzprodukt namens Zantac, das sich womöglich besser verkaufte als jedes andere Medikament in der Welt. Aber Manny Flexner mischte mit.
Die ersten Forschungsergebnisse zu Fidoxin waren ermutigend. Manflex investierte gewaltige Summen in Studien und Feldversuche, um das Prüfungsgremium des Gesundheitsministeriums zufriedenzustellen, das über die Zulassung von Medikamenten entschied. 1981 sah es ganz danach aus, als würde Manflex seine Konkurrenten auf einem Milliarden-Dollar-Markt aus dem Rennen werfen. Doch dann, in der Endphase, wurden bei Patienten, die Fidoxin über einen längeren Zeitraum eingenommen hatten, Nebenwirkungen festgestellt. Fast jedes Mittel hat unerwünschte Nebenwirkungen, doch das Risiko einer ernsten Nierenschädigung ist inakzeptabel. Wohl oder übel mußte Manny Flexner seine Verluste abschreiben und das Projekt einstellen.
Manflex hatte zuviel in dieses Medikament investiert, so daß Manny in den achtziger Jahren bei neuen Forschungsprojekten zurückhaltender war. Die Rezession von 1991 hatte Manflex härter getroffen als die Konkurrenten. Vor allem dank seines altbewährten Produkts Kaprofix zählte das Unternehmen noch immer zu den Top Ten in den USA, aber es war vom vierten auf den siebten Platz zurückgefallen. Oder noch tiefer. Manny wollte es gar nicht mehr so genau wissen.
Heute war der bislang schwärzeste Tag. Er hatte das »Wall Street Journal« vor sich liegen. Seine Aktien waren über Nacht in Tokio und New York in den Keller gerutscht. Der Grund?
»Man spricht vom größten Feuerwerk seit Menschengedenken«, las er seinem Stellvertreter Michael Leapman vor und warf ihm dann die Zeitung zu. »Ein Feuer für zwanzig Milliarden Lire. Die Flammen waren noch dreißig Kilometer südlich von Mailand zu sehen. Wieviel ist das, Michael?«
»Ungefähr zwanzig Meilen.«
»Die Lire, zum Donnerwetter.«
»Nicht so wild, wie’s klingt. Etwa siebzehn Millionen Dollar.«
»Nicht so wild«, wiederholte Manny ironisch. »Eine ganze Fabrik geht in Flammen auf, ein Viertel unserer Beteiligungen in Italien, und es ist nicht so schlimm.«
»Versicherung«, murmelte Michael Leapman.
»Die Versicherung übernimmt die Fabrik und die Materialien. Aber wir hatten da Forschungslabors. Sie haben ein Mittel gegen Depressionen getestet. Depressionen. Ich hoffe bei Gott, daß noch ein bißchen von dem Zeug übriggeblieben ist, ich kann’s nämlich gebrauchen. Forschung ist unersetzlich, und der Markt weiß das. Wissen wir schon Genaueres aus Italien? Ist alles hin?«
Leapman nickte. »Ich habe vor einer Stunde mit Rico Villa gesprochen. Das Ganze ist nur noch ein Haufen weißer Asche.« Er ging durch den Raum zum Getränkeschrank und nahm den Scotch heraus. »Möchtest du einen?«
Manny schüttelte den Kopf und deutete auf das Alka-Seltzer.
»Was dagegen, wenn ich mir einen genehmige?« Michael Leapman, siebenunddreißig, einssiebenundachtzig und blond, war weniger temperamentvoll als sein Chef. Er war halb Schwede. Vermutlich bewahrte ihn die schwedische Hälfte davor, aus der Haut zu fahren. Er war vor fünf Jahren zu Manflex gestoßen, ohne selbst etwas dafür zu tun. Flexner hatte in Detroit eine kleine Firma gekauft, deren Geschäftsführer Leapman war; wie sich herausstellte, war Leapman der einzige Gewinn bei dieser Übernahme, ein kreativer Kopf mit hervorragendem Organisationstalent. Er hatte ein gutes Verhältnis zu seinem zähen, kleinen Boß entwickelt und wurde schon nach nur einem Jahr in den Vorstand berufen.
»Irgendwelche Toten?« fragte Manny. Seine Stimme verriet, daß er an diesem Tag nur schlechte Nachrichten erwartete.
»Offenbar nicht. Sieben Leute sind im Krankenhaus, zwei davon Feuerwehrleute mit Rauchvergiftung. Das ist alles.«
»Umweltschäden?«
Leapman zog eine Augenbraue hoch. Sein Boß war nicht dafür bekannt, daß er eine Schwäche für die Grünen hatte.
»Das könnte uns richtig Ärger einbringen«, sagte Manny. »Denk nur an Seveso. Die Dioxindämpfe. Und es war in Italien, meine ich. Wie viele Millionen mußten die Besitzer an Entschädigung blechen?«
Leapman goß sich großzügig Scotch ein. »Von giftigen Dämpfen ist bisher nicht die Rede gewesen.«
Die Anspannung in Mannys Gesicht ließ ein wenig nach. Er nahm seine Brille ab und wischte sie mit einem Papiertaschentuch ab, das er aus einer Manflex-Packung zog.
»Wir werden schon damit fertig«, sagte Leapman mit Überzeugung. Zuversicht zu verbreiten, war eines seiner nützlichsten Talente. »Natürlich, wir werden ein blaues Auge davontragen. Ein oder zwei Wochen lang werden wir schlechter notiert werden, aber wir sind groß genug, um das zu verkraften. Das Werk bei Mailand hat ohnehin nicht viel Gewinn abgeworfen. Rico hat uns dauernd in den Ohren gelegen, es müsse modernisiert werden.
»Ich weiß, ich weiß. Wir wollten doch gegen Ende des Jahres einiges Kapital reinstecken.«
»Jetzt können wir uns vordringlich um die beiden Werke bei Rom kümmern.«
Manny setzte die Brille wieder auf und musterte Leapman. »Meinst du nicht, wir sollten in Mailand wieder aufbauen?«
»Bei dem derzeitigen wirtschaftlichen Klima?« Sein Ton war unmißverständlich. Ein Wiederaufbau kam nicht in Frage.
»Du hast recht. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir da drüben haben, und Mailand verkaufen.« Manny hatte die Möglichkeiten abgewogen und schien nun beruhigt. »Ich möchte, daß jemand nach Italien fährt und dort alles in Ordnung bringt, Personalprobleme löst und soviel wie möglich aus diesem Fiasko für uns rettet.« Er zögerte, als suchte er nach einem Namen. »Was meinst du, wer dafür in Frage kommt? Würdest du sagen, daß David das schafft?«
»David?« Der Name erwischte Leapman auf dem falschen Fuß. Er hatte fest damit gerechnet, selbst mit dieser Aufgabe betraut zu werden.
»Mein Junge.«
»Keine Frage.« Leapman war zu klug, als daß er versucht hätte, seinen Chef davon abzubringen, die Aufgabe seinem Sohn zu übertragen, ganz gleich, was er insgeheim davon hielt. Der junge David Flexner – jung, aber beileibe kein Junge mehr – legte keineswegs die seinem Vater eigene Begeisterung für das Unternehmen an den Tag, und doch hegte Manny die unsinnige Hoffnung, daß sein Sohn eines Tages seinen Beitrag leisten würde. Nach vierjährigem Studium der Wirtschaftswissenschaften und drei Jahren im Vorstand von Manflex hätte David eigentlich soweit sein müssen, Führungsaufgaben zu übernehmen. In Wahrheit steckte er all seine Energie in die Hobbyfilmerei.
Am späten Vormittag zeichnete sich auf den Bildschirmen in dem großen Büro neben dem von Manny Flexner eine gewisse Erholung der Aktienkurse des Konzerns ab. Wall Street hatte sich an Tokio und London orientiert und auf die Nachricht von dem Feuer zunächst überreagiert. Jetzt setzte sich eine gemäßigtere Haltung durch. Der Manflex-Konzern hatte zwar einen schweren Rückschlag erlitten, war aber letztlich nicht ernsthaft gefährdet.
Manny demonstrierte seine Zuversicht, indem er seinen Sohn zum Lunch in das Four Seasons einlud. Manny war zweimal geschieden und lebte allein. Das heißt, offiziell lebte er allein. In Wahrheit hatte er eine ganze Reihe von Freundinnen, die sich darin abwechselten, ihn zum Dinner in New Yorks besten Restaurants zu begleiten, und die hinterher die Nacht in seinem Haus an der Upper East Side verbrachten. Daher wußte er, wo man gut essen konnte. Und er mußte sich gut ernähren, um seine Vitalität zu bewahren. Er war dreiundsechzig.
Die Mittagsmahlzeiten jedoch blieben stets dem Geschäft vorbehalten.
»Ich empfehle den Lachs in süßer Senfsauce. Oder den Entensalat mit Sauerkirschen. Nein, probier den Lachs. Der ist wirklich köstlich. Hast du von dem Feuer in Mailand gehört?«
Offensichtlich hatte sein Sohn nicht in den Wirtschaftsteil der Zeitung geschaut. David war über das Alter jugendlicher Rebellion hinaus. Er war ein erwachsener Rebell, mit blondgefärbtem Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel. Manny fand, daß blonde Haare nun mal nicht zu einem jüdischen Jungen paßten. Das dunkelgrüne Kordjackett, das David trug, war eine Konzession an die Spielregeln im Restaurant. An Vorstandssitzungen nahm er häufig im T-Shirt teil.
Manny klärte ihn über die wichtigsten unangenehmen Punkte auf und eröffnete ihm seinen Plan, wie er in Italien weiter vorgehen wollte.
»Ich soll dahin? Das könnte schwierig werden, Pop«, sagte David wie aus der Pistole geschossen. »Wann?«
»Wie wär’s mit heute abend?«
David lächelte. Sein gewinnendes Lächeln war zugleich ein Vorteil und ein Nachteil. »Das ist nicht dein Ernst?«
»Mein voller Ernst. Ich habe da zweihundert Leute ohne Arbeit, man muß mit den Gewerkschaften verhandeln ...«
»Ja, aber ...«
»Der Anspruch an die Versicherung muß geltend gemacht werden, und mit Sicherheit wird es Gerichtsprozesse geben. Das muß alles geregelt werden, David.«
»Und Rico Villa? Er ist vor Ort, und er spricht die Sprache.«
Manny verzog das Gesicht und zuckte die Achseln. »Rico könnte noch nicht mal ein Schulsportfest organisieren.«
»Du willst also, daß ich nach Mailand fliege und das Kriegsbeil schwinge.«
»Du sollst den Leuten da bloß die Fakten klarmachen, mehr nicht. Ihr Arbeitsplatz ist nur noch ein Haufen Asche. Es hat keinen Sinn, die Fabrik wieder aufzubauen. Falls einige bereit sind, nach Rom zu wechseln, okay. Verhandle über Abfindungen. Wir werden so großzügig wie möglich sein. Wir sind schließlich keine Ungeheuer.«
David seufzte. »Pop, ich kann hier nicht alles stehen und liegen lassen.«
Obwohl Manny damit gerechnet hatte, tat er überrascht. »Was meinst du damit?«
»Ich habe meine Verpflichtungen. Ein paar Leute sind von mir abhängig, sie verlassen sich auf mich.«
Manny starrte ihn durchdringend an. »Haben die Verpflichtungen auch nur im entferntesten etwas mit Manflex zu tun?«
Sein Sohn errötete. »Nein, es geht um ein Filmprojekt. Wir haben einen Zeitplan.«
Der Kellner kam, einen Sekundenbruchteil bevor Manny aus der Haut fahren konnte. Vater und Sohn schlossen Burgfrieden, solange die gastronomischen Entscheidungen getroffen werden mußten. David wählte diplomatisch den Lachs, den sein Vater empfohlen hatte. Es würde ihn keine Überwindung kosten. Als sie wieder allein waren, versuchte Manny es anders. »Einige der besten Filme, die ich je gesehen habe, sind in Italien gemacht worden.«
»Natürlich. Das italienische Kino zählt zu den besten. Schon immer. ›Fahrraddiebe‹. ›Tod in Venedig‹. ›Der Garten der Finzi Contini‹.«
»›Für eine Handvoll Dollar‹.«
David stellte sich sphinxhaft. »Ach – du meinst Spaghettiwestern.«
Manny nickte und sagte dann großzügig: »Du könntest diese Typen doch kennenlernen. Nimm dir ein paar Wochen länger. Bring in Mailand alles in Ordnung, und danach hast du freie Hand, Junge. Fahr nach Venedig. Ist das ein Angebot?«
Soviel Selbstlosigkeit von einem Workaholic verdiente eine Minute atemloser Anerkennung und erhielt sie auch.
Schließlich gestand David. »Pop, ich weiß, du möchtest, daß ich eines Tages in deine Fußstapfen trete, aber ich denke, ich sollte dir sagen, daß mich die Pharmaindustrie zum Erbrechen langweilt.«
»Du erzählst mir nichts Neues.«
»Aber du willst es einfach nicht akzeptieren.«
»Weil du dem Geschäft keine Chance gibst. Hör zu, David. Das ist die spannendste Branche, die es gibt. Es geht um neue Medikamente und darum, neue Marktanteile zu gewinnen.«
»Das habe ich auch schon verstanden«, sagte David lakonisch.
»Ein einziger Erfolg, ein neues Medikament, kann dein ganzes Leben verändern. Das ist für mich der Kick.«
»Du meinst, es kann das Leben eines kranken Menschen verändern.«
»Natürlich«, sagte Manny, ohne zu zögern. »Nur was den Kranken guttut, tut auch meiner Bilanz gut.«
Er zwinkerte, und sein Sohn mußte unwillkürlich grinsen. Diese Ethik mochte fragwürdig sein, aber die Freimütigkeit war unwiderstehlich.
»Forscherteams sind wie Rennpferde. Man will immer so viele haben, wie man sich leisten kann. Hin und wieder kommt eines davon als erstes ins Ziel. Aber du darfst dich nie zufriedengeben. Wenn du das Medikament dann hast, brauchst du immer noch die staatliche Genehmigung, um es zu vermarkten.« Mannys Augen funkelten angesichts der Herausforderung. In letzter Zeit lächelte er nicht mehr oft, aber gelegentlich huschte ein Ausdruck über sein erschöpftes Gesicht, der Ausdruck eines Mannes, der früher einmal Treffer gelandet hatte, aber anscheinend das Händchen dafür verloren hatte. »Und in Null Komma nix läuft das Patent ab, und du mußt was Neues finden. Ich habe rund um den Globus Teams, die für mich arbeiten. Jeden Augenblick könnten sie das Mittel gegen eine tödliche Krankheit entdecken.«
David nickte. »In dem Werk bei Mailand gab es eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung.«
Manny sagte beifällig: »Du weißt mehr, als du dir anmerken läßt.«
»Du glaubst anscheinend wirklich, daß ich die Sache regeln kann.«
»Deshalb bitte ich dich ja darum, mein Sohn.« Er winkte dem Weinkellner. Nachdem er einen guten Bordeaux ausgesucht hatte, sagte er zu seinem Sohn: »Der Ärger in Italien ist mir an die Nieren gegangen. Ich habe immer geglaubt, daß irgendwer da oben auf meiner Seite ist. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht sollte ich mich zur Ruhe setzen.«
»Pop, das ist verrückt, und du weißt es. Wer soll den Laden denn sonst schmeißen?« Dann bemerkte David den eindringlichen Blick seines Vaters. »Oh, nein. Das ist nichts für mich. Ich hab dir doch schon so oft gesagt, daß ich nicht weiß, was ich von der Branche halten soll. Wenn es bloß darum ginge, Medikamente zu machen, die kranken Menschen helfen, okay. Aber wir wissen doch beide, daß dem nicht so ist. Es geht um Beziehungen, darum, sich gut mit Politikern und Bankern zu stellen. Um das, was unter dem Strich rauskommt.«
»Nenn mir eine Branche, in der es nicht darum geht. Das ist nun mal die Welt, in der wir leben, David.«
»Ja, aber die Profite stecken nicht in den Medikamenten, die Leute heilen. Zum Beispiel Arthritis. Wenn wir dafür ein Heilmittel finden, verlieren wir einen prima Markt, also entwickeln wir lieber weiter Medikamente, die den Schmerz betäuben. Sie unterscheiden sich kaum von Aspirin, bloß daß sie fünfzigmal so teuer sind. Wie viele Millionen werden wohl im Augenblick für Nachahmer gegen Arthritis ausgegeben?«
Manny antwortete nicht. Aber er registrierte befriedigt, daß sein Sohn den Branchenjargon benutzte. Ein ›Nachahmer‹ war ein Imitat, leicht abgewandelt, um die Zulassung zu erhalten. Es gab über dreißig solcher Mittel zur Behandlung von Arthritis.
David wurde allmählich wütend. »Aber wieviel wird in die Erforschung der Sichelzellenanämie gesteckt? Die Krankheit tritt zufällig vor allem in Dritte-Welt-Ländern auf, also würde sie nicht viel Profit bringen.«
»In deinem Alter war ich auch ein Idealist«, sagte Manny.
»Und jetzt wirst du mir sagen, daß du in der realen Welt lebst, aber das tust du nicht, Pop. Du willst von der realen Welt nichts wissen, bis du die Augen nicht mehr verschließen kannst, wie beispielsweise bei AIDS. Ich meine nicht dich persönlich. Ich meine die gesamte Industrie.«
»Nun hör aber auf. Die Branche hat sehr schnell auf AIDS reagiert. Wellcome hat in Rekordzeit Retrovir auf den Markt gebracht.«
»Ja, und gleichzeitig sind ihre Aktienkurse um 250 Prozent hochgeschnellt.«
Manny zuckte die Achseln. »Die Gesetze des Marktes. Wellcome hatte das Wundermittel zuerst.«
David spreizte die Hände, um zu signalisieren, daß seine Meinung damit bestätigt war.
Der Kellner kam und goß Manny etwas Wein zum Kosten ein. Nachdem er ihm zugenickt hatte, sagte Manny listig zu seinem Sohn: »Du weißt mehr, als du dir manchmal anmerken läßt. Wenn du Vorstandsvorsitzender wirst, bist du allmächtig. Wenn du willst, kannst du ja versuchen, ein bißchen Ethik in die Pharmaindustrie einzubringen.«
David lächelte. Nach all den Jahren besaß sein Vater noch immer die Chuzpe eines New Yorker Taxifahrers.
Kapitel fünf
Die Bibliothek in Kensington wurde 1960 erbaut, aber der Lesesaal im oberen Stock hat eine eindeutig viktorianische Atmosphäre. Der Teppich ist freudlos olivgrün, und die Polstersessel sind in dunklem Leder gehalten. Überall hängen Plakate, auf denen die Leser vor Taschendieben gewarnt und gebeten werden, sofort das Personal zu verständigen, wenn sie sehen, daß jemand Zeitschriften beschädigt oder mitnimmt. Zugegeben, einige dieser Zeitschriften sind höchst begehrt. Der »Evening Standard«, der am frühen Nachmittag geliefert wird, kann nur auf Nachfrage eingesehen werden – nicht, weil sein Inhalt irgendwie anstößig wäre, sondern weil er aus der Auslage verschwinden und nie wieder auftauchen würde. Im Laufe der Zeit kennen die Angestellten die Männer mit den glänzenden Augen, die von zwei Uhr nachmittags an bei ihnen rumhängen und darauf hoffen, als erste ein günstiges Gebrauchtwagenangebot zu entdecken, einen Tip fürs Hunderennen oder eine Stellenanzeige.
Peter Diamond – ehemals beim Sicherheitsdienst von Harrods – gehörte jetzt auch zu diesen Stellungssuchenden.
Endlich war er an der Reihe, den »Standard« durchzusehen, und fuhr mit dem Daumen die Spalten entlang. Wenn er fand, daß eine der angebotenen Stellen für ihn in Frage kam, würde er zum nächsten Telefon eilen. Die meisten Anzeigen schlugen einen freundlichen Ton an – »Rufen Sie unsere Sachbearbeiterin an« oder »Unsere Personalchefin freut sich auf Ihren Anruf« –, so daß man sich förmlich eine nette Dame am anderen Ende der Leitung vorstellen konnte, die darauf brannte, über den vorzüglich bezahlten Posten mit Leistungsbonus und Altersversorgung zu sprechen. Doch wie üblich schien heute in ganz London keine gute Fee eine offene Stelle für einen achtundvierzigjährigen Exdetective zu haben, dem nicht einmal zuzutrauen war, ein Stockwerk bei Harrods zu sichern.
Er gab auf. Unter der Schlagzeile »VERZWEIFLUNG BEI LONDONS BESCHÄFTIGUNGSLOSEN« meldete der »Standard« einen weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Außer Diamonds hängenden Schultern deutete nicht viel auf die Verzweiflung auf der Kensington High Street hin. Junge Frauen mit bunten Plastiktüten voller Leckereien aus den Supermärkten standen am Straßenrand und versuchten Taxis zu bekommen. Männer mittleren Alters in Designertrainingsanzügen joggten Richtung Holland Park. Noch immer war das Al Gallo D’Oro, ein italienisches Restaurant auf der anderen Straßenseite, nach dem mittäglichen Andrang voll besetzt.
Seit nunmehr sieben Monaten lebten Diamond und seine Frau Stephanie eher schlecht als recht in einer Souterrainwohnung auf der Addison Road, einer Einbahnstraße, wo der Verkehrslärm ohne Doppelglasfenster und Ohrstöpsel beinahe unerträglich war. Das Haus war ein stuckverziertes, dreistöckiges Gebäude mit vermoderten Fensterrahmen, die unablässig bebten. Gegenüber war St. Barnabas, ein großer, rußfleckiger Klotz mit einem Türmchen auf jeder Ecke, der beim besten Willen nicht als schöne Kirche bezeichnet werden konnte, obwohl eine Reinigung der Fassade vielleicht einiges bewirkt hätte. Abgesehen von den Türmen von St. Barnabas konnten sie aus ihrem Fuchsbau lediglich die oberen Etagen hoher Mietshäuser sehen. Es war ein gewaltiger Unterschied zu dem Blick über das georgianische Bath, den sie bis vor einem Jahr genossen hatten.
Da er nicht untätig sein wollte, hatte Diamond Wände und Decken der Wohnung mit einer Dispersionsfarbe gestrichen, die auf der Farbtafel als Primelgelb bezeichnet wurde. Er hatte jede Schublade und jeden Schrank ausgeräumt, jede Türangel geölt, den Schornstein gefegt, alle Steckdosen kontrolliert, die Dichtungsringe an den Wasserhähnen ausgetauscht und alle Türen abgedichtet. Sein bewundernswerter Eifer hatte nur den Nachteil, daß er kein Heimwerker war, und so bekam er Öl und Farbe an die Schuhsohlen und trug sie durch die ganze Wohnung, die Wasserhähne tropften schlimmer denn je, die Türen klemmten, bei jedem Windstoß fiel Ruß ins Wohnzimmer, und die Katze hatte sich verstört in den Wäscheschrank geflüchtet.
Stephanie Diamond hätte es am liebsten der Katze gleichgetan. Sie arbeitete an zwei Vormittagen in der Woche in einem UNICEF-Laden und hatte ihre Arbeitszeit vor kurzem verdoppelt, nur um aus dem Haus zu sein. Um die Heimwerkermanie ihres Gatten zu dämpfen, brachte sie seit neuestem Puzzles mit nach Hause, die gestiftet worden waren, so daß Peter sich damit beschäftigen konnte, sie zusammenzusetzen, um festzustellen, ob Teile fehlten, bevor sie im Laden verkauft wurden. Die Idee war nicht so gut, wie sie zunächst schien. Eines Nachts wachte Stephanie gegen vier Uhr auf, weil sich etwas in ihren Rücken bohrte.
»Was um Himmels willen ...?« Sie schaltete die Nachttischlampe ein.
Diamond sah nach. »Na, wer sagt’s denn! Das ist das Eckstück, das mir gefehlt hat.«
»Zum Donnerwetter, Pete.«
»Tasse Tee?«
Sie erinnerte sich an den Geschmack des Tees, seit er den Kessel entkalkt hatte. »Nein, schlaf weiter.«
»Weiß der Himmel, wie das ausgerechnet hier hingekommen ist.«
»Ach, vergiß es.«
Nach einer Pause sagte er: »Stephanie, bist du wach?«
Sie seufzte. »Jetzt ja.«
»Ich habe über das Kind nachgedacht.«
»Welches Kind?«
»Das japanische Mädchen, wegen dem ich rausgeflogen bin. Warum setzt jemand so ein Kind einfach aus? Es war gut angezogen. Sauber. In keinster Weise vernachlässigt.«
»Vielleicht ist sie von zu Hause weggelaufen.«
»Und dann irgendwie im siebten Stock von Harrods gelandet? Das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Es nützt nichts, darüber nachzugrübeln«, sagte Stephanie. »Du hast nichts damit zu tun.«
»Stimmt.«
Er schwieg eine Weile.
Sie war fast eingeschlafen, als er sagte: »Es muß doch eine Möglichkeit geben, daß alle Teile an einem Ort bleiben.«
»Hä?«
»Die Puzzles. Ich hab mir gedacht, wenn ich im Laden mithelfen würde...«
Sie setzte sich gerade auf. »Untersteh dich!«
»Ich wollte sagen, daß ich die Puzzles da machen könnte, und wenn dann Teile fehlen, wüßten wir wenigstens, daß sie irgendwo im Laden sein müssen.«
»Wenn du auch nur einen Fuß in diesen Laden setzt, Peter Diamond, verläßt du ihn auf einer Trage, wenn ich mit dir fertig bin.« Eine kühne Behauptung angesichts der Tatsache, daß sie ungefähr fünfzig Kilo wog und er hundertsechsundzwanzig, aber sie wußte, welche Verwüstungen er – in aller Unschuld wohlgemerkt – bei dem vielen Kram dort anrichten konnte. Schon als sie ihn heiratete, hatte sie gewußt, daß er zu Mißgeschicken neigte. Er war schlecht koordiniert. Manche dicken Menschen bewegen sich mit Anmut. Ihr Gatte tat das nicht. Er stieß Dinge um. Auf der Straße übersah er regelmäßig den Bordstein. Gefahrenquellen wie beispielsweise Hundehaufen schienen ihn magnetisch anzuziehen.
»Das ödet mich an, ich hab keine Lust mehr«, sagte er am nächsten Morgen beim Frühstück.
»Angeln?« fragte Stephanie.
Er zuckte die Achseln.
»Na schön, dann sag ich es. Du bist nicht so alt.«
»Offenbar zu alt, um zu arbeiten.«
»Peter, hör auf damit.«
»Du solltest sie mal beim Arbeitsamt Schlange stehen sehen. Jüngere Männer als mich. Manche von ihnen sind viel jünger. Kinder, frisch von der Schule.«
Sie häufte durchwachsenen Speck auf seinen Teller. »Es könnte schlimmer sein.«
»Du meinst, eines von diesen arbeitslosen Kindern könnte unseres sein.«
Sie sah weg, und er verfluchte sich selbst für seine Taktlosigkeit. In ihrer ersten Ehe mit einem Betriebsleiter hatte Steph drei Fehlgeburten gehabt. Nachdem sie Diamond geheiratet hatte, verlor sie noch ein Baby. Es hatte Komplikationen gegeben, die schließlich durch eine Hysterektomie gelöst wurden. In den frühen siebziger Jahren war man mit solchen Operationen rasch bei der Hand. Sie hatte ihre Gebärmutter verloren, aber nicht ihren mütterlichen Instinkt. Bevor er sie kennenlernte, war sie Gruppenleiterin bei den Jungpfadfinderinnen gewesen. Das machte sie jahrelang und mit mehr Engagement, als Baden-Powell sich je hätte träumen lassen. Immer war sie bereit, die Ersatzmutti für kleine Mädchen zu spielen, die von ihren Eltern vernachlässigt wurden. Die waren jetzt alle junge Erwachsene, und manchen von ihnen schrieb sie noch immer.
Er legte seine Hand auf ihre und sagte: »Tut mir leid wegen letzte Nacht, Schatz.«
Ihr Gesicht nahm einen verwunderten Ausdruck an. »Letzte Nacht?«
»Im Bett.«
Sie starrte ihn mit großen Augen an.
»Das Puzzleteilchen.«
»Ach!« Sie lachte. »Das hatte ich schon ganz vergessen. Ich dachte, du redest von was völlig anderem. Ich wußte jetzt gar nicht, was du meinst.«