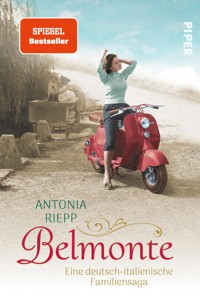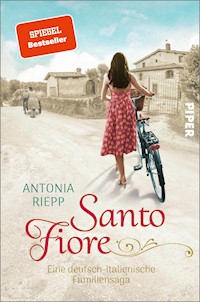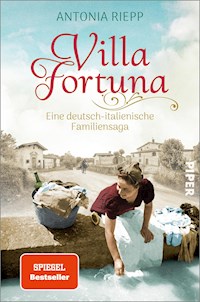22,73 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer, Sonne, Capri – eine neue, wunderbar atmosphärische und tief bewegende Familiengeschichte von SPIEGEL-Bestsellerautorin Antonia Riepp (»Belmonte«)!
In »Die Frauen von Capri – Im blauen Meer der Tage« nimmt Antonia Riepp ihre Leserinnen und Leser mit auf eine schicksalhafte Reise zwischen Deutschland und Italien, die Neuanfang und Abschied zugleich ist.
Die Heldin Catia steckt mitten in einer Lebenskrise, als sie auch noch ins Krankenhaus muss. Doch ausgerechnet dort lernt sie die 80-jährige Italienerin Elisa kennen. Elisa möchte ihr Haus auf Capri verkaufen und bittet Catia, ihr gegen Bezahlung bei der Entrümpelung zu helfen. Begeistert nimmt Catia an.
Doch auf Capri stellt sich heraus, dass Elisa nicht ganz aufrichtig war. Als sie Catia ihr Herz öffnet und diese nach und nach in ein tragisches Familiengeheimnis einweiht, erkennen die beiden Frauen, dass es nie zu spät ist, einen Neuanfang zu wagen …
Zwei Schicksale, eine florierende Weberei in den Sechzigern und ein bitterer Verrat vor der eindrucksvollen Kulisse Capris – »Die Frauen von Capri – Im blauen Meer der Tage« hat alle Zutaten für eine spannende und zu Herzen gehende Lektüre. Von Anfang an fühlt man sich Antonia Riepps Figuren zutiefst verbunden und fiebert mit ihnen, während sie nach Antworten suchen, nach ihren Wurzeln und ihrer ganz persönlichen Vorstellung von Glück.
»Gleich ab der ersten Seite fühlt man mit den so unterschiedlichen Frauen mit und kann das Buch kaum noch zur Seite legen.« Freundin über »Belmonte«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Frauen von Capri – Im blauen Meer der Tage« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: u1 berlin/Patrizia Di Stefano
Covermotiv: Foto di Fosco Maraini/Proprietà Gabinetto Vieusseux © Archivi Alinari; Getty Images (Gianpaolo Fabozzo / EyeEm; Dimitris66); Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Kapitel 1
Mannaggia
München, Gegenwart
Kapitel 2
Wilhelmine
Capri, 1914
Kapitel 3
Die Sache mit Oskars Zimmer
München, Gegenwart
Kapitel 4
Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann
München, Gegenwart
Kapitel 5
Die Reise
Neapel, Capri, Gegenwart
Kapitel 6
Die Firma
Capri, die Nachkriegsjahre
Kapitel 7
Die Villa Santoro
Gegenwart, Anacapri
Kapitel 8
Niccolò
Capri, die Fünfzigerjahre
Kapitel 9
Gemischte Gefühle
Capri, Gegenwart
Kapitel 10
Karriere
Capri, Sardinien, Neapel 1960
Kapitel 11
Die kleine Wachtel
Capri, Gegenwart
Kapitel 12
Die Verlobung
Capri, Ischia, Neapel, 1960–1961
Kapitel 13
Alte Sachen, alte Geschichten
Capri, Gegenwart
Kapitel 14
Väter
Capri, 1961
Kapitel 15
Mare di sotto
Capri, Gegenwart
Kapitel 16
Die Geburt
Anacapri, 1963
Kapitel 17
Der Auftrag
Capri, Gegenwart
Kapitel 18
Die Unzufriedene
Capri, 1963–1965
Kapitel 19
Valentina
Capri, Gegenwart
Kapitel 20
Die Befreiung
Capri, späte Sechziger- und frühe Siebzigerjahre
Kapitel 21
Catias Traum
Capri, Gegenwart
Epilog
Daniel
Capri, Gegenwart, drei Monate später
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Kapitel 1
Mannaggia
München, Gegenwart
»Nein, ich will dich nicht sehen«, flüsterte Catia. »Schließlich liege ich nicht im Sterben, ciao, Daniel.« Hastig legte sie auf. Ihre Wangen glühten, denn es war nicht normal für sie, so mit ihrem Ehemann zu reden. Noch dazu fand das Gespräch unter erschwerten Bedingungen statt, denn Catia war dafür unter die Bettdecke gekrochen. Sie wollte die andere Patientin nicht stören, außerdem sollte diese nicht jedes Wort mitbekommen. Mit einem gemurmelten Fluch wühlte Catia sich wieder unter dem Bettzeug hervor. Zwischen ihren Ärger schlich sich erneut die Angst.
Der Countdown lief. Morgen um elf Uhr sollte es so weit sein. Endoskopische Entfernung der Gallenblase, eine Routineoperation. Ehe das passierte, musste noch die Entzündung zurückgehen, und deswegen hing sie seit vorgestern am Tropf.
Die Operation mochte für die Ärzte etwas Alltägliches sein, doch sie war und blieb ein Eingriff. In ihren Körper. Etwas würde in Bereiche ihres Innersten vordringen, die nicht einmal sie selbst kannte, und ein Stück davon würde herausgeschnitten werden. Eine gruselige Vorstellung. Schon bereute sie es, sich Daniel gegenüber so unversöhnlich gezeigt zu haben. Was, wenn etwas schiefging und sie nicht mehr aus der Narkose erwachte? Wie würde er sich dann fühlen?
Warum musste sie sich auch so aufregen über die Sache mit Oskars Zimmer? Ja, Daniel hätte mit ihr reden sollen, ehe er sich dort breitmachte, kaum dass sein Sohn das Flugzeug nach Sydney bestiegen hatte. Aber woher hätte er wissen sollen, dass sie sich schon seit Wochen darauf freute, wenigstens für eine Weile ein Zimmer für sich zu haben? Die Aussicht darauf hatte sie sogar ein wenig darüber hinweggetröstet, dass sie ihren Sohn fast ein Jahr lang nur per Videotelefonat sehen würde. Ich bin eine Rabenmutter, dachte sie, und als Ehefrau gebe ich auch kein souveränes Bild ab.Mama wäre das mit dem Zimmer nicht passiert. Die hatte Papa stets im Griff.
Catias Blick begegnete dem der alten Dame, die im anderen Bett lag, dem vor dem Fenster. Frau Santoro, bestimmt achtzig oder noch älter. Sie hatte das Kopfteil des Bettes hochgefahren, vor dem milchigen Grau des süddeutschen Winterhimmels hob sich ihr schwarzes Haar ab wie eine Gewitterwolke. Heute Morgen hatte sie es sorgfältig mit Haarnadeln und Spangen hochgesteckt, nur um das Kunstwerk gleich danach erschöpft in die Kissen sinken zu lassen. Zuvor war sie lange im Bad gewesen, welches sie dezent geschminkt verließ. Angesichts dieser Anstrengungen befürchtete Catia eine Phalanx von Besuchern, doch Frau Santoro bekam keinen Besuch und schien auch keinen zu erwarten. Vielleicht hatte die alte Dame lediglich beschlossen, trotz Alter und Krankheit an gewissen Standards festzuhalten. Tatsächlich haftete ihr etwas Distinguiertes, Vornehmes an, und diesen Eindruck in einem Krankenhausbett zu vermitteln, dazu gehörte schon etwas, fand Catia. Was für einen elenden Anblick bot sie selbst, die nur halb so alt war wie ihr Gegenüber, wohl gerade?
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Frau Santoro. »Ihre Wangen sind so rot.«
»Mir ist nur warm«, antwortete sie. »Und ich habe ein bisschen Bammel vor morgen. Es ist dumm von mir, ich weiß, weil es ja nur eine Routineoperation ist, aber trotzdem …«
»Für die Ärzte mag es Routine sein, für Sie nicht. Es ist verständlich, dass Sie Angst haben.«
Catia schaute ihre Mitpatientin dankbar an. Sie wusste nicht, weswegen Frau Santoro hier war. Bestimmt etwas Ernstes. In ihrem Alter dürfte so gut wie alles ernst sein.
Sie hätte gern das Fenster gekippt, aber sie wagte gar nicht erst zu fragen, denn über der Bettdecke hatte Frau Santoro eine weitere Decke liegen, die sie selbst mitgebracht hatte. Sie war aus sehr feiner Wolle, das konnte Catia erkennen, ohne sie angefasst zu haben. Die Farben leuchteten kräftig in Zitronengelb, Türkisblau, verschiedenen Grüntönen und ein wenig Rot, das Muster erinnerte entfernt an Bilder von Kandinsky. Ein Gedanke blitzte auf: Sie könnte in Oskars Zimmer eine Staffelei aufstellen und wieder anfangen zu malen. Es war bestimmt zwanzig Jahre her, dass sie zum letzten Mal einen Pinsel in der Hand gehalten hatte, der nicht dazu diente, Wände zu streichen oder einen Kuchen zu glasieren. Sie war damals gar nicht so schlecht gewesen, das hatte ihr die Kunstlehrerin der Volkshochschule bestätigt. Doch dann stellte sie sich Daniels Gesicht vor, wenn sie ihm dies eröffnete. Verblühte Frau malt Bilder von Blumen, um die Leere zu füllen, die das Erwachsenwerden ihrer Kinder hinterlässt. Natürlich würde er das nicht aussprechen. Aber denken.
»Gefällt sie Ihnen?«, fragte Frau Santoro.
»Wie bitte?«
»Die Decke.«
»O ja. Ich muss sie ständig anschauen, Verzeihung. Eine so außergewöhnliche Decke habe ich noch nie gesehen.«
»Es freut mich, dass Sie das erkennen. Ich habe sie nämlich selbst entworfen.«
»Sie ist ein Kunstwerk. Die Farben beleben das ganze Zimmer.«
»Dazu gehört hier drin allerdings nicht viel.« Frau Santoro wechselte das Thema: »Entschuldigen Sie meine ungehörige Frage, Frau Heubeck, aber haben Sie vielleicht neapolitanische Vorfahren?«
Catia war verblüfft. Noch nie hatte jemand Fremdes dies erraten. Die Gene ihres deutschen Vaters hatten bei ihr voll durchgeschlagen, und mit dunkelblondem Haar, graublauen Augen und einer Größe von eins fünfundsiebzig sah sie überhaupt nicht neapolitanisch aus.
»Was hat mich verraten?«
»Mannaggia.«
Stimmt, das Fluchwort hatte Catia am Ende des Telefonats mit Daniel gemurmelt. Die Alte musste Ohren haben wie ein Luchs. »Die Eltern meiner Mutter stammen tatsächlich aus Neapel«, erklärte Catia. »Sie kamen als Gastarbeiter nach München, der Klassiker. Meine Oma hat gerne mal geflucht.«
Catia erinnerte sich gut daran. Brach der Nonna ein Absatz ab – mannaggia, schlug der Fischhändler am Viktualienmarkt die Preise auf – mannaggia, wankte der Großvater betrunken nach Hause oder verlangte der Vermieter mehr Geld – mannaggia la miseria!
Seit dem Tod ihrer Großmutter vor vier Jahren benutzte Catia das Wort öfter einmal selbst, quasi als Reminiszenz an ihre Nonna. »Andere hängen Fotos an die Wand, ich fluche zu ihrem Andenken«, fuhr sie fort.
»Das hätte Ihrer Großmutter sicher gefallen.«
»Woher kennen Sie das Wort, Frau Santoro?«
»Ich bin auf Capri aufgewachsen. Dort flucht man gelegentlich auch.«
Frau Santoro sprach ein perfektes Deutsch, und ihre Art und Wortwahl ließen ahnen, dass sie in kultivierten Kreisen verkehrte. Dennoch konnte oder wollte sie ihren kleinen, aparten Akzent nicht ganz verbergen. Catia hatte ihn bisher nicht zuordnen können, aber auch nicht fragen wollen.
»Capri! Wie schön!«, rief sie jetzt.
»Waren Sie denn schon dort?«
»Nur einmal, da war ich neun. Mein Großvater sollte in der Heimaterde bestattet werden. Ehe wir zurückfuhren, haben meine Oma, meine Mutter und ich einen Abstecher nach Capri gemacht. Heimlich, denn die Verwandtschaft hätte einen solchen Ausflug skandalös gefunden, so kurz nach der Beerdigung. Meine Nonna hatte es vor ihrer Auswanderung nie nach Capri geschafft, obwohl es nur ein Katzensprung ist. Sie waren zu arm. Jetzt wollte sie es endlich sehen, Anstand hin oder her.«
»Das Leben bei den Barbaren hat Ihre Nonna also verdorben für die strengen heimischen Sitten«, bemerkte Frau Santoro mit einem kleinen Lächeln.
»Diese Verwandten!« Catia schüttelte sich bei der Erinnerung daran. »Sie waren alle fürchterlich bigott und gluckten in dieser düsteren Wohnung unter den Neonlampen zusammen wie eine Schar Krähen. Ich weiß noch, wie mich Mama ermahnt hat, bloß nicht vorlaut zu sein oder anstößige Wörter zu benutzen. Wenn meine Oma oder ihre Geschwister früher fluchten oder etwas Unanständiges sagten, wurde ihnen der Mund mit Seife ausgewaschen. Vielleicht hat sie deswegen in Deutschland kein Blatt mehr vor den Mund genommen.« Catia lächelte beim Gedanken an die resolute kleine Person mit den tief liegenden dunklen Augen hinter der hakenartig geformten Nase, die eine Vorliebe für Kleiderschürzen und Lockenwickler hatte.
»Hat sich der Ausflug nach Capri denn wenigstens gelohnt?«, wollte Frau Santoro wissen.
»Auf jeden Fall. Ich bekam dort den besten Eisbecher meines jungen Lebens. Nie wieder sind mir so gute Pfirsiche untergekommen.«
»Pfirsiche hatten wir auch im Garten. Sie schmecken dort wirklich unvergleichlich.« Frau Santoro lächelte und räumte ein, sie habe zudem aus Catias Glücksbringer auf deren Herkunft geschlossen. »Ein curniciello. Sehr typisch für Neapel und die Gegend.«
Sie hatte das Wort cornicello, Hörnchen, im neapolitanischen Dialekt ausgesprochen und meinte damit die Kette mit dem in Silber gefassten Anhänger aus roter Koralle, der auf den ersten Blick aussah wie eine Chilischote. Catia trug das Amulett seit Jahren, nur nicht im Bett, deshalb lag das Hörnchen auf dem Nachttisch. »Es soll Glück bringen und den bösen Blick abwehren.«
»Hat es denn geklappt mit dem Glück?«
»Mal mehr, mal weniger.«
»Meine Verwandtschaft war auch abergläubisch«, berichtete Frau Santoro. »Bei mir ist es genau umgekehrt, meine Vorfahren sind aus Capri und Procida, nur meine Großmutter väterlicherseits stammte aus München. Sie hieß Wilhelmine Feldmeier.«
»Und nun leben Sie auch in München«, stellte Catia fest. »Oder?«
»Ja, schon seit vielen Jahren, sogar im Elternhaus meiner Großmutter. So schließt sich der Kreis. Aber das ist eine lange Geschichte.«
»Entschuldigung. Ich wollte nicht neugierig sein.«
»Nur zu. Neugierde ist im Grunde eine positive Eigenschaft.«
»Nennen Sie mich Catia«, sagte Catia aus einem Impuls heraus. »Mit C geschrieben und ohne J.«
»Das ist ein schöner Name. Ich heiße Elisa. Jetzt sollte ich wohl vor dem Abendessen noch ein wenig schlafen.«
»Natürlich, Signora …«
»Signora«, wiederholte sie und lächelte. »So hat mich schon ewig niemand mehr genannt.«
»Nur noch eine Frage: Die Farben Ihrer Decke – ist das Capri?«
»Das haben Sie gut erkannt, Catia.«
»Sie leuchten.«
»Ja, und ein wenig vom Licht des Südens kann man hier drin wirklich gut gebrauchen.«
* * *
Die Signora ließ sich in die Kissen sinken und schloss die Augen. Der Anblick war so friedlich. So sollte man sterben, dachte Catia, mit einem Lächeln auf den Lippen und dem Gedanken an Capri. Oder war das jetzt makaber? Sie checkte ihr stummgeschaltetes Handy. Kein Anruf mehr von Daniel, aber eine SMS von Jakob Pfaller, ihrem Abteilungsleiter. Bis gestern hatte er ihr noch nie eine SMS geschickt und auch keine Blumen. Aber sie war ja auch nie vorher im Büro zusammengebrochen und im Rettungswagen abtransportiert worden. Wie peinlich! Der Strauß, Gerbera und Freesien mit Grünzeug drum herum, stand jetzt auf ihrem Nachttisch. Eine Karte mit Genesungswünschen hing daran, Jakob hatte sie mit vollem Namen unterschrieben. Nur er, nicht das ganze Büro.
Liebe Catia, wie geht es Dir heute? Es grüßt dich Jakob.
Typisch Jakob. Ein Mann, der zur Arbeit Dreiteiler trug, bestand selbstverständlich auch bei der Benutzung digitaler Kommunikationsmedien auf der Wahrung der Form.
Sie und Jakob hatten regelmäßig zusammen den Monats- und den Quartalsabschluss erstellt. Catia fand es angenehm, mit ihm zu arbeiten, besonders wenn nach Feierabend alle anderen weg waren. Vor etwa zwei Jahren lud er sie danach auf ein Glas Wein in eine Kneipe ein. Daraus wurde rasch eine Gewohnheit.
Jakob war Ende fünfzig, besaß kluge braune Augen, schmale Hände und einen kleinen Bauch. In seiner Gegenwart fühlte Catia sich charmant und begehrt. Trotz aller Harmlosigkeit haftete ihren Zusammenkünften der Hauch des Verbotenen an. So empfand es zumindest Catia. Daniel hätte Jakob Pfaller nie und nimmer als Konkurrenten wahrgenommen, aber vielleicht ihre Treffen mit süffisanten Bemerkungen ins Lächerliche gezogen. Deshalb sollte ihr allmonatliches Rendezvous Catias Geheimnis bleiben. Sie kleidete und schminkte sich an diesen Tagen mit besonderer Sorgfalt, und wenn Jakob sie hinterher zwei U-Bahn-Stationen entfernt von ihrem Zuhause absetzte, kam sie sich herrlich verrucht vor, wie eine Frau aus einem französischen Film.
Sie simste zurück: Morgen werde ich operiert. Alles Routine.
Seine Antwort kam zwei Minuten später, er war nicht der Schnellste im Tippen: Liebe Catia, würdest Du mich bitte kurz anrufen? Es ist wichtig.
Catia wurde mulmig. Was wollte er ihr sagen? Hatte ihr Zusammenbruch irgendetwas an der Art ihrer Beziehung geändert? Sie stand auf, zu rasch, ihr wurde schwindelig. Sie setzte sich wieder hin. Hoffentlich sagte er nichts, was sie zwingen würde, ihre Treffen zu beenden. Bitte, Jakob, verdirb nicht, was wir haben!
Das Ganze noch mal langsam und von vorn: aufstehen, den Bademantel überwerfen, das Handy einstecken, den Infusionsständer nach draußen schieben. Sie hatte sich binnen Kurzem so sehr an die Oase ihres Krankenzimmers gewöhnt, dass ihr der Flur der Station wie ein unbekannter Planet vorkam. Endlos lang, der Boden glänzte, und es roch nach Putzmitteln. Aliens in weißen und grünen Kitteln eilten vorbei. An die Wand gelehnt, rief sie Jakob an. Während die Verbindung aufgebaut wurde, zwang sie sich zu einem Lächeln, das sich hoffentlich auf die Stimme übertrug. Sie wollte nicht klingen wie eine Kranke.
»Hier Jakob Pfaller.«
»Jakob, was ist los? Machst du dir etwa Sorgen? Du weißt doch, Unkraut vergeht nicht.«
»Catia, wie schön, deine Stimme zu hören. Du klingst ja ganz munter.«
»Mir geht es gut. Danke für die schönen Blumen.«
»Das freut mich.« Er räusperte sich. »Catia, ich wollte, dass du es als Erste und von mir erfährst. Ich habe gekündigt.«
Catia wusste nichts darauf zu sagen, und er redete auch bereits weiter: »Diese Umstrukturierung … Nichts gegen Frauen in Führungspositionen, aber diese Engstler könnte meine Tochter sein, und ich kann sie nicht leiden, ehrlich gesagt.«
»Niemand kann das«, sagte Catia. Gekündigt. Einfach so. »Hast du schon was anderes?«
»Noch nicht. Aber ich sehe da kein Problem. Das gilt auch für dich, Catia. Du verkaufst dich seit Jahren schon unter Wert. Du solltest dir etwas Neues suchen.«
»Wann gehst du denn?«
»Am Montag ist mein letzter Arbeitstag. Catia?«
»Ich … ich weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich dir gratulieren? Dann tu ich’s. Gratuliere.«
»Entschuldige, dass ich dich damit behelligt habe. Du hast momentan bestimmt andere Sorgen. Ich wünsche dir alles Gute für morgen, meine Liebe. Melde dich, wenn du die Sache überstanden hast.«
Also gab es künftig auf der Arbeit nichts mehr, worauf sie sich freuen konnte. Im Gegenteil. Es war in ihrer Abteilung niemandem verborgen geblieben, dass Jakob Pfaller ein Faible für sie hatte. Man würde sie ab sofort dafür büßen lassen, so waren die Menschen nun einmal. Vielleicht sollte sie sich wirklich eine neue Stelle suchen. Doch allein die Vorstellung, Bewerbungen zu schreiben, Interviews zu führen und sich bestmöglich verkaufen zu müssen, erfüllte sie mit Widerwillen. Nach zwanzig Jahren wusste sie gar nicht mehr, wie das ging.
»Wir bleiben in Verbindung, Catia«, hörte sie ihn sagen.
»Ja«, sagte sie. »Natürlich.«
Kapitel 2
Wilhelmine
Capri, 1914
Elisa Santoro schlief nicht gleich ein. Das Gespräch über Catia Heubecks neapolitanische Vorfahren hatte Erinnerungen an ihre eigene Großmutter Wilhelmine geweckt.
Elisa hatte Wilhelmine Feldmeier, die Mutter ihres Vaters Edoardo, nie persönlich kennengelernt, aber ihre weit entfernt lebende Vorfahrin hatte Elisas Kindheit und Jugend dennoch stark beeinflusst.
Offiziell sprach man in der Familie Santoro nicht über sie, aber manchmal, besonders wenn Edoardo nicht zugegen war, war ihre deutsche Großmutter doch ein Anlass für boshafte Bemerkungen und Getuschel hinter vorgehaltener Hand. Bei diesen Lästereien wurde nie ihr Name genannt. Man sprach von la tedesca, der Deutschen, und verband damit stets eine moralische Botschaft, welche im Großen und Ganzen darauf hinauslief, dass diese Frau alles verkörperte, was gegen Sitte und Anstand verstieß. Mach es wie la tedesca, und das ewige Höllenfeuer ist dir sicher, lautete die unterschwellige Drohung. Was Edoardo anging, war man dagegen gern bereit, seine Charakterdefizite zu entschuldigen. Der arme Edoardo, was für eine Bürde er doch zeit seines Lebens zu tragen hatte, mit so einer Mutter …
Elisa, hieß es, komme leider ziemlich nach la tedesca. Solche Aussagen, stets begleitet von einem klagenden Seufzer, weckten erst recht Elisas Neugierde. Welches junge Mädchen wollte nicht gerne möglichst viel über eine Person wissen, der man angeblich ähnelte, und sei sie noch so verdorben und des Teufels? Folglich übte Wilhelmine Santoro, geborene Feldmeier, ein Kind des Fin de Siècle, auf ihre Enkelin Elisa Santoro, die mitten im Zweiten Weltkrieg geboren wurde, einen unwiderstehlichen Reiz aus. Dass die Spurensuche einigermaßen mühsam war, machte die Sache nur noch interessanter.
Niemand in der Familie war bereit, Elisa etwas über das Leben ihrer Großmutter zu berichten, am wenigsten derjenige, der am meisten über sie wusste: ihr Vater Edoardo Santoro. Erwähnte man die Persona non grata in seiner Gegenwart, bekam er diesen bitteren Zug um den Mund, und die Ader an seiner Schläfe schwoll an. Diese Warnzeichen hielten alle, die ihn kannten, von weiteren Nachfragen ab, auch Elisa.
Dennoch, aus aufgeschnappten Bemerkungen, erlauschten Gesprächen und dem Dorfklatsch konnte sich Elisa im Lauf der Jahre einiges über ihre Nonna zusammenreimen.
Wilhelmine Feldmeier stammte aus München-Grünwald, wo sie im Jahr 1893 geboren wurde. Sie war die Jüngste von vier Kindern, das verwöhnte Nesthäkchen eines Textilfabrikanten und der Tochter eines Professors der Chirurgie. Münchener High Society also. Rasch besetzte Wilhelmine innerhalb ihrer Geschwisterreihe die bis dahin vakante Rolle des schwarzen Schafes. Ein Part, den Elisa zwei Generationen später aufnehmen und neu interpretieren sollte.
Die anderen drei Kinder der Feldmeiers liefen in der vorgezeichneten Spur. Arthur, der Älteste, war in die Textilfirma eingestiegen und bereits die rechte Hand des Vaters. Agathe, die Zweitälteste, war mit dem Sohn eines Geschäftspartners verlobt, und Cornelius, die Nummer drei, hatte gerade sein Examen in Jura abgeschlossen. Wilhelmine jedoch löste sich aus der Rolle der braven höheren Tochter, indem sie eine Bildungsreise durch Italien nutzte, um auf Capri hängen zu bleiben. Es war die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, und schon damals war die Felseninsel im Golf von Neapel ein Anziehungspunkt für die Boheme aus ganz Europa. Die Feldmeiers waren zwar nicht Boheme, sondern Ärzte und Fabrikanten, aber es handelte sich bei ihnen um gebildete, weltoffene Menschen. Daher gestanden sie ihrer Jüngsten, die zweifellos eine kreative Ader besaß, einen gewissen Freiraum und ein paar Kapriolen zu. Sollte die anstrengende junge Frau doch ruhig eine Weile dem Laisser-faire huldigen, ein wenig zeichnen und malen und sich in Selbstfindung üben. Gab es denn nicht in fast jeder Familie einen bunten Vogel? Warum eigentlich sollte keine Künstlerin aus ihr werden? An der Seite eines künftigen Ehemannes, der sie versorgte, während sie ihr Talent kultivierte, könnte das durchaus eine Bereicherung für die Familie sein, solange sie dabei Mann und Kinder nicht vernachlässigte. Zudem war Capri ja nicht irgendeine Insel, sondern beherbergte zahlreiche Müßiggänger von Rang und Namen. Folglich ließen die Feldmeiers sich nicht lumpen und gestanden Wilhelmine für eine gewisse Zeit eine großzügige Apanage zu, damit sie sorglos und standesgemäß unter ihresgleichen leben konnte.
Doch Wilhelmine zog es nicht zu den Reichen und Berühmten, auch wenn sie hin und wieder als Gast in der Villa Krupp weilte und mit etlichen auf Capri gestrandeten Künstlern verkehrte. Sie schloss sich einem losen Haufen von Zurück-zur-Natur-Bewegten an, die eine pflanzliche Ernährungsweise propagierten, mit Drogen experimentierten, der Freikörperkultur anhingen und obskure Zeremonien zur Verehrung alter Gottheiten in Capris Höhlen durchführten. Gut fünfzig Jahre später nannte man solche Leute Hippies. Schon dieses Betragen hätte wahrscheinlich gereicht, um das Missfallen der Feldmeiers zu erregen, doch München war weit weg und die Familie gutgläubig und ahnungslos. Dann aber schoss Wilhelmine endgültig über das Ziel hinaus.
Im Frühjahr 1914 verliebte sie sich, warum auch immer, in einen Bauernsohn aus Anacapri namens Silvano Santoro, dessen Familie Gärten mit Zitronen- und Olivenbäumen besaß. Silvano Santoro war der älteste und einzige Sohn. Er hielt ein paar Wollziegen und hatte darüber hinaus nicht viel zu bieten, wenn man von einem attraktiven Äußeren einmal absah.
Im Sommer 1914 – gerade war der Große Krieg ausgebrochen, an dem Italien sich jedoch erst ein Jahr später beteiligen sollte – schrieb Wilhelmine ihren Eltern, sie habe sich mit Silvano verlobt und wolle mit ihm ein einfaches Leben im Einklang mit der Natur führen. Sie sei unheimlich glücklich und mit sich im Reinen und entsage hiermit dem Luxusleben ihrer Familie und der Großstadt München. Dem Brief lag eine kolorierte Bleistiftskizze bei, welche die junge Künstlerin angefertigt hatte. Die Zeichnung zeigte sie selbst und einen jungen Mann vor einem schlichten weißen Quader, der inmitten eines Zitronenhaines stand und offensichtlich das Haus darstellte, in dem das junge Paar künftig leben wollte.
»Das ist eine Hütte!«, klagte Frau Feldmeier entsetzt. Woher sollte sie ahnen, dass das Haus eine eklatante Verbesserung des Lebensstandards ihrer Tochter darstellte, hatten die Anhänger der Freikörperkultur doch sogar in Höhlen gehaust.
Alarmiert von solchen Neuigkeiten, schickten die Feldmeiers ihren jüngsten Sohn Cornelius nach Capri. Er solle seine Schwester zur Vernunft und nach Hause bringen. Zu ihm, dem Jurastudenten, hatte Wilhelmine den besten Draht. Er war ihr Lieblingsbruder, sie waren nur ein Jahr auseinander, während zwischen Wilhelmine und den älteren Geschwistern, Arthur und Agathe, zehn beziehungsweise acht Jahre lagen.
Cornelius kam drei Tage zu spät. Als er auf der Insel eintraf, hatten Wilhelmine und Silvano sich schon in der Kirche San Michele in Anacapri das Jawort gegeben. Strahlend empfingen die Frischvermählten den Bruder und Schwager in dem kleinen einstöckigen Bauernhaus mit den bunten Bodenfliesen.
»Ich erkenne erst jetzt, was für ein dekadentes Leben wir zu Hause führen, Nello. Der Mensch kann mit so wenigen Dingen auskommen und zufrieden sein«, verkündete Wilhelmine.
Nachdem Cornelius sich an Plumpsklo und Wasserpumpe gewöhnt hatte, wäre auch er fast dem Charme der Insel erlegen, zumal zu Hause nur Krieg und schlechtes Wetter auf ihn warteten. Außerdem hatte er möglicherweise ein Techtelmechtel mit seiner Schwägerin Stefania, einer jungen Witwe von vierundzwanzig Jahren. Ob dies wirklich zutraf, wurde allerdings nie ganz aufgeklärt. Sicher ist, dass er drei Monate auf Capri verbrachte und dem Schwager beim Bau eines neuen Hauses half. Schließlich aber kehrte Nello doch pflichtbewusst zurück nach Deutschland, meldete sich freiwillig zum Militärdienst und kam ohne sein rechtes Bein von der Front zurück.
Die Familie des Bräutigams war ebenfalls nicht glücklich über die Heirat ihres Sohnes mit der verrückten Deutschen. War ihnen überhaupt klar, dass Wilhelmine aus einer sehr respektablen und wohlhabenden Familie stammte, also eine wirklich gute Partie war? Falls es so war, zählte das hier wenig. Moglie e buoi dei paesi tuoi, lautete das Motto, was so viel hieß wie: Such dir Ehefrau und Ochsen in deinen Dörfern.
Die Capresen sahen dem Treiben der Fremden auf ihrer Insel seit Jahrhunderten gezwungenermaßen zu, sie machten mit ihnen Geschäfte, aber ansonsten blieb man für sich. Schon gar nicht heiratete man eine Ausländerin, egal ob arm oder reich. Nein, man hatte sich für den Sohn eine Einheimische gewünscht, keine exzentrische Deutsche. Wer weiß, was diese seltsame junge Frau noch alles mit Silvano vorhatte. Am Ende entriss sie ihn der Insel und der Familie und zog mit ihm in den Norden, zu den Barbaren. Silvano war doch fast noch ein Kind, gerade erst zwanzig, ein Jahr jünger als seine Braut, von der man in Anacapri munkelte, sie habe den Jungen verhext.
* * *
Diese und andere Dinge erfuhr Elisa mit den Jahren aus verschiedenen Quellen. Eine davon war Großtante Stefania, die ältere Schwester ihres Großvaters Silvano. Stefania hatte Edoardo, den Sohn ihres Bruders Silvano und dieser Deutschen, praktisch aufgezogen. Sowohl aus Dankbarkeit als auch aus pragmatischen Erwägungen heraus nahm Edoardo seine Tante daher in seinen Haushalt auf, nachdem er seine Angela geheiratet hatte.
Zia Stefania, wie man sie nannte, ging Elisas Mutter Angela in Haus und Garten und bei der Kindererziehung zur Hand, ehe sie immer verrückter und damit selbst zu einer Last wurde. Ihr einst üppiger Körper schnurrte mit den Jahren zusammen wie eine Traube, die zur Rosine wurde, und ihrem Gehirn schien es ähnlich zu ergehen. Sie verwechselte Personen und wusste nicht mehr, welcher Tag heute war. Angela war stets dankbar, wenn Elisa sich um Zia Stefania kümmerte, ihr das Essen und die Wäsche brachte und zusammen mit ihr den Gemüsegarten in Ordnung hielt. Sie wunderte sich in solchen Momenten über ihre Älteste, die sich ansonsten, wo es nur ging, vor der Hausarbeit drückte. Bis Angela irgendwann doch misstrauisch wurde, hatte Elisa ihre Großtante längst über Wilhelmine ausgequetscht. Stefania wusste eine Stunde nach dem Mittagessen nicht mehr, was es gegeben hatte, aber was die ferne Vergangenheit anging, so arbeitete ihr Gedächtnis präzise, und Elisa scheute sich nicht, ihr Wissen anzuzapfen.
»Zia Stefania, erzähl mir von der Hochzeit von Nonno Silvano und Nonna Wilhelmine!«
Die Tante zog eine Grimasse und produzierte unter Zuhilfenahme von Mund und Handrücken eine pernacchia, ein ordinäres, flatulent klingendes Geräusch, eine für die Gegend typische Missfallensäußerung, ehe sie zu klagen begann. Ärmlich sei die Hochzeit gewesen, grundlos überhastet, eine Schande für die Familie. »Das Essen allein! Ein besseres Sonntagsessen, mehr war das nicht. Sie wollte es so, und Silvano hat gekuscht. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte es gar kein Fleisch gegeben, kannst du dir das vorstellen, Kind? Ein Hochzeitsessen ohne Fleisch!«
Was sollte auch dabei herauskommen, wenn man weniger als drei Wochen zur Vorbereitung hatte? Keine Verwandten der Braut seien da gewesen, nur ein paar komische Gestalten von dieser Sekte, bei der sie zuvor gelebt hatte. Und das alles in der glühenden, alles verdorrenden Augusthitze. »Wer heiratet denn bitte schön an Ferragosto? Der Brautstrauß war schon welk, ehe sie in der Kirche angekommen waren. Und dann das Kleid! Dieses Fräulein hätte genug Geld gehabt, um sich in Neapel das schönste Brautkleid machen zu lassen. Aber sie stellt sich in einem Leinenfetzen vor den Altar. Kein Schleier, nur ein Blumenkranz, der war natürlich auch sofort verwelkt. Dabei musste man froh sein, dass die zwei überhaupt den Weg in die Kirche gefunden haben. Denk dir nur, diese gottlose Person wollte sich von irgendeinem Quacksalber aus ihrer Sekte am Strand von Punta Carena trauen lassen!« An dieser Stelle pflegte sich Stefania zuerst zu bekreuzigen und danach die Hand mit ausgestrecktem Zeige- und kleinem Finger zu Boden zu richten, um den bösen Blick abzuwehren. »Wenigstens damit konnte Silvano sich durchsetzen. Mein Bruder stellte sie vor die Wahl: eine richtige Kirche und ein richtiger Pfarrer oder gar keine Hochzeit. Gerüchte hat es gegeben, was sich wohl unter dem weiten Kleid verbarg, und unsere Mutter, Gott hab sie selig, hat fast die ganze Hochzeit hindurch geweint. Aber nicht vor Glück.«
Da war nichts gewesen, unter dem Kleid.
»Dein Vater Edoardo wurde auf den Tag zwölf Monate später geboren, am 15. August 1915. Das arme Würmchen. Seinen Vater Silvano, meinen Bruder, hatten sie kurz zuvor zum Kriegsdienst eingezogen. Der Kleine hätte wahrlich eine bessere Mutter verdient. Wie sie ihn ständig herumgeschleppt hat, wie eine Affenmutter! Von einem Kinderwagen hielt sie nichts. Er war mit drei noch nicht richtig sauber, es hat sie gar nicht gekümmert. Wäre ich nicht gewesen, Gott weiß, ob dein Vater überlebt hätte.«
Es existierte ein Foto des Brautpaares. Silvano mit breiten Schultern, die Gesichtszüge mit der schmalen Römernase und dem etwas zu kleinen Mund wie gemeißelt. Schwarze Locken und sanfte schwarze Augen. Das Lächeln verhalten, als könne er noch nicht fassen, was ihm da gerade geschah. Seine Braut war so groß wie er und stand, ohne ihn zu berühren, neben ihm, aufrecht, mit zusammengezogenen Schultern, das Kinn etwas vorgeschoben und mit einem entschlossenen Ausdruck in den Augen. Auch bei ihr war nur ein sanftes Kräuseln ihrer schmalen Lippen zu sehen. Sie war keine ausgemachte Schönheit, aber in ihrem Blick lag etwas Wissendes, und ihre Züge ließen auf einen starken Willen und Intelligenz schließen – obgleich sie in jungen Jahren nicht unbedingt immer klug handelte. Die Last ihres langen, dunklen Haars drückte auf ihre schmale Gestalt. Sie trug tatsächlich nur ein schlichtes weißes Hängekleid ohne Ärmel, das die mageren Arme entblößte. Ihre Hände, groß und sehnig, hielten einen Blumenstrauß im Würgegriff. Besagten Blumenkranz hatte sie entweder schon abgenommen, oder er war Stefanias Fantasie entsprungen.
Das Foto hing heute in Silber gerahmt und an prominenter Stelle über dem Kaminsims in der Villa der Feldmeiers in Grünwald. Sie würde es mitnehmen, beschloss Elisa in ihrem Krankenhausbett. Nach Capri. Mit diesem Gedanken glitt sie in den Schlaf.
Kapitel 3
Die Sache mit Oskars Zimmer
München, Gegenwart
Catia saß auf dem Bett, das Gesicht zur Tür gewandt. Draußen dämmerte es bereits, das Zimmer lag im Halbdunkel. Sie starrte ins Leere, Tränen standen in ihren Augen.
»Möchten Sie darüber reden?« Signora Santoro hatte ihr Schläfchen beendet und sich aufgesetzt.
Catia wischte sich verlegen über die Wange.
»Es ist nichts, nur … es kommt gerade einiges zusammen.«
Die alte Dame schwieg und schien geduldig auf detailliertere Informationen zu warten. Ihr Konzept ging auf. Catia verspürte plötzlich den Drang, ihr Herz auszuschütten. Vielleicht würde es ihr guttun, mit einer Person zu sprechen, die sie schon bald nie wieder sehen würde. Wenn Catia sich bei ihrer Mutter über ihre Lebensumstände beklagte, führte das immer zu Streit. Eine Freundin, bei der sie sich ausheulen konnte, hatte sie nicht, denn um Freundschaften zu pflegen, fehlte es ihr an Zeit und Energie.
»Wir wohnen seit über zwanzig Jahren in Schwabing, in der Clemensstraße«, begann sie. »In einer Altbauwohnung. Sie hat ein gewisses bourgeoises Flair, ist aber viel zu klein für vier Personen. Schon seit unser Sohn Oskar zur Welt kam, wünsche ich mir, dass wir in die Vorstadt ziehen, aber Daniel, mein Mann, weigert sich, Schwabing zu verlassen.« Sie seufzte. »Ich befürchte, er ist im Herzen ein Snob, er liebt unsere Stuckdecken und das knarzende Parkett mehr als mich und die Kinder. Daniel ist Journalist und arbeitet für diverse Zeitungen. Er ist wirklich talentiert, ab und zu bringt er sogar einen Artikel in der Süddeutschen oder einer ähnlich großen Zeitung unter. Aber das mit der Festanstellung wird wohl nichts mehr werden, er hat das nur noch nicht realisiert. Bisher kamen wir einigermaßen über die Runden, ich verdiene ja nicht schlecht. Aber in letzter Zeit wachsen uns die Kosten über den Kopf. Wir heizen schon nur noch die Küche. Trotzdem redete er unserem Sohn zu, ein Jahr nach Australien zu gehen. Work and travel.« Catia schnaubte. Sie war nicht so zuversichtlich wie Oskar, dass das mit dem Work in Australien so einfach klappen würde. Wer wartete schon auf einen Achtzehnjährigen ohne jegliche berufliche Praxis und mit gerade einmal einem Semester BWL-Studium?
Die Signora schwieg noch immer, und Catia fing an, ihre Redseligkeit zu bereuen. »Entschuldigen Sie. Ich sollte mich nicht so gehen lassen.«
»Nur zu, ich habe ja gefragt«, erwiderte die Signora. Offenbar hatte sie nun aber doch genug von Catias Familiendramen, denn sie erkundigte sich: »Worin besteht Ihre Arbeit?«
»Ich bin bei einer Versicherung im Controlling. Eigentlich habe ich eine Ausbildung im Hotelfach. Ich war in Hotels in der Schweiz und in Österreich. Dann lernte ich Daniel kennen, und nachdem unsere Tochter Valentina da war, suchte ich nach einem Job mit regelmäßigen Arbeitszeiten. Dort bin ich dann hängen geblieben.«
»Also sind Sie diejenige, die die Familie über Wasser hält.«
Eine simple und wahre Feststellung, und doch klang es für Catia wie eine Anklage. Möglicherweise reagierte sie bei dem Thema auch etwas empfindlich. Was Daniel gerne als hippes, zeitgeistiges Familienmodell verkaufte, war für Catias Mutter Renata Anlass, regelmäßig darauf hinzuweisen, dass Catia den falschen Mann geheiratet habe. Nur weil sie in jungen Jahren auf diesen Pseudointellektuellen hereingefallen sei, müsse sie sich nun zeit ihres Lebens abstrampeln, während der feine Herr es ruhig angehen ließ. So lautete ihre Zusammenfassung der Ehe ihrer Tochter.
»Im Moment schon«, sagte Catia zu Frau Santoro und realisierte dabei, dass der Moment schon über zwanzig Jahre andauerte. Wie die Zeit verging!
Catia solle die Mutterschaft ruhig genießen, meinte Daniel nach Valentinas Geburt. Er würde die kleine Familie von den Früchten seiner geistigen Arbeit ernähren. Erst als der Dispo ausgereizt war und die Stadtwerke drohten, ihnen den Strom abzustellen, begriff Catia, dass Daniel zur Selbstüberschätzung neigte und nicht mit Geld umgehen konnte. Sie zog die Notbremse. Ab sofort durfte er die Freuden der Vaterschaft genießen, Catia meldete sich beim Arbeitsamt und bekam sofort einen Job als Aushilfskraft bei einer Versicherung. Nach einem Jahr bot man ihr eine Festanstellung an. Anders als andere Männer hatte Daniel kein Problem damit, dass seine Frau den größten Teil des Lebensunterhalts verdiente und sich um alles Finanzielle kümmerte. Er brachte die Kinder in die Kita und später zur Schule, und er war es auch, der Valentina und Oskar abends Geschichten vorlas, wenn Catia schon vor dem Fernseher eingeschlafen war. Aber Catia war zufrieden. Sie merkte, dass Daniel wesentlich besser mit den Kindern zurechtkam als sie. War der Nachwuchs versorgt oder schlief, flanierte Daniel gern und ausgiebig durch Schwabing. Das war sein Biotop, dort griff er die Themen für seine Artikel auf. Schon deshalb war ein Umzug in die Peripherie für ihn undenkbar. Stets stand er kurz vor seinem großen Durchbruch. Er verfolgte Projekte, die entweder im Sande verliefen oder nicht viel einbrachten. So wie dieses Buchprojekt über Schwabinger Originale – überwiegend abgerissene, kiffende Altachtundsechziger. Ein Wunder, dass er dafür einen Verlag gefunden hatte. Die Tantiemen aus dem Buchverkauf waren denn auch eher marginal.
Früher hatte Catia das alles weniger ausgemacht, doch in letzter Zeit merkte sie, wie ihre Kräfte nachließen. Sie fühlte sich, als würde sie eine abwärts führende Rolltreppe hinaufrennen. Was, wenn sie einfach stehen bliebe? Was schon? Sie würde alle in den Abgrund reißen.
Ein beredtes Schweigen breitete sich im Krankenzimmer aus, und Catia bereute schon, so viel von sich erzählt zu haben. Sie versuchte, das schiefe Bild, das sie von ihrem Leben gezeichnet hatte, wieder einigermaßen geradezurücken: »Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin glücklich, ich liebe meinen Mann. Ich bin nur gerade sehr gestresst und außerdem ziemlich wütend auf ihn.«
Die Signora hob fragend die Augenbrauen.
»Es ist wegen der Sache mit Oskars Zimmer …«
Catia brachte Oskar allein zum Flughafen. Daniel, der angeblich mit Hochdruck an einem Artikel arbeiten musste, verabschiedete sich zu Hause von seinem Sohn. Catia nahm ihm das übel. Wie konnte irgendein Artikel wichtiger sein, als seinem Sohn, den er ein Jahr lang nicht sehen würde, bis zum letzten Augenblick nahe zu sein? Oskar schien es nichts auszumachen. Auch dass seine Schwester Valentina nicht da war, entlockte ihm kein Wort des Bedauerns. Was sind wir nur für eine desolate Familie?, dachte Catia, als sie und ihr Sohn sich allein in der S-Bahn gegenübersaßen. Sie betrachtete sein schmales Gesicht mit den großen grauen Augen. Er hatte ihre Augen und ein bisschen auch ihr Gesicht, die hohen Wangenknochen, die schmale Nase. Ihr war elend zumute. Er war doch noch so ein Kind! Was, wenn ihm am anderen Ende der Welt etwas zustieß? Selbst wenn alles gut ging, würde Oskar als ein anderer zurückkommen. Gereifter, erwachsener. Was ja irgendwie auch der Zweck dieses Aufenthalts war, doch der Gedanke daran schmerzte Catia.
Sie war nie eine Glucke gewesen, wirklich nicht. Als Kleinkinder hatten die beiden mehr Zeit mit Daniel verbracht als mit ihr, und Catia war an manchen Tagen dankbar gewesen, ins Büro zu dürfen. Jetzt fiel es ihr umso schwerer loszulassen. Valentina hatte sich bereits von ihr entfernt, wenn auch mehr geistig als räumlich, und nun entglitt ihr auch noch Oskar. Verschwand auf einen anderen Kontinent, Australien, so weit weg, wie es nur ging. Zu ihrer Traurigkeit gesellte sich eine unterschwellige Wut auf Daniel, der Oskar in dieser Sache bestärkt hatte, anstatt sie ihm auszureden.
Am Terminal tauchte Valentina auf, um ihren Bruder noch einmal zu drücken. Mit ihr hatte Catia am wenigsten gerechnet, umso dankbarer war sie ihr. So musste sie nachher nicht allein zurückfahren. Davor hatte sie sich gefürchtet: allein in der S-Bahn zu sitzen, ohne Oskar. Eine Verlassene.
Als Oskar seinen Riesenrucksack aufgab und schließlich durch den Sicherheitscheck verschwand, war es mit Catias Beherrschung vorbei, sie weinte hemmungslos. Ihr Inneres fühlte sich wund an.
Valentina reichte ihr ein Taschentuch: »Beruhige dich, Mama. Er zieht schließlich nicht in den Krieg.«
Später, in der Bahn, legte Valentina in einer ungewohnt fürsorglichen Geste den Arm um ihre Mutter und meinte: »Keine Sorge, der wird in einem Vierteljahr wieder da sein, vorausgesetzt, ihr bezahlt ihm den Rückflug. Er wird wieder ein Studium anfangen und abbrechen und bis dreißig an deinem Rockzipfel hängen.«
Valentina übertrieb natürlich, aber ganz unrecht hatte sie nicht. Sie war zweiundzwanzig und deutlich zielstrebiger als ihr Bruder. Im Sommer würde sie ihren Bachelor in Kommunikationswissenschaften abschließen und vielleicht noch einen Master draufsetzen. So gesehen war alles in Ordnung mit ihr. Doch seit sie diesen Freund hatte, über den sie nichts erzählen wollte, war Catia auch ihretwegen beunruhigt. Warum machte sie so ein Geheimnis daraus? War er verheiratet? Dann könnte sie wohl schlecht tagelang bei ihm sein. Auf jeden Fall war er ein gutes Stück älter als sie. Catia hatte neulich vom Fenster aus beobachtet, wie Valentina aus einem Volvo-Geländewagen stieg. Den Fahrer konnte sie von oben nicht erkennen, aber so ein Auto war keines, das gleichaltrige junge Männer fuhren. Die fuhren heutzutage Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
»Kommst du heute zum Abendessen?«, fragte Catia.
»Ich weiß noch nicht. Rechne lieber nicht mit mir.«
»Du kannst deinen Freund ruhig mitbringen.«
Valentina runzelte verärgert die Stirn.
»Warum nicht? Was stimmt nicht mit ihm?«
»Siehst du! Allein deswegen mag ich ihn nicht mitbringen. Ich habe keine Lust, ihn von euch beurteilen zu lassen wie einen … Bewerber, den man auf Schwachstellen abklopft. Du würdest deine typischen Muttifragen stellen, Papa würde mit seinem kleinbürgerlichen Bildungskanon protzen, und es wäre einfach nur peinlich.«
»Seit wann ist dir dein Vater peinlich?«
Sie antwortete nicht.
»Mit deinen anderen Freunden hattest du dieses Problem aber nicht.«
Valentina verdrehte die Augen. »Es liegt nicht an Tom, es liegt an mir, kapier das doch endlich, Mama! Ich bin alt genug, mir meine Freunde selbst auszusuchen.«
»Als hätten wir dir jemals einen ausgesucht!«, protestierte Catia und fuhr fort: »Valentina, ich möchte ihn einfach nur kennenlernen. Du bist meine Tochter, du verbringst ganze Tage bei einem Menschen, über den ich nichts weiß, außer dass er Tom heißt!«
»Du bist ein Kontrollfreak, Mama, das ist dir schon klar?«
»Schließlich bin ich Controllerin«, meinte Catia matt.
»Ich muss hier aussteigen.« Valentina stand ruckartig auf.
»Was willst du denn am Ostbahnhof?«
»Meine Ruhe.«
Weg war sie. Catia hätte nicht damit anfangen sollen, nicht ausgerechnet heute. Valentina war wegen Oskar zum Flughafen gekommen, aber sie hatte sich ihr, Catia, endlich wieder einmal zugewandt. Und was tat sie? Sie vermasselte es prompt.
Catia hatte den Tag freigenommen. Sie ahnte, dass ihr der Abschied von ihrem Sohn schwer zu schaffen machen würde, sie wollte nicht mit verheulten Augen im Büro erscheinen. Doch es war nicht nur das. Seit ein paar Tagen waren diese Schmerzen wieder da, ein diffuses Ziehen zwischen Bauch und Rücken, nicht genau zu lokalisieren. Manchmal gingen sie von selbst wieder weg, manchmal halfen nur starke Schmerzmittel. Oder eine Operation. Ihr Hausarzt appellierte jedes Mal, wenn Catia ihn um ein neues Rezept bat, an ihre Vernunft und meinte, es sei das letzte Mal, dass er ihr etwas aufschrieb. Sie versprach ihm dann, sich beim geringsten Anzeichen einer neuen Kolik von ihm einweisen zu lassen. Nur jetzt passe es eben gerade gar nicht. Oft war danach monatelang Ruhe, und ihr Arzt vergaß seine Drohung und Catia ihr Versprechen.
Was also anfangen mit dem freien Tag? Sie gönnte sich seit Langem wieder einmal einen Bummel durch die Innenstadt, doch es war kalt und windig, und einen Trostkauf konnte sie sich nicht leisten. Die Kosten für Oskars Flug – Daniels Geschenk an seinen Sohn zum Achtzehnten – hatten arg ins Kontor geschlagen, und an die nächste Heizkostenabrechnung durfte sie erst recht nicht denken, sonst bekam sie Panik.
Sie ging nach Hause und schleppte sich die Treppe hinauf. Ihr war, als wiege sie plötzlich das Doppelte. Ein Krampf durchzog ihren Körper, sie musste stehen bleiben und sich am blank polierten Handlauf festhalten. Ein Brocken Putz lag auf den Stufen. Seit Jahren wurde in diesem Achtparteienhaus so gut wie nichts renoviert, weder im Hausflur noch in den Wohnungen. Das Haus, scherzte Daniel zuweilen, glich immer mehr einem dieser bröselnden Paläste in Havanna, deren morbider Charme und verblasste Grandezza einst beide fasziniert hatten. Klar, auf Hochzeitsreise und bei karibischen Temperaturen findet man so etwas romantisch.
Seit Oskar mit vier Jahren ein eigenes Zimmer verlangt und bekommen hatte, schliefen Daniel und Catia im Esszimmer, in dessen Erker Daniel seinen Arbeitsplatz eingerichtet hatte. Es war mit dem Wohnzimmer durch einen breiten Durchgang verbunden. Ursprünglich hatte es dort Flügeltüren gegeben, die Angeln waren noch zu sehen, aber die Türen waren abhandengekommen. Immerhin hatte das Haus zwei Kriege überstanden. Also musste es ein Vorhang aus einem dicken goldfarbenen Stoff tun. Catia fühlte sich dahinter nie mehr richtig geborgen. In gewissen Situationen, fand sie, ging doch nichts über eine geschlossene Schlafzimmertür. Erst recht, wenn man zwei Kinder hatte.
Als Catia die Wohnung betrat, saß Daniel in Oskars Zimmer auf dem Fußboden, umgeben von Kartons. Er wandte sich um, seine Augen leuchteten. »Endlich kann ich meine alte Eisenbahn wieder aufbauen!«
Catia, normalerweise stets harmoniesüchtig und friedfertig, schleuderte Daniel ihre Handtasche in den Rücken und schrie ihn an, was ihm einfiele, ob sie hier denn überhaupt nicht mehr zähle, ob es ihm nicht eine Sekunde lang in den Sinn gekommen sei, sie zu fragen, ob sie vielleicht ebenfalls Pläne mit dem Zimmer habe.
»Hast du denn Pläne mit dem Zimmer?«, fragte Daniel, während er sich aufrappelte und die Tasche betont sachte auf Oskars Schreibtisch stellte.
»Mir wäre schon noch etwas eingefallen.«
Eine erbärmliche Antwort! Ein konkreter Plan, ein Projekt, hätte in Daniels Augen ihren Ärger berechtigt erscheinen lassen. So wirkte sie einfach nur hysterisch.
Bis ihr etwas eingefallen sei, meinte ihr Mann mit provozierender Überlegenheit, könne er ja die Eisenbahnanlage ausprobieren.
Catia ertrug seine Gegenwart nicht länger. Sie brachte im Bad ihr Gesicht einigermaßen in Ordnung und fuhr zur Arbeit. Wohin sollte sie auch sonst? Zu ihrer Mutter, um sich einen Vortrag der Sorte Augen auf bei der Wahl des Ehemanns anzuhören? Die Arbeit würde ihr helfen, sich abzulenken.
Eine Stunde später krümmte sie sich vor Schmerzen hinter ihrem Schreibtisch und wollte wieder nach Hause, doch Jakob Pfaller ließ sie nicht gehen. Zusammen mit einer Kollegin schleppte er Catia in den Sanitätsraum und rief den Rettungsdienst.
»Und jetzt bin ich hier, in der Klinik«, beendete Catia ihren Bericht.
»Kein Wunder, dass Ihnen bei alldem die Galle übergekocht ist«, konstatierte Frau Santoro. »Mir scheint, Ihr Mann hat keinerlei Respekt vor Ihnen.«
Das saß. Einen verwirrten Augenblick lang glaubte Catia, ihre Mutter zu hören. Aber die kannte Daniel wenigstens. Was fiel dieser Frau ein, über jemanden zu urteilen, den sie noch nie gesehen hatte? Sie kannte nur Catias Geschichte, diese kleine, vermutlich subjektiv gefärbte Momentaufnahme, aber weder Daniel noch die komplizierten Verflechtungen zwischen ihm und ihr. Sie merkte, wie Ärger in ihr hochkam. Geschieht mir recht, dachte sie. Was erzähle ich dieser Fremden auch meine intimsten Probleme?
»Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin«, hörte sie ihre Bettnachbarin sagen. Catia wollte gerade einlenken und versichern, dass es ihre Schuld sei, dass bei ihrem Gejammer leicht dieser falsche Eindruck hatte entstehen können, da fügte die Signora hinzu: »Aber bedenken Sie, Frau Heubeck, den Boten der Nachricht trifft keine Schuld.«
Catia schnappte nach Luft, eine scharfe Antwort lag ihr auf der Zunge, doch der Pfleger mit den tätowierten Armen kam herein und brachte ihnen das Abendessen. Für den Rest des Abends war es still im Zimmer. Catia tat, als würde sie lesen, und die Signora gab vor zu schlafen.
* * *
Am nächsten Morgen hatten sich Catias Kummer und Aufregung gelegt, und sie war auch nicht mehr eingeschnappt. Sie wünschte der alten Dame freundlich einen guten Morgen, und Frau Santoro antwortete mit einem warmen buongiorno.
Möglicherweise kamen Catias Gelassenheit und Großmut auch von der Tablette, die der Pfleger salopp als Leck-mich-Pille bezeichnet hatte.
Oskar hatte eine Nachricht geschickt. Er würde noch drei Tage in Sydney bleiben, dann herumreisen und sich unterwegs Jobs suchen, schrieb er, gefolgt von drei Herzchen. Auf dem angefügten Foto stand er vor der berühmten Oper, die Sonne schien, er trug kurze Hosen und Flipflops. Catia blickte automatisch zum Fenster. Nasse Schneeflocken wurden gegen die Fensterscheibe geweht und rutschten langsam daran hinab.
Zwei Krankenschwestern kamen herein. »Handy weg!«, trompetete die eine, und die andere löste die Bremse an Catias Bett.
»Es wird alles gut, Catia.« Die Signora nickte ihr zu. »Ich weiß das.«
Die Signora sollte recht behalten. Die Stunden nach der Operation verbrachte Catia auf einer Wachstation in einem entspannten Dämmerzustand. Sie stand noch unter der Wirkung von Schmerzmitteln und fühlte sich wohl und geborgen in diesem riesigen Klinikapparat. Alles Routine, alles easy. Sie würde ab jetzt gesund sein. Keine Koliken mehr, und vor allen Dingen: keine Angst mehr vor Koliken. Geradezu rosige Aussichten waren das.
Erst am späten Nachmittag rollte man sie zurück in ihr Zimmer. Das Bett am Fenster war leer. Nicht nur leer, sondern frisch bezogen und mit einer Plastikfolie bedeckt. Der sterile Anblick versetzte Catia einen Schrecken. »Ist sie …« Sie wagte nicht, den Satz zu beenden.
»Frau Santoro wurde heute entlassen«, sagte die Schwesternschülerin. »Sie hat Ihnen das da dagelassen.«
Neben Jakobs Blumenstrauß lag, sorgsam zusammengefaltet, die Decke mit den leuchtenden Farben. Dazu eine Visitenkarte und ein Zettel.
Liebe Catia, es ging nun doch schneller als vermutet mit meiner Entlassung. Die Decke soll Sie wärmen in Ihrer noblen, kalten Wohnung. Vielleicht melden Sie sich einmal? Ich würde gerne bei einer Tasse Tee erfahren, wie es Ihnen geht.
In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen,
Elisa Santoro.
Kapitel 4
Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann
München, Gegenwart
Die Villa in Grünwald lag ein ganzes Stück zurückversetzt vom Gehweg auf einem über viele Jahre hinweg eingewachsenen Grundstück. Altes Geld, dachte Catia beim Anblick des an den Jugendstil angelehnten Gebäudes und des großzügigen Gartens. Sehr viel altes Geld. Sie bereute schon, dass sie die Decke dabeihatte. Sie hatte sich zwischenzeitlich über den Wert von Ziegenhaardecken informiert und war ein wenig erschrocken. Das Geschenk erschien ihr viel zu wertvoll für die kurze Bekanntschaft mit Frau Santoro, deshalb wollte sie ihr die Decke lieber zurückbringen. Womöglich war sich die alte Dame gar nicht darüber im Klaren, was so etwas heutzutage kostete, oder sie war überhaupt ein wenig neben der Spur. Jetzt allerdings überlegte Catia, ob für jemanden, der so wohnte, eine Decke im Wert des Monatsgehalts eines Normalverdieners sonderlich bedeutsam war. Doch nun war es zu spät, wo sollte sie damit hin? Sie klingelte. Ein Summer ertönte, Catia drückte das Tor auf und stakste über den geräumten und mit Sand bestreuten Plattenweg des Vorgartens.
Eine Frau, etwa Mitte fünfzig und ganz in Schwarz gekleidet, begrüßte sie und nahm ihr den Daunenmantel und den wollenen Schal ab.
Frau Santoro erwarte sie im Wintergarten, erklärte die Frau und erkundigte sich, ob Catia Tee recht wäre oder lieber Kaffee?
»Tee ist in Ordnung«, sagte Catia.
Es ging durch ein riesiges Wohnzimmer mit alten Möbeln, deren Holz im milden Licht dezent goldbraun schimmerte, und großflächigen Bildern an den Wänden. Einige Motive erinnerten Catia an das Design der Wolldecke, die sie, in Folie gewickelt, unter dem Arm trug. Die Farben waren ähnlich kräftig. Blickfang des Zimmers war jedoch, zumindest für die seit Tagen frierende Catia, der Kaminofen in Form eines Glaswürfels. Wie schön musste es sein, sich dort am Feuer zu wärmen, wenn es draußen fror so wie jetzt.
Der Wintergarten glich einem Jugendstil-Gewächshaus und war mit Korbmöbeln mit hellen Brokatpolstern ausgestattet. Oleander-, Feigen- und Zitronenbäume fristeten ein mickriges Dasein unter der kraftlosen bayerischen Februarsonne, die durch die mit Sprossen unterteilten Fensterscheiben fiel. Der Garten hinter der Villa war noch einmal doppelt so groß wie der Vorgarten. Schneereste lagen auf dem Rasen, am Rand einer kahlen Buchenhecke lugten die ersten Schneeglöckchen aus der nassen Erde.
Vor dem Hintergrund der winterlichen Gartenlandschaft stellte die Signora einen kräftigen Farbtupfer dar. Ihr weiter wadenlanger Rock changierte in Türkis, Hellgrün und Purpur, dazu trug sie eine kirschrote Seidenbluse unter einer tiefblauen Steppweste. Die Sachen waren todschick für einen normalen Dienstagnachmittag, nur wirkten sie, als seien sie ihr eine Nummer zu groß. Wahrscheinlich hatte sie im Krankenhaus abgenommen. Sie sah gepflegt aus, aber nicht gesund. Das üppig aufgetragene Wangenrouge und der rote Lippenstift unterstrichen die Blässe ihrer Haut. Sie blieb auf Catias Bitte hin in ihrem Sessel sitzen, als sie ihrer Besucherin zur Begrüßung die Hand reichte.
Catia überlegte, ob sie schon einmal in einem Haus wie diesem gewesen war. Vielleicht mit Daniel auf irgendeiner Party, früher, als er noch in der Kulturschickeria verkehrte, in der Hoffnung, die eine oder andere Beziehung würde ihn direkt ins Feuilleton der Süddeutschen katapultieren.
Es war nicht nur die Größe und die Lage, die dieses Haus so besonders machten, es war vor allen Dingen diese exquisite Einrichtung, die mit jedem Gegenstand Geschmack und Kultur ausstrahlte, und dies – und das war das Besondere – auf eine so unangestrengte Weise, dass man sich in den Räumen sofort wohlfühlte. Bei aller Ungezwungenheit war Catia dennoch froh, dass sie ihre Jeans und den warmen Pullover gegen die grau melierte Hose, die hellblaue Bluse und den schwarzen Blazer getauscht hatte. Was sie in ihrer kühlen Wohnung einige Überwindung gekostet hatte.
»Catia, bitte setzen Sie sich. Ich freue mich, dass Sie sich gemeldet haben und so kurzfristig hergekommen sind.«
Tatsächlich war Catias Anruf bei Frau Santoro erst drei Stunden her, und deren prompte Einladung zum Tee kam dann doch reichlich überraschend. Sie plane eine Reise, hatte sie angegeben, und sei nur noch diese Woche hier.
Catia sank ihr gegenüber in einen der Korbstühle, der dabei leise knackte. Die Decke ließ sie verschämt neben sich auf den Boden gleiten, was Frau Santoros scharfen Augen jedoch nicht entging.
»Mögen Sie die Decke so sehr, dass Sie sie überallhin mitnehmen?«
»Sie ist wunderbar. Aber ich kann sie nicht behalten. Wie könnte ich so ein Geschenk annehmen, obwohl wir uns doch kaum kennen?«
»Ach, herrje! Sind Sie etwa auch so eine, die sich schwertut, sich etwas schenken oder helfen zu lassen?«
Catia musste darauf nicht antworten, denn die Signora signalisierte mit einer unwilligen Geste, dass sie sich nicht länger über derlei Petitessen unterhalten wollte. Zumal über der Armlehne ihres Sessels ein ähnliches Exemplar hing, und auf dem Polster der Chaiselongue, die direkt am Fenster stand, lagen zwei davon, nebeneinander und zusammengefaltet.
Die Haushälterin erschien und brachte ein Tablett mit einer Teekanne und zwei Gedecken aus dünnem weißem Porzellan. Auf einer Platte lagen Petits Fours, die allesamt wie Kunstwerke aussahen und bei denen Catia das Wasser im Mund zusammenlief.
»Frau Bierbichl, wenn Sie noch im Wohnzimmer den Kaminofen anheizen würden – danach können Sie gehen, den Rest schaffe ich alleine.«
»Gut, dann bis morgen, Frau Santoro.«
Die Hausherrin wartete, bis Frau Bierbichls Schritte verhallt waren, und wandte sich dann mit aufmerksamem Blick an Catia. »Wie geht es Ihnen?«
»Gut, danke.«
»Sie sehen besser aus als neulich. Ich musste oft an Sie denken. Ich hätte Sie nach der Operation noch gerne getroffen, aber man hat mich nicht zu Ihnen gelassen.«
»Es lief glatt, und ich darf auch alles essen.«
»Dann langen Sie zu!«
Zehn Tage waren seit der Operation vergangen, und sie merkte wirklich nichts mehr davon.
»Und wie geht es Ihnen, Signora?«, fragte Catia nach einem Bissen von einem in Pistaziengrün kuvertierten Küchlein.
Frau Santoro stellte die Teetasse ab. Die dünnen Goldarmreifen an ihren mageren Handgelenken klirrten, als sie abwinkte. »Ach, in meinem Alter ist immer irgendetwas, am besten, man ignoriert es. Lassen Sie uns nicht von Krankheiten sprechen. Hat sich Ihre häusliche Situation denn inzwischen geändert?«
»Mein Mann behandelt mich seit meiner Entlassung aus der Klinik wie ein rohes Ei.«
»Was ist aus der Sache mit dem Zimmer Ihres Sohnes geworden?«
Dass sie sich daran noch erinnerte.
»Ich will es gar nicht mehr«, murmelte Catia und musterte dabei verschämt ihre Stiefeletten.
»Sie haben doch nicht etwa klein beigegeben?«
»Es steht unentschieden. Im Moment benutzt es keiner von uns, denn es ist sowieso nicht geheizt.« Catia hob wieder den Kopf und verkündete mit hochroten Wangen: »Aber etwas hat sich verändert. Ich habe meine Stelle gekündigt.«
»Interessant. Erzählen Sie!«
»Ich hatte mich letzte Woche noch krankschreiben lassen, ich wollte einfach mal durchatmen. Als ich gestern ins Büro kam, dachte ich zuerst, ich hätte mich im Stockwerk vertan. Da war nichts mehr wie vorher. Die Mitarbeiter haben ab sofort keine festen Schreibtische mehr, und statt des Besprechungsraums gibt es nun eine Couchlandschaft in Bonbonfarben.«
»Der Zeitgeist lässt grüßen«, warf die Signora ein.
»Signora Santoro, ich bin nicht von gestern und auch nicht unflexibel«, räumte Catia ein. »Trotzdem war ich schockiert. Da saßen Leute, die meine Kinder sein könnten und die ich gar nicht kannte, und meine neue Chefin wollte von mir erfahren, wie viele Tage Homeoffice ich in Zukunft machen wolle. Dabei besetzt ja Daniel seit zwanzig Jahren unser Homeoffice. Wissen Sie, es war ein gutes Gefühl, sich jeden Tag an diesen Schreibtisch zu setzen, an dem nur ich saß. So einen Ort habe ich zu Hause nicht. Meine persönlichen Sachen hatten sie in einen Karton getan, und es fühlte sich an, als hätten sie auch mich in einen Karton geworfen und in eine Ecke gestellt. Dann bat mich die neue Chefin in ihr Büro – sie hat natürlich schon noch eines für sich allein – und sprach mit mir über meinen zukünftigen Aufgabenbereich. Als ich merkte, dass es auf eine Degradierung hinauslief, wusste ich, es ist Zeit zu gehen.«
»Richtig so!«, sagte Frau Santoro mit Nachdruck. »Man darf sich nicht alles gefallen lassen. Nicht heutzutage, da gute Leute überall gesucht werden. Was meint denn Ihr Mann dazu?«
»Ich sage es ihm erst, wenn ich was Neues habe.«
Frau Santoro sah aus, als müsse sie mit sehr viel Beherrschung eine Bemerkung hinunterschlucken. Sie nippte an ihrer Teetasse und fragte dann: »Drücken Sie sich so lange auf Parkbänken und in öffentlichen Bibliotheken herum?«
»Nein. Ich sage, ich arbeite im Homeoffice.«
»Sie sind mir ja eine!«
Für einen Moment war es still. Aus dem Wohnzimmer hörte man das Knacken eines Scheits, was Frau Santoro an das Feuer erinnerte. Sie bat ihre Besucherin, etwas Holz nachzulegen. Catia kam der Bitte nach und verharrte noch kurz vor dem Ofen. Wie gut diese Wärme tat! In ihrer Wohnung herrschten nur noch um die achtzehn Grad. Wären sie und Daniel beizeiten umgezogen, grollte Catia, hätten sie jetzt vielleicht ebenfalls einen Kaminofen, wenn auch sicher keinen wie diesen hier. Catia ging etwas in die Knie und hielt ihren Rücken und ihr Hinterteil nah an die Scheibe. Könnte sie diese Hitze doch nur ein paar Stunden lang in ihren Knochen speichern! Während sie sich wärmte, betrachtete sie ein rundes, metallenes Wandregal im Art-déco-Stil, in dem allerlei exotische Gegenstände zur Schau gestellt wurden: Statuetten, Masken, Tongefäße. Ihr Blick wurde von einer Schwarz-Weiß-Fotografie angezogen, die Frau Santoro in jüngeren Jahren zeigte, mit einem breitkrempigen Hut auf dem Kopf und einer feinen Stola über einem im Wind flatternden leichten Sommerkleid. Sie wandte sich einem attraktiven, grau melierten Herrn in einem Leinenanzug zu. Das Paar posierte vor einem orientalisch anmutenden Gebäude. Sie schauten nicht in die Kamera, sondern blickten einander lächelnd an. Mit einer Hand hielt die Signora ihren Hut fest, während er einen Arm um ihre schmale Taille geschlungen hatte. Sie wirkten sehr vertraut und ineinander versunken, als würde für die beiden die Umgebung in diesem Moment gar nicht existieren. Das Foto, fand Catia, hätte auch das Kinoplakat zu einem altmodischen Liebesfilm sein können. Ein schönes, nicht mehr ganz junges Paar, das offenbar viel in der Welt herumgereist war und dabei kostbare Souvenirs gesammelt hatte. Und jetzt lebte die alte Dame offenbar allein in diesem Riesenkasten voller Kunst und Erinnerungen.
Catia stellte sich vor, wie ihre Gastgeberin nachher vor diesem Regal in diesem Ohrensessel unter der Leselampe Platz nehmen und die Flammen beobachten oder lesen würde. So kuschelig warm würde es sein …
»Sie haben ein wunderschönes Haus«, sagte Catia, als sie zurückkam. »Um den Kaminofen beneide ich Sie am meisten.«
»Deshalb müssen Sie auch Ihre Decke wieder mitnehmen. Ich will sie nicht wiederhaben, ich habe etliche davon.«
»Gut, wenn das so ist … Dann noch mal vielen Dank.«
»Das Haus ist alter Familienbesitz, aber es gehört mir nicht. Albrecht, mein Mann, starb vor drei Jahren und hat es seiner Stiftung vermacht, die sich der Förderung der schönen Künste widmet. Ich erhielt jedoch ein lebenslanges Wohnrecht.«
»Das würde mir auch schon reichen«, entschlüpfte es Catia.
»Essen Sie noch etwas«, forderte Frau Santoro sie auf, ehe sie unvermittelt feststellte: »Also sind Sie momentan quasi arbeitslos.«
»Hm«, nickte Catia, die gerade in einen winzigen Windbeutel gebissen und den Mund voller Vanillesahne hatte.
»Was wollen Sie in Zukunft machen, Catia?«
»Ich weiß es nicht. Es fühlt sich noch neu und seltsam an. Plötzlich hat man wieder so viele Möglichkeiten. Ich werde mich bei diversen Stellenbörsen im Internet registrieren und sehen, was sich ergibt.«
»Mir kommt gerade eine Idee.« Frau Santoro machte eine Kunstpause und trank von ihrem Tee. Die Petits Fours hatte sie noch nicht angerührt, während Catia sich gerade Nummer vier oder fünf einverleibte.
»Ich besitze ein Haus in meinem Heimatort Anacapri. Es ist mein Elternhaus, und ich habe vor, die nächsten Monate dort zu verbringen und es dann zu verkaufen. Um einen guten Preis zu erzielen, müsste es ein wenig hergerichtet werden. Es steht seit etlichen Jahren leer. Ich habe zwar einen Verwalter, dennoch hege ich gewisse Befürchtungen, was mich dort erwartet. Kurz und gut, ich möchte Ihnen einen Job anbieten, Catia. Ich bin, wie Sie sehen, nicht mehr ganz fit, ich würde mich wohler fühlen, nicht allein reisen zu müssen und jemanden zu haben, der sich um die Dinge vor Ort kümmert. Keine Angst, Sie müssten keine Möbel schleppen, Wände streichen oder Bäume entwurzeln, und Sie wären auch nicht die Putzfrau. Allenfalls würde ich Sie hin und wieder um die Zubereitung einer kleinen Mahlzeit bitten. Es wäre mir eine Erleichterung, wenn ich Sie an meiner Seite hätte. Sie beherrschen die Sprache, Sie sind nicht auf den Mund gefallen, Sie könnten mir in vielerlei Hinsicht behilflich sein. Und ich hätte ein wenig Gesellschaft.«
Catia wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Es wäre etwa für drei, vier Monate. Als Bezahlung biete ich Ihnen dasselbe, was Sie jetzt verdient haben, nur in bar und im Voraus und noch einen kleinen Bonus obendrauf. Wenn man unterwegs ist, möchte man sich ja auch etwas gönnen. Capri ist im Vorfrühling wunderschön, ehe die Touristenschwärme und das neureiche Gesocks auf ihren Jachten dort einfällt. Was meinen Sie?«
»Ich … ich weiß nicht recht.«
»Ihnen würde eine Luftveränderung sicher guttun, Catia. Man steigt außerdem gewaltig in der Wertschätzung der Männer, wenn man nicht ständig anwesend ist, glauben Sie mir.«
Catia fehlten noch immer die Worte. Sie nahm erneut einen Schluck Tee, er war kalt geworden.