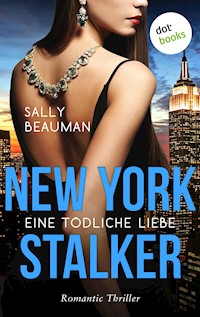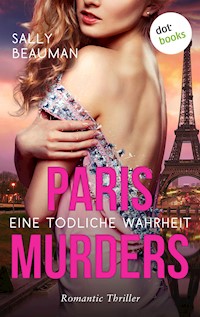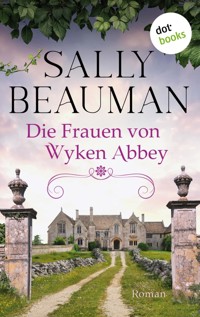
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn sich lange verborgene Gefühle entladen: Der Familiengeheimnisroman »Die Frauen von Wyken Abbey« von Sally Beauman jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Ort voller Schatten und wohlgehüteter Geheimnisse …Im langen, heißen Sommer des Jahres 1967 kommen die drei Töchter der Familie Mortland zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf der mittelalterlichen Abtei zusammen, in der die Familie wohnt – und jede scheint etwas vor den anderen zu verbergen: Da ist Julia, die blonde, kühle Schönheit, die davon träumt, in London Journalistin zu werden; die schüchterne Finn, die in Cambridge Literatur studiert; und schließlich Maisie, das Nesthäkchen. Selbst noch zu jung für eine Romanze, beobachtet sie Julia und Finn umso aufmerksamer, wenn der Medizinstudent Nicholas, der Nachbarsohn Daniel und der exzentrische Künstler Lucas zu Besuch sind. Und so ist sie die Einzige, die ahnt, welchen dunklen Geheimnissen sich die Mortland-Schwestern bald stellen müssen – und wie sehr sich ihr Leben dadurch ändern könnte … »Grandiose Charaktere und fulminante Schilderungen einer längst vergangenen Epoche. ›Die Frauen von Wyken Abbey‹ ist perfekte Unterhaltung.« Belfast Telegraph Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Schicksalsroman »Die Frauen von Wyken Abbey« von Sally Beauman. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Ort voller Schatten und wohlgehüteter Geheimnisse …Im langen, heißen Sommer des Jahres 1967 kommen die drei Töchter der Familie Mortland zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf der mittelalterlichen Abtei zusammen, in der die Familie wohnt – und jede scheint etwas vor den anderen zu verbergen: Da ist Julia, die blonde, kühle Schönheit, die davon träumt, in London Journalistin zu werden; die schüchterne Finn, die in Cambridge Literatur studiert; und schließlich Maisie, das Nesthäkchen. Selbst noch zu jung für eine Romanze, beobachtet sie Julia und Finn umso aufmerksamer, wenn der Medizinstudent Nicholas, der Nachbarsohn Daniel und der exzentrische Künstler Lucas zu Besuch sind. Und so ist sie die Einzige, die ahnt, welchen dunklen Geheimnissen sich die Mortland-Schwestern bald stellen müssen – und wie sehr sich ihr Leben dadurch ändern könnte …
eBook-Neuausgabe August 2022, Februar 2026
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »The Landscape of Love« bei Little, Brown, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Das Liebesgeheimnis« im Goldmann Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2005 by Sally Beauman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mk)
ISBN 978-3-98690-099-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sally Beauman
Die Frauen von Wyken Abbey
Roman
Aus dem Englischen von Angela Stein
Für Finlay und seine Eltern, James und Lucy
Immer wieder, ob wir der Liebe Landschaft auch kennen
und den kleinen Kirchhof mit seinen klagenden Namen
und die furchtbar verschweigende Schlucht, in welcher die andern
enden: immer wieder gehen wir zu zweien hinaus
unter die alten Bäume, lagern uns immer wieder
zwischen die Blumen, gegenüber dem Himmel.
Rainer Maria Rilke
Dann rief ich die Völker der Toten mit Bitten und Beten, packte die Tiere und schnitt ihnen über der Grube den Hals ab. Dunkel dampfend rann da ihr Blut. Aus dem Düster indessen kamen in Scharen die Seelen der lang schon gestorbenen Toten ... Zahllose drängten von sämtlichen Seiten heran an die Grube, lärmten, als sprächen Verzückte; – mich packte das bleiche Entsetzen.
Homer, Odyssee, Elfter Gesang
Teil 1
Fünf der Kelche
Wykenfield, Suffolk (Einwohner: 102. Gewerbe: Landwirtschaft)
Malerischer, idyllischer Weiler am Südufer des Flusses Wyke. Schöne Kirche aus dem 13. Jahrhundert, der heiligen Etheldreda, Gründerin des Klosters Ely, geweiht (gut erhaltener Lettner; Fragmente eines frühen Freskos, »Das Jüngste Gericht«, an der Nordwand des Kirchenschiffs). Interessant auch die Cottages aus dem Mittelalter und der Tudor-Zeit (besonders Nr. 29 in The Street) und »Der Grüne Mann« (in Richtung Dorfplatz und Teich; eindrucksvolles Fachwerk, schöne Stuckarbeiten, die einen Fuchs und eine Gans darstellen). Das Pfarrhaus (erbaut 1814, ein prächtiges Beispiel für den Baustil der damaligen Zeit), angrenzend an das Schulgebäude (erbaut 1879, weniger eindrucksvoll) und das Armenhaus (im Cottage-Orné-Stil erbaut von einem Schüler von Nash, gestiftet von der Familie Mortland [s. d.]), sind alle sehenswert.
Wyken Abbey (ca. zwei Kilometer nördlich des Dorfes; weitläufiges Gelände)
Das Kloster wurde 1257 von Isabella de Morlaix gegründet, Erbin, Cousine und Freundin von Winifride of Ely (s. d.). Sehr zum Ärger ihrer einflussreichen Familie weigerte sich Isabella, die Ehe einzugehen, und verschrieb sich ganz der Religion: Im Jahre 1258 wurde sie im zarten Alter von zweiundzwanzig Jahren erste Äbtissin der Wyken Abbey. Die Abtei, die unter dem Protektorat des Klosters von Deepden stand, blühte und gedieh bis ins 15. Jahrhundert und verlor dann an Einfluss. Zur Zeit des Act of Suppression lebten kaum mehr ein Dutzend Nonnen dort; sie verließen das Kloster schließlich im Jahre 1538. Das Land wurde von der Krone beschlagnahmt und Sir Gervase Mortland, einem Gefolgsmann Heinrichs VIII., übereignet, für seine Verdienste bei der grausamen Niederschlagung der Pilgrimage of Grace; große Teile der Abtei wurden später zerstört. Die verbliebenen Gebäude wurden vorübergehend von Bauern bewohnt, Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch verlassen. Im Jahre 1919 wurde die Abtei von Henry Mortland von Elde Hall (s. d.) bei Framingham vor dem Verfall bewahrt und restauriert.
(Einige Teile des mittelalterlichen Klostergebäudes in gut erhaltenem Zustand; andere stark zerstört oder durch unsensible und unfachgemäße Anbauten und Umbauten beeinträchtigt. Erhalten geblieben sind Kreuzgang, Refektorium und Teile der Marienkapelle aus dem 13. Jahrhundert. Der Graben entlang der Mauer, die das Gelände umgab, wurde trockengelegt. Das Hagioskop [ca. 1450} ist sehenswert und das einzige seiner Art im Lande; die Gründe für den Bau der Anlage, die nicht religiösen Zwecken diente, sind unbekannt. Der unterirdische Gang zwischen Klostergebäude und einem kleinen Bauwerk im nahe gelegenen Nun Wood wird in Dokumenten des Bistums aus dem 15. Jahrhundert erwähnt, sorgte jedoch in kirchlichen Kreisen für Kontroversen, weshalb man den Eingang abriss. Die Grundrisse des Baus sind noch erkennbar, doch dessen ursprünglicher Zweck – er diente eventuell der Kontemplation – konnte nie geklärt werden.)
Gegenwärtig befindet sich das Anwesen im Privatbesitz von Mr H. G. Mortland. Der Öffentlichkeit nicht zugänglich.
The King’s England Guides, Bd. VI: Suffolk (überarbeitet); K. M. James, 1938
Gott hat mir den Weg zu diesem Ort gewiesen. Als ich ihn erblickte, erkannte ich, dass er heilig war. Ich war erschöpft von der Reise, doch ich stieg vom Pferd und küsste die Erde. Die Steinmetze werden an Mariä Verkündigung mit der Arbeit beginnen. Ich habe den Lohn für ein halbes Jahr im Voraus bezahlt. Sagt mir, Herzensschwester, war das unklug von mir?
Briefe von Isabella de Morlaix an Winifride of Ely, 1257–1301; herausgegeben und aus dem Lateinischen übertragen von V. B. S. Taylor, 1913
Kapitel 1
Sommer-Maisie, 1967
Bei unserem ersten Aufenthalt in der Abtei regnete es fünf Tage lang von früh bis spät. Man hatte mich schon gewarnt, dass so etwas in England im Sommer und im Winter vorkommen kann, aber ich hatte es nicht glauben wollen. Jeden Morgen hockten wir stumm beim Frühstück. Großvater versteckte sich hinter seiner Zeitung, meine Schwestern blickten auf ihre Teller, und meine Mutter starrte Löcher in die Luft. Mich hatte man auf drei Kissen gesetzt, damit ich an mein Essen heranreichte. Die Welt vor dem Fenster war nass und todtraurig.
Damals waren die Lorbeersträucher am Haus noch unbeschnitten; sie schienen tiefschwarze Tränen zu weinen. Dahinter sah man eine Ecke des alten Klosters mit einem Wasserspeier, dem der Regen aus Mund und Augen schoss. Der Rasen war verwildert, und die Gräser ließen die Köpfe hängen wie eine Horde Büßer. Die Luft hier in England kam mir sonderbar dick und violett vor. Erbarmungslos fegte der Wind durch die Bäume; unter den Birken lagen abgerissene Gliedmaßen. Ich sah einen abgefallenen Arm, den Schenkelknochen eines Riesen und einen grässlichen knorrigen, von Efeublättern umwucherten Schädel mit zwei gewaltigen Augen. Ich wusste, dass sie beobachteten, wie diese ganze Trauer ins Haus sickerte. Sie betrachteten die Nässe, die an den Wänden entlangkroch, und zählten die Tropfen, die von der Decke fielen – in diesem Raum allein drei Eimer voll. Der Wind rumorte und heulte im Kamin, die Fenster klapperten. »Tja, Kinder«, sagte Stella in diesem trockenen Tonfall, der nie Gutes verhieß, »heute können wir nicht spazieren gehen.«
Fünf Tage lang machte sie diese Bemerkung jeden Morgen zur selben Zeit. Am sechsten Tag schloss sie sich in ihrem Zimmer ein. Wir versuchten es mit den üblichen Tricks: Blumen, Romane, Essen. Julia brachte ihr ein Tablett hinauf, Finn kam mit Büchern, ich pflückte mit Finns Hilfe im Nun Wood einen Strauß blaue Glockenblumen (Hyacinthus nonscriptus). Am dritten Tag standen sie immer noch vor der Tür.
Inzwischen schien draußen die Sonne. Stella wollte sich nicht in dem großen Zimmer aufhalten, in dem früher Daddy und sie geschlafen hatten. Sie hatte sich in einer hässlichen kleinen Kammer auf dem Dachboden einquartiert, wo die Nonnen früher ihre Zellen gehabt hatten. In den dunklen engen Fluren dort oben roch es modrig. Das Wasser in dem Marmeladenglas war verdunstet, die Glockenblumen vertrocknet. Die Zigaretten, den Jack Daniels und die kleinen Sandwiches hatte sie nicht angerührt. Finn zählte die Bücher. Sie hatte sechs mitgebracht; Betty und ihre Schwestern, Mansfield Park, Jane Eyre, Der geheime Garten und Große Erwartungen lagen noch da, aber eines fehlte – ich glaube, es war Entführt. »Immerhin ein Fortschritt«, meinte Finn und horchte an der Tür; kein Laut war zu hören. Die Luft in dem Haus ist eigenartig, wie du weißt, irgendwie schwer und lastend, was uns damals zu Anfang besonders auffiel, und so kam es uns vor, als belausche sie uns auch, während wir an der Tür lauschten. Es war ziemlich unheimlich.
Nach einer Weile meinte Finn, sie könne hören, wie Buchseiten umgeblättert würden. Erleichtert setzten wir unsere Erkundungstour fort. Wir streiften durch die Bibliothek, die damals noch staubiger und verfallener wirkte als heute. Großvater meinte, dort sei früher die Marienkapelle gewesen. Wo heute der Kamin ist, stand damals der Altar – wusstest du das? Wir probierten das berühmte Hagioskop aus, was erstaunlich gut funktionierte. Beim ersten Mal fanden wir noch nicht heraus, was so sonderbar daran ist. Dann sahen wir uns die Gärten, die Wälder, das Dorf, die Obstgärten, den Teich und den Black Ditch an ...
»Hast du die Buchseiten auch gehört?«, unterbricht mich Lucas, als ich gerade in Fahrt komme. Mit gezücktem Stift schaut er von seinem Skizzenblock auf. Ich werfe einen verstohlenen Blick auf die Seite, die eindrucksvoll aussieht, ein Geflecht aus Schraffierungen und diesen Schatten, die Lucas erzeugt, indem er mit dem Daumen übers Blatt wischt. Aus diesen schwarzweißen Mustern werde ich, Maisie, entstehen.
Solange mein Porträt noch nicht fertig ist, ist es ein Geheimnis; Lucas entgeht mein neugieriger Blick nicht, und er hält den Skizzenblock so, dass ich nichts mehr sehen kann. Ich denke über seine Frage nach. Das alles ist zehn Jahre her, und damals war ich noch klein. Es ist ein einschneidendes Erlebnis, wenn man seinen Vater verliert. Ich habe es damals nicht verstanden; wenn eine Tür aufging, wartete ich immer darauf, dass er hereinkam.
Deshalb sind all meine Erinnerungen an diesen ersten Sommer in der Abtei schwer zugänglich. Sie sind so klar und bunt wie die Abbildungen auf Spielkarten, aber sobald ich sie mir genauer ansehen will, bekomme ich Angst. Ich habe dann das Gefühl, dass sie nicht vollständig sind, dass der Zauberkünstler, der sie ausgeteilt hat, noch welche im Ärmel verbirgt. Er kann toll mischen, wie Dans Großmutter, aber es ist irgendein Trick dabei. Es geht nicht mit rechten Dingen zu.
Ich konzentriere mich auf die verschlossene Tür und die trockenen Sandwiches. Finn und Julia kauern neben mir. Eine Fliege stößt brummend an ein Fenster, das seit Jahrzehnten nicht geöffnet wurde. Schließlich meine ich auch, ein Rascheln zu hören, das von Buchseiten herrühren könnte. Doch an diesem Ort, an dem wir uns aufhalten, könnte ein solches Geräusch auch andere Gründe haben. Die Nonnen, die früher hier lebten, sind noch da, erkläre ich Lucas. Sie wandern durch die oberen Korridore, verweilen auf der Treppe; ihre Rosenkränze klappern, und ihre Röcke rascheln. Wenn man an ihnen vorübergeht, betrachten sie einen, geduldig und bleich, als seien sie sicher, dass man ihnen bald Gesellschaft leisten wird.
Sie sind seit achthundert Jahren tot – aber das hält sie nicht davon ab, hier umherzustreifen. Warum ruhen sie nicht in Frieden, wie Tote das tun sollen? Ich frage mich, warum ausgerechnet sie um mich herumgeistern und nicht die Menschen, die ich wirklich gerne sehen würde, meinen Vater zum Beispiel. »Ach, komm schon, Maisie«, sagt Lucas. »Hör auf damit. Diese Geschichte geht allen auf die Nerven, und langweilig ist sie auch. Es gibt kein Jenseits. Keinen Himmel, keine Hölle, keine Unterwelt, keinen Gott, keinen Teufel, keine Engel, Dämonen oder Geister. Und das sage ich dir jetzt zum tausendsten Mal: auch keine durchsichtigen Nonnen. Du bist ein vernünftiges Mädchen. Du weißt das ganz genau. Hör jetzt auf, dir diesen Humbug auszudenken, und sitz still.«
Lucas ist ein Ungläubiger und hat keine Ahnung. Doch er klingt gereizt, ich muss ihn wohl geärgert haben – er langweilt sich schnell. Deshalb sitze ich jetzt so still wie eine Zwergmaus (Micromys minutus), und nach einer Viertelstunde wird er weich, was ich schon vorhergesehen habe. Lucas hat nämlich ein Faible für meine Geschichten. Alle anderen hier haben nie Zeit, mir zuzuhören. Nicht jetzt, Maisie, sagen sie und weichen zurück. Aber Lucas ist versessen auf Informationen, und ich bin eine gute Historikerin; deshalb geben wir ein prima Paar ab. Ich weiche der Wahrheit nicht aus wie Stella, ich schweife nicht ab wie Großvater, ich lasse die unangenehmen, aber interessanten Stellen nicht aus wie Finn und Julia. Wenn man über dieses Gebäude und diese Familie etwas erfahren will – und das will Lucas –, sollte man immer mich fragen. Ich gebe die Geheimnisse gerne preis – und es gibt ziemlich viele. Ich mag zwar ein Kind sein, aber ich bin sehr aufmerksam, und das weiß Lucas. Raus mit der Sprache, sagt Julia immer. Mich muss man da nicht lange bitten. Nein, wirklich nicht.
»Wann ging es Stella wieder besser?«, fragt Lucas mit seinem leicht ironischen Unterton. »War Julia schon immer so schön? Und Finn schon immer so verschlossen? Wer hat den Löwen in der Bibliothek erlegt? Erinnerst du dich noch an Amerika? Nimmst du Milch oder Sahne in deinen Kaffee?« Er gähnt, dann blickt er mit zusammengekniffenen Augen auf, betrachtet mich genau, erschafft mich. Zwei schnelle Striche, eine Daumenbewegung. Ich mag Lucas. Er mag mich auch. Ich glaube sogar, dass er mich lieber mag als meine Schwestern, obwohl ich mich da vielleicht irre. Jedenfalls verstehen wir uns gut und finden das beide angenehm. Der Hauch eines Lächelns tritt auf sein Gesicht.
»Na komm schon, Maisie«, sagt er schmeichelnd. »Ich will alles wissen. Erzähl weiter.«
Es macht mir Spaß, Lucas’ Scheherazade zu sein, und er wird mich natürlich auch nicht umbringen, wenn meine Geschichten zu Ende sind. Aber es besteht die Gefahr, dass er sich langweilt. Deshalb bekommt er nie alles von mir, was er will. Das sollten meine beiden Schwestern auch bald lernen. Seine Fragen sind nicht so unschuldig, wie sie sich anhören. Manchmal habe ich den Eindruck, dass er etwas ganz Bestimmtes erfahren will, obwohl er das niemals zugeben würde. Heute glaube ich, dass er etwas über Dan hören möchte. Deshalb werde ich ihm ein paar Brocken hinwerfen, aber eben nur ein paar – um sein Interesse nicht zu verlieren, halte ich immer mit einigen Details hinter dem Berg.
Also mache ich ein Weilchen »hm« und »ähm« und gehe meine Erinnerungen durch. Eine sehe ich besonders deutlich, und so teile ich ihm mit, dass ich ihm etwas über Dans Großmutter erzählen werde, auch die böse Hexe oder die Zwergin genannt. (Den letzteren Spitznamen hat Julia erfunden. Er ist gemein, aber sie ist tatsächlich sehr klein.)
»Ich werde dir erzählen, wie sie uns die Zukunft vorausgesagt und uns die Karten gelegt hat«, fange ich an. Dann gerate ich ins Stocken. Da ist etwas Kaltes, Hartes in meinem Hals, als hätte ich versucht, einen großen Kieselstein zu schlucken. Er steckt mir im Hals fest. Ich kann ihn nicht ausspucken, aber auch nicht hinunterschlucken.
Lucas betrachtet mich aufmerksam. Er sieht freundlich aus, obwohl bestimmt niemand Lucas als freundlichen Menschen bezeichnen würde. Manchmal denke ich, dass ich ihm Leid tue, und dafür gibt es vielleicht auch Gründe – ich sitze hier in diesem Haus fest, mit meinem Großvater, der tattrig wird, mit Stella, die auf einem anderen Planeten lebt, und meinen beiden schrecklich schönen und klugen Schwestern. Man bemuttert mich, aber niemand hört mir zu. Wenn die Nonnen nicht mit mir reden würden, spräche gar keiner mit mir. Ich bin das Mädchen in der Ecke, das jeder übersieht. Brüste habe ich auch noch nicht. Doch, auf der Mitleidskala kann man mich schon recht hoch ansetzen.
»Dans Großmutter – und sie hat euch dreien die Karten gelegt? Hast du mitbekommen, was sie zu Finn und Julia gesagt hat?«
»Ja.«
»War Dan dabei?«
»Ja.«
»Wie alt warst du damals?«
»Warte mal.« Ich tue so, als müsste ich das ausrechnen, obwohl ich es genau weiß. Ich bin der Nachzügler der Familie, der letzte Versuch, noch einen Jungen zu bekommen. Meine Schwestern sind viel älter als ich. Ich war damals fast sieben, Finn vierzehn und Julia sechzehn. »Es war an Julias Geburtstag«, sage ich. »Deshalb sind wir zu Dans Großmutter gegangen. Um das Orakel zu befragen. An Geburtstagen ist das am günstigsten. Und es war Vollmond.«
»Starker Stoff.« Lucas wischt wieder ein bisschen übers Papier. Wenn das so weitergeht, bestehe ich nur aus Schatten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, höre ich eine vertraute Stimme in meinem Kopf. Denn du bist bei mir, antworte ich stumm.
»Sitz still, Maisie«, sagt Lucas. »Hör auf, herumzuzappeln.« Er runzelt die Stirn.
Die Mutter Oberin steht neben mir und lächelt. In ein paar Wochen wird Isabella dreiundzwanzig; sie hat flaschengrüne Augen und hält einen kostbaren Rosenkranz aus Jade in der Hand. Sie hat viele Verpflichtungen, findet aber immer Zeit für mich. Sie berührt meinen Arm, legt einen Finger an die Lippen, blickt auf Lucas und verschwindet dann lautlos. Lucas, der Ungläubige, bemerkt natürlich nichts. Draußen scheint die Sonne. Seit Wochen ist kein Regentropfen gefallen. Dieser Sommer ist golden, der schönste Sommer, den ich je erlebt habe. Wenn er zu Ende geht, werde ich verwandelt sein, ich spüre es. Ich werde kein Mädchen mehr sein, sondern eine Frau. Ich werde aus der Puppe schlüpfen, mit feuchten Flügeln, doch strahlend schön, eine neue Maisie!
Nach einer Weile sagt Lucas: »Gut – es ist also Hochsommer. Der Mond ist voll. Ihr geht ins Dorf, und Oceans Tochter legt euch die Karten. Und was hat die alte Hexe den drei Schwestern verhießen, frage ich mich? Einen Schatz? Ein Erbe? Eine Reise? Bestimmt einen Schatz. Einen großen dunkelhaarigen Fremden. So einen wie mich.«
»Nein, all so was nicht.«
»Das ist aber ungewöhnlich für eine Wahrsagerin«, erwidert er trocken. Er tut jetzt so geschäftsmäßig, aber ich weiß, dass er neugierig ist, und das gibt mir ein gutes Gefühl. Er hält den Skizzenblock schräg, damit ich nichts sehen kann, und sagt: »Hör zu, Maisie, du kannst reden, aber beweg deinen Kopf nicht mehr. Das Licht ist perfekt. Ein klein wenig nach links noch. Mach diesen obersten Knopf auf. Prima. Gutes Mädchen. Ich bin ganz Ohr. Erzähl weiter.«
Ich denke, ganz Ohr und auch ganz Auge. Lucas hat so viele Augen wie Argus, und wenn sich eines kurz schließt, bleiben die anderen neunundneunzig offen. Ihnen entgeht nichts. Wer mit Lucas zu tun hat, sollte das nicht vergessen. Und ich vergesse es auch nicht.
Ich versuche, trotz meiner Pose entspannt zu sitzen, mich zu konzentrieren und mir einen schlüssigen Bericht zurechtzulegen. Es ist kühl und still hier in Lucas’ behelfsmäßigem Atelier, einem großen Raum mit Steinboden und Kuppeldecke. Er entstand unter Isabellas Anweisungen im dreizehnten Jahrhundert und wurde im fünfzehnten Jahrhundert erweitert, zur Hochzeit der Abtei. Er diente einst als Refektorium und war durch Korridore mit den Kreuzgängen und den Hauptgebäuden des Klosters verbunden, doch diese Verbindungen wurden zur Zeit der Reformation vernichtet. In diesem abgeschiedenen Teil der Abtei kann man sich gut zurückziehen. Ganz entfernt höre ich Musik – Julia hört schon wieder ihre Jefferson-Airplane-Platte –, sie hat den Plattenspieler voll aufgedreht. Von diesem fremden Hämmern und Stöhnen abgesehen, sind alle anderen Geräusche, die man hier vernimmt, typisch englisch: das Summen der Bienen, das Rascheln der Ulmen, das Blöken der Lämmer. Die sind um diese Zeit des Jahres schon ziemlich fett geworden und werden bald zum Schlachthof geschafft.
Durch die sechs hohen Bogenfenster des Refektoriums blickt man nicht auf Gebäude, sondern auf Felder, Obstgärten und das Tal. Stella zog sich früher gerne hierher zurück. Sie wollte zu sich selbst finden, sagte sie, und dieser schöne stille Raum war ein geeigneter Ort dafür. Ja, es ist kalt hier im Winter, aber sie ist in Kanada aufgewachsen, englische Winter machten ihr keine Angst. Sie waren kurz, und es gab selten Schnee – wo war das Problem? Doch dann entdeckte Stella die englische Feuchtigkeit, die kalte Nässe von East Anglia, die in die Knochen kriecht und alles durchdringt. Und sie merkte, wie es sich anfühlt, wenn der Wind von Osten kommt, aus Sibirien, und über die Fens fegt.
Hier im Refektorium stößt man noch überall auf die Überbleibsel von Stellas vielen kurzlebigen Selbstfindungsversuchen: eingetrocknete Farben aus ihrer Aquarellzeit im Frühling, die Nähmaschine aus dem Sommer, in dem sie sich als Modedesignerin versuchte, die Objektive aus ihrer Fotophase, die klapprige Schreibmaschine, auf der sie Kurzgeschichten schrieb. Diese Phase war die letzte, und sie hielt am längsten an. Vielleicht hat Stella sich ja inzwischen gefunden (ich frage mich, wie das geht). Vielleicht hat sie es aber auch aufgegeben, sich zu suchen. Im Refektorium hält sie sich jedenfalls nicht mehr auf.
Das hat Lucas jetzt in Beschlag genommen. Er und Dan sind gerade aus Cambridge eingetroffen, zum letzten Mal. Sie haben die Prüfungen geschafft und kamen dann am Tag nach der Abschlussfeier mit üblem Kater hier an. »Unser letzter langer Urlaub«, erklärte Dan, »der soll auch richtig toll werden.« Dan ist jetzt oft bei uns in der Abtei; er könnte auch bei seinem Vater und seiner Großmutter im Dorf wohnen, aber er ist lieber hier. Er hat sich in seinem üblichen Zimmer im Haupthaus einquartiert und bleibt bis zum Ferienende. Lucas war auch schon öfter hier, aber er bleibt nie lange – er bleibt nirgendwo lange. Deshalb ist es erstaunlich, dass er diesmal offenbar anderes im Sinn hat. Ich wüsste auch nicht, wer ihn eingeladen haben sollte, außer vielleicht Finn. Er hat nicht angekündigt, wann er wieder abfahren will – wenn die Ferien vorbei sind, vielleicht früher, vielleicht auch später. Lucas macht nie Pläne – oder jedenfalls spricht er nicht darüber. Er kommt, wenn ihm danach zumute ist, und verschwindet, ohne sich zu verabschieden. Ich kann damit leben, weil ich mich gut verstehe mit Lucas; für Finn und Julia ist das viel schwerer.
Lucas legt keinen Wert auf Bequemlichkeit. Er schläft auf einer durchgesessenen alten Couch in der Ecke unter einer Decke aus Armeebeständen. Kaffee macht er sich auf einem Gaskocher. Wenn er baden möchte, geht er im Fluss schwimmen. Wenn er Hunger hat, was nicht oft vorkommt, erscheint er in der Küche, umgarnt Stella und plündert die Speisekammer. Stella kann hervorragend kochen und hält Lucas für ein Genie, wogegen er keinen Einspruch erhebt, wie mir aufgefallen ist. Auf dem Tisch im Refektorium sehe ich unter einer Fliegenglocke ihre letzten Gaben für den Künstler des Hauses: ein Stück Madeira-Kuchen und ein großes Stück Schweinefleischpastete mit goldbrauner Kruste, von dem er ein-, zweimal abgebissen hat.
Daneben steht auf einer Staffelei, zur Wand gedreht und mit Tüchern verhängt, das Bild, das Lucas malen soll – im Gegenzug dafür, dass er hier den ganzen Sommer umsonst wohnen kann. Es soll ein riesiges Porträt von Julia, Finn und mir werden. Dan behauptet, es sei Lucas’ Opus magnum – aus diesem Jahr jedenfalls. Es soll Die Schwestern Mortland heißen; ein blöder und langweiliger Titel, finde ich. Lucas scheint nicht gerade oft daran zu arbeiten, außer vielleicht nachts.
Ich schlafe nicht gut nachts. Manchmal wecken mich die Nonnen, manchmal wache ich an meinen Träumen auf. Als ich wieder mal nicht mehr schlafen konnte, bin ich aufgestanden und in den Garten gegangen, und da habe ich im Atelier Licht gesehen. Lucas schließt die Läden von innen, aber sechs Lichtstreifen zeichneten sich auf dem Boden ab wie goldene Gitterstäbe. Vielleicht macht er diese Skizzen von mir als Vorbereitung für das große Porträt, oder vielleicht auch nur, um sich die Zeit zu vertreiben. Ich würde Lucas gerne fragen, ob sie wichtig sind für ihn, und wenn ja, warum – aber ich weiß, dass er nicht antworten würde, denn er ist verschwiegen. Da haben sich die Richtigen gefunden, würde Bella wahrscheinlich sagen; ich bin nämlich ein verschwiegenes Mädchen.
Ich denke aber schon, dass sie wichtig sind, denn Lucas sagt, er will dieses Jahr vier Zeichnungen von mir machen. Also scheint ihn irgendetwas an mir zu interessieren. Die erste Zeichnung, Frühlings-Maisie, hat er in den Osterferien gemacht. An Sommer-Maisie arbeitet er jetzt gerade, und Herbst-Maisie und Winter-Maisie will er dann im Lauf des Jahres fertig stellen. Ich darf die Zeichnungen erst sehen, wenn alle vier fertig sind. Die Schwestern Mortland bleiben vorerst auch geheim – das gilt auch für Julia und Finn. Ich habe schon mehrmals versucht, einen Blick darauf zu erhaschen, aber es ist mir nicht gelungen. Wenn Lucas das Atelier verlässt, verriegelt er Fenster und Türen. Er hat eigens zu diesem Zweck ein neues Vorhängeschloss angeschafft. »Wie paranoid kann man denn noch sein?«, sagt Julia dazu. Sie ist gerade von einem Jahr an der Uni in Berkeley in Kalifornien zurückgekommen, was man an ihren Kleidern und ihrer Ausdrucksweise merkt. »Paranoid« ist jetzt eines ihrer Lieblingswörter.
»Na komm, Maisie, du träumst«, sagt Lucas. »Sprich mit mir, sonst wird dein Gesicht zu starr. Du kannst nicht mürrisch schauen, sonst misslingt das Bild.«
»Ich bin nicht mürrisch«, antworte ich. Aber der gereizte Tonfall ist wieder da, und ich konzentriere mich. Ich wünsche mir allmählich, dass ich ein anderes Ereignis zum Erzählen ausgesucht hätte, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dieser kalte Kieselstein steckt mir immer noch in der Kehle. Ich runzle die Stirn, Lucas wartet, den Stift erhoben, und ich erfülle wie immer artig seinen Wunsch und begebe mich in die Vergangenheit.
Ich sehe uns drei, wie wir uns an diesem Nachmittag auf den Weg ins Dorf machen. Wir gehen durch den Wald, was wir ganz selten tun. Julia hat ein neues weißes Kleid mit einem Petticoat und weißen Stickereien am Kragen an. Quasi über Nacht ist sie zur Frau geworden, und sie ist so wunderschön, dass es mir in den Augen wehtut. Meine Schwester Finn trägt ihre üblichen alten Sachen: eine abgetragene Hose, eine zerknitterte Bluse und Sandalen. Sie ist gertenschlank. Ich weiß, was Julia denkt – das ist leicht zu erraten, weil sie meist nur an sich denkt –, aber hinter Finns Gedanken zu kommen, das ist schwierig. Sie ist kompliziert wie ein Knoten, den man nicht lösen kann.
Meine Schwestern gehen voraus und zanken sich, ich folge ihnen. Ich habe braune Leinenshorts, kastanienbraune Sandalen und ein weißes Aertex-Hemd an, das Finn schon lange zu klein ist. Ich habe heimlich die Fünf-Freunde-Bücher gelesen (die stehen ganz oben auf Stellas Liste verbotener Lektüre) und möchte jetzt ein Junge sein, wie die unsterbliche George von Kirrin Island.
Ich pfeife dem Hund, den nur ich sehen kann – wir hatten in diesem Sommer gerade keinen Hund, wie zurzeit auch. Ich stecke die Hände in die Taschen und schlurfe hinter den beiden her. Ich zähle Bäume und benenne sie. Ich glaube, ich bin fröhlich; Fröhlichkeit ist ansteckend. Nach einer Weile hören Finn und Julia auf, sich zu streiten, und Finn – die eine sehr schöne Stimme hat – fängt an zu singen: zuerst ein Madrigal, dann geht sie lachend und hüpfend zu Blue Suede Shoes über.
Wir treten aus dem Wald in die Hitze hinaus. Das Tal zu unseren Füßen schimmert golden in der Sonne. Die Holundersträucher hängen voller Beeren, die Äpfel sind bald reif, die Ulmen am Weg und der Weizen auf den Feldern wiegen sich im Wind. Gott hat dafür gesorgt, dass auf dem Acre Field einundvierzig Kühe grasen. Weit oben unter dem Himmel zwitschern Lerchen. Ich atme tief ein; die englische Luft tut gut und macht mich munter. Finn nimmt mich an der Hand; sogar Julia ist lebhaft und lustig. Wir hüpfen, rennen und springen den Abhang hinunter.
Unten erwartet uns Dan, wie verabredet. Er ist groß geworden, seit ich ihn zum letzten Mal gesehen habe – was über ein Jahr her ist, wie mir auffällt. Früher kam er täglich in die Abtei, aber jetzt scheint er einen Bogen darum zu machen – wenn es dafür einen Grund gibt, hat man ihn mir wie üblich verheimlicht. Finn und er sind aber weiterhin befreundet. Sie war schon oft bei Dan zu Hause, doch für Julia und mich ist es Neuland – Dan hat uns nie weiter als bis zum Gartentor vorgelassen. Wir wandern durchs Dorf, in dem es ganz still ist in der Nachmittagshitze. Am Wegrand picken dreizehn Hühner.
Seit Jahrhunderten hat sich hier nichts verändert. Ich finde das schön, Julia dagegen behauptet, es sei schrecklich langweilig. Das schiefe alte Cottage, in dem Dan wohnt, ist das letzte Haus am Weg, linker Hand, genau vierhundert Schritte hinter dem Entenweiher. Niemand benutzt den Vordereingang, und wir gehen auch nach hinten. Dort ist es schattig, und die Tür steht offen.
Der Türsturz ist so niedrig, dass Dan, Finn und Julia sich bücken müssen, als sie ins Haus gehen. Ich folge ihnen, und nach der Helligkeit draußen ist es drinnen so dunkel, dass ich nichts mehr sehen kann.
Kapitel 2
Der Junge am Fenster
Es gibt vier Zimmer in dem Cottage – das hat Finn mir erzählt. Das vordere Zimmer im Erdgeschoss ist picobello in Ordnung, weil dort Totenwachen abgehalten werden. Dans Mutter, Dorrie, wurde in diesem Zimmer aufgebahrt, in ihrem weißen Hochzeitskleid aus Satin, mit ihrem weißen Gebetbuch in Händen. Das Beileidtelegramm, das Daddy geschickt hat, ist immer noch da, sagt Finn. Dans Großmutter hat es gerahmt, und es hängt über einem offenen Kamin, der nie benutzt wird.
Dieser schreckliche Todesfall – Dorrie war erst neunzehn – ereignete sich bei Kriegsende. Ein Zimmer vierzehn Jahre lang nicht zu benutzen, ist seltsam, vor allem, wenn man so wenig Platz hat, aber Finn meint, so sei es üblich, und überdies sei Dans Großmutter abergläubisch und schwarzseherisch und glaube, es könne jederzeit wieder jemand sterben, und dann müsse man vorbereitet sein. Ich hätte dieses Zimmer und Daddys Telegramm gerne gesehen, aber die Tür ist zu.
Wir gehen in die Küche, wo die Familie kocht, wäscht, isst und sich meistens aufhält. Eine schmale Treppe führt zu den beiden Schlafzimmern im Obergeschoss – Dans Vater, seine Großmutter und Dan müssen sich die Räume teilen. Bevor wir herkamen, habe ich Finn gefragt, wo sie denn alle schliefen, und Finn sagte, Dan schliefe in einem Zimmer mit seinem Vater, wo sonst? Als ich weiterfragte, fing sie an, sich aufzuregen, und meinte, ich sei eine neugierige Göre und das ginge mich alles gar nichts an; nicht jeder könne in einem Haus mit zwanzig Zimmern herumtoben. Zwanzig Zimmer, von denen die meisten unmöbliert und unbenutzbar sind und von Mäusen bewohnt werden, hätte ich gerne erwidert, aber ich ließ es bleiben. Ich merkte, dass meine Fragen Dan kränken konnten und dass Finn ihn schützen wollte. Aber meine Neugier konnte ich trotzdem nicht bezähmen. Dan ist groß und sein Vater ist geradezu ein Riese, wenn auch ein freundlicher: Schlafen sie zusammen in einem Bett, frage ich mich – im Ehebett, wo früher die arme Dorrie lag? –, und wenn ja, liegen sie dann nebeneinander oder verkehrt herum?
Was mich auch brennend interessiert, sind die Waschgelegenheiten – es gibt wohl nur das Spülbecken in der Küche –, und noch spannender finde ich die Frage der Toiletten. Finn meint, es gäbe ein Klo im Garten hinter dem Schweinekoben, und das funktioniere einwandfrei. Die Cottages im Dorf sind alle so angelegt, das weiß ich, aber ich habe noch nie zuvor eines betreten. Die Frauen aus dem Dorf mögen uns nicht; sie flüstern hinter vorgehaltener Hand, wenn wir vorbeigehen, und nennen uns »die sonderbaren Schwestern«, was ich frech finde. Deshalb durfte ich noch nie in einem dieser kleinen Steinhäuschen pinkeln. Ich wollte die Gelegenheit dieses Besuchs bei Dan nutzen und das Klo aufsuchen, aber Finn hat meine Absichten erraten und es mir verboten. Ich darf hier nicht pinkeln gehen. Ich darf auch nicht müssen oder auch nur daran denken. Der Lokus ist streng untersagt. Es wäre erniedrigend für Dan und gefährlich für mich, denn es zöge eine Strafe nach sich. Und ich kenne Finns Strafen; sie erfolgen prompt und sind gnadenlos und schmerzhaft. Dieser Gefahr werde ich mich nicht aussetzen. »Ich habe Tee gekocht«, sagt Dans Großmutter, als wir gerade mal zehn Sekunden da sind. Ich spüre, dass Finn mich scharf beobachtet. »Maisie trinkt keinen Tee, nur ein kleines Glas Wasser«, sagt sie hastig. »Ja, ein bisschen Wasser, bitte, Mrs Nunn«, sage ich wohlerzogen. Von Tee muss man pinkeln.
Wir stehen alle um den Tisch herum und warten darauf, dass Bella Nunn sich setzt. Meine Augen gewöhnen sich allmählich an die Dunkelheit, und ich kann Einzelheiten erkennen. Das Zimmer ist so wundersam, wie Finn mir verhießen hat, und außerdem bemerkenswert schmutzig. Aber Dans Großmutter ist ja unsere »Zugehfrau«, und da ich ihre Putzmethoden kenne, wundert mich das nicht. Auf dem gesprungenen Linoleum liegen Staubmäuse, im Spülbecken türmt sich schmutziges Geschirr, und der Tisch fühlt sich schmierig an. Julia sorgt sich um ihr weißes Kleid, ich sehe es ihr an; ihr Gesicht ist ganz starr vor Schreck. Sie zögert, bevor sie sich hinsetzt – die Stühle sind klebrig –, und blickt bestürzt auf die Sachen, die uns auf dem Tisch erwarten. Da steht eine Platte mit dick geschnittenen, fettigen Schinkenstücken, auf denen sich Schmeißfliegen niederlassen; grüner Salat, schon mit Salatsoße übergossen; Rote Beete und ein Stück Pastete, das mir bekannt vorkommt – es stammt aus Stellas Speisekammer und ist eine Woche alt. Ferner Brotscheiben und Margarine, ein trockener, unnatürlich gelber Kuchen und ein glitschiger Haufen hart gekochter Eier, dekoriert mit welken Petersilienstängeln. In der Mitte erhebt sich ein rosa Pudding in Form einer Burg, umgeben von einem Burggraben aus Dosenmandarinen. Es ist drei Uhr nachmittags. »Oh, Mrs Nunn, Sie haben sich so viel Mühe gemacht«, sagt Julia mit matter Stimme. »Das hätten Sie doch nicht tun müssen. Wir haben gerade erst zu Mittag gegessen.«
»Unsinn, ich habe einen Bärenhunger. Das sieht großartig aus«, sagt Finn scharf. Ich schaue zur Tür, wo Dan stehen geblieben ist. Er scheint vor Scham im Boden versinken zu wollen und tut mir furchtbar Leid. Dann wendet er sich ab und betrachtet den Hof draußen so eingehend, als sähe er ihn zum ersten Mal. Mir fällt erst jetzt auf, dass er seinen besten Anzug trägt, obwohl Ferien sind, den Anzug, der angeschafft wurde, als er einen Platz in der Grundschule zugesprochen bekam. Er ist schon lange rausgewachsen aus dem Anzug. Die Manschetten des frisch gewaschenen, weißen Nylonhemds ragen aus den Ärmeln heraus. Seine Schnürschuhe sind auf Hochglanz poliert. Er hat einen neuen Haarschnitt. Als ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, trug er eine Schmalztolle, aber die Schule hat offenbar dagegen Einwände erhoben. Jetzt hat er einen kurzen Haarschnitt wie ein Sträfling. Am Hals hat er rote Pickel. Finn hat gesagt, er rasiert sich, aber das scheint nicht gut zu funktionieren.
»Großmutter hat den Kuchen für euch gebacken. Wollen sich die Damen nicht setzen?«, sagt Dan. Er blickt in unsere Richtung, schaut uns aber nicht an, und ich merke, dass er überhaupt zum ersten Mal gesprochen hat, seit wir ihn getroffen haben. Seine Stimme hat sich so schrecklich verändert wie sein Äußeres: Er bemüht sich, korrekt zu sprechen, klingt aber unsicher dabei. Ich glaube, dass er diese Äußerung vorher eingeübt hat, und auch die unbeholfene Geste, die damit einhergeht. Er bemüht sich, seinen Suffolk-Akzent verschwinden zu lassen; er hat sich diesen eigenartigen und charmanten Singsang der Roma abgewöhnt, den er von Ocean gelernt hat und der zum Vorschein kam, wenn er aufgeregt oder begeistert war. Übrig geblieben ist eine traurige Mischung aus den Cockney-Einflüssen seiner Großmutter und der überkorrekten Sprechweise, die er sich auf der Schule angeeignet hat. Ich überlege, ob er vielleicht versucht, seinen Freund aus dem Dorf zu imitieren, Nicholas Marlow (der inzwischen in Winchester lebt), oder womöglich Nicks Mutter, die im alten Pfarrhaus wohnt und das Women’s Institute leitet, die noch Gott belehren würde, wie Julia meint.
Bella Nunn stellt eine große braune Teekanne auf den Tisch und setzt sich. Wir tun es ihr gleich. Ich lasse mir eine Riesenportion hart gekochter Eier, Pastete, Schinken, Salat mit Fertigsoße und Rote Beete auf den Teller häufen. Ich verabscheue alle diese Sachen. Tiere zu essen ist mir ein Gräuel. Die Roten Beete bluten. Ich starre auf den blutbefleckten Teller, auf dem die Krönungszeremonie von Königin Elizabeth II. abgebildet ist – Bella ist überzeugte Monarchistin und verehrt die Königsfamilie. Der Teller ist vergoldet, mit Wappen und am Rand abgeschlagen.
Ich denke: O Dan, was ist nur aus dir geworden?
Ich habe Dan als Erste von uns gesehen, aber keiner aus der Familie will mir das glauben. Sie sagen, ich sei viel zu klein gewesen, um mich daran zu erinnern. Sie behaupten, ich hätte mir wieder was zurechtfantasiert. Finn, die ihr Verhältnis zu Dan eifersüchtig hütet, äußert sich besonders bösartig darüber. Julia, die ihn noch nie leiden konnte – sie tut jedenfalls so –, sagt: »Gott, Maisie, du bist wirklich eine kleine Spinnerin. Wen interessiert denn das, ob du ihn zuerst gesehen hast? Er ist der Lehrling der Zwergin. Er ist verwandt mit ihr. Er gehört zur Abtei, genau wie sie. Er war schon immer da.«
Aber das stimmt nicht. Ich habe Daniel am Tag von Daddys Begräbnis gesehen – und so was vergisst man nicht, oder? Ich bringe bestimmt nichts durcheinander.
Es war natürlich kein normales Begräbnis, aber das habe ich damals nicht verstanden. Mein Vater war ein Kriegsheld. Er hatte die Luftschlacht um England überlebt, war dann aber später in New Mexico in den USA gestorben, wo wir alle auf Betreiben von Stella hingezogen waren, damit er dort seine Lunge kurieren konnte. Er kehrte mit uns auf dem Schiff nach England zurück, in einer kleinen Urne, die sich in einem stabilen Karton mit der Aufschrift »Not wanted on voyage« befand. Als wir in der Abtei ankamen – auf dem »Ahnenschrottplatz«, wie Großvater abfällig sagt –, stand die Urne drei Monate lang auf der Kommode in Stellas Zimmer. Es gab ein großes Gerede darüber, wo sie platziert werden sollte und mit welcher Zeremonie. Erst hieß es, sie solle in einer Nische in der Kirche neben den vielen anderen legendären Mortlands stehen. Einer von Stellas Künstlerfreunden (fast alle von Stellas Freunden sind Künstler) sollte eine Gedenktafel gestalten.
Dann: Nein, ein Gedenkfenster wäre viel würdiger, und es sollte zu dem Fenster gegenüber passen, das für einen Ururonkel geschaffen wurde, der in irgendeinem Krieg im Ausland eines tapferen Todes starb. Dann verfielen sie auf den Kirchhof und danach auf eine Stätte auf dem Acre Field, weil Daddy sich als Junge dort so gerne aufhielt. Später sollte es das Waldstück mit den Glockenblumen sein, weil Stella meinte, die Glockenblumen hätten genau denselben Blauton wie Daddys Augen – den wir alle geerbt haben. Schließlich machte Großvater einen Aufstand, weil sein Sohn nicht in einem Waldstück liegen sollte, wo man auch die toten Hunde verscharrte, und sie wandten sich wieder der Idee mit der Kirche zu, aber inzwischen war weniger Geld da. Deshalb geriet auch die Tafel kleiner, und der ausführliche blumige Text, den Stella sich vorgestellt hatte, schrumpfte auf: Guy Mortland, DSO, DFC. 1920–1955.
An dem Tag, an dem die Urne ihren letzten Ruheort finden sollte, pilgerten wir zur Kirche: Großvater und Stella vornweg, danach Julia und Finn, am Ende kam ich mit Bella. Bella, die sich um das Haus gekümmert hatte, während wir im Ausland lebten, war befördert worden. Sie war jetzt Haushälterin, Putzfrau, Vertraute und Kindermädchen zugleich. Bella hatte meinen Vater sehr verehrt und wollte ihm nun die letzte Ehre erweisen; überdies sollte sie dafür sorgen, dass ich nicht die Zeremonie störte und die Familie blamierte, indem ich zappelte, schniefte oder sonst irgendwelchen Unsinn trieb.
In der Kirche wurde Daddys Lieblingshymne gespielt: »Wir pflügen und wir streuen/Den Samen auf das Land«. Dann sprach der Pfarrer ein paar Gebete, und Stella las ein langes Gedicht vor, das sie selbst geschrieben hatte und das von irgendeinem bekannten Literaturmenschen – auch einem Freund von ihr – überarbeitet worden war. Der Literaturmensch hatte versprochen, an der Trauerfeier teilzunehmen, war aber durch wichtige Geschäfte in London verhindert. Die Dorfbewohner wollte man einladen, aber Großvater war so durcheinander, dass er auf die Trauerkarten ein falsches Datum geschrieben hatte; außerdem arbeiteten zur Erntezeit alle auf den Feldern, und deshalb kam niemand aus dem Dorf. Es war kalt in der leeren hallenden Kirche, und in den Bänken konnte man schlecht sitzen. Ich war klein und pummelig und kam mit den Füßen nicht an das Gebetskissen, geschweige denn bis zum Fußboden. Bella roch nach Mottenkugeln und ließ meine Hand nicht los. Ich saß neben der zierlichen Frau und versuchte, mich an Daddy zu erinnern, was Großvater mir aufgetragen hatte. Aber die Erinnerungen verhedderten sich immer und verschwanden, und ich bekam nur kurze Momente zu fassen – ausgestreckte Arme, den Geruch seiner Haut, die Szene, als er Blut ins Taschentuch hustete und Stella weinte. Diese Szene bildete ich mir vielleicht auch ein, vielleicht auch die anderen. Ich war erst eineinhalb Jahre alt, als er starb.
Nach einer Weile wurde mir langweilig. Ich starrte auf Bellas ulkige Schuhe – sie waren schwarz und klobig, mit scharlachroten Schnürsenkeln. Ich betrachtete ihren Mantel, der mit struppigen rotbraunen Fellstücken von einem toten Tier besetzt war. Ich beäugte ihren Schmuck – viele Ringe an den Fingern und mehrere Jetstein-Ketten. Ich bestaunte ihren sonderbaren Hut; im schwarzen Band steckte eine Pfauenfeder. Dann spielte ich mit meinem Gebetbuch und zappelte herum, bis Bella die Geduld verlor und mich kräftig in die Hand zwickte. Daraufhin saß ich still und ließ meinen Blick durch die Kirche schweifen. Sah mir das Gemälde vom Jüngsten Gericht an, auf dem höhnisch grinsende Teufel eine Horde nackter Menschen mit Spießen in einen Abgrund stießen, in die rot lodernden Flammen des Höllenfeuers. Betrachtete den Kreuzritter aus der Familie der Mortland, eine Marmorstatue, die auf ihrem Sarkophag ruhte, und eine Messingplatte, mit der man der Gattin eines Tudor gedenken wollte; sie war so oft poliert worden, dass der Kopf der Dame verschwunden war. Ich schaute zu dem Gedenkfenster für den Ururonkel aus diesem vergessenen Krieg auf. Dann blickte ich zu dem Fenster auf meiner Seite hoch, das Daddys Gedenkfenster geworden wäre, wenn wir mehr Geld gehabt hätten.
Es bestand aus durchsichtigem Bleiglas mit Streben. Am unteren Rand erblickte ich plötzlich einen wunderbaren Jungen. Er hatte wirres schwarzes Haar, schwarze Augen, eine schmale gerade Nase, einen breiten Mund und strahlend weiße Zähne. Er trug einen kleinen goldenen Ohrring, und sein Blick war wild und anklagend. Sein Körper fehlte. Kaum hatte ich ihn entdeckt, verschwand er auch schon wieder. Doch er tauchte noch dreimal auf.
»Wenn ich diesen Burschen erwische, bring ich ihn um«, knurrte Bella, als wir die Kirche verließen und auf den Friedhof gingen. Der Junge, der immer noch wild aussah, zu dem jetzt aber ein Körper gehörte, war gerade hinter einem Grabstein hervorgehuscht. »Ich werd ihm den Hintern versohlen«, sagte Bella, als sie ihn auf dem Weg entdeckte, wo er im Geäst einer Ulme hing. In der Abtei erschien er ein letztes Mal. Plötzlich tauchte sein Gesicht am Fenster der Bibliothek auf, und er starrte herein. Stella reichte Sandwiches herum, Großvater goss Sherry ein, Julia und Finn spielten auf dem Löwenfell, Bella machte Feuer im Kamin. Ich war die Einzige, die den Jungen bemerkte. Die Bibliothek liegt im ersten Stock; von dem Fenster aus musste man sich drei Meter weit fallen lassen und landete auf Steinplatten. Der Junge und ich starrten uns ein paar Minuten lang an. Etwas schien ihm Sorgen zu machen. Er rieb sich mit einer Hand das Auge. Ich blinzelte, und da war er verschwunden.
Das war Dan. Ich weiß jetzt, dass er an einer Regenrinne zu diesem Fenster hinaufgeklettert sein muss, obwohl er steif und fest behauptet, er sei geflogen. Und kürzlich habe ich herausgefunden, was ihm Sorgen bereitete – er behauptet allerdings, er hätte damals nicht geweint. Aber solche Kleinigkeiten sind unwichtig. Seit diesem Tag hatte ich jedenfalls ein festes Bild von Dan. Er ist der Junge am Fenster. Und obwohl er sich inzwischen sehr verändert hat, bleibt er für mich immer noch der wilde Junge, der mir auf den ersten Blick so gut gefiel – der Junge, der draußen ist und durch eine Fensterscheibe hereinblickt. Wenn ich ihm begegne, will ich immer sagen:
Lasst ihn herein! Macht das Fenster auf! Öffnet die Tür!
Kapitel 3
Oceans Tochter legt die Karten
»Noch ein bisschen Pudding, Miss Julia? Sie essen ihn doch so gern«, sagt Bella und häuft eine große Portion auf Julias Teller, bevor die ein Wort hervorbringt. Julia, von der allgemein bekannt ist, dass sie Pudding verabscheut, kann sich nur mit Mühe ein Schaudern verkneifen. Bella, die ziemlich gemein sein kann, wirft ihr einen munteren Blick zu, und ihre kleinen schwarzen Augen funkeln vor Vergnügen. »Trinkt den Tee aus, Mädels«, sagt sie. »Und, Maisie, du musst auch was davon trinken, ich fange mit den Teeblättern an.«
»Können wir nicht mit der Kristallkugel anfangen, Mrs Nunn?«, frage ich. Die Kristallkugel steht auf der Kommode, verhängt mit einem weißen Seidentaschentuch, und ich betrachte sie schon die ganze Zeit. »Nein. Erst später«, erwidert Bella. »Alles muss in der richtigen Reihenfolge passieren. Zuerst die Teeblätter, dann die Kristallkugel, dann die Karten.«
Bella ist herrisch und dickköpfig obendrein, und man widerspricht ihr besser nicht. Außerdem ist sie jähzornig; wenn ich sie ärgere, wahrsagt sie uns vielleicht gar nicht – und wir sind alle ganz verrückt danach, sogar Julia, die behauptet, das sei alles Hokuspokus. Bella hat das zweite Gesicht; Dan und sie haben uns das so oft erzählt, dass wir es glauben. Das ist ein Erbteil ihrer Ahnen, der Roma. »Manche Leute erben ein Haus oder einen Buckel«, sagt Bella gerne. »Manche erben ein Herzogtum oder die Hämophilie, wie diese russischen Zaren. Ich hab das zweite Gesicht geerbt. Wie viele Kinder hatte Ocean?«
»Vierzehn«, antworte ich. Ich bin gut vorbereitet.
»Und wie viele davon haben das zweite Gesicht?«
»Nur eines. Du.«
»Richtig«, sagt Bella mit leuchtenden Augen. »Also, sieh dich vor, Maisie. Mich kannst du nicht hinters Licht führen. Ich kann durch Wände und Türen schauen.«
Jetzt gießt sie Tee in eine Tasse und reicht sie mir. Blätter schwimmen darin, und ich trinke den Tee in kleinen Schlucken, scharf beobachtet von Finn. Ich habe Stella und Großvater versprochen, dass ich ihnen das Hexenhaus genau schildern werde. Deshalb schaue ich mich um, während Julia noch damit beschäftigt ist, den Pudding hinunterzuwürgen.
Ich finde diesen halbdunklen geheimnisvollen Raum wunderbar. Die Balken sind mit scharlachroten Rosen bemalt. In den Fensternischen hängen Spiegel in schimmernden Blechrahmen, die einen Teil der Welt draußen reflektieren. Überall steht Nippes herum, die Kleiderhaken sind mit paillettenbesetzten Schleifen verziert, und an dem schwarzen Eisenofen lehnen glänzende Messingtöpfe und leuchtend bunte Kissen mit Blumenmustern, mit Punkten und Streifen in Knallrot, Gelb, sonnigem Orange, Blattgrün und Himbeerrosa; besonders gut gefällt mir eines, das mit glitzernden Sternchen bestickt ist. Doch am großartigsten finde ich die Ahnengalerie direkt neben mir.
Sie sieht aus wie ein kleiner Altar; auf einem mit rotem Stoff bezogenen Regal stehen Fotos, beleuchtet von einem ewigen Licht, das die Menschen auf den Bildern zum Leben zu erwecken scheint. In der Mitte steht ein Bild von Dans Urgroßmutter, Bellas Mutter, der berühmten Ocean Jones. Sie sitzt auf den Stufen eines Wohnwagens – ich habe so einen Wagen noch nie zu Gesicht bekommen, aber ich möchte gerne in einem leben. Er ist aus Brettern zusammengenagelt, hat ein gewölbtes Dach, aus dem ein Ofenrohr hervorragt, große Räder und eine bunt bemalte Deichsel für das zottige gescheckte Pony, das nebendran grast. Ocean sieht fantastisch aus. Sie ist fett und runzlig. Ihre Augen sind kohlschwarz und blicken in die Ferne, und sie ist so hergerichtet, wie man sich eine Zigeunerin vorstellt: Über mehreren bestickten Röcken trägt sie eine Weste und eine bauschige Bluse. An ihrem Hals glitzern unzählige Ketten (von ihr hat Bella das abgeguckt), und um die Stirn trägt sie ein mit Münzen besticktes Tuch. Sie hat ihr weißes Haar niemals geschnitten – Bella behauptet, das bringt Unglück; auch sie schneidet sich nie die Haare – und hat es zu einem Zopf geflochten, der so dick ist wie ein Pferdeschweif und ihr bis zur Hüfte reicht. Ihre Füße stecken in Männerstiefeln, und sie hält eine Tabakspfeife in der Hand. Am Fuß der Treppe stehen Männer, doch neben Ocean wirken sie klein und unbedeutend. Es gab keinen Zweifel, wer in diesem Klan das Sagen hatte, denke ich. Zum ersten Mal verstehe ich, was Finn meinte, als sie Ocean als »Matriarchin« bezeichnete.
Ocean starb im Jahre 1949, als Dan vier Jahre alt war – Bella hat mir oft davon erzählt. Ocean hatte ihren eigenen Tod vorausgesagt und sich sorgfältig darauf vorbereitet. Damals kamen die Zigeuner noch ein Mal im Jahr nach Suffolk, meist zur Erntezeit, wenn man Hilfsarbeiter brauchte. Sie errichteten ihr Lager unten am Black Ditch, blieben manchmal über den Winter und zogen dann weiter durch ganz England. Manchmal hielten sie sich in Städten auf, aber Bella sagt, dass sie lieber auf dem freien Feld, unter den Sternen kampierten. Sie zogen weit nach Norden, bis nach Yorkshire, wo die Leute engstirnig waren, und weit nach Süden, nach Dorset, wo die Leute offener und freier dachten. Sie kamen zu den Jahrmärkten im ganzen Land, verkauften Wäscheklammern, Flickendecken, Werkzeug, Kunsthandwerk. Sie ernteten Hopfen in Kent, gruben in Lincolnshire Kartoffeln aus, sammelten Altmetall und hatten jedes Jahr einen Verkaufsstand im Londoner East End. Bella hätte beinahe einen »Perlenkönig« geheiratet, erzählt sie, einen Zigeunerbaron, der so charmant daherreden konnte, dass er sie um den kleinen Finger wickelte. Sie hat ihn beim Pferderennen in Epsom kennen gelernt. Er trug einen Anzug mit dreißigtausend aufgestickten Perlenknöpfen. Auf dem Rücken des Anzugs prangte das Auge Gottes, am Kragen schimmerten Sonne und Mond. Bella warf einen Blick auf den Mann und war verloren. Aber Ocean missfiel sein Wagen, und so nahm Bella zu guter Letzt Vernunft an und heiratete nicht ihn, sondern Dans Großvater. Dans Großvater war ein Sesshafter, wie auch Dans Vater – und das braucht eine Frau, meint Bella, einen Mann, der sesshaft und verlässlich ist.
Ocean wollte auf den Feldern am Black Ditch sterben, das war ihr Wunsch. Sie liebte Wykenfield und hatte nicht nur viele Freunde hier, sondern auch eine Tochter, die zwar einen Sesshaften geheiratet hatte, der Ocean aber dennoch verbunden blieb. Doch ihr Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen. Sie versammelte die sechsundneunzig Mitglieder ihrer Familie um sich und starb Schlag Mitternacht unweit von Scunthorpe (was nicht so eindrucksvoll ist). Es ist Brauch bei den Roma, dass der Wohnwagen erst verbrannt wird, wenn das männliche Oberhaupt der Familie stirbt, doch da Ocean so eine starke außergewöhnliche Person war und über das zweite Gesicht verfügte, machte man bei ihr eine Ausnahme. Wenige Stunden nach ihrem Tod stand der Wohnwagen in Flammen.
Von diesem Ereignis gibt es leider kein Foto. Ich muss mich zufrieden geben mit Fotos von Ernest Jones, Oceans Gatten, aus der berühmten Zigeunerfamilie Jones; deshalb unterscheiden sie sich von allen gewöhnlichen Leuten mit Namen Jones, erklärt Bella. Ich betrachte die vielen Töchter von Ocean und versuche Bella zu erkennen. Und ich starre fasziniert auf Oceans wilde barfüßige Söhne mit den zerlumpten Kleidern, die so stolz aussehen wie Prinzen. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie in diesem Land gelebt haben, doch die Bilder entstanden vor dem Krieg, und Großvater sagt, damals war die Welt ganz anders. Wo sind diese Prinzen jetzt, frage ich mich. Leben sie noch? Sind sie noch immer Zigeuner und ziehen durchs Land? Ich hoffe es. Mit ihren zerzausten Locken, knochigen Beinen und kohlschwarzen Augen ähneln sie alle dem Daniel, den ich zu kennen glaubte, dem Daniel, um den ich trauere.
Ich frage mich, wieso nirgendwo Fotos von Bellas Familie in Suffolk zu sehen sind – das ist auch ein Klan. Im nächsten Dorf leben noch vier Nunns, die irgendwie verwandt sind; auf dem Friedhof an unserer Kirche hier liegen fünfzehn Nunns begraben (Finn und Dan haben die Gräber gezählt). Doch nirgendwo steht ein Foto von dem Sesshaften, Bartholomew Nunn, Bellas verstorbenem Mann, oder von der armen Dorrie, ihrem einzigen Kind. Auch Joe Nunn, Dans Vater, ist nirgendwo zu sehen. (Dorrie hat einen Vetter geheiratet; es gibt viel Inzucht hier, pflegt Großvater immer finster zu sagen.) Eigentlich gibt es gar keine Spuren von Dans Vater in diesem Zimmer; es ist ganz und gar Bellas Reich. Abgesehen von einer Urkunde, aus der man ersehen kann, dass Joseph John Nunn acht Jahre in Folge den jährlichen Pferdepflugwettbewerb von Ostengland gewonnen hat – das ist eine gewaltige Leistung, hat Dan mir einmal erzählt. Und ein Gewehr liegt auf einem Regal an der Wand gegenüber, das Dan oder seinem Vater gehören könnte – oder auch Bella. Ich weiß, dass sie als Mädchen Kaninchen geschossen und in Fallen gefangen hat; im Gegensatz zu mir hat sie keine Achtung vor Tieren, die sind für sie nur Essen auf Beinen. Wenn ein Huhn alt wird oder brütig, ist es reif fürs Beil: Ab der Kopf, in den Topf, schreit sie dann. Ich habe einmal miterlebt, wie Bella einer von Stellas Hennen den Kopf abschlug, und das werde ich nie vergessen. Blut sprudelte aus dem Hals; das kopflose Huhn rannte noch zwei endlose Minuten im Hof herum. Es hieß Miranda und fraß mir aus der Hand.
Dan räuspert sich. »Wir sollten mal loslegen, Gran«, sagt er mit seiner schrecklichen neuen Stimme. Feierlich fördert er ein Päckchen Zigaretten zutage und reicht es herum. Er ist dunkelrot angelaufen, und seine Hand zittert leicht. Ich frage mich, wen die Kippen beeindrucken sollen – Finn etwa? Julia wirft einen verachtungsvollen Blick auf sie. »Nein danke, wir rauchen nicht«, sagt sie mit ihrer zickigsten Stimme. »Ach Quatsch«, sagt Finn und nimmt eine.
Dan zündet ein Streichholz an und beugt sich vor, um Finn Feuer zu geben. Ich sehe die Spiegelung in Finns ungewöhnlichen Augen. Als Dan und sie sich ansehen, kommt es mir vor, als hätten sie sich einen Raum geschaffen, in dem sie ganz allein sind. Ich bin irgendwie schockiert von diesem Blick, obwohl ich nicht genau weiß, warum. Ich fühle mich, als hätte ich durch ein Schlüsselloch geschaut oder eine Geheimtür geöffnet und etwas Verbotenes erspäht. Es fühlt sich so ähnlich an, wie wenn man in das Hagioskop schaut – und das Gefühl ist ziemlich unangenehm. Es macht mich so nervös, dass ich ans Pinkeln denke, obwohl ich gar nicht muss. Ich glaube, Julia entgeht dieser Blick auch nicht, aber Bella ist die Einzige, die eine Reaktion zeigt: Sie lächelt maliziös.
Die Luft im Raum wird bläulich durch den Rauch und scheint zu schimmern. Der Ofen ist angeheizt, und es wird immer stickiger. Mir ist ein bisschen schwindlig, und ich kann kaum atmen – wahrscheinlich die Aufregung. Bella erhebt sich, nun vom Scheitel bis zur Sohle Oceans Tochter, und holt Kristallkugel und Karten.
Bella hat eine Schwäche fürs Dramatische, und jetzt, wo ich älter bin, wird mir klar, dass sie einen ziemlichen Zinnober veranstaltet hat. Sie musste die Spannung aufbauen und las uns als Erstes aus der Hand, studierte eingehend unsere Handflächen, schüttelte den Kopf, murmelte vor sich hin, runzelte die Stirn.
»Also, hier sehe ich einen prächtigen Ehemann«, sagte sie und drehte Julias Hand hin und her. »Wer hätte das gedacht! Du bist von der dunklen Sorte, kein Zweifel«, rief sie aus, als sie Finns Hand betrachtet hatte. »Für dich wird es Rosen regnen, Schätzchen«, sagte sie rasch, als sie meine Handfläche gesehen hatte. »Siehst du dieses Kreuz hier? Das Zeichen für Glück, dein Leben lang.« Weder Finn noch Julia haben ein Kreuz. Ich bin stolz und krümme die Hand, damit ich es noch deutlicher sehen kann: kein Zweifel, ein Kreuz!
Als Nächstes sind die Teeblätter dran. Wir müssen sie in unserer Tasse herumwirbeln und in eine weiße Porzellanschale schütten. Bella macht wieder ein großes Aufhebens davon, dreht die Schalen in der Hand – an diesem Punkt, habe ich mir später überlegt, lief irgendetwas schief. Entweder Bella kann nichts erkennen in den Blättern, oder was sie sieht, behagt ihr nicht. Sie greift immer wieder aufs Neue nach den Tassen, stellt sie wieder weg, vergleicht sie, bis ich meine, es nicht mehr aushalten zu können vor Spannung. »Undeutlich«, sagt sie schließlich. »Sie sagen nichts. Widersetzen sich. Wir machen mit der Kristallkugel weiter. Wo ist das Geburtstagskind? Sie sind zuerst dran, Miss Julia. Hier herüber bitte.«
Julia und Bella beugen sich am Tischende über die Kugel. Mir ist heiß und leicht übel von dem schrecklichen Essen. Ich habe immer noch den Nachgeschmack von schwefligen Eiern, Roter Beete und Pudding im Mund. Ich sehne mich nach frischer Luft. Wenn ich nicht Finns Unmut zu fürchten hätte, würde ich darum bitten, in den Steinverschlag im Garten gehen zu dürfen, aber ich wage es nicht. Ich versuche, mich auf die Fotos von Ocean und den Ahnenaltar zu konzentrieren, aber die Bilder verschwimmen mir vor den Augen. Die Hintertür steht offen, aber es scheint keine Luft hereinzukommen. Bella murmelt und seufzt; Dan zündet sich noch eine Zigarette an, und der beißende Rauch weht über den Tisch genau zu mir. Ich verstehe nicht, weshalb, denn die Luft ist reglos.
»Tja, Miss, Sie werden alles bekommen, was Ihr Herz begehrt«, höre ich, und Julia kehrt mit roten Wangen und siegesgewissem Blick an ihren Platz zurück. Als Nächstes ist Finn dran. Als sie sich über die Kugel beugt, fällt ihr Haar nach vorn wie ein Schleier. Das ist ziemlich enttäuschend; ich sehe nur Finns knochigen braunen Arm und ihre weizenblonde Mähne, die im Gegensatz zu Julias Haaren schon länger keinen Kamm mehr gesehen hat. Wie sehr ich mir auch den Hals verrenke: Die Kugel bekomme ich nicht zu sehen. Nicht einmal Bellas Gesicht kann ich erkennen, obwohl ich sie undeutlich sprechen höre. Sie scheint eine Ewigkeit vor sich hin zu murmeln und in Erregung zu geraten. Da scheint etwas zu passieren. Das Zimmer kommt mir auf einmal noch stickiger und dunkler vor, und irgendeine störende Schwingung liegt in der Luft, als zupfe man an einer Saite, die lange nachklingt. Wenn die Nonnen durch die Flure wandern, fühlt es sich auch so an – und ich weiß, dass ich es mir nicht einbilde, denn Dan spürt es auch: Er ist bleich geworden.
»Ich sehe ein Opfer«, sagt Bella plötzlich klar und deutlich. Sie scheint verstört zu sein oder sich zu fürchten. Dann murmelt sie etwas Unverständliches auf Romani, glaube ich, und gibt ein sonderbares Summen von sich. So ähnlich hört es sich auch an, wenn Großvater am Radio herumdreht – ein halber Satz, zwei Töne Musik, ein Fetzen von einem Lied: so viele Stimmen, die in der Luft herumschwirren! Doch Bella stellt einen Sender ein, ich spüre es, und dann spricht sie wieder laut und deutlich. »Die Zweite wird die Erste sein«, verkündet sie, und sie klingt verstört dabei. Dann verliert sie den Sender, oder vielleicht gibt es eine Störung, denn sie schiebt Finn plötzlich beiseite und hält sich die Ohren zu. Finn schaut sie unsicher an – das Ganze macht ihr wohl keinen Spaß –, und Bella fährt fort. »Und viele Reisen«, sagt sie mit hohler Stimme. »Eine große Fahrt. Über viele Meere, aber am Ende ein sicherer Hafen.«
»Buchen Sie Ihre Passage jetzt«,