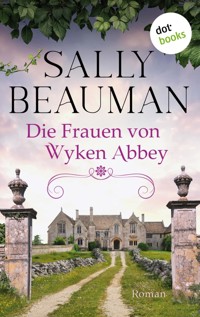Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Journalists
- Sprache: Deutsch
Dieses Geheimnis ist lebensgefährlich ... Der romantische Thriller »London Killings – Ein tödliches Geschenk« von Sally Beauman als eBook bei dotbooks. Ein schwarzer Handschuh und ein Paar goldene Handschellen – was ist ihre Bedeutung in diesem Spiel um Eifersucht, Macht und Leidenschaft? In London begegnen sich zwei Menschen wieder, die glaubten, einander für immer verloren zu haben: Pressefotograf Pascal Lamartine und Journalistin Gini Hunter, die einst eine leidenschaftliche Liebe verband. Nun sollen sie herausfinden, ob die finsteren Gerüchte, die sich um die Ehe des US-Botschafters John Hawthorne ranken, wahr sind. Haben auch die rätselhaften Pakete, die Gini und Pascal kurz vor ihrem Auftrag zugespielt wurden, etwas damit zu tun? Je tiefer sie bohren, desto mehr geraten sie ins Visier der Reichen und Mächtigen, die alles geben würden, um den Schein zu wahren ... »Eine überzeugende Mischung aus Romantik und Spannung!« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: »London Killings – Ein tödliches Geschenk« von Bestsellerautorin Sally Beauman, ein Thriller voll prickelnder Leidenschaft und rasanter Spannung, ist der erste Band der »Journalists«-Reihe, deren Bücher unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1241
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein schwarzer Handschuh und ein Paar goldene Handschellen – was ist ihre Bedeutung in diesem Spiel um Eifersucht, Macht und Leidenschaft? In London begegnen sich zwei Menschen wieder, die glaubten, einander für immer verloren zu haben: Pressefotograf Pascal Lamartine und Journalistin Gini Hunter, die einst eine leidenschaftliche Liebe verband. Nun sollen sie herausfinden, ob die finsteren Gerüchte, die sich um die Ehe des US-Botschafters John Hawthorne ranken, wahr sind. Haben auch die rätselhaften Pakete, die Gini und Pascal kurz vor ihrem Auftrag zugespielt wurden, etwas damit zu tun? Je tiefer sie bohren, desto mehr geraten sie ins Visier der Reichen und Mächtigen, die alles geben würden, um den Schein zu wahren ...
Über die Autorin:
Sally Beauman (1944–2016) war eine englische Autorin und Journalistin. Sie studierte in Cambridge Englische Literaturwissenschaft und war anschließend in England und den USA als Journalistin für viele angesehene Zeitschriften wie die »New York Times« und die »Vogue« tätig. Besonders bekannt ist sie für ihre acht international erfolgreichen Bestsellerromane, die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden.
Sally Beauman veröffentlichte bei dotbooks bereits:
»Rebeccas Geheimnis«
»Das Geheimnis von Winterscombe Manor«
»Die Frauen von Wyken Abbey«
»Erben des Schicksals«
Außerdem erscheint von ihr die Romantic-Thriller-Reihe »Journalists« mit den Titeln »London Killings – Ein tödliches Geschenk«, »Paris Murders – Eine tödliche Wahrheit« und »New York Stalker – Eine tödliche Liebe«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1994 unter dem Originaltitel »Lovers and Liars« bei Bantam Press, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Reise in die Nacht« bei Random House
Copyright © der englischen Originalausgabe 1994 by Sally Beauman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-470-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »London Killings – Ein tödliches Geschenk« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sally Beauman
London Killings – Ein tödliches Geschenk
Romantic Thriller
Aus dem Englischen von Charlotte Franke
dotbooks.
Prolog
Vier Päckchen
Die Londoner Zentrale des ICD – Intercontinental Deliveries – liegt, nicht weit von St. Mary Axe, mitten in der City. Vor hundert Jahren standen hier rund um den Hof düstere, überfüllte Häuser. Eine Herberge für Seeleute gehörte dazu, ein Bordell und eine Kneipe, in der für einen Twopence ein Glas Gin ausgeschenkt wurde. Das war vor hundert Jahren, bevor die Grundstückspreise in der City zu steigen begannen und ihre gegenwärtige Höhe erreichten: Jetzt befand sich die Zentrale des ICD in der fünften Etage eines eleganten Tempels aus Glas und Stahl.
Von dieser Stelle aus wurden, wie es der Firmenname versprach, fünf Kontinente verbunden. Eine ganze Flotte Flugzeuge, Waggons, Lieferwagen und Motorräder sorgte dafür, daß eilige Sendungen und Pakete von uniformierten Kurieren rund um den Globus prompt und zügig an ihr Ziel befördert wurden.
Im Sommer 1993 hatte man zur Verschönerung des frisch renovierten Empfangsbüros des ICD eine neue Mitarbeiterin gesucht und die Stelle in einer Anzeige in der Times ausgeschrieben. Die erfolgreiche Bewerberin war eine junge Frau im Twinset und mit Perlen namens Susannah. Sie hatte das Abschlußdiplom im Blumenbinden von einer Schweizer Schule vorzuweisen, einen großzügigen Kleiderbonus von ihrem Vater, der Geschäftsmann war, und einen Akzent wie fein geschliffenes Glas.
Wären Susannahs Vorzüge rein dekorativer Art gewesen, hätten die folgenden Ereignisse vielleicht einen völlig anderen Verlauf genommen. Doch Susannah erwies sich als intelligent, flink und tüchtig und hatte Übung am Computer. Und was noch wichtiger war – Susannah besaß ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ganz im Unterschied zu den meisten Zeugen konnte sie sich mit unerschütterlicher Schärfe an frühere Ereignisse erinnern. Das sollte sich später als wichtig erweisen, denn es war Susannah, die Anfang Januar des darauffolgenden Jahres vier äußerlich identische Päckchen zum Versand entgegennahm, und es war wiederum Susannah, die – nach einem ausgedehnten Weihnachts- und Neujahrsurlaub ins Büro zurückgekehrt – um neun Uhr dreißig vormittags den sonderbaren und bedeutsamen Telefonanruf ihres Absenders bekam.
Es war Dienstag morgen. Es lag Schnee in der Luft, und es war noch völlig still in der Stadt. Susannah erwartete ein flaues Geschäft. Das Neujahrsfest war auf ein Wochenende gefallen, so daß der gestrige Montag auch noch ein Feiertag gewesen war. Ein weiterer Tag, um der Langeweile des Büros zu entfliehen. Susannah gähnte und streckte sich. Sie beklagte sich nicht – das verlängerte Wochenende hatte ihr einen zusätzlichen Vormittag auf den Gstaader Skihängen beschert.
Sie kochte Kaffee, begrüßte ein paar Kollegen, die hinter den Kulissen in Büro und Buchhaltungen arbeiteten und sich verspätet hatten, arrangierte die frischen Blumen in der Vase, die sie immer auf ihrem Schreibtisch stehen hatte, und blätterte in der Dezemberausgabe des Magazins Vogue.
Aber in Gedanken war sie noch auf den Skihängen und bei einem gewissen Börsenmakler, den sie dort kennengelernt hatte und der die gefährlichsten schwarzen Abfahrten ohne Furcht meisterte. Er war mit ihren älteren Brüdern zusammen in Eton gewesen und wohnte auch in ihrem Chalet. Sie war neugierig, ob er sie, wie versprochen, anrufen würde, um sie zum Lunch einzuladen. Und als um neun Uhr dreißig das Telefon klingelte, überfiel sie ein angenehmes Gefühl der Hoffnung – aber es war nicht der Börsenmakler. Eine Frauenstimme. Geschäftlich also. Susannah sah auf die Uhr und notierte den Anruf.
Meistens wurden die Dienste des ICD von Sekretärinnen angefordert, so daß an dem Anruf zuerst nichts ungewöhnlich war – außer daß die Anruferin eine tiefe, harmonische englische Stimme hatte, und einen Akzent, der Susannahs eigenem sehr ähnlich war. Susannah hätte heftig widersprochen, wenn man sie bezichtigt hätte, ein Snob zu sein, auch wenn sie sich natürlich, wie jedermann englischer Abstammung, der feinen verräterischen Modulationen des Akzents bewußt war. Und so reagierte sie auch sofort auf die Tatsache, daß die Anruferin ihrer eigenen, höhergestellten Klasse angehörte – was sich noch als nützlich erweisen sollte. Von Anfang an war Susannah eine aufmerksame Zeugin.
Allerdings benahm sich die Anruferin irgendwie merkwürdig. Sie drückte sich außerordentlich unklar, wenn nicht sogar vage aus.
»Ich möchte Sie gern fragen«, sagte die Stimme, als handelte es sich dabei um ein äußerst ungewöhnliches Anliegen an einen Kurierdienst, »ob es vielleicht möglich wäre, daß Sie vier Päckchen durch Boten überbringen?«
»Selbstverständlich«, sagte Susannah. »Und wohin sollen die Päckchen geschickt werden?«
»Eines soll nach Paris«, sagte die Stimme, »und eines nach New York –«
»Stadt oder Staat?« unterbrach Susannah.
»Oh. Stadt. Ja. Manhattan. Dann eines nach London und eines nach Venedig ...« Ihre Stimme klang entschuldigend, zweifelnd, als wäre Venedig ein Dorf in Tibet oder eine Siedlung in der Arktis. Dann entstand eine atemlose Pause. »Ginge das?«
»Selbstverständlich. Kein Problem.«
»Wunderbar.« Die Stimme klang erleichtert. »Wie schön. Es ist nämlich ... die vier Päckchen müssen unbedingt morgen früh zugestellt werden.«
Susannah reagierte ein wenig kühler. Fast hatte sie den Verdacht, als wollte die Anruferin sie auf den Arm nehmen. »Das kann ich garantieren«, erwiderte sie schroff, »vorausgesetzt, daß wir die Sendung bis heute nachmittag vier Uhr erhalten.«
»O ja, Sie werden sie ganz bestimmt noch heute vormittag erhalten.«
»Möchten Sie, daß ich sie abholen lasse?«
»Abholen?« Sie zögerte, dann lachte sie leise. »Nein. Das wird nicht nötig sein. Ich bringe sie Ihnen selbst. Ich werde gegen elf Uhr dort sein ...«
Inzwischen fand Susannah das Benehmen dieser Frau ausgesprochen eigenartig. Einerseits diese Eile, und andererseits diese vagen Auskünfte. Das war ziemlich ungewöhnlich. Die Frau klang irgendwie so, als wäre sie nicht ganz bei sich oder als stünde sie unter starkem Druck. Als Susannah anfing, die einzelnen Punkte auf ihrem Lieferschein abzufragen, gab die Frau – wie Susannah jedenfalls später behaupten würde – nur noch ausweichende Antworten.
»Größe der Päckchen?« fragte Susannah.
»Wie bitte?«
»Die Größe. Sehen Sie, wenn sie besonders groß oder schwer sind, muß ich besondere Vorkehrungen treffen.«
»Ach so. Nein, nicht so groß.« Es klang vorwurfsvoll. »Und auch nicht schwer. Ziemlich leicht sogar. Überhaupt nicht schwer ...«
»Und der Inhalt?«
»Was meinen Sie damit?«
»Na ja, für die drei, die ins Ausland gehen, müssen wir Zollerklärungen abgeben«, erklärte Susannah. »Wegen der Betäubungsmittelgesetze, wissen Sie. Darum muß ich wissen, was drin ist.«
»Ach so, jetzt verstehe ich.« Die Stimme klang amüsiert. »Also, ich verschicke kein Kokain, und ich glaube auch nicht, daß ich einen Kurierdienst beauftragen würde, wenn ich es täte ... Trotzdem – ich verstehe Ihr Problem. Inhalt ... Ja. Könnten Sie vielleicht ›Geschenke‹ schreiben?«
»Tut mir leid, aber ein bißchen genauer muß es schon sein.«
»Natürlich. Geburtstagsgeschenke vielleicht?«
Susannah kniff die Lippen zusammen. »Noch genauer. Pralinen. Bücher. Spielzeug – irgend so etwas.«
»Ach so. Ja, das ginge. Geburtstagsgeschenke – Anziehsachen. Schreiben Sie das, bitte.«
»Bei allen, die ins Ausland gehen?«
»Ja.« Sie lachte fröhlich. »Komisch, nicht? Alle meine Freunde sind offenbar Steinböcke.«
Susannah verzog das Gesicht vor ihrem Computer. Sie gab schnell die einzelnen Flüge und Kurierfahrten ein. Während sie die Zahlen und Daten prüfte, ging sie die restlichen Fragen durch: Adresse des Absenders, Adressen der Empfänger, bevorzugte Zahlungsweise. Die Stimme unterbrach sie.
»Ach was, das können wir alles erledigen, wenn ich die Päckchen bringe.«
»Schön. Aber wollen Sie mit Scheck oder mit Kreditkarte bezahlen? Dann könnte ich die Einzelheiten schon jetzt –«
»Bar«, unterbrach sie die Stimme, die plötzlich fest klang. »Ich werde die Rechnung in bar bezahlen, wenn ich komme.«
Barzahlung war ziemlich ungewöhnlich. Zu diesem Zeitpunkt kamen Susannah zum ersten Mal Zweifel. »Schön«, sagte sie. »Aber wenn ich mir einen Namen oder eine Telefonnummer notieren könnte –«
»Ich muß jetzt Schluß machen«, sagte die Stimme. »Ich danke Ihnen sehr. Sie waren mir eine große Hilfe.« Dann legte diese eigenartige Frau ohne eine weitere Erklärung einfach auf.
Susannah war irritiert. Sie nahm an, daß sie von dieser Sache nie wieder etwas hören würde. Sie rechnete nicht damit, daß die Anruferin Gestalt annehmen würde. Oder daß sie die vier Päckchen jemals zu Gesicht bekommen würde. Reine Zeitverschwendung, dachte sie. Aber sie sollte sich irren.
Punkt elf Uhr vormittags schwangen die Türen zu ihrem Empfangsbüro auf, und eine der schönsten Frauen, die Susannah je gesehen hatte, kam herein. Susannah war überzeugt, daß es sich um ein Fotomodell handeln mußte, obwohl sie nicht hätte sagen können, um welches. Sie mußte sich richtiggehend Mühe geben, damit sie die Frau nicht anstarrte, so elegant und so vollkommen war sie, und jedes Detail ihrer Kleidung so kostspielig, daß Susannah der Atem stockte. Aber dafür konnte sie dann später eine genaue Beschreibung abgeben – was vielleicht von Anfang an beabsichtigt gewesen war.
Die Frau war mindestens einen Meter fünfundsiebzig groß und beneidenswert schlank. Ihre Haare waren kurz geschnitten, eine Mischung aus Gold- und Silbertönen, wie sie nur ein sehr teurer Friseur zustande brachte, wenn er der Natur ein wenig nachhalf. Sie brauchte und trug auch kein Make-up. Ihre Haut war gebräunt, ihre Augen waren saphirblau, ihre Zähne ebenmäßig, und ihr Lächeln war herzlich.
An ihrem Handgelenk trug sie, gerade noch sichtbar, eine goldene Tankuhr von Cartier mit einem grünen Krokodillederband, die Susannah sofort begehrte. Der Pelzmantel, den sie anhatte, war prächtiger als alles, was Susannah in ihrem ganzen Leben gesehen hatte, so daß sie sofort ihre sämtlichen guten Vorsätze vergaß, die niedlichen kleinen Pelztiere zu beschützen: Der Mantel war lang und luxuriös und aus Zobelfell.
Unter dem Mantel war sie von oben bis unten in Chanel gekleidet. In diesem Punkt war sich Susannah absolut sicher. Es war ein Kostüm aus weichem beigefarbenem Tweed, das noch dazu in der Ausgabe von Vogue abgebildet war, die gerade auf ihrem Schreibtisch lag. Susannah konnte sogar die betreffende Seite aufschlagen und mit Sicherheit sagen, daß auch sämtliche Accessoires gestimmt hatten, von den unpraktischen klassischen zweifarbigen fersenfreien Chanel-Pumps bis zu der doppelreihigen echten Perlenkette am Hals dieser erstaunlichen Frau – hier, auf dieser Seite des Magazins, mit einer Bildunterschrift, die genaue Auskunft über ihren Hersteller (Bulgari) und ihren Preis (eine halbe Million) erteilte.
Die Frau hatte vier kleine Päckchen unter dem Arm, alle in gleicher Größe und Form, auf die gleiche Weise verpackt, aber von unterschiedlichem Gewicht. Die Übergabe ging schnell vor sich. Die Daten wurden in Susannahs Computer eingegeben und konnten jederzeit abgerufen werden. Sie lauteten:
Name und Adresse des Absenders:
Mrs. J. A. Hamilton
132 Eaton Place
London SW1
Telefon – 071 7500 0007
Namen und Adressen der Empfänger
1) M. Pascal Lamartine
Atelier 5
13, Rue du Bac
Paris 56742
2) Mr. Johnny Appleyard
Apt. 15, 31 Gramercy Park
New York 10003
NY
3) Signor James McMullen
6, Palazzo Ossorio
Calle Streta
Campiello Albrizzi
Venedig 2361
4) Miss Genevieve Hunter
Flat 1,56 Gibson Square
London N1
Die Gebühr für den Versand belief sich auf insgesamt $ 175,50. Die dazu erforderlichen Geldscheine wurden aus einer nagelneuen Vuitton-Brieftasche gezogen, das Fünfzig-Pence-Stück wurde einem nagelneuen Vuitton-Portemonnaie entnommen. Mit leiser höflicher Stimme bedankte sich die Absenderin und verließ zehn Minuten, nachdem sie gekommen war, die ICD-Zentrale.
Später, als sich herausstellte, daß dieser Auftrag keineswegs das war, wofür er sich ausgab – einer der Empfänger war bereits tot, und keiner von ihnen hatte im Januar Geburtstag –, war Susannah keineswegs verwundert. Denn es hatte, wie sie sagte, eine ganze Reihe merkwürdiger Unstimmigkeiten gegeben.
Erstens einmal hatte die Frau in dem Zobelpelzmantel behauptet, Mrs. J. A. Hamilton zu sein, obwohl sie keinen Ehering getragen hatte. Zweitens hatte sie behauptet, dieselbe zu sein, die vorher angerufen hatte, was aber eindeutig falsch war. Die Frau am Telefon hatte englisch gesprochen, sehr englisch sogar; aber die Schönheit in dem Zobelpelzmantel war Amerikanerin gewesen.
»Was seltsam war«, sagte Susannah und runzelte die Stirn. Sie drehte sich um und sah aus dem Fenster. Ihr Blick glitt über die Türme und Dächer der City.
»Wieso seltsam?« fragte eine der beiden Personen, die sie befragten.
»Weil diese Unstimmigkeit ganz unnötig war«, erwiderte Susannah. »Es war, als wüßte sie –«
»Als wüßte sie was?«
»Als wüßte sie, daß man sich bei mir nach diesen Päckchen erkundigen würde«, sagte Susannah. »Verstehen Sie? Der tolle Mantel, die Kleider. Zwei verschiedene Frauen, die behaupten, ein und dieselbe zu sein. Wer immer sie war, sie wollte unbedingt, daß ich mich an sie erinnere ...« Dann schwieg Susannah. Die beiden Personen, die sie ausgefragt hatten, tauschten Blicke aus.
»Aber warum nur?« fragte Susannah.
Teil Eins
Vier Sendungen
Kapitel I
Pascal Lamartine
Das Päckchen wurde kurz nach neun gebracht. Pascal Lamartine, der zu einer Verabredung mußte und sich bereits verspätet hatte, bestätigte den Empfang, schüttelte des Päckchen und legte es auf den Frühstückstisch. Keine Eile: Er würde es später öffnen. Inzwischen versuchte er mehrere Dinge gleichzeitig zu tun – Kaffee kochen, packen, seine Fototaschen überprüfen und, das Schwierigste von allem, seine Tochter Marianne dazu bringen, ihr Frühstücksei zu essen.
Päckchen kamen in zweierlei Form bei Pascal an. Wenn sie flach waren, enthielten sie Fotos und konnten eilig sein; waren sie nicht flach, dann handelte es sich zumeist um etwas Unwichtiges, um Werbematerial, das von einer PR-Agentur verschickt wurde. Seine Tochter Marianne, sieben Jahre alt, sah die Dinge anders. Für sie bedeuteten Päckchen so etwas wie Weihnachten oder Geburtstag; sie bedeuteten Spaß. Als Pascal fertig gepackt und Kaffee gemacht hatte, ging er wieder zum Tisch und fand Marianne mit dem Päckchen in den Händen. Das Ei – nicht gerade appetitlich, wie Pascal zugeben mußte, aber schließlich konnte er nicht einmal die einfachsten Dinge kochen – fand keine Beachtung.
Marianne untersuchte das Päckchen. Sie machte sich an der Verpackung zu schaffen. Sie sah ihren Vater erwartungsvoll an. »Ein Geschenk«, sagte sie. »Schau, Papa. Jemand hat dir ein Geschenk geschickt. Du mußt es sofort aufmachen.«
Pascal lächelte. Er konzentrierte sich darauf, ganz nach Mariannes Geschmack einen café au lait zu mixen, nach Mariannes Art. Das Getränk mußte milchig und süß sein. Es mußte auf traditionelle französische Art serviert werden – in der grünen Keramikschale, die Marianne von seiner Mutter bekommen hatte und die sie liebte und auf deren Rand ein orangefarbener Hahn thronte. Dann mußte die Schale so auf den Tisch gestellt werden, daß der Hahn Marianne ansah. Seine Tochter hatte eine Vorliebe für solche Einzelheiten, die ihm manchmal Sorgen bereitete. Er fürchtete, daß sie ein Nebenprodukt seiner unerfreulichen Scheidung von ihrer Mutter sein könnte. Er tat drei Stück Zucker in die Schale, rührte um und reichte sie ihr über den Tisch hinweg. Traurig betrachtete er die Schale. Drei Jahre alt und leicht angeschlagen, war sie ein Relikt: Seine Mutter war jetzt schon fast ein Jahr lang tot.
»Ich glaube nicht, daß es ein Geschenk ist, Liebling«, sagte er und setzte sich hin. »Ich kriege kaum noch Geschenke. Wahrscheinlich, weil ich schon so alt bin.« Er zog die Schultern ein, während er es sagte, um sich kleiner zu machen. Und verzog melancholisch das Gesicht.
Marianne lachte. »Wie alt bist du denn?« fragte sie, während sie sich bemühte, den Knoten in der Schnur aufzuknüpfen.
»Fünfunddreißig.«
Pascal zögerte, um der Versuchung zu widerstehen, dann zündete er sich doch eine Zigarette an. Er seufzte. »In diesem Frühjahr werde ich sechsunddreißig. Uralt!«
Marianne dachte darüber nach. Ihre Augen flackerten, und sie spitzte die Lippen. Fünfunddreißig Jahre mußten ihr sehr alt vorkommen, dachte Pascal. Mein Vater, der Methusalem. Er zuckte die Achseln. Für Marianne war das Alter eine Tatsache ohne natürliche Folgen. Sie war noch zu jung, um das Altern mit Krankheit und Tod in Verbindung zu bringen, auch jetzt noch.
»Das Ei ist nicht gelungen, was?« Er lächelte. »Du mußt es nicht essen. Iß lieber das Brot.«
Marianne warf ihm einen dankbaren Blick zu und biß in das knusprige Brot mit der Erdbeermarmelade darauf, die sofort an ihrem Kinn, ihren Händen und dem Tischtuch klebte. Pascal streckte die Hand aus und nahm vorsichtig einen Krümel von ihrem Kinn und legte ihn auf ihre Nasenspitze. Marianne kicherte. Sie kaute zufrieden weiter und schob dann das Päckchen über den Tisch.
»Aber vielleicht ist es doch ein Geschenk«, sagte sie ernst. »Ein schönes Geschenk. Man kann nie wissen. Mach es auf, bevor wir gehen, Papa, bitte.«
Pascal sah auf seine Armbanduhr. Er hatte gerade noch eine Stunde Zeit, um Marianne wieder bei ihrer Mutter abzuliefern, die in einem Pariser Vorort wohnte, dann durch den Stoßverkehr wieder ins Zentrum zurückzufahren, um sich mit Françoise zu treffen und die neuen Fotos abzugeben. Wenn er nicht aufgehalten wurde, könnte er leicht den Mittagsflug nach London erreichen, der vom Flughafen de Gaulle startete. Er zögerte: Sie hätten die Wohnung schon vor zehn Minuten verlassen sollen.
Andererseits war Mariannes hübscher Koffer, den er selbst für sie gekauft hatte, schon fertig gepackt. Die Menagerie an Teddybären und Hasen und das traurige ausgestopfte Känguruh, ohne das sie nicht schlafen konnte, waren schon alle bereit und warteten im Flur. Er konnte es nicht ertragen, sie zu enttäuschen, wenn sie ihn so erwartungsvoll ansah.
»Also gut«, sagte er. »Sehen wir doch mal nach, was wir hier haben.« Er zog das Päckchen näher zu sich. Als er es jetzt genauer betrachtete, sah es wirklich interessant aus – und auch ungewöhnlich, nicht wie die Päckchen, die die Werbeagenturen verschicken. Braunes Papier, ganz neu, das um einen Karton gewickelt war. Nicht schwer. Sauber verpackt, ungefähr fünfzehn Zentimeter hoch und breit. Die Schnur um das Päckchen war in regelrechten Abständen verknotet, die Knoten mit rotem Wachs versiegelt. Ein solches Päckchen hatte er schon seit Jahren nicht mehr gesehen, und schon gar nicht selbst erhalten. Sein Name und seine Adresse waren, sorgfältig in Großbuchstaben, mit der Hand geschrieben. Er sah genauer hin und stellte fest, daß sie mit einer Schablone geschrieben waren.
Er gab sich Mühe, sich nichts anmerken zu lassen, aber als er es sich später wieder ins Gedächtnis rief, wurde ihm klar, daß er sich zu schnell bewegt hatte, daß er hastig seinen Stuhl zurückgeschoben hatte. Vielleicht war er blaß geworden – irgend etwas an seinem Benehmen mußte Marianne aufgefallen sein. Denn sie besaß die dünnhäutige Sensibilität eines Einzelkindes, dem schon kleinste Nuancen auffielen, mit einem sechsten Sinn für Schwierigkeiten, der durch die jahrelangen elterlichen Streitigkeiten hinter verschlossenen Türen geschärft worden war. Als er jetzt ganz beiläufig das Päckchen nahm und damit wegging, verdüsterte sich ihr Gesicht. Sie sah ihn unsicher an.
»Was ist los, Papa?«
»Nichts, Liebling. Nichts«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Ich habe gerade bemerkt, daß es schon spät ist, das ist alles. Lauf und hol deinen Mantel, ja?«
Sie blieb einen Augenblick sitzen und beobachtete ihn. Sie beobachtete, wie er die brennende Zigarette im Aschenbecher liegenließ. Sie beobachtete, wie er das Päckchen in die Küche trug und auf das Abtropfbrett aus fleckenlosem Stahl legte. Sie beobachtete, wie er Wasser in den Ausguß laufen ließ. Dann kletterte sie plötzlich gehorsam von ihrem Stuhl.
Als er sich das nächste Mal umdrehte, hatte sie ihren Mantel geholt und war in die Küche gekommen. Sie stand mitten in dem großen Raum und beobachtete ihn, während das Licht durch die großen Fenster auf ihr Haar fiel. Auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck wie schon seit Monaten nicht mehr, ein Ausdruck, den er niemals wieder hatte bei ihr hervorrufen wollen, nachdem die Scheidung vorüber gewesen war. Das hatte er sich versprochen. Diesen Ausdruck von Verwirrung und Schuldgefühlen. Pascal ließ das Päckchen liegen und ging zu ihr hin. Er gab ihr einen Kuß auf den Kopf, legte den Arm um sie und schob sie sanft zur Tür. An der Tür blieb sie stehen und sah zu ihm hoch, ihr Gesicht war vor Angst ganz rot.
»Was ist denn, Papa?« fragte sie noch einmal. »Was habe ich getan?«
Die Frage schnitt Pascal ins Herz. Er fragte sich, ob es das Schicksal aller Kinder geschiedener Eltern war – durch das Leben zu gehen und sich die Schuld für das Versagen ihrer Eltern zu geben.
»Nichts, Liebling«, erwiderte er und zog sie fest an sich. »Ich habe dir doch gesagt, daß wir uns schrecklich verspätet haben. Ich habe eben erst gemerkt, wie spät es schon ist. Hör zu, Marianne –« Er machte die Wohnungstür zum Treppenhaus auf und schob sie sanft nach draußen. »Ich werde das dumme Päckchen später aufmachen – wenn ich aus London zurück bin. Und wenn es irgend etwas Aufregendes ist, rufe ich dich an und erzähle es dir, das verspreche ich. Zieh den Mantel an, so ist es gut. Was haben wir denn hier? Einen Bären, einen Hasen, ein Känguruh – hör zu, ich habe eine Idee. Du läufst bis nach unten ins Erdgeschoß und wartest dort auf mich, wirst du das tun? Warte direkt an der Tür, geh nicht hinaus, ich komme gleich nach. Papa muß nur noch ein paar Papiere suchen, sein Flugticket ...«
Es klappte. Mariannes düstere Miene hellte sich wieder auf. »Kann ich Madame Lavalle guten Tag sagen, so wie letztes Mal?«
Pascal lächelte. Im stillen segnete er die freundliche Concierge, die seine Tochter liebte. »Natürlich, Liebling. Zeig ihr deine Tiere, ich wette, die gefallen ihr.«
Marianne nickte und lief zur Treppe. Pascal hörte das Klappern ihrer Schuhe, als sie hinunterlief, dann das Geräusch einer Tür, die aufging, dann Madame Lavalles Stimme.
»Du liebe Güte, was haben wir denn da alles? Einen Hasen. Einen Bären und – mon Dieu, was kann das sein? So etwas habe ich ja noch nie gesehen!«
»Das ist ein Känguruh, Madame.« Mariannes hohe Stimme schallte durch das Treppenhaus bis zu Pascal. »Und sehen Sie, sehen Sie nur, es hält sein Baby ganz fest, sehen Sie den kleinen Beutel hier?« Pascal machte die Tür zu. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er ging wieder in die Küche und blieb stehen und starrte auf das altmodische viereckige Päckchen, das auf dem Tropfbrett lag, mit den säuberlich versiegelten Knoten an der Schnur. Es war jetzt fünf Jahre her, seit er die PLO-Story gemacht hatte, sechs, seit er in Nordirland gewesen war. Seine jetzige Arbeit war völlig anderer Art, aber die Vorsicht – die früher unbedingt notwendig gewesen war – war ihm erhalten geblieben.
Er streckte die Hände aus und legte sie auf das Päckchen. Er strich mit den Fingern über das Papier, tastete an den Rändern nach Drähten.
Er konnte nichts entdecken. Er drehte das Päckchen um, so daß die Ränder des Packpapiers oben lagen. Wo es übereinander reichte, waren keine Siegel, aber es lag fest an. Er zögerte, dann nahm er sein schärfstes Küchenmesser. Er sprengte zuerst die Siegel ab. Dann schnitt er den Bindfaden an vier Stellen durch und zog ihn herunter.
Nichts. Er kam sich bereits etwas albern vor, fand sein Mißtrauen übertrieben. Aber warum hatte man die Adresse mit einer Schablone geschrieben? Er starrte auf die Flecken an seinen Fingernägeln, die er vom Auswickeln hatte. Er zog die Stirn in Falten und sah das Päckchen an und mußte an die Fotos denken, die er in seiner Aktentasche hatte und die er abliefern mußte.
Um diese Bilder zu bekommen, war er in Tarnkleidung fünfhundert Meter durch Gestrüpp und Büsche eines Anwesens in der Provence gekrochen. Er hatte ein 1200-Millimeter-Teleobjektiv mit sich herumgeschleppt, das über zwanzig Pfund schwer war, und ein niedriges Spezialstativ, das nach seinen Anweisungen gebaut worden war. Mit dieser Ausrüstung war es ihm gelungen, über eine Entfernung von dreihundert Metern hinweg gestochen scharfe, klare Bilder von seiner ahnungslosen Beute anzufertigen, die wie eine Schlange auf dem Bauch lag. Früher war er Bildreporter an Kriegsschauplätzen gewesen. Alles, was er damals gelernt hatte, nutzte er jetzt auf eine andere Weise. Was war er denn jetzt? dachte er, während er weiter auf das Päckchen starrte. Ein Paparazzo – niemand, den zu verletzen sich lohnte, niemand, der den Schaden wert war, den eine Briefbombe verursachte. Einen Augenblick lang fühlte er Selbstverachtung, ein vertrautes Gefühl von Scham. Dann klappte er das braune Packpapier mit einer schnellen Bewegung auseinander und nahm den Deckel von dem Karton, der darin eingepackt gewesen war.
Was er, in Seidenpapier gehüllt, darin fand, war höchst seltsam und machte wenig Sinn. Zwischen den Falten des Papiers lag keine Notiz, keine Karte und keine Nachricht, nur ein etwas zerknitterter, schwarzer Gegenstand, den er zuerst für ein Stück Stoff hielt.
Er zog ihn heraus und stellte erstaunt fest, daß er aus Leder war, feines weiches schwarzes Ziegenleder, und daß es sich um einen Frauenhandschuh handelte.
Ein linker Handschuh, und nagelneu – noch nicht getragen, dachte er zuerst. Dann sah er die kleinen Fältchen, die quer über den Handballen verliefen, als wäre dieser Handschuh doch schon getragen worden, wenn auch nur kurz, und als wäre die Hand darin fest zusammengeballt gewesen. Er betrachtete den Handschuh genauer. Er war sehr schmal geschnitten, für eine zierliche Hand gemacht. Ein Abendhandschuh. Am Arm einer Frau würde dieser Handschuh vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen reichen.
Er starrte auf den Handschuh, versuchte seine Botschaft zu entschlüsseln. Sollte er verführerisch oder bedrohlich sein? War er ein Hinweis oder ein Schmuckstück? Er wollte ihn gerade wieder in den Karton zurücklegen, als ihn seine Neugier dazu brachte, ihn sich genauer anzusehen. Er drückte ihn gegen seinen Handrücken und merkte, daß er ganz leicht über seine Haut glitt, als wäre er mit Öl eingerieben. Dann hob er ihn an sein Gesicht und roch daran.
Der Handschuh hatte einen intensiven, störenden Geruch. Er enthielt den Duft eines weiblichen Parfüms, und daneben, fast völlig zugedeckt von Ambra, Zibet und Damast, noch einen anderen irdischeren Geruch. Fisch, Blut – etwas in der Art. Plötzlich ekelte er sich vor diesem feinen Handschuh.
Er ließ ihn fallen. Schon spät, dachte er, während er wieder auf seine Armbanduhr sah. Das verdammte Päckchen hatte ihn aufgehalten. Er nahm seine Aktentasche, seinen Fotokoffer und die kleine ausgebeulte Reisetasche, die mit Kleidungsstücken vollgestopft war. Als er die Wohnungstür öffnete, hörte er von unten die Stimme seiner Tochter. Eine Woche bis zum nächsten Besuchstag. Er wurde von einer Welle der Liebe und Fürsorge erfaßt, so schmerzhaft stark, daß er einen Augenblick erstarrte.
Er stand oben auf dem Treppenabsatz und starrte, ohne etwas wahrzunehmen, über eine Dächerlandschaft in einen blassen, trüben, bleiernen Himmel. Heute Regen, gestern Regen, vorgestern Regen: ein endloser Winter. Frühling, dachte er mit einem plötzlichen leidenschaftlichen Verlangen. Und da! Für einen kurzen Augenblick bekam er ihn zu fassen, spürte ihn auf seiner Haut – den Frühling seiner Kindheit, den Optimismus und das erhebende Gefühl, von dem er begleitet gewesen war. Er konnte die Felder sehen und riechen, die Weinberge, die Eichenwälder seiner Kindheit. Durch den endlosen goldenen Nachmittag hörte er seine Mutter rufen und sah, wie sich der Fluß durch das Tal wand, während das Licht langsam verblaßte und den Frühlingsabend in Silber tauchte. Jetzt war das Haus verkauft, und seine Mutter war tot. Es war schon viele Jahre her, seit ihm der Frühlingsanfang das Gefühl von Hoffnung oder Erneuerung gebracht hatte.
Die nostalgische Stimmung verging. Er schlug die Tür hinter sich zu. Von unten im Treppenhaus rief ihn seine Tochter. Pascal schob die Riemen seiner Gepäckstücke über die Schulter und lief schnell die Treppe hinunter.
Kapitel II
Johnny Appleyard
Das Gebäude, in dem Johnny Appleyard wohnte, lag an der südwestlichen Ecke von Gramercy Park. Es war hoch, mit Türmchen, gotischer Stil. Julio Severas, der ICD-Kurier für diesen New Yorker Stadtteil, kam kurz vor zehn Uhr vormittags dort an.
Es war ein klarer kalter Tag. In der Nacht hatte es geschneit. Der Gehsteig vor Appleyards Haus war sauber gefegt. Julio blieb stehen, um den breiten Säulenaufgang vor dem Gebäude zu bewundern, die glänzenden Marmorstufen. Julio liebte seinen Job – er verschaffte ihm die Gelegenheit, zu sehen, wie die andere Hälfte lebte. Als er die Eingangshalle betrat, sah er sich neugierig um: dunkle Holzverkleidung, ein Fenster mit buntem Glas – komisch, dachte er, fast wie eine Kirche.
Der Portier, ein Grieche, zeigte sich wenig geneigt, mit ihm zu reden. Er begleitete Julio zu einem Fahrstuhl – auch mit Holz verkleidet, und mit einem kleinen lederbezogenen Sitz. Der Fahrstuhl wurde mit der Hand bedient. Erstaunt sah Julio zu, wie der Portier gekonnt an einem Seil zog. Man hörte Geräusche von einem Getriebe, von Gegengewichten. Mit erstaunlicher Sicherheit glitt der Fahrstuhl in die Höhe.
»Tolle Sache«, sagte Julio. »Ohne Strom, stimmt’s?«
Der Portier deutete auf ein blankpoliertes Messingschild mit der Aufschrift Otis Elevators, 1908. »Original«, sagte er. »Handbedienung. Hundert Prozent zuverlässig. Einzigartig – in New York City.«
»Regelrecht antik, was?« sagte Julio und merkte sich diese Information für seine Frau. Auch sie war von allem fasziniert, was die Reichen und ihre Art zu leben betraf. »Teuer, schätze ich. Exklusiv«, spekulierte er, während der Grieche die Kabine anhielt.
Der Grieche musterte ihn verächtlich. Hastig schob er ihn aus dem Fahrstuhl auf den blankpolierten Parkettboden, wo er sich vor einer hohen Tür aus Mahagoniholz wiederfand. Er klingelte und wartete dort zusammen mit Julio, der neben ihm stand. Hinter der Tür dröhnte laute Rockmusik. Julio seufzte und versuchte es von neuem. »Ihr habt hier wohl eine Menge gefeierter Größen? Rockstars? Schauspieler? Künstlervolk?«
Der Portier warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Hören Sie«, sagte er, »ich habe es Ihnen doch schon unten gesagt. Mr. Appleyard ist nicht da. Es meldet sich niemand. Okay? Und jetzt – wollen Sie das Päckchen bei mir lassen?«
»Nein«, sagte Julio und war wieder ganz er selbst. »Will ich nicht.« Der Portier hob die Hand, um es noch einmal mit Klingeln zu versuchen, aber im selben Augenblick ging plötzlich die Tür auf. Der durchdringende Geruch von Rosenöl schlug ihnen entgegen. Und vor ihnen stand ein außerordentlich exquisites Mädchen in der Tür, das von den Schultern bis zu den Knöcheln in einen weißen Frotteebademantel gehüllt war. Als es die beiden Männer sah, fiel seine erwartungsvolle Miene zusammen.
»Oh, ich dachte, es wäre Johnny –« begann es mit leiser rauchiger Stimme und brach ab.
Julio kniff die Augen zusammen. Bei näherem Hinsehen erkannte er seinen Irrtum. Das war keine junge Frau, sondern ein junger Mann: ein junger Mann mit makelloser olivfarbener Haut, hyazinthenblauen Augen und langen dicken blonden Haaren. Das Haar fiel ihm bis über die Schultern; an der feuchten Haut an seiner Kehle klebte eine nasse Haarsträhne. In seinem rechten Ohrläppchen steckte ein goldener Ohrring, und am rechten Handgelenk trug er ein schmales goldenes Kettchen. Er war ungefähr zwanzig Jahre alt, groß und schlank und umwerfend schön. Nur die Tonlage seiner Stimme verriet sein Geschlecht. Wenn Julio an ihm vorbeigekommen wäre, hätte er es nicht geahnt. Großer Gott! Julio spürte, wie er errötete. Er bemühte sich, den Jungen nicht anzustarren, und konzentrierte sich auf seine nackten Füße.
»Ein Päckchen für Mr. Appleyard«, verkündete der Grieche in reichlich anmaßendem Ton. Er zeigte mit dem Daumen auf Julio.
»Ich habe es ihm schon gesagt. Der ist nicht da, stimmt’s? Hab’ ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen.«
Seine Worte trieften vor Hohn. Der Junge wurde ganz rot im Gesicht. Als er den Kopf hob, sah Julio, daß er Mühe hatte, nicht in Tränen auszubrechen.
»Er ist gerade nicht da«, entgegnete er, wie zur Verteidigung, »aber ich erwarte ihn schon bald zurück. Heute nachmittag, oder vielleicht sogar schon heute vormittag.« Er streckte seine schmale Hand nach dem Päckchen aus. »Ich nehme es für ihn. Ich werde es Johnny sofort geben, wenn er kommt. Muß ich etwas unterschreiben?«
Julio gab ihm das Päckchen. Der Junge hatte einen ländlichen Akzent, gedehnt und leicht krächzend. Irgendwo aus dem Westen, dachte Julio. Der Junge nahm das Päckchen wie ein Kind in Augenschein, drehte es erst auf die eine Seite, dann auf die andere. Er schüttelte es, zog beim Anblick des Zollscheins die Stirn in Falten. »Kleidungsstücke. Geburtstagsgeschenk«, las er laut. »Geburtstagsgeschenk?« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Johnny hat im Juli Geburtstag. Er ist Löwe, so wie ich. Das ist doch erst in sechs Monaten. Merkwürdig.«
Wieder schüttelte er das Päckchen. Es klirrte leise. Julio starrte den Portier an.
»Wohnt er denn hier?«
»Sicher wohnt er hier. Stevey ist Mr. Appleyards Mitbewohner, stimmt’s Stevey?« Er grinste. »Schon seit drei Jahren ist er hier, oder sogar vier. Kümmert sich geradezu rührend um Mr. Appleyard. Paßt auf seine Wohnung auf, wenn er weg ist.«
Julio tat der Junge leid. Die Anspielungen in der Stimme des Portiers waren nicht zu überhören – nicht nur anmaßend, sondern direkt unverschämt. Der Portier wippte, noch immer grinsend, auf den Fersen, musterte den Jungen von oben bis unten. Julio wartete darauf, daß Stevey sich wehrte, daß er ihn fertigmachte. Denn schließlich, wer war dieser Kerl denn schon? Nicht mehr als eine bezahlte Hilfskraft.
Zu seiner Überraschung wehrte sich der Junge nicht. Er sah den Griechen mit großen unsicheren Augen an, als wünschte er, es wäre ein Kompliment. Julio bestrafte den Griechen mit einem unfreundlichen Blick. Er reichte dem jungen Mann sein Schreibbrett und einen Stift. Der Junge zögerte, dann kritzelte er einen unleserlichen Namen auf das Formular.
»Einen schönen Tag noch«, sagte Julio, der bemüht war, das schlechte Benehmen des Portiers wieder gutzumachen. Der junge Mann nickte, lächelte scheu, machte die Tür zu und schloß die rosendufterfüllte Luft weg.
»Verdammte Hurenböcke«, sagte der Grieche barsch, dann sah er Julio mit einem boshaften Grinsen an. »Armer kleiner Stevey. Was er jetzt wohl tun wird, wo Mr. Appleyard nicht mehr scharf auf ihn ist? Der Bursche kriegt es schon mit der Angst. Haben Sie das gesehen? Gott, der hat ja fast geheult. Mr. Appleyard hat schon seit über einer Woche keinen Fuß mehr über die Schwelle gesetzt. Schätze, der hat sich einen neuen Bubi zum Spielen genommen. Aber wen soll das schon kümmern?«
Er schlurfte aus dem Fahrstuhl in die Eingangshalle. Julio folgte langsam. Er hatte noch immer Mitleid mit dem jungen Mann. Er legte sich schon in Gedanken zurecht, wie er am Abend alles seiner Frau erzählen würde, was er auslassen würde, was er ergänzen würde. Diesen Aspekt seines Jobs mochte er am liebsten. Es war wie in einem Kinofilm. Kleine Ausschnitte aus dem Leben anderer Menschen.
»Also, dieser Appleyard –« Er war schon an der Tür, versuchte es ein letztes Mal. »Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Könnte ich ihn vielleicht schon gehört haben? Ein Sänger? Ein Musiker?«
»Schreibt für die Zeitungen. Hängt immer mit den Stars herum. Ein Geizkragen. Hat eine Vorliebe für hübsche Jungs, ’ne Menge hübsche Jungs.«
»Jedem das Seine, was?« sagte Julio, dem etwas unbehaglich war. Der Portier verdrehte die Augen. »Und wahrscheinlich schon älter, dieser Appleyard, oder?«
»Vierzig. Und ein richtiges Arschloch. Herr der Scheiße.« Mit einem letzten bösen Grinsen im Gesicht schlug ihm der Grieche die Tür vor der Nase zu.
Kapitel III
James McMullen
Der ICD-Kurier in Venedig war Giovanni Carona. Es war kein Full-time-Job. Giovanni, der frisch verheiratet war und noch bei seinen Eltern wohnte, um Geld für eine eigene Wohnung zu sparen, übte diese Tätigkeit nebenher aus, wann immer die Anrufe kamen. Im Sommer, wenn die Touristen da waren, hatte er ganz schön zu tun, fuhr Amerikaner und Japaner auf dem Canale Grande herum und bis hinaus zur Lagune. Im Winter nahm er jede Arbeit an, die er kriegen konnte.
Das Päckchen sollte um neun Uhr am Flughafen sein. Um acht ging Giovanni an diesem bitterkalten Morgen nach draußen zu dem kleinen Kanal hinter dem Haus seines Vaters und redete dem Motor in dem alten Boot, das seinem Vater gehörte, gut zu, endlich anzuspringen.
Um halb neun bahnte er sich einen Weg durch das Labyrinth enger Kanäle. Über dem Wasser hing grauer Nebel. Die Stadt war gerade dabei, zu neuem Leben zu erwachen.
Vorbei an der Friedhofsinsel von San Michele – Giovanni bekreuzigte sich, als er vorbeifuhr – und hinaus in den Kanal, der direkt zum Flughafen führte. Das Boot tuckerte zwischen den schwarzen Pfählen hindurch, die den Weg markierten. Der Nebel war hier dichter, legte sich klamm auf die Haut. Vor ihm, über dem Industriegelände von Mestre, hinter dem sich der Flughafen erstreckte, hatte der Nebel eine gelbliche Farbe, wie dicke, zusammengeballte Gewitterwolken.
Durch den Nebel verspätete sich der Flug von London. Es war fast elf, als alle Formalitäten für die Übergabe erledigt waren und Giovanni sich auf den Rückweg machte. Diesmal fuhr er eine andere Strecke, näherte sich der Stadt durch den Canale Grande, bog dann in das verschlungene Labyrinth aus kleineren Kanälen an seiner südlichen Flanke ein.
In diesen Stadtteil von Venedig drangen nur wenige Touristen vor, aber hier war Giovanni zu Hause. Er entspannte sich, verspürte keine Eile. Eine blasse Sonne erschien am Himmel, die die Luft erwärmte und den Nebel auflöste. Als er sein Boot am Palazzo Ossorio festmachte, war es fast Mittag. Er stemmte die Hände in die Hüften und warf einen prüfenden Blick auf das Gebäude. Einst ein prächtiger Bau, der jetzt verfallen war. Eine Ruine. Giovanni betrachtete die abbröckelnde Fassade des alten Palastes. Das Erdgeschoß war schon seit langem aufgegeben, die rissige Ockerfarbe des Stuckwerks hatte sich schilfgrün verfärbt. Die Fenster des Gebäudes, dunkel, verschlossen und wenig einladend, hatten sich gesenkt und verbogen. Die Fensterläden waren nur noch zur Hälfte vorhanden, und die eleganten Balkone und die hohen Eingangstore mit ihren Säulen befanden sich in einem trostlosen Zustand. Das ganze Gebäude machte einen baufälligen Eindruck.
Giovanni sah auf das Päckchen. McMullen, ein Ausländer – Engländer? Ire? Amerikaner? Seiner Erfahrung nach mieden die meisten Ausländer Orte wie diesen. McMullen mußte exzentrisch sein, jemand, der den Verfall pittoresk fand. Giovanni hatte für derartige Liebhabereien nichts übrig. Er kletterte aus dem Boot und ging zu den Eingangstoren, die auf den Hof des Gebäudes führten. Als er ihn betrat, hörte er eine schnelle Bewegung, aber er sah keine Ratten. Anzeichen für eine Concierge oder einen Portier konnte er nicht entdecken. Wenn er es richtig bedachte, keinerlei Anzeichen für irgendwelche Bewohner. Die Läden vor den Fenstern, die auf diesen Innenhof führten, waren alle fest verriegelt.
An der einen Hofseite führten breite Steinstufen nach oben. Nummer sechs, die Wohnung dieses McMullen, mußte oben sein; ein Pfeil, von dem die Farbe abblätterte, zeigte nach oben. Als Giovanni hinaufstieg, sah und hörte er nichts und niemanden. In den Ecken der Stufen raschelten vertrocknete dürre Blätter. Die Türen, an denen er vorbeikam, sahen aus, als wären sie schon seit langem nicht mehr geöffnet worden. Allmählich glaubte er, am falschen Ort zu sein – aber nein, das hier war der Palazzo Ossorio, und hier, im obersten Stock, stand ganz deutlich die Ziffer 6 an einer Tür.
Giovanni starrte auf die verschlossene Tür. Das Treppenhaus war nur schwach beleuchtet. Eine Klingel oder einen Türklopfer konnte er nicht entdecken. Er hämmerte gegen die dicke Türfüllung, lauschte, hämmerte noch einmal. Keine Schritte, keine Reaktion. Nichts.
An der Tür hing, vergilbt und mit Fliegenschmutz bedeckt, eine Nachricht. Giovannis Englisch reichte aus, sie zu entziffern. Darauf stand: Wenn ich nicht hier bin, versuchen Sie es später noch mal.
Ein englischer Name auf dem Päckchen, eine Nachricht in englischer Sprache an der Tür – es mußte der richtige Ort sein. Giovanni hämmerte noch ein drittes Mal an die Tür. Er rief mehrmals laut ein paar holas durch die Türfüllung. Aber dann zuckte er zurück, rümpfte angewidert die Nase. Hier war nicht nur alles schmutzig und verrottet, sondern es stank auch gewaltig.
Ein beißender Ammoniakgeruch hing über der Treppe, als würde sie zum Urinieren benutzt, und dahinter dieser eklige Gestank von noch viel Schlimmerem – wie von verwesendem Fleisch. Giovanni konnte sich keinen Reim darauf machen.
Dann hörte er ein Miauen. Als er nach unten sah, entdeckte er eine dünne rötlich-gelbe Katze, die an den Wänden entlangstrich, sich vorsichtig zentimeterweise auf ihn zu bewegte. Sie sah halbverhungert aus. Giovanni bückte sich zu ihr hinunter. Die Katze machte einen Buckel und fauchte.
Giovanni trat mit dem Fuß nach ihr, traf sie aber nicht. Er dachte über das Päckchen nach und über die Nachricht an der Tür. Es verstieß gegen die Vorschriften des ICD, ein Päckchen ohne eine Unterschrift zurückzulassen. Andererseits war es ziemlich unwahrscheinlich, daß es hier jemand stehlen würde. Man könnte McMullens Unterschrift fälschen, das prüfte sowieso nie jemand nach. Giovanni zögerte. Die Versuchung war groß. Inzwischen war es schon Mittag, und er hatte Hunger, und außerdem hatte er mit dieser Sache schon den ganzen Vormittag verplempert. Er gelangte zu einem Entschluß. Er bückte sich und lehnte das Päckchen an die Tür. Dann ging er: zum Teufel damit!
Später, am Nachmittag, bekam er Angst: Er war nur zu faul gewesen, er hatte gegen die Vorschriften verstoßen. Er brauchte diesen Job dringend, aber jetzt hatte er ihn aufs Spiel gesetzt. Er beriet sich mit seiner Frau, was er tun sollte, und ging auf ihr Drängen hin am Abend noch einmal zum Palazzo Ossorio zurück.
Seine Frau begleitete ihn. Sie hatten verabredet, daß er nur nachsehen sollte, ob das Päckchen den Empfänger auch sicher erreicht hatte. Danach wollten sie einen kleinen Abendspaziergang machen und in irgendeiner Cafeteria ein Glas Wein trinken.
Das Gebäude war noch genauso verlassen wie vorher. In McMullens Wohnung rührte sich noch immer nichts. Aber das Päckchen war verschwunden, und neben der Tür stand jetzt eine Untertasse mit Milch für die Katze am Boden. Anscheinend hatte man das Päckchen weggenommen: Trotzdem fühlte sich Giovanni unbehaglich. Er hämmerte mehrmals an die Tür, dann legte er das Ohr dicht an das Holz. Er lauschte und erstarrte. Er war überzeugt, daß er jemanden hörte. Er hörte leise knarrende Geräusche hinter der Tür, das Knarren der Dielen. Jemand mußte in der Wohnung sein, mußte sich darin bewegen.
Dann ging das Licht aus. Seine Frau zog ihn am Ärmel. Sie zitterte am ganzen Körper und starrte ängstlich über seine Schulter.
»Laß uns gehen, Giovanni«, flüsterte sie. »Laß uns gehen. Es ist so unheimlich hier.«
Giovanni legte den Finger auf die Lippen. »Hör zu«, sagte er leise. »Da ist jemand drin. Ich kann ihn hören. Aber warum macht er nicht auf, wenn er da ist?«
»Ich höre nichts. Das ist nur der Wind.« Seine Frau hatte jetzt auch das Ohr an die Tür gelegt. Dann fuhr sie entsetzt zurück. »Was ist das für ein schrecklicher Geruch, Giovanni?« flüsterte sie. »Es riecht nach Verwesung.«
»Wahrscheinlich die Abflußrohre. Es stinkt tatsächlich. Noch schlimmer als heute morgen.«
Er trat einen Schritt zurück und runzelte die Stirn. Dann hämmerte er ein letztes Mal an die Tür. Diesmal blieb es still, völlig still.
»Bitte, laß uns gehen, Giovanni. Bitte. Das bildest du dir doch alles nur ein.«
»Gut, gut. Großer Gott, ist das kalt hier. Du zitterst ja. Wir wollen lieber gehen.«
Auf dem Platz vor dem Palazzo war gleich um die Ecke eine kleine Cafeteria, wo sie ein Glas Rotwein tranken. Giovanni stellte dem Besitzer ein paar Fragen – ob er einen Signore McMullen kannte, ob der Palazzo Ossorio bewohnt war –, aber er fand nicht viel heraus. Der Besitzer der Cafeteria war ein wortkarger Mann und zuckte nur die Achseln. In dieser Gegend? Eine verrückte alte Großmutter vielleicht, mit fünfzig streunenden Katzen. Sonst niemand. Diese Ruine würde jeden Augenblick in den Kanal stürzen, so heruntergekommen war alles.
Aber ob es der Besitzer der Cafeteria nun gewußt hatte oder nicht – diese Vermutung war nicht ganz richtig. Denn als Giovanni und seine Frau auf ihrem Heimweg noch einmal an dem Palazzo vorbeikamen, sah Giovanni an dem Haus hinauf. Das Fenster der Wohnung mit der Nummer sechs lag im obersten Stockwerk, an der Ecke des Gebäudes. Und die Fenster im Palazzo waren alle dunkel, bis auf dieses eine.
Giovanni blieb stehen und schaute zu ihm hoch. Nein, er täuschte sich nicht, und er hatte sich auch vorher nicht getäuscht. Es war jemand in der Wohnung, und er war auch jetzt noch dort. Die Fensterläden waren geschlossen, aber durch eine Ritze fiel ein schwacher Lichtschimmer nach draußen, der deutlich zu erkennen war.
Kapitel IV
Genevieve Hunter
Genevieve Hunter wohnte im Parterre eines großen terrassenförmig angelegten Hauses im frühviktorianischen Stil, an einem der schönsten Plätze Islingtons. Als der ICD-Kurier eintraf, war es kurz nach neun Uhr morgens, und Genevieve hatte sich gerade damit abgefunden, an diesem Morgen zu spät in die Redaktion ihrer Zeitung zu kommen. Sie befand sich im oberen Stockwerk des Hauses, um ihrer Nachbarin, einer alten Dame, einen Besuch abzustatten, als sie es unten an der Tür klopfen hörte. Sie öffnete das Fenster, lehnte sich hinaus und sah einen Mann in Uniform, mit einem Päckchen und einem Schreibbrett unter dem Arm.
»Warten Sie – ich komme sofort«, rief sie. Der Mann sah zu ihr hoch, schüttelte sich vor Kälte, stampfte mit den Füßen auf den Boden und nickte.
Als sie die Treppe zu ihrer Wohnung erreichte, kam ihr der Mann in Uniform schon entgegen. Er hielt ein kleines Päckchen in der Hand. Gini sah, daß es mit einer Schnur zusammengebunden und mit rotem Wachs versiegelt war.
Der Kurier musterte Genevieve Hunter von oben bis unten. Als sie oben das Fenster aufgemacht und ihn gerufen hatte, hatte er sie zuerst für einen jungen Mann gehalten. Aber jetzt, bei genauerem Hinsehen, sah er, daß er sich geirrt hatte, und auch, warum. Sie war groß und schlank und wie ein Mann gekleidet: schwarze Hosen, schwarzer Rollkragenpulli, flache Schuhe. Ihre langen blonden Haare waren straff nach hinten gekämmt und unter einer abgewetzten khakifarbenen Baseballmütze versteckt, und der Trenchcoat, den sie anhatte, war ziemlich lang und mit unzähligen Klappen und Epauletten besetzt, was ihr ein merkwürdiges militärisches Aussehen verlieh. Aber als er sie jetzt genauer betrachtete, bestand gar kein Zweifel, daß sie eine Frau war. Eine junge Frau mit einem ernsten und sehr schönen Gesicht und klaren Augen.
»Tut mir leid, daß Sie warten mußten«, sagte Genevieve. Sie bestätigte den Empfang des Päckchens mit ihrer Unterschrift und wollte es gerade ungeöffnet in ihre Tasche stopfen, als sie innehielt und es sich genauer ansah. Sie hatte es zwar eilig, in ihr Büro in der Redaktion der News zu kommen, aber dieses Päckchen kam ihr, gelinde gesagt, ungewöhnlich vor.
»Merkwürdig«, sagte sie. »Würden Sie das glauben? Schauen Sie mal!« Sie hielt dem Kurier das Päckchen hin. »Die Adresse ist mit einer Schablone geschrieben.«
Sie schüttelte das Päckchen, und der Kurier beugte sich nach vorn, um sich das Päckchen aus der Nähe anzusehen. Ein leises Klappern war zu hören. Genevieve runzelte die Stirn, und der Kurier schüttelte den Kopf.
»Vielleicht soll es eine Überraschung sein«, sagte er in beruhigendem Ton. »Damit Sie die Handschrift nicht gleich erkennen, nicht gleich wissen, wer es geschickt hat, bis Sie es aufgemacht haben. Vielleicht ein Freund?« Er warf ihr einen verschmitzten Blick zu. »Eine Überraschung vom Freund oder so was?«
Genevieve lächelte. Es gab keinen Freund, jedenfalls nicht gerade jetzt, und der eine, der vielleicht in Frage gekommen wäre, hatte sich vor einem Monat auf den Weg nach Australien gemacht, um dort eine Zeitung herauszugeben. Genevieve weinte ihm nicht gerade viele Tränen nach, und im übrigen gehörte er auch gar nicht zu der Sorte Männer, die Überraschungspäckchen verschickten. Sie spürte ein momentanes Unbehagen und schüttelte das Päckchen noch einmal. Der Kurier, der genauso neugierig zu sein schien wie sie selbst, holte ein Taschenmesser hervor.
»Hier.« Er reichte es ihr mit einem Lächeln. »Heutzutage kann man nie wissen, meine Liebe – vielleicht ist es keine besonders gute Idee, es lange mit sich herumzutragen. Vielleicht sollten Sie es lieber gleich aufmachen.«
Genevieve folgte seinem Rat. Vorsichtig zerschnitt sie die Schnur und zog das braune Packpapier herunter. Ein kleiner Karton kam zum Vorschein. Der Karton war mit schweren Lagen Seidenpapier ausgelegt. Dazwischen lagen ein Paar Handschellen. Sie waren aus schwerem Stahl. In ihrem Schloß steckte ein kleiner Schlüssel.
Mit einem erschrockenen Aufschrei zog Genevieve sie heraus. Das Gefühl des Unbehagens wurde stärker. Sie wühlte in dem Seidenpapier, aber außer den Handschellen war nichts zu finden. Keine Nachricht und keine Mitteilung. Sie kniff wütend die Lippen zusammen, und ihre Wangen färbten sich rot.
»Großartig. Keine Nachricht.« Sie sah den Kurier an, der ungläubig den Kopf schüttelte. »Trotzdem ist die Botschaft ziemlich eindeutig. Welcher miese Typ könnte mir das geschickt haben?«
Sie zog die Stirn in Falten und starrte auf die Handschellen, überlegte, wer dafür in Frage kam: Wer würde ein solches anonymes Geschenk verschicken, wer würde sich einen derart üblen Scherz mit ihr erlauben?
Ihr fiel niemand ein. Natürlich hatte sie in ihrer Redaktion nicht nur Freunde, sondern auch Feinde, und es gab genügend Leute, die sie mit ihren Artikeln vor den Kopf gestoßen hatte, sicher, aber sie konnte sich niemanden vorstellen, der sich auf diese besondere Weise heimlich an ihr rächen würde. Mit einem wütenden Schulterzucken faltete sie das Packpapier zusammen.
»Werfen Sie es einfach weg – das würde ich tun«, sagte der Kurier fast entschuldigend. Er deutete auf die Mülltonne neben der Straße.
»Kommt nicht in Frage.« Genevieve kniff die Lippen zusammen.
»Ich brauche es noch. Ich muß herausfinden, wer es mir geschickt hat.«
Sie stopfte die Handschellen in ihre Tasche. Der Kurier zögerte.
»Wenn Sie wollen, könnte ich ein paar Nachforschungen anstellen«, sagte er. »In meinem Büro. Soviel ich weiß, kommt es aus unserer Zentrale in der City. Ich könnte dort mal nach Feierabend vorbeigehen – um mich umzuhören.« Genevieve lächelte ihn dankbar an.
»Würden Sie das für mich tun? Ich würde mich ja selbst darum kümmern, aber ich kann heute den ganzen Tag nicht weg.« Sie reichte ihm ihre Karte. »Das sind meine Telefonnummern – in der Arbeit und zu Hause. Ich müßte gegen sechs Uhr wieder hier sein. Würden Sie mich anrufen, wenn Sie was herausfinden? Ich wäre Ihnen sehr dankbar.«
Der Kurier versprach, es zu tun. Er sagte, sein Name sei George, und daß er sie zu Hause anrufen würde, ganz bestimmt, nach sechs. Dann verabschiedete er sich, weil er noch andere Lieferungen hatte, und Genevieve blieb noch eine Weile auf dem Gehsteig stehen und sah seinem Wagen nach. Es war kalt, und es fing an zu regnen. Sie klappte ihren Mantelkragen hoch und zitterte ein wenig. Handschellen. Hatte das etwa zu bedeuten, daß sie einen unbekannten Feind besaß? Oder was sonst wollte ihr dieses anonyme Päckchen zu verstehen geben?
Sie ging zu ihrem Wagen und machte sich auf den Weg in ihr Büro. Es herrschte dichter Verkehr, und sie verspätete sich noch mehr, aber auf dem ganzen Weg zu ihrer Zeitungsredaktion an den Docks grübelte sie über das anonyme Geschenk nach, so daß sie gar nicht merkte, wie die Zeit verging. Auf halbem Weg dorthin gelangte sie schließlich zu dem Schluß, daß der Absender der Handschellen höchstwahrscheinlich männlichen Geschlechts war – was ihr Unbehagen nur noch verstärkte.
Kapitel V
Es war typisch für seine Exfrau, dachte Pascal, während er in das schöne Anwesen einbog, auf dem ihr Haus stand, daß sie sich entschlossen hatte, gerade hier zu wohnen, in Paris und doch nicht in Paris, in einer Gegend, die kaum weniger französisch sein konnte. Seine frühere Frau, die ein geborenes Sprachtalent war und fließend Französisch, Deutsch und Italienisch sprach, war bis ins Innerste ihres Herzens englisch geblieben. Sie hatte sich eine gewisse schmallippige Verachtung für alles bewahrt, was nicht englisch war, den unerschütterlichen Glauben an dessen Minderwertigkeit. »Paris?« hatte Helen bei ihrer Scheidung gesagt. »In Paris leben? Bist du verrückt? Ich bleibe nur wegen Marianne in Frankreich, weil es nicht anders geht. Ich habe schon ein passendes Haus gefunden. In einem Außenbezirk. Es kostet fünf Millionen Franc. Wir können es in unsere Vereinbarungen aufnehmen. Ich hoffe, du bist nicht kleinlich, Pascal. Für den Preis ist es billig.«
Das Fünf-Millionen-Franc-Haus lag jetzt direkt vor ihm, oben am Ende der Straße. Es entsprach genau dem, was sich Helen unter »gehobenen Ansprüchen« vorstellte. Es hatte sieben Schlafzimmer, alle kostspielig eingerichtet, aber fünf davon unbenutzt. Es hatte sieben Badezimmer, die Küche war wie ein Operationssaal, die Garage groß genug für vier Autos, und es hatte eine Aussicht auf einen trostlos kahlen, aber makellosen Rasen. Es war ein Haus, wie es überall auf der Welt in jedem teuren Vorort hätte stehen können. Pascal hatte schon viele solche Häuser gesehen, die ganz genauso aussahen, genauso vulgär – in Brüssel, in London, in Bonn, in Detroit. Die Ziegelsteine hatten eine aggressive scharlachrote Farbe. Er hatte es auf den ersten Blick verabscheut.
An diesem Morgen fand in der sonst üblichen Routine eine Veränderung statt. Normalerweise begegneten sich Pascal und Helen aufgrund eines stillschweigenden Abkommens nicht. Wenn das Besuchswochenende um war, fuhr Pascal draußen vor dem Haus vor. Helen, die ihn von den großen Fenstern des Wohnzimmers aus kommen sah, eilte zur Tür und breitete die Arme aus. Marianne lief zu ihr, die Tür ging zu, und Pascal fuhr weg.
Wie es schien, war es an diesem Morgen anders. Helen wartete neben der Auffahrt, sie wirkte schmal, elegant und verwirrt. Sie gab Marianne einen oberflächlichen Kuß und schickte sie ins Haus. Pascal kurbelte das Autofenster herunter.
»Du kommst spät«, sagte Helen auf englisch.
»Ich weiß. Es tut mir leid. Es war soviel Verkehr.«
Helen zog vorwurfsvoll und ungläubig die Augenbrauen hoch. »Ach, wirklich? Na ja, das macht ja nichts. Ich habe doch sowieso nichts anderes zu tun, als zu warten, wie du weißt. Könntest du wohl einen Augenblick ins Haus kommen? Ich möchte gern mit dir reden.«
»Das geht leider nicht. Ich habe in zwanzig Minuten eine Verabredung in Paris und muß den Mittagsflug nach London schaffen.«
»Wann mußt du es eigentlich mal nicht zu einem Flug schaffen?« Sie drehte sich mit hochrotem Gesicht um. »Wie es aussieht, scheint sich niemals etwas zu ändern. Na schön, wenn du mir keine zehn Minuten von deiner kostbaren Zeit opfern kannst, werde ich es eben von den Anwälten erledigen lassen. Das ist langwieriger und natürlich teurer – aber du willst es ja nicht anders.«
Als sie »Anwälte« sagte, schaltete Pascal den Motor ab. Er stieg aus, schlug die Wagentür zu und ging vor ihr ins Haus. In der Küche hob er das Telefon ab und begann eine Nummer zu wählen. Er bemerkte die Kaffeemaschine, die mit frischem Kaffee gefüllt war, den Teller mit Plätzchen und den weißen Küchentisch mit der Marmorplatte, die beiden weißen Tassen und Untertassen, die beiden Teller.
Helen kam in die Küche und machte die Tür zu, auf ihren Lippen lag ein kleines triumphierendes Lächeln. Als sie ihn am Telefon sah, runzelte sie die Stirn.
»Wen rufst du an?«
»Das Magazin. Ich habe dir doch gesagt, daß ich verabredet bin. Jetzt werde ich zu spät kommen.«
Sie ging nicht darauf ein. Während Pascal seinen Anruf machte, goß sie Kaffee in die beiden Tassen und trug sie zu dem Tisch am Fenster. Sie stellte einen Keramikkrug mit Milch und eine Keramikdose mit Zucker in die Mitte der leeren weißen Tischplatte.
»Setz dich doch«, sagte sie, als Pascal den Hörer aufgelegt hatte.
»Mach kein so finsteres Gesicht. Ich werde mich bemühen, es kurz zu machen.«
Pascal betrachtete nachdenklich den Kaffee in den beiden Tassen, den Beweis dafür, daß seine Exfrau überzeugt gewesen war, daß er, sosehr er sich auch sträubte, am Ende doch nachgeben würde. Er zuckte die Achseln und setzte sich hin. »Ich wäre dir dankbar, wenn du es wirklich kurz machen würdest.« Seine Stimme war höflich. »Es ist wichtig, daß ich das Flugzeug kriege.«
»O ja, da bin ich mir sicher.« Sie lächelte. »Das war schon immer wichtig. Wenn ich zurückblicke auf unsere Ehe – was ich, wie ich gestehen muß, möglichst vermeide –, weißt du, was mir dann das Wichtigste gewesen zu sein scheint? Daß du nie dagewesen bist. Immer wenn ich oder Marianne dich gebraucht haben, wo warst du dann? Auf irgendeinem Flughafen. Mitten in einem Krieg. In irgendeinem heruntergekommenen Hotel irgendwo am Ende der Welt, wo die Schalttafel nicht funktioniert hat. Und wenn sie doch einmal funktioniert hat –« Sie nahm sich einen Keks und biß hinein, »dann warst du nicht in deinem Zimmer. Sehr merkwürdig war das.«
Pascal wandte den Blick ab. Er gab sich Mühe, ruhig zu bleiben. »Das ist doch alles kalter Kaffee«, sagte er. »Wir waren uns doch einig, daß wir das nicht immer wieder aufwärmen wollen. Als du mich geheiratet hast, da wußtest du doch –«
»Als ich dich geheiratet habe, wußte ich überhaupt nichts.« Ihre Stimme wurde bitter. Aber sie nahm sich schnell wieder zusammen. »Wie du gesagt hast – kalter Kaffee. Deshalb komme ich gleich zur Sache. Ich will mich in dieser Angelegenheit zivilisiert verhalten. Du solltest wissen, daß ich das Haus verkauft habe.«
Dann schwieg sie. Pascal sah sie mißtrauisch an. Aber sein Magen machte einen Freudensprung. »Dieses Haus hier?«
»Natürlich dieses Haus. Es ist alles, was ich besitze. Und ich finde – ich finde, es paßt nicht.«
»Es paßt nicht? Du hast es dir doch selber ausgesucht. Es hat fünf Millionen Franc gekostet. Du hast nicht mal drei Jahre darin gewohnt, und jetzt paßt es nicht mehr?«
»Ich habe dieses Haus drei Jahre lang ertragen.« Ihr Gesicht war jetzt noch röter. »Und würdest du bitte etwas leiser sprechen? Ich will nicht, daß Marianne uns hört oder die Kinderschwester. Ich will keine Kündigungen mehr. Die hatte ich schon zur Genüge. Marianne braucht Beständigkeit, und diese Mädchen lieben derartige Szenen nicht.«
»Szenen? Szenen?« Pascal stand auf. »Wenn man bedenkt, wieviel ich ihnen zahle, können sie ruhig auch mal eine Szene ertragen, noch dazu eine so seltsame wie diese.«
»Das habe ich nicht gewollt. Es gehört sich nicht. Ich wollte nur endlich einmal fünf Minuten vernünftig mit dir reden – und dann muß so was passieren –«