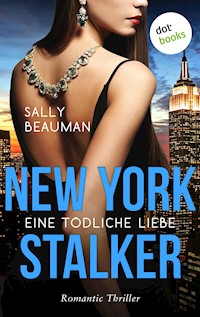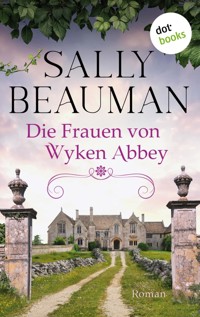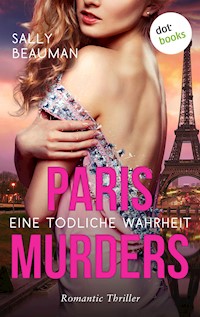
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Journalists
- Sprache: Deutsch
Welche Schatten lauern im Leben dieser Frau? Der Romantik-Thriller »Paris Murders – Eine tödliche Wahrheit« von Sally Beauman als eBook bei dotbooks. Ihr Privatleben war das bestgehütete Geheimnis von Paris – doch nun ist die berühmte Designerin Maria Cazarés tot: Wurde die ungekrönte Königin der Modewelt ermordet? Die Starreporterin Gini Hunter fliegt sofort von London an die Seine, weil sie eine hochbrisante Story wittert – aber warum mischt sich ihr verboten attraktiver Chefredakteur Rowland McGuire ständig in die Recherchen ein? Während zwischen beiden in vielerlei Hinsicht die Funken fliegen, wird die Lage plötzlich brenzlig, als Gini und Rowland in eine Entführung und einen Drogenskandal im Umfeld der Designerin verwickelt werden. Welche Geheimnisse hat Maria Cazarés mit ins Grab genommen – und wer ist zu allem bereit, um sie zu bewahren? »Fesselnd von der ersten Seite an!« The Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Paris Murders – Eine tödliche Wahrheit« von Bestsellerautorin Sally Beauman, ein Thriller voll prickelnder Leidenschaft und rasanter Spannung, ist der zweite Band der »Journalists«-Reihe, deren Bücher unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 962
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ihr Privatleben war das bestgehütete Geheimnis von Paris – doch nun ist die berühmte Designerin Maria Cazarés tot: Wurde die ungekrönte Königin der Modewelt ermordet? Die Starreporterin Gini Hunter fliegt sofort von London an die Seine, weil sie eine hochbrisante Story wittert – aber warum mischt sich ihr verboten attraktiver Chefredakteur Rowland McGuire ständig in die Recherchen ein? Während zwischen beiden in vielerlei Hinsicht die Funken fliegen, wird die Lage plötzlich brenzlig, als Gini und Rowland in eine Entführung und einen Drogenskandal im Umfeld der Designerin verwickelt werden. Welche Geheimnisse hat Maria Cazarés mit ins Grab genommen – und wer ist zu allem bereit, um sie zu bewahren?
Über die Autorin:
Sally Beauman (1944–2016) war eine englische Autorin und Journalistin. Sie studierte in Cambridge Englische Literaturwissenschaft und war anschließend in England und den USA als Journalistin für viele angesehene Zeitschriften wie die »New York Times« und die »Vogue« tätig. Besonders bekannt ist sie für ihre acht international erfolgreichen Bestsellerromane, die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden.
Sally Beauman veröffentlichte bei dotbooks bereits »Rebeccas Geheimnis«, »Das Geheimnis von Winterscombe Manor«, »Die Frauen von Wyken Abbey«, »Erben des Schicksals«.
Außerdem erscheint von ihr die Romantic-Thriller-Reihe »Journalists« mit den Titeln »London Killings – Ein tödliches Geschenk«, »Paris Murders – Eine tödliche Wahrheit« und »New York Stalker – Eine tödliche Liebe«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Danger Zones« bei Bantam Press, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Eine verhängnisvolle Wahrheit« bei Goldmann.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by Sally Beauman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-445-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »PARIS MURDERS« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sally Beauman
Paris Murders – Eine tödliche Wahrheit
Romantic Thriller
Aus dem Englischen von Christoph Göhler
dotbooks.
Für meinen lieben Lovell
Prolog
Der junge leitende Angestellte im schwarzen Mantel war nervös, doch es gab keine Probleme beim Grenzübertritt. Um fünf Uhr früh fuhr er an einem kalten Januarmorgen in einem Mercedes der Cazarès-Flotte aus Amsterdam ab. Draußen lag die Temperatur unter dem Gefrierpunkt. Im Wagen hatte er die Klimaanlage auf 15° Celsius eingestellt: nicht wärmer, denn er wollte hellwach bleiben. Aus Furcht vor überfrierender Nässe, selbst dem kleinsten Unfall oder einer Begegnung mit der Polizei fuhr er höchst korrekt und defensiv und blieb immer zehn Stundenkilometer unter der in den Niederlanden erlaubten Höchstgeschwindigkeit.
Seine Anspannung wuchs, als er sich der belgischen Grenze näherte, aber bis dahin hatte der Verkehr zugenommen; er war nur einer unter vielen Geschäftsleuten in ähnlichen Limousinen, die auf dem Weg nach Antwerpen, Brüssel oder Paris waren. Außerdem hatte man aufgrund entsprechender EU-Bestimmungen die Grenzkontrollen weitgehend eingestellt: Wenn nicht gerade eine Großfahndung lief, wurde man kaum je angehalten. Auf den schnellen, ebenen belgischen Autobahnen ging es zügig in Richtung Süden; vor neun Uhr hatte er die Grenze nach Frankreich überquert und war höchstens noch zwei Stunden von seinem Ziel – Paris – entfernt.
Sobald er in Frankreich war, begann er sich zu entspannen – ein Fehler, wie er später erkannte; er schaltete den CD-Player ein, genehmigte sich eine längst fällige Zigarette; seine Stimmung hellte sich auf, weil sein Auftrag so gut wie erledigt war, und so gestattete er sich, die Geschwindigkeit ein wenig zu erhöhen.
Der gewaltige V8-Motor des Mercedes reagierte auf den geringsten Pedaldruck. Er schloß hinter einen langsam dahinzuckelnden Lastzug auf, wechselte auf die Überholspur, brauste mit einem verächtlichen Blick vorbei – und entdeckte den vor dem Lastzug herfahrenden Streifenwagen fünf Sekunden zu spät.
Er spürte, wie Adrenalin durch seine Adern schoß und sein Mund augenblicklich trocken wurde, aber er blieb gefaßt. Im Weiterfahren drosselte er allmählich das Tempo; er blinkte und wechselte zurück auf die mittlere Spur. Er sagte sich, daß die Polizisten wahrscheinlich nichts bemerkt hatten. Wenn er ein auffälligeres Auto fahren würde, einen Porsche zum Beispiel; wenn er nicht so untadelig gekleidet wäre, in einen Mantel von Hermès und einen 20.000 Francs teuren Anzug aus der Savile Row, dann hätten sie ihn vielleicht rausgewunken; ja. So jedoch wirkte er wie die Verkörperung von Reichtum und Prestige und war deshalb bestimmt außer Gefahr.
Noch während er das dachte, merkte er, daß der Streifenwagen sich an seine Stoßstange geheftet und Sirene und Blaulicht eingeschaltet hatte.
Ruhig bleiben, ermahnte er sich. Eine Verwarnung, schlimmstenfalls ein Bußgeld; die Situation war zu meistern. Er gab mit einer höflichen Geste zu erkennen, daß er anhalten würde, und lenkte den Wagen auf den Seitenstreifen. Ihm blieben etwa fünfzehn Sekunden, bis der Streifenwagen hinter ihm angehalten hatte und die Beamten ausgestiegen waren. Er warf einen Blick auf den schwarzen Diplomatenkoffer auf dem Beifahrersitz. Alle leitenden Angestellten bei Cazarès bekamen einen solchen Koffer ausgehändigt; dieser hier trug seinen Namen, Christian Bertrand, und am Griff einen unauffälligen Anhänger mit den Initialen JL – ein Hinweis darauf, daß Bertrand zu den sechs Führungskräften zählte, die Jean Lazare direkt unterstanden.
Eine lange, qualvolle Sekunde lang blickte er auf diesen Koffer. Instinktiv wollte er einen Mantel oder eine Zeitung darüberwerfen; ihn unter dem Sitz verstecken. Aber der erste Polizist näherte sich bereits, und es wäre ein Fehler gewesen, die Aufmerksamkeit auf den Diplomatenkoffer zu lenken. Schnell prüfte er sein Gesicht im Rückspiegel – er sah bleich, aber gefaßt aus. Dann öffnete er die Tür. Bis der erste Polizist das Auto erreicht hatte, hatte er die Papiere bereits in der Hand; er gab sich höflich, respektvoll – und hatte sich seine Ausrede bereits zurechtgelegt.
Natürlich tat es ihm leid; ein Augenblick der Unaufmerksamkeit. Er stockte, dachte – sag nichts von Amsterdam – und redete dann ruhig weiter: Er sei in Gedanken bei den Details seiner morgendlichen Geschäftsbesprechung in Brüssel gewesen und habe darüber nachgedacht, was er Mr. Lazare berichten würde, wenn er später an diesem Vormittag in der Zentrale von Cazarès angekommen wäre. Er hielt inne, damit diese Namen, die für jeden Franzosen magische Bedeutung hatten, Wirkung zeigen konnten. Und sie machten Eindruck – das war deutlich zu sehen.
Der Polizist wirkte zwar nicht ausgesprochen ehrfürchtig, aber er schien etwas aufzutauen. Er bemerkte, daß eine wichtige Geschäftsbesprechung und ein Augenblick der Unaufmerksamkeit vieles entschuldigen könnten, aber nicht eine Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von hundertdreißig Stundenkilometern um mehr als zwanzig Stundenkilometer. Bertrand murmelte ein paar angemessene Entschuldigungen. Er reichte dem Beamten seine Papiere und fügte beiläufig hinzu, daß zur Zeit natürlich jeder bei Cazarès unter enormen Zeitdruck stehe; wie der Beamte sicherlich wisse, werde in einer Woche die Frühjahrskollektion von Cazarès präsentiert.
Der Polizist verdaute diese Information, während er Bertrand lange prüfend ansah. Sein Blick erfaßte den Mantel, den untadeligen Anzug, Hemd und Krawatte, den konservativen Elysée-Haarschnitt, die getönte Schildpattbrille. Bertrand flehte insgeheim, daß dieser nüchterne Aufzug ihn retten würde. Die Sorbonne, Oxford, Doktor der Harvard Business School – so rezitierte er für sich die Litanei seiner Leistungen. Mach, daß dieser Mann vernünftig ist, betete er, und kein pingeliger Paragraphenreiter wie so viele Polizisten; laß ihn begreifen, daß er es mit einem gebildeten Geschäftsmann mit weitreichenden Verbindungen zu tun hat, dessen Arbeit für Cazarès von internationaler Bedeutung ist und wesentlich zum Glanz und Ruhm Frankreichs beiträgt.
Mach, daß er ein Patriot ist; mach, daß er sich beeindrucken läßt, flehte der junge Mann insgeheim, dann erstarrte er. Während der eine Beamte unerträglich langsam seine Papiere überprüfte, umrundete der andere mit gemessenen Schritten den Mercedes. Er beugte sich über das Nummernschild, befingerte seine Rückleuchte, ging dann nach vorne und überprüfte ausgiebig und mit nervtötender Gründlichkeit die Scheibenwischer. Dann öffnete er die Beifahrertür. Bertrand beobachtete ihn aus dem Augenwinkel. Er beugte sich in den Wagen; er nahm das Armaturenbrett in Augenschein, die Instrumente, den CD-Spieler, die handgenähten schwarzen Ledersitze. Er faßte nach vorne, öffnete das Handschuhfach, schloß es dann wieder. Bertrand wandte den Blick ab. Er vergrub die Hände in den Manteltaschen und hoffte, keinem der beiden Polizisten würde auffallen, daß sie zu zittern begonnen hatten.
Inzwischen besah sich der zweite Polizist den Diplomatenkoffer, das konnte der junge Angestellte spüren. Er wagte einen Seitenblick und sah sich bestätigt: Der Mann hatte den Koffer zu sich her gezogen und inspizierte jetzt den Anhänger mit dem Monogramm. Bertrand merkte, wie sich sein Magen vor Angst verkrampfte; ihm wurde übel und schwindlig; er dachte, ich muß sie ablenken, ich muß was sagen ...
Und dann, ganz plötzlich, war es vorbei. Der zweite Polizist schlug die Beifahrertür zu; der erste faltete die Papiere zusammen und reichte sie ihm zurück.
»Unter diesen Umständen ...«, sagte er.
Er beendete den Satz nicht, aber der junge Angestellte verstand; ihm wurde flau vor Erleichterung. Sie drückten ein Auge zu – nicht einmal ein Strafzettel! Er hatte es geschafft. Der zweite Beamte ging bereits zum Streifenwagen zurück; der erste wollte sich schon umdrehen und hielt dann inne.
»Cazarès ...«, sagte er.
Bertrand wurde nervös.
»Arbeiten Sie schon lange da?«
»Vier Jahre.«
Einen Moment schwiegen beide. Bertrand sah den Polizisten unsicher an und versuchte, seine Miene zu deuten. Sie wirkte jetzt weniger bürokratisch, sondern fast respektvoll, fand er.
»Dann sind Sie ihr doch bestimmt schon begegnet – der Cazarès?«
Eindeutig respektvoll jetzt, wenn nicht gar ehrfürchtig; Bertrand entspannte sich.
Er war vom Haken, und diese Frage war ihm nur allzu vertraut. Man stellte sie ihm bei Essenseinladungen, auf Parties, bei geschäftlichen Besprechungen in Paris, London, Rom, New York. Sie leistete gute Dienste, denn sie diente einer Legende: Der Glanz, den man mit Maria Cazarès in Verbindung brachte, strahlte auf alle aus, die für sie arbeiteten, vom Manager bis zur Näherin. Er lächelte. Natürlich habe er sie gesehen, antwortete er, bei jenen feierlichen Anlässen zweimal im Jahr, wenn sie aus ihrer Abgeschiedenheit auftauchte, um am Ende ihrer Couture-Schauen ihren Applaus entgegenzunehmen. Er hielt inne, senkte die Stimme, ließ sie vertraulicher klingen; und außerdem, fügte er hinzu, sei ihm das Privileg zuteil geworden, sie auch privat kennenzulernen; vor etwa zwei Jahren sei er ihr von Jean Lazare persönlich vorgestellt worden, bei einem Empfang ihr zu Ehren.
»Sie meinen, Sie haben tatsächlich mit ihr gesprochen?«
»Ein paar Worte, ja. Mlle. Cazarès ist ausgesprochen menschenscheu, wie Sie wahrscheinlich wissen; und sehr empfindsam. Sie blieb nicht lange auf dem Empfang, insofern hatte ich außerordentliches Glück. Eine Frau, die ihre eigene Berühmtheit fürchtet – eine Künstlerin – so schön. Eine Begegnung, die ich nie vergessen werde ...«
Die Lügen gingen ihm leicht von der Zunge; sie waren gut geprobt, denn sie waren Bestandteil der Firmenpolitik bei Cazarès, und er hatte die gleiche Antwort, wenn auch in Variationen, schon bei vielen Gelegenheiten gegeben. Der Öffentlichkeit mußte vermittelt werden, daß die Cazarès zwar eine zutiefst geheimnisvolle Persönlichkeit war, aber durchaus noch arbeitete, daß sie immer noch Entwürfe machte. Andere Mitglieder der Geschäftsführung bei Cazarès mochten eher ihr Aussehen oder ihren Charme oder ihre außerordentliche Inspiration betonen: Bertrand, der nie persönlich mit ihr gesprochen hatte, war immer der Ansicht gewesen, daß er sie am besten als gepeinigte Künstlerin verkaufen konnte.
»Eine ungewöhnliche Frau«, sagte der Polizist jetzt kopfschüttelnd. Bertrand stimmte ihm ernst zu, gab aber keine weiteren Informationen preis, da niemand, nicht einmal seine Frau, erfahren durfte, was das Ungewöhnliche an Maria Cazarès war – außerdem konnte er dabei selbst nur Vermutungen anstellen.
Die Sache war überstanden; der Streifenwagen fuhr weiter. Immer noch aufgewühlt kehrte Bertrand zu seinem Mercedes zurück, rauchte noch eine Zigarette, um sich zu beruhigen, und beschloß, unter den gegebenen Umständen M. Lazare den kleinen Zwischenfall zu verschweigen. Dann setzte er die Fahrt nach Paris in ruhigerem Tempo fort.
Als er in den Innenhof des wunderschönen Stadthauses aus dem siebzehnten Jahrhundert einbog, das Lazare vor etwa fünfzehn Jahren als Firmensitz für Cazarès erworben hatte, wurde er wieder nervös. Lazares Unmut, wenn man ihn warten ließ, und seine Wutausbrüche waren berüchtigt. Bertrand wappnete sich gegen die scharfe Zurechtweisung, die ihn bestimmt erwartete; er schob den Portier beiseite, winkte dem Liftboy ab, eilte zur Treppe und begann zu rennen, sobald er außer Sicht war.
Lazares ungewöhnliche Bürosuite befand sich in der obersten Etage des Gebäudes. Seine Festung wurde von einer Phalanx von Sekretärinnen und Assistentinnen und Gehilfen bewacht, die in einer Reihe ehrfürchtig gedämpfter Büros untergebracht waren. Da Bertrand erwartet wurde, machte niemand Anstalten, ihn aufzuhalten, wenn auch Lazares persönliche Sekretärin im letzten Zimmer einen Blick auf die exquisite, in die Vertäfelung eingelassene Uhr warf. Sie machte eine kleine, warnende Geste. »Calmez-vous«, sagte sie.
Bertrand rückte sich die Krawatte zurecht, faßte den Diplomatenkoffer fester und öffnete die Tür am anderen Ende des Büros. Er durchquerte einen Vorraum, einen von Spiegeln und großen Fenstern flankierten Saal mit Blick auf die Rue St. Honoré. Der Ausblick von hier gehörte zu den schönsten und teuersten der Welt – so prahlte Bertrand jedenfalls gern gegenüber seiner Frau.
Die Tür zu Lazares Büro war mit schwarzem, geräuschedämpfendem Leder gepolstert; die Polsterung war fast zehn Zentimeter dick. Bertrand blieb stehen, räusperte sich, trat dann ein. Er wußte, daß man ihn bereits angekündigt hatte, und gestattete sich – wie jedesmal – ein paar Sekunden in der Tür, damit sich seine Augen an das Zwielicht gewöhnen konnten, in dem Lazare am liebsten arbeitete.
Er schritt über den blanken Parkettboden zu seinem Schreibtisch und einem Sessel, den einzigen Möbeln im Büro. Dort blieb er stehen, sah Lazare an, neigte ehrerbietig den Kopf und machte sich auf die Rüge gefaßt, die eine solche Verspätung erwartungsgemäß nach sich zog.
Im Raum blieb es still. Es kam keine Rüge. Lazare hob langsam den Kopf. Sein Blick richtete sich auf den Diplomatenkoffer, nicht auf seinen Assistenten. Dann schob er mit einer langgliedrigen Hand die Dokumente auf dem Schreibtisch beiseite.
»Keine Probleme?« fragte er.
»Nein, Monsieur, keine. Auf der Autobahn war starker Verkehr. Bitte verzeihen Sie die Verspätung.«
»Sie haben das neue Produkt?«
»Ja, Monsieur. Wie besprochen.«
»Uns bleibt noch genug Zeit?«
»Ja, Monsieur. Sie raten zu einer Beobachtungsphase von vier Tagen, um eine gewisse Toleranz herzustellen. Eine Tablette pro Tag, gleich morgens zum Frühstück ...« Bertrand zögerte.
»Fahren Sie fort«, sagte Lazare.
»Es ist ratsam, etwas dazu zu essen, Monsieur. Und es muß sichergestellt sein, daß vor und nach der Tabletteneinnahme Wasser getrunken wird. Darauf haben sie großen Wert gelegt.«
»Nebenwirkungen?«
Bertrand zögerte wieder. Lazare bewegte sich, beugte sich vor, so daß die Lichtinsel unter seiner Schreibtischlampe sein Gesicht erhellte.
»Haben Sie mich verstanden? Nebenwirkungen? Ja oder nein?«
»Nun, Monsieur, natürlich konnte das Produkt bislang nur in begrenztem Rahmen getestet werden, aber sie behaupten, es gebe keine negativen Reaktionen. In seltenen Fällen ein beschleunigter Puls, aber das würde sich nach ein paar Stunden legen. Vereinzelt kam es zu Schlaflosigkeit, aber nur, wenn die Dosis zu hoch war oder die Tablette zu spät am Tag eingenommen wurde ...«
Lazare schritt ihm mit einer knappen Geste das Wort ab. Er bedeutete Bertrand, den Diplomatenkoffer auf den Schreibtisch zu legen. Eine Weile betrachtete er ihn schweigend. Lazare war berühmt für dieses Schweigen und setzte es ein, um andere Menschen einzuschüchtern, hatte der Assistent einst geglaubt. Inzwischen hatte er mehr Erfahrung im Umgang mit seinem Chef und sah das weniger dramatisch. Lazares Schweigen, so glaubte er jetzt, war die Folge seiner außergewöhnlichen – und beunruhigenden – Konzentrationsfähigkeit. Bertrand war klar, daß er für Lazare im Moment nicht mehr existierte.
Er blieb schweigend stehen und beobachtete Lazare, dessen Hände jetzt auf dem Koffer ruhten. Seit 1991 arbeitete er für diesen Mann, doch er verstand ihn genausowenig wie am ersten Tag. Im Laufe von vier Jahren hatte Lazare ihm keinerlei Vertraulichkeit oder tiefere Einblicke gewährt und nicht ein einziges Mal über sein Privatleben gesprochen. Bertrand wußte lediglich, daß Lazare um die fünfzig war, wahrscheinlich kein gebürtiger Franzose, bis spätabends arbeitete, wenig schlief und dem Hörensagen nach alleine lebte – allerdings unterhielt Lazare mehrere Wohnsitze in und um Paris, so daß vielleicht nicht einmal dieses Gerücht der Wahrheit entsprach.
Wie scharfsinnig und energisch Lazare in Geschäftsdingen sein konnte, wußte Bertrand aus erster Hand; an seiner Hingabe an das Modeimperium Cazarès konnte es keinen Zweifel geben. Bertrand war nicht sicher, ob das Gerücht stimmte, demzufolge Lazare gegenüber Maria Cazarès die gleiche Ergebenheit und Hingabe empfand.
Das Schweigen zog sich hin. Bertrand, der Lazare nicht mochte, aber achtete, blickte mit einer Mischung aus Bewunderung und Angst, gepaart von Mitleid, auf den einschüchternden und asketischen Mann hinab, der ihn eingestellt hatte. Es widersprach Lazares stolzem Wesen, Schwäche zu zeigen, und doch lag der Beweis für diese Schwäche – eine Schwäche, die Bertrand nie vermutet hätte – in diesem Augenblick zwischen ihnen auf Lazares Schreibtisch.
Wenn Lazare dies nötig hatte, um die Tage vor der Kollektionspremiere durchzustehen, dann mußte er in letzter Zeit unter größerer Anspannung gestanden haben, als Bertrand angenommen hatte. Als er Lazare jetzt genauer betrachtete, wurde ihm klar, daß er Spuren dieser Anspannung erkennen konnte und daß er sie schon früher hätte bemerken müssen. Lazare sah müde und abgespannt aus; als er den Blick hob, erschrak Bertrand über den Ausdruck in seinen Augen.
»Öffnen Sie den Koffer«, sagte Lazare.
Bertrand tat es. Darin lag eine Handvoll winziger Päckchen, die Bertrand in der vergangenen Nacht in seinem Amsterdamer Hotelzimmer Stück für Stück mit akribischer Sorgfalt und getreu Lazares präzisen Anweisungen eingeschlagen hatte. Jedes Päckchen bestand aus einer weißen Schachtel von etwa fünf Zentimetern Seitenlänge, und in jeder lag, in ein Stück schweres Gold-Faille gewickelt, eine Tablette. Verpackt war jede Schachtel in schwere weiße Rohseide, einen für Cazarès typischen Stoff; jedes Päckchen war mit der silbernen Cazarès-Seidenkordel verschnürt. Die Päckchen schimmerten im Licht der Schreibtischlampe. Sie sahen klein und verführerisch aus, als enthielten sie etwas Seltenes und Kostbares, einen Edelstein, ein kunstvoll verarbeitetes Juwel oder eine winzige Phiole mit einem seltenen Duft. Es war Lazares Idee gewesen, sie als Geschenk zu verpacken.
Insgesamt waren es sechs Schachteln. Lazare schob sie zurecht, so daß vier davon neben seiner linken Hand und zwei zu seiner Rechten lagen. Er sah wieder auf; der Schein der Lampe verstärkte die scharf gemeißelten Gesichtszüge und die undurchdringliche Düsternis seines Blickes.
»Vier Tage zur Beobachtung. Damit wären wir am Tag vor der Präsentation. Und dann?«
Der Assistent schluckte.
»Am Tag der Präsentation selbst, Monsieur, können zwei Tabletten verabreicht werden.«
»Ich verdopple die Dosierung?«
»Ja, Monsieur. Bis dahin hat der Körper sich an den Stoff gewöhnt.«
»Und das Ergebnis?«
»Ein intensives Wohlbehagen und Optimismus, Monsieur. Hochstimmung. Zuversicht.«
»Gut zu wissen, daß sich das alles kaufen läßt.«
»Und dazu eine bemerkenswerte körperliche Belebung, Monsieur. Die Wirkung ist nur vorübergehender Art, aber die neu geweckten Kräfte sind deutlich zu erkennen. Die Haut wirkt strahlender, und ...«
»Die Augen?«
»Eine leichte Kontraktion der Pupillen, Monsieur. Nicht weiter auffallend, und nur aus nächster Nähe festzustellen.«
»Sprache? Bewegungen?«
»Bleiben unbeeinträchtigt, Monsieur.«
»Sie haben das Produkt selbst getestet?«
»Ja, Monsieur, wie angewiesen.«
Bertrand blickte Lazare fest in die Augen, wie er es für klug erachtete, wann immer er diesen Mann anlog.
»Ich habe gestern früh eine Tablette genommen ...«
»Eine ganze Tablette?«
»Ja, M. Lazare«, bestätigte der Assistent, der in Wahrheit nur eine halbe geschluckt hatte. »Ich habe sie um zehn Uhr vormittags genommen, nach einem Frühstück in meinem Hotelzimmer. Die Wirkung setzte fast augenblicklich ein und war ganz erstaunlich ...«
»Die Details interessieren mich nicht. Das gewünschte Resultat wurde erreicht?«
»Ja, Monsieur. Ganz entschieden. Nervosität und Ängste schwanden augenblicklich. Ein Gefühl der Ruhe und der Zuversicht trat ein. Ein intensives Raumgefühl. Farben und Geräusche wirkten außergewöhnlich intensiv, und –«
»Konnten Sie sich auch ausruhen?«
Lazare stellte die Frage unerwartet eindringlich. Bertrand verstummte auf der Stelle.
»Mich ausruhen? Ja, schon, später. Ich schlief gegen Mitternacht ein, und –«
»Haben Sie gut geschlafen? Keine Träume?«
»Nur angenehme, Monsieur.« Bertrand riskierte ein Lächeln.
»Träume, wie ich sie gern jede Nacht haben wollte ...«
»Ich verstehe nicht.«
»Alle fünf Sinne sind angeregt, M. Lazare. Das wirkt erotisierend. Ich habe, sagen wir mal, eine markante und sofortige Steigerung der Libido verspürt. Wenn ich nicht allein gewesen wäre, hätte ich –«
»Sie können gehen.«
Der Einwurf kam knapp und kühl. Bertrand, der geglaubt hatte, daß selbst Lazare sich über seine letzte Bemerkung amüsieren würde, merkte, daß er sich arg im Ton vergriffen hatte. Lazares Gesicht war jetzt eine abweisende Maske; dann senkte er den Kopf und widmete sich wieder den Schachteln. Der Assistent sah seine glatten schwarzen Haare im Lampenschein glänzen. Leise zog er sich vom Schreibtisch zurück. Lazare duldete keinerlei Vertraulichkeiten: Mit etwas Glück, dachte er, schaffe ich es vielleicht bis zur Tür, ehe Lazare explodiert. Er hatte schon vorhin Glück gehabt, als seine Verspätung ungetadelt geblieben war. Es war kaum damit zu rechnen, daß er zweimal davonkam. Während er sich der Tür näherte, machte er sich auf einen Rüffel, auf eisigen Sarkasmus gefaßt. Was Lazares Wutausbrüche so furchterregend machte, war ihre Kälte: Er konnte einen Mann mit Worten vernichten, ohne auch nur die Stimme zu erheben.
»Warten Sie«, sagte Lazare.
Bertrand erbleichte und drehte sich um.
»Sagen Sie ...« Lazare war immer noch mit den Päckchen beschäftigt. Er hielt eines in der Hand und drehte es hin und her. »Diese kleinen Wunderpillen – hat man sie schon getauft? Haben sie schon einen Namen?«
Mit vor Erleichterung weichen Knien bestätigte Bertrand, daß die kleinen Wunderdinger schon getauft worden seien, jawohl. Ihr Schöpfer, der junge holländische Chemiker, hatte sich für einen harten, aggressiven Namen stark gemacht, eine Bezeichnung, die seinem neuen Produkt auf der Straße Ansehen verschaffen würde. Sein langhaariger, durchgeknallter amerikanischer Partner hatte ihm abgeraten. Sie bräuchten, hatte er eingewendet, einen Namen, in dem der erste starke Rausch ebenso anklinge wie das darauf folgende Gefühl wohligweicher Ruhe.
»Wenn das Zeug erst mal auf dem Markt ist«, hatte er erklärt, »werden die Kids es sowieso umtaufen, das ist immer so. Bis dahin – es verleiht dir Flügel, Mann, und dann baut es dir ein kuschliges Nest, dann ...«
»Wie heißen sie?« hakte Lazare nach.
Bertrand hatte sich wieder gefangen und kam zum Punkt. Er verriet Lazare, daß die kleinen, ungefärbten und süßen Wunderpillen unter der Bezeichnung »White Dove« verkauft werden sollten.
Gedankenverloren murmelte Lazare die Bezeichnung vor sich hin, als sprächen die Worte »weiße Taube« etwas in ihm an. Er sah noch einmal zu Bertrand auf; die letzte Frage kam scharf: »Und sie sind sicher?«
Bertrand, der es kaum erwarten konnte, aus dem Büro zu kommen, begriff, daß dies nicht der Augenblick war, ins Detail zu gehen. Er beschloß, weder die verworrenen Anmerkungen des holländischen Chemikers noch die zusammenhanglosen Warnungen des Amerikaners zu erwähnen. Er hatte ganz bestimmt nicht die Absicht, Lazare zu gestehen, wie schon eine halbe Tablette in der vergangenen Nacht auf ihn gewirkt hatte. Bertrand, ein verheirateter und in den meisten Dingen sehr konservativer Mensch, war es nicht gewöhnt, derart die Kontrolle zu verlieren. Lazare wird eine Überraschung erleben, dachte er mit einem Anflug von Boshaftigkeit.
»Sie sind stark, Monsieur«, antwortete er. »Aber absolut sicher. Jawohl.«
Erster Teil
England
Kapitel 1
Die Besprechung mit Rowland McGuire war auf zehn Uhr angesetzt – in seinem Büro in der Feuilletonredaktion, nicht in Lindsays in der Moderedaktion. Lindsay hatte sich mit dem Treffpunkt einverstanden erklärt und dann erkannt, daß McGuire dadurch einen Heimvorteil hatte. Zornig hatte sie augenblicklich zu planen begonnen. Sie konnte McGuire nicht leiden; sie stand kurz davor, McGuire zu hassen, der ihr in den zwei kurzen Monaten, die er jetzt bei der Zeitung war, mehr als einmal Knüppel zwischen die Beine geworfen hatte. Es war höchste Zeit, sich mit McGuire zu befassen; Lindsay hatte beschlossen, daß sie sich bei dieser Besprechung nicht mehr auf taktisches Geplänkel beschränken würde: Sie würde – wie auch immer – zum vernichtenden Schlag ausholen.
Sie traf an diesem Morgen wie immer um acht Uhr an ihrem Schreibtisch ein. Am vergangenen Abend war sie um zwölf zu Bett gegangen, um sechs Uhr war sie wieder aufgestanden. Bevor sie aus dem Haus gegangen war, hatte sie sich mit den üblichen häuslichen Komplikationen – leckende Leitung, keine Milch, kotzende Katze – herumgeschlagen und daher das unbestimmte Gefühl, schon wieder erschöpft zu sein. Während sie sich auf die eingegangene Post stürzte, versuchte sie sich einzureden, daß sie wild entschlossen war, voller Energie und bereit für den Waffengang gegen McGuire.
Gegen neun Uhr hatte sie die Modeseite für die laufende Woche gestaltet, drei neue Fototermine arrangiert, ihrem Lieblingsfotografen, Steve Markov, als unbezahlter Therapeut gedient – die meisten ihrer Fotografen waren Neurotiker, doch Markov, dessen letzter Geliebter sich soeben mit Reiseziel Barbados abgesetzt hatte, war in dieser Beziehung unübertroffen –, und die letzten Arrangements für die Berichterstattung des Correspondent von den Pariser Kollektionspremieren getroffen, die in der kommenden Woche stattfinden sollten.
Um neun Uhr dreißig zog sie sich in ihr Büro zurück und schloß die Tür vor den schrillenden Telefonen, den herumirrenden Sekretärinnen, dem Geschrei. Sie trank ihren dritten schwarzen Kaffee an diesem Morgen und begann, Listen zu erstellen – immer ein schlechtes Zeichen.
Die Listen wurden länger. Auf der einen, mit ARBEIT überschrieben, sammelten sich Telefonnummern von Models und Assistenten und Ausstattern und Agenten, die, wenn man sie nur richtig hofierte und erpreßte und lobte und umgarnte, unter Umständen dazu beitragen konnten, daß sie erfolgreich über die Kollektionspremieren berichtete, und zwar ohne daß Markov ihr alle zehn Minuten drohte, sich die Kehle aufzuschlitzen. Die andere Liste, die mit der Überschrift DRINGEND, war ausgesprochen deprimierend. Auf ihr standen Dinge wie Hühnchen? und Klopapier!! und Tanken / Gini anrufen / Klempner besorgen / Vollkorn-Brot / Tom: Muß Videos zurückbringen.
Es war Freitag; sie wollte über das Wochenende wegfahren. Weder ihre Mutter noch ihr Sohn gehörten zu den Menschen, denen es in den Sinn kam, Essen einzukaufen oder einen Klempner anzurufen, wenn die Leitung tropfte. Wie sollte sie sich einen perfekten Schlachtplan gegen McGuire zurechtlegen, wenn sie ständig von derartigen Bagatellen abgelenkt wurde?
Lindsay drückte den Rücken durch, starrte eisig auf den bleiernden Januarhimmel vor ihrem Fenster und probte ein paar Minuten lang froideur. Den McGuires dieser Welt begegnete man am besten mit arktischer, machtvoller Herablassung, entschied sie. Sie versuchte, sich das Auftreten und die Techniken jener grandes dames ins Gedächtnis zu rufen, die noch in der Modewelt regiert hatten, als sie vor etwa fünfzehn Jahren zu arbeiten angefangen hatte.
Als Gattung waren diese Vreelands inzwischen so gut wie ausgestorben: In manchen ihrer Nachkommen ließen sich vielleicht noch Spuren ihrer eisigen Eleganz, ihrer mühelosen Tyrannei entdecken, aber Lindsay gingen derartige Qualitäten völlig ab. Soweit sie sich erinnern konnte, waren diese Frauen natürlich auch von allem abgeschottet gewesen, was auch nur entfernt an das wahre Leben erinnerte. Höchstwahrscheinlich hatten Scharen von Fahrern, Dienstmädchen, Haushälterinnen und Köchinnen sie abgeschirmt; Ehemänner hatten entweder nicht existiert oder waren unsichtbar gewesen; keine von ihnen hatte Kinder gehabt, soweit sich Lindsay entsann, und wenn doch, dann hatten diese beispielhaften, wohlgeratenen, unproblematischen Kinder längst das elterliche Nest verlassen.
Ich bin die Moderedakteurin einer angesehenen, seriösen Zeitung, sagte sich Lindsay. Ich halte mich in einem Job, um den mich viele beneiden und der weiterhin, wenn auch irrtümlich, mit Glamour assoziiert wird – was immer das bedeuten soll. Ich bin eine unabhängige Frau und stehe auf eigenen Füßen. Ich kann eine grande dame sein, wann immer mir danach ist. Am Montag fahre ich nach Paris zu den Kollektionspremieren. Nimm dich in acht, Rowland McGuire, denn ich weiß, wie man in der Arbeitswelt überlebt, und ich werde dich in den Boden stampfen.
Lindsay warf einen Blick auf die Füße, die das bewerkstelligen sollten und an denen sie sonst wunderbar weiche, geräumige schwarzleinene Basketballschuhe trug. Heute steckten sie in schwarzen, schlanken Pumps von Manolo Blahnik mit Acht-Zentimeter-Absätzen. Diese atemberaubend eleganten und atemberaubend teuren Schuhe kniffen an den Zehen. Ihr Sohn Tom bezeichnete sie als »Bürotussi-Schuhe«, aber so war Tom eben.
Lindsay trat ans Fenster, probte noch einmal diesen Blick, der McGuire das Blut in den Adern gefrieren lassen sollte, dann knüllte sie die Listen zusammen, schleuderte sie in hohem Bogen in Richtung Papierkorb – und traf daneben. Sie war einfach nicht zur grande dame geschaffen und war es nie gewesen. Erstens hatte sie nicht die Figur dazu, klein und knabenhaft, wie sie war; zweitens ließen sich ihre Lebensumstände nicht ignorieren: Sie war eine achtunddreißigjährige alleinerziehende Mutter, die in einer chaotischen Wohnung in West London lebte, zusammen mit einer einfach unmöglichen Mutter und einem siebzehnjährigen Sohn, der in Kürze, wie sie hoffte, die Hormonstürme der Pubertät überstanden haben würde. Mutter wie Sohn verließen sich stillschweigend darauf, daß sie sämtliche Rechnungen beglich und für alle Lebenskrisen eine Lösung wußte.
Tom war teuflisch schlau, aber äußerst schweigsam. Während der vergangenen drei Jahre hatten seine Gesprächsbeiträge gewöhnlich in einem Grunzen bestanden. Seit dem Herbst hatte er allerdings Schlag auf Schlag erst eine Freundin gefunden, dann die Grippe bekommen und schließlich Dostojewski entdeckt. Diese Verquickung von Liebe, Literatur und vierzig Grad Fieber hatte ihm die Stimme wiedergegeben. Nun wurde Lindsay, während sie schnell mal staubsaugen oder zu kochen versuchte, mit ethischen Monologen traktiert. Louise, ihre Mutter, die auf einer Wolke von Zweckoptimismus durchs Leben schwebte, hielt das für einen Durchbruch; Lindsay war sich dessen nicht so sicher.
»Tom kommt endlich aus seinem Elfenbeinturm heraus, Liebling«, hatte Louise ihr erst am vergangenen Abend erklärt. »Jetzt kannst du eure Beziehung endgültig festigen. Mit vielen wunderbar klugen Mutter-Sohn-Gesprächen.«
»Er kann mit seiner Freundin reden«, preßte Lindsay zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, während sie hektisch in der Fertigsoße für die Spaghetti rührte. »Dazu ist sie schließlich da. Jungs in Toms Alter wollen nicht mit ihren Müttern reden. Auf sie einreden, vielleicht. Ich bin so gut wie überflüssig. Sehen wir den Tatsachen ins Auge.«
»Unsinn, Liebling.« Louise wischte die Bemerkung hoheitsvoll beiseite, schenkte sich ein Glas Wein ein und zündete sich die nächste Zigarette an. »Mit dem Mädchen will er nicht reden. Sie ist für den Sex da.«
Lindsay schloß die Augen. Das stets hyperaktive schlechte Gewissen in ihrem Hinterkopf begann sie augenblicklich mit Gedanken an Verhütungsmittel, AIDS-Statistiken und ähnliches zu traktieren. Dann wechselte es abrupt das Thema – das beherrschte es meisterhaft – und rief ihr unvermittelt ins Gedächtnis, daß Toms Füße wie die Pilze wuchsen und daß er bis Montag ein Paar neue Fußballschuhe brauchte, aber nicht hatte. Ach du Schreck, sagte Lindsay laut und mit Nachdruck. Sie kritzelte TOM / SCHUHE / LOUISE ANRUFEN auf einen Post-It und klebte ihn ans Telefon. Sie warf einen Blick auf die Uhr, fluchte, stand auf, trug grellroten Lippenstift auf und besprühte sich mit einem superstarken und auffälligen amerikanischen Duftwasser. Dann marschierte sie ins Vorzimmer. Dort wartete ihre Assistentin Pixie voller Vorfreude bis genau fünf Minuten nach zehn, um dann in McGuires Büro anzurufen. Ebenso zuckersüß und unverschämt erklärte sie, daß sich Miss Drummond in einer Konferenz befinde und sich ein wenig verspäten werde: Lindsay stand währenddessen neben ihr und schnitt Grimassen.
Pixie war neunzehn und ehrgeizig. Talentiert ebenfalls; sie hatte sich das Ziel gesetzt, noch vor ihrem dreißigsten Geburtstag Chefredakteurin der englischen Vogue zu werden und drei Jahre danach New York im Sturm zu erobern. Was originelle Kleidung betraf, konnte man sich auf Pixie, einen nouveau punk, allezeit verlassen. An diesem Morgen steckte ein Diamant in ihrer Nase; dazu trug sie eine hautenge, seitlich geschnürte Hose, eine afrikanische Kette und ein hautenges, transparentes Top von Gaultier. Sie hatte einen unüberhörbaren Liverpool-Akzent und war ausgesprochen clever. Lindsay gab immer vor, sie vor allem deshalb eingestellt zu haben; in Wahrheit hatte sie sich für Pixie entschieden, weil sie das Mädchen mochte und weil ihre vergnügte, selbstbewußte Art Lindsay daran erinnerte, wie sie früher selbst gewesen war. Pixie, in deren Gegenwart sich Lindsay oft alt fühlte, legte kichernd auf.
»Der arme McGuire«, sagte sie. »Er klang schwer getroffen.«
»Gut.«
»Warum mögen Sie ihn eigentlich nicht?« Pixie sah sie fragend an.
»Ich finde ihn total süß.«
»Er ist ein Mann. Er ist arrogant und muß überall seine Nase reinstecken. Warten Sie ab, Sie werden das schon noch begreifen, Pixie.«
»Bei mir könnte er seine Nase jederzeit reinstecken. Nichts lieber als das.«
»Pixie! Passen Sie auf. Sehe ich furchterregend aus? Wie ist das Kostüm?«
»Das Kostüm ist einfach spitze. Wirklich geil. Darf ich raten?«
»Also gut. Ich geben Ihnen einen Tip. Es hat mich fünf Monatsgehälter gekostet. Ich mußte eine Hypothek aufnehmen. Einen Kredit von der Weltbank.«
»Es ist ganz offensichtlich von Cazarès.« Pixie zog die Stirn in Falten. »Einen Moment ... Letztes Jahr? Frühling? Herbst? Ja – Herbst '94. Keine Kaufhausware ... Es sagt ›Couture‹ zu mir ...«
»Hoffen wir, daß es das auch zu McGuire sagt.«
»– aber es ist bestimmt kein Modellkleid. Es sei denn, Sie hätten in letzter Zeit einen Millionär kennengelernt ...«
»Ich wünschte, es wäre so.«
»Also ist es prêt-à-porter, aber erste Klasse. Ich seh' mir mal die Knöpfe an – ich liebe diese Knöpfe –, das Design der Jacke, den Schrägschnitt, den Stoff – Kaschmir?«
»Und Seide. Was noch?«
»Der Kragen?« Pixie begann zu lächeln. »Wie sich der Kragen um den Hals schmiegt?«
»Gut. Es wird wärmer.«
»Ich hab's. Herbst '94. Aus der Designer-Kollektion. Kate Moss hat es gemodelt, in Beige, nicht in Schwarz. Es kam als Nummer zweiundvierzig, oder war es dreiundvierzig?«
»Dreiundvierzig. Sehr gut, Pixie. Und – bin ich spät genug dran? Was meinen Sie?«
Pixie grinste und sah auf ihre Uhr. »Zwanzig Minuten. Vielleicht sollten Sie noch mal fünf dranhängen? Ich meine, wenn schon unhöflich, dann richtig unhöflich, stimmt's?«
»Ganz genau.« Lindsay erwiderte ihr Grinsen.
Sie hängte noch zehn dran.
»Möchten Sie einen Kaffee?« Rowland McGuire nahm seine Füße vom Schreibtisch und erhob sich zu seiner vollen Größe von einem Meter fünfundneunzig. Lindsay bedachte ihn mit einem wohlkalkulierten eisigen Blick, dessen Wirkung durch die Tatsache, daß sie zu ihm aufsehen mußte, geringfügig getrübt wurde.
»Wenn es Ihnen noch paßt«, sagte sie. »Ich bin spät dran, wie Sie wissen.«
McGuire ließ diese Bemerkung auf sich beruhen, ohne auch nur verstohlen auf seine Uhr zu blicken. »Setzen Sie sich«, forderte er sie über die Schulter hinweg auf. »Verzeihen Sie die Unordnung. Schieben Sie die Bücher einfach beiseite. Rezensionsexemplare. Lauter Mist.«
Lindsay funkelte wütend seinen breiten Rücken an. Sie stellte fest, daß McGuire im Gegensatz zu jedem anderen Mann in diesem Gebäude in der Lage schien, sich seinen Kaffee selbst zu machen. Noch einer seiner Tricks, urteilte sie – und dazu gedacht, Eindruck zu schinden. Wäre sie nicht hier gewesen, hätte er sicher eine Sekretärin gerufen, einer der vielen und durch die Bank neuen Sekretärinnen, die draußen vor McGuires Büro hockten und bebend seiner Befehle harrten.
Wortlos schlängelte sie sich zu seinem Schreibtisch durch. Papier- und Bücherstapel versperrten ihr den Weg. Innerhalb von zwei Monaten hatte McGuire diese Abteilung und ihre Arbeitsweise umgekrempelt. Vor McGuire war die Feuilletonredaktion ein freundlicher Ort voller talentierter junger Männer gewesen, die allzu anstrengende Aktivitäten scheuten und, wenn sie nicht gerade auf einem Geschäftsessen waren, einen Großteil des Tages damit verbrachten, sich zu der Tatsache zu beglückwünschen, daß sie sich um die Anforderungen der Nachrichtenredaktion gedrückt hatten, wo die Leute tatsächlich arbeiten mußten. Seit McGuire die Bühne betreten hatte, waren diese Müßiggänger abgewandert. Sie waren, wie Lindsay auf dem Weg zu McGuires Heiligtum mißmutig bemerkt hatte, von einer großen Zahl ungewöhnlich attraktiver junger Frauen ersetzt worden, die Gerüchten zufolge allesamt ehrgeizig, furchterregend klug – und in Rowland McGuire verliebt waren. Lindsay war zwischen ihren kritischen Blicken Spießruten gelaufen; sie war heilfroh gewesen, ein Cazarès-Kostüm zu tragen.
McGuires Büro war ebenfalls nicht wiederzuerkennen. Einst ein kompromißloses modernistisches Gesamtkunstwerk und ganz in Chrom und schwarzem Holz gehalten, ähnelte es jetzt der Studierstube eines Gelehrten um circa. 1906. Gut, es gab McGuires topmodernen IBM-Computer, aber der war praktisch nicht zu sehen: überall im Zimmer stapelten sich Papiere, Zeitschriften, Bücher. Als sich Lindsay vor dem Schreibtisch niederließ, überflog sie die Titel dieser Bücher und stellte zu ihrem Verdruß fest, daß der Stapel vor ihrer Nase aus lauter Regierungsakten bestand, auf denen ein eselsohriger und eindeutig intensiv gelesener Proust-Roman thronte – im französischen Original.
Sie beugte sich vor und warf einen Blick auf die Papiere, die McGuire gelesen hatte, als sie hereingekommen war; sie konnte eine große grüne Aktenmappe erkennen, ein paar Faxe und die heutige Ausgabe der Times mit aufgeschlagenem Kreuzworträtsel. Sie wußte bereits, daß man McGuire nachsagte, er würde diese Kreuzworträtsel innerhalb von fünfzehn Minuten lösen; jetzt sah sie, daß dieser unerträgliche Mensch sie noch dazu in Tinte ausfüllte.
»Sie sind wahrscheinlich der einzige Mensch in London«, bemerkte sie bissig, »der das Times-Rätsel mit dem Füller löst. Was ist, wenn Sie sich irren?«
»Ich irre mich nicht. Für gewöhnlich.« McGuire reichte ihr eine Tasse Kaffee. »Ich fand Kreuzworträtsel immer ziemlich einfach. Selbst das der Times. Kreuzworträtsel liegen mir einfach. Es ist wohl eine Art Veranlagung.«
Lindsay sah ihn scharf an. Er klang bescheiden. Vor zwei Monaten, als McGuire eingestellt worden war, hätte sie sich von seinem Tonfall vielleicht täuschen lassen: jetzt nicht mehr. Nachdem sie anfänglich den Eindruck gehabt hatte, daß McGuire nicht nur erstaunlich gut aussah, sondern auch ein angenehmes Wesen hatte und zu gutmütig war, um lange in seinem Job zu überleben, hatte er damit begonnen, Leute an die Luft zu setzen. Und noch während er das tote Holz ausschlug, hatte er sich innerhalb eines Monats zweimal über Lindsays Entscheidungen hinweggesetzt.
Einmal war noch verzeihlich. Zweimal nicht mehr. Lindsay hatte keine Zeit mehr damit verplempert, mit McGuire zu streiten, dem sie von Anfang an hätte mißtrauen müssen, wie ihr inzwischen aufging. Sie überging ihn und wandte sich direkt an den Chefredakteur des Correspondent, einen alten Freund namens Max.
In seinem Büro machte sie, nach Feierabend und bei einem großen Whisky, eine weitere Entdeckung. McGuire, der sich augenscheinlich nicht im geringsten für Bürointrigen interessierte, war ihr zuvorgekommen. »Sag mal, Max«, hatte sie gesagt, »wer leitet hier eigentlich die Moderedaktion? Ich dachte immer, das wäre ich. Jedenfalls steht es so in meinem Vertrag. Doch plötzlich stelle ich fest, daß es ein aufgeblasener Adonis ist. Unternimm was, Max. Du bist meine letzte Hilfe. Schaff mir diesen Mann vom Hals und aus meinem Leben.«
»Starke Worte«, erwiderte Max und zündete sich eine Zigarette an.
»Max, er hat keinen blassen Schimmer von Mode. Warum zum Teufel mischt er sich ein? Seit wann unterstehe ich der Feuilletonredaktion? Will er sich ein Imperium schaffen oder was?«
»Ganz bestimmt nicht. Das widerspräche Rowlands Wesen. Obwohl ich zugeben muß – manchmal glaube ich, man hat ihn auf meinen Job angesetzt.«
Max, einst ein ungestümer junger Mann, dessen Aufstieg zum Olymp der Redakteure sich in schwindelerregendem Tempo vollzogen hatte, gab sich inzwischen gern als gütiger Patron. Er trug konservative Anzüge mit Weste, wie es sich für den Chefredakteur einer mächtigen und konservativen Tageszeitung ziemte. Jüngst hatte er sich eine Brille zugelegt, die er Lindsays Überzeugung nach überhaupt nicht brauchte. Max war sechsunddreißig, gab sich aber wie fünfundsechzig, zumindest im Büro. Jetzt unterdrückte er ein Lächeln, rückte die überflüssige Hornbrille zurecht und sah Lindsay mit großen Eulenaugen an.
»Max – verstehst du, was ich sage? Dieser Mensch hat Bilder von Steve Markov rausgeworfen, die mich drei Monate Arbeit gekostet haben. Diesem Kerl gefiel weder das Model, noch die Bilder, noch die Kleider. Der Kerl, der das verbrochen hat, Max, hat noch nie von Christian Lacroix gehört. Er hat das selbst zugegeben – und mich hat das nicht überrascht. Ich bezweifle, daß ihm der Name Saint-Laurent was sagt.«
»Das hat Rowland gesagt? Daß er noch nie von Lacroix gehört hat?«
»Ganz genau. Und er ist dabei nicht einmal rot geworden.«
Max seufzte. Er senkte den Blick auf die Tischplatte. »Du darfst nicht alles glauben, was Rowland sagt, Lindsay. Er flunkert gern. Ich nehme an, er wollte dich provozieren.«
Diese Bemerkung trug nicht dazu bei, Lindsays Laune zu heben.
»Er ist ein Clown«, fauchte sie. »Und verdammt gerissen dazu, glaube ich allmählich.«
»Eigentlich nicht. Nicht wirklich«, widersprach Max milde. »Er hat mit summa cum laude auf dem Balliol abgeschlossen. Gerissen, nun ja – er ist schon extrem von seiner Sache überzeugt. Damit könntest du recht haben.«
»Fein. Und sein Oxford-Diplom hat er in Mode gemacht, wie?«
»Komm schon, Lindsay. Sei nicht so langweilig. Es war der humanistische Fachbereich.«
»Wunderbar. Ich bin beeindruckt. Er kann Latein und Griechisch im Original lesen. Das ändert nichts daran, daß er weniger von Mode versteht als meine Katze. Wer leitet also die Moderedaktion, Max? Ich oder dieser machtbesessene Erbsenschleifer mit Oxford-Diplom?«
»Du liegst in drei Punkten falsch.« Max schenkte ihr einen wohlwollenden Blick. »Du solltest ihn nicht nur mit Oxford assoziieren. Er ist zur Hälfte Ire, ein Bauernsohn. Er ist kein Erbsenschleifer, sondern ausgesprochen unterhaltsam. Er ist ein sehr erfahrener und vielumworbener Journalist, den ich in diese Zeitung geholt habe, damit er in der Feuilletonredaktion aufräumt. Was er auch getan hat, in nicht einmal zwei Monaten. Und er ist nicht machtbesessen. Er möchte einfach, daß so gearbeitet wird, wie er es für richtig hält. Genau wie du, natürlich.«
»O mein Gott. Allmählich geht mir ein Licht auf. Wie alt ist er?«
»Um die fünfunddreißig.«
»Ungefähr dein Alter. Ihr seid also Altersgenossen. Habt ihr euch in Oxford kennengelernt, Max?«
»Ja«, bestätigte Max, immer noch gönnerhaft. »Wir hatten im zweiten Jahr dieselben Tutoren. Wir hatten uns gemeinsam ein Motorrad gekauft. Wir waren in dieselbe Frau verliebt, nur daß Rowland mich ausgestochen hat. Wir –«
»Gnade, Max.« Lindsay schüttete ihren Whisky in einem Schluck hinunter. Ihr entging nicht, wie sehr Max das hier genoß. Sie stand auf.
»Also gut. Ich werde dir nicht mit alten Seilschaften kommen, Max.«
»Das wäre auch viel zu simpel.«
»Ich werde kein Wort über Männerkumpanei verlieren – das wäre Zeitverschwendung. Ich habe verstanden. Der Erbsenschleifer hat recht, ich habe unrecht ...«
»Mir haben diese Markov-Bilder auch nicht gefallen. Und das Model genausowenig. Das arme Mädchen sah ja halb verhungert aus. Ich kann mit diesen Elendsgestalten nichts anfangen ...«
»Ihr habt euch über meine Entscheidung hinweggesetzt, und dabei bleibt's, nicht wahr? Dieser falsche Hund hat dich beackert. Ihr habt mich auflaufen lassen ...«
»Nur bei diesen zwei Gelegenheiten. Sagen wir, ich habe mich McGuires Argumenten nicht verschließen können. Er meint, wir könnten unsere Modeberichterstattung verbessern, wenn wir das Thema journalistischer aufbereiten würden. Glaub mir, Lindsay, er ist sehr klug. Und er ist verdammt gut. Er hat sich mit seiner Auffassung durchgesetzt. Nächstes Mal –«
»Wenn er sich das nächste Mal mit seiner Auffassung durchsetzt, kündige ich, Max. In diesem Monat werden die Kollektionen präsentiert. Ich lasse mir von McGuire nicht in die Arbeit pfuschen. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten.«
Diese Drohung brachte Max zum Strahlen.
»Unfug«, antwortete er. »Du wirst bestimmt nicht kündigen. Du liebst diesen Job. Du liebst diese Zeitung. Du liebst mich – ich bin dir ein guter Freund und ein außergewöhnlich guter Chefredakteur ...«
»Das warst du mal.«
»Und Rowland McGuire wirst du auch noch lieben lernen. Du kannst jeden fragen, Lindsay. Alle lieben ihn. Außer den Leuten, die er gefeuert hat, natürlich.«
Ich nicht, dachte Lindsay jetzt, während McGuire an seinen Schreibtisch zurückkehrte. Hätte sie ihn nicht so gehaßt und ihm weniger mißtraut, dann hätte sie vielleicht sogar eingeräumt, daß Pixie ihn treffend beschrieben hatte. Menschen mit McGuires Aussehen brachten den Straßenverkehr zum Erliegen – und Lindsay mußte zugeben, daß er zwar viele Fehler haben mochte, Eitelkeit jedoch nicht dazugehörte; McGuire schien nicht im mindesten zu ahnen, wie gut er aussah. Jedenfalls tat er nichts, um sein Aussehen hervorzuheben. Nicht einmal die alten, verknitterten Tweedanzüge, die er meistens trug, konnten seinen schlanken, muskulösen Körperbau verbergen. Sein wildes schwarzes Haar war etwas zu lang und schlecht geschnitten. Er hatte grüne Augen, und seine Miene wirkte heiter, gelassen und leicht ironisch: Seine Wutausbrüche waren angeblich fürchterlich, aber Lindsay hatte noch keinen miterlebt.
Hätte sie ihn nicht so gut gekannt, hätte sie sich vielleicht ausgemalt, wie er im keltischen Nebel über weite Felder schritt. Ein echter Landmensch, der irgendwelchen männlichen Tätigkeiten nachging, kranken Tieren half, schwere Lasten trug oder Holz hackte; sie konnte sich vorstellen, wie er furchtlos einen Berg erklomm; sie konnte ihn als Soldat oder Poet oder Tierarzt sehen: aber nicht als jemanden, der in einer modernen Zeitungsredaktion zurechtkam – was er jedoch ganz offensichtlich tat, weshalb sie sich in dieser Hinsicht eindeutig irrte.
Sie sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Diese offenkundige Freundlichkeit, diese immer wieder hervorbrechende Sanftheit: Sie täuschen, dachte sie, und zwar ganz bewußt. Damit wollte McGuire entwaffnen und betören; damit sorgte er dafür, daß er in der aggressiven Welt des Journalismus seine Konkurrenten ausschaltete und so als erster ans Ziel gelangte.
»Sie fahren heute aufs Land, habe ich gehört?« fragte McGuire soeben. »Sie verbringen das Wochenende bei Max?« Lindsay schreckte hoch. Sie war so in Gedanken über McGuires mögliche und bereits erwiesene Skrupellosigkeit versunken, daß sie ganz vergessen hatte, die grande dame zu spielen. Sie richtete sich auf und bedachte ihn mit einem Gletscherblick.
»Ja.«
»Richten Sie Mrs. Max liebe Grüße von mir aus. Und den ganzen Mini-Mäxen.« Er lächelte. »Vier Kinder – früher hielt ich das für übertrieben. Jetzt finde ich es nett. Das fünfte ist wohl schon unterwegs ...«
»Ja. Es soll in zwei Monaten kommen.«
»Vielleicht wird es diesmal ja ein Mädchen. Das würde Max gefallen.«
»Bestimmt«, bestätigte Lindsay. Sie hörte über den kaum wahrnehmbaren irischen Einschlag hinweg, der sich ab und zu in McGuires Stimme schlich. Er war genauso attraktiv wie das Lächeln; und sie war überzeugt, daß McGuire sich dessen bewußt war.
»Können wir jetzt anfangen?« Sie beugte sich vor. »Ich habe vor meiner Abreise noch eine Menge zu erledigen. Ich muß die letzten Arrangements für Paris treffen. Sie haben doch das Konzept gesehen, daß ich hochgeschickt habe?«
McGuire begann, Papier auf seinem Schreibtisch hin und her zu schieben. »Wenn ich mich recht erinnere, hat Max mir erzählt, daß Sie mit einer Freundin zu ihm fahren ...«
»Ja, Gini. Genevieve Hunter. Sie werden Sie kaum kennen ...«
»Nein. Das war vor meiner Zeit ...« Er wühlte zerstreut in seinen Unterlagen. »Aber ich kenne ihre Arbeit. Und natürlich ihre Berichte aus Bosnien vergangenes Jahr. Sie waren exzellent. Auf ihre Weise genausogut wie Pascal Larmartines Fotos ... Die beiden haben schon früher zusammengearbeitet, nicht wahr?«
»Ja.«
»Sie geben ein gutes Team ab. Das habe ich auch Max gesagt. Wo habe ich das verdammte Konzept bloß hingelegt? Eben war es noch da ... Warum ist sie nicht unten geblieben und hat weiter mit ihm gearbeitet?«
»Das kann ich wirklich nicht sagen.«
»Jemand hat mir gesagt ... Sie war wohl krank?«
»Eigentlich nicht. Nein. Jedenfalls geht es ihr inzwischen wieder gut.«
»Ach, das muß ich falsch verstanden haben. Max hat gesagt ...«
Er ließ den Satz unvollendet. Lindsay ignorierte den Wink. McGuire war gut informiert; wenn er von Ginis Krankheit wußte – und das taten nur wenige –, dann hatte Max getratscht. Ganz offensichtlich war Max und er weit enger befreundet, als sie geglaubt hatte – es mußte so sein, denn Max war ein diskreter Mensch.
Und dann, während sie gerade rätselte, was ihm Max wohl sonst noch alles erzählt hatte, landete McGuire seinen Coup. Er fand schließlich das Konzept und schob es ihr über den Schreibtisch zu.
»Wunderbar«, sagte er.
Lindsay starrte ihn an.
»Wunderbar? Sie meinen, es gefällt Ihnen?«
»Sie sind die Moderedakteurin.« Er zog die Achseln hoch. »Wenn Sie unbedingt diesen verdammten Markov nehmen müssen, dann nehmen Sie ihn. Berichten Sie über die Shows, die Sie sich ausgesucht haben. Natürlich wäre es nett, wenn Sie es übers Herz bringen könnten, dabei wenigstens hin und wieder Biß zu zeigen.«
»Sie haben keine Änderungswünsche? Das überrascht mich.«
»Nein. Die Modenschauen sind Ihre Sache. Es würde mir nicht im Traum einfallen, mich einzumischen. Schließlich kann ich keinen Lacroix von einem Saint-Laurent unterscheiden ...«
Max, du Mistkerl, dachte Lindsay, die den ironischen Glanz in seinen grünen Augen wohl bemerkte. Er hatte also von ihrem Gespräch erzählt.
»Ich bin froh, daß Sie Ihre Grenzen inzwischen kennen.« Lindsay rückte ihren Stuhl zurück, weil sie so schnell wie möglich verschwinden wollte.
»Da wäre noch was«, sagte McGuire.
Überrascht drehte sich Lindsay um. Sie sah, daß McGuire jetzt die grüne Akte in der Hand hielt, eine schwere, grüne und mit Klebeband verschlossene Mappe.
»Ihr Kostüm – das ist doch von Cazarès, nicht wahr?«
Die Bemerkung erheiterte ihn; Lindsay sah ihn streng an. »Ganz recht.«
»Sind Sie Maria Cazarès jemals begegnet? Haben Sie sie vielleicht interviewt?«
Lindsay sah ihn unschlüssig an. Sie vermochte nicht zu sagen, ob die Frage ganz unschuldig oder arglistig gestellt worden war.
»Nein«, antwortete sie. »Noch nie. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist sie noch nie interviewt worden. Die Cazarès erscheint nie in der Öffentlichkeit, lediglich am Ende ihrer Shows. Und sie gibt keine Interviews, niemals, wem auch immer. Sie führt praktisch ein Einsiedlerleben.«
»Eine schöne Einsiedlerin, nehme ich an ...«
»Das ist sie ganz bestimmt.«
»Aber Jean Lazare – er spricht doch mit der Presse?«
»Mit ein paar ausgewählten Journalisten. Freunden. Leuten, die keine unangenehmen Fragen nach Maria Cazarès stellen. Doch, das tut er. Ich würde das nicht als Interview bezeichnen, doch ab und zu gibt er eine Audienz, das ist richtig.«
»Könnten Sie eine Audienz mit ihm arrangieren?«
»Falls ich eine wollte. Wahrscheinlich. Ja.«
»Versuchen Sie's. Versuchen Sie, zu ihm vorzudringen, wenn Sie in Paris sind ...«
Lindsay sah McGuire verdutzt an.
»Wozu? Das ist witzlos. Selbst wenn er mich empfangen würde, würde ich nichts von Belang erfahren. Natürlich wüßte ich gerne, was an den Gerüchten dran ist – würde das nicht jeder? Ich wüßte gerne, ob Maria Cazarès tatsächlich vor fünf Jahren einen Nervenzusammenbruch hatte. Und ich würde zu gern wissen, wieviel von der Kollektion sie wirklich selbst entwirft. Jeder wüßte das gern ...«
»Dann fragen Sie ihn doch. Fragen Sie Lazare. Warum nicht?«
»Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen«, fuhr Lindsay ihn an.
»Erstens würde ich das nicht wagen – und wenn doch, dann bekäme ich dort keinen Fuß mehr auf den Boden. Ich wäre fortan aus allen Cazarès-Shows verbannt. Zweitens ist das, wie ich Ihnen schon erklärt habe, witzlos. Lazare spult in jedem Interview denselben Text ab: Maria Cazarès ist ein Genie. Seine Aufgabe ist es, sie vor der aufdringlichen Presse abzuschirmen. Basta.«
»Und ein Unternehmen von mehreren Millionen Dollar zu führen. Das sollten wir nicht vergessen ...«
»Natürlich. Das tut er mit absoluter Hingabe. Da würde er kein Blatt vor den Mund nehmen. Er würde mir von ihren Prêt-à-porter-Kollektionen erzählen, den Kosmetika, den Parfüms. Er würde mir Statistiken vorbeten und seinen Charme spielen lassen. Reine Zeitverschwendung. Ich kenne die Statistiken. Cazarès hat die beste PR-Abteilung von allen Pariser Modehäusern. Ich weiß Bescheid.« »Bestimmt? Sind Sie sicher?«
Lindsay wollte schon mit einer bissigen Bemerkung reagieren, besann sich aber anders. McGuires grüne Augen sahen sie scharf an, und seine Stimme klang plötzlich härter. Sie zögerte, weil sie eine unausgesprochene Rüge ahnte, und zuckte dann mit den Achseln.
»Also gut. Ich übertreibe. Ich weiß nicht alles – das tut niemand. Lazare und die Cazarès sind von Geheimnissen umgeben. Uralten Geheimnissen ...«
»Das würde ich auch so sehen.« McGuire blickte auf seine Mappe.
»Wobei ich natürlich als Laie spreche. Woher sie kommen, wie sie sich kennengelernt haben, woher Lazares Vermögen stammt, was für eine Beziehung sie heute eigentlich verbindet, warum Lazare das Unternehmen vergangenes Jahr abstoßen wollte –«
»Angeblich abstoßen wollte«, warf Lindsay ein.
»Warum Lazare es sich dieses Jahr wieder anders überlegt hat und jetzt eisern auf der Firma sitzt. Alles nur Nebensächlichkeiten, natürlich. Nichts, was die Modefuzzis ernsthaft interessieren müßte ...« McGuire warf ihr kurz einen grünäugigen Blick zu.
»Natürlich«, fuhr er fort, »arbeiten Moderedakteurinnen nicht wie andere Journalisten, nicht wahr? Allmählich beginne ich das zu begreifen. Sie stellen keine unangenehmen Fragen. Sie stellen keine Recherchen über ihre Branche an. Sie gehen zu den Modeschauen, schnattern mit ihren Freundinnen, schalten die winzigen Bereiche ihres Gehirns ab, die noch funktionsfähig sind, kommentieren die Saumhöhe eines Kleides mit Aah und Ooh und geraten in Verzückung. Über eine Bluse. Oder eine Jacke. Oder einen Hut –«
»Moment mal«, fiel ihm Lindsay ins Wort.
»Was sie zu sehen bekommen«, fuhr McGuire ungerührt fort, »hat mit dem Leben von neunundneunzig Prozent aller Frauen nicht das geringste zu tun. Es wirkt sich nicht einmal auf die Kleidung dieser Frauen aus. Es ist frivol, obszön teuer, eine Beleidigung des weiblichen Geschlechts –«
»Darf ich auch mal was sagen?«
»Natürlich schaffen sie durch ihre Berichte einer höchst profitablen Industrie zweimal im Jahr kostenlose Publicity. Doch das stört die Modejournalisten nicht. Sie machen Werbung für ein Produkt – ganz egal, ob dieses Produkt häßlich, dämlich oder, verdammt noch mal, untragbar ist. Damit bin ich lange nicht klargekommen. Warum lügen sie? Warum preisen sie Jahr für Jahr diesen Unfug in den höchsten Tönen? Jetzt begreife ich das natürlich. Sie dürfen keine Kritik üben. Sie wagen es nicht. Andernfalls könnten sie vielleicht ihrer wertvollen Einladungen verlustig gehen oder ihrer prestigeträchtigen Plätze in der ersten Reihe ... Sitzen Sie zufällig in der ersten Reihe, Lindsay?« Er richtete seinen kühlen grünen Blick auf sie. Lindsays Nägel bohrten sich in ihre Handflächen.
»Ja«, antwortete sie. »Genau. Ich habe zehn verdammte Jahre gebraucht, um dorthin zu gelangen. Und ich kann von dort aus wesentlich besser sehen – und berichten – als aus Reihe zehn. Hören Sie –«
»Das tun Sie bestimmt.« McGuire streckte sich. »In meiner Heimat sagt man, wer mit dem Teufel ißt, sollte einen langen Löffel nehmen. Aber das trifft in diesem Fall bestimmt nicht zu. Denn wenn Sie schreiben würden, was Sie tatsächlich denken – wenn Sie zum Beispiel bemerken würden, daß es den Cazarès-Kollektionen in letzter Zeit an Inspiration und Glanz fehlt, was würden Sie damit erreichen? Man würde Sie fortan verbannen.«
Er zitierte sie mit einem überaus charmanten Lächeln. Lindsay, die einst zu Wutausbrüchen geneigt, aber gelernt hatte, sich zu beherrschen, zählte bis zehn und inhalierte beruhigende, abgemessene Yoga-Atemzüge. Bigotter irischer Torfkopf, dachte sie. Heuchler. Pharisäer. Unerträglicher, eingebildeter, aufgeblasener, unhöflicher ... Sie zögerte. Sie war ehrlich genug, sich einzugestehen, daß viel Wahres an seinen Worten war, und wütend genug, das um keinen Preis zuzugeben.
»Vielleicht wäre es ganz nützlich, Rowland«, begann sie schließlich übertrieben höflich, »wenn ich Ihnen einiges über meinen Beruf erklären würde. Ich gehe auf Modeschauen, um über Kleider zu berichten. Um über Trends zu berichten. Ich beschäftige mich mit Schnitten, Farben, Stoffen, Linien. Darin bin ich Expertin. Dabei kommt mir zugute, daß ich mich für Kleider interessiere. Ich mag Kleider. Wie übrigens Hunderttausende anderer Frauen, die jede Woche meine Seiten lesen. Weibliche Leser, auf die diese Zeitung angewiesen ist. Die die Herzen in den Werbeagenturen höher schlagen lassen, Rowland, jener Agenturen, die in dieser Zeitung Anzeigenraum kaufen und auf diese Weise dazu beitragen, Ihr Gehalt ebenso wie meines zu bezahlen ...«
»Ich kenne die wirtschaftlichen Zusammenhänge der Zeitungsbranche, vielen Dank ...« fiel ihr McGuire abfällig ins Wort. Lindsay kämpfte gegen den wachsenden Drang an, sich über seinen Schreibtisch zu beugen und ihm eine Ohrfeige zu verpassen.
»Ach, hören Sie doch auf ...«, sagte sie. »Bevor Sie anderen predigen, sollten Sie sich lieber ihre eigene Produktion ansehen, Rowland. Letzten Samstag zum Beispiel. Da hatten Sie einen langen Artikel über Tschetschenien drin und was über die Clintons ...«
»Und?«
»Und außerdem in der Autospalte einen Bericht über den neuen Aston Martin, auf der Reiseseite einen Bericht über einen exklusiven Strand in Thailand und von ihrem Feinschmeckerpapst einen Vergleichstest zwischen fünfzehn verschiedenen nativen Olivenölen, bei dem schon der erste Satz so verdammt schwülstig und prätentiös klang, daß mir fast das Kotzen kam. Sie haben diesem schrecklichen Mädchen, das für Sie Restaurantkritiken schreibt – einem schrecklichen Mädchen, das Sie in diese Zeitung geholt haben –, erlaubt, eine ganze Spalte für so ein verdammtes Schickilokal in der Nähe von Oxford zu verschwenden, in dem sie mit ihrem neuesten Liebhaber an die zweihundert Pfund aus dem Budget Ihrer Redaktion verpulvert hat. Ist das etwa nicht frivol? Ist das etwa nicht obszön? Hören Sie doch auf, Rowland. Kommen Sie mir nicht mit dieser Scheiße.«
Es wurde still. Grandes dames, dachte Lindsay, hätten diese letzten Worte nicht in den Mund genommen, mehr noch, sie hätten sich überhaupt nicht so hinreißen lassen. Na und, dachte sie. Ihr ging es schon wesentlich besser. Bloß keine Reue zeigen. McGuire, fiel ihr auf, war rot angelaufen. Aber falls ihn ihre Kritik getroffen hatte, dann erholte er sich schnell; im Gegenteil, Lindsay begann zu vermuten, daß er zu den Menschen gehörte, die einen richtigen Streit genossen. Er schenkte ihr einen kurzen, glänzenden Blick und brach dann – zu ihrem Verdruß – in Gelächter aus.
»Gut gekontert«, sagte er. »Ausgezeichnet gekontert. Andererseits ...« Er beugte sich vor, »hat das schreckliche Mädchen seine Kritikfähigkeit nicht völlig verloren. Die duglère-Soße hat nicht vor ihr bestanden ...«
»Na toll.«
»... und unser Autotester war mit dem Design des Armaturenbrettes gar nicht einverstanden.«
»Er hat diesen verdammten Aston über den grünen Klee gelobt. Ein Auto, das fast eine Viertelmillion kostet. Machen Sie mal Pause.«
»Der Olivenöl-Artikel allerdings – da bin ich ganz Ihrer Meinung. Fürchterlich. Unlesbar. Unerträglich affektiert.«
»Und Sie haben deswegen etwas unternommen, nicht wahr? In Ihrer Eigenschaft als verantwortlicher Redakteur?«
»Natürlich habe ich das.« Er erwiderte gleichmütig ihren Blick. »Haben Sie das noch nicht gehört? Ich habe den Mann diese Woche gefeuert.«
Wieder herrschte Schweigen, diesmal für länger. Lindsay saß absolut regungslos da. Sie sah in die grünen Augen, dann auf die Tweedjacke und die Bücherstapel. Einen kurzen Moment dachte sie an Schulgebühren und Hypothekenrückzahlungen und neue Fußballschuhe.
»Ist das eine Drohung?« fragte sie schließlich. Sie sprach mit absoluter Ruhe.
Jetzt wirkte McGuire zum ersten Mal wirklich verblüfft. Er sah sie verständnislos an, dann fuhr er sich mit der Hand durchs Haar und begann hastig zu reden.
Lindsay hörte ihm nicht zu. Sie stand auf. Sie fühlte sich wie an einem kalten, eisigen Ort gefangen, wo die Luft dünn war und man deshalb kaum atmen oder sprechen konnte. »Denn wenn das eine Drohung war«, fuhr sie genauso ruhig und tonlos fort, »dann muß ich Gini anrufen und unsere Verabredung verschieben. Wir wollen uns in einer Stunde treffen, doch dann werde ich natürlich zu spät kommen.«
»Zu spät? Zu spät? Was reden Sie da?«
»Gini wird warten müssen. Wie auch meine Mutter, falls Sie das interessieren sollte – was es wahrscheinlich nicht tut –, und mein Sohn und der Einkauf und der Klempner –«
»Klempner? Was für ein Klempner?«
»Und die Werkstatt und der verdammte Laden, wo sie vielleicht, nur vielleicht, noch ein letztes Paar Fußballschuhe in Größe 47 haben. Und der ganze andere aufreibende, triviale Kram, mit dem ich mich neben meiner Arbeit abgeben muß, die – falls Sie sich das fragen sollten – noch in dieser Woche fertig werden müssen. All das wird warten müssen, Rowland, weil ich oben sein werde, in diesem Gebäude. Ich werde mit Max reden. Unter solchen Bedingungen arbeite ich nicht.«
Zufrieden über ihre kontrolliert sarkastische und zugleich würdevolle Rede machte Lindsay sich auf den Weg zur Tür. Sie hatte das Gefühl, einen guten Abgang geschafft zu haben; McGuire hustete.
»Fußball oder Rugby?« fragte er.
Lindsay blieb stehen. Sie drehte sich um und schleuderte ihm einen vernichtenden Blick entgegen.
»Die Fußballschuhe«, wiederholte er. »Für Fußball oder Rugby?«
»Fußball. Und versuchen Sie nicht, sich bei mir einzuschleimen. Dazu ist es zu spät.«
»In Größe 47? Das ist beachtlich. Er muß groß sein.«
»Er ist groß. Er ist eins achtundachtzig. Er ist siebzehn. Hilft Ihnen das bei Ihren Berechnungen?«
»Ich habe nichts berechnet, aber ich bin überrascht. Ich dachte, Sie wären um die dreißig. Einunddreißig vielleicht.«
»Sparen Sie sich die Schmeicheleien«, sagte Lindsay, die sich insgeheim über die Bemerkung freute. »Sie können sich nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Ich –«