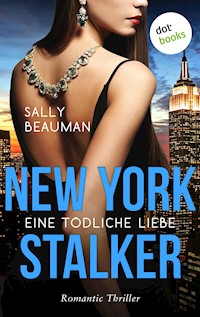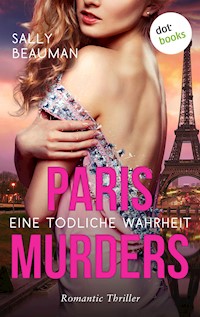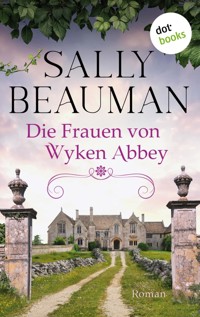Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe wie keine andere: Die große Familiensaga »Erben des Schicksals« von Sally Beauman jetzt als eBook bei dotbooks. Ein verheißungsvoller Sommerabend in Paris gegen Ende der 50er Jahre: Edouard de Chavigny, Sohn einer berühmten Juweliersfamilie und Erbe eines gewaltigen Wirtschaftsimperiums, trifft auf Hèléne – und ist wie vom Donner gerührt. Ausgerechnet er, der jede Frau haben könnte, verfällt dieser rätselhaften Schönheit auf den ersten Blick … Doch obwohl Hèléne gleichermaßen von ihm angezogen zu sein scheint, verlässt sie ihn nach einer kurzen, leidenschaftlichen Affäre. Warum nur ist sie ohne ein Wort gegangen? Edouard spürt zum ersten Mal in seinem Leben, dass Stolz im Angesicht der wahren Liebe bedeutungslos wird. Er kann nicht anders – er muss Hèléne wiederfinden … Sally Beaumans berühmte Saga, die seit ihrem Erscheinen Millionen Leserinnen und Leser begeistert hat – für die Fans der New-York-Times Bestsellerautorinnen Kate Morton und Katherine Webb. »Ein internationaler Blockbuster!« Sunday Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der weltweite Bestseller »Erben des Schicksals« von Sally Beauman, auch bekannt unter dem Titel »Diamanten der Nacht«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1549
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein verheißungsvoller Sommerabend in Paris gegen Ende der 50er Jahre: Edouard de Chavigny, Sohn einer berühmten Juweliersfamilie und Erbe eines gewaltigen Wirtschaftsimperiums, trifft auf Hèléne – und ist wie vom Donner gerührt. Ausgerechnet er, der jede Frau haben könnte, verfällt dieser rätselhaften Schönheit auf den ersten Blick … Doch obwohl Hèléne gleichermaßen von ihm angezogen zu sein scheint, verlässt sie ihn nach einer kurzen, leidenschaftlichen Affäre. Warum nur ist sie ohne ein Wort gegangen? Edouard spürt zum ersten Mal in seinem Leben, dass Stolz im Angesicht der wahren Liebe bedeutungslos wird. Er kann nicht anders – er muss Hèléne wiederfinden …
Sally Beaumans berühmte Saga, die seit ihrem Erscheinen Millionen Leserinnen und Leser begeistert hat – für die Fans der New-York-Times Bestsellerautorinnen Kate Morton und Katherine Webb.
»Ein internationaler Blockbuster!« Sunday Times
Über die Autorin:
Sally Beauman (1944–2016) war eine englische Autorin und Journalistin. Sie studierte in Cambridge Englische Literaturwissenschaft und war anschließend in England und den USA als Journalistin für viele angesehene Zeitschriften wie die »New York Times« und die »Vogue« tätig. Besonders bekannt ist sie für ihre acht international erfolgreichen Bestsellerromane, die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden.
Bei dotbooks erscheinen von Sally Beauman:
»Rebeccas Geheimnis«
»Das Geheimnis von Winterscombe Manor«
»Die Frauen von Wyken Abbey«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1987 unter dem Originaltitel »Destiny« bei Bantam Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1987 unter dem Titel »Diamanten der Nacht« im Goldmann Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1987 by Sally Beauman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1987 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-173-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Erben des Schicksals« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sally Beauman
Erben des Schicksals
Roman
Aus dem Englischen von Anneliese Tornow
dotbooks.
Für James,
den freundlichsten aller Militär-Philosophen,
und für Alan.
In Liebe.
»Whether we fall by ambition, blood or lust,
Like diamonds, we are cut with our own dust.«
Webster, Die Herzogin vom Amalfi
Erster Teil
Prolog
Paris 1959
Der Betrag belief sich auf zwei Millionen Dollar. Es war das letzte Schreiben des Tages.
Er las jeden Satz aufmerksam durch, kontrollierte jede Zeile. Ihm gegenüber, vor dem Schreibtisch, saß seine Sekretärin und wartete geduldig, ohne sich anmerken zu lassen, daß sie frisch verlobt und unendlich verliebt war und es sehr eilig hatte, nach Hause zu kommen. Er blickte flüchtig zu ihr auf und lächelte. Draußen, vor dem Spiegelglasfenster, schien noch immer die Sonne, und von der Straße unten drang, durch die dicke Glasscheibe gedämpft, der Lärm des Pariser Straßenverkehrs herauf. Es war sechs Uhr nachmittags.
Paris im Sommer; die Seine an einem lauen Abend. Früher einmal, dachte er, da wußte ich, wie man sich am Ende des Tages fühlt, wenn ein Abend voller Verheißungen wartet. Jetzt nicht mehr. Wieder konzentrierte er sich auf die Papiere, griff zu seinem Platinfüller und unterschrieb. Edouard de Chavigny.
Er schob den weißen Bogen über die schwarze Platte des Schreibtischs, sagte dann aber, weil sie ihm leid tat: »Sie können jetzt gehen.«
Unvermittelt hob sie den Kopf; sie war verblüfft. Dann stieg ihr heiße Röte in die Wangen, und ihre Augen leuchteten auf.
»Aber es ist erst sechs.«
»Ich weiß. Ich würde sagen, Sie gehen jetzt gleich, bevor wieder ein Telefon klingelt.« Sein Ton wurde ironisch. »Bevor ich’s mir anders überlege.«
»Vielen Dank.«
Während sie eilig ihre Papiere zusammensuchte, stand Edouard auf. Mit dem Rücken zu ihr blieb er vor einem der Fenster stehen und sah hinaus. Die City von Paris. Unten auf der Straße herrschte dichter Verkehr. Er sah, wie die Autos ein Stück fuhren, anhielten und wieder ein paar Meter fuhren. Sekundenlang lehnte er die Stirn ans Glas. Tief unten, auf der anderen Straßenseite, schüttelte der Wind die silbrigen Blätter einer Platane, und einen kurzen Moment sah es so aus, als tanzten sie.
»Ich werde auch bald gehen.«
Sie hatte bereits die Tür erreicht, hielt aber inne, als sie seine Stimme vernahm. Er spürte die Neugier in ihrem Blick: eine begreifliche Neugier, da er das Chavigny-Gebäude selten vor acht Uhr abends verließ.
»So früh?« Ihr Ton verriet so tiefes Erstaunen, daß Edouard sich mit leichtem Lächeln zu ihr umwandte.
»Warum nicht?« gab er zurück. »Es ist ein wunderschöner Abend.«
In diesem Augenblick, als er sprach, als er lächelte, wußte er, daß das Verlangen wiederkehrte, so stark und unverhofft wie immer, als hätte es die vergangenen drei Wochen nervösen Zölibats niemals gegeben.
Die Tür fiel ins Schloß. Mit einem Anflug von Verzweiflung wandte er sich wieder zum Fenster und preßte die Stirn ans kühle Glas. Das Verlangen ergriff Besitz von ihm; dunkel drängte es sich bis in den hintersten Winkel seines Gehirns, vernebelte sein Sehvermögen, erstickte seine Denkfähigkeit. Das Verlangen und die Verzweiflung, die darin lag: Immer kamen sie zusammen. Gereizt wandte er sich vom Fenster ab.
Er brauchte eine Frau. Frauen ließen ihn stets vergessen – jedenfalls für eine gewisse Zeit.
Es gab natürlich andere Mittel. Musik. Geschwindigkeit: Er fuhr gern sehr schnell. Zuweilen auch Alkohol. Vor allem aber Arbeit. Doch keines davon wirkte so schnell und so sicher wie Sex. Sex erlöste ihn für eine Weile – bis der Schmerz wiederkehrte.
Er verachtete dieses Verlangen und versuchte daher – wie immer –, dagegen anzukämpfen. Nachdem er sein Büro verlassen hatte, schickte er seinen Chauffeur nach Hause und fuhr den Wagen, jenen Aston-Martin, den Grégoire so sehr geliebt hatte, persönlich. Er lenkte ihn durch die belebten Straßen, hielt die mächtige Maschine in Schach, und fuhr so schnell wie möglich zur City hinaus, wo er nach Belieben beschleunigen konnte. Er schaltete das Radio ein und drehte die volle Lautstärke auf. Musik und Geschwindigkeit. Er hatte das Gefühl, als treibe Beethoven den Wagen an – und vorübergehend wurde er ruhiger. Er wußte, warum dies so war, wußte genau, was gerade jetzt sein Verlangen ausgelöst hatte. Erinnerungen, natürlich – Erinnerungen, die er niemals ganz verdrängen konnte, so sehr er sich auch bemühte, jede Sekunde eines jeden Tages auszufüllen. Erinnerungen, die sich ihm aufdrängten, wenn er sie am wenigsten erwartete: aus heiterem Himmel an einem stillen Sommerabend, durch die Erwartung im Gesicht einer Frau – Bilder der Vergangenheit, Gedanken an ein Glück, das niemals wiederkehren würde.
Die Musik steigerte sich zu einem leichten, zornigen Crescendo und verstummte. Resigniert dachte er: Na schön, dann also eine Frau. Und bog an der nächsten Kreuzung ab.
Das Rechte Ufer, vorbei an teuren Häusern und teuren Geschäften. Aus den Augenwinkeln sah er flüchtig schwarzen Samt und das eiskalte Geglitzer von Diamanten. Er, der so bekannt war für die Geschenke, die er den Frauen machte, hatte niemals Diamanten verschenkt. Saphire, Rubine, Smaragde – ja, aber niemals Diamanten. Irgend etwas hinderte ihn daran. »Ein perfekter Stein, Edouard.« Die Stimme seines Vaters. Er hielt den Diamanten ins Licht. »Siehst du? Perfekte Farbe. Makellos.«
Edouard lenkte den Wagen in Richtung Pont Neuf. Jetzt brauche ich keine Perfektion, dachte er. Das Leben kannte nichts Absolutes und keine Gewißheit. Er blickte auf die funkelnde Seine hinab.
Das Linke Ufer. Er nahm den Quai des Augustins und bog dann rechts ab, in den Boulevard St. Michel. Dort begann er nach einer Frau Ausschau zu halten.
Die Straßen waren sehr belebt. Die Menschen drängten sich vor den Geschäften, der Métro, dem tabac an der Ecke. Die Abendluft war still und lau. Aus den Cafés drangen die Klänge des zarten Liebeslieds auf die Straße, das er den ganzen Sommer gehört hatte.
Er spürte, wie sein Verlangen wuchs und die Verzweiflung stärker wurde, und ließ den Wagen langsam an den Cafés vorüberrollen. Sehr viele Touristen und – in diesem Stadtviertel – Studenten; er hörte ihre Stimmen: englisch, amerikanisch, italienisch, schwedisch. Er sah, wie sich Köpfe umwandten, als er vorbeifuhr, sah Frauengesichter. Sie musterten den starken Wagen, musterten den Fahrer; dann beugten sie sich wieder über ihre winzigen Tassen mit café noir, steckten sich eine Gauloise an und schenkten ihm kichernd einen längeren Blick ...
Als er sich einer Kreuzung näherte, fiel sein Blick auf zwei junge Mädchen. Eine von ihnen war ein Rotschopf. Als er zu ihr hinübersah, warf sie den Kopf zurück und lachte. Ein schöner, schlanker Hals, volle Brüste, die milchweiße Haut der Rothaarigen. Ihre Begleiterin hätte Französin sein können: ein Juliette-Greco-Typ, von denen es unendlich viele gab. Schwarz, natürlich, mit langem, schwarzen Trauerhaar, leichenblassem Gesicht, die Augen dick ummalt. Sie wirkte nervös, schien sich nicht ganz behaglich zu fühlen. Er zögerte eine Sekunde, dann trat er den Gashebel herunter.
Er mied Frauen mit rotem Haar, weil sie ihn an seine Vergangenheit erinnerten, die er lieber vergessen wollte, und die Dreistigkeit des Mädchens schreckte ihn ab. Die andere wirkte wie jener Typ Frau, der tief verletzt durchs Leben geht.
Er bog in eine schmale Nebenstraße ein, fuhr an den dunklen Mauern und vorspringenden Wasserspeiern der Église St. Séverin vorbei. Danach an einem marokkanischen Restaurant mit würzigem Duft nach Kreuzkümmel und gegrilltem Fleisch, ein riesiges Graffiti: Algérie Française. Voll Widerwillen wandte er den Blick ab und riß hastig das Steuer herum.
Zwei weitere Straßen, schmal, gewunden; und dann nach rechts, in die Rue St. Julien le Pauvre.
Linker Hand vor ihm lag ein kleiner Park und dahinter die winzige Kirche St. Julien. Im Park spielten Kinder. Er vernahm den Klang ihrer Stimmen, sah die Farbtupfer ihrer Kleider: marineblau, weiß, scharlachrot – die Farben französischer Kinder, die Farben der Libération. Und dann sah er die Frau.
Später – acht, zehn, zwölf Jahre später – erinnerte er sich an diesen Moment mit glasklarer Präzision: die Rufe der Kinder; das Geräusch fahrender Autos; das Knirschen, wenn die Kinder über den Kies liefen; das Bunt der Farben; das Ansteigen des Verlangens und zugleich der Verzweiflung; und dann, das junge Mädchen.
Sobald er sie sah, gab es nichts anderes mehr für ihn. Die Geräusche verstummten; der Raum verengte sich auf sie. Er sah nur sie, ein helles Strahlen und ihr Gesicht.
Sie stand vor der kleinen Kirche und blickte empor. Ihr Haar war von einem außergewöhnlichen, blassen Goldton. Es fiel ihr bis auf die Schultern herab, mit stumpf abgeschnittenen Enden. Eine leichte Brise wehte ihr die Strähnen so aus dem Gesicht, daß sie eine Aureole um ihr Profil bildeten.
In diesem Augenblick wandte sie sich sekundenlang um: als hätte sie seinen Blick gespürt, als hätte jemand nach ihr gerufen. Aber er hatte nicht gerufen, hatte sich nicht gerührt. Mit zusammengezogenen Brauen spähte sie die Straße entlang zum Quai hinüber, und er entdeckte unter ihren dunklen, geraden Brauen weitstehende, graublaue Augen von außerordentlicher Schönheit.
Sie schien ihn nicht zu bemerken und wandte sich wieder der Kirche zu. Edouard starrte sie an. Sein Puls war langsamer geworden; das hartnäckige Hämmern seiner Sinne war verstummt; ganz vage war er sich eines traumhaften Kraftgefühls bewußt, einer halluzinatorischen Klarheit, als bewege er sich auf sie zu, obwohl er stillstand.
Sie mochte etwa neunzehn sein, vielleicht auch ein wenig älter. Hochgewachsen. Sehr schlank. Gekleidet in blaue Levis-Jeans, ein schlichtweißes T-Shirt, unter dem sich die Konturen ihrer hohen, runden Brüste abzeichneten. In St. Germain gab es Tausende von jungen Mädchen, die praktisch genauso gekleidet waren. Dieses Mädchen jedoch ähnelte keinem von ihnen. Als er sie betrachtete, sah er körperliche Perfektion, eine Schönheit, so eindeutig wie Perfektion in allen Formen. Er sah sie in diesem Mädchen, wie er sie im Herzen eines Diamanten gesehen hätte. Darum zögerte er nur einen Sekundenbruchteil.
Er hatte aussteigen und auf sie zugehen wollen, aber sie kam ihm zuvor. Sie drehte sich um und sah ihn an: mit einem langen, offenen Blick ohne jede Koketterie. Sie sah ihn an, als wolle sie sich sein Gesicht einprägen, und Edouard erwiderte ihren Blick. Und dann kam sie, bevor er eine Bewegung machen konnte, zum Wagen herüber.
Sie stand da, vor der langen, schwarzen Motorhaube, und sah ihn, noch immer mit leicht zusammengezogenen Brauen, an, fast so, als erkenne sie ihn nur halb. Ihre Haltung war graziös und gelassen, und er sah die Intelligenz in ihren Augen, den Charakter im Schwung ihrer Lippen. Ihr Anblick ließ ihn still werden; die Verzweiflung legte sich, sein Verstand wurde glasklar und sehr, sehr ruhig.
Er sah sie an und spürte den Schock des Erkennens: eine Frau, die ihm sofort vertraut war; eine Frau, die er noch nie zuvor gesehen hatte.
Und plötzlich lächelte sie. Es lag ein gewisser Spott in diesem Lächeln, als hätte sie gerade beschlossen, ihm etwas möglichst leicht zu machen.
»Verzeihen Sie. Ich hatte geglaubt, Sie zu kennen.«
Sie sprach französisch, korrekt, aber eben doch nicht ganz perfekt. Engländerin, dachte er, oder Amerikanerin.
»Ich dachte dasselbe.«
»Dann haben wir uns beide geirrt. «
»Oder auch nicht. «
Jetzt lächelte er ebenfalls, wurde aber sofort wieder ernst. Er mußte jetzt sehr schnell etwas tun, etwas sagen, obwohl er keine Ahnung hatte, was.
Um ein wenig Zeit zu gewinnen, öffnete er die Tür, stieg aus, ging um den Wagen herum und blieb neben ihr stehen. Er kannte seinen Ruf genau; er wußte, daß man von seinem Charme sprach und behauptete, er könne ihn nach Belieben an- und abschalten. Er wußte, man hielt ihn für kalt und teilnahmslos, und war sich klar darüber, daß Menschen, die keine Ahnung hatten, was es ihn kostete, neidisch von seiner Selbstbeherrschung sprachen.
Jetzt fühlte er sich entwaffnet – ein vierunddreißigjähriger Mann und zugleich doch ein verletzliches Kind.
Sie war groß für eine Frau, aber er war noch größer. Sie blickte ihm in die Augen. Ein Schweigen entstand, das stundenlang zu währen schien. Irgend etwas mußte er sagen: »Ich finde, Sie sollten mit mir essen gehen.« Er nahm an, daß er es mit Charme gesagt hatte – daß er überhaupt etwas gesagt hatte, erschien ihm auf einmal so absurd, daß er wünschte, er hätte lieber geschwiegen. Sekundenlang sah er sich und die Frau, wie ein Dritter sie wohl gesehen hätte: ein hochgewachsener, dunkelhaariger Mann in erstklassig geschnittenem, sehr formellem schwarzem Anzug, der in jeder Hinsicht allen anderen Anzügen glich, die er besaß, und eine schlanke, blonde junge Frau. Sie würde seine Einladung ablehnen. Vermutlich empört.
»Sollte ich?« Dann hellte sich ihre Miene auf. »Das finde ich auch«, erklärte sie energisch, öffnete kurzerhand den Wagenschlag und stieg ein.
Edouard startete den Motor, löste die Bremse, legte den Gang ein und ließ die Kupplung kommen – ohne sich dessen bewußt zu sein. Der Wagen rollte an. Als sie am Portal von St. Julien vorbeikamen, sah sie ihn an. »Eine so wunderschöne Kirche! Leider war sie verschlossen. Kann man überhaupt nicht hinein?«
Sie sprach, als kenne sie ihn ihr Leben lang. In Edouard stieg sofort wilder Jubel hoch.
»Doch, ich werde Sie hineinführen«, antwortete er, während er Gas gab.
Es war in diesem Augenblick, dachte er später, daß seine Besessenheit begann. Er täuschte sich natürlich. Sie hatte früher begonnen, weit früher – viele Jahre, bevor er sie kennenlernte. Eine große Zeitspanne, und alles raste auf einen einzigen Ort zu: auf jene Straße, jene Kirche, jenes Mädchen und jenen warmen Sommerabend.
Reiner Zufall. Zuweilen fand er das beruhigend, dann wieder beängstigend.
Kapitel 1Edouard
London 1940
Das Haus am Eaton Square lag in der Mitte von Thomas Cubitts berühmter Terrasse auf der Südseite und war in prunkvollerem Stil gehalten als seine Nachbarn. Hohe korinthische Säulen rahmten die Fenster des Salons im ersten Stock, und ein eleganter Balkon zog sich über die gesamte Breite des Hauses.
Der Eaton Square war das Juwel der Londoner Besitzungen des Herzogs von Westminster, und Hugh Westminster war ein alter Freund von Edouards Mutter. Kaum hatte er gehört, daß sie Paris verlassen wollte, da stellte er ihr das Haus zur Verfügung. Dafür war Edouard sehr dankbar. Natürlich wäre er lieber bei Papa in Frankreich geblieben, in St. Cloud, im Château an der Loire oder im Sommerhaus in Deauville. Doch da das leider unmöglich war – dann schon am liebsten mitten in London. Die tagtäglichen Jagdfliegerattacken im Spätsommer waren inzwischen den nächtlichen Bombenangriffen gewichen, im August jedoch hatte es einen spektakulären Luftkampf zwischen einer Spitfire und einer Messerschmitt ME 110 gegeben, den er vom Balkon aus wie auf einem Tribünenplatz beobachtete.
Als Papa verkündet hatte, sie müßten abreisen, hatte er gefürchtet, die Mutter würde sich aus Sicherheitsgründen irgendwo weit draußen auf dem Land vergraben. Zum Glück schien sie das jedoch nicht in Betracht gezogen zu haben. Jean-Paul, sein Bruder, mußte natürlich in London wohnen. Er gehörte zum persönlichen Stab General de Gaulles und organisierte die Einsätze der Freien Französischen Armee, die Frankreich in nicht allzu langer Zeit befreien würde. Die Mutter beugte sich stets den Bedürfnissen und Forderungen ihres Ältesten – Edouard wünschte, das träfe auch auf seine Forderungen zu –, und überdies liebte sie London.
Gerade jetzt stand er an eines der hohen Fenster gelehnt und hauchte an das Glas der Scheibe, das zum Schutz gegen den Luftdruck der Bomben kreuz und quer mit Heftpflaster beklebt war. In eines der von seinem Atem beschlagenen Dreiecke schrieb er gelangweilt seinen Namen. Edouard Alexandre Julien de Chavigny: ein so endlos langer Name, daß er ihn schließlich auf zwei Dreiecke verteilen mußte. Er hielt inne und fügte dann hinzu: Age – quatorze ans.
Stirnrunzelnd blickte er auf den Platz hinaus. Auf der gegenüberliegenden Seite sah er das Haus, das ein paar Nächte zuvor einem Volltreffer zum Opfer gefallen war. Sein Kammerdiener hatte gesagt, es sei niemand umgekommen, das Haus habe leer gestanden, doch Edouard vermutete, daß man ihm aufgetragen hatte, das zu sagen. Er selbst war nicht so sicher. Er wünschte, er wäre nicht erst vierzehn. Er wünschte, er wäre zehn Jahre älter, wie Jean-Paul. Oder achtzehn. Achtzehn würde durchaus reichen. In dem Alter konnte man sich freiwillig melden. Und etwas Nützliches tun.
Einer der Luftschutzwarte kam in sein Blickfeld; am ausgestreckten Arm entlangpeilend zielte Edouard auf dessen Stahlhelm. »Piuhh! Getroffen!«
Sekundenlang empfand er Genugtuung, dann ärgerte er sich. Er war zu alt für diese Spiele, das wußte er. Schließlich war er fast fünfzehn. Im Stimmbruch war er auch schon. Bald würde er sich rasieren müssen. Und andere Anzeichen gab es auch: Wenn er die eine oder andere von den Hausangestellten betrachtete, rührte sich etwas an seinem Körper und wurde hart. In der Nacht hatte er Träume – lange, herrliche, wahnsinnige Träume, nach denen am Morgen die Bettlaken feucht waren und mit verständnisinnigem Lächeln vom Kammerdiener – nicht von den Mädchen – entfernt wurden. O ja, sein Körper veränderte sich; er war kein Kind mehr; er war – beinahe – ein Mann.
Edouard des Chavigny war im Jahre 1925 geboren worden, als seine Mutter Louise dreißig war. In den Jahren zwischen Jean-Pauls Geburt und der ihres zweiten Sohnes und letzten Kindes hatte sie mehrere Fehlgeburten erlitten. Während ihrer letzten Schwangerschaft war Louise sehr krank gewesen. Nach der Geburt wurde eine Hysterektomie vorgenommen, und ganz langsam – zuerst im Château de Chavigny an der Loire und dann im Haus ihrer Eltern in Newport – erholte sie sich von der Operation. Auf jene, die ihr nur auf Gesellschaften, Bällen oder Empfängen begegneten, wirkte Louise genau, wie sie immer war – eine gefeierte Schönheit, berühmt für ihre Eleganz und ihren erstklassigen Geschmack, einzige Tochter eines Stahlbarons und eines der reichsten Männer Amerikas, aufgewachsen wie eine Prinzessin, der von ihrem in sie vernarrten Vater jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde, zeit ihres Lebens bezaubernd, anspruchsvoll und unwiderstehlich. Unwiderstehlich sogar für Xavier, Baron de Chavigny, und der galt seit langem als einer der eingefleischtesten Junggesellen Europas.
Als er im Jahre 1912 zum ersten Mal nach Amerika kam, um die Ausstellungsräume des Schmuck-Imperiums de Chavigny zu eröffnen, wurde Xavier sofort zum begehrtesten Mann der Ostküste. Die Damen der Gesellschaft wetteiferten um ihn. Ohne sich zu schämen, führten sie dem gutaussehenden jungen Mann ihre Töchter vor, und Xavier de Chavigny war charmant und aufmerksam – und zum Verzweifeln unverbindlich.
Für die Mütter der Ostküste vereinigte er alle Vorteile Europas auf sich: Er war aufregend schön, hochintelligent, er hatte perfekte Manieren, war vermögend und von uraltem Adel.
Die Väter der Ostküste schätzten ihn dagegen wegen seines unvergleichlichen Gespürs für Geschäfte. Dieser Mann war mitnichten ein Taugenichts von einem französischen Aristokraten, der nur zusah, wie sein Vermögen dahinschmolz, während er sich ein schönes Leben machte. Im Gegensatz zu den meisten Franzosen seines Standes verfügte er über ein durch und durch amerikanisches Gefühl für den Kommerz. Er baute das von seinem Großvater im neunzehnten Jahrhundert gegründete Schmuck-Imperium de Chavigny zum größten und berühmtesten Unternehmen seiner Art aus, dem international einzig Cartier Konkurrenz zu machen vermochte. Er erweiterte und verbesserte seinen Weinanbau an der Loire. Er erhöhte seine Investitionen im Bankgeschäft, in der Stahlproduktion und in den Diamantenminen Südafrikas, die das Rohmaterial für den Chavigny-Schmuck lieferten – Schmuck, der die gekrönten Häupter Europas geziert hatte und nun auch die ungekrönten Häupter reicher, anspruchsvoller Amerikaner zierte.
Xavier lernte Louise in London kennen, als sie neunzehn, er neunundzwanzig war, und sie in die englische Gesellschaft eingeführt wurde. Das war Ende 1914. Xavier war in den ersten Monaten des Krieges verwundet und – zu seinem Ärger – aus dem aktiven Dienst entlassen worden. Sie trafen sich auf einem der letzten Debütantinnenbälle der Kriegsjahre: sie in einer Worth-Robe aus zartrosa Seide, er in der Uniform eines französischen Offiziers. Am folgenden Morgen bat er ihren Vater in dessen Suite im Claridge um ihre Hand.
Sie heirateten in London, verbrachten die Flitterwochen auf den Sutherland-Besitzungen in Schottland und kehrten nach Kriegsende mit ihrem zweijährigen Sohn Jean-Paul nach Paris zurück. In Europa wurde Louise sehr schnell für ihren Charme, ihren Geschmack und ihre Schönheit genauso berühmt, wie sie es in Amerika gewesen war. Und wie sich herausstellte, besaß Baron de Chavigny eine Eigenschaft, die man bei einem Franzosen niemals erwartet hätte: Er war ein liebevoller und treuer Ehemann.
Als Louise de Chavigny sich also sieben Jahre später von der schweren Geburt ihres zweiten Sohnes erholte und sich, unverändert in Aussehen, Charme und Eleganz, wieder in der Gesellschaft blicken ließ, vermuteten jene, die sie nicht so gut kannten, daß sie ihr schönes Leben fortsetzen werde. Gewiß, es hatte eine schwierige Phase gegeben, doch das war vorbei. Als Louise im Jahre 1927 ihre Rückkehr aus Newport nach Paris feierte, indem sie Coco Chanels gesamte Frühjahrskollektion aufkaufte, lächelten ihre weiblichen Bekannten verständnisinnig: Plus ça change, plus c’est la même chose ...
Jene, die sie besser kannten, erlebten eine andere Louise. Sie erlebten eine Frau, deren Launenhaftigkeit von Jahr zu Jahr zunahm, eine Frau, die spontanen und zuweilen heftigen Stimmungsschwankungen unterlag und von unvermittelt freudiger Erregung in ebenso plötzliche Depressionen stürzte.
Darüber wurde nicht diskutiert. Ärzte kamen und gingen. Der Baron de Chavigny tat alles, um ihr eine Freude zu machen. Er schenkte ihr neuen Schmuck: einen Satz perfekt zueinander passender Saphire, ein kostbares Rubin-Collier, für die letzte Zarin gefertigt, das nach der Revolution wieder in die Hände des Barons gelangt war. Louise erklärte, die Rubine erinnerten sie an Blut, erinnerten sie an einen Keller in Jekaterinburg, und weigerte sich, sie anzulegen. Der Baron schenkte ihr Pelze: Zobel von so feiner Qualität, daß man jedes Fell durch einen Ehering hätte ziehen können. Er schenkte ihr Rennpferde: einen herrlichen Irish Hunter, denn das Jagdreiten liebte sie ganz besonders. Er schenkte ihr Autos: einen Delage, einen Hispano-Suiza, einen Rolls-Royce, einen Bugatti. Und als ihr alles nicht gefiel, ging er mit ihr auf Reisen. Nach England und zur Westküste Amerikas, wo ihre Laune sich vorübergehend besserte. Nach Indien, wo sie im Palast des Vizekönigs wohnten und mit dem Maharadscha von Jaipur Tiger jagten. Nach Italien, wo sie eine Audienz beim Papst hatten. Zurück nach England. Zurück nach Frankreich.
Abend für Abend begleitete er sie bis an ihr Schlafzimmer:
Ça va mieux, ma chérie?
Pas mal. Mais je m’ennuie, Xavi, je m’ennuie ...
Im Jahre 1930, als seine Frau vierunddreißig und der Baron vierundvierzig war, folgte er schließlich dem Rat seiner männlichen Freunde und nahm sich eine Mätresse. Er sorgte dafür, daß Louise davon erfuhr, und zu seiner Freude ließ die Eifersucht sie wieder aufleben. Aber es erregte sie auch, wie er schweren Herzens feststellen mußte, wenn sie ihn, wieder im Ehebett vereint, mit fiebriger, besessener Neugier nach seiner affaire ausfragte.
Hat sie dies getan, Xavi? Oder dies?
Sie legte sich in die Spitzenkissen zurück. Das schwarze Haar umrahmte ihr vollkommenes Gesicht, die dunklen Augen funkelten, die vollen Lippen waren rot geschminkt. Der Baron hatte in seiner Ungeduld die feine Spitze an ihrem Negligé zerrissen, und das hatte sie erregt. Sie hatte hoch angesetzte, runde, kindliche Brüste, die er schon immer geliebt hatte, und ihr schlanker, sahnigweißer Körper war noch so biegsam wie der eines jungen Mädchens. Jetzt hob sie mit beiden Händen ihre Brüste an und bot sie seinem suchenden Mund.
Calme-toi, sois tranquille, je t’aime, tu sais, je t’adore ...
Er nahm die zarten Brustspitzen zwischen seine Lippen und küßte sie sanft. Diesmal würde er langsam vorgehen, das nahm er sich fest vor. Sehr langsam. Er konnte und würde sich zurückhalten und sie einmal, zweimal, dreimal zum Höhepunkt bringen, bevor er selbst kam – und sie würde, wie immer, erschauern und sich an ihn klammern. Er wurde hart, und sie spürte, wie sich sein Körper an ihrem Leib regte. Hastig, heftig stieß sie ihn zurück und drückte seinen Kopf von sich weg.
»Nein, nicht so! Ich will das nicht!«
Sie sprach englisch, früher war es immer französisch gewesen, wenn sie sich liebten.
»Gib ihn mir in den Mund, Xavi. Nur zu. Ich weiß, daß du das magst. Tu ihn rein ... Ich will es so ...«
Sie zog ihn auf dem Bett nach oben, bis sich sein steifer Speer vor ihren Lippen befand. Sie lächelte ihm zu und berührte die Spitze einmal, zweimal mit einem kleinen, schlangengleichen Züngeln.
»Er schmeckt nach mir. Salzig. Ich mag das...«
Ihre Augen schimmerten dunkel. Sie öffnete die vollen, roten Lippen, und dann spürte er erschauernd die Wärme ihrer Mundhöhle, ihr stetes, rhythmisches Saugen. Er schloß die Augen. Sie war gut darin, war es immer gewesen. Sie wußte, wie sie ihn erregen, mit der Zunge sanft am Rand seiner zurückgeschobenen Vorhaut entlangstreichen mußte. Sie verstand es, seine Reaktion zu beschleunigen, indem sie gerade eben stark genug sog, bis er an ihren Gaumen stieß, verstand sanft, feucht, rhythmisch zu saugen. Nun strich sie mit beiden Händen langsam über seinen Rücken hinab, über seine Hinterbacken und zwischen seine Beine, um ihn dort zu massieren, wo die Haut von der Liebe lose und feucht war. Mit zarten Händen umfaßte sie seine Hoden und bog den Kopf so weit zurück, daß er das Gefühl hatte, an die Rückseite ihrer Kehle zu stoßen. Er fühlte, wie die Woge begann, wie sie sich allmählich aufbaute.
Und dann hörte sie plötzlich auf zu saugen. Sie ließ den schwellenden Penis aus dem Mund gleiten und blickte zu ihrem Ehemann auf.
»Hat sie das mit dir gemacht, Xavi? Ja? Kann sie das auch so gut wie ich? Erzähl’s mir, Xavi... Sag’s mir ins Ohr, während du’s mir besorgst... Ich will’s wissen. Was hat sie sonst noch mit dir getrieben, Xavi? Hast du sie einfach nur gebumst oder mehr als das? Hat sie’s vielleicht gern von hinten? Erzähl doch, Xavi, erzähl...«
Ihre vulgäre Ausdrucksweise stieß ihn ab und erregte ihn zugleich. Während er ihre dunklen Augen, ihren gierigen Mund betrachtete, spürte er, wie seine Erektion nachließ. Er schloß die Augen und drückte sie in die Kissen zurück. Dann wechselte er die Stellung, spreizte ihre Beine und drang heftig in sie ein. Sie bog den Rücken durch und stieß einen Schrei aus. Xavier begann zuzustoßen: tief, dann flach, dann wieder tief. Er stieß zu, zog sich zurück, stieß wieder zu. Dann stieg zu seiner eigenen Überraschung das Bild seiner Mätresse vor seinen Augen auf. Er sah ihren üppigen, bereitwilligen Körper, die vollen Brüste mit den dunklen Spitzen, hörte ihren keuchenden Atem. Diese Phantasievorstellung brachte ihn zum Höhepunkt. Er stöhnte auf und ergoß sich in den reglosen Körper seiner Frau, haßte sich selbst, haßte sie. Als er sich zurückzog, fuhr sie ihm mit ihren scharfen Nägeln über den Rücken.
»Du Schwein! Du hast an sie gedacht, nicht wahr? Nicht wahr?« Xavier sah auf sie hinab.
»Ich dachte, das hättest du gewollt«, erwiderte er kalt. Dann verließ er sie und kehrte in sein eigenes Schlafzimmer zurück.
Im Jahr danach schlief er gelegentlich mit seiner Frau, weit häufiger jedoch, und mit wachsender Verzweiflung, mit einer Reihe anderer Frauen. Deprimiert mußte er feststellen, daß er sich immer stärker zu jungen Frauen hingezogen fühlte, Frauen, die ähnlich aussahen wie Louise damals, als er sich in sie verliebt hatte. Zuweilen, wenn die Ähnlichkeit zu vage war, schloß er die Augen und rief sich das Bild seiner Frau in jungen Jahren in Erinnerung. Ihre nach Rosen duftende Haut; ihre ganz persönliche Mischung aus Schüchternheit und Leidenschaft; die Gewißheit ihrer Liebe zu ihm. Diese Vorstellung wirkte unfehlbar. Sie brachte ihn selbst in den Armen einer Hure aus den Markthallen zum Orgasmus.
Im Privatleben wurde er immer verschlossener, zog sich sogar von seinen ältesten Freunden zurück und vertiefte sich in die Probleme seiner Unternehmen und Besitzungen. In der Öffentlichkeit blieben er und seine schöne Frau genauso, wie sie immer gewesen waren: liebevoll, extravagant, großzügig. Sie wurden überall gesehen, überall beneidet, überall bewundert. Falls doch gelegentlich Gerüchte aufkamen – sogar die beste Ehe brauchte gelegentlich ein divertissement –, so ignorierte er sie einfach. Eines habe ich wenigstens von meiner Frau gelernt, sagte er sich. Sie hat mich gelehrt, was ennui wirklich bedeutet, was es bedeutet, tagein, tagaus in einem grauen Gefängnis zu leben.
Den bevorstehenden Krieg sah er schon früh voraus. Schon 1933 warnte er seine Freunde, daß es Krieg geben würde, aber sie lachten ihn aus. 1936 veräußerte er mit Gewinn seine Beteiligungen an der deutschen Stahlindustrie und kaufte sich statt dessen in die englische und amerikanische Industrie ein. Nach der Besetzung des Rheinlands im selben Jahr transferierte er all seine Holdings sowie einen beträchtlichen Teil seines Kapitals von Frankreich in die Schweiz und nach New York. Das Eigentumsrecht an der Firma de Chavigny ging aus seiner privaten Hand in die einer in Luzern registrierten Holding-Gesellschaft über, deren Aktien zu neunzig Prozent er und zu zehn Prozent sein Sohn Jean-Paul besaßen. Seine persönliche Juwelensammlung, seine Gemälde, sein Silber, die wertvollsten und am schwersten zu ersetzenden Möbel aus den drei Häusern in Frankreich wurden zusammengepackt und ebenfalls in die Schweiz geschickt, wo sie vorerst gelagert wurden. Im Jahre 1937 begann er mit der Planung der notwendigen Vorbereitungen, damit die Familie, sollte es zu der gefürchteten Invasion kommen, Frankreich sofort verlassen konnte. Im Mai 1940, kurz bevor die britischen Truppen Dünkirchen evakuierten, reiste Louise mit ihren beiden Söhnen aus Frankreich ab. Als die Deutschen am 14. Juni desselben Jahres Paris erreichten, waren die Verkaufsräume der Firma de Chavigny zwar noch geöffnet, Xavier de Chavigny jedoch schien nahezu all seine Aktiva abgestoßen zu haben.
Wann immer man ihn darum bat, stellte er den Offizieren des deutschen Oberkommandos sich und seine Verkaufsräume zur Verfügung und war auf Grund dieser zuvorkommenden Bereitwilligkeit nicht selten in der Lage, den anderen Mitgliedern des sechsten Kaders der Pariser Résistance, dem er ebenfalls angehörte, Informationen von beträchtlichem Wert zu liefern.
Zu seinem Erstaunen stellte er fest, daß er weder Louise noch seine Mätressen vermißte und daß der ennui verschwunden war. Er sah wieder einen Sinn im Leben, und zwar um so intensiver, weil er wußte, daß er sich in ständiger Gefahr befand.
Er fürchtete nicht für sich, aber er fürchtete – noch immer – für Louise und seine Kinder. Hätten sie sich mit seinem ursprünglichen Plan, nach Amerika zu gehen, einverstanden erklärt, er selbst wäre wesentlich ruhiger gewesen. Louise war Halbjüdin. Frances, ihre Mutter, war eine geborene Schiff und in der engen Gemeinschaft der deutsch-jüdischen Gesellschaft New Yorks aufgewachsen, in der die Tatsache, daß man – genau wie die Rothschilds und die Warburgs – ursprünglich aus Frankfurt stammte, von allergrößter Bedeutung war. Frances wuchs in dem fest abgeschlossenen Kreis der ›Einhundert‹ auf, und unter ihren Onkeln und Tanten, ihren zahllosen Cousins und Cousinen gab es eine beträchtliche Anzahl von Warburgs, Loebs, Lehmans und Seligmans. Man erwartete, daß sie in eine Dynastie einheiratete. Als sie dann jedoch mit neunzehn Jahren mit John McAllister durchbrannte, wurde sie von ihrer Familie verstoßen, und die Erschütterungen des Schocks, den diese Mischehe auslöste, hallten noch Jahrzehnte nach.
Frances kehrte ihrer Kindheit den Rücken. John McAllister war reich, denn er hatte von seinem aus Schottland emigrierten Großvater ein Stahlimperium geerbt. Er investierte in die Northern Pacific Railroad und wurde noch reicher. Frances McAllister konzentrierte ihre ganze Energie darauf, sich zu assimilieren, und da sie nicht nur reich war, sondern auch schön, klug und charmant, war sie damit weitgehend erfolgreich. In der Metropolitan Opera glänzte sie in der McAllister-Loge des Diamond Horseshoe, deren Logen ihren jüdischen Verwandten verschlossen blieben. Sie ließ sich ein Haus bauen – in Newport, und natürlich nicht in Elberon, wo ihre Onkel und Tanten Villen besaßen. Sie erzog Louise sehr umsichtig; ihre eigene jüdische Abstammung wurde zwar nicht geleugnet, Anspielungen darauf jedoch nicht gern gesehen. Als Louise älter wurde und merkte, daß sie durch die Herkunft ihrer Mutter zur Ausnahme unter ihren Altersgenossen wurde, war sie besonders sorgfältig darauf bedacht, sie niemals auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Sie trat zum katholischen Glauben über, und als sie Xavier heiratete, konzentrierte sie ihre beträchtlichen Energien ausschließlich auf ihre neue Rolle der Baronne sowie darauf, französischer zu sein als die Franzosen.
Ihre Bemühungen in dieser Hinsicht waren derart erfolgreich, daß Xavier de Chavigny beinahe vergaß, welcher Abstammung die Vorfahren seiner Frau waren. Bis 1938: Da wurde ihm klar, daß man sie nicht länger ignorieren konnte. Bei einem Feind, der einen Familienstammbaum auf der Suche nach jüdischem Blut geduldig durch acht, neun Generationen zurückverfolgte, waren eine halbjüdische Mutter und eine jüdische Großmutter eine lebensbedrohende Gefahr. Aus diesem Grund hatte er seine Pläne sorgfältig durchdacht, und der Baron zweifelte nicht daran, daß das auch notwendig gewesen war. Trotzdem war er beunruhigt: Hatte er sie wirklich sorgfältig genug durchdacht?
Edouard legte sich auf das mit Seidenbrokat bezogene Sofa, stopfte sich ein Kissen unter die Füße, schlug das Buch auf und starrte ins Feuer. Er fühlte sich überaus behaglich und, wie so oft nach einem englischen Tee, sogar ein bißchen schläfrig.
Der Tee, entschied er, gehört zu den Mahlzeiten, auf die sich die Engländer verstehen. Edouard war schon ziemlich groß. Er hatte das gute Aussehen seines Vaters geerbt, dem er mit seinem fast pechschwarzen Haar und den verblüffend tiefblauen Augen sehr ähnlich sah. Genau wie sein Vater war auch er athletisch gebaut: mit breiten Schultern, langen Beinen und schmalen Hüften.
Edouard las jeden Morgen die Times; und bei seinen Ausflügen in die City waren ihm die langen Warteschlangen vor den Geschäften aufgefallen. Es war ihm klar, daß die reichhaltigen Mahlzeiten, die seine Mutter auch jetzt für selbstverständlich hielt, außergewöhnlich, ja möglicherweise sogar unpatriotisch waren. Aber er war eben einfach immer so hungrig! Half er wirklich, den Krieg zu gewinnen, wenn er eine zweite Scheibe Filet de boeuf en croûte oder einen zweiten Löffel Sevruga ablehnte? Bestimmt nicht.
Schuldbewußt senkte er den Blick auf das Buch, das auf seinem Schoß lag. Bis morgen Früh mußte er mindestens fünf Seiten Vergil übersetzen, geschafft hatte er bisher aber nur zwei. In Frankreich hatte er bei einem älteren Jesuiten Lateinunterricht gehabt, der höchst angenehm entschlummerte, während sich Edouard durch die Äneis quälte. Sein englischer Privatlehrer jedoch war ganz anders.
Er war von Edouards Mutter auf Empfehlung einer Freundin eingestellt worden, und Edouard war fest überzeugt, daß sein Papa ihn rundheraus abgelehnt hätte. Hugo Glendinning war ein Mann unbestimmten Alters, zu alt, um eingezogen zu werden, und wahrscheinlich Mitte Vierzig, obwohl er manchmal älter wirkte. Er war sehr groß, sehr dünn und auf eine nachlässige Art elegant. Sein Haar wurde schon grau, und jedesmal, wenn Edouard einen Schnitzer begangen hatte, fuhr er sich mit den gespreizten Fingern melodramatisch durch die Mähne. Er war ein ehemaliger Eton-Schüler, ein klassischer Oxfordianer, sein Blick war immer etwas vage, sein Verstand jedoch so scharf wie eine Rasierklinge.
Mit seiner Herkunft und seinen akademischen Meriten wäre Papa zufrieden gewesen, davon war Edouard fest überzeugt. Doch politisch? Da hatte Edouard so seine Zweifel. Hugo Glendinning hatte im spanischen Bürgerkrieg gekämpft, und Edouard hatte schnell gemerkt, daß er ein Radikaler war – etwas, womit Edouard noch nie zuvor konfrontiert worden war. Nein, mehr noch: Er war vermutlich ein Sozialist!
Seine Unterrichtsstunden waren, gelinde gesagt, unkonventionell. Am ersten Tag hatte er Edouard zwei Bücher in den Schoß geworfen: die Ilias und die Äneis.
»Gut.« Er legte beide Füße auf den Tisch und reckte sich. »Die erste Seite von beiden. Erst lesen. Dann übersetzen.«
Während Edouard sich durch den Text quälte, lehnte sich Hugo Glendinning mit geschlossenen Augen und einem gequälten Zug um den Mund zurück. Als Edouard zögernd innehielt, richtete er sich plötzlich auf.
»Gut. Du bist kein ausgesprochener Schwachkopf, und das ist wenigstens etwas.« Er musterte Edouard aufmerksam. »Es könnte da ein gewisses Aufflackern von Intelligenz geben. Ich selbst war mit neun Jahren wesentlich besser als du. Bist du faul?«
Edouard erwog diese Möglichkeit, die ihm noch niemals zuvor nahegebracht worden war.
»Hoffentlich nicht.« Hugo drückte die eine Zigarette aus und steckte sich die nächste an. »Faulheit ist unendlich langweilig. Etwas, das ich über alles verabscheue. Und nun ...« Unvermittelt beugte er sich vor und fixierte Edouard durchdringend. »Um was geht es bei der Ilias?«
Edouard zögerte. »Es geht um – äh –, na ja, um die Griechen und die Trojaner.«
»Und?«
»Den Trojanischen Krieg.«
»Exakt.« Hugo lächelte. »Krieg. Es ist dir möglicherweise aufgefallen, daß wir gegenwärtig auch im Krieg leben – oder?«
Edouard nahm sich zusammen. »In einem ganz anderen Krieg.«
»Meinst du? Nun ja, wortwörtlich ja; da hast du recht. Homer beschreibt nicht den Einsatz von Panzern und Flugzeugen. Aber Krieg ist Krieg. Töten ist Töten ... Vielleicht, wenn du wirklich versuchst, Homers Versstruktur Geltung zu verschaffen, vielleicht könntest du dann... Nun gut, wir werden sehen...«
Er lehnte sich wieder im Sessel zurück und schloß die Augen. Ohne einen einzigen Blick in das Buch zu werfen, das vor ihm lag, begann er auf griechisch zu rezitieren. Edouard saß ihm schweigend gegenüber.
Anfangs wehrte er sich dagegen. Keiner seiner französischen Lehrer hätte es gewagt, in diesem Ton mit ihm zu sprechen. Er beschloß, sich weder beeindruckt noch interessiert zu zeigen. Allmählich jedoch begann er widerwillig zuzuhören. Und es war seltsam: Diese fließende, leidenschaftslose Sprache unterschied sich völlig von dem trockenen, stockenden Vortrag seines früheren jesuitischen Lehrers.
Er begann, aufmerksamer zuzuhören, und als er in sein eigenes Buch blickte, nahmen die – ihm bereits vertrauten – Worte nach und nach ein ganz neues Leben an. Er sah das Schlachtfeld, sah das Licht auf den Waffen blitzen, hörte die Schreie der Sterbenden. Von diesem Augenblick an war er fasziniert. Zum erstenmal in seinem Leben freute sich Edouard auf den Unterricht und arbeitete auch fleißig dafür. Eines Tages, eines Tages würde er Hugo Glendinning zwingen, ihn zu loben – und wenn er sich umbringen müßte!
Als es später ans Latein ging, schob Hugo Caesars De Bello Gallico beiseite. »Ein guter, klarer, langweiliger Text.« Er schniefte. »Gräben und Wälle. Ich denke, was den Krieg angeht, so werden wir uns an Homer halten. Nun aber – was ist mit der Liebe? Der sexuellen Ausstrahlung? Der Leidenschaft? Dafür dürftest du dich doch wohl interessieren, nicht wahr? Als ich in deinem Alter war, habe ich mich dafür interessiert ...«
»Jetzt nicht mehr?« warf Edouard ein, und Hugo lächelte.
»Möglicherweise. Aber das ist nebensächlich. Wir werden natürlich die Äneis lesen. Aber ich glaube, auch Catull. Hast du schon mal Catull gelesen?«
»Nein.« Edouard empfand eine gewisse Erregung. Soweit es seinen Jesuiten-Lehrer betroffen hatte, stand Catull ganz eindeutig nicht auf dem Stundenplan für vierzehnjährige Jungen.
»Dann wollen wir mal anfangen.« Hugo hielt inne. »Catullus ist ein Intellektueller und Zyniker. Er mokiert sich über die eigene Leidenschaft, akzeptiert jedoch zugleich, daß er ihr Sklave ist. Einige seiner Gedichte lassen sich recht gut mit gewissen Shakespeare-Sonetten vergleichen. In beiden Fällen mögen die beschriebenen Emotionen für einen Jungen schwierig zu verstehen sein. Kannst du dir vorstellen, was ein Mann empfindet, wenn er körperlich und geistig von einer Frau wahrhaft besessen ist? Einer Frau, deren Charakter und Moral er verabscheut?«
Edouard zögerte. Er dachte an seine Eltern und an gewisse Szenen, gewisse Gespräche, die er zufällig gehört hatte.
»Vielleicht«, antwortete er vorsichtig.
»Sexuelle Besessenheit – das ist es natürlich, wovon wir sprechen –, sexuelle Besessenheit scheint mir ein höchst interessanter Zustand zu sein. Weit interessanter als die romantische Liebe, mit der sie oft verwechselt wird. Sie ist ungeheuer mächtig, und sie ist tödlich.« Er lächelte. »Du wirst sie zweifellos auch irgendwann erleben. Und wirst dann, wie wir alle, felsenfest davon überzeugt sein, daß dein Erlebnis einzigartig ist. Das ist es natürlich nicht. Also fangen wir an. Übrigens, wußtest du, daß Catull erst dreißig war, als er starb?«
So ging es weiter. Doch so sehr sich Edouard auch bemühte, es gelang ihm nie, den Verlauf der Lektion des folgenden Tages vorauszusagen. Manchmal jagten sie kreuz und quer durch die Geschichte, übersprangen Jahrhunderte und Kontinente. Die französische, die russische Revolution, der amerikanische Bürgerkrieg. Und dann pflegte Hugo ganz unerwartet zuzuschlagen.
»Was meinst du, um was es bei diesem Bürgerkrieg ging, Edouard?«
»Na ja – um die Befreiung der Sklaven in den Südstaaten.«
»Unsinn! Yankee-Propaganda. Es ging hauptsächlich um kommerzielle Interessen, denn die Nordstaaten waren auf den Reichtum des Südens aus. Er verbesserte das Los der Negersklaven nur nebenbei. Ich nehme an, du bist dir klar darüber, daß ein Schwarzer in den Südstaaten noch immer nicht wählen darf.« Er hielt inne. »Nicht etwa, daß die Engländer Grund zur Überheblichkeit hätten. Nächste Woche werden wir uns mit der beklagenswert langsamen Entwicklung des Stimmrechts in diesem Lande beschäftigen, der Abschaffung des Grundbesitz-Paragraphen, der früher die Interessen der herrschenden Klassen schützte, und der Ausweitung des Frauenwahlrechts.« Er hielt inne. »Findest du das belustigend?«
Edouard zuckte die Schultern. »Über die Suffragetten hab ich schon was gelesen. Aber ich sehe nicht ein, weshalb die Frauen wählen sollten. Papa sagt, er kennt keine einzige Frau, die sich auch nur entfernt für Politik interessiert. Maman geht auch niemals zur Wahl.«
Hugo runzelte die Stirn. »Haben Frauen Verstand?«
»Aber natürlich.«
»Meinst du dann nicht, daß sie ihn auch gebrauchen sollten? Genau wie du den deinen? Fragen muß man. Immer fragen. Und denken ...«
Edouard gab sich Mühe. Es war gut und schön, über Suffragetten und den Verstand der Frauen zu diskutieren, aber es fiel Edouard überaus schwer, ihren Verstand überhaupt in Betracht zu ziehen. Wie konnte man an so etwas denken, wenn die Sinne immer wieder auf ihre schlanken Fesseln, das Rascheln ihrer Unterröcke, die bezaubernde Kurve zwischen ihren Brüsten gelenkt wurden?
Er klappte den Vergil mitten in Didos leidenschaftlichem Bitten an Äneas zu. Verdammt, er konnte sich nicht konzentrieren! Er spürte wieder diese Regung, diese Spannung zwischen den Beinen, und sein Kopf war angefüllt mit wirren, erregenden Bildern: Brüsten und Schenkeln, Kissen und gelöstem Haar, Feuchtigkeit und steigender Lust. Er wußte genau, was er wollte: Er wollte in sein Schlafzimmer hinaufgehen, die Tür verschließen und sich auf diese Bilder konzentrieren, um sich dann langsam, rhythmisch zu schuldbewußter Erlösung zu bringen. Schuldbewußt deshalb, weil er seit langem schon, seit er acht oder neun Jahre alt war, den Lehren der Priester über die Sünde der Selbstbefleckung ausgesetzt gewesen war. Jean-Paul behauptete, das sei alles Unsinn, alle heranwachsenden Jungen onanierten, es sei eine Phase, die man durchmachen müsse. Sobald man dann mit Frauen schlafe, brauche man das nicht mehr so sehr. Edouard war überzeugt, daß sein Bruder recht hatte; und war genauso überzeugt, daß Hugo ihm ebenfalls zustimmen würde. Dennoch schaffte er es nicht, die Warnungen der Priester einfach so in den Wind zu schlagen.
Pater Clément sagte, wenn man diese Sünde nur ein einziges Mal begehe, würden einem Haare auf den Handflächen wachsen. »Sie werden dort sein, mein Kind, wie ein Kainsmal, damit alle Welt es sieht. Vergiß das nicht!«
Verstohlen musterte Edouard seine Handflächen. Bis jetzt wuchsen dort noch keine Haare, doch wenn Pater Clément recht hätte, müßten sie eigentlich zu sehen sein. Also stimmte es vielleicht doch nicht? Pater Clément hatte jedenfalls gesagt, Onanie sei eine Sünde, und Edouard hatte sie bekannt. Diese Beichte war furchtbar peinlich für ihn gewesen.
»Warst du allein, als du dies getan hast, mein Sohn?«
»Ja, Pater.«
»Bist du dessen sicher, mein Sohn?«
»Ja, Pater.«
Edouard war völlig verwirrt. Wer hätte denn wohl bei mir sein sollen, hätte er am liebsten gefragt. Aber er traute sich nicht. Es endete jedesmal mit dreißig ›Gegrüßet seist du, Maria‹ und der Ermahnung, diese Sünde nicht noch einmal zu begehen. Kaum jedoch hatte er den Beichtstuhl verlassen, da spürte er das Verlangen schon wieder, stärker denn je. Er seufzte.
Edouard stand auf und sah auf die Uhr. Dann widmete er sich wieder der Äneis, denn Ablenkung war das beste Gegenmittel. Nachdem fünfzehn aus dem Lateinischen übersetzte Verse ihre Wirkung getan hatten und seine hartnäckige Erektion endlich verschwand, empfand er den Triumph siegreicher Tugend. Wieder sah er auf die Uhr. Kurz vor sechs. Um sechs sollte Jean-Paul nach Hause kommen, und wenn Jean-Paul es nicht vergessen hatte, dann brachte er ihm gute Nachrichten. Wichtige Nachrichten: die wichtigsten, die es für ihn geben konnte. Wäre er jetzt in Paris, hätte Papa diese Aufgabe übernommen, aber so hatte Jean-Paul ihm versprochen, nein geschworen, daß er dafür sorgen werde. Jean-Paul würde an diesem Tag Edouards erste Begegnung mit einer Frau arrangieren.
Seit frühester Kindheit war Jean-Paul für Edouard der wichtigste Mensch im Leben gewesen. Er liebte seinen Papa und bewunderte ihn über alles, der Vater jedoch war zwar stets freundlich, aber eigentlich kaum vorhanden. Als kleines Kind sah er ihn, genauso wie seine Mutter, nur zu festgelegten Zeiten. In St. Cloud wurde er von seinem ältlichen Kindermädchen täglich um Glockenschlag vier aus dem Kinderzimmer in den Salon hinuntergebracht. Dort saß er dann, gab sich Mühe, nicht zu zappeln oder sich allzu bemerkbar zu machen, während seine Eltern sich entweder höflich nach seinem Tagesverlauf oder den Fortschritten seines Unterrichts erkundigten, gelegentlich aber auch ganz vergaßen, daß er überhaupt vorhanden war, und sich ausschließlich miteinander unterhielten.
Um vier Uhr dreißig wurde er ins Kinderzimmer zurückgebracht und gezwungen, eine eklige englische Kindermahlzeit zu essen, denn seine ›Nanny‹ hatte von vornherein klar gemacht, daß ihr Wort hier Gesetz war und das Kind auf angemessene englische Art erzogen werden würde. Gelegentlich, wenn die Nanny einmal in der Woche am Nachmittag frei hatte, schlich er sich heimlich hinunter, und Francine, die Köchin, fütterte ihn mit Leckerbissen, die eigentlich für das Speisezimmer des Barons bestimmt waren.
Aber das waren Ausnahmen. Gewöhnlich wurde er von seiner strengen ›Nanny‹ gefüttert, gebadet und ins Bett gebracht. Ein- oder zweimal pro Woche bequemte sich der Vater oder die Mutter ins Kinderzimmer hinauf, um ihm einen Gutenachtkuß zu geben. Dann funkelte die Mutter vor Juwelen, ihr seidenes Kleid raschelte, sie duftete nach Rosen, und er hörte sie schon lachen, bevor sie überhaupt sein Zimmer betrat. Sie kam nur zu ihm, wenn sie glücklich war, deswegen hatte er das Gefühl, daß sie immer lachte.
Sein Papa duftete nach Eau de Cologne und gelegentlich auch nach Zigarren, und wenn er kam, war es viel schöner, weil er länger blieb als Maman und Edouard ihn manchmal dazu überreden konnte, daß er gewisse Leute nachmachte oder sich mit ihm unterhielt. Der Vater erklärte ihm alles über Trauben und Reben und Weinproduktion: über Diamanten und das Geheimnis ihres Schliffs. Zuweilen, wenn die Mutter Nachmittagsbesuche machte, schickte Papa Nanny fort und holte Edouard zu sich ins Herrenzimmer. Und wenn er guter Laune war, öffnete er dann den Safe und zeigte Edouard Edelsteine, sprach über Fassungen, Design und Qualität. Als Edouard sieben war, erkannte er sogar ohne Lupe auf den ersten Blick, nur indem er ihn gegen das Licht betrachtete, ob ein Diamant makellos war. Doch das waren sehr seltene Gelegenheiten, eingegrenzt von Vorschriften und Regeln. Es war Jean-Paul, der ihm nahe war, Jean-Paul, mit dem er reden konnte.
Eine seiner ersten Erinnerungen an den Bruder war dessen aufregende Heimkehr, als seine école militaire Ferien hatte. Er selbst mußte ungefähr vier oder fünf gewesen sein, der Bruder vierzehn. Er trug die Uniform der Schule, eine Uniform, die sehr schlicht war, auf Edouard jedoch prächtig wirkte. Er lief auf den älteren Bruder zu, Jean-Paul stieß einen Jubelruf aus, schwenkte ihn hoch in die Luft und setzte ihn sich auf die Schultern. Damals hatte Edouard das Gefühl gehabt, sein Bruder sei die Verkörperung all dessen, was ein französischer Gentleman und Soldat sein sollte – ein Gefühl, das er nie wieder verloren hatte.
Er sah gut aus, war aber im Gegensatz zu Edouard kleiner und gedrungener gebaut. Mit seiner hellen Haut, dem dichten, rötlichblonden Haar und Augen, die heller blau waren als die des kleinen Bruders, schlug er nach seinem amerikanischen Großvater und dessen schottischen Vorfahren.
Er war immer und unfehlbar ausgeglichener Stimmung. Nie brauchte Edouard, wie bei seiner Mutter, zu befürchten, daß seine Laune auf einmal umschlug oder daß sein Temperament Funken sprühte. Edouard hatte kaum jemals erlebt, daß Jean-Paul ärgerlich wurde, es sei denn, sein Pferd begann auf der Jagd plötzlich zu lahmen oder er war nicht gut zum Schuß gekommen. Aber selbst dann dauerte sein Ärger nur kurz und war schnell wieder vergessen. Er war auf eine träge Art gutmütig, und das machte ihn sowohl Männern als auch Frauen gegenüber so charmant.
Nichts konnte ihn dazu bewegen, etwas zu tun, was ihn langweilte: Als Junge haßte er die Unterrichtsstunden, las kaum ein Buch und besuchte nie ein ernstes Theaterstück, obwohl er eine Schwäche für Revuetänzerinnen hatte. Er liebte populäre Musik – einfache Melodien, die er pfeifen oder summen konnte; die einzigen Gemälde aus seines Vaters Sammlung, die ihm gefielen, waren die Bilder von Toulouse-Lautrec. Jean-Paul zog Champagner oder Bier den anspruchsvolleren Weinen, Pferde der Kunst, Gewißheit den Fragen vor. Das Schmuckimperium de Chavigny, das er eines Tages erben würde, langweilte ihn nur. Es war recht nützlich, auf familiären Rat zurückgreifen zu können, wenn er einer Frau etwas Hübsches schenken wollte, aber das war auch alles. Vom Preisunterschied abgesehen, vermochte Jean-Paul Granate nicht von Rubinen zu unterscheiden und dachte auch nicht daran, es zu lernen.
Er war in allem immer so sicher! Das war es, was Edouard am meisten an ihm bewunderte. Vielleicht, weil er der ältere, der Erbe war. Jean-Paul war in der Gewißheit aufgewachsen, eines Tages, ohne einen Finger rühren zu müssen, einer der reichsten Männer Europas zu sein. Er würde der Baron werden. Er war in eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Position im Leben hineingeboren worden, und es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, diese Tatsache in Frage zu stellen.
Auch Edouard würde später reich sein, soviel stand fest. Aber er würde nicht den Titel erben und würde, falls er sein Leben nicht verzetteln wollte, irgendeine Funktion für sich finden müssen, nur hatte er nicht die geringste Ahnung, welche. Im Gegensatz zu seinem Bruder, zu Jean-Pauls Unbeirrbarkeit in allen Fragen, von der Politik bis zum Schlafzimmer, kam Edouard sich irgendwie ungefestigt vor, zerrissen von Unsicherheit und Zweifeln. Er wußte, daß er intelligenter war als Jean-Paul. Er wußte, daß er Dinge schneller und präziser erfaßte und begriff, doch diese Fähigkeit erschien ihm wertlos. Jean-Paul machte sich einfach nichts daraus, und war dabei glücklich. Das war die zweite Quelle seines Charmes: die Fähigkeit, sich des Lebens zu freuen, den Augenblick zu genießen und sich niemals Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft zu machen.
Aber Jean-Paul war auch nicht dumm. Alles, was ihn interessierte, beherrschte er vorbildlich. Er hatte schon immer Soldat werden wollen, und seine militärische Führung war erstklassig. Er kannte keine Angst, ob zu Pferde oder auf dem Schlachtfeld. Er war einer der besten Schützen Frankreichs und machte auf dem Tanzboden eine erstaunlich gute Figur. Er konnte seine Offizierskameraden unter den Tisch trinken und hatte trotzdem noch nie unter einem Kater gelitten. Auf Frauen wirkte er unwiderstehlich.
Wie er selbst behauptete, hatte Jean-Paul seine erste Frau mit dreizehn Jahren gehabt: eines der Dienstmädchen im Château an der Loire. Als er dann fünfzehn war, hatte der Vater, wie es in ihren Kreisen üblich war, dafür gesorgt, daß er von einer Französin, die in Paris für ihren Takt in derartigen Angelegenheiten bekannt war, in die Freuden der Liebe eingeweiht wurde.
Jean-Paul hatte dem Vater seine vorangegangenen Erlebnisse verschwiegen, und die fragliche Dame war, laut Jean-Paul, von seinem routinierten Verhalten angenehm überrascht gewesen. Jean-Paul hatte dem neugierigen jüngeren Bruder nur allzu gern erklärt, was von einem Mann verlangt wurde, was er tun mußte und was er dafür von einer Frau erwarten konnte. Seine Schilderungen, in der Kasernensprache formuliert, waren höchst beeindruckend und präzise.
Er brauche es einmal pro Tag, erklärte er lässig, während Edouards Augen sich weiteten. Manchmal auch mehr. Die Tageszeit spiele keine Rolle, obwohl er selbst den Nachmittag bevorzuge, weil man dann am Abend ruhig trinken könne, denn ein Mann, der getrunken habe, sei nicht so gut. Alle Frauen ließen sich gleich gut bumsen: erfahrene, unerfahrene, junge, alte, schöne, häßliche, dünne, dicke.
»Häßliche?« fragte Edouard erstaunt. In seinen Träumen waren die Frauen immer schön.
Jean-Paul zwinkerte ihm zu. »Es ist nett, ein hübsches Gesicht zu küssen, das muß ich zugeben. Aber für das andere ist das Gesicht unwichtig. Denn dabei siehst du ihnen nicht ins Gesicht, kleiner Bruder.«
Was aber war das? In dieser Hinsicht drückte sich Jean-Paul weniger präzise aus. Die Frage schien ihn unsicher zu machen.
Jungfrauen seien im allgemeinen schlecht, antwortete er schließlich. Er rate Edouard, Jungfrauen zu meiden – das heißt, bis auf die spätere Ehefrau natürlich. Bei einer Jungfrau könne Sex schmutzig und unangenehm sein, außerdem seien sie meist nervös, wüßten nicht, was sie tun sollten, und fürchteten, schwanger zu werden, was einfach albern sei. Jungfrauen seien eine Verpflichtung, also müsse man sie meiden.
Verheiratete Frauen seien weit besser. Die meisten von ihnen – vor allem hier in England, bei diesen sexuell so unterbelichteten Männern – seien ganz wild darauf. Die wüßten genau, was sie zu tun hätten, und wann, und könnten unter der Anleitung des Mannes zuweilen überaus phantasievoll werden. Nun beschrieb Jean-Paul einige der reizvolleren Methoden sowie einige seiner erprobten Techniken, und Edouard hörte ihm staunend zu. Jean-Paul versicherte ihm, der Mund einer Frau könne genauso viel Lust bereiten wie ihre Scheide, ja, in manchen Fällen sogar mehr, da gewisse Frauen im wichtigsten Augenblick ein wenig lahm seien.
»Manche können einfach nicht kommen«, erklärte Jean-Paul bereitwillig. »Gott weiß, warum, aber es ist eben so. Doch wenn das ausbleibt, vergiß es, mach einfach weiter, kleiner Bruder. Oder, wenn du das willst, probier’s mit ihrem Mund. Zuerst tun sie alle immer furchtbar entsetzt, behaupten, das könnten sie nicht, weigern sich, und so. Aber das hat nichts zu sagen. Sie finden es trotzdem großartig.«
»Aber wenn ... Ich meine, wenn man das macht ...« Edouard zögerte. »Ich meine, was tun sie, wenn’s rauskommt? Spucken sie’s aus?«
Jean-Paul lachte laut auf. »Manchmal. Wenn sie sich zu fein sind. Die guten schlucken’s runter.«
»Schlucken tun die das?« Edouard starrte den Bruder an. »Schmeckt ihnen das denn?«
»Keine Ahnung.« Jean-Paul zuckte die Schultern. »Darüber mache ich mir in dem Moment keine Gedanken – nie ...«
Und so ging es weiter. Endlos. Diese Position im Vergleich zu jener; die Vorteile des langsamen Bumsens, die gelegentlichen Freuden eines schnellen. Im Liegen; im Stehen; angezogen; ausgezogen; von vorn – die Missionarsstellung, sagte Jean-Paul – oder von hinten, aneinandergeschmiegt wie Löffel in der Schublade. Verhütung; die Nachteile des Gummis, des capote anglaise; der richtige Moment zum Zurückziehen beim Coitus interruptus; und daß man an bestimmten Tagen des weiblichen Monatszyklus’ völlig gefahrlos bumsen könne, ohne eine Schwangerschaft befürchten zu müssen.
Edouard schwirrte der Kopf. Jean-Paul versicherte ihm, im Grunde sei alles furchtbar einfach, und wenn der Augenblick gekommen sei, würde er schon wissen, was zu tun sei. Auf Edouard wirkte es allerdings überhaupt nicht einfach. Er war überzeugt, daß er alles falsch machen werde. Und dann war da noch ein anderer Punkt, der ihm rätselhaft war. Schließlich nahm er all seinen Mut zusammen und fragte den Bruder.
»Was ist denn mit der Liebe, Jean-Paul?«
Jean Paul lachte laut auf. Liebe? Liebe habe damit nichts zu tun. Das sei Lektion Nummer eins, die allerwichtigste. Er legte Edouard den Arm um die Schultern und wurde ernst.
»Wir sprechen über Lust, kleiner Bruder. Über Sex. Nicht über Liebe. Die Liebe läßt du besser aus dem Spiel; die würde dich nur verwirren. Du mußt genau wissen, was du willst. Die Frau schenkt dir Lust, und wenn du Glück hast, schenkst du ihr ebenfalls Lust. Das ist alles. Manchmal magst du sie, ja; mit manchen Frauen kann man sehr gut zusammensein, sie sind charmant, vielleicht sogar intelligent. Manche mag man wiederum nicht, und das ist etwas ganz anderes. Aber Liebe hat damit nichts zu tun. Hör auf mich: Bei dem ersten Anzeichen davon machst du dich aus dem Staub. Die nächste Frau wird dich sehr schnell von dieser Krankheit heilen.«
»Aber wäre es denn nicht besser ...« bohrte Edouard weiter. »Wäre es denn nicht ein schöneres Gefühl, wenn du sie liebst?«
»Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich war noch niemals verliebt.«
»Noch nie? Aber die Menschen verlieben sich doch, nicht wahr? In Büchern. In Gedichten. Papa hat sich auf den ersten Blick in Maman verliebt. Das hat er mir selbst einmal erzählt.«
»Wirklich?« Jean-Pauls Miene verdüsterte sich. »Na ja, es scheint diesen Zustand tatsächlich zu geben. Aber ich traue ihm nicht. Er ist eine Falle. Du wirst feststellen, daß die Frauen ständig darüber reden – weit mehr als die Männer. Und warum? Weil sie unbedingt heiraten wollen. Das gehört zu dem Spiel, das sie treiben. Gibst du zu, daß du sie liebst – bitte, Edouard, tu das niemals! –, erwarten sie sofort einen Heiratsantrag.« Er hielt inne. »Hat Papa das wirklich von Maman gesagt? Hast du dir das nicht ausgedacht?«
Edouard schüttelte den Kopf. Jean-Paul krauste die Stirn. Dies war eine der wenigen Gelegenheiten, da Edouard ihn unsicher erlebte. Und eine der wenigen Gelegenheiten, da er sich vornahm, den Rat des Bruders nicht zu befolgen.
Dieses Gespräch über die Liebe im Gegensatz zum Sex hatte ungefähr drei Jahre zuvor in Frankreich stattgefunden. Es war nicht wiederholt worden. Als Edouard nun draußen Schritte vernahm, das Geräusch der Haustür, die Parsons öffnete, Jean-Pauls tiefe und die helle, klare Stimme einer Frau, mußte Edouard lächeln.
Es hatte sich einiges verändert, in diesen drei Jahren. Jean-Paul hatte sich verlobt. Seine Verlobte war Engländerin, jung und wunderschön. Und Jean-Paul muß inzwischen gemerkt haben, daß er sich geirrt hat, dachte Edouard voller Genugtuung. Er war verlobt. Er war in die Falle gegangen. Und daher mußte Jean-Paul sich doch verliebt haben.