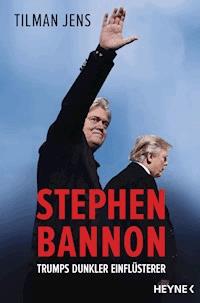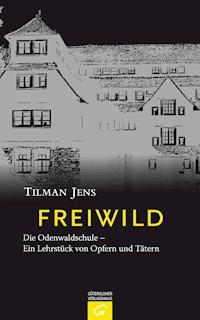15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Mir wird keiner Grenzen setzen, die ich nicht akzeptieren kann.« So beschreibt Tilman Jens, der große Autor, Journalist und Schriftsteller, seine Lebenshaltung. Keiner – das heißt: auch der Diabetes nicht, der Zug um Zug von seinem Körper Besitz ergriff.
Tilman Jens stellt die großen Fragen, wenn er in diesem letzten Dokument seines Schaffens von seinem langsamen Dahinschwinden erzählt: Wie wollen wir unser Leben leben? Gestalten wir es selbst, gehen wir unseren eigenen Weg – oder lassen wir uns von anderen Menschen oder den Umständen vorschreiben, wie wir zu leben haben?
Wollen wir frei und selbstbestimmt leben, auch wenn es mitunter schwierig und schmerzhaft ist – oder passen wir uns an?
Und wie soll unser Sterben und Tod sein? Erleiden wir unser Ende – oder nehmen wir es selbst in die Hand?
Tilman Jens hat auf diese Fragen so klar und deutlich geantwortet, wie es nur irgend möglich ist: Mit seinem eigenen Tod hat er ein letztes Statement gesetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
»Mir wird keiner Grenzen setzen, die ich nicht akzeptieren kann.« So beschreibt Tilman Jens, der große Autor, Journalist und Schriftsteller, seine Lebenshaltung. Keiner – das heißt: auch der Diabetes nicht, der Zug um Zug von seinem Körper Besitz ergriff.
Tilman Jens stellt die großen Fragen, wenn er in diesem letzten Dokument seines Schaffens von seinem langsamen Dahinschwinden erzählt: Wie wollen wir unser Leben leben? Gestalten wir es selbst, gehen wir unseren eigenen Weg – oder lassen wir uns von anderen Menschen oder den Umständen vorschreiben, wie wir zu leben haben?
Wollen wir frei und selbstbestimmt leben, auch wenn es mitunter schwierig und schmerzhaft ist – oder passen wir uns an?
Und wie soll unser Sterben und Tod sein? Erleiden wir unser Ende – oder nehmen wir es selbst in die Hand?
Tilman Jens hat auf diese Fragen so klar und deutlich geantwortet, wie es nur irgend möglich ist: Mit seinem eigenen Tod hat er ein letztes Statement gesetzt.
Zum Autor
Tilman Jens (1954–2020) lebte als Journalist zuletzt in Leipzig. Er brach Tabus und sprach, filmte und schrieb mutig darüber, was ihm wichtig war. Als freier Autor und Filmemacher arbeitete er unter anderem für die ARD, Arte und 3Sat. Insgesamt veröffentlichte Tilman Jens elf Bücher. In den Medien breit diskutiert wurde sein Buch über die Erkrankung seines Vaters Walter Jens:Demenz. Abschied von meinem Vater (2009). Als Antwort auf diese leidenschaftliche Debatte veröffentlichte er 2010 Vatermord – wider einen Generalverdacht. 2011 folgte Freiwild. Die Odenwaldschule – Ein Lehrstück von Opfern und Tätern, eine Rückschau auf Jens’ Jahre in einem skandalumwitterten Internat; 2013 die Streitschrift Der Sündenfall des Rechtsstaats. 2014 erschien zusammen mit Heribert Schwan Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle. 2015 mit Du sollst sterben dürfen ein Buch zur Patientenverfügung und 2017 Stephen Bannon. Trumps dunkler Einflüsterer.
TILMAN JENS
Die
Freiheit
zu leben
und
zu sterben
EINBEKENNTNIS
Wenn Sie selbst sich in einer akuten Krise befinden oder einen gefährdeten Menschen kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten, die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter 112. Sie erreichen die Telefonseelsorge rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222
(Telefonseelsorge Österreich: 142/Schweiz: 143).
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 06/2021
Copyright © 2021 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-22346-5V001
www.Ludwig-Verlag.de
Inhalt
Vorbemerkung
von Heribert Schwan
Untergehen gilt nicht
Vorwort von Tilman Jens
01
Der Bescheid
02
In der Risikogruppe
03
Die Diagnose
04
Ursachenforschung: Das Problem bin ich
05
Der halbe Mann
06
Endzeitstimmung: Mein Diabetes in den Zeiten von Corona
Statt einer Erklärung: »Du sollst sterben dürfen«
Vortrag von 2015
Die letzten Monate, Wochen, Tage
Nachwort von Heribert Schwan
Für den Hurrikan
Eine Erinnerung von Matthias Jim Günther
Quellennachweis
Zu den Autoren
Vorbemerkung
von Heribert Schwan
Vor uns liegt das letzte Projekt von Tilman Jens: Ein Buch über Diabetes sollte es werden, über seinen Diabetes Typ 2. Genauso ehrlich und rückhaltlos sollte es werden wie Demenz, das 2009 veröffentlichte Buch über den Abschied von seinem Vater Walter Jens – nur dass sein unerbittlich genauer Blick diesmal ihm selbst, dem eigenen Leben galt. Und so geriet es ihm unter der Hand zu mehr als dem geplanten Buch über seinen Diabetes, es wurde umfassender, autobiographisch. Es geht ums Leben, unterhaltsam, knapp und aufrichtig erzählt, sein ganzes Leben.
Zu großen Teilen hat Tilman Jens dieses Buch geschrieben, fünf von den geplanten sechs Kapiteln liegen vor. Es blieb unvollendet. Am 29. Juli 2020 hat er seinem Leben ein Ende gesetzt.
Wir lesen das Buch von diesem Ende her und begreifen: Tilman Jens erzählt von einem angekündigten Tod, von seinem Tod. Von der ersten bis zur letzten Seite geht es ums Sterben, um das unausweichliche Ende und wie damit umzugehen sei.
Hier spricht ein großer Autor, Journalist und Schriftsteller von einem Thema, das uns alle in der einen oder anderen Form bewegt: Wie wollen wir unser Leben leben? Gestalten wir es selbst, gehen wir unseren eigenen Weg – oder lassen wir uns von anderen Menschen oder von den Umständen vorschreiben, wie wir zu leben haben?
Wollen wir frei und selbstbestimmt leben, auch wenn es mitunter schwierig und schmerzhaft ist, oder passen wir uns an?
Und wie soll unser Sterben und Tod sein? Erleiden wir unser Ende – oder nehmen wir es selbst in die Hand?
Das sind die Fragen, die dieses letzte Buch von Tilman Jens durchziehen, es sind die Fragen, die im Zentrum der Debatte über das Recht auf einen selbstbestimmten Tod stehen. Mit seiner Entscheidung hat Tilman Jens auf diese Fragen so klar und deutlich geantwortet, wie es nur irgend möglich ist.
*
Untergehen gilt nicht
Vorwort von Tilman Jens
Ich bin einer von geschätzt über sieben Millionen Bundesbürgern, deren Zuckerstoffwechsel nicht mehr funktioniert. Ich weiß seit Jahrzehnten um den Befund und habe alles darangesetzt, die gravierenden Folgen der Diagnose zu verdrängen. Mein Körper gleicht einer Großbaustelle. Die Leistungskraft des Herzens nimmt ab, Augen und Ohren werden schwächer. Der Muskelabbau hat dramatische Züge angenommen, was vermutlich Folge eines neuen Diabetesmedikamentes ist.
Beide großen Zehen wurden mir wegen Durchblutungsstörungen amputiert. Ich muss damit rechnen, irgendwann ist der Vorderfuß dran. Dann werde ich ohne Prothese nicht mehr laufen können und meine Wohnung im dritten Stock kaum noch erreichen. Ich habe Angst vor Demenz, ich habe Angst davor, nicht mehr arbeiten zu können.
Ich will darüber nachdenken, wie ich mir diese Krankheit zugezogen habe. Was ich hätte verhindern können, verhindern müssen. So präzise wie irgend möglich werde ich von den Stationen ausgeschlagener Therapieangebote erzählen. An Chancen hat es nicht gefehlt. Mehr als zehnmal war ich in unterschiedlichen Kliniken und Sanatorien.
Der Weg von meiner frühen Begeisterung fürs Journalistenleben bis zum Verkennen meiner fatalen Krankheit scheint weit – ist es freilich nicht. Mich faszinierten Geschichten, die Probleme des Alltags schob ich beiseite und delegierte sie gern. Um Altersvorsorge habe ich mich nie ernsthaft gekümmert und in vollen Zügen aus dem Augenblick gelebt.
Was ich protokollieren möchte: Meine irreversible, über kurz oder lang todbringende Krankheit ist untrennbar mit meinem rastlosen Freiberuflerdasein verbunden, das ich über Jahrzehnte hinweg als schieres Glück, als vornehmliches Lebenselixier empfand. Der Beruf: ein Abenteuerspielplatz und ein Reservat von Widerständigkeiten zugleich. Ich habe in bald einem halben Jahrhundert so manchen Mächtigen, allzu Selbstgewissen in Kultur und Medien, in Staat und Kirche bekennend geärgert. Nicht selten habe ich kräftig Prügel dafür bezogen.
Ich habe, stets auf der kompromisslosen Suche nach einem neuen Arbeitsabenteuer, Freundschaften verkommen lassen, Vorgesetzte, auch solche, die es gut mit mir meinten, mit meiner gelegentlich wenig diplomatischen Art, meiner Lust an der Fehde für immer vergrätzt. Treu geblieben bin ich in der Rückschau nur meinem Beruf. Für ihn habe ich sehenden Auges, bewusst, meine Gesundheit, meine Existenz aufs Spiel gesetzt.
Nein, ich hadere nicht, aber ich habe vieles kaputtgeschlagen und alles, was meinem Erkundungswahn im Wege stand, ohne Rücksicht auf Verluste wie ein Bulldozer beiseite geräumt. Gelegentliche Ängste und Selbstzweifel habe ich mit viel gutem Essen und gehörigen Mengen Alkohol kompensiert. Hedonismus als Variante des Verdrängens. Für meine sich langsam ausbreitende Krankheit war in meinem Leben kein Platz. Ich habe nicht über den Tellerrand geschaut – und bin mir am Ende selbst abhandengekommen – aber: Schön, turbulent und aufregend war es doch! Das faszinierende Bild von der Kerze, die an beiden Enden brennt … Reue empfinde ich nicht, ganz im Gegenteil – auch wenn das Ende vermutlich bitter sein wird und mir in der konkreten Vorstellung Angst macht.
Mein Lebensplan war eindeutig: Arbeiten, solange es irgend geht. Und wenn dann die Kräfte eines Tages nicht mehr reichen, in Dankbarkeit und mit Trotz aus dem Leben scheiden: Schlaftabletten, eine Flasche Wodka und eine übergestülpte Plastiktüte. Hemingway hat’s auf seine Weise vorgemacht. The party is over. Nach mir die Sintflut!
Tilman Jens
Sarajevo, im August 2019
01
Der Bescheid
Das Todesurteil kam an einem Montag im März 2019 und war von letzter Instanz gefällt. Aktenzeichen 54353855-8. Eine Revision sei nicht möglich. Zwei Vorstandsmitglieder der bald hundertjährigen Raiffeisen- und Volksbanken-Versicherung in Wiesbaden hatten die Daumen gesenkt. Nein, man werde mir keine Kreditbürgschafts-Police für den Fall meines Ablebens mehr ausstellen. Einer wie ich sei der Gemeinschaft der Versicherten nicht zuzumuten. Zu fortgeschritten seien die Folgeschäden meiner Diabetes-Typ-2-Erkrankung: die im Fragebogen von mir bereitwillig eingeräumte Lungenembolie, die zwei Großzehamputationen, die zunehmend manifesten Durchblutungsstörungen. Nach statistischer Wahrscheinlichkeit werde mich der Tod vor der vollständigen Rückzahlung meines Darlehens in fünf Jahren ereilen.
Das Unternehmen bat um Verständnis und kündigte an, den Vorgang zu den Akten zu nehmen. »Im Antrag haben Sie eingewilligt, dass die R+V Ihre Gesundheitsdaten drei Jahre speichern darf, auch wenn kein Vertrag zustande kommt.« Der Bescheid, der mir mit wenigen Textbausteinen recht unverbrämt den unerbittlich nahenden Tod prognostizierte, zeichnete sich nicht eben durch Feinfühligkeit aus und zerrte mir mit geballter Wucht den Spiegel vor Augen. Zunächst war ich empört. Dann kam der große Katzenjammer.
Schon Ende der Achtzigerjahre hatte mich meine damalige Hausärztin, zur Mäßigung in den Alltagsgewohnheiten mahnend, auf meinen wenn auch damals nur gelegentlich erhöhten Blutzuckerspiegel hingewiesen. Ich habe den vorsichtigen Weckruf überhört. Zehn Jahre später war der Befund manifest: Ich bin zuckerkrank. Seitdem habe ich alles darangesetzt, die absehbaren Folgen beiseite zu drängen, auch den mir bekannten Umstand, dass die Lebenserwartung eines Diabeteskranken um mehr als fünf Jahre unter dem Durchschnitt liegt. Die Forschung nennt das »diabetesbedingte Sterblichkeit«. Aber was sind schon fünf Jahre für einen, der damals noch nicht einmal fünfundvierzig war! Mein Großvater ist vierundneunzig geworden. Dann werde ich eben nur neunundachtzig. Die Vorstellung, eines Tages alt und grau zu werden, schien mir ohnehin ein Greuel.
Warum also mein geliebtes, rastloses und so genussreich ungesundes Dasein als Reporter gegen einen geregelten Job, etwa den eines Sitzredakteurs in einer Sendeanstalt, tauschen? Ich bin selbständig aus Passion. Mein Appetit aufs Reisen, meine Gier auf immer neue Abenteuer hat früh begonnen. Als Vierzehnjähriger bin ich das erste Mal getrampt: von Tübingen nach Hamburg, mit schriftlicher Genehmigung meiner Eltern. Nur alle fünf Stunden, das war die Abmachung, hatte ich mich, mit Groschen versorgt, von einer Autobahntelefonzelle aus zu melden. So bin ich über Jahre per Anhalter gereist, habe viele spannende Menschen getroffen und hatte mir geschworen, eines Tages einen Tramper-Atlas zu verfassen, der Hotspots und die Plätze des endlosen Wartens gegeneinanderstellen sollte. Am ärgsten, ich entsinne mich genau, war die Auffahrt in Bad Hersfeld-Aua. Auch wenn das Werk nie Gestalt annehmen sollte: Meine Eltern hielten es für pädagogisch angezeigt, den Freiheitsdrang ihres ältesten Sohnes nicht zu stoppen.
Ich habe früh mein Lebensmuster gefunden. Jede Form der Einschränkung, ob nun bei der Arbeit, beim Trinken oder Schlemmen, die mir wohlmeinende Ärzte zunehmend nahelegten, widersprach meinem Naturell. Einen gewissen Mangel an Weitsicht kann ich nicht leugnen. Maß- und Diät halten mögen bittschön andere.
Was mein Krankheitsbild angeht, scheine ich ins Raster zu passen. Viele meiner Leidensgenossen mit Diabetes Typ 2 – bei denen die Störung des Zuckerstoffwechsels keine angeborene Autoimmunerkrankung ist und die Insulinproduktion noch in Ansätzen, wenn auch stark reduziert, funktioniert – haben den Ausbruch ihrer Krankheit durch einen, ein wenig altmodisch gesagt, ausschweifenden Lebenswandel selber verursacht. Der bayerische Arzt und Mitbegründer des modernen Klinikwesens Friedrich von Müller fällte schon 1928 ein recht sarkastisches Urteil: »Meine Diabetiker aus wohlhabenden Kreisen (und Diabetes ist vorwiegend eine Krankheit der reichen Klassen) haben sich durch die Bank als außergewöhnlich geschickte Hamster entpuppt.« Ich fühle mich ertappt, auch wenn ich schon lang nicht mehr wohlhabend bin.
Die dreistelligen Ziffern auf dem allenfalls sporadisch zu Rat gezogenen Glukosemessgerät begriff ich als Chiffren sinnloser Selbstbespiegelung. Fieber schmerzt bis in die Knochen. Eine Erkältung setzt dich schachmatt. Aber ob der Zuckeranteil im Blut nun 100, 205 oder 312 Milligramm pro Deziliter beträgt, ändert zunächst einmal nichts am gefühlten Wohlbefinden. Das dauerhafte In-die-Fingerbeere-Stechen, um gelegentlich erst im zweiten Anlauf einen Blutstropfen herauszuquetschen, hinterließ zudem Knötchen und Narben, die das Tippen am Laptop erschwerten. Jeder Buchstabe ein kleiner Schmerz. Unblutige Verfahren mithilfe eines sogar von der Kasse erstatteten Sensors gibt es erst seit wenigen Jahren. Seitdem messe ich regelmäßiger, zumindest morgens und abends, und spritze mir die zur Regulierung erforderlichen Insulineinheiten in die Bauchdecke. Eigentlich ganz einfach.
Aber wenn der Doc einmal im Quartal mit kriminalistischem Spürsinn den HbA1c-Langzeitwert, den Blutzuckeranteil der letzten acht Wochen ermittelt, dann steht da dennoch oft ein in meinen Augen lästig moralisierendes Sündenregister. 8,4 Prozent! Ich habe also wieder einmal über die Stränge geschlagen, verdrängt, dass ich krank bin. Das Resultat ist Selbstbeknirschung für ein paar Tage. Dann geht es bald im alten Trott weiter. Ein wenig habe ich mich gebessert. Aber im Unterbewussten schlummert die alte Maxime noch immer: Ich lebe selbstbestimmt. Ich werde mich nicht dem Diktat der Broteinheiten beugen, nicht vor jeder Mahlzeit erst einmal rechnen und spritzen, fortdauernd an die Mitnahme von Kanülen oder des digitalen Auslesegeräts denken. Ich bin kein Kontrolleur meiner selbst. Basta! Lebensfreude und Buchhaltung: Geht das zusammen? – Wenn es bedrohlich wird, werden es Ärzte und Medikamente schon richten.
So habe ich mit Wonnen Raubbau getrieben, meine Vielbeschäftigung vorschützend auf sportliche Betätigung verzichtet, stattdessen so viel Arbeit in mich hineingeschaufelt, wie es nur immer ging. Und mich, bevorzugt wenn ich auf Reisen war, am späten Abend mit Teigwaren und Rahmsoßen belohnt, begleitet oft von reichlich gutem Wein. Um Salat oder Gedünstetes machte ich weite Bögen. In meinen ärgsten Zeiten brachte ich trotzig angefressene hundertachtzehn Kilo auf die Waage. Ich war hemmungslos dick. »Du siehst aus wie Helmut Kohl«, hat mir meine frühere Freundin Beate im Hallenbad auf dem Tübinger Waldhäuser einmal an den Kopf geworfen.
Übergewicht ist bekanntlich ein entscheidendes Merkmal, das den Diabetes befördert. Aber sollen sie doch reden, die sauertöpfischen Freunde und Weißkittel: Das bisschen Kranksein, da war ich sicher, haut mich nicht um. Ich bin schließlich nur einer von rund sieben Millionen Bundesbürgern, deren Zuckerstoffwechsel nicht mehr funktionieren will, bei denen die Langerhans-Inseln in der Bauchspeicheldrüse nicht mehr ausreichend Insulin produzieren und ausschütten.
Wir liegen im europäischen Ranking weit vorn, auf Rang zwei, knapp hinter der Russischen Föderation. Sieben bis acht Prozent aller Deutschen haben mit der langsam vorwärtsschleichenden Krankheit zu kämpfen. Die achte Ausgabe des IDF Diabetes Atlas (Jahrgang 2017) beziffert die Kosten für den Kampf gegen den Zucker hierzulande auf umgerechnet fünfunddreißig Milliarden Euro, jährlich. Das ist einsamer Rekord in Europa. Die Krankenkassen wenden rund zwanzig Prozent ihrer Ausgaben für Schäden auf, die der Diabetes mellitus anrichtet. Ich trage seit geraumer Zeit das Meine zu dieser Statistik bei, obwohl ich Süßes seit Kindheit nur in Maßen konsumiert habe. Doch die Leber zerlegt, dem Himmel sei’s geklagt, auch Kohlenhydrate in Glukose.
Auf den gern herbeizitierten Fluch der Genetik kann ich nichts abwälzen. Seit Generationen sind in meiner Familie keine vergleichbaren Fälle bekannt. Das Gros der Vorfahren – viele wurden weit über neunzig – war rank und bis ins Alter kerngesund. Meine Mutter und ihre drei Geschwister leben – Stand 31. Dezember 2019 – bis heute. Auch das Demenz-Siechtum meines Vaters begann erst deutlich nach dem achtzigsten Lebensjahr. Seine Glukose-Werte waren gut bis zuletzt.
Kurzum, ich hab’s selber verbockt. Kein anderer sonst. Nun ist es vermutlich zu spät. Als ich meinen Frankfurter Arzt des Vertrauens frage, wieviel Zeit mir noch bleibt, antwortet der Emeritus aus Sachsenhausen salomonisch: »Möglicherweise nicht mehr sehr viel.« Die systematische, fahrlässig in Kauf genommene Verwüstung der Physis lässt sich nicht mehr leugnen.
Mein Körper, mittlerweile immerhin mager, ist zur Großbaustelle geworden. All die verfluchten Folgeerkrankungen! Die Leistungsfähigkeit des Herzens nimmt ab, Augen und Ohren werden schwächer. Die Hauptschlagader ist angegriffen. Die Füße, zu wenig durchblutet, sind kalt, die Sohlen sind taub oder zumindest pelzig, eine Folge der Polyneuropathien, der unumkehrbaren Nervenschädigungen in den Beinen, die gut einem Drittel aller Diabetiker zu schaffen machen. Ich taumele oft mehr als dass ich kontrolliert einen Schritt vor den anderen setze. Immerhin tröstet mich die Bewegungs-App auf meinem Smartphone: Täglich sieben oder acht Kilometer Fußstrecke schaffe ich – noch. Aber wenn ich stürze, kann ich mich schon heute kaum ohne Stütze aufrichten.
Der Muskelabbau in den Beinen hat dramatische Ausmaße angenommen, was vermutlich Folge eines neuen, wenngleich wirkungsvollen Medikaments ist. Treppen ohne Geländer sind ein Problem. Im Bus auf dem Weg vom Terminal zum Flugzeug bieten mir rüstigere Mitreisende ihren Sitzplatz an. Schon seit geraumer Zeit setze ich mich nicht mehr zu Tisch, sondern lasse mich recht ungelenk auf den Stuhl plumpsen. Und nachts setzt bisweilen, wenn auch nur für Sekunden, die Atmung aus. Ich erwache in Panik. Auch die Schlafapnoe ist eine typische Begleiterscheinung des Diabetes. Sie reduziert, statistisch gesehen, die Lebenserwartung erheblich. Wissenschaftler des Düsseldorfer Leibniz-Zentrums für Diabetesforschung fanden 2017 heraus, dass über 20 Prozent aller Todesfälle in Deutschland auf Diabetes zurückzuführen sind.
Der Küchenschrank in meiner Wohnung gleicht einer Privatapotheke. Insulin, Nadeln und Sensoren, Pflegelotion für die geschundenen Füße, acht verschiedene Tabletten täglich. Balsam gegen den vor allem in den Wintermonaten auftretenden Juckreiz am Rücken und an den nächtens im Tiefschlaf blutig aufgekratzten Beinen. Der Entzündungsschmerz in der linken Schulter, die »Frozen Shoulder«, ließ sich über Wochen nur mit der Dauergabe von Ibuprofen betäuben. Vermutlich stünde mir ein Schwerbehindertenausweis zu. Aber den zu beantragen fiele dem Ego schwer. Ich lasse mich für eine bescheidene Erhöhung des Steuerfreibetrags nicht mit Amtssiegel zum Krüppel schlagen. Der alte Freigeist lodert auf: Mit fünfundsechzig Jahren helfen mir fünf Tage bezahlter Zusatzurlaub ohnehin nichts mehr. Ich habe beschlossen, solange es geht auf meine Art gegen all die lästigen Ausformungen der Zuckerkrankheit anzukämpfen, am Schreibtisch, vor allem aber als Fernsehreporter vor Ort.
Im Schnitt rund hundertfünfzig Tage, oft mehr als zweihunderttausend Kilometer auf Achse im Jahr. Die Bandbreite der Aufträge war immens. Als Berichterstatter mit Minensuchtrupps unterwegs auf den Falkland-Inseln, beim Weihnachtsgottesdienst auf Hallig Hooge, unter christlichen Fundamentalisten in Schwaben, eingekesselt von einer Bürgerwehr im thüringischen Bornhagen, als das »Zentrum für politische Schönheit« Björn Höcke in einer genialen Aktion ein kleines Holocaust-Stelenfeld vor die Nase setzte. Erschrockener Zeuge der AfD-Aufmärsche in Chemnitz. An Bord eines Binnenschiffer-Kahns, der sich in nervenaufreibender Monotonie von Duisburg über Datteln bis nach Berlin schleppte. Inmitten von Scientologen in Florida. Unter orthodoxen Juden in Tel Aviv, denen ihr Glaube verbietet, sich zur Begrüßung die Hand zu geben. In La Valletta, in Moskau oder Bratislava auf den Spuren ermordeter Journalistenkollegen. Im September 2001 in New York, Tage nach dem Anschlag vor den noch dampfenden Trümmern des World Trade Centers. Im Cockpit eines Löschflugzeugs über kalifornischen Waldbrandgebieten.
Nur: Dies Leben auf Abruf bedeutete Termindruck als Dauerzustand, rund um die Uhr Stress. Und der hebt nun einmal den Blutzuckerspiegel an und ist, wie etwa eine Studie finnischer Wissenschaftler mit über hunderttausend Probanden belegt, ein signifikanter diabetischer Risikofaktor. Der mich freilich nicht weiter kümmerte, die Verlockungen des Berufs waren einfach zu groß. Im togolesischen Lomé erlebte ich im von Untergrundkämpfern gebrandschatzten Goethe-Institut, wie gefährlich deutsche Kulturarbeit in Krisengebieten sein kann. Im Zuge der weltweiten Recherche bin ich wahren Helden begegnet, Institutsleitern und -leiterinnen unter totalitären Regimen, etwa in Weißrussland, und autoritären Systemen, die unterdrückte Künstler und Literaten hilfreich vernetzten. Am eindrücklichsten war die kugelrunde Leiterin des Goethe-Lesesaals im kirgisischen Bischkek. Die Stadt lag 2005 nach bürgerkriegsähnlichen Aufständen zu weiten Teilen in Trümmern. Straßenbarrikaden, die Schaufensterauslagen geplündert. Allein die Bibliothekarin schien durch nichts zu erschüttern: »Und wenn sie draußen Bomben werfen, wir haben von Montag bis Freitag, von zehn bis siebzehn Uhr geöffnet.«
Gelegentlich allerdings ging es auch beschaulicher zu: Einen verregneten Sommer lang mit dem polnischen Kurorchester auf Norderney. Im hessischen Bad Salzhausen an der Seite von chinesischen Investoren, die mit dem wahnwitzigen, alsbald scheiternden Versprechen antraten, den maroden Erholungsort an der Nidda zur Gesundheitsoase für fernöstliche Touristen umzubauen. Astrid Lindgren, die Autorin, mit der ich das Lesen erlernte, führte mich, im Tiefschnee stapfend, durch die Bullerbü-Heimat ihrer Kindheit im südschwedischen Vimmerby. Ein sympathischer Gangster, der Kaufhaus-Erpresser »Dagobert«, zeigte mir die Tatorte seiner einstigen Untaten in Berlin.
Den Neutöner Mauricio Kagel durfte ich 2006, zwei Jahre vor seinem Tod, auf seiner triumphalen Rückkehr ans Teatro Colón in Buenos Aires begleiten, das ihn knapp ein halbes Jahrhundert zuvor so schnöde verstoßen hatte. Peter Sodann, der Tatort-Kommissar a.D., der ewig grantelnde Klassenkämpfer, führte mich im sächsischen Staucha durch seine Monumentalbibliothek geretteter DDR-Hinterlassenschaften. Alexander Gauland lernte ich 2002 kennen, als er noch kein Rechtsaußen, sondern ein besonnener Frankfurter CDU-Mann war, ein konservativ aufgeschlossener Denker. Und während einer Reportage unter Bettlern in der Expo-Stadt Hannover erklärte mir Günther, den seine Mit-Obdachlosen den Philosophen nannten, was er unter Ehre versteht: »Solange ich beim Betteln stehen kann. Aber wenn ich sitzen und zu den Passanten aufschauen müsste, dann wäre es vorbei.« Das sind Lektionen fü