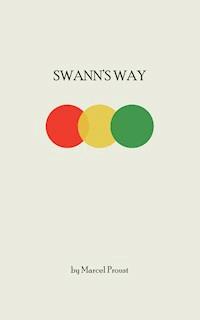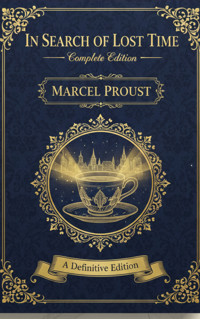23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die hier erstmals übersetzten fünfundsiebzig handschriftlichen Bögen von Marcel Proust sind die Keimzelle seines siebenbändigen Romanwerks Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (À la recherche du temps perdu). Man wusste, dass es sie gibt, aber sie waren verschollen. 2018 im Nachlass des Proust-Forschers und Verlegers Bernard de Fallois endlich gefunden, erschienen sie 2021 bei Gallimard: eine Sensation.
Wir begegnen vielen aus der Lektüre der Recherche bekannten Figuren und Szenen, hier noch belassen in der Ursprünglichkeit früher Erinnerung: an die geliebte Mutter, das Kindheitsdrama des Zubettgehens, die jungen Mädchen am Strand. Proust ist erkennbar noch auf der Suche: nach den literarischen Mitteln, sein Leben zu erzählen, sein unendliches autobiographisches Material zu organisieren. Bei aller sprachlichen Meisterschaft liegt der Reiz dieser Texte auch in ihrer Unmittelbarkeit, ihrem bekenntnishaften Ton. Erst später gelingt Proust dann der letzte und entscheidende Schritt: das Erinnern selbst zum Gegenstand des Erzählens zu machen.
Sich dieser Urzelle der Recherche anzunähern bedeutet, Prousts lebenslanger Erinnerungs- und Schreibarbeit und damit dem Geheimnis des Romans auf die Spur zu kommen.
Die deutsche Ausgabe erscheint in besonderer Ausstattung in der Übersetzung von Andrea Spingler und Jürgen Ritte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Titel
Marcel Proust
Die fünfundsiebzig Blätter
und andere Manuskripte aus dem Nachlass
Herausgegeben von Nathalie Mauriac Dyer
Mit einem Vorwort von Jean-Yves Tadié
Aus dem Französischen von Andrea Spingler und Jürgen Ritte
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Titel der Originalausgabe: Les soixante-quinze feuillets et autres manuscripts inédits.Die Übersetzung und Edition der vorliegenden Ausgabe wurde von der Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung gefördert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2023.
Erste Auflage 2023Deutsche Erstausgabe
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Schimmelpenninck.Gestaltung, Berlin
eISBN 978-3-518-77401-4
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Der heilige Augenblick
Zu dieser Ausgabe
Das Manuskript
Prinzipien der Texterstellung
Abkürzungen und Siglen
Editorische Notiz zur deutschen Ausgabe
Die fünfundsiebzig Blätter
Ein Abend auf dem Land
Die Seite von Villebon und die Seite von Meséglise
Aufenthalt am Meer
Junge Mädchen
Adelsnamen
Venedig
Andere Manuskripte
Nachwort »Hier beginnt die Suche nach der verlorenen Zeit«
Von Nathalie Mauriac Dyer
Adèle, Jeanne, Marcel
Die drei Metamorphosen des Onkels Louis
Ein jüdisches Familiengedächtnis
Auf »Seiten« des Vaters
Spuren und Reminiszenzen
Geranien und Orangenblüten
Nach Sodom, aber auf Seitenwegen
Chronologie
Literatur
Verwendete französische Ausgaben von Werken, Briefen und Manuskripten Marcel Prousts, mit Siglen, falls erwähnt oder zitiert
Verwendete deutsche Ausgaben der Werke und Briefe Marcel Prousts
Manuskripte
Werke und Aufsätze
Biographien, Dokumentationen
Sekundärliteratur zum Werk allgemein (Auswahl)
Sekundärliteratur zur Entstehung des Werks
Konkordanz
Fußnoten
Informationen zum Buch
1949 betraute Suzy Mante-Proust Bernard de Fallois mit der Sichtung des Manuskriptkonvoluts, das sie 1935 von ihrem Vater Dr. Robert Proust, dem jüngeren Bruder Marcel Prousts, geerbt, hatte, nachdem es ihm selbst nach dessen Tod 1922 zugefallen war.
Bernard de Fallois stellte aus dem Material zwei Editionen zusammen (Jean Santeuil, 1952; Contre Sainte-Beuve, 1954) und begann eine Dissertation, die er aber aufgab. Bei seinem Tod wurde an seinem Wohnsitz ein Proust-Archiv – in unserer Ausgabe als Fallois-Archiv bezeichnet – entdeckt, insbesondere die »Fünfundsiebzig Blätter«, das älteste Manuskript von À la recherche du temps perdu, von dessen Existenz er im Vorwort zu seiner Edition von Contre Sainte-Beuve[1] als Erster gesprochen hatte.
Den Schatz der »Fünfundsiebzig Blätter« hütet nun die Bibliothèque nationale de France.
Der heilige Augenblick
Hier sind sie also, diese so lange verborgenen, so lange erwarteten und legendär gewordenen fünfundsiebzig Blätter! In Le Peuple hat Michelet bedauert, dass große Geister die Spuren ihrer Schöpferkraft oft verwischt haben: »Selten behalten sie die Reihe der vorbereitenden Entwürfe«[2] . Der Historiker versucht, den einzigartigen Augenblick der Erfindung zu erfassen, er möchte begreifen, welches der heilige Augenblick war, in dem das große Werk zum ersten Mal aufblitzte. Wir nähern uns hier diesem »heiligen Augenblick«. Das Besondere an diesen Seiten des zukünftigen Buches ist, dass sie die ersten sind, die geschrieben wurden, obwohl sie als letzte auf uns gekommen sind. Als die Herausgeber der Pléiade und die Forscher des ITEM-CNRS (Institut des textes et manuscrits modernes) sich bemühten, die Geschichte des Proust'schen Textes durch seine materiellen Schichten hindurch nachzuzeichnen, fehlte ihnen diese erste Stufe. Sie waren wie Archäologen, die unter der gothischen Kathedrale eine kleine merowingische oder romanische Kirche suchen.
Der erste Verleger von Jean Santeuil und Contre Sainte-Beuve hatte auf die Existenz dieser Seiten hingewiesen. Er bezog sich auf die Liste der »pages écrites« im ersten der Carnets, das Proust 1908 benutzte, insbesondere um Kapitelanfänge zu skizzieren, eine Liste, die den Inhalt dieser Blätter nicht genau abdeckt. Sie beschrieb nur eine Etappe. Tatsächlich befinden wir uns am Ende des Jahres 1907 oder im ersten Halbjahr 1908. Proust hat seit 1899, als er Jean Santeuil endgültig aufgab, an keinem Romanprojekt mehr gearbeitet. Er durchlebte damals ein Tief. Nur zwei Ruskin-Übersetzungen und das Vorwort dazu beschäftigen ihn bis 1905. Ein weißes Jahr, nach dem Tod seiner Mutter, oder ein schwarzes (obwohl sein Freund René Peter in Une saison avec Marcel Proust behauptet, ihn im Herbst 1906 in Versailles unablässig schreiben gesehen zu haben), in dem allerdings seine Ruskin-Übersetzung Sesam und Lilien und ein Artikel über Ruskins Die Steine von Venedig erscheinen. Venedig, »Friedhof des Glücks«, das wir in diesen Blättern wiederfinden.[3]
1907 ein außerordentlicher Artikel, in dem er seine Auffassung vom Ödipuskomplex erklärt, »Sohnesgefühle eines Muttermörders«, ein anderer »Zum Tod der Großmutter«, »Tage im Automobil«, also Seiten, in denen sich theoretische Gedanken und Autobiographisches vermischen, und einige Bemerkungen zu Lektüren. Lauter Themen, die im zukünftigen Werk wieder erscheinen, die aber allein nicht genügt hätten, den Namen ihres Autors bekannt zu machen. Plötzlich, Ende 1907 oder Anfang 1908, öffnen sich die Türen zum Roman von neuem. Ein Fächer von Wegen, die aufgegeben wurden, bevor sie nun bis zu Ende verfolgt werden. Die Ideen, die Themen sind gekommen und wieder gegangen, gleich einem Besuch geheimnisvoller Geister.
Denn Proust wird noch mindestens zweimal ansetzen müssen, bevor er nicht etwa Auf der Suche nach der verlorenen Zeit schreibt, sondern »Combray« mit seinen beiden Seiten und einem Aufenthalt am Meer, und noch viel länger warten, bis er eine Reise nach Venedig erzählt. Was war so gut an diesen fünfundsiebzig Blättern, dass er sie schrieb, und so schlecht, dass er sie aufgab? Wie jene Computerprogramme, die sich, kaum ausgeführt, selbst zerstören? Ist es die fragmentarische Form, die ihn noch zu sehr an Freuden und Tage erinnert? Das Thema, das nur die Geschichte einer Berufung sein kann, ist es gefunden? Tatsächlich, was soll er erzählen? Welche Erinnerungen? Die Geschichte welcher Figuren? Die eines Bruders, die verschwinden wird? Des Familienlebens in einem Landhaus, gelegen nicht in Illiers, sondern in Auteuil? Der beiden Seiten seiner geistigen Heimat? Adliger Provinzler oder Pariser? Junger Mädchen am Meer? Wo ist die Liebe? Wo sind Sodom und Gomorrha? Und vor allem, wo ist die mémoire involontaire, die unwillkürliche Erinnerung? Diese Fragen beantwortet Nathalie Mauriac Dyer in ihrem Nachwort. Denn der Roman beginnt wirklich erst in dem Moment zu existieren, da Proust die unwillkürliche Erinnerung nicht nur zu einem wesentlichen psychologischen Ereignis, sondern zum erzählerischen Organisationsprinzip gemacht hat, das heißt, von dem Tag an, da er den Einfall hatte zu schreiben, ganz Combray sei aus einer Tasse Tee aufgestiegen.
Proust hat selbst diese Szenen beschrieben, wo man einen Anblick, ein Gesicht, einen Eindruck aufgibt, die hätten vertieft werden können und müssen: die Kirchtürme von Martinville, die drei Bäume von Hudimesnil, das Milchmädchen von Balbec. In seinem Leben hat er geliebte Menschen aufgegeben wie Texte, von Reynaldo Hahn bis Henri Rochat, ewige Skizzen, ewige Entwürfe, von einem liebenswerten Mann, dem man nie begegnet. Unveröffentlichtes zu präsentieren bedeutet, die Geschichte eines Aufgebens, eines aufgegebenen Romans zu erzählen wie Die verlassene Frau von Balzac, wie An eine Passantin von Baudelaire. Prousts Herz und Verstand sind erstaunlich unruhig, er ist der Cherub oder der Don Juan der geschriebenen Seite.
Er wird ihre Penelope werden. Unveröffentlichtes zu präsentieren, heißt auch, die Geschichte sukzessiver Auferstehungen zu erzählen. Die beiseitegelegten, verworfenen, Tag und Nacht neu geschriebenen Seiten, sie kehren wieder. Diese Wiederkehr ist ein Fortführen und ein Übertreffen, ein Erlebnis. Was Proust nicht gemacht hat bei Jean Santeuil und was Zeit und viele gescheiterte Versuche verlangen wird bei Unterwegs zu Swann. Diese Blätter haben übrigens keinen Titel. Manche Romanciers beginnen mit einem Titel und schreiben dann ihr Buch; Balzac beispielsweise hat Listen von Titeln hinterlassen für Bücher, die noch nicht geschrieben waren. Nun ist der Titel ein Einheitsfaktor, ein Motor, ein Ideal, bevor er ein Grund zu Ruhm ist. Kein Titel, und das Buch entsteht nicht, ist nur ein Schatten, ein verrenkter Hampelmann. Ihr werdet die zerstreuten Glieder des Orpheus darin nicht erkennen, würde Horaz sagen, Disiecti membra poetae[4] .
Das Gefühl von »déja-lu«, all das schon einmal gelesen zu haben, ist sehr ungerecht: es ist der Tatsache geschuldet, dass, was als Letztes gelesen wird, als Erstes geschrieben worden ist. Darin besteht das Paradox des Liebhabers von Unveröffentlichtem: er forscht gerade nach dem, was der Autor verworfen hat, er bewundert, was gestrichen, entfernt, umgeschrieben wurde, weil es abweicht. Die Abweichung wird wieder zur Neuheit, ein neuer Proust, der der älteste ist. Man hofft, ein Geheimnis darin zu finden, das eigentliche Geheimnis des Werkes, das Muster im Teppich, die Aspern-Schriften. Das Wunder der Manuskripte ist, dass sie diese im echten Leben unmögliche Rückkehr in die Kindheit erlauben. Nur in Kunstwerken und besonders im Film kann ein Kind, nach dem Erwachsenen, das es geworden ist, in einer Rückblende erscheinen. Kehren wir das bekannte Bild um, dem zufolge wir Zwerge auf den Schultern von Riesen sind. Der Riese hat sich auf die Schultern eines Zwergs gesetzt, der er selbst war.
Der unversiegbare Strom der Kindheitserinnerungen und der Trauer ist noch nicht gebändigt, er fließt ununterbrochen. Aus einem einfachen Grund: dieser endlose Monolog ist nicht der des Romans, sondern der Monolog der Beichte, der Autobiographie. Und mit diesem beginnt Proust Ende 1907. Was durch ein entscheidendes Phänomen bestätigt wird: der Autor verwendet die echten Vornamen der Familie. Die Großmutter heißt Adèle (Berncastell-Weil), die Mutter Jeanne (Weil-Proust), der Erzähler Marcel. Die Großmutter, die Mutter, immer wenn Proust von ihnen spricht, ist er am ergreifendsten. Das kindliche Leid, das so anders ist als das der Erwachsenen und das hinter (oder unter) dem zu raschen oder verweigerten Kuss zum Ausdruck kommt, nimmt eine fast unerträgliche Dimension an; denn viele Kinder hätten sich damit begnügt zu wissen, dass ihre Eltern da sind, nicht weit von ihnen entfernt, im Garten oder im Esszimmer. Die Seiten über den Aufenthalt am Meer ebenso wie die über den Adel zeugen von einem leidenschaftlichen Wunsch, anerkannt zu werden. Was ist dem kleinen Marcel widerfahren, welche Ungerechtigkeit oder welcher Schicksalsschlag, dass er so sehr leidet?
Ein kleines Kind weint in Auteuil. Diese offene Wunde wird die Literatur schrittweise zudecken, in Gegen Sainte-Beuve und dann in den sukzessiven Stadien von Unterwegs zu Swann. Nathalie Mauriac Dyer zeigt in ihrem Nachwort, wie der Schaffensprozess fortschreitet, angefangen von diesen Blättern bis in ihre Fortsetzungen und gleichsam Tentakeln in den folgenden Cahiers. Die Seiten häufen sich, um unter ihrem Gewicht eine Wunde zu verbergen. Die verschlungenen Satzperioden kaschieren die Klage. Nach diesem Anfang einer Autobiographie kommt Proust auf den kritischen Essay zurück. Nach dem Essay, immer noch unzufrieden, beginnt er seinen Roman. Nach dem letzten Satz dieser fünfundsiebzig (oder sechsundsiebzig) Blätter und den Pastiches blitzt die Idee von Gegen Sainte-Beuve auf oder vielmehr von den Gesprächen mit Maman über Sainte-Beuve. Diese Möglichkeit, die Mutter wieder zum Leben zu erwecken, ist auch eine Möglichkeit, sich von ihr zu trennen. Erst wenn ihm das gelungen ist, kann Proust seinen Roman wirklich beginnen.
Der Rückgriff auf die Technik des Romans wird dem Proust'schen Monolog eine Form geben, Grenzen, Verfahrensweisen, eine Dichte, auch eine Schamhaftigkeit, die er Anfang 1908 noch nicht hatte. Dafür haben wir den Eindruck, das Werk besser zu verstehen; alles, was verborgen war, wird uns erklärt. Im endgültigen Text hätten wir uns mehr davon gewünscht. Hier wissen wir alles und empfinden eine Art Schamlosigkeit. Doch das Genie ernährt sich von den Opfern, die das Talent nicht bringt. Ein kleines Kind weint in Combray, und daraus entsteht ein Meisterwerk.
Jean-Yves Tadié
Zu dieser Ausgabe
Das Manuskript
Als die »Fünfundsiebzig Blätter« – oder genauer gesagt: die sechsundsiebzig beschriebenen Seiten – in Bernard de Fallois' Wohnung entdeckt wurden, befanden sie sich in einem bordeauxroten, kartonierten Aktendeckel im Standardformat, bezeichnet als »Dossier 3«, wobei es sich bei dieser Etikettierung von seiner Hand um die Überschreibung einer früheren Beschriftung handelt.
Die Blätter waren auf fünf Dokumentenhüllen verteilt, die Fallois mit den Titeln »Abende in Combray«, »Der Weg nach Villebon«, »Die jungen Mädchen«, »Adelsnamen« und »Venedig« versehen hatte. Diese Titel fanden sich jeweils auf Vorsatzblättern zu den verschiedenen Ensembles wieder. Mit Ausnahme von »Der Weg nach Villebon« waren den Ensembles, ebenfalls von der Hand de Fallois', lose Blätter mit kurzen Inhaltsverzeichnissen beigelegt. Wir haben diese Titel für die vorliegende Ausgabe nur zum Teil beibehalten (siehe weiter unten).
Zahlreiche Seiten waren beschädigt: eingerissene Ränder (f. 70, 83), eine kleine Klebespur eines anderen Blattes (f. 83), behelfsmäßige Reparaturen (Klebeband auf f. 53v.), verschiedene Flecken; der untere Teil von f. 84 ist, wahrscheinlich von Proust selbst, abgeschnitten worden.
Das Manuskript der »Fünfundsiebzig Blätter« setzt sich aus 43 Doppelbögen zusammen, d. h. 86 Blättern oder eben 172 Seiten auf blankem Velinpapier ohne Wasserzeichen im Format 360 × 230 mm. Es handelt sich um ein mittleres Format, denn die Faltung der Bögen ist unregelmäßig[5] . 76 Blatt hat Proust mit Tinte beschrieben, drei davon auch rückseitig (f. 41v, 83v, 85v). Mit Ausnahme von einem knappen Dutzend hat er sie vollständig und ohne einen Rand zu lassen beschrieben. Sie enthalten keinerlei Paginierung von Prousts Hand. Auffällig sind ein paar Zeichnungen: kleine abstrakte Skizzen (f. 36), ein weibliches Profil (f. 39), eine Kirche (f. 43).
F. 8, 38, 42, 44-50, 52, 66 und 84 sind leer geblieben. F. 44 und 49, 45 und 48, 46 und 47 waren ursprünglich wie ein Heft zwischen den Folios 43 und 50 eingefasst.
Die Nummerierung der Folios folgt der Ordnung, in der das Manuskript auf uns gekommen ist – mit Ausnahme von f. 27-43, die neu sortiert worden sind (siehe unten). Wir haben folgende Aufteilung vorgenommen und Titel vergeben, die in Teilen von den von Bernard de Fallois vorgesehenen abweichen:
f. 1-26: [Ein Abend auf dem Land]: 13 Doppelbögen, d. h. 26 Blatt, 25 nur recto beschriebene Seiten. F. 8 ist unbeschrieben. Die beiden letzten Seiten (f. 25-26) sind anonym unter dem Titel »Séparation« [Trennung] im Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray (n° 1, 1950, S. 7-8) erschienen. Die letzten sieben Seiten (f. 20-26) hat Bernard de Fallois in Contre Sainte-Beuve publiziert (CSB, Kap. XV: »Retour à Guermantes« [Rückkehr nach Guermantes], S. 291-297).
f. 27-52: [Die Seite von Villebon und die Seite von Meséglise]: 13 Doppelbögen, d. h. 26 Blatt, 17 sämtlich recto beschriebene Seiten, außer f. 41, das auch verso beschrieben ist. F. 38, 42, 44-50, 52 sind unbeschrieben. Gestützt auf materiale und textgenetische Indizien, haben wir dieses Ensemble umgruppiert, das uns in folgender Anordnung vorlag: f. 27-30, 39-41v, 43, 37-38, 35-36, 33-34, 31-32. Wie zu sehen sein wird, ist dies, mit Ausnahme der ersten Zweiergruppe, die exakt umgekehrte Reihenfolge der von uns vorgeschlagenen. Es ist also durchaus möglich, dass die Doppelbögen nach Bearbeitung einfach nur falsch wieder eingeordnet worden sind. Der Platz von f. 51 lässt sich nur schlecht bestimmen.
f. 53-65: [Aufenthalt am Meer]: Sieben Doppelbögen, d. h. 14 Blatt, 13 recto beschriebene Seiten. F. 66 ist unbeschrieben. Anders als Bernard de Fallois trennen wir dieses »Kapitel« von dem unmittelbar folgenden ab.
f. 67-74: [Junge Mädchen]: 4 Doppelbögen, d. h. 8 Blatt, 8 recto beschriebene Seiten.
f. 75-82: [Adelsnamen]: 4 Doppelbögen, d. h. 8 Blatt, 8 recto beschriebene Seiten. Die ersten sieben Seiten (f. 75-81) hat Bernard de Fallois in Contre Sainte-Beuve publiziert (CSB, Kap. XIV, »Noms de personnes« [Personennamen], S. 273-283).
f. 83-86: [Venedig]: 2 Doppelbögen, d. h. 4 Blatt, 5 beschriebene Seiten, davon zwei verso (f. 83v, 85v). Ein kleines Fragment von der rechten oberen Ecke eines anderen Blatts ist am Rand von f. 83 auf Höhe der zweiten und dritten Zeile haften geblieben; es sind dort noch zwei Buchstaben von Prousts Hand zu erkennen. Der untere Teil von f. 84, den Proust nicht beschrieben hat, fehlt.
Das Manuskript der »Fünfundsiebzig Blätter« ist inzwischen unter der Signatur NAF 29020 eingegangen in die Manuskriptsammlungen der französischen Nationalbibliothek (Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits).
Prinzipien der Texterstellung
Die Niederschrift der »Fünfundsiebzig Blätter«[6] erstreckt sich von den ersten Monaten des Jahres 1908 bis in den Herbst. Der Beginn ihrer Ausarbeitung geht vielleicht schon auf das Ende des Jahres 1907 zurück. Da wir nicht wissen, wie Proust diese Seiten arrangiert hatte, reihen wir sie in einer dem Text der Suche nach der verlorenen Zeit entsprechenden Ordnung an; es ist dies auch die Ordnung, in der sie wieder aufgetaucht sind.
Die Titel der verschiedenen »Kapitel« stammen nicht von Proust. Sie haben nur Hinweischarakter und liefern dem Leser vertraute Orientierungspunkte.
Die Transkription verzichtet im Interesse einer flüssigen Lektüre weitestgehend auf die Nachbildung von Streichungen im Manuskript. Nachfolgend seien die Prinzipien aufgeführt, die uns bei der Texterstellung leiteten.
Eine integrale diplomatische Transkription, das heißt eine Transkription, die Seite für Seite die Topographie der Handschrift genau wiedergibt und die Gesamtheit aller Streichungen und Zusätze von Prousts Hand integriert, kann auf der Website gallimard.fr heruntergeladen und mit dem Faksimile der »Fünfundsiebzig Blätter« abgeglichen werden, sobald Letzteres auf gallica.fr zugänglich sein wird.
Diese Transkription war Grundlage der hier vorliegenden. Beide hat Bertrand Marchal kritisch gegengelesen.
Unserer »Lesetext«-Transkription sind Dokumente beigegeben (Andere Manuskripte), die sowohl die Genese der »Fünfundsiebzig Blätter« als auch ihren Platz in der Genese der Suche nach der verlorenen Zeit erhellen. Diese Dokumente stammen aus den Beständen des Fonds Proust in der französischen Nationalbibliothek und dem Fallois-Archiv.
Prousts Handschrift in den Entwürfen ist durchsetzt von zahllosen Verbesserungen und Zusätzen. In die hier vorliegende, vereinfachte Transkription sind die Zusätze integriert und die Streichungen nicht eigens gekennzeichnet worden, es sei denn, eine Fußnote verweist auf eine besonders signifikante Passage, die man in der diplomatischen Transkription genauer zur Kenntnis nehmen kann.
Proust schreibt sehr rasch, es kommt vor, dass er manche Wörter auslässt oder die Übergänge zwischen den verschiedenen Fassungen vernachlässigt. Dort, wo es uns nötig erschien, haben wir im Interesse einer korrekten Syntax oder der Nachvollziehbarkeit eines Satzes die entsprechenden kleineren Korrekturen vorgenommen. In eckige Klammern setzen wir Passagen, die wir aufgrund einer Beschädigung des Manuskripts restituiert haben. Es handelt sich bei den Restitutionen mithin um Konjekturen.
Es ist nicht immer deutlich, wo im Text Proust seine Zusätze zu platzieren gedachte. Notgedrungen haben wir die Entscheidung getroffen.
Proust geht mit der Zeichensetzung sehr zurückhaltend um, zudem ist seine Interpunktion zuweilen unregelmäßig: Wir haben sie ergänzt, um den Lesefluss zu erleichtern, außer im Falle von Dialogen, wo diese Zurückhaltung dem mündlichen Stil zugutekommt, und in den Fällen, wo eine Modifikation der Interpunktion ganz offensichtlich Einfluss auf die Interpretation genommen hätte. Die Rechtschreibung ist gegebenenfalls korrigiert und die typographische Präsentation (Abkürzungen, Titel von Werken) ist normalisiert worden. Wir haben die Einteilung in Abschnitte nach Möglichkeit respektiert.
Diese »Kosmetik« am Manuskript übertüncht nicht dessen unvollendeten Charakter. Es kommt vor, dass die Niederschrift in medias res abbricht: Wir weisen dann mit einem kurzen editorischen Kommentar in eckigen Klammern darauf hin. Den Übergängen zwischen manchen Seiten, die zu verschiedenen Momenten geschrieben worden sind, hat Proust nicht immer sein Augenmerk geschenkt: Wir haben Wiederholungen stehen lassen. Falls mehrere Fassungen einer selben Passage aufeinander folgen, haben wir sie nach der zeitlich wahrscheinlichsten Abfolge der Niederschriften angeordnet, beginnend mit der ältesten.
Abkürzungen und Siglen
f.
Folio (falls keine weitere Spezifizierung folgt, handelt es sich stets um die Vorderseite [recto]. Ein nachfolgendes v [für verso] bezeichnet die Rückseite.
Ms.
Manuskript
NAF
Nouvelles Acquisitions Françaises (gefolgt von der Seriennummer) [= Französische Neuerwerbungen der Handschriftenabteilung der BNF, Bibliothèque nationale de France]
v
verso (s. o.)
[ ]
Editorische Eingriffe
〈 〉
Hinzufügung nach Streichung
/
Zeilensprung oder Trennung zwischen zwei Schreibungen, d. h. zwischen einer gestrichenen Passage und deren Überschreibung.
//
Übergang zum nächsten Folio
Die allgemeine Bibliographie und die Abkürzungen bzw. Siglen für die zitierten Ausgaben sowie die in den Fußnoten zum Nachwort zitierte Sekundärliteratur finden sich am Ende des Bandes. Wir verweisen auf Bücher und Artikel anderer Autoren, indem wir den Namen nennen, gefolgt von der Jahreszahl der Publikation (und ggf. den kleinen Lettern a, b, c …, wenn mehrere Publikationen desselben Autors im selben Jahr vorliegen).
Editorische Notiz zur deutschen Ausgabe
»Ici commence À la Recherche du temps perdu« – Hier beginnt Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Mit diesem Satz auf roter Bauchbinde lagen im Jahr 2021, pünktlich zu Prousts 150. Geburtstag im Juli, die 75 feuillets, die hier auf Deutsch vorgelegten Fünfundsiebzig Blätter, in den französischen Buchhandlungen aus. Dass der Fund der 75 Blätter (es handelt sich genauer gesagt um 43 Doppelbögen) eine Sensation war, ein, wie der große Proustforscher Jean-Yves Tadié schreibt, »heiliger Augenblick«, steht außer Zweifel. Ob die Suche nach der verlorenen Zeit nun genau hier beginnt, kann man dahingestellt sein lassen. Die Behauptung, Prousts monumentaler Roman beginne gleich mit den ersten Zeilen, die Proust als junger Mann geschrieben und publiziert habe, dass Proust mithin stets auf der Suche nach der Suche war, scheint heutzutage nicht mehr ganz abwegig[7] … Aber gleichwohl: Eine Sensation ist der Fund aus den Archiven des 2018 verstorbenen Verlegers und frühen Proustforschers Bernard de Fallois – ihm verdanken wir die Herausgabe der unter dem Titel Jean Santeuil (1952) versammelten Romanfragmente sowie der Texte zum Projekt Contre Sainte-Beuve (1954) – allemal, haben wir es hier doch erstmals mit längeren, teilweise schon sehr soigniert ausformulierten Passagen und Motiven zu tun, die zuweilen in dieser Form, oft aber noch weiter variiert, von Proust später in die Suche nach der verlorenen Zeit integriert werden.
Die auf die dreiundvierzig Doppelbögen verteilten Texte sind zwischen Frühjahr und Herbst 1908 entstanden, manches lässt sich womöglich, wie Nathalie Mauriac Dyer vermutet, auf Ende 1907 datieren. Wir bewegen uns also in einem Zeitraum von vier bis fünf Jahren vor Abschluss der ersten Version von À la recherche du temps perdu, deren ersten Teil Proust im Spätherbst 1913 bei Bernard Grasset auf eigene Kosten publizieren konnte. Wie schon angedeutet, weisen die »Fünfundsiebzig Blätter« aber auch Spuren von Texten und Motiven auf, die Proust schon Jahre zuvor formuliert hatte. Die großartige, für alle künftige Proustphilologie unumgängliche und unverzichtbare Leistung der Herausgeberin Nathalie Mauriac Dyer besteht nun darin, diese Motive, diese Formulierungen, diese Textbausteine in ihrer weit verzweigten Genese aufgezeigt zu haben: ihre Herkunft aus früheren Texten, ihre weiteren Entwicklungen in den Carnets, Cahiers, Placards (Bögen der von Proust reichlich annotierten Druckfahnen) und anderen Brouillons. Sie hat dies in einem umfangreichen Anmerkungsteil zu den 75 feuillets vorgeführt, auf den wir für die deutsche Ausgabe aus einsichtigen Gründen weitestgehend verzichten mussten: Zum einen liegen viele dieser redaktionellen Zwischenstufen nicht auf Deutsch vor, zum anderen stammen die Texte, so sie auf Deutsch vorliegen, von verschiedenen Übersetzern (weisen also unterschiedliche Stillagen und übersetzungstechnische Entscheidungen auf), und letztlich: Es handelt sich in aller Regel um redaktionelle Versuche Prousts. All dies ist für die Proustphilologie, für die Erforschung der Textgenese von kapitaler Bedeutung – im französischen Original. Dies im Deutschen nachvollziehen zu wollen, es, mit einem bösen Wort, »nachäffen« zu wollen, ist nicht sehr ertragreich. Philologisch-textgenetische Ausgaben und Kommentare haben stets ein Original zum Gegenstand.
Ertragreich, erhellend, gewinnbringend aber ist für den deutschen Proustliebhaber auf jeden Fall die Lektüre der »Fünfundsiebzig Blätter«, deren Echo oder Nachhall er in der Suche nach der verlorenen Zeit wiederfinden wird. Und geradezu unverzichtbar ist für ihn das hervorragende Nachwort Nathalie Mauriac Dyers, das nicht nur eine wirklich profunde Studie zu den »Fünfundsiebzig Blättern« liefert, zu deren Entstehung, Bedeutung und Interpretation, sondern auch eine Lektürehilfe bietet, die keine Fragen offenlässt und einen Ariadnefaden durch das Proust'sche Textlabyrinth spinnt. Oder noch einmal anders: Das Nachwort führt in den Maschinenraum der Recherche. Nathalie Mauriac Dyer hatte zudem beschlossen, die französische Ausgabe um weitere Manuskripte zu ergänzen, die – obwohl teilweise bereits bekannt – ebenfalls aus de Fallois' Nachlass stammen und Entstehung sowie Bedeutung der 75 feuillets erhellen. Diese »Anderen Manuskripte« haben wir für die deutsche Ausgabe mit Nathalie Mauriac Dyers Erläuterungen zum besseren Verständnis vollständig übernommen.
Ebenfalls zur besseren Orientierung und zum besseren Verständnis haben wir Nathalie Mauriac Dyers Anmerkungen zu ihrem Nachwort um Zitate aus den deutschen Proust-Übersetzungen der Frankfurter Ausgabe erweitert und am Ende dieses Bandes eine Konkordanz erstellt, die dem Leser die Suche nach den mit den »Fünfundsiebzig Blättern« korrespondierenden Textstellen in der Frankfurter Ausgabe und in der französischen Pléiade-Ausgabe der Recherche erleichtern werden.
Nathalie Mauriac Dyer hat zugunsten besserer Lesbarkeit auf eine textgenetische, diplomatische Edition der 75 feuillets verzichtet. Wie sie in ihrer editorischen Notiz anmerkt, sind sowohl Manuskript als auch Transkription online zugänglich. Wir folgen ihrer Entscheidung zugunsten einer Lese-Ausgabe und haben auf eventuelle Überschreibungen und Übersetzungen von gestrichenen Passagen verzichtet. In den kommentierenden Partien belassen wir es bei den Bezeichnungen Cahier, Carnet, Placard oder dem auch im Deutschen nicht ungebräuchlichen »Brouillon« (Entwurf). Es sind dies Bezeichnungen, die sich in der internationalen Proustforschung eingebürgert haben. Bei den Proust'schen »Cahiers« handelt es sich in der Regel um Schulhefte, bei den »Carnets« um Notizhefte im gestreckten Hochformat, bei den »Placards« um die Druckfahnen, die Proust oftmals als Bögen (acht Seiten) zugestellt bekam. Die 75 feuillets sind, anders als die wörtliche Übersetzung zunächst vermuten lässt, 75 meist nur vorderseitig beschriebene Blätter, wobei man sich diese Blätter als die eine Hälfte eines Doppelbogens, als die eine Hälfte der allen Franzosen seit ihrer Schulzeit vertrauten »copie double« vorstellen muss. Proust hat insgesamt 43 große Bögen in der Mitte gefaltet, hat also 43 »copies doubles« zu 86 Blättern gefaltet. Ähnlich verfuhr Proust übrigens auch in seiner Korrespondenz: Er faltete fast jeden Briefbogen in der Mitte, machte ihn zu einer kleinen »copie double«. Von den 86 Blättern beschrieb Proust 75 (in Wahrheit 76, aber da Bernard de Fallois nun einmal den Mythos der »75 feuillets« in die Welt gesetzt hatte …), allerdings immer nur – bis auf drei Ausnahmen – die Vorderseite, das sogenannte »recto«. Als »Blatt« oder »feuillet« gilt hier also die eine Hälfte eines Doppelbogens, dieses hat zwei Seiten, Vorder- und Rückseite. Als »Folio«, abgekürzt »fol.« oder einfach nur f., gefolgt von der Nummer, gilt durchgehend die Vorderseite (das recto). In den Fällen, da Proust auch die Rückseite beschrieben hat, folgt der Nummer des jeweiligen Folios ein »v« für verso, also z. B. f.7v für Blatt 7, Rückseite. Um die Folios der »Fünfundsiebzig Blätter« von denen der Cahiers und Carnets zu unterscheiden, aus denen die »Anderen Manuskripte« bestehen, verzichten wir in den »Fünfundsiebzig Blättern« auf das f. und geben nur die Nummern in eckigen Klammern an. In den Fußnoten werden editorische Hinweise von Nathalie Mauriac Dyer um einzelne Sachinformationen zum besseren Verständnis für deutsche Leser ergänzt.
Jürgen Ritte, Juli 2022
Die fünfundsiebzig Blätter
Übersetzt von Andrea Spingler
Ein Abend auf dem Land
[1] Man hatte die kostbaren Rohrmöbel zurück auf die Veranda getragen, denn es begannen ein paar Regentropfen zu fallen, und meine Eltern waren, nachdem sie einen Moment auf den Eisenstühlen gekämpft hatten, hereingekommen, um sich im Trockenen niederzulassen. Meine Großmutter aber, ihr ergrauendes Haar im Wind, setzte ihren raschen und einsamen Spaziergang auf den Gartenwegen fort, weil sie fand, man sei auf dem Land, um an der Luft zu sein, und es sei ein Jammer, wenn man das nicht nutze. Mit erhobenem Kopf, durch den Mund den brausenden Wind einatmend, der sie veranlasste zu sagen »endlich kann man einmal frei atmen«, beschleunigte sie ihren Schritt und schien weder den Regen zu spüren, der sie zu durchweichen begann, noch die Neckereien meines Großonkels, der von der Veranda rief: »Der Regen ist angenehm, Adèle; das tut gut, nicht wahr. Das bekommt deinem neuen Kleid (damit versuchte er feige, ein Bündnis mit meinem Großvater zu schmieden, der sich damit begnügte, den Kopf zu schütteln). Es ist doch komisch, dass sie niemals wie alle anderen ist.« Er sagte es, weil er es dachte. Aber da sie niemals war wie er und er vielleicht in einem uneingestandenen Winkel seines Bewusstseins nicht absolut sicher war, immer recht zu haben, sagte er es auch, weil es ihm nicht unlieb war, »alle anderen« auf seine Seite zu ziehen. Da der Garten nicht sehr groß war, dauerte es nie lange, bis meine Großmutter wieder bei uns vorbeikam. Sobald ich sie aus dem Seitenweg auftauchen sah, begann ich zu zittern, denn ich spürte, dass man ihr etwas zurufen, ihr unangenehme Dinge sagen würde, die mir das Herz zerrissen, und ich hatte sogar Angst, mein Großvater würde sie zwingen, ins Haus zu kommen. In diesen Augenblicken hätte ich alle umbringen können, um sie zu rächen, und manchmal, wenn ich es nicht mehr aushielt, stürzte ich mich auf sie und küsste sie verzweifelt, um sie zu trösten und ihr zu beweisen, dass jemand zumindest sie verstand, dann rettete ich mich aufs Klosett, das zu dieser Zeit mein einziger Zufluchtsort war, und ließ dort meinen Tränen freien Lauf. Aber meine Großmutter [2] antwortete auf die Neckereien immer nur mit diesem schönen liebevollen Lächeln, das sich am Gespött der anderen über sie zu beteiligen schien, denn sie war niemals jemandem gram, sie hat niemals andere Gefühle gehabt als die der Liebe, der absoluten Ergebenheit den anderen gegenüber. Das einzige feindselige Gefühl, das sie gehegt hat und ständig hegte, war die Empörung, doch die einzige Person, um derentwillen sie sich nie empörte, war sie selbst. Es schien, als hätte sie, als sie auf die Welt kam, ihre Person und ihr Leben aufgeopfert, so frei war sie von Eigenliebe, Selbstliebe, Eigennutz. Und man hätte sie zu Unrecht ins Gefängnis werfen, zum Tod verurteilen können, ohne in ihr die Empörung zu erregen, die sie zittern machte, wenn mein Vater mich aus Schwäche ein Mokkaéclair essen ließ oder mir erlaubte, eine Stunde länger als üblich im Salon zu bleiben. Ihr Spaziergang war zu Ende und der Regen auch, sie hatte sich wieder zu uns gesetzt, aber natürlich außerhalb der Veranda. Obwohl sie nur ein paar Schritte gemacht hatte und die Wege noch nicht wieder ganz durchweicht waren, hatte sie ihren prunefarbenen Rock entsetzlich verdreckt, denn offensichtlich hören die Beine von Personen, die mit einer blühenden Phantasie, einem höheren Geist begabt und ohne ein Gegengewicht an Eigenliebe sind, während sie tausend Gedanken wälzend spazieren gehen, keinen Augenblick auf, den ganzen Matsch der Wege einzusammeln und obendrein sogar, ihn rasch über die gesamte Länge der Röcke zu verteilen, ihn gebührend auf einer recht großen Fläche zu verreiben und auch noch die Teile des Kleides oder der Hose zu bespritzen, die zu weit entfernt sind, um direkt vom Schlamm erreicht zu werden. Meine Großmutter betrachtete den Garten, ohne etwas zu sagen, und wahrscheinlich dachte sie an etwas ganz anderes, doch mein Onkel, der [3] wusste, dass ihr die Art, wie der neue Gärtner alles verändert hatte, gründlich missfiel, beanstandete sogar noch ihr Schweigen, in dem er Missbilligung zu lesen glaubte. »Du findest den Garten natürlich nicht gut, Adèle«, rief er aus, »alles ist schlecht, was wir gut finden.« Seitdem der neue Gärtner die Bäume ausgeschnitten hatte, an deren Gezweig sie jeden Tag hängenblieb, worin sie aber die Freiheit der Natur wiederzufinden glaubte, seitdem er mitten in einem wie mit der Schnur abgezirkelten Rasenstück ein Ehrenkreuz[8] aus Hauswurz gepflanzt und schließlich unter dem Vorwand, Orangenblütenwasser zu bereiten, meinen Onkel überredet hatte, ihn von den Orangenbäumchen im Eingang alle Blüten entfernen zu lassen, litt meine Tante[9] sicherlich grausam. Ich kann sagen, sie hat seit dem Tag, an dem man beschloss, uns nicht mehr mit nackten Beinen hinausgehen zu lassen, nie so sehr gelitten. Die Ankunft einer neuen Köchin, die »verkleidete« Gerichte zubereitete, und dann einer Klavierlehrerin für uns, die beim Spielen Bewegungen machte und deren Hände vor lauter Gefühl nicht zusammenspielten, sollte ihr leider bald weitere Sorgen bereiten. Sie fuhr mit uns jedes Jahr ans Meer und ließ uns dort leben, wie es ihr gefiel. Sie hätte uns, wenn die Preise zu hoch waren, lieber nur Mansarden gemietet, aber es musste am Strand sein. Ein Palais in der Stadt hätte sie nicht gewollt, sie hätte sich nicht einmal die Zeit genommen, es zu besichtigen, um auch nicht eine Stunde guter Luft zu verpassen. Leute, die auf dem Land Spazierfahrten im Auto machen, die zu Hause bleiben, die ins Kasino gehen, flößten ihr tiefes Mitleid ein. Morgens brachen wir ans Meer auf, sie stellte ihren Klappstuhl an den Saum der Wellen und passte seinen Standort dem Wechsel von Ebbe und Flut an, während wir im Sand spielten. Wir hatten nur so eben Zeit, mittagessen zu gehen, und ließen die Klappstühle stehen, die uns regelmäßig vom Meer oder von Passanten genommen wurden. Sie fand, es wäre dumm, die Rückreise nicht zu nutzen, um uns irgendeine berühmte Stätte, irgendein Monument zu zeigen, dessen einfache und große Schönheit mit derjenigen der Natur unterwegs wetteiferte. Anstatt also dort, wo wir waren, den Zug zu nehmen, fuhren wir um fünf Uhr morgens mit der Postkutsche los, legten zwanzig Meilen zurück, vermochten weder, die Kathedrale zu sehen, noch den »Anschluss« [4] mit dem Zug zu bekommen, und blieben unterwegs stecken, ohne unsere beunruhigten Eltern benachrichtigen zu können. In der Regel legte ich mich bei der Ankunft für vierzehn Tage ins Bett. Während des Aufenthalts schickte sie selbst Nachrichten an unsere Eltern, weil es ein Verbrechen gewesen wäre, uns um eine Stunde Luft zu bringen, weil wir schreiben mussten. Aber ihre Briefe waren unleserlich. »Nach deiner Rückkehr liest du mir dann deine Briefe vor«, sagte mein Onkel jedes Jahr zu ihr, wenn sie verreiste. Und da sie geistreich und gebildet war und fand, man solle in Briefen vorsichtshalber niemals Eigennamen nennen, sprach sie von allem nur in Andeutungen, Bildern, Rätseln, niemand verstand, über wen sie sprechen wollte, und wenn man sie später um Erklärungen bat, konnte sie sich, sosehr sie überlegte, absolut nicht mehr erinnern, was sie hatte sagen oder über wen sie hatte sprechen wollen. Im Übrigen war das ohne jede Bedeutung, denn sie vergaß stets, die Adresse auf die Briefe zu schreiben, und sie waren stets unzustellbar. Von denen, die dennoch ihr Ziel erreicht hatten und durch einen nicht weniger seltenen glücklichen Zufall halbwegs leserlich und verständlich waren, habe ich einige, nach ihrem Tod von ihrer Tochter ehrfürchtig aufbewahrt, wiedergefunden. Nichtsdestoweniger sind sie alle in diesem Privatstil verfasst, der ihre Lektüre recht schwierig macht. Hier einer aufs Geratewohl:
Meine Tochter
Gestern Durendal gezogen der fliegende Holländer mit Ich störe Sie Madame. Ah! Die Verrückte, die Verrückte, die Verrückte. Wir wurden unterbrochen vom bösen Dok und Mutter Sie sind die Ballkönigin. Er hat erklärt, die Kinder seien blutarm. Dieser Machut. Ich habe ihn von unseren vierzig Jahrhunderten aus betrachtet, aber Sie hätten besser als ich gewusst, was zu antworten war, leider bin ich in Étampes. Ich schicke Ihnen zwei oder drei kleine Nimm dir den Strick, Sévigné, die Gold wert sind. Haben Sie die Schwalben de Myroti bekommen.
Mit zwanzig Jahren Abstand ist es mir gelungen, fast alles zu rekonstruieren. »Durendal ziehen« bedeutete in Anspielung auf Durendal, Rolands Schwert im Rolandslied, zornig werden, jemandes Partei ergreifen. Der fliegende Holländer, wie Wagners Geisterschiff-Oper heißt, war unser Spitzname für einen musikbegeisterten holländischen Bankier, den wir für einen Gauner[10] hielten. Meine Tante verteidigte ihn oft. Und natürlich hatte sie ihn verteidigt gegen »Ich störe Sie Madame«, die nervtötende Person, die wir am Strand kennengelernt hatten und die jedes Mal, wenn meine Tante sich mit uns unterhielt oder ein interessantes Buch las, kam, um sich bei uns niederzulassen, wobei sie regelmäßig sagte: »Ich werde Sie stören, Madame«, und sich dann, ohne einen Protest abzuwarten, der im Übrigen nicht kam, niederließ. Sie hatte keinen [5] Funken Verstand und machte meiner Tante lächerliche Geständnisse über ihre Ehe. Auf irgendein derartiges Geständnis muss meine Tante anspielen, wenn sie diese Worte Sganarelles aus L'Amour médecin[11] zitiert: »Ah! Die Verrückte, die Verrückte!« Sie waren unterbrochen worden durch den »schlimmen Dok«, einen wenig seriösen Arzt, auf den in seinem Beisein mein Onkel, der sich nicht genierte, Labiches Worte aus La poudre aux yeux[12] münzte: »Schlimmer Doktor, warum wollen Sie nicht Mitglied der Akademie werden?«, denn er glaubte nur an die »akademischen, klinischen« Ärzte und hatte für die anderen bloß Ironie übrig. »Mutter, Sie sind die Ballkönigin« hatte ein junger Kretin, dem dieser Spitzname geblieben war, auf einem Ball naiv zu seiner eigenen, übrigens sehr hässlichen Mutter gesagt. Man stellte ihn uns oft als Beispiel hin, um uns zu zeigen, dass man den Seinen keine Komplimente machen und den Komplimenten, die man uns über sie macht, nicht allzu bereitwillig glauben sollte. Als ich Maman sehr viel später einmal ein Kompliment machte, antwortete sie spöttisch »Mutter, Sie sind die Ballkönigin«. Ich habe gesagt, »schlimmer Dok« sei eine Anspielung auf Poudre aux yeux von Labiche. Seine Stücke waren zu diesem Zeitpunkt sehr in Mode, denn die beiden folgenden Sätze sind wieder Anspielungen auf seine Stücke. »Dieser Machut«, auf La Grammaire: »Dieser Machut, der schaut dir einer Kuh ins Auge«[13] … und weiß sogleich, was sie hat, und ebenfalls auf La Grammaire: »Wie könnte ich in Étampes sein, während meine Orthographie in Arpajon ist«. Hier ist »meine Orthographie« meine Mutter[14] , die besser Bescheid weiß über unsere Gesundheit. »Unsere vierzig Jahrhunderte« ist natürlich eine Anspielung auf Napoleons Satz »Denkt daran, dass von diesen Pyramiden vierzig Jahrhunderte auf euch herabblicken«. »Nimm dir den Stick, Sévigné«[15] bedeutete missratene Briefe (denn sie beurteilte alle, die sie empfing, nicht im Hinblick auf eine strenge Korrektheit, sondern nach der Erhabenheit der Gefühle, der Einfachheit des Stils, der Eleganz der Schrift etc.), nachdem einem dummen Herrn, den wir kannten, die nicht weniger dummen Briefe seiner Tochter einmal diesen Ausruf entlockt hatten: »Ah! Nimm dir den Strick, Sévigné!« Was die Schwalben »de Myroti« angeht, so sind sie bestimmt »demi-rôties«, halb gebraten, denn meine Großmutter hatte die Angewohnheit, aus Zerstreuung Wörter ganz falsch zu schreiben. Aber was mochten diese halb gebratenen Schwalben sein. Ich habe mich abgemüht, es herauszufinden. Aber leider sind die letzten Personen gestorben, die mir darüber Aufschluss hätten geben können.
Ich glaube, ich war bei meinem Onkel stehengeblieben, wie er zu meiner Großmutter sagt: »Nun ja, Adèle, der Garten gefällt dir nicht.« Aber nachdem er so gezeigt hatte, dass er Diskussionen nicht aus dem Weg ging, vermied er sie lieber, indem er sagte »lasst uns hineingehen«, und nachdem man die kleinen Bänke unter die [6] Stühle geschoben hatte, damit man nicht »darüber stolpern« konnte, begab man sich in den Salon, denn es war noch eine gute Stunde bis zum Abendessen. Da mein Onkel an diesem Abend ein befreundetes Paar eingeladen hatte, auf das er sehr stolz war, den Vicomte und die Vicomtesse de Bretteville, und dem er unbedingt sein Haus, seine Neffen, seine Schwägerin etc. vorführen wollte (und nicht weniger brannte er darauf, uns Monsieur und Madame de Bretteville vorzuführen), hatte der Gärtner, der es verstand, durch solche kleinen Aufmerksamkeiten meinem Onkel zu gefallen und ihn leichter über die Plünderung des Gartens, dessen schönste Blüten er verkaufte, hinwegsehen zu lassen, leider in alle Vasen Blumensträuße gestellt. Die Art des Gärtners aber, Sträuße zu binden, die meine Großmutter selbstverständlich »naturbelassen«, wild, riesengroß, frei liebte, war unlängst Gegenstand einer der stürmischsten Diskussionen zwischen ihr und meinem Onkel gewesen. Sie hatte erklärt, er könne keinen Strauß binden. »Ich bin kein Gärtner, doch wenn man mich ließe«, sagte sie wie »Ich bin kein Klavierlehrer, dennoch weiß ich, dass man nicht diese kleinen gespreizten Diminuendo-Effekte machen soll, wenn man die Polonaise von Chopin spielt«, »Ich bin kein Arzt, dennoch weiß ich, dass Flanell und Süßigkeiten den Kindern nur schaden können«. Der Anblick der Blumensträuße erfreute meinen Onkel, der sofort dachte, sie würden den Brettevilles eine gute Vorstellung vom Luxus des Hauses geben, verstimmte ihn aber zugleich, weil er ihn an die jüngste Diskussion erinnerte, und ließ ihn befürchten, sie könnte wieder losgehen. Er hatte nicht unrecht, denn meine Großmutter, die sich zwar geschworen hatte, sich nie mehr anmerken zu lassen, was sie dachte, konnte sich bei ihrem Anblick nicht beherrschen und zog mit raschem Griff an einer Rose, damit sie lockerer wirken und den Strauß überragen sollte, doch die Vase, die wahrscheinlich nicht im Gleichgewicht war, ließ sich von der Rose mitziehen, und das Wasser ergoss sich auf den Teppich. Meine Großmutter entschuldigte sich, lachte aber dabei und sagte, es sei kein so großes Unglück, wenn Vasen und Sträuße zerstört würden, was meinen Onkel erboste. Dann brachte man die Lampen. Jeden Abend war mein Herz beklommen bei ihrem Anblick, dem Rascheln der Vorhänge, die man gleich danach zuzog. Denn ich spürte, in ein paar Stunden würde der grässliche Augenblick kommen, da ich Maman gute Nacht sagen musste, da ich spüren musste, wie das Leben von mir wich, wenn ich sie verließ, um in mein Zimmer hinaufzugehen, und dann, was man nie erfahren wird, in meinem Zimmer leiden musste, wo ich die Geräusche von unten hörte, bis es mir gelang einzuschlafen. Wenn es mir gelang.
[7] Seit die Lampen gebracht worden waren, konnte ich an nichts anderes mehr denken und saß reglos auf meinem Stuhl, vor mich hin starrend, noch ohne die grässliche Angst in mir aufsteigen zu fühlen, aber traurig und gebrochen, wenn ich daran dachte, dass mich nur eine kurze Zeitspanne davon trennte und kein Glück mehr vor mir lag. Meine Großmutter wollte als Einzige nicht hinaufgehen, um sich umzukleiden, denn auf dem Land kleidet man sich nicht um. Als mein Onkel wieder herunterkam und sah, dass sie noch im Gartenkleid war, hatte er einen Wutausbruch, da er an Bretteville dachte, und murmelte etwas, was ich nicht gut verstand, aber ich glaube, es war »so ein Biest«. Im Übrigen war er fest entschlossen, sie dem Gast gegenüber als verrückt hinzustellen. An jenem Abend war meine Qual größer als sonst, denn ich sollte nicht bei Tisch dabei sein, sondern Maman gute Nacht sagen, bevor sie sich zum Essen begab, und wie üblich um halb neun zu Bett gehen, während sie noch beim Essen wäre. Es fiel mir schon jeden Tag sehr schwer, wenn der Kuss, den ich Maman gegeben hatte, mein ganzes Denken erfüllte, mich nach dieser Zärtlichkeit zu beruhigen, um rasch ins Bett zu gehen, ihre Wange noch unter meiner Lippe zu fühlen und einzuschlafen, bevor mich wieder die Angst vor der Trennung von ihr ergriff. Und leider gelang es mir nicht. In der halben Stunde, die der fatalen Minute vorausging, war ich wie ein Verurteilter. Manchmal bat ich inständig, mit flehendem Blick um ein paar Minuten Gnade, mein Onkel, mein Großvater, jeder mischte sich ein und erteilte einen Ratschlag, halb neun, das sei schon spät für ein Kind, ohne zu wissen, welche Schläge sie mir versetzten. Dann kamen die letzten Minuten, ich verstand nicht mehr, was gesagt wurde, stumm sah ich Maman an, ihr schönes Gesicht, das so sanft war und so grausam (aber konnte ich mir ein solches Leben überhaupt vorstellen!), wollte sie doch das Leben ihres Kindes nicht von dieser Qual befreien, meine Augen suchten nach der Stelle, wo ich sie küssen würde, ich versuchte, alles, was nicht das Gefühl dieser Stelle wäre, aus meinem Denken zu entfernen, damit meine Augen die Farbe und das Verhältnis zum Wesen ihres Gesichts auch richtig erfassten, damit mein Geist die Vorstellung von seinem Geschmack in dem Moment, wenn meine Lippen es berührten, ganz direkt aufnahm, und schließlich, damit ich diesen kostbaren, einzigen Kuss, denn ich durfte sie nicht mehrmals küssen, weil man das lächerlich fand, unversehrt in Erinnerung, oder besser, länger in meinem Geist bewahren konnte, so dass ich in meinem Zimmer, wenn ich anfinge, nach Luft zu schnappen vor lauter Alleinsein und von ihr Getrenntsein, die unveränderte Erinnerung würde hervorholen können, die mein Verstand in Reichweite hielt wie [9][16] eine Hostie, in der ich ihr Fleisch und Blut finden würde, oder vielmehr glich diese Erinnerung an die Wange einer der modernen Hostien der Wissenschaft, denn ich brach sie und führte sie an meine Lippen, die glauben sollten, wieder die Sanftheit der Wange zu spüren, und ich fand darin den Schlaf wie in einer Betäubungstablette. Daher versuchte ich immer, Maman in einen anderen Raum zu locken. Ach! könnte ich erreichen, dass sie zum Gutenachtsagen heraufkommt in mein Zimmer, wenn ich im Bett liege, dann würde ich ihren Kuss bewahren wie ein unauslöschliches Siegel, das mein Herz vor den sinnlosen Ängsten verschlösse. Ach! Das Geräusch ihrer Schritte, die mein Zimmer betraten, beinahe gefürchtet, denn sie kündigten nach ihrem so kurzen Eintreten das Rascheln ihres sich zur Tür wendenden Kleides an …, wäre die Tür wieder zu, würde ich sie nicht mehr küssen können. Manchmal rief ich sie zurück: »Maman Maman«, aber ich wagte es nur sehr selten, denn sie, betrübt über meine schwachen Nerven, machte ein ärgerliches Gesicht, und dann war all die Süße des Kusses vergangen, und was sie mir ließ, war die grauenhafte Beklemmung. Manchmal, wenn ich gezögert hatte, sie zurückzurufen, und hörte, wie sie die ersten Stufen der Treppe hinunterging und dass sie bald im Garten unten wäre, holte ich sie mit einem Satz auf der Treppe ein. Beinahe gewaltsam beschwor ich sie, nicht böse zu sein. Aber an jenem Abend würde ich gezwungen sein, ihr eine halbe Stunde, bevor ich schlafen ging, Adieu zu sagen. Ich hatte alles versucht, ich hatte gefleht, Papa zu bitten gewagt, meiner Großmutter ein Briefchen geschrieben, ich hatte mich vor Maman auf die Knie geworfen. Es hatte nichts genützt. Und ich wurde vom Läuten an der Tür überrascht, dem Läuten Monsieur de Brettevilles. Diesen Kuss, dessen Süße so lange bewahrt werden musste, ohne dass sie verflog, auf der Veranda, während meines Abendessens, auf der Treppe und bis in mein Zimmer, den konnte ich ihr nun nicht einmal allein geben und dabei all mein Denken darauf konzentrieren wie ein Besessener, der beim Schließen der Tür seine Aufmerksamkeit darauf konzentriert, um sicher zu sein, dass er sie geschlossen hat, und seinen Zweifel, wenn er in ein paar Minuten wieder daran denkt, mit der vollständigen Erinnerung an den Moment, als er sie schloss, zu entkräften. Maman küsste mich rasch, ich hielt sie flehend fest, sie stieß mich zurück aus Sorge vor Papas Ärger [10] über ihr Getue, ihr leichtes blaues Kleid, an dem strohgeflochtene Quasten hingen, entglitt meinen Armen, sie sagte mit vorwurfsvollem Ton, sanfter als die Vorwürfe früher, um keine neuen Ängste in mir zu wecken: »Nun nun, mein Liebling«, mein Vater drehte sich in diesem Augenblick wütend um: ›Also bitte, Jeanne, das ist lächerlich‹, und ich flüchtete, aber ich spürte, dass mein Herz nicht mit mir kommen konnte, sondern bei Maman geblieben war, die ihm nicht mit ihrem üblichen Kuss den Dispens erteilt hatte, sie zu verlassen und mich zu begleiten. Ich versuchte, solange ich unten blieb, meine Angst zu zügeln, indem ich mich bemühte, nicht an den Zeitpunkt zu denken (es waren nur noch zehn Minuten), da ich hinaufgehen musste, ich bemühte mich, ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen, die schönen Rosen zu betrachten, einem Klavier zu lauschen, das man aus dem Nebenhaus hörte, aber nichts kann ins Herz eindringen, wenn man zu viel Kummer hat, die schönsten Dinge bleiben draußen. Genau das verleiht besorgten Menschen jenen großen leeren Blick, an dem man sieht, dass nichts sie erreicht von dem, was man ihnen sagt, von den Dingen, die sie sehen, den schönen Dingen oder den heiteren Dingen. Ein Blick, konvex, wie es ihre Seele geworden ist, der seine Sorge nach außen wendet und nichts davon in sich eindringen lässt. Sowenig ich meinem Leid vorgreifen wollte, in Gedanken war ich bereits im Flur am Fuß der Treppe angekommen, die zu meinem Zimmer hinaufführte und von deren Stufen jede einzelne nicht grausamer hinaufzusteigen gewesen wäre, hätte sie zur Guillotine geführt. Und tatsächlich musste ich Punkt halb neun die von grünen Holzsprossen unterteilte Tür öffnen, den Lackgeruch der Treppe und der Geländerstäbe riechen, die jeden Abend, mit meinen traurigen Gedanken verquickt und getränkt, diese auf noch schmerzlichere Weise ausdrückten, als es eine klare Äußerung, ein volles Bewusstsein davon getan hätten. Der Geruch verfolgte mich wie jene Dämonen des Traums, die durch die immer gleiche rasende Idee [11] eine schmerzliche Empfindung von uns zum Ausdruck bringen; eine so schmerzliche Empfindung, dass wir beim Erwachen so etwas wie Erleichterung verspüren, denn die Blume, die wir mit aller Gewalt abreißen wollten, war unser Zahnschmerz, das junge Mädchen, dem wir aufzuhelfen versuchten, unser Erstickungsanfall. Wenn unter dem Ansturm des Lackgeruchs der Treppe dunkel meine Traurigkeit aufschien, drückte sie mich vielleicht grausamer nieder als in jedem anderen Moment. Und dann begann dieses Labyrinth von Stufen, deren jede mich von Maman entfernte und meinem Gefängnis näherbrachte, denn es wäre zu spät, mich zu besinnen, noch einmal zurückzugehen (ohnehin etwas sehr Schwieriges), um ihr gute Nacht zu sagen; ein so grauenhaftes Labyrinth von Schmerzen war diese Treppe, dass ich selbst tagsüber (wenn der Tag noch nicht einmal halb vorbei war und ich noch Stunden mit Maman verbringen würde und vielleicht sogar ein guter Küchenduft ihn mit der Verheißung köstlicher Augenblicke erfüllte) nicht ohne eine vage Unruhe hinaufgehen konnte, wenn ich etwas aus meinem Zimmer holen musste und es ganz ungefährlich war, die Treppe hinaufzusteigen, in mein Zimmer zurückzukehren, aus dem ich wieder herauskommen würde, mein Bett zu betrachten, in das ich mich keineswegs legen würde, und wenn dieses Hinaufsteigen der Treppe mit dem Hinaufsteigen zur abendlichen Folterqual nicht mehr gemein hatte als die Darstellung des Todes in einem Drama, dem wir bequem in einer Loge zuschauen, mit dem wirklichen Tod; und sowenig ich auf diesen friedlichen sonnenhellen Stufen, die ich frei hinaufstieg und hinunterlief, die Grade meiner Passion erkannte, deren Stufenleiter ich abends nicht erklimmen konnte, ohne »à contre-cœur«, in die Gegenrichtung zu meinem Herzen, zu gehen, diese Bühne meiner allabendlichen Folterqual bewahrte, erweckte für mich auch tagsüber noch einen schmerzlichen Eindruck.
Schon während ich im Flur die Kerze anzündete, hatte ich das Gefühl, ich könne nicht hinaufgehen, so wie jemand, der seine Koffer für eine Reise packt, zu der er sich nicht entschließen kann, und bereits spürt, dass er nicht bis zum Bahnhof kommen wird. Wie schmerzhaft sie sind, die Vorbereitungen [12] zu einer Handlung, von der man noch nicht sicher ist, ob man die Kraft hat, sie zu vollziehen, die uns ihr aber näherzubringen und sie unvermeidlicher zu machen scheinen, Handschuhe, die man langsam zuknöpft, während man nach einer Szene mit der Geliebten der Tür zustrebt, durch die man dann nicht gehen wird. Doch ich löschte die brennende Kerze entschlossen und schlich zurück zum Salon mit einem kurzen flehenden Brief an Maman, in dem ich sie »aus Gründen, die ich ihr nicht schreiben könne« bat, nach dem Abendessen zu mir zu kommen. Ich sagte zu meinem alten Kindermädchen: »Ach Gott, ich habe vergessen, Maman die Auskunft zu geben, um die sie mich dringend für den Herrn gebeten hatte, der heute Abend zum Essen da ist. Hat sie noch nicht danach geschickt? Dann hat sie noch nicht daran gedacht. Sie wird sehr zornig sein. Lassen Sie ihr rasch von Auguste diesen Brief überbringen, sonst werde ich ausgeschimpft.« Mein altes Kindermädchen, zunächst misstrauisch, ging mit dem Brief zu Auguste, der antwortete, während des Essens sei es unmöglich, aber wenn man sich erhebe, um den Kaffee im Salon einzunehmen, werde er ihn Maman geben. Ich wartete selig, das, was ich vor mir sah, war nicht mehr mein Zimmer, sondern Maman, und sei es wütend. Leider ließ sie mir sagen, es sei ihr unmöglich zu kommen, ich sollte schon längst im Bett sein, ich möge schnell hinaufgehen, sie sei sehr ungehalten. Ich ging hinauf, ich betrat mein Zimmer, ich baute selbst mein Gefängnis, indem ich meine Läden und meine Fenster schloss, die auf den Garten hinausgingen, wo man, wenn es schön war, vielleicht nachher den Kaffee trinken würde, indem ich meine Decke zurückschlug, indem ich das Bett aufdeckte, dieses Gefängnis im Gefängnis, wo ich gerade genug Platz hatte, um meinen Körper zu bewegen. Mit klopfendem Herzen lag ich reglos im Bett. Während sich in Paris zwischen den Möbeln meines Zimmers [13]




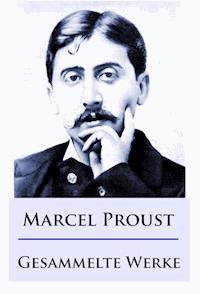


![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)