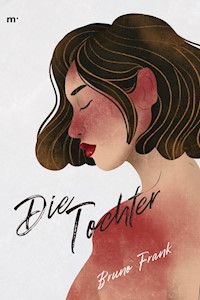Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Der Roman schildert die Entwicklungsgeschichte eines jungen Manns, der sein Lebensglück in einer untergeordneten, dienenden Stellung findet. #wenigeristmehrbuch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Fürstin
Bruno Frank
Meinem Freund Hulle
Impressum
Instagram: mehrbuch_verlag
Facebook: mehrbuch_verlag
ISBN: 9783756214938
Public Domain
1
Das Vorwerk, wo Matthias' Vater als Inspektor bedienstet war, gehörte zu einem riesigen, fünfzehntausend Morgen großen Gute, das Wälder, Seen und unüberblickbare Kornfelder umschloß, weit im Osten des Reiches. Bis Matthias sieben Jahre alt war, bekam er niemals den Gutsherrn zu sehen, aber dann eines Tages mußte er mit den anderen Kindern Spalier stehen, als der Graf, der so lange in der Hauptstadt Offizier gewesen war, seinen Einzug hielt.
Man hatte Matthias und seine kleine Schwester am Tage vorher kräftig gebadet und am Morgen selbst noch eine Reinigung mit ihnen vorgenommen, die sich ins Delikatere erstreckte, und nun standen sie von früh neun Uhr bis gegen elf Uhr beim Schloß im Spalier und wagten kaum miteinander zu flüstern. Endlich kam der Wagen von der Station, in weitem Bogen umfuhr er den Fischteich, man konnte ihn lange sehen, und alle Gesichter wanderten langsam mit der Kurve. Er erreichte die ersten Kinder, Alle riefen Hoch, und vom offenen Sitze schaute ein junger Herr mit braunem, ziemlich mißmutigem Gesicht über sie hinweg nach dem Walde. Matthias' Vorstellung von dem, was der Graf tun müsse, war unklar gewesen, aber die Art, wie jener nun auf die ganze großartige Zurichtung antwortete, brachte einen tiefen Eindruck auf sein Knabengemüt hervor. Er kniff die kleine Susa, die neben ihm stand, unwillkürlich in den Arm, so daß sie anfing zu weinen, worauf er tief erschrocken, sehr liebreich, aber doch zerstreut begann sie zu trösten.
Seine Blicke waren auf das freie Rondell vor dem Schloßportal gerichtet. Dort hielt der erste Verwalter barhaupt eine Rede, die man nicht hören konnte. Der Graf war aus dem Wagen gestiegen und lehnte am Schlag. Als der Verwalter fertig war, nickte er, griff an seinen grauen, weichen Reisehut und ging die Treppe hinauf.
2
Matthias' Vater hatte sich um die Waschungen nicht gekümmert, die der großen Begebenheit vorausgingen. Als er hinzugekommen war, hatte er gelacht und etwas Lustiges gesagt, das die Kinder nicht verstanden. Er war ein stattlicher und vergnügter Mann, der nichts von Förmlichkeiten hielt und den alle gern hatten. Die Mutter pflegte ihn, auch wenn kein besonderer Grund vorlag, wie erschrocken aus ihren dunklen, schwärmerischen Augen anzusehen. Sie war außerordentlich gottesfürchtig und menschenfürchtig. Seit der junge Herr nach Hause zurückgekommen war, hatte sie eine Art, ihn in ihrer Mischsprache »Pun grof« zu nennen, die den Kindern ehrerbietige Schauer über die Seele jagte. Wenn der Vater sie so hörte, ahmte er ihr gutmütig nach: »Pun grof«, sagte er, machte fromme Augen und blies die Backen auf, dann aber nahm er die Mutter zärtlich um die Schultern.
Als Matthias größer war, merkte er, daß sein Vater sich über den Gutsherrn ein wenig lustig machte. Er kam etwa vom Herrenhause zurück und erzählte ernsthaften Tones eine Unterredung: »Der Graf meint ja, wir könnten ganz einfach die Karauschenzucht eingehen lassen und mal zur Abwechselung Forellen in den Teich setzen. Ich sagte, das ginge ja schließlich …« Aber am Ende seines Berichtes fing er an zu schmunzeln, er schlug sich aufs Knie, und zuletzt lag er nach rückwärts in seinem Sessel und lachte aus vollem Hals. Susa fürchtete sich und sah zu ihrer Mutter hin. Aber Matthias war in sich nicht einig. Er bewunderte seinen Vater und fand es großartig, daß jemand sich innerlich so frei hielt, allein irgendwo in seinem Herzen bestand ein dunkles Gefühl, das ihn hinderte, so recht mitzulachen, – auch als er schon anfing, die Torheiten des Grafen würdigen zu können.
In anderen Stücken freilich folgte er durchaus dem Vater nach, ungewiß, ob überall zu seinem Heil. Ihm war eine Natur eigen, der die Leitung der Religion vielleicht von besonderem Segen gewesen wäre. Doch er sah seinen Vater von kirchlichen Dingen sich abkehren, und er tat es ihm gleich. Bei dem Inspektor entsprang wohl diese Unbekümmertheit jener Empfindung so manches tüchtigen und fröhlichen Menschen, der sich aller Sermone und heiligen Lieder glaubt begeben zu können. Aber es spielte hinein, daß ihm die Kirchenläuferei als eine ganz besonders polnische Angelegenheit erschien – und alles polnische Sonderwesen, wie es sich in der Gegend störend breit machte, war ihm ein Greuel. Auch mochte er den Pfarrer nicht leiden.
Gewiß ist, daß diese persönliche Abneigung bei dem jungen Matthias kräftig mitsprach. Als heranwachsender Knabe erinnerte er sich noch wohl, wie ihn einst die ersten Meßgänge an der Hand der Mutter mit einem dumpfen und süßen Vergnügen erfüllt hatten. Aber als er gerade anfing, die Augen richtig aufzutun, wurde der neue Geistliche in das Gutsdorf versetzt, und bei dessen erster Predigt befestigte sich in Matthias jene Empfindung, die an Haß grenzte. Der Mensch dort oben hatte ihm nichts angetan und würde ihm möglicherweise niemals etwas antun. Aber er verdiente Haß, das war dennoch wahr. Er predigte mit einer rauhen, bellenden Stimme, seine Augen waren klein und trüb und von ungutem Ausdruck, und wenn er mit einer Ermahnung, einem Flehen an die Gemeinde sich wandte, so hob er seine tierisch dicken Fäuste nicht wie ein fromm um Frömmigkeit Bittender, sondern wie ein Schlächter. Er war vermutlich nichts Anderes als ein Bauerntölpel, der wenig in sein Kleid paßte; aber für den jungen Matthias war er nichts Anderes als ein böser, ein gemeiner Mensch. Es wurde Matthias' Mutter bald schwer und dann unmöglich, ihn in die Kirche zu bringen … Auch die Zeit vor der ersten Kommunion und die erste Kommunion selber änderten nichts. Er schauderte ein wenig, als er die Hostie aus der Hand dieses Menschen empfing. Aber dies blieb von dem Tage sein einziger Eindruck.
Da sein Vater mit ihm übereinstimmte, so brauchte Matthias sich von dem Geistlichen nicht unterrichten zu lassen. Es wäre das Natürliche gewesen und wurde mit einer Dringlichkeit angeboten, die man höflicherweise kaum abschlagen durfte; dennoch wurde die Gefahr umgangen. Matthias würde sich also mit dem begnügen, was ihm der Schullehrer beizubringen vermochte, und er würde um ein Jahr früher in die Kreisstadt zur Schule geschickt werden.
Denn Matthias' Vater hatte seine bestimmten und ehrgeizigen Pläne mit dem Knaben. »Inspektor soll er mir nicht werden,« sagte er, als der Kleine noch im Röckchen herumlief. Und seit mehreren Jahren nun stand es fest, daß Matthias die Forstakademie besuchen und sich so eine schöne und sogar vornehme Karriere aufschließen sollte. Matthias war das zufrieden, er hatte den Wald gern wie alle gutartigen Kinder. Übrigens wurde er wenig gefragt; als er dahin gelangte, zu denken, war alles längst beschlossene Sache. Und er hatte auch zunächst nur Annehmlichkeiten von diesem Plan: denn auf dem Vorwerk, auf dem ganzen Gut verlieh es ihm eine gewisse Würde, daß er dazu bestimmt war, in einigen Jahren »nach Eberswalde« zu gehen … Die Männer, die im Winter am Abend manchmal bei seinem Vater zusammenkamen, fingen an, ihn zu bemerken, sie zogen ihn auf mit seinem Studium, und sie taten das mit Achtung. Er saß, ohne daß ihn jemand ins Bett wies, oft ziemlich lange bei ihnen wach und hörte ihren Geschichten zu.
Eine, die der Verwalter eines kleinen benachbarten Gutes mitbrachte, beschäftigte ihn geraume Zeit. Auf jenem Gute wurde, nach alter schlechter Sitte, ein Kettenhund gehalten, ein großer schwarzer Neufundländer. Unter dem Dach des Ökonomiegebäudes dort hatte man, die ganze Front entlang, einen Eisenstab angebracht und an ihm mittels eines verschiebbaren Ringes eine lange Kette; und dem Neufundländer war auf diese Weise die Möglichkeit gelassen, die Länge des Hauses hinauf und hinunter zu jagen. Da er ein ziemlich begriffsstutziges Tier war, so bildete er sich stets von Neuem ein, er sei frei, und brach stets von Neuem in ein wildes Geheul aus, wenn er die Wahrheit einsah. So raste er nun nächtelang halb toll hin und her. Der Inspektor – eben der, der die Geschichte erzählte – hatte seinem Herrn Vorstellungen gemacht; es war unmöglich für ihn und seine Frau, bei dem Höllenlärm zu schlafen, außerdem tat ihm der arme Köter leid. Im Grunde war ja auch, so fügte er hinzu, gar nicht viel zu bewachen, – eine Bemerkung, die von allen mit Vergnügen aufgefaßt wurde, denn man wußte, daß es mit der Besitzung nicht zum Besten stand. Der Herr, der lange sein eigener Verwalter gewesen war, hatte sie hoffnungslos heruntergebracht. Eines Abends nun, wie er, wohl ein bißchen betrunken, aus der Kreisstadt nach Hause kam, fiel es ihm ein, zum Ökonomiegebäude hinüberzugehen, um seinem Wachhund einen guten Abend zu wünschen. Im Frack, den Überzieher überm Arm, geht er auf die Scheune zu … Der Hund läuft ruhelos, heulend, an seiner langen Kette hin und wider. Wie er den Urheber seines Unglückes kommen sieht, bleibt er stehen. Und dann springt er an ihm empor, aber nicht zu einer Liebkosung. Mit einem einzigen Ruck reißt er ihm von oben bis unten den rechten Arm auf, so daß zerfetztes Fleisch durch den Frackärmel herausquillt. Dann legt er sich nieder, als sei er nun, zum ersten Mal, beruhigt …
»Das Sonderbare ist,« sagte der Erzähler, »daß der Herr durchaus keine Wut bekommen hat. Er hat den Hund auch nicht etwa erschießen lassen, sondern losbinden, und nun geht der seit einigen Tagen ganz vernünftig um die Häuser herum. Der Herr sieht ihn von seinem Krankenbett aus durchs Fenster.«
Matthias, der in einer wilden Erregung zugehört hatte, ging hinaus und rief den Hund seines Vaters. Es war ein tapferer, struppiger Terrier, von der Airedale-Rasse, nicht mehr jung; er schlief schon in seiner Hütte. Aber er ermunterte sich und kam mit tolpatschigen Sprüngen durch die Dunkelheit auf Matthias zu. Matthias hockte sich bei ihm nieder und nahm ihn um den Hals. Er sagte: »Guten Abend, Wächter. Dir geht es gut, nicht? Dir tut keiner was …« Er nahm den Hund sacht bei seinen weichen Ohren und ließ sie durch die Hände gleiten, mit einer begeisterten Rührung, die ihn beinahe hätte schluchzen lassen. Wächter schüttelte sich, geniert von der ungewohnten Nähe. Aber zartfühlend, um das wieder gutzumachen, legte er dann eine tröstende Pfote auf Matthias' Arm.
3
Mit fünfzehn Jahren bekam Matthias noch einmal Schläge von seinem Vater. Bei einer Jagd hatte er gesehen, wie der Graf einen ungeschickten Treiber mit dem Kolben seiner Flinte traktierte, und schäumend kam er heim. Er sprach während des Nachtessens exaltiert von nichts Anderem und vergaß sich schließlich so weit, vor den Eltern mit der Faust auf den Tisch zu hauen und etwas von »verfluchter Preußenwirtschaft« zu sagen. In diesem Augenblick schlug ihm sein Vater ins Gesicht. Ruhig und sachlich erteilte er ihm vier fürchterliche Ohrfeigen. Er haßte das großpolnische Gehetze, das sich, wie er wußte, mit sklavenmäßiger Unterwürfigkeit von Mann zu Mann vertrug, und in der Familie jedenfalls wollte er mit dem Treiben nichts zu tun haben. Er für seine Person kam aus Niederschlesien, und seine Frau, mochte sie braune Haut und dunkle Augen haben, war eben seine Frau. Immerhin fing sie und fing Susa bei der ungewohnten Szene zu weinen an; Matthias stand auf und legte sich im Dunkeln auf sein Bett.
Ein halbes Jahr später heiratete der Graf, und auf dem Gut wurde drei Tage lang getanzt und getrunken. Am Abend des dritten Tages saß Matthias bei den Arbeitern eines entfernten, des nördlichen Vorwerks. Es waren fast lauter Polen, und sie sangen. Die großen Worte der Lieder und der Branntwein stiegen Matthias zu Kopf, und er sagte den Polen begeistert und eindringlich, er gehöre zu ihnen. Weil er der Sohn seines Vaters war, den man als einen so scharfen Gegner der »Sache« kannte, so merkte man auf sein wirres Gerede und ermunterte ihn.
Die Kellnerin, die bediente, ein großes starkes Frauenzimmer, das man zur Aushilfe hatte kommen lassen, sah ihn mit Bewunderung an. Matthias war über seine Jahre gewachsen, er war weiß von Haut, mit schwarzem dichtem Haar. Seine Augen, ebenfalls dunkel, leuchteten vom Trinken und vom Reden. Schließlich fiel ihm ein, daß er nach Hause müsse, und daß der Weg ziemlich weit sei. Aber wie er zur Tür hinaus war, kam die Kellnerin um das Gebäude, faßte ihn ohne irgend etwas zu sprechen um die Hüfte und zog ihn mit sich zurück durch die hintere Tür. Es war nicht viel Zeit, in der Schankstube rief schon jemand nach neuem Schnaps. Hinter der Anrichte lag ein Verschlag mit einem primitiven Bett, wo das Mädchen die Nacht zubringen sollte. Sie warf Matthias, mehr als daß sie ihn legte, über den Strohsack, riß ihm die Kleider auf und nahm, in rasender Eile, Besitz von ihm. Dann brachte sie ihn eilig wieder in Ordnung, küßte ihn unter der Tür noch einmal tief in den Mund und schob ihn hinaus. Die Leute drinnen schrieen nach ihr, und der Schankpächter schlug an die Bretterkammer.
4
Es war als sei damit eine Pforte aufgestoßen. Wie auf Verabredung fielen die Mädchen des Gutes nun über ihn her. Er blieb wirklich nirgends mehr sicher vor ihnen. Dies schmeichelte ihm nicht, Eitelkeit war nicht in seinem Wesen, und bald ertrug er es schwer. Vielleicht war er nicht tugendhafter als andere heranwachsende Knaben auch, aber sein Sinn war früh schon auf eine bestimmte Art wählerisch. Dennoch wußte er nicht recht zu widerstehen. Das Weibervolk dort in der Gegend war – eine Folge gewiß der Blutvermischung – recht zügellos, und sie scheuten sich nicht, ihn ohne Umstände anzupacken. Und obgleich ihm das zuwider wurde, so erlag er gleichwohl fast jedem dieser schamlosen Angriffe, es war sogar eben ihr Unverhülltsein und ihre Frechheit, was ihn erliegen machte, und er wußte das und ängstigte sich davor, als vor einem schlimmen Geheimnis.
Er fragte seinen Vater eines Tages, ob es nicht möglich sei, ihn statt erst im kommenden Frühjahr schon jetzt, schon im Herbst, zur Kreisstadt auf die Schule zu schicken. Der Vater, der seit einiger Zeit weniger fröhlich war und zur Seltsamkeit neigte, sah den bleichen Sohn scharf und unverwandt an und sagte nach einer Weile langsam: »Gut, werden sehen, mag sein, mag alles sein …« Matthias behielt von diesen nicht ganz gewöhnlichen Worten einen Schauer auf dem Rücken, aber nach einigen Tagen, man hatte Erkundigungen eingezogen, wurde alles endgültig nach seinem Wunsche bestimmt.
Er hatte nur einen Monat noch zu warten: man schrieb Anfang September. Die Jagd ging auf, und eines Tages, wie Matthias müßig im Walde umherging, sah er vor sich in einiger Entfernung den Grafen und die Gräfin mit zwei Hunden. Sie standen still. Die Frau hatte einen angeschossenen Hasen bei den Löffeln gefaßt, der unter ihrem Griff hin und her zappelte. Matthias konnte nicht hören, was gesprochen wurde, aber es war deutlich, daß sie dem Grafen einen schlechten Schuß vorwarf, den er wohl aus großer Nähe getan hatte. Der Graf stand in verlegener Haltung neben ihr. Schließlich, nachdem die Frau ihre Vorhaltungen beendet hatte, warf sie das Tier zu Boden, bückte sich und gab ihm mit einem kurzen Stoße den Rest … Matthias sah an ihrer Bewegung, daß sie ein Jagdmesser zwischen die Nackenwirbel stieß; eigentlich genügte ja ein Schlag mit der flachen Hand. Die Gräfin war eine nicht sehr große, doch straffe junge Dame, mit hellem Haar über einem weißen Gesicht, mit Augen wie aus blauem Stein. Matthias hatte sie nur zwei, drei Mal aus der Nähe gesehen und jedes Mal mit Herzklopfen. Schon sehr bald erzählte man auf den Gütern eigentümliche Geschichten: von Nächten, die der Graf in Unterhosen an ihrer Tür verbracht haben sollte; von einem schlecht gegürteten Steigbügel, den sie ihm vor Leuten ins Gesicht geschleudert habe, so daß sein Zahnfleisch anfing zu bluten; und mehr dergleichen.
Matthias vergaß niemals ihre stolze und boshafte Haltung vor ihrem zerknirschten Gatten und den zugleich nachlässigen und hastigen Stoß, mit welchem sie dem zuckenden Hasen zum Tode verhalf.
5
In der Kreisstadt zeigte es sich, daß Matthias' Vorstudium mangelhaft und seine Lernfähigkeit mäßig war. So öffnete sich ihm eine Zeit sehr strenger Arbeit. Das Logis, das man für ihn ausgewählt hatte, wurde nach dem Ablauf des ersten Jahres allzu kostspielig erfunden, und man gab Matthias einem Hilfslehrer in Pension, der für seine Mansardenstube geringere Forderungen stellte.
Dieser Hilfslehrer, ein kränklicher und meist mißlauniger junger Mann, war bereits verheiratet und zwar mit einer kleinen blonden Frau von ordinärer Hübschheit, der Tochter eines Weißwarenhändlers aus der Stadt. Sie hatte weiche, kurze, fette Händchen mit niemals sauberen Nägeln, und sie lag beim Essen mit dem Gesicht in ihrem Teller; Matthias brachte ihr wenig Neigung entgegen. Er war der einzige Pensionär des Ehepaars, und er benahm sich mit äußerster Bescheidenheit. Sogleich nach dem Abendessen pflegte er gute Nacht zu wünschen und auf seinem Zimmer beim Schein von Kerzen, deren Preis er sich zusammensparte, noch zu lesen. Ein Buch, das er kaum beendigt immer von Neuem begann, waren die Memoiren des russischen Revolutionärs Krapotkin; der Band war das Eigentum eines Kameraden, und Matthias bat von Monat zu Monat, ihn ferner behalten zu dürfen.
Eines Abends kam die Lehrersfrau ohne weitere Umstände zu ihm ins Zimmer. Sie gab sich wenig Mühe, einen Vorwand zu erfinden, erzählte, daß ihr Mann in eine deutschnationale Versammlung gegangen sei, und stellte sich blinzelnd vor Matthias hin. Er versuchte mit Stottern, beängstigt, ein Gespräch zu beginnen, aber sie kam vollends heran, sah ihm von unten her in sein schönes Gesicht und begann, sich wie eine Katze an ihm zu reiben. Doch diesmal war die Mischung von Mitleid und gedemütigter Lust, die er in solchen Fällen zu empfinden pflegte, schwächer als sein persönliches Widerstreben. Er packte die Frau bei den Schultern, schob sie ein Stück weit zurück und schüttelte den Kopf. Er sagte: »Ich bitte, gehen Sie hinunter, Frau Adam, oder ich weiß, was ich morgen früh tun muß.«
Aber kaum hatte sie nach einem rachsüchtigen Blick die Tür geschlossen, so faßte ihn eine sonderbare Art von Beschämung. Er empfand seine Weigerung und besonders seine verzweifelte Drohung als etwas sehr Gemeines. Ohne daß er wohl vermocht haben würde, dies in klaren Worten auszudrücken, – es erschien ihm grausam und verwerflich, eine Kreatur, die ihren blinden Trieben unterlag, derart zurückzustoßen. Ich darf es sie nicht entgelten lassen, daß sie mir nicht gefällt, dachte er in seinem Knabenherzen, und ohne sich viel zu besinnen, warf er sein Buch, das er noch immer hielt, auf den Tisch und ging im Finstern die Treppe hinunter.
Aus dem Schlafzimmer kam ein Lichtschein. Er klopfte und öffnete, ohne zu warten. Die Lehrersfrau saß, mit nackten Brüsten bereits, auf dem Bettrand. Er warf sich vor ihr hin, legte den Kopf auf ihre Kniee und flüsterte: »Oh verzeihen Sie, verzeihen Sie!«
Sie, ganz verwundert, nahm ihn auf und hielt es für angebracht, nun ein wenig »ideal zu tun«, wie sie es in ihrem Innern nannte. Sie saßen dann nebeneinander, und eben hatte die Frau begonnen, von ihrer Liebe zu erzählen, die sie bereits am ersten Tag nach seiner Ankunft für ihn empfunden habe, als sie zusammenfuhr, schrie und Matthias hastig unter das Ehebett stieß.
Der Lehrer kam herein, hustend und schlechter Laune. Er erzählte, daß er den Tabaksrauch und die unentschlossenen Reden nicht länger habe vertragen können. Die Frau, bösen Gewissens, suchte ihn mit einer zärtlichen Energie aufzuheitern, die er erstaunt und geschmeichelt aufzunehmen schien. Nicht lange, so schlief er.
Aber der große Junge lag in Staubwolken unbeweglich wach und zerriß sich sein Herz mit Vorwürfen. Er war nicht der Mensch, der die Fähigkeit besessen hätte, sich zu trösten und zu beruhigen, obwohl sein Gewissen gerade in diesem Falle hätte frei sein dürfen. Zerknirschung und grenzenlose Demut zogen in seine Seele ein … Auf ein Zeichen wagte er endlich mit ungeheuerer Vorsicht, sich der Tür zu nähern, und ohne daß der ermattete Lehrer ihn hörte, gelangte er hinaus und auf sein Zimmer.
Aber nun begann eine Zeit des Leidens für ihn. Matthias machte sich für die Frau zu einer Sache, die sie nach Wunsch gebrauchen konnte, und vor dem Manne erniedrigte er sich, aus Sehnsucht nach Buße, zu hündischer Unterwürfigkeit. Das Ergebnis war natürlich, daß er verachtet wurde; doch er selbst verachtete sich mehr.
Eines Mittags, wie sie beim Essen saßen – er nahm sich immer wenig und vom Schlechtesten – wurde geklingelt, und da es kein Mädchen gab, stand Matthias auf, um zu öffnen. Es war eine Depesche, an ihn selber adressiert. Sein Vater rief ihn nach Hause, die Mutter liege im Sterben … Matthias fuhr mit der Kleinbahn, sodann mit dem Wagen, aber er kam schon zu spät. Es war eine galoppierende Schwindsucht gewesen, und da die Mutter sich schwach, doch frei von Schmerzen fühlte, so hatte man erst am Tag zuvor den Arzt kommen lassen.
Als der Wagen vors Haus fuhr, wußte Matthias alles; man hatte ihm die Nachricht vom Feldrand aus zugerufen. Er fand seinen Vater neben der Leiche sitzen, trübselig und sehr gealtert, mit schmutzigen hohen Stiefeln, die er gewiß zwei Tage lang nicht abgezogen hatte. Susa, in einem hübschen schwarzen Kleid, sehr frisch gewaschen, hantierte lautlos im Hause herum. Wie Matthias sie umarmte, fühlte er, daß sie eine Frau geworden war, und er erschrak ein bißchen darüber. Er setzte sich neben seinen Vater und sah auf das Gesicht der Toten, das tief befriedet und vollkommen leer war. Er fühlte keinen Schmerz und eine gewisse Scham über diesen Umstand. Auch kam es ihm zum Bewußtsein, wie wenig er sich in dieser vergangenen Zeit in Gedanken mit seinem Elternhause abgegeben hatte … Freilich bot man ihm wenig Anlaß, man ließ ihn fast ohne Nachrichten. Was aber hatte ihn denn erfüllt – außer jenen Vorgängen, an die er jetzt nicht denken wollte?
Er suchte im Schweigen, und er fand wenig mehr als einige große und begeisternde Worte seiner Bücher. Gerechtigkeit, dachte er, Wohltun … Freiheit … Und sie machten sein Herz schlagen und erwärmten es mit einem ungewiß flammenden Feuer, während seine Augen starr und ohne Blick auf dem braunbleichen Sklavengesicht seiner Mutter hafteten.
6
Am Tag des Begräbnisses, eine Stunde ehe der Sarg sollte fortgetragen werden, kamen der Graf und die Gräfin zur Beileidsvisite. Der Graf sprach einige zerstreute und gnädige Worte zum Vater und sodann auch zu den beiden Kindern, die regungslos standen. Er zuckte nervös mit der einen Hälfte seines Gesichts. Matthias fand ihn im Ganzen zu seinem Nachteil verändert, besonders fiel ihm auf, daß in dem braunen Gesicht die Hautpartie um die Nase sich abgebleicht, ja erstorben weiß zeigte. Übrigens sah er nur aus einer Art von Pflichtgefühl mitunter auf den Gutsherrn hin, die Gegenwart der Frau erfüllte ihn ganz.
Sie saß, während die Anderen sprachen, völlig unbeteiligt auf dem ledernen Sofa, einige Blumen in ihrem Schoße, und gebrauchte das Lorgnon, doch offenbar nur, um irgend etwas zu tun. So betrachtete sie aus ihren Steinaugen zuerst ein Bild an der Wand, dann den breiten alten Eichenschrank, endlich den blauen Kachelkranz des Ofens; und alle Teile seines elterlichen Hausrats schienen Matthias unter ihren Augen ärmlich zu werden und zu verbleichen.
Plötzlich spürte er, daß sie ihn betrachte. Wenig hätte gefehlt und er wäre an die Wand getaumelt, von der er in Entfernung stand. Was er in diesem vergangenen Jahr erlebt hatte – wenn auch noch so sehr ohne seinen Willen erlebt – hatte sein Blut zugänglich gemacht: ihm war, als müßte sein Herz vor dieser kalten schönen Dame zerbersten. Er wußte es dumpf schon längst, und brausend bestätigte es dieser Augenblick, daß hier sein Geschick sei, nicht in dieser Frau gewiß, aber in solchen Frauen. Er fühlte sich ohnmächtig und süß vernichtet.
Rücksichtslos tat sie, in die gedämpften Worte des Vaters hinein, eine Frage an Matthias. Sie fragte: »Wie ist das, kommen Sie hierher zurück, wenn Sie mit Ihrer Schule fertig sind?« Zu spät wagte Matthias zu glauben, sie habe sich an ihn gewendet. Er fand keinen Anfang, er stotterte, verwirrte sich. Gelangweilt sah sie von ihm weg, und da ihre Augen von ungefähr auf die Blumen in ihrem Schoße fielen, stand sie auf, schritt durch die schmale Tür ins Nebenzimmer, wo der geschlossene, verhängte Sarg sich befand, und man sah sie die weißen Blumen auf den Flor legen. Sie verharrte einen Augenblick, Matthias' Augen folgten der festen, schlanken Kontur ihres Rückens, sie kehrte zurück, reichte allen die Hand und ging – wie selbstverständlich gefolgt von ihrem Manne.
»Er haut die Leute jetzt«, sagte Susa, während sie unter der Tür stand und dem davonrollenden Wagen nachsah.
»Wen haut er?«
»So die Leute …« antwortete sie vage, »wenn einer etwas falsch macht.« Matthias fühlte, daß er sich empören müßte; davon geschah nichts. Er trat neben Susa hin und erkannte in der Ferne noch den schwarzen Stutz des kleinen, seidenen Hutes – an einer Biegung des Wegs, der sich gleich darauf in den schon winterlichen Wald verlor.
»Wir denken ja nicht an die Mutter«, sagte er laut, ohne daß er es wollte.
»Nein«, erwiderte Susa mit klarer Stimme.
Er blickte sie an; ja, sie war ein Weib mit ihren sechzehn Jahren. Eine Stunde darauf, während in der kleinen Kirche der Sarg eingesegnet wurde, folgte Matthias ihren Augen. Sie tauchten mit versunkenem Glanz in die eines jungen Menschen, der abseits an der Wand lehnte; er war hübsch und gewöhnlich, und der Blick, den er zurückgab, unverhüllt verlangend.
Während die Mutter eingesegnet wird! dachte Matthias, und wieder wollte er sich vorschreiben, zornig zu werden. Doch er erinnerte sich gewisser Auftritte in der Lehrerswohnung und sah schwach und gedemütigt auf seine gefalteten Hände hinunter.
Nach der Beisetzung war er allein zu Hause; er saß auf dem Ledersofa der Wohnstube, dort wo die Gräfin gesessen hatte, und starrte vor sich hin, mit einer bittern Leere im Herzen. Etwas kratzte an der Tür, er öffnete dem Hunde. Wächter war sehr gealtert, zum Mindesten ging er auch in sein vierzehntes Jahr. Seine Augen wiesen eine klebrige Nässe auf, und wie Matthias ihm den Rücken streichelte, kam die Hand an eine offene Wunde, deren Ränder zeigten, daß sie längere Zeit schon bestand, sich nicht mehr schließen konnte. Matthias schauderte ein wenig zurück, denn er neigte zum Ekel, und der Hund, als ob er in ihm läse, blickte ihn trübselig an.
»Ja,« sagte Matthias, »es war zu leicht, dich zu lieben, als du noch schön warst.« Er kniete nieder, zog das Tier zu sich heran und berührte die Wunde mit seinen Lippen. In diesem Augenblick ging die Tür auf, und Matthias sah den Vater im weiten Gehrock, den Seidenhut in seiner Hand, die in schwarzer Baumwolle steckte. »Wächter ist krank«, sagte Matthias verwirrt.
»Alt. Er benagt sich schon selbst,« sagte der Vater, »man muß ihm Gift zu fressen geben.«
»Gib ihn mir mit, die Lehrerin hat immer Abfälle, er kann unter meinem Bett schlafen.«
»Meinetwegen«, sagte der Vater, der an etwas Anderes dachte.
7
Die Lehrersfrau duldete das alte Tier, aber mit Ärger, und Matthias, in unbestimmter Angst, zeigte es wenig. Er kaufte ihm Milch von den wenigen Pfennigen, die zu seiner Verfügung waren, und ließ es des Nachts neben seinem Bett auf dem Kopfkissen liegen, dessen Überzug er beim Schlafengehen abnahm. Er erreichte durch seine Pflege, daß dem Terrier die Rückenwunde noch einmal zuheilte.
Eines Abends war die Frau wieder einmal allein zu Hause, und Matthias, wie er es pflichtmäßig tat, ging hinunter um ihr Gesellschaft zu leisten. Mürrisch empfing sie ihn, und als er sanft nach dem Grund ihrer Laune fragte, erklärte sie ihm mit einem Wort von gemeinem Klang, sie fühle sich schwanger, und das Kind sei gewiß nicht von ihrem kranken Manne.
Matthias erschrak bis auf den Grund seiner Seele; aber dann, nach einem Schweigen, sprach er zu ihr aus heiliger Pflicht die liebreichsten und schönsten Worte. Sie antwortete mit erneuten Giftreden, sie steigerte sich in Wut und versetzte ihm zuletzt einen Schlag. Matthias neigte nur das Gesicht ein wenig. Da stieß sie mit den Füßen nach ihm und spie ihm alle Schmutznamen ins Gesicht, die in ihr aufgespeichert lagen.
Es kamen für Matthias fast unertragbar harte Wochen. Der Mann ahnte zwar nichts, aber die Aussicht auf diesen Zuwachs schien ihn verzweifelt zu machen, und Matthias bot sich jeder Laune als Ziel. Er wollte es so. In seiner tiefen Unberatenheit hatte er sich eine schwere Schuld zurechtgelegt, die abzubüßen sei. Alles in ihm drängte nach Buße – nach einer Buße, die lichtlos war, weil er sich keine Verheißung gegenwärtig zu halten wußte. Die Religion mit ihren Erleichterungen war ihm ja fremd geblieben.
Matthias schränkte jedes seiner Bedürfnisse auf das Strengste ein. Er trank keine Milch und keinen Milchkaffee ferner, sondern einzig ein wenig Wasser, er nahm von den mageren Schüsseln noch weniger, als er gewohnt war; er gönnte sich nicht mehr die dünne Matratze seines Bettes. Sein Kissen war ja längst dem Hunde abgetreten, der immer darauf wartete, als auf sein Recht; nun aber zog Matthias, wenn er seine Kammer verschlossen hatte, an jedem Abend auch seine Matratze fort und breitete die Leinwand auf das nackte Drahtgeflecht, dessen Vorsprünge und Buckeln unter ihr hervortraten wie Rippen unter einem Leichentuch.
Matthias' Jugend triumphierte, er schlief dennoch, obgleich sein Rücken schwielig wurde. Er machte es sich zur Aufgabe, in jeder Nacht dreimal aufzuwachen, um nach Wächter zu sehen, der ihn matt anblinzelte und ihm die Hände leckte. Er zog sie fort …
Eines Nachmittags im Februar, als er nach Hause kam, fand er das Tier sehr krank, es heulte