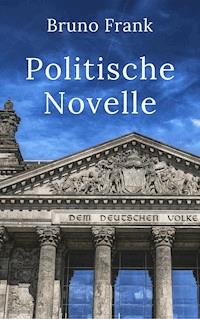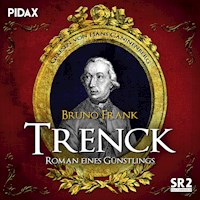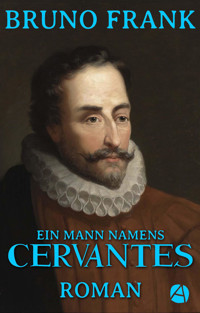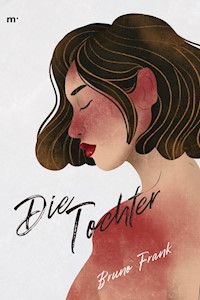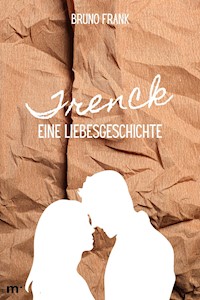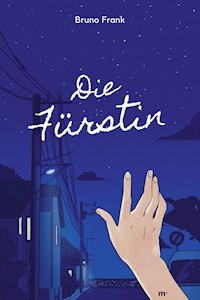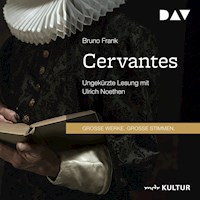Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unter den Arkaden, die den Marktplatz der tschechoslowakischen Grenzstadt Kumerau umgeben, kam an einem kalten Novemberabend des Jahres 1935 ein junger Mann daher, mit zögernden und vor Müdigkeit ungleichen Schritten. Mitunter machte er halt und blickte um sich. Passanten ließen sich keine sehen. Es war ziemlich dunkel hier, denn die Kaufläden schienen alle geschlossen, obschon es kaum über sieben war. Dort wo die Kolonnade umbiegt, fiel ein trübes Lichtband über den Gang. Der junge Mann blickte in den Vorraum eines Gasthofs. Er trat ein. Es war eine Absteige geringen Ranges, nichts, was einem Empfangsraum ähnlich sah, war vorhanden. Neben einem Stehpult, mit einem Schlüsselbrett dahinter, ging es gleich die läuferlose Treppe hinauf. Eine unbeschirmte elektrische Birne spendete zuckendes Licht, das Elektrizitätswerk von Kumerau schien an diesem stürmischen Spätherbstabend nicht ganz in Ordnung zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruno Frank
Der Reisepass
Roman
Inhalt
Der Reisepass
Prinz Ludwig
Herr Ozols
Der Smaragd
Der Reisepass
Unter den Arkaden, die den Marktplatz der tschechoslowakischen Grenzstadt Kumerau umgeben, kam an einem kalten Novemberabend des Jahres 1935 ein junger Mann daher, mit zögernden und vor Müdigkeit ungleichen Schritten. Mitunter machte er halt und blickte um sich. Passanten ließen sich keine sehen. Es war ziemlich dunkel hier, denn die Kaufläden schienen alle geschlossen, obschon es kaum über sieben war.
Dort wo die Kolonnade umbiegt, fiel ein trübes Lichtband über den Gang. Der junge Mann blickte in den Vorraum eines Gasthofs. Er trat ein. Es war eine Absteige geringen Ranges, nichts, was einem Empfangsraum ähnlich sah, war vorhanden. Neben einem Stehpult, mit einem Schlüsselbrett dahinter, ging es gleich die läuferlose Treppe hinauf. Eine unbeschirmte elektrische Birne spendete zuckendes Licht, das Elektrizitätswerk von Kumerau schien an diesem stürmischen Spätherbstabend nicht ganz in Ordnung zu sein.
Der Ankömmling rief mit einer belegten, wie von Anstrengung heiseren Stimme Hallo. Als niemand kam, zog er an einem Glockenstrang aus räudigem Samt. Nun öffnete sich hinter dem Pult eine Tür, die nicht ganz Mannshöhe hatte, und es zeigte sich ein untersetzter, verfetteter Mensch, der sich den Mund wischte und ohne Freundlichkeit nach dem Begehren fragte.
»Ein Zimmer für die Nacht!«
Der Wirt schob dem Fremden den üblichen Anmeldebogen hin. »Soll das Gepäck vom Bahnhof geholt werden?«
»Nicht nötig. Wenn Sie es wünschen, kann ich im Voraus bezahlen. Aber ich habe nur deutsches Geld.«
»Fünf Mark, Bett mit Frühstück. Und dann Ihren Pass bitte!«
Der Wirt musterte seinen Gast ungeniert, während der seine Personalien auf das Papier malte. Er war gut gekleidet, obwohl zu dünn für die gebirgige Gegend in dieser Jahreszeit. Von seinen Schuhen, die elegant, aber nicht besonders neu aussahen, sickerte Schmutzwasser und verbreitete zwei Lachen auf dem Estrich. Offenbar kam der junge Herr in diesem Promenadenanzug vom nahen Erzgebirge herunter, wo seit einigen Tagen schon Schnee lag. Seine Hand, die an den Daten schrieb, zitterte vor Kälte.
»Zweiter Stock. Nummer acht.« Der Wirt wies mit dem breiigen Kinn nach oben. Er machte keine Anstalt, den Fremden zu begleiten. »Den Pass nicht vergessen!«, rief er ihm nach, aber jener hatte schon das erste Stockwerk erreicht und hörte wahrscheinlich nicht mehr.
Der Verfettete nahm den Meldebogen mit sich in die Hinterstube, wo seine Frau beim Abendessen saß. Das Zimmerchen war überheizt, es roch nach warmer Wurst und Kartoffelsalat. Neben dem apoplektischen Hausherrn präsentierte sich seine Gefährtin mager und dürftig, als ein hausmausartiges Wesen, offenbar älter als er.
»Na?«, fragte sie kauend.
»Wieder so ein Jud, ein verdächtiger.« Und er las vor: »Ludwig Camburg, geboren 1908, Kunstgelehrter. Das kennt man.«
Er kannte das in der Tat. Der Übertritt aus dem deutschen Reichsgebiet war hier an der Erzgebirgsgrenze nicht leicht zu kontrollieren, und so sickerten Flüchtende, einzeln oder in kleinen Trupps, unausgesetzt herüber in das Gebiet der Nachbarrepublik, wo sie der Schutz einer verständigen und menschlichen Regierung erwartete. Die Arkaden um diesen Marktplatz hatten schon manchen Erlösungsseufzer gehört. Aber die deutschsprechende Grenzbevölkerung hier in der Gegend, wirtschaftlich leidend und von Agitatoren hitzig bearbeitet, war voll unklarer Sympathie mit den Zuständen im Reiche. Dort blühte ganz zweifellos das Paradies. Der Wirt zum »Morgenstern« war selber einmal in eine ziemlich finstere Affaire verwickelt gewesen, bei der zwei sehr forsche Herren in Sportanzügen einen weniger forschen, der sogar etwas betäubt erschien, morgens um drei in einen feinen Mercedeswagen zu ziehen bestrebt waren, genau hier vor seinem Etablissement unter den Arkaden. Niemand konnte damit rechnen, dass morgens um drei gerade an dieser Stelle zwei tschechische Polizisten auftauchen würden. Der »Morgenstern« war damals acht Wochen lang geschlossen gewesen. Und seither musste sich Herr Stohanzl damit begnügen, verdächtigen Reisenden doppelte Zimmerpreise abzuverlangen.
Zimmer Nummer acht war ein unwirtliches Loch, zwei Schritt breit und fünf lang, vom Schnitt einer Gefängniszelle. An ein derartiges Lokal erinnerte – wenn man solche Erinnerungen hatte – auch das Mobiliar.
Der Gast nickte vor sich hin, als habe er das alles nicht anders erwartet, und legte den Mantel ab. Da schlugen ihm vor Frost die Zähne zusammen. Ein eisernes Öfchen war vorhanden. Er blickte suchend nach einer Klingel umher. Aber schon öffnete sich ohne alle Umstände die Tür.
»Ich habe den Herrn um den Pass ersucht!« Der Wirt keuchte vom Treppensteigen.
»Muss das sein?«
»Polizeivorschrift. In einer Stunde können Sie ihn wiederhaben, wenn alles in Ordnung ist.«
Widerwillig zog der junge Herr das Dokument hervor. »Hören Sie, hier ist's sibirisch. Lassen Sie doch etwas einheizen.«
»Jetzt in der Nacht? Der Hausknecht wird nicht mehr auf sein.«
»Wann legen Sie denn Ihren Herrn Hausknecht ins Bett? Sehr human von Ihnen, aber weniger gegen die Gäste.«
Herr Stohanzl gab keinerlei Antwort, er lächelte auch nicht, wozu sich übrigens sein gepolstertes Antlitz schon physisch nicht eignete, und verschwand mit dem Pass.
Der Ankömmling setzte sich auf das Bett, das überraschend weich und elastisch nachgab. Unfähig zu irgendeinem Entschluss schloss er die Augen. Sein schmales, braunhäutiges Gesicht, das heute und vielleicht auch gestern nicht rasiert worden war, wirkte krank vor Erschöpfung. Die ungeschützte Birne hoch an der Decke – diese Art Beleuchtung schien eine Spezialität des Hauses zu sein – zuckte unablässig, und dies Zucken tat ihm weh hinter seinen Lidern.
Es pochte. Er antwortete nicht. Auf dem schäbigen Bettvorleger zu seinen Füßen breiteten sich bereits zwei neue Schneewasserlachen aus.
Behutsam öffnete sich die Tür, und abermals erschien der Wirt. Ein verwandelter Wirt, den gedunsenen Leib in Devotion zusammengeduckt. Hinter ihm war seine graue Lebensgefährtin sichtbar, die mageren Arme hoch bepackt mit Brennmaterial.
Herr Stohanzl bewegte sich vorwärts gegen das Bett, den Reisepass vor sich hingestreckt wie eine unanrührbare Kostbarkeit. »Haben Hoheit die Gnade zu entschuldigen«, ließ er vernehmen, »ich konnte unmöglich wissen, dass Hoheit ...«
»Heizen Sie bloß ein«, sagte der junge Herr. »Ich bin schon ganz blau.«
»Wenn Hoheit vielleicht ein größeres Zimmer wünschen ... Geruhen Hoheit nur zu verfügen.«
»Lassen Sie doch Ihr dummes Zeug«, sagte der Gast geärgert und warf den wunderwirkenden Pass hinter sich auf die Bettdecke. Er war aufgestanden und stapfte im Zimmer umher.
Die Wirtsfrau stand beim Ofen. Sie hielt ihre Holz- und Papierlast mit dem Kinn fest und starrte ihn an, in blödsinniger Verzückung.
Ihr Gatte kniete nieder, stopfte, raschelte und machte Feuer. Sein ungeheures Gesäß, das die Nähte zu sprengen drohte, sein elefantischer Rücken, der die Maschen der braunen Strickjacke dehnte, schienen kläglich um Verzeihung zu bitten.
Der junge Mann schob sich im Umherwandern die Hand unter die Weste. Sein Hemd fühlte sich feucht und hart an.
»Hören Sie mal«, begann er. Herr Stohanzl ließ sein Material zu Boden fallen und stand auf den Füßen. »Machen Sie mir einen Tee, recht stark, Rum dazu oder Arrak oder sonst einen Schnaps. Und dann hätte ich gern ein Nachthemd. Aber die Läden sind wohl schon zu?«
»Wird alles bestens besorgt, Hoheit. Ich komme schon hinten hinein. Wollen mir Hoheit nur die Allerhöchste Halsweite sagen.«
»39 – allerhöchste Halsweite 40. Und eine Zahnbürste wenn's geht, und ein Stück Seife.«
»Gewiss, Hoheit, geht es. Alles geht, Hoheit.« Er badete sich in der Anrede, unersättlich. »Hoheit haben sich gewiss auf der Jagd verirrt«, fügte er waghalsig hinzu, in Erinnerung vielleicht an ein Lesebuchstück vom Kaiser Maximilian, das er in alten habsburgischen Zeiten in der Volksschule hatte auswendig lernen müssen.
»Auf der Jagd«, sagte der junge Gast, »gewissermaßen.«
Als er sich eine Viertelstunde später entkleidete, riss ihm unter seinen erstarrten Fingern eine dünne Kette aus Platin, die er um den Hals trug, und ein schwerer Gegenstand fiel auf den schäbigen Bettvorleger. Betroffen schaute er darauf nieder, hob ihn auf und legte ihn auf den Nachttisch, neben das Teegeschirr. Er nahm einen Schluck von dem heißen, fadschmeckenden Trank und schielte dabei auf das grüne Ding. Es war flach wie ein Amulett oder Medaillon. Er setzte die Tasse weg und nahm es zur Hand. Es schien sein Interesse zu fesseln, obgleich er es doch am Leibe getragen hatte und also eigentlich kennen musste. Aber vielleicht kannte er es eben darum nicht genau.
So verhielt es sich. Dieses Medaillon oder Amulett hatte er seit seinem zehnten Geburtstag um den Hals getragen, siebzehn Jahre lang, ununterbrochen, sogar im Bad. Und gerade heute, gerade hier, war nun die kurze Schnur gerissen, und das Ding war zu Boden gestürzt. Er konnte nicht umhin, das seltsam zu finden. Es ging ihm sogar ein kleiner Schauer durch den Leib, und er kam nicht von der Kälte.
Er schlüpfte ins Bett und verbrannte sich den Fuß an der blechernen Wärmflasche, die man ihm unbemerkt hineingeschoben hatte. Dann kam ein Wohlbehagen über ihn, das Behagen des Geborgenen, Wohlaufgehobenen – ein Behagen, das unstatthaft war, dessen er sich schämte, und dem er sich doch überließ. Eine süß schmerzende Müdigkeit sickerte ihm durch die Glieder. Der Lichtschalter befand sich in Reichweite über dem Bett. Im Grunde – eigentlich – war dies hier ein recht komfortables Gasthaus. Und in der Tschechoslowakischen Republik lag es auch.
Aber anstatt nach dem Schalter griff er noch einmal rechtshin nach seinem Amulett. Er betrachtete es, als sähe er's zum ersten Mal. Es war übrigens der Betrachtung wert.
Es war ein flacher, wunderbarer Smaragd von selten erschauter Größe. Höchst kunstvoll hatte man ihn zum Wappenschilde gearbeitet. In sein satt leuchtendes Grün war das Wappen eingeschnitten mit der goldenen Königskrone darüber. Es zeigte sieben goldene Türme, und die Türme wiederum hatten winzige Türchen aus Saphir. Es war ein Stück aus der portugiesischen Erbschaft seines Hauses.
Diesen Smaragd der Maria da Gloria in der Hand schlief er ein. Die unbeschirmte Birne brannte und zuckte die Nacht durch. Das Elektrizitätswerk von Kumerau schien in immer schlimmere Unordnung zu geraten. Aber er schlief wie ein Toter, oder wie ein vom Tode Geretteter.
Prinz Ludwig
1
Ludwig Prinz von Sachsen-Camburg war nicht ganz zehn Jahre alt, als sein Vater, der regierende Herzog, zugleich mit all den anderen deutschen Herzögen, Großherzögen und Königen, von seinem Throne glitt. Ludwig erinnerte sich lange genau an den Tag. Er stand mit seinem um drei Jahre älteren Bruder August und dem Hauslehrer auf einem Seitenbalkon des Residenzschlosses, als um elf Uhr morgens die angekündigte Delegation der neuen republikanischen Regierung erschien. Sie kam zu Fuß. Es waren drei Herren im Zylinder, mit dunklen Überziehern, zwei von ihnen schlank und auffallend groß, der in der Mitte untersetzt. Sie verschwanden im Mittelportal.
Der Hauslehrer forderte die Prinzen auf, ins Zimmer zurückzukehren, denn der Novembertag war unfreundlich. Aber Ludwig erklärte, er müsse die Abordnung bei ihrem Rückzug noch einmal sehen, und blieb allein auf dem Balkon zurück. Er hatte auch nicht lange zu warten. Nach kaum zehn Minuten war der Staatsakt vorbei. Die drei Herren wandelten genierten Schrittes wieder über den menschenleeren Schlossplatz. Dann blieben sie stehen. Der in der Mitte tastete in seiner Mappe umher, als fürchte er, etwas verloren oder vergessen zu haben, nahm dann ein Papier hervor, entfaltete es, und alle drei steckten die Köpfe zusammen und blickten hinein. Es war dem zehnjährigen Prinzen auf seinem Balkon klar, dass dies der unterzeichnete Thronverzicht war.
Um halb eins war Familienfrühstück wie immer. Ludwig war gespannt, was der Vater vom Ereignis des Vormittags zu berichten haben würde. Aber er berichtete gar nichts. Der einschneidende Akt wurde ignoriert. Herzog Philipp erschien ruhig wie sonst und teilte in langen Pausen ein paar seiner frostigen Scherze aus. Sein Haus war mehr als tausend Jahre souverän gewesen, ihm seinen Rang durch ein Blatt Papier abdingen zu wollen, war eine nicht erwähnenswerte Albernheit. Erwähnt wurde sie immerhin, einmal, ganz kurz, ganz zum Schluss. Als der Herzog die Tafel aufhob und seiner Gattin die Hand küsste, hielt er sie einen Augenblick länger fest als gewöhnlich und sagte mit herabgezogenen Mundwinkeln: »Auf der Schreibmaschine getippt, Beatrix!« Das war alles. Aber augenblicklich, als hätte sie auf dieses Stichwort gewartet, liefen der Herzogin die Tränen herunter.
Anna Beatrix war eine portugiesische Braganza, sehr fromm, sehr still, vom Beginn ihrer Ehe an leidend. Ihre Stimme, die lieber und geläufiger Französisch sprach als Deutsch, klang klagend und ausgebleicht, es war eine weiße Stimme.
Einige Wochen nach der Thronentsagung feierte Ludwig seinen zehnten Geburtstag. Nach dem Herkommen wäre er an diesem Tag als Leutnant in das Sachsen-Camburgische Infanterieregiment eingestellt worden. Eine kleine Uniform mit Gardelitzen war bereits angefertigt und lag bereit. Dies fiel nun weg. Stattdessen hing ihm seine Mutter am Morgen, nach dem Gottesdienst in der Annenkirche, den Smaragd der Maria da Gloria um den Hals. Sie küsste ihn unter Tränen dabei. Ludwig war ihr Liebling.
Im Übrigen blieb so ziemlich alles wie es war. Der Landtag des kleinen Bundesstaates hatte eine sozusagen sozialistische Mehrheit, die fast vom ersten Tag an mit schlechtem Gewissen regierte. An den gesellschaftlichen Verhältnissen änderte sich nichts, an den ökonomischen beinahe nichts. Die Lage der Arbeiter in den Industriebezirken des Ländchens – man produzierte vorwiegend Spiel- und Glaswaren – blieb wie sie gewesen, die Lage der landesherrlichen Familie ebenfalls. Der sozialistische Landtag sprach ihr eine Abfindung in fast verblüffender Höhe zu. Man wollte auch ferner den Glanz des uralten Hauses, auf das man stolz war. Es blieben der Hofstaat und das bescheidene Zeremoniell, es blieben sogar die beiden grün-weiß gestrichenen Schilderhäuschen am Hauptportal, obwohl sie jetzt leer standen. Nicht ohne Bedauern nahm der Staatspräsident, eben jener kleine Herr, der in der Mitte der Delegation geschritten war, Inhaber eines florierenden Gas- und Wasserleitungsgeschäfts, sein Hoflieferantenschild herunter. Er war aber auch der Einzige, der das tat. Es wurden sogar neue Hoflieferanten ernannt, und jedermann fand es ganz in Ordnung.
Prinz Ludwig genoss weiter den Unterricht des Hauslehrers Doktor Steiger, eines befähigten Philologen und Historikers, auch als sein Bruder August in die Oberklasse des Gymnasiums eingetreten war. Steiger war ein ruhiger, überaus gepflegter Mann in den Dreißigern, mit sehr großen, sanften, braunen, etwas vorstehenden Augen und einer feinen Stimme; er hatte im ersten Kriegsjahr durch einen Granatsplitter die linke Hand verloren. Sein Monarchismus war tief und leidenschaftlich und von speziell camburgischer Prägung. Er hatte über die herzoglichen Linien des Hauses Sachsen mehrere Werke veröffentlicht, und wahrscheinlich gab es auf Erden niemand, der über deren kompliziert verschränkte Geschichte so nachtwandlerisch Bescheid wusste. Lang verschollene, verschwundene Zweige, Sachsen-Merseburg, Sachsen-Römhild, Sachsen-Teschen, Sachsen-Barby, führten in seinem Kopf, in seinem allein, ein farbiges, plastisches Leben. Dies alles waren Wettiner, die Welt hieß für Doktor Steiger Wettin. Und das war nicht abstrakte Genealogie und Heraldik. Sein Gegenstand entflammte ihn. Er träumte, er plante vielleicht. Warum ließ sich dieses fürstliche Haus nicht ebenso gut als Schnittpunkt europäischer Geschichte denken wie Habsburg und Zollern? Camburg war älter. Camburg war älter als alle. Vor fast tausend Jahren war Prinz Ludwigs Vorfahr Dietrich in der Sarazenenschlacht Kaiser Ottos des Zweiten in Kalabrien gefallen. Und das war keineswegs der früheste Ahnherr seines Schülers, von dem Doktor Steiger wusste.
Im 19. Jahrhundert hatte das nahe verwandte Coburg nacheinander seine Söhne auf die Throne von Belgien, England, Portugal und Bulgarien entsandt. Doktor Steiger sprach selten davon. Doch er dachte daran. Vielleicht war er eifersüchtig auf Coburg.
Denn das Haus, dem er diente, schien ihm zu solcher Rolle weit glänzender bestimmt. Die Camburger, obwohl Herren über eine vorwiegend protestantische Bevölkerung, waren vor zweihundert Jahren zur alten Kirche zurückgekehrt – aus Gründen irgendeiner Erbteilung. Ihr Katholizismus war ziemlich äußerlich geblieben, Herzog Philipp zum Beispiel war religiös ganz indifferent. Aber als eine der wenig zahlreichen katholischen Fürstenfamilien hatte man sich durch Heirat mit Habsburg verknüpft, mit Sizilien, mit Savoyen. Andererseits bestand, seit der Reformationszeit, Verwandtschaft mit Schweden und den holländischen Oraniern.
Mit Rührung blickte Steiger auf seinen jungen Prinzen, dies zarte Gefäß für jedes erlauchte europäische Blut. Der Umgang mit ihm wurde ihm niemals zur Selbstverständlichkeit. Unter der bräunlichen Haut seiner Schläfen sah er in seinen Adern das Blut klopfen, und es war das von Maria Theresia und von Wilhelm dem Schweigenden.
Häufig richtete er die gemeinsamen Spaziergänge nach dem unweit gelegenen Stammschloss. Es stand nur noch ein einziger Turm von der Camburg, ein uralt rohes Gemäuer, das man neuerdings leider wieder besteigbar gemacht hatte. Viel Butterbrotpapier lag dort oben immer herum. Aber Butterbrotpapier oder nicht – der alte Turm schien dem Doktor Steiger verehrungswürdiger als Buckingham Palace und als die Schlösser von Laeken und Lissabon.
Als Ludwig fünfzehn Jahre alt war, verlor er seine Mutter. Ihr schwaches Licht verflackerte schmerzenlos. Tage hindurch saß Ludwig und hielt eine nasse heiße Hand, die nicht breiter war als bei anderen Menschen drei Finger. Es roch im ganzen Trakt nach Weihrauch. Herzog Philipp kam in gemessenen Abständen ins Zimmer, küsste seine Frau auf die Stirn und frug nach ihren Wünschen. Und immer fand er seinen zweiten Sohn an ihrem Bett. Der Erbprinz erschien selten und immer nur auf einen Augenblick; die Atmosphäre von Krankheit und Hingang war seiner egoistisch groben Natur unerträglich. Am Tag vor dem Ende fand Ludwig den Bruder, wie er in einem Saal des Erdgeschosses mit einem Kammerherrn Billard spielte. Der Kavalier wurde rot, aber August blieb zielend über der Tischkante liegen, um einen schwierigen Ball zu machen. Ludwig wartete, bis der Ball gefehlt war und sein Bruder wieder auf den Beinen stand, dann blickte er an ihm hinauf und sagte mit Ekel in der Stimme: »August, du bist ein erstaunliches Schwein.« Worauf er seinen Weg fortsetzte.
Die Beisetzung vereinigte Fürstlichkeiten aus ganz Europa. Mehrere Thronfolger noch regierender Häuser waren erschienen, dazu eine ganze Anzahl von Prätendenten. Es kamen Braganza, Bourbon, Orléans, Este, die ganze untergegangene Geschichte des Erdteils, Hochadel dazu mit verwunderlichen Namen, Dentici-Frasso, Vallabriga y Chinchon. Herrschaften waren darunter, die jedes Mal den Hut abnahmen, wenn sie die Worte »Feu mon grand-père« aussprachen, und solche, bei denen die Türklinken abgewischt wurden, wenn ein Protestant zu Besuch dagewesen war. Man sah Uniformen, die in keinem Lande der Erde mehr galten, Sterne und Großcordons, die im Jahre 1868 zum letzten Mal rechtmäßig verliehen worden waren. Der spukhafte Glanz in der Annenkirche war so seltsam, dass die Trauer vor ihm zunichte wurde. Nur Ludwig, der ein vom Weinen völlig verschwollenes Gesicht aufwies, brauchte keine Anstrengung, um zu wissen, dass dort in dem Katafalk der schmale Leib seiner Mutter verschlossen lag.
Er ließ sich nach der Zeremonie sogleich von Steiger in seine Wohnung zurückführen, zwei Zimmer im Ostflügel des Schlosses, deren Fenster auf den Park sahen. Es war Juni und wunderschönes Wetter. Ludwig lehnte sich zum Fenster hinaus. Gerade vor ihm stand ein alter Ahorn. Ein niedlicher Specht mit rotem Scheitel hackte aus Leibeskräften auf die Rinde los und schickte nach je zwei Schnabelhieben seine spitzige Zunge hinein, um Insekten hervorzuholen.
»Macht er denn den Baum nicht kaputt?«, fragte Ludwig.
»Nein«, sagte der hinter ihm stehende Steiger, »ein Specht hackt nie gesunde Stellen an. Der alte Ahorn ist morsch.«
»Aha«, wollte Ludwig sagen. Aber er brachte nur ein Krächzen heraus und warf sich laut aufweinend in einen Sessel, das Gesicht in den Händen, den ganzen Körper geschüttelt.
Sein Lehrer sah dem eine Weile sorgenvoll zu. Dann legte er ihm den unverstümmelten Arm um die zuckende Schulter: »Ludwig, Sie machen sich krank. Bewahren Sie Haltung. Es wird Ihnen helfen.«
»Ich will aber keine Haltung! Ich hasse Haltung. Nichts fühlen und ein feierliches Gesicht dazu schneiden kann jeder. Ich hätte die haltungsvollen Herrschaften anspucken können in ihren roten und grünen Affenjacken. Man hat meine Mama zu wenig geliebt, und daran ist sie gestorben.«
»Sie wissen doch selber ganz gut ...«
»Ja, ich weiß alles ganz gut. Krankheiten sind Vorwände, glauben Sie mir's, Doktor!«
»Vorwände«, sagte Steiger kopfschüttelnd.
»Wandschirme, die sich die ermattete Seele vorhält, wenn es ihr nicht mehr lohnt zu leben.«
»Kommen Sie«, sagte Steiger, »Sie sollen an anderes denken!«
Seine Stimme schwankte, er war selber den Tränen nahe. Ihm war anzusehen, dass er seinen Zögling leidenschaftlich liebte. Dieser Monarchist sah in dem zarten, schönen hochveranlagten Knaben etwas, was es auf Erden sonst kaum mehr gab: einen wirklichen Fürsten. Er hatte die Trauergäste, von denen Ludwig so respektlos sprach, selbst eingehend und sehr kritisch gemustert. Er fand sie, mit zwei oder drei Ausnahmen, grenzenlos ordinär. Er fand auch den Erbprinzen ordinär. Der Herzog selber war zwar nicht ordinär, aber resigniert und blutlos, kein Gegenstand der Liebe. Ludwig war dies und war mehr.
»Woran soll ich denken nach Ihrer Ansicht? Vielleicht ans Billard wie mein Bruder? Was macht der Mensch übrigens?«
»Seine Hoheit geleitet die Fürstlichkeiten zum Bahnhof. Dankenswert, dass Seine Hoheit das übernommen hat.«
»Bringen Sie mich nicht zur Verzweiflung mit Ihren Kurialien, Steiger. Seine Hoheit! Das ist wahrhaftig die Bezeichnung für den.« Aber der Ausbruch hatte ihn doch entlastet. »Woran soll ich denken«, fragte er ruhiger.
Steiger zog einen Stuhl heran, ließ sich nieder und nahm vertraulich die Hand seines Schülers. »Haben Sie bemerkt, dass der Sarg Ihrer entschlafenen Frau Mutter neben dem Sarkophag des Kaisers seinen Platz gefunden hat?«
»Nun und?«, fragte Ludwig. Seine Stimme klang wund.
»Und«, wiederholte Steiger mit sanftem Vorwurf und sah seinem Zögling in die Augen.
Es war in der Tat ein deutscher Kaiser in der Krypta der Annenkirche beigesetzt, einer aus dem 14. Jahrhundert, der freilich nur kurz und umstritten regiert hatte.
Ludwig wurde plötzlich rot und stand auf.
»Wie kann ein Mann wie Sie solchen Träumen nachhängen«, sagte er in Verwirrung.
Steiger antwortete ernst: »Nicht weit von hier hat schon einmal ein einfacher Mensch, ein Landarzt, solche Träume gehegt. Er hat sie in Taten umgesetzt. Er hat die coburgischen Verwandten Eurer Hoheit auf drei Königsthrone geleitet.«
»Ich weiß, dass dieser Doktor Stockmar Ihre Gedanken beschäftigt. Aber das ist hundert Jahre her. Die Zeiten sind vorbei.«
»Und darf ich Sie fragen, warum, Prinz? Meinen Sie, diese deutsche Republik werde ewig stehen – eine Republik, die selber nicht wagt, sich bei Namen zu nennen, eine Republik ohne Mut, ohne Glanz, ohne wirklichen Drang zur Gerechtigkeit. Die Leute pfeifen ja in den Versammlungen, wenn man ihre Staatsform erwähnt. Und was kommt dann?«
»Kein Camburgischer Kaiser.«
»Warum nicht! Deutsche Kaiser haben Nassau geheißen, Luxemburg, Pfalz. Waren das bessere Namen? Warum nicht ein Kaiser aus einem Haus, neben dem diese kompromittierten Hohenzollern Parvenüs sind? Nennen Sie mich nicht gefühllos, Ludwig, wenn ich noch einmal an die Krypta erinnere. Fünfhundert Jahre lang hat jene Grabnische leergestanden. Es ist kein Zufall – es soll keiner sein, dass der neue Sarg nun neben dem Sarge des Kaisers steht.«
2
Im Westflügel des Residenzschlosses, im zweiten Stockwerk, lagen die »Kammern Johanns des Gläubigen«, drei Räume in der Ausschmückung des siebzehnten Jahrhunderts. Sie umfassten das Münzkabinett des Herzogs. In langen Mahagonikästen waren hier auf dunkelgrünem Samt seine silbernen und goldenen Schätze zur Schau gelegt.
Die beiden ersten Säle waren völlig der Münzgeschichte Sachsens gewidmet. In wundervoll erhaltenen Exemplaren erglänzte hier Johann Friedrich neben Johann Georg, Adolf Wilhelm neben Franz Josias, Ernst an Ernst. Diese Sammlung war so gut wie lückenlos. Sie hatte vor Herzog Philipp nicht existiert, sie war völlig sein Werk, sein Stolz und eigentlich seine einzige Liebhaberei.
Er war sonst nicht leicht zu unterhalten. Wie alle seine Kollegen subventionierte er zwar ein Hoftheater und ein Hoforchester, aber er zeigte sich selten, nur aus Anlässen notwendiger Repräsentation, in der mit Purpurtuch behangenen rechten Proszeniumsloge. Baulust, die ihm als Erbteil wahrscheinlich im Blute lag, mochte durch die verfassungsmäßige Kontrolle seiner Finanzen zurückgedrängt worden sein. Die Jagd, herkömmliche Zerstreuung sich langweilender Fürsten, zu der in den ausgedehnten Wäldern seines Gebietes reiche Gelegenheit war, hatte ihn niemals gereizt; er war erstaunt, diese Leidenschaft in seinem älteren Sohne neu aufflammen zu sehen. Als Münzensammler hatte er Rang und genoss Ansehen unter den Fachleuten. Vermutlich hatte er zuerst einfach sein Vergnügen daran gehabt, seine Ahnherren und Verwandten in Edelmetall beieinander zu haben. Aber dieser Hang hatte sich langsam zu wirklicher Kennerschaft gewandelt. Er verbrachte mehr Zeit in den Kammern Johanns des Gläubigen als in seinem Arbeitszimmer.
Gerade als an der sächsischen Sammlung nicht viel mehr zu tun blieb, hatte ihn eine Italienfahrt in die Münzkabinette von Turin und Neapel geführt. Und hier, ganz zur rechten Zeit, hatte sich seiner ein neuer Ehrgeiz bemächtigt, vor dem die fast kompletten Herzöge und Kurfürsten alsbald zurücktraten. Dieser neuen Leidenschaft war das dritte, kleinste Zimmer gewidmet.
Eine Sammlung altgriechischer Münzen war hier vereinigt, nicht umfangreich, doch erlesen. Um jedes ihrer Stücke war auf den Auktionen von London und Paris gerungen, für manche waren Preise bezahlt worden, über die in der herzoglichen Finanzdirektion Kopfschütteln entstand. Wetzlar, der Frankfurter Antiquar, der diese Ankäufe vermittelte, war in der Finanzdirektion kein beliebter Mann. Aber ihm hatte es Herzog Philipp zu danken, wenn sein griechisches Münzkabinett neben den großen europäischen Sammlungen ernsthaft mitzählte.
Seine Leidenschaft war umso konzentrierter und heftiger, als sie einsam war. An seinem Hofe, in seiner Stadt, verstand niemand etwas von griechischer Numismatik. Der Althistoriker der Landesuniversität, ein unappetitlicher und verlegener Greis, sah in diesen Gold- und Silberstücken nichts als Hilfsmittel zur geschichtlichen Forschung und war ohne Auge für ihren Kunstwert und Reiz. Er wurde zweimal zu Hofe geladen und dann niemals wieder. Über seine Schätze sprechen konnte der Herzog eigentlich nur mit Jacques Wetzlar selbst, und der kam natürlich nicht ungerufen. Allzu häufig rufen aber konnte man ihn schicklicher Weise nicht. Erschien er, so verweilte der Herzog viele Stunden lang mit ihm in jenem dritten Zimmer, niemand durfte stören, und noch Tage nach einem solchen Besuch pflegte der Landesherr in gehobener Stimmung zu sein.
Kein geringes Ziel hatte sein Ehrgeiz sich gesteckt. Die leicht erlangbaren Münzen der Spätzeit, ausgegeben von den hellenistischen Königen und unter der Römerherrschaft, waren verschmäht. Die Sammlung hob an mit uralten, plumpen Stücken, sechs oder sieben Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung aus dem Golde der lydischen Flüsse geprägt: oval noch die ersten oder kugelig von Gestalt, die folgenden flach, aber unvollkommen gerundet, einseitig bebildert und ohne Aufschrift, zu unterscheiden nur am Emblem ihres Landes oder ihrer Stadt. Die Schildkröte von Ägina war da, der böotische Schild, die ephesische Biene, die Rose von Rhodos. Eine etwas spätere Zeit bevorzugte Silber: Geld von Amphipolis mit dem Apollon, Geld von Naxos mit dem efeubekränzten Dionysos, Geld von Athen mit dem Haupte der Pallas. Und die Sammlung schloss ab mit Münzen des großen Alexander, auf denen zum ersten Mal statt des Götterbilds das Portrait eines irdischen Herrschers erscheint.
Den Prinzen war das Betreten der Räume lange Zeit ausdrücklich untersagt, und zwar seit dem Tage, da Herzog Philipp versucht hatte, seinen Ältesten mit seinen Schätzen bekannt zu machen. August war damals sechzehn, für standesgemäßen Sport interessiert, dazu in etwas auffälliger Weise auf seine persönliche Eleganz bedacht, und er wusste ganz offenkundig nicht, was er aus den buckeligen Metallstückchen machen sollte, die da so anspruchsvoll in grünen Samt gebettet lagen. Es hatte Jahre gedauert, bis der Sammler an seinem Zweitgeborenen den Versuch wiederholte. An ihm erlebte er mehr Freude. Der fragte wenigstens. »Hat man auch vor den Griechen schon Münzen geprägt, Papa, oder haben die sie erfunden«, fragte er, nachdem er eine Weile unter den beobachtenden Augen des Herzogs stumm von Kasten zu Kasten gerückt war.
»Das ist eine ganz gute Frage«, antwortete Herzog Philipp, und es war beinahe ergreifend zu sehen, wie seine matten grauen Augen aufglänzten. »Eine ganz gute, verständige Frage. Nein, das ist eben der Grund, weshalb wir diese frühen Kugeln und Barren mit Verehrung betrachten müssen. Im Kopf eines Griechen vor nun fast dreitausend Jahren ist dieser Gedanke entstanden. Es muss ein Mann gewesen sein, Ludwig, so originell und bedeutend wie der, der – ja – die Schere erfunden hat oder das Wagenrad. Eines von den wahren Genies, deren Name auf immer verborgen bleibt. Stell es dir nur recht lebendig vor: Gold und Silber waren selten in der Welt und waren gesucht, und man zahlte damit. Aber wie mühsam! Kauft einer sich Waffen oder Gewebe oder Öl, immer musste er das Metall abwägen mit der Waage und ausproben mit dem Probierstift. Noch war keinem der Gedanke gekommen, keinem unter Millionen, dass man dem Barren ja einen Stempel aufdrücken könne, um Bürgschaft zu leisten für Gewicht und Gehalt. Bis eines Tages der Geniale kam und das einfache Wort aussprach. Vielleicht drehte er sich dann auf den Hacken um und ging davon und hatte es schon vergessen – aber die Kaufleute oder Regierungsmänner blickten ihm nach mit offenen Mündern, und so sollten auch wir ihm noch nachblicken, dem Unbekannten, in die Dämmerung der Vorzeit, darin er verschwunden ist.«
Am darauffolgenden Tag wurde Wetzlar aus Frankfurt erwartet. Er wurde zur Tafel gezogen. »Gestern habe ich meinen Jüngsten in unsere Anfangsgründe eingeweiht«, sagte der Herzog aufgeräumt zu seinem Kommissionär, »es scheint, dass er begriffen hat oder doch einmal begreifen wird.« Und er schenkte, mit einer Geste, als verliehe er einen Orden, Ludwig ein halbes Glas Rotwein ein. Dann streifte er mit einem ziemlich verächtlichen Blick den Erbprinzen und schloss ein Auge dabei. Der Erbprinz wurde zornrot, er sah sich bloßgestellt vor dem Händler und verschloss dies Erlebnis in seinem primitiven Herzen.
Er hätte sich sagen mögen, dass er keineswegs bloßgestellt sei. Wetzlar konnte den abschätzigen Blick nicht bemerkt haben. Denn seine dunklen Augen, die hinter kompliziert geschliffenen, dicken Gläsern unheimlich vergrößert erschienen, sahen beinahe nichts. Dieser berühmte Experte des numismatischen Weltmarkts, ohne den das Britische Museum und die Bibliothèque Nationale wichtige Münzkäufe ungern abschlossen, nahm nur Umrisse wahr. Dafür hatte sich das Gefühl seiner Finger, und zwar besonders seiner beiden kleinen Finger, bis zum Unfassbaren entwickelt. Sacht und liebkosend tupfte er mit der Spitze über die geprägte Fläche und sprach ein Verdikt, gegen das es keine Berufung gab. Im vertrauten Kreise ließ er sich zu Experimenten herbei. Er schloss die Augen, man legte ihm Münzsorten vor, und nach kurzem Tasten und Streicheln hieß es: Zwölf Kreuzer Christian von Lüneburg, Denar Karls des Großen, China Thsin-Dynastie.
Jacques Wetzlar war ein kleiner, feingliedriger Herr mit seidig gepflegtem Schnurrbart und Kinnbart, weit vor seinen Jahren ergraut. Er sprach Frankfurter Dialekt mit unverhohlen jüdischem Tonfall, und den behielt er auch in den fünf oder sechs fremden Sprachen bei, die er beherrschte. Sein Vermögen galt für bedeutend. Er lebte in einer weitläufigen Villa an der Miquelallee in Frankfurt, als Witwer, ganz allein mit seinem Töchterchen. Seine Geschäftsräume am Rossmarkt galten als eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Er pflegte, vermutlich aus Scheu vor den Stufen der Eisenbahnwaggons, seine zahlreichen Berufsreisen im Auto zurückzulegen. Alle paar Monate sah Ludwig den großen grauen Tourenwagen im inneren Schlosshof halten. Immer hatte der Chauffeur, ein treuaussehender Mensch von Gardemaßen, nachdem er seinen Herrn die Treppen hinaufgeleitet, an dem Auto etwas zu scheuern und blankzureiben.
Mit den Jahren wandelte sich Wetzlars Schwachsichtigkeit in fast völliges Blindsein. Die Netzhautablösung war weit vorgeschritten. Und als Ludwig zum ersten Mal von der Universität nach Hause kam, hatte Wetzlar nicht mehr allein reisen können. Er hatte sein Töchterchen mitgebracht, ein Kind von vierzehn Jahren, das ihn führte und ihm bei Tisch die Geräte zurechtlegte.
Ludwig kam aus besonderem Anlass mitten im Semester von der Hochschule herüber. Heute vor 25 Jahren war Herzog Philipp zur Regierung gelangt.
Der Tag wurde still begangen. Mochte seiner nun in der Bevölkerung gedacht werden oder nicht – zu Festlichkeiten bestand wenig Anlass, da ja das Haus Camburg seit zwölf Jahren nicht mehr »regierte«. Dem Magistrat der Residenzstadt, der unter der Hand angefragt hatte, ob eine offizielle Begrüßung willkommen sei, war durch das Hofmarschallamt abgewinkt worden. Die ›Camburgische Landeszeitung‹ hatte einen wehmütig-innigen Aufsatz gebracht, in ihrem nichtpolitischen Teil. Fünfzig oder sechzig Depeschen waren eingetroffen, hingegen auf Wunsch kein Verwandtenbesuch. Die beiden Prinzen hatten am frühen Morgen schon gratuliert, Ludwig mit ein paar gelispelten Worten und einem Kuss auf die väterliche Hand, der Erbprinz mit Kommandostimme und Hackenzusammenschlagen, genau in der Art, die seinen Vater unfehlbar nervös machte.
Die Entfremdung zwischen den beiden war neuerdings schlimm gewachsen, besonders seitdem Prinz August sich der populär nationalistischen Richtung verschworen hatte, deren Gelärm und Gehetze dem leidenden Deutschland in den Ohren zu gellen begannen. Bei einem Neujahrsdiner vor nunmehr fast zwei Jahren hatte er den versammelten kleinen Hof damit überrascht, dass er seinen Toast auf den Vater mit einem kehlig hervorgestoßenen »Deutschland erwache!«, beschloss, worauf ihm der Herzog überhaupt nicht dankte und ihm unmittelbar nachher unter vier Augen nahelegte, derartiges Pöbel-Rülpsen, wie er sich ausdrückte, gefälligst für seinen engeren Freundeskreis zu reservieren.
Jacques Wetzlar hatte vor einigen Tagen telegraphisch angefragt, ob sein Besuch genehm sei, in einer Form, aus der nicht hervorging, dass er die Bedeutung des Tages kannte. Antiquarische Geschäfte aber waren diesmal nicht abzuwickeln.
Die Mittagsmahlzeit im kleinsten Kreis war vorüber. Der Erbprinz stand auf. »Du könntest wenigstens noch den Kaffee mit uns nehmen«, sagte sein Vater erstaunt und wies nach dem anstoßenden Raum.
Prinz August erwiderte laut und schneidend: »Ich komme wieder, Papa, sobald hier die übliche gute Luft herrscht.« Er verbeugte sich eckig und ging.
Ludwig war um die Nase herum ganz weiß geworden, er verspürte eine plötzliche Übelkeit. Ohne den Kopf zu bewegen, blickte er zwischen den Anwesenden hin und her. Sowohl der Herzog als der Hofmarschall als auch der diensttuende Adjutant hatten völlig sachliche, ausdruckslose, verbindliche Gesichter. Gesichter, die das Gehörte leugneten, es einfach ausstrichen, man konnte zweifeln, ob etwas dergleichen wirklich ausgesprochen worden war. Anders der Antiquar selbst. Auf den Arm seines stillen Töchterchens gelehnt, stand er schon aufrecht. Er lächelte entschuldigend. »Junge Leite!«, sagte er mit besonders starkem Akzent und erweckte damit in Ludwig eine seltsam komplizierte Empfindung. War dies Würdelosigkeit, Demut, Hohn oder war es Weisheit – er wusste es nicht zu entscheiden. Aber noch dreißig Jahre später, als Jacques Wetzlar und der Herzog lange schon tot waren und er selbst graue Schläfen hatte, vermochte sich Ludwig den Tonfall dieser zwei Worte ohne Mühe zurückzurufen.
Im angrenzenden Salon, der mit breiten englischen Sesseln ausgestattet war, bestand die eine Wand fast völlig aus Glas. Man blickte über den Park in eine weiche, weite Flusslandschaft, die in der Septembersonne leuchtete. Die beiden Kavaliere hatten sich zurückgezogen. Man trug den Kaffee auf. Das junge Mädchen hatte sich den einzigen unbequemen Sitz ausgesucht, einen hochlehnigen Holzstuhl dicht neben dem flammenlosen Kamin, möglichst weit entfernt von der Fensterwand.
»Nun komm ich also mit meinem kleinen Geschenk, Hoheit«, sagte Wetzlar, als der Diener gegangen war, und holte aus der Innenseite seines Rockes eine kleine, schmiegsame Brieftasche hervor. Er schlug sie auf, entnahm ihr ein mehrfach zusammengelegtes sämisches Leder und faltete es mit einer gewissen Umständlichkeit auseinander. Dann stand er unsicher auf und überreichte seine Gabe mit einer kleinen Verbeugung dem Herzog.
Der unterdrückte einen Aufschrei. »Das schenken Sie mir, Wetzlar?«, sagte er mit wankender Stimme, »wissen Sie aber, das ist in der Tat –« Er suchte nach Worten und fand sie schwer. »Das ist generös, Wetzlar, ungewöhnlich reizend, ein ganz großes Vergnügen.«
Und im Bedürfnis sich mitzuteilen, seine Freude anzuvertrauen, wandte er sich an Ludwig, der interessiert herzugetreten war. »Du wirst das nicht ganz verstehen können, Louis« – er nannte ihn neuerdings Louis – »es ist ein Stück, das mir schmerzlich gefehlt hat. Ich möchte sagen, ich hatte Sehnsucht danach. Die großen Institute besaßen es natürlich, aber zu erwerben war es nicht mehr. Einmal tauchte eins auf, aber die Echtheit war zweifelhaft, Wetzlar riet ab. Nach ein paar Jahren wieder eins, in unanfechtbaren Händen diesmal – unerschwinglich. Das British Museum kaufte es an. Und nun kommt dieser Wetzlar dahergefahren in seinem Automobil und wickelt es aus seinem Tuch und behauptet, er schenke mir's ... Außerordentlich generös, Wetzlar«, wiederholte er und nickte mehrmals dazu mit dem Kopf, »sehr dankenswert und besonders charmant.«
»Darf ich fragen, was es ist, Papa«, sagte Ludwig.
»Die Dekadrachme von Syrakus doch natürlich«, sagte der Herzog, »und was für ein Exemplar!« Er betrachtete die Münze ergriffen, wandte sie um und nochmals um, und der gemessene Herr sah aus, als werde er das alte Geldstück im nächsten Moment an die Lippen führen.
Auch Ludwig sah, dass es schön war. Die Rückseite zeigte in wundervoll klarer Ausgestaltung ein stürmendes Viergespann, die Hauptseite aber das lieblich strenge Haupt einer jugendlichen Göttin. Die vier ersten Lettern des Wortes Syrakus waren deutlich zu lesen, und am Rande wiegten sich Fischlein.
»Eine Nymphe, Papa, nach den Fischen zu schließen.«
»Arethusa, wer sonst«, sagte Herzog Philipp. »Die Quellnymphe. Hast du denn das nicht gelernt? Die in Syrakus als Göttin verehrt wurde. Sieh die Stirn, sieh den Mund, das ernste, liebliche Lächeln. Drei Jahrtausende alt, die Quelle vertrocknet. Syrakus ein Haufen Geröll – aber dies hier in so wunderbar anfänglicher Frische. Lieber Wetzlar, ich danke Ihnen«, sagte er noch einmal, »kommen Sie, wir gehen hinüber, sie bekommt gleich ihren Platz. Sie selber sollen sie dort hinlegen, wohin sie gehört.«
Und er führte seinen blinden Gastfreund vorsichtig hinaus, hinüber zu der dritten Kammer Johanns des Gläubigen.
Ludwig blieb mit dem jungen Mädchen allein. Aus ihrer Ecke kam kein Laut. Er trat näher. Da sah er, dass aus den übergroßen Augen über das Kindergesicht Tränen herabliefen. Ihre Wangen waren ganz nass. Sie hatte wohl die ganze Zeit über geweint. Der Kummer über den Schimpf, der ihrem Vater, ihr, ihrem Volk, vorhin bei Tafel angetan worden war, stürzte in lautloser, salziger Flut aus ihren dreitausendjährigen Augen.
3
Ludwig von Camburg war kein sehr normaler Student. Mit den zweitausend Zwanzigjährigen, die sonst die Gassen und Hallen der Universitätsstadt bevölkerten, hatte er wenig gemeinsam.
Es war Tradition, dass die Söhne seines Hauses diese nahegelegene Hochschule bezogen; er hatte der Überlieferung umso lieber gehorcht, als die Luft des väterlichen Palais auf ihm zu lasten begann.
Bei Herzog Philipp war die Beschäftigung mit seinen Münzen allmählich zur beherrschenden Schrulle geworden, eine gemarterte Langeweile drückte sich in seinen Zügen aus, sobald auf etwas anderes die Rede kam. Nun war freilich Ludwigs Interesse echt und nahm zu. Hier war ihm zuerst offenbart worden, was eigentlich Kunst sei. Dennoch konnte ihm niemand zumuten, in stundenlangen Konversationen über Prägestempel und Feingehalt, über Prägerechte und Fälschung den ausschließlichen Inhalt für seine jungen Jahre zu erblicken. Er atmete auf, als er in der Universität anlangte.
Mit seinem Diener Hermann bezog er die kleine Etagenwohnung, die man in der Villengegend für ihn ausfindig gemacht hatte. Darauf begann er gemächlich sich umzusehen. Aber wonach? Welches Studium empfahl sich für einen deutschen Fürstensohn in dieser Zeit? Ludwig war weit davon entfernt, seine Stellung in der Welt für etwas Besonderes zu halten. Prinzen wie er liefen zu Dutzenden, liefen schockweise in Deutschland herum, und wenige, das wusste er, hatten etwas aufzuweisen, was einem Lebenszweck ähnlich sah. In früherer Zeit, als die zwanzig Dynastien noch in Funktion waren, hatten sich Volkswirtschaft und Verwaltungsrecht als Studium von selber empfohlen; es war immer gut, davon etwas zu verstehen, wenn man vielleicht eines Tages doch auf den angestammten Löwen- oder Adlersessel gelangte. Überhaupt war damals der Weg vorgezeichnet. Man trat in ein Corps ein, in »das« Corps, jenes vornehmste, das die Söhne des heimischen Adels mit einigen auserlesenen Bürgerlichen vereinigte, und lernte hier, von der studentischen Disziplin bis auf wenige Äußerlichkeiten entbunden, seine zukünftigen Staatsminister und oberen Verwaltungsbeamten kennen.
Mit alledem war es vorbei. Die Ehrfurcht, die noch fünfzehn Jahre zuvor die souveränen Familien getragen hatte, war eine Erinnerung, gerade noch wirksam genug, um deren Söhne mit einer Isolierschicht zu umgeben. Mit einigen Studierenden von Adel, einem Larisch, einem Gerstenberg, einem Herrn von Zednitz besonders, stellte sich Umgang her, aber auch der war nicht ohne Gezwungenheit. Selbst diese jungen Leute wussten noch eher, wohin sie sozial und beruflich gehörten.
Prinz Ludwig, solcherart alleingelassen, hatte für juristische Vorlesungen inskribiert, auch für naturwissenschaftliche und philosophische, und war überall ziemlich rasch erlahmt, da weder ein fassbarer Zweck noch eine entschiedene Neigung ihn leiteten. Vielleicht wäre das anders gewesen, wenn starke Figuren unter den Lehrern ihn angezogen hätten. Diese Hochschule besaß eine stolze Tradition. Von ihren Kathedern hatten Fichte, Schlegel, Schelling, hatte sogar Schiller zur Jugend gesprochen. Diese Vergangenheit war toter Schall. Ludwig hatte eigentlich bei jedem der Professoren die missmutige Empfindung, dass ein beliebiges Lehrbuch den mündlichen Vortrag völlig zu ersetzen imstande sei. Er fühlte sich überhaupt nicht wohl. Bei aller Bescheidenheit des Camburger Hofes war er eben doch ein verwöhnter junger Mann, und die gedrängte Nähe der nicht immer soignierten Kommilitonen bereitete ihm Unbehagen. Er registrierte das mit Ärger über sich selbst.
Da geriet er, schon gegen Ende seines zweiten Semesters, in eine kunsthistorische Vorlesung des Geheimrats Johannes Rotteck. Es geschah beinahe mit dem Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. »Kunstgeschichte ist gar nichts«, hatte daheim sein Lehrer Steiger gelegentlich zu ihm gesagt, »Kunstgeschichte ist etwas für unnütze Söhne aus alten Firmen.« – »Ganz mein Fall«, hatte er lachend geantwortet. Aber das Wort war haften geblieben.
Es war sogleich fortgewischt, wie er jetzt den Mann da oben auf seinem Katheder sah, einer kleinen Estrade eigentlich, auf der er sich im Reden bewegte. Etwas weniger Professorales an Erscheinung ließ sich nicht wohl erdenken. Mit seinem kantigen, länglichen Gesicht, darin steingraue Augen unter borstigen Brauen ihre kräftige Sprache führten, mit dem schmalen, hart wirkenden Körper, den langen federnden Beinen, mit seiner ganzen unbekümmerten, etwas schlampigen Eleganz, erinnerte dieser Fünfzigjährige weit eher an einen Reitergeneral als an einen Dozenten. Mit einem langen Stock zeigte er illustrierend auf der Projektionsfläche hinter seiner Estrade umher.
Was da augenblicklich zu sehen war, stellte einen Teil des Isenheimer Altars dar. Der Geheimrat sprach eigentlich nur halb zu den Hörern, halb sprach er zu der Christusfigur hinauf, die er erläuterte. Seine Aussprache, ohne ein Dialekt zu sein, war süddeutsch, alemannisch gefärbt. Im Saal war es still. Man befand sich im Auditorium Maximum, denn Rotteck war eine Berühmtheit, zwischen den Studenten saßen zahlreiche Damen aus der Stadt, die sich übrigens durch Krassheiten in seinem Vortrag nicht selten schockiert fanden. Wahrscheinlich kamen sie eben deshalb umso lieber.