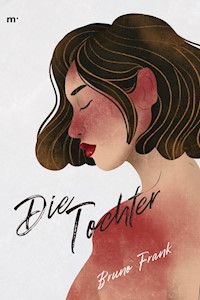
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Galizien 1914 am Ufer des Dnjestr: Elisabeth, Tochter einer jüdischen Sängerin und eines Wiener Offiziers, durch Geburt zwischen die Religionen gestellt, bleibt nur die Flucht aus ihrer Heimat. Kirchner schreibt, in der Titelfigur symbolisiere Bruno Frank die Verbindung von Christentum und Judentum. #wenigeristmehrbuch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruno Frank
Die Tochter
Impressum
Instagram: mehrbuch_verlag
Facebook: mehrbuch_verlag
ISBN: 9783756214723
Public Domain
Erster Teil
Pattay und Recha
I
Selbst in dem lebensheitren, duldsamen Wien von 1913, das einem Mitglied der Reichsaristokratie ungefähr alles erlaubte, hatten die Spiel-, Weiber- und Zweikampfaffären des Grafen Franz von Pattay eines Tages die Grenze erreicht, bis zu der sie übersehen werden konnten, und seine Versetzung nach einer der Kavallerie-Garnisonen im Nordosten der Monarchie wurde verfügt.
Der Kommandeur des Nobel-Regiments, bei dem er diente, wäre vielleicht willens gewesen, es nochmals bei einer letzten und vorletzten Warnung bewenden zu lassen. Er war dem glänzenden jungen Menschen gutmütig zugetan, auch war in dessen Ausschreitungen nichts, was mit den traditionellen Ehrengesetzen von Armee und Gesellschaft durchaus unvereinbar gewesen wäre. Die Strafversetzung kam über den Kopf des Obersten hinweg von der höchsten Stelle. Die einzige nahe Verwandte des Exzedenten nämlich, eine Fürstin Weikersthal, verwitwete Schwester seiner Mutter, eine tyrannische und sehr bigotte Dame, hatte um Audienz in Schönbrunn nachgesucht und hatte vom Thron des achtzigjährigen kaiserlichen Pedanten den inappellabeln Spruch zurückgebracht. Es bereitete ihr ein ungütiges Vergnügen, ihn dem Betroffenen als Erste zu verkünden.
Aber dem war zu ihrer Enttäuschung weder Erstaunen noch Bedauern anzumerken. »Das kommt genau im rechten Moment, gnädigste Tante«, sagte er sofort. »Drei Jahre Amüsement in Wien sind wahrhaftig genug. Ich hoffe, Sie besuchen mich bald einmal dort in der Steppe, damit ich Ihnen meinen Zug vorexerzieren kann.«
Mit besserer Manier ließ sich eine fatale Lebensveränderung nicht hinnehmen. Der Gedanke, sich zu weigern und lieber den Dienst zu quittieren, als in einem öden Grenzstädtchen ukrainische Rekruten zu drillen, schien den Oberleutnant gar nicht zu streifen. Unter den Offizieren seines Regiments, die den liebenswürdigen Kameraden ungern verloren, hatte man dafür eine naheliegende Erklärung. Dem Befehl des Kaisers, meinte man, wäre schließlich zu trotzen gewesen, dem Wunsch der frommen Tante aber nicht. Denn sie allein stand zwischen Pattay und dem Familienvermögen. Überwarf er sich mit ihr, so ging er dereinst wahrscheinlich leer aus, und den Vorteil hatte die Kirche.
So fanden sich denn drei Wochen später in der zugigen Halle des Nordbahnhofs alle jüngeren Herren des Regiments zum Abschied versammelt. Eine ziemlich krampfige Ausgelassenheit stellte sich zur Schau. Man legte dem Abreisenden ans Herz, sich vor den sengenden Augen der schönen galizischen Judenmädchen zu hüten; einer beschenkte ihn mit prächtig gebundenen Wörterbüchern der polnischen, ukrainischen und jiddischen Sprache, da ohne Kenntnis all dieser Idiome in jener Gegend der Neuankömmling notwendig verloren sei; ein anderer überreichte ihm ein riesiges, in rosa Seide gehülltes Gefäß, von dem sich herausstellte, dass es Insektenpulver enthielt.
Der Exilierte nahm das alles mit gutem Humor auf, bestieg endlich den Waggon und umfasste die bunte Eskorte mit einem abschiednehmenden Blick. Er trug bereits die Uniform der Ulanen, denen er zugeteilt war, den lichtblauen Waffenrock mit umgehängter silberner Patronentasche, die grellroten Hosen, die in den hohen Lackstiefeln steckten, und überm schmalen, kräftigen Gesicht die flotte Tschapka mit dem Haarschweif. Er grüßte noch einmal, schlug leicht die Hacken zusammen, dass es fröhlich klingelte. Die Wagentür knallte zu. Das letzte, was man von dem Scheidenden sah, war ein blaues und silbernes Blitzen.
II
Auf der vielstündigen Fahrt in den Reichsosten hatte Pattay Zeit, sich mit dem Wechsel in seinen Lebensumständen auseinanderzusetzen. Seine Kameraden waren im Irrtum: er machte nicht einfach freundliche Miene zum bösen Spiel, und das bedrohte Erbe hatte mit seiner Bereitwilligkeit nicht viel zu tun. Praktische Schlauheit lag ihm fern, sein Wunsch nach Umkehr war echt.
Drei oder vier Monate früher wäre ihm selbst dergleichen noch unwahrscheinlich vorgekommen. Er fand an seinem Dasein nichts auszusetzen. Die Geldleute, bei denen seine Schulden aufgelaufen waren, saßen ihm nicht weiter drängend im Nacken, sie wussten, dass er mit hohen Interessen bezahlen würde, sobald der Familienbesitz an ihn fiel. Bei den Ehrenkämpfen, die er ausgefochten hatte, war Allerschlimmstes nicht geschehen. Meist hatte er durch überlegene Fechterkunst den Gegner entwaffnet; der eine bedenkliche Stich in die Schulter, mit dem er einem vorlauten Legationssekretär den linken Arm gelähmt hatte, belastete sein Gewissen keineswegs. Und was seine Abenteuer mit Frauen betraf, so war bis in die jüngste Zeit keines darunter gewesen, auf das er anders als mit einer halb heiteren, halb gerührten Befriedigung zurückgeblickt hätte. Die wechselnden Damen, um die es sich handelte, ob nun seinem engeren Gesellschaftskreis angehörig oder entgleisende Bürgerinnen, waren nicht von der Art, der das Ende einer leichtgeknüpften Verbindung gleich das Herz bricht.
Eine Ausnahme aber hatte es hier vor kurzem gegeben, und mit dem tragischen Ausgang dieser Episode war er zu seinem Befremden nicht recht fertig geworden. Er hatte eigentlich keinen Anlass, sich schuldiger zu fühlen als sonst. Das Mädchen war ihm anheimgefallen so leicht, womöglich leichter als andere vor ihr. Auch wusste er nichts von bedrohlichen Komplikationen, nichts war »passiert«, und er hatte nach einiger Zeit die Beziehung einschlafen lassen, ohne lauten Konflikt, mit geübter und schonungsvoller Allmählichkeit. Das Ganze schien gründlich abgetan, da vernahm er durch einen Zufall, dass sie schon seit vierzehn Tagen unter der Erde lag.
Er war erst nicht besonders erschüttert und brachte die Tat kaum mit sich selbst in Zusammenhang. Dann kehrten Einzelheiten in sein Gedächtnis zurück, und er konnte nicht mehr gut zweifeln. Aber was hatte sie denn erwartet? Dass ein Pattay, Letzter seines Hauses, das mit einem halben Dutzend regierender Familien und sogar mit Habsburg selber verwandt war, die Tochter eines Juweliers Blau heiraten würde? Seine Erinnerung an das reizende Geschöpf mit dem nächtigen Haar und den weiten, immer etwas angstvoll blickenden, sehr hellen Augen war weniger von Reue als von Unmut über so viel urteilslose Torheit gefärbt.
Da kam ihm, an einem Samstagnachmittag im September, auf der Ringstraße unvermutet ihr Vater entgegen, eine schwarze Figur im prächtigen Herbstsonnenlicht. Er kannte den Juwelier flüchtig und ging rasch mit sich zu Rat, ob es schicklich wäre, stehenzubleiben und eine Kondolation zu murmeln. Aber Siegmund Blau hatte ihn bereits von weitem bemerkt. Drei Schritte, ehe sie einander passierten, nahm er den hohen Hut vom Kopf und grüßte den ihm Entgegenklirrenden tief und respektvoll. Und dabei sah Pattay in seinen Augen, dass er alles wusste.
Es geschah weiter nichts. Es war der Vorgang einer Minute gewesen. Aber eigentümlicherweise behielt er mehr Bedeutung für Pattay als das traurige Ereignis, das vorausgegangen war. Es war die Demut im Blick und in der Geste des Mannes, die ihm nicht aus den Gedanken ging, dieses Sichbeugen, dies devote Hinnehmen einer empörenden Gegebenheit. Da war diesem Bürger ein Äußerstes, Furchtbares zugestoßen, und er wusste oder vermutete doch, durch wessen Schuld. Aber er lehnte sich nicht auf, er verbiss seinen Gram und grüßte den Zerstörer seines Glücks und seiner Hoffnungen mit einem servilen Schwung seines schwarzen Hutes.
Zum ersten Mal schien es Pattay, dass in seiner Existenz etwas nicht stimme. Er war ungeübt in Selbstbetrachtung und zu unwissend, um aus seinem Erlebnis allgemeine Erkenntnisse abzuleiten. Aber die klare Wirklichkeit, die ihn umschloss, erschien ihm zum ersten Mal anfechtbar. Sein Instinkt schrak zurück vor dem Zweifel; denn gab man dem einmal Raum, so tat sich ein Abgrund auf, und geheiligte, selbstverständliche Begriffe, Adelsprivileg, Ehre der Armee, ja der Begriff Österreich selbst, schwankten am Rande.
Er zuckte über sich selber die Achseln, suchte zu vergessen und wegzudrängen; aber der schwarze Hut des Juweliers Blau hing in der Schwebe zwischen ihm und dem heiter-festen Horizont seines bisherigen Daseins. Ein sonderbarer Missmut, unangemessen seinen Jahren und seiner Position, schlich sich bei ihm ein. Er fühlte, dass er »heraus müsse«.
In solch einer Verfassung traf ihn der Exilsbeschluss, den ihm die Fürstin Weikersthal mit ungütigem Vergnügen überbrachte.
III
Der Bahnhof, gelb getüncht, lag ganz allein zwischen abgeernteten Hafer- und Maisfeldern. Zwei Herren vom Regiment, ein Fähnrich und der jüngste Leutnant, erwarteten Pattay, versorgten sein Gepäck und bestiegen mit ihm den leichten Wagen, dem zwei schwarzbraune Pferdchen vorgespannt waren, struppig wie russische Steppenpferdchen. Vom Bock grüßte mit seiner geflochtenen Peitsche ein blasser junger Jude mit Schläfenlocken.
»Es ist ziemlich weit bis zur Stadt«, sagte der Leutnant. »Unser Bahnhof liegt schon auf dem halben Wege nach Wien.«
Pattay hörte, dass das ein Witz sein sollte, einer von denen, die Generation auf Generation von Offizieren wiederholt, ein müder, abgetriebener, sehnsüchtiger kleiner Witz hier im Exil. Er lächelte höflich.
Die Straße ging immer geradeaus zwischen den Stoppeläckern, dann, unvermutet, bog sie um und senkte sich gleichzeitig, und der Fluss kam in Sicht, breit, gelbgrau, mit lautlos ziehenden Wogen. Der Trab der Steppenpferdchen schallte auf der hölzernen Brücke.
»Der Dnjestr«, sagte vorstellend der Fähnrich. Der Name schmeckte Pattay nach Russland, nach Asien.
Drüben angelangt, durchquerten sie das Städtchen, in dessen engen, ungleich gepflasterten Gassen es kellerig roch. Die Häuser endeten unvermutet, und über ein Stück baumloses, strauchloses Land rollte man auf den langgestreckten, niedrigen Bau der Kaserne zu.
Er zeigte dasselbe eigentümliche Gelb wie der Bahnhof, eine Farbe, nüchtern und anheimelnd zugleich, so wohlvertraut jedem, der in den Ländern der Monarchie zu Hause war. So sahen offizielle österreichische Bauten aus, von der Adria bis nach Böhmen und von der russischen Grenze bis Salzburg. Die Farbe stammte von dem kaiserlichen Schloss in Schönbrunn, wo der achtzigjährige Reichsverwalter saß, dessen Spruch Pattay hierher verdammt hatte.
»Wir haben dich in der Kaserne einlogiert, Herr Oberleutnant«, sagte wieder der Ältere von den zweien, »die paar besseren Quartiere im Städtchen sind alle besetzt.«
»Es ist mir so lieber«, antwortete Pattay zu leichter Überraschung seiner Begleiter.
Das Zimmer, in das sie ihn führten, war ein großer, nicht hoher Raum mit teppichloser Holzdiele, sehr kahl und sehr sauber. Ein Kruzifix, schön geschnitzt, aus Barockzeiten hinterblieben, hing über dem spartanischen Bett, ein abscheuliches Öldruckporträt des Kaisers in großer Generalsuniform an der Wand gegenüber.
Die zwei Fenster gingen nach dem Hof hinaus, jenseits lagen die Stallungen. Pattay, als er herantrat, blickte auf eine Reihe von Pferdehinterteilen, auf deren blankgestriegeltem Fell die schräge Nachmittagssonne blitzte. Eine Sekunde lang dachte er an seine Junggesellenwohnung in einem oberen Stockwerk an der Herrengasse in Wien mit den Familienandenken aus vier Jahrhunderten, den Möbeln aus der Zeit Karls VI., dem Blick über heiter geschwungene Giebel hin nach der Hofburg.
Er wandte sich um, denn der ihm zugeteilte Bursche war mit den Gepäckstücken eingetreten. Er war ein ukrainischer Bauer, breitschultrig und fest, mit auffallend hochgeschwungenen Brauen über den gutmütigen Augen, sandfarben von Haar. In ziemlich gepresster Erwartung schaute er auf den neuen Herrn, dies über ihn verhängte, unbekannte Schicksal. Mit seiner Hilfe begann Pattay sein mitgebrachtes Eigentum im Zimmer zu verteilen. Pjotr hielt die seidenen Hemden auf ausgestreckten Armen vor sich hin wie die Hostie. Aber dann begann sein unbekanntes Schicksal mit ihm zu plaudern, so wie es die lässigen Herren aus altem Blut allenthalben im weiten Reich mit ihren Untergebenen taten. Und ehe er die letzte Schublade wieder geschlossen hatte, war Pjotr, obwohl er Pattays Deutsch nur halb verstand, diesem aus der Wolke herabgestiegenen Halbgott verfallen – mit einer Liebe, von der noch seine Kinder und Enkel einen Strahl auffangen würden, wenn Pjotr vielleicht einmal alt war und Zeit hatte, sich zu erinnern.
Dann schnallte Pattay um, zog die Handschuhe an und setzte die Tschapka auf, um sich bei seinem neuen Kommandeur zu melden.
IV
Achtzehntausend Menschen wohnten in der Stadt, beinahe die Hälfte davon waren Juden. Aber sie schienen zu überwiegen, die ukrainische Bevölkerung, trotz der Buntheit ihrer ländlichen Tracht, trat vor ihnen zurück. Fast alle Kaufläden gehörten ihnen, armselige Buden zumeist von geringer Tiefe, jedoch mit schweren Fenstertüren versehen, die mit Eisen beschlagen waren. Die Juden handelten mit jedem Bedürfnis, mit Tuch und Linnen, mit Schnur und Knopf und Band und Litze, mit Schuhen und Kappen, mit Brot und Bier und Fetten und Butter. Sie waren Schneider und Kürschner, sie waren auch Schlosser und Kesselschmiede. Sie deckten die Dächer, sie fegten die Schlote aus, sie fuhren die Wagen. Sie waren überall. Die meisten von ihnen waren sehr arm. Die wenigen, die zu Wohlstand gelangt waren, der Besitzer des einen Warenhauses, das existierte, ein paar Wirte, die Eigentümer der Zuckerfabrik überm Fluss, lebten nach außen kaum anders als die Unbegünstigten, bestrebt, durch achtsame Wohltätigkeit Vorwurf und Neid von sich fernzuhalten. Furcht steckte ihnen allen im Blute, obgleich ihnen seit langer Zeit kein Anlass dazu geworden war. Die eingeborene Bevölkerung nahm ihr Dasein hin als etwas natürlich Gegebenes.
Eingeboren waren sie eigentlich selbst, eingesessen hier seit sechs Jahrhunderten, aber in ihrem Blick war ewig und immer etwas von einem, der aufgescheucht werden kann mitten in der Nacht und um sein Leben rennen muss durch Wälder und Bäche.
Sie kamen aus Deutschland. Sie hatten dort den Rhein entlang gesessen, immer, seit ihre Ureltern den römischen Legionären über die Alpen gefolgt waren – bis nach einem Jahrtausend fortschwelendes Misstrauen zu Hass und Verfolgung aufbrach. Es geschah im Jahre der schwarzen Pest. Millionen in Deutschland erlagen der Seuche, deren Ursprung geheimnisvoll war. Und die Fremdlinge trugen die Schuld. Die einst den Heiland ans Kreuz genagelt, sie hatten jetzt auch die Brunnen vergiftet, all das gute, klare, gesunde Wasser im deutschen Land, aus dem nun das Volk sich den Tod trank. Man erschlug sie dem Tausend nach. Die sich verbergen konnten, blickten verzweifelnd nach Zuflucht aus. Ein Fürst tat seine Länder auf, die von Kriegen verheert und entvölkert waren, Kasimir, den das polnische Volk seinen Großen nennt – Friedensstifter, Verwalter, Schützer der Bauern, weit ausschauend, fühlend und unbetrügbar.
Die Juden kamen mit ihrer Todesangst, ihren geretteten Habseligkeiten, ihren wachen Talenten. Und sie kamen mit ihrem Deutsch. Das sprachen sie weiter. Dort hinten verwandelte es sich, die Wasser der Zeiten schliffen es ab. Aber die Juden sprachen es fort, so wie es gewesen war im Augenblick, als Deutschland sie mordend ausstieß. Ein paar Brocken aus ihrer Sakralsprache mischten sich ein, ein paar slawische Laute. Unkundigen, späten Ohren klang es verdorben, so wie die Juden es redeten, mit heftigem Tonfall, übermäßigen Gesten. Aber es war das Deutsch, das die Minnesänger geredet hatten und die staufischen Kaiser. Das Blut der Juden vergaß die Hügel und Ströme nicht, an denen sie tausend Jahre lang geglaubt hatten, Bürger zu sein.
Viele von ihnen, die älteren Leute zumal, gingen im langen schwarzen Kaftan herum, der den christlichen Bewohnern, soweit sich einer Gedanken machte, für ein Erbstück aus Asien galt. Doch es war etwas anderes. Es war der alte deutsche Bürgerrock, den ihre Urväter am Rhein getragen hatten. Er sah nicht stattlich aus an den Juden, der gotische Rock, schäbig und fleckig war er geworden im Staub und Drang der Jahrhunderte, und er passte zu den bleichen Gesichtern mit den Schläfenlocken.
Bleich waren selbst die unter ihnen, denen ein physischer Beruf die Brust breiter machte und die Muskeln schwellte. Zu lange hatten ihre Voreltern in den Lehrhäusern und Betschulen gesessen, gebückt über den aufgehäuften Geistesschatz der Rabbinen, Gemara und Mischna – mit dem stillen Hochmut derer, die im Buchstaben der Wahrheit wohnen. Solcher Betstuben gab es noch heute Dutzende in der kleinen Stadt, niedrig alle, luftlos und lichtlos, ohne einen Schmuck, ohne ein Bild. Und so ungesund wie hier war das Atmen in ihren dumpfen, schmalfenstrigen Häusern und Kaufgewölben, in den ungepflasterten, feuchtriechenden Gassen, die nur an einer Stelle sich jählings auftaten zum freien, unmäßig geweiteten Ringplatz.
In seiner Mitte erhob sich das städtische Rathaus, ein neuer und hässlicher Bau, in irriger Gotik errichtet, und jenseits des Rings im Umkreis andre offizielle Gebäude: unterm selben figurengeschmückten Dach Gericht und Finanzamt; die Bezirkshauptmannschaft, zweistöckig, vornehm nüchtern und kaisergelb; und die griechisch-katholische Kirche, schief zur Front stehend, ein unübersichtliches Gebilde, ganz aus Holz mit drei ungleichen Kuppeln, das hier gewesen war, ehe alles andere kam. Die Synagoge der Juden stand nicht hier am Platz, sie hielt sich verborgen irgendwo in der Enge. Aber das Kaufhaus Gelbfisch und Sohn war da und das Hotel »Zum Erzherzog Rainer«, Besitzer Salomon Löw.
Dies war eine jüdische Stadt – die Offiziere des Ulanenregiments wussten es alle nicht anders. Neu herversetzte nahmen vielleicht in den ersten Tagen befremdeten Anstoß, ungeschickt versuchten sie, das singende »Mauscheln« und die fremdartige Mimik zu imitieren. Die Eingewöhnten lächelten nur gelangweilt und wussten, das würde sich geben.
Antisemitismus galt als sehr schlechter Stil unter den Herren, es roch ihnen nach ungelüfteten Spießbürgerstuben. Man wusste, dass er von gewissen Parteien im politischen Kampfe verwendet wurde, um das Selbstgefühl der kleinen Leute zu kitzeln und ihre Wahlstimmen zu fangen. Man selbst stand viel zu hoch und unangefochten, um Abneigung gegen die bleichen Fremdlinge zu fühlen. Ja, die geistig lebendigeren unter den Herren achteten in deren starr bewahrter Eigenart, diesem Festhalten an absurden Gesetzen, Bräuchen und Sprachformen, sogar etwas unbestimmt Verwandtes, einen weither gekommenen, etwas herabgekommenen Aristokratismus.
Aber nicht gab sich der Schock bei manchen der »Einjährigen«, jungen Leuten aus wohlhabendem Haus, deren Privileg es war, kürzeren Armeedienst zu leisten als das besitzlose Volk. Für diese Söhne von Wiener Bankiers und Brünner Fabrikanten war der Tonfall des Jiddisch, der Anblick der Figuren im Kaftan ein täglich erneuerter Stich. Denn ihr Ehrgeiz war es, in Manier und Rede ganz der Herrenklasse zu gleichen, ja vielleicht in gnädigen Ausnahmefällen zu ihr aufzurücken. Und furchtbar war ihnen die Vorstellung, einer der Offiziere könnte in Gedanken die Brücke schlagen zwischen ihnen und diesen Händlern. Eisig und zitternd blickten sie über die blassen Verwandten hinweg, die mit ausfahrenden Gesten vom Mittelmeer das Deutsch Herrn Walthers von der Vogelweide sprachen.
V
Man hatte sich im Regiment von Pattay, dem sein verwegener Ruf vorausflog, allerlei Neubelebung versprochen. Aber schon nach den ersten Tagen griff Enttäuschung Platz. Denn mit anspruchsloser Selbstverständlichkeit fügte der Held eleganter Gerüchte sich in den gleichförmigen Tageslauf ein, gar nicht gewillt offenbar, den exzentrische Darbietungen frische Farben zu geben.
Blieben die Herren nach der Abendmahlzeit beim Wein im Kasino beisammen und fingen die Anekdoten und Erzählungen an, gewagter und schließlich eindeutig zu werden, so lachte er gutwillig auch zu den weniger geglückten Pointen, trug aber selbst nichts Nennenswertes bei. Ging man dann, was ziemlich regelmäßig geschah, zu substanzielleren Vergnügungen über und wurden zur Bakkarat-Partie die Karten fächerförmig auf dem Tisch ausgebreitet, so pflegte er sich zu empfehlen und auf sein Zimmer zu gehen. Das hielten erst manche für Hochmut. Vermutlich reizte ihn dieses kleine Jeu unter Kameraden nicht mehr, nach allem was er in seinen Wiener Klubs mitgemacht und mitangesehen hatte.
Und dabei war dieser nächtliche Zeitvertreib durchaus nicht so bescheiden und unschuldig. Im Gegenteil, es ging recht verantwortungslos zu unter den gelangweilten Herren hier an der Grenze. Sah man sie in sonniger Harmonie an der Abendtafel beisammen, so wäre niemand auf die Vermutung gekommen, wie schwer verschuldet hier einer dem andern war. Denn im Allgemeinen wurde mit der Bezahlung nicht gedrängt, die Gewinner – es waren fast immer dieselben – ließen die Kette schleifen, da sie unzerreißbar war. Dem präraffaelitischen Gesicht des Leutnants Baron Seldnitzky zum Beispiel sah niemand an, dass er seinem älteren Nachbar am Tisch eine Summe schuldete, von der dieser längst entschlossen war, sein verlorengegangenes Stammgut in Kärnten dereinst arrondiert zurückzukaufen. Auch die einjährig dienenden jungen Leute waren trotz ihrer gesellschaftlichen Zwitterstellung nur allzu willkommene Teilnehmer, und gewisse Industrielle in Wien und Brünn ahnten nicht, mit welch ruinösen Beträgen ihre Unternehmungen für die Zukunft belastet waren. Einmal, ein paar Jahre früher, war im Zusammenhang mit diesen Zerstreuungen ein Selbstmord vorgekommen, und damals war ihnen ein Ende gesetzt worden. Aber das war vergessen, und der jetzige Kommandeur sah seinen Herren sehr vieles nach, wenn nur der Dienst nach seiner Zufriedenheit lief.
Auch in dieser Richtung bot der Neuangelangte Anlass zum Erstaunen. Wer ihn auf dem Gelände sah, wie er mit nicht ermattender Geduld begriffsstutzigen Rekruten kurzen und langen Trab beibrachte, keinen geringsten Mangel an Adjustierung, Sitz und Haltung übersah und von diesen Übungen in Staub oder Regen mit unberührt heiterer Laune nach der Kaserne zurückkehrte, der musste zum Schluss kommen, dass der Reichs- und Altgraf von Pattay und Schlern, Verwandter der Dynastie, in dieser Tätigkeit den ausfüllenden Inhalt seiner Existenz gefunden habe.
Man begann zu glauben, dass er militärisch ehrgeizig sei, etwas ganz Unwahrscheinliches bei einem österreichischen Kavallerieoffizier aus vornehmem Haus. Und die Vermutung wurde bekräftigt, als nacheinander mehrere Büchersendungen aus der Hauptstadt für ihn eintrafen und er die Gewohnheit annahm, seine privaten Stunden studierend auf seiner Stube zu verbringen. Dergleichen war nicht erschaut worden. In seinen Kreisen galt es als guter Ton, auf Bildung und Wissenschaft ironisch herabzublicken, sich noch uninteressierter zu stellen, als man in Wirklichkeit war; die Pose eines halben Analphabetentums gehörte zum Schick.
Nicht dass sich Pattay zu Strategie und Taktik besonders berufen gefühlt hätte; die Beschäftigung mit ihren Problemen fiel ihm schwer. Nie geschah es ohne Widerstand, dass er einen der gewichtigen Bände vom Regal nahm, Clausewitz oder Willisen, Puysegur oder Gilbert. Da er sich von hier aus leichteren Zugang versprach, ließ er sich eine »Geschichte der österreichischen Kavallerie« von seinem Buchhändler schicken; aber die Darstellung langweilte ihn so unsäglich, dass die ritterliche Waffe, der er angehörte, von Kapitel zu Kapitel mehr von ihrem Schimmer verlor. Trotzdem ließ er nicht ab.
Der Kommandeur der Ulanen hatte Weisung erhalten, nach Ablauf des ersten Vierteljahres der höchsten Stelle ein Gutachten über die Konduite des Oberleutnants einzureichen. Das Gutachten fiel über jede Erwartung günstig aus. Der pedantische Oberherr in Schönbrunn ließ eine Abschrift davon der Fürstin Weikersthal zuleiten, und als sie nach der Lektüre ihre Lorgnette von den Augen nahm, waren die Aussichten der Kirche auf das Pattaysche Familienvermögen in sich zusammengefallen.
Pattays tugendhafte Schrullen, oder was man im Regiment dafür hielt, hätten vielleicht einen anderen missliebig gemacht. Aber Pattay war hilfsbereit, gutlaunig, ein angenehmer Gesellschafter – ohne neiderregend glänzend zu sein. Eine gute Akquisition.
Der Rittmeister Schaller allein schien ihn dafür nicht zu halten. Vom ersten Augenblick an brachte er Pattay eine steife Kälte entgegen, eine ganz offenbar physische Abneigung.
Ferdinand Schaller war ein Mann aus mittlerem Beamtenstamm, Sohn und Enkel strebsamer Justiz- und Finanzfunktionäre, immer mit subalternem Argwohn auf seiner Hut. Alles war ihm zuwider an Pattay, seine nachlässige Freundlichkeit, in der er Missachtung witterte, die gestreckte Reiterfigur mit den sorglosen Bewegungen, das schmale und feste Gesicht mit den empfindlichen Schläfen und dem verwöhnten Mund. Dieser Mund besonders war ihm verhasst. Ihm selber hatte schon in der Kadettenanstalt seine stramme Soldatenerscheinung den unfreundlich gemeinten Spitznamen »der Preuße« eingetragen. Preußisch wirkte zumal sein rechteckig geschnittenes, unbestimmt blondes Haar, das aufrecht über der engen, ledern gefurchten Stirn stand.
Der Rittmeister war verheiratet und Vater von vier ungewöhnlich reizlosen Kindern. Er war bekannt für seine humorlose Strenge im Dienst, für seinen Geiz und für seinen giftigen Judenhass, der beim unzureichendsten Anlass hervortrat und über den man im Regiment leicht angewidert die Achseln zuckte.
VI
Wenn für die Ulanen Wien das entrückte Ziel von Wünschen und Träumen war, so sah im erreichbaren Umkreis die Stadt Lemberg einer Großstadt am ehesten ähnlich, und man fuhr hin, so oft es sein konnte. Am frühen Samstagnachmittag pflegte man im Rudel die dreistündige Fahrt nach der Ersatzmetropole anzutreten.
Im Hotel wurden unter viel Gelächter und Türenschlagen die bestellten Zimmer okkupiert. Dann blieb eben noch Zeit für ein hastiges Mahl vor der Vorstellung im Varieté, deren Beginn man niemals versäumte. Dem Etablissement, wo sie stattfand, hatte sein weltkundiger Gründer einst den Namen »Vauxhall« verliehen, was niemand recht aussprechen konnte.
Man war in Zivilkleidung. Trotzdem kannte jedermann die Ulanenoffiziere, die regelmäßig die beiden großen Logen rechts an der Bühne besetzt hielten, eine auf dem Niveau des Parterres und eine in Höhe der Galerie. Man ließ sich Champagner servieren während der Vorstellung, und es herrschte ungenierter Verkehr zwischen oben und unten. Ja, es war vorgekommen, dass einer der Herren halsbrecherisch an einer der vergoldeten Karyatiden hinunterkletterte, was den Ablauf des Programms auf einige Augenblicke unterbrach.
Dies Programm bestand aus einer sogenannten Revue, einer an dünnem Handlungsfaden aufgereihten Folge von burlesken und sentimentalen Spielszenen, Exzentrikakten, Gesangsnummern und Ballettdarbietungen, bei welch letzteren in der Kostümierung der Tänzerinnen von der Duldsamkeit der Polizeibehörde dankbar Gebrauch gemacht war. An Samstagabenden galten das Lächeln und die freigebigen Gesten der Mädchen vorwiegend den beiden Proszeniumslogen, deren Inhaber man sämtlich bei Vornamen kannte. Und.der Nachtportier des Hotels, in dem die Ulanen abgestiegen waren, konnte an diesen Samstagen auf Trinkgelder rechnen, wie er sie während der Woche vom bürgerlichen Reisepublikum nicht empfing.
Pattay hatte an den vergnügten Ausflügen nie teilgenommen, und er zeigte auch dann kein Verlangen danach, als man ihm, schon in der zweiten Hälfte der Theatersaison, mit einer besonderen Verlockung zusetzte. Die berühmte Recha Doktor, hieß es, sei wie alljährlich zum Gastspiel eingetroffen, sie zu bewundern, könne und dürfe er nicht versäumen, sie sei das Beste, ja eigentlich das Einzige, was diese gottverlassene Provinz an wahrem Kunstgenuss zu bieten habe. Nicht einmal in Wien, wo sie verständlicherweise noch niemals aufgetreten sei, gebe es Ähnliches. Aber als er sich schließlich erkundigte, worin denn bei dieser Recha das Außergewöhnliche bestehe, bekam er nicht viel Präzises zu wissen, er hörte nur immer wieder, sie sei einmalig, göttlich; denn die Fähigkeit, empfangene Eindrücke wiederzugeben, war unter den Ulanen wenig entwickelt.
Wieder einmal standen die Herren zum Aufbruch beisammen. Und mehr zum Scherz, ohne an einen Erfolg zu glauben, drang man nochmals auf Pattay ein. Dies sei eine letzte oder vorletzte Gelegenheit; Recha Doktors Gastspiel gehe schon seinem Ende entgegen.
Der Rittmeister Schaller hatte heute ausnahmsweise an der Mittagstafel im Kasino teilgenommen, vermutlich, weil seine Gattin zu Hause große Reinigung abhielt. Er schnallte sich eben den Säbel um. »Recha Doktors, sagte er laut in die Unterhaltung hinein. »Ich wollte, ich brauchte von dieser dreckigen Judengeiß nichts mehr zu hören.« Die Herren verstummten.
Pattay war rot geworden bis unter die Haare. »Da werd’ ich heut’ also mitfahren«, hörte er sich selber sagen. Es kam Schlag auf Schlag, war ganz deutlich die Antwort an Schaller.
Der Rittmeister fuhr herum und starrte Pattay ins Gesicht. Aber die Situation bot keine Handhabe für ihn. Er grüßte summarisch und klirrte hinaus.
Pattay ärgerte sich. Einen Augenblick vorher hatte er durchaus nicht die Absicht gehabt, mitzufahren. Was fiel ihm denn ein, sich zum Ritter für eine unbekannte Varietédame aufzuwerfen. Ach, er wusste schon, was ihm einfiel. Der ganze Auftritt hätte schwerlich stattgefunden, hätte es nicht in seiner Vergangenheit ein unverständiges Mädchen gegeben, das eines Nachts zwanzig Veronaltabletten in ein Glas Wasser rührte, und nicht den hohen schwarzen Hut des Juweliers Blau, der jenen weiten, so entsetzlich demütigen Bogen beschrieb. Aber das war es durchaus nicht allein.
Während der ganzen Bahnfahrt saß Pattay missmutig schweigend in seiner Coupé-Ecke. Es war leider klar, dass er den Rittmeister Schaller hasste, genauso oder schlimmer als jener ihn. Denn seinem eigenen Hass war eine reichliche Portion Ekel beigemischt. Er war dem Mann aus dem Wege gegangen, was meist gelang, denn der Rittmeister war ihm nicht unmittelbar vorgesetzt. Aber kamen sie doch in Berührung und reichte der Mensch ihm die Hand, so spürte Pattay jedes Mal ein Bedürfnis, sich die Ärmel bis zum Ellbogen aufzustreifen und sich minutenlang Hände und Arme zu waschen. Es lag durchaus nicht in seiner Gewohnheit, so mit Ekel zu hassen. Sich kräftig zu ärgern, jawohl. Aufzubrausen, jawohl. Dafür waren seine Ehrenhändel ein Zeugnis. Aber wenn er früher in Wien in der Morgenfrische einem Kontrahenten gegenübertrat, so wusste er gewöhnlich kaum mehr, warum er sich schlug, und das Ganze tat ihm schon leid.
Dies hier war anders. Im kalten, schnöden, giftigen Pedantismus dieses Menschen spürte er seinen Widersacher von Natur aus. Pattay lehnte in seiner Ecke, er hatte die Augen geschlossen, er war nicht mehr ganz wach. Er stand dem Rittmeister gegenüber auf dem nachtnassen Rasen, nackt beide bis zum Gürtel, er hörte den Unparteiischen zählen, er fasste eisern in seinen Säbelkorb, fiel aus und spaltete mit einem sauberen Hieb diese ledern gefaltete Stirn.
Jemand berührte ihn an der Schulter. Man war angekommen.
VII
Die Handlung der diesjährigen Revue in der »Vauxhall« überschritt an dürftiger Albernheit noch das sonst übliche Maß. Ihr Mittelpunkt und komischer Held war Herr Dienstel aus Lemberg, den seine eifersüchtige Gattin eines Fehltritts mit seiner Sekretärin verdächtigt und wild bedroht. Herr Dienstel flieht. Die Rasende setzt ihm nach, rund um den Planeten.
Überall erwartet Herrn Dienstel die Verlockung in Gestalt schöner Exotinnen, in der Türkei und in Indien, in Japan, auf den Inseln der Südsee und in Peru. Überall findet er eben noch Zeit, der Versuchung auch zu erliegen. Überall kommt die Verfolgerin knapp zu spät. Bis er zuletzt, vom atemlosen Liebesglück erschöpft und bereit zu kapitulieren, wieder im heimischen Lemberg eintrifft. Hier klärt sich erlösend alles auf. Denn nie hat Herr Dienstel sich mit jener Sekretärin vergangen, der Verdacht seiner Gattin war falsch, und mit Rührung zieht sie den maßlosen Sünder an ihre reuige Brust.
Der Herr aus Lemberg war sonst auch schon aus Krakau gewesen, aus Beuthen, aus Breslau, aus Lódź, je nach dem Ort, wo die Truppe gastierte. Varieté-Unterhaltung jeder Art, Zauber-, Jongleur- und Groteskakte, fügten sich seiner erotischen Flucht mühelos ein. Und was die Hauptsache war, fremdartige Tänze, vom Bauchtanz über den Geishatanz zum Fandango, boten den hübschen Mädchen des Chors reiche Gelegenheit zur Darstellung ihrer Reize. Siebenmal hatten sie in rasender Eile das Kostüm zu wechseln. Nur vor und nach dem Akt in der Südsee war ihnen eine Atempause gegönnt. Denn hier trugen sie beinahe gar nichts. Aber während dieser Umzüge und während hinten eine neue exotische Kulisse aufgebaut wurde, trat vor den Zwischenvorhang die Sängerin Recha Doktor und sang ihr Lied.
Bei solchen Einlagen pflegte sonst das Publikum sich gehenzulassen, niemand hörte recht hin, man lachte und schwatzte laut in Erwartung des Kommenden. Hier war es umgekehrt. Kaum schloss sich der Vorhang und Recha Doktor kam seitlich hervor in ihrem schwarzen, anliegenden Kleid, so trat freudige Stille ein. Man wollte keine Note verlieren.
Sie war eine brünette, zierliche Frau, mit weitgeschnittenen, sehr dunklen, redenden Augen und mit prinzessinnenhaft schmalen Händen und Füßen. Sie verschmähte beinahe die Geste, und ihre Mimik war sparsam. Aber jede winzige Regung in diesem bräunlichen Gesicht übertrug sich. Sie senkte die schweren, gewölbten Lider, und durch einen Schleier der Sehnsucht blickte der Zuschauer in eine geahnte schönere Welt. Sie drückte vor einer Pointe den einen Augenwinkel kaum merklich zu, und eine Verheißung zartester Freuden fuhr noch dem Gelassensten elektrisch durch alle Sinne.
Ihre Stimme war nicht sehr groß, sie war von einer gedeckten, etwas scharfen Süße, aber Recha Doktor beherrschte dies Mittel vollkommen. Ihre Souveränität, dies Spielen mit ihrer Wirkung, war das eigentlich Mitreißende an ihr. Berühmt war ihre Kunst, zu pausieren. Es kam vor, dass sie solch eine Pause dehnte, dehnte, bis die Empfindung der Hörer zum Zerreißen gespannt war, und der Einsatz wirkte wie Erlösung aus einer süßen Qual. Wenn dann der Applaus losjubelte, während sie sich damenhaft ein wenig verneigte, das Orchester exotisch ausbrach und hinter ihr der Vorhang sich voneinander tat zum Massenauftritt, so blieb in ihrem Publikum ein wundervoll unbestimmtes Verlangen zurück, eine ohnmächtige, begeisterte, beglückende Ungestilltheit.
Nicht leicht konnte ein Künstler in elenderem Material zu arbeiten haben als die Sängerin Doktor. Gott weiß, dass die Verfasser ihrer Chansons sich durch Geschmack oder Anstand keine Beschränkung hatten auferlegen lassen. Das schielte und kicherte nur so vor grundordinärer Dummheit. Aber in ihrem Munde war nichts gemein.
Da war zum Beispiel das Chanson, mit dem sie im ersten Zwischenakt Herrn Dienstels erotische Erlebnisse in Japan vorzubereiten hatte. »In Europa ist alles so groß, und in Japan ist alles so klein«, lautete sein Refrain, und das ließ, zusammen mit dem Rest der drei Strophen, an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Aber nur die allerprimitivsten Besucher dieser Samstagsvorstellung reagierten mit Grinsen auf die Absicht der Textfabrikanten. Die meisten schlossen ihre Augen und lächelten, fremdartig angerührt. Denn Japan war da, ein Traum- und Illusions-Japan, mit all seiner Zierlichkeit, seinen Häuschen aus Bambus, gezirkelten Zwerggärtchen, seinen leisen, delikat sich verneigenden Menschen, das alles bedroht von einer grob redenden, laut daher trappenden Rasse – in Europa ist alles so groß, und in Japan ist alles so klein. Es war entzückend, und der hingerissene Beifall hatte gar nichts von einer Quittung über einen unanständigen Witz.
Trotzdem verließ, während dieser Beifall noch scholl und der Vorhang auseinanderging zum Aufzug der zwanzig hochfrisierten Geishas, einer der Offiziere nervös und hastig die Loge, riss Hut und Mantel vom Haken und eilte durch das hallende Vestibül. Draußen schlug er den Kragen hoch und begann in der windigen, regnerischen Februarnacht einen ziellosen Spaziergang. Er ging um den Rynek, an Rathaus und Kathedrale vorbei, durchquerte den Park, gelangte zur Krakauer Vorstadt hinaus und kehrte in großem Bogen zurück, entlang dem Gitter des alten jüdischen Friedhofs, durch das die versinkenden Steine regennass schimmerten.
Er glaubte, weit gegangen zu sein. Aber es war noch lange nicht Mitternacht. Und erst um zwei kam der Express aus Deutschland hier durch, mit dem Pattay nach seiner Garnison zurückfahren konnte.
VIII
Aber am Montag, nach beendetem Dienst, nahm er den Abendzug und kam noch zurecht, um sie ihre beiden letzten Lieder singen zu hören. Kaum tat sie den Mund auf, so war der unertragbar gemischte Zustand von Bezauberung, Zorn, Scham und ratlosem Verlangen wieder da, der ihn in der Samstagnacht aus dem Hause getrieben hatte. Doch diesmal hielt er aus bis zum Schluss. Dann ging er um das Theater herum an den Bühneneingang.
Er blickte durch die Glasscheibe hinein. Er sah in seiner Loge den Portier, einen freundlichen jüdischen Alten mit schwarzem Käppchen und dünnem, rundem Bart, wie er den Choristinnen zunickte, die einzeln oder zu zweit die steinerne Treppe herunterkamen. Heute, am Wochentag, wurden sie von niemand erwartet. Jede, die herauskam, blickte neugierig in Pattays Gesicht. Dann erschien der muntere Herr Dienstel. Er trug einen mitgenommenen Krimmerpelz und eine Krimmerpelzmütze, hielt sich das Taschentuch vor den Mund und hüstelte grämlich.
Pattay hatte schon die Hand auf dem rotlackierten Drehknauf der Tür. Aber er entschloss sich nicht. Er trat zurück in den Schatten und überlegte. Und zu spät nahm er wahr, dass eine der beiden Frauen, die eben das Theater verlassen hatten und den Bäumen der Promenade zustrebten, den Umriss der Gesuchten aufwies. Er folgte ihnen nicht. Es erleichterte ihn, die Entscheidung hinauszuschieben. Eigentlich wartete er auf den Moment, da er aufwachen würde, sich die Stirne reiben, über sich selber in Lachen ausbrechen. Aber dieser Moment kam durchaus nicht.
In einem Kaffeehaus am Halickiplatz, in einer Ecke, wo das Licht schon ausgedreht war, saß er, bis die Dame am Buffet ihre Kasse verschloss und rings um ihn her die Kellner die Stühle auf die Tische stellten. Im Zug schlief er ein wenig und war in seiner Kaserne zurück – eine Stunde, ehe der Dienst begann.
Er fuhr am Dienstag, am Mittwoch, kam keinen Schritt weiter und stieg an jedem frühen Morgen aufs Pferd, übernächtigt, mit schmerzenden Augen. Endlich, am Donnerstag, drehte er den roten Türknauf, schritt rasch an dem Alten vorbei, der ihn erst anrief, als er schon auf der Treppe war, und fand oben gleich ihre Garderobe. Es war eine Art Bretterverschlag; ihr Name, der seltsame Nachname nur, stand auf einem Stück Pappe zu lesen. Sein Entschluss entsank ihm. Die Kehle war ihm so trocken, er räusperte sich laut. Spaltweit öffnete sich die Türe, und jemand schaute heraus. Eine großgewachsene Frau kam hervor und fragte nach seinem Begehren. Die Tür fiel hinter ihr zu.
Pattay vermutete oder wusste vielmehr, dass es die Frau war, mit der zusammen die Sängerin damals im Dunkel verschwunden war. Es war das versorgte, eher harte Gesicht einer Frau in den Fünfzigern. Die offene Gasflamme neben der Tür beschien scharf ihren stumpfschwarzen Scheitel, in dem jedes künstliche Haar ordentlich und einzeln neben dem andern lag.
»Wollen Sie bitte dem Fräulein meine Karte geben.« Die Frau streckte die Hand nicht aus.
»Sie empfängt niemand in ihrer Loge.«
»Dann werde ich warten.«
»Sie schließt keine Bekanntschaften.«
Er lächelte ironisch, und sogleich schämte er sich. Das war ein Lächeln aus vergangenen Tagen gewesen. »Vielleicht bestimmen Sie das Fräulein, eine Ausnahme zu machen«, sagte er immerhin, und tat eine Bewegung nach seiner Brusttasche.
»Geben Sie sich gar keine Mühe. Ich bin ihre Tante.«
»Das freut mich«, sagte er sinnlos.
Hinter der Frau ging die Tür auf, und Recha Doktor trat heraus, in schwarzem, anliegendem Mantel, mit einem dreieckigen kleinen Hut. Die bräunliche Blässe ihres Gesichts schimmerte warm im Licht. Ihre weiten Augen sahen an Pattay vorbei.
»Sie sollten hier keine Auftritte machen«, sagte die süße und scharfe Stimme. »Es ist völlig nutzlos.«
Pattay stand da, den Hut in der Hand. »Die Situation ist ganz ungehörig«, sagte er. »Aber ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte, Sie zu sprechen.«
»Gar nicht«, sagte sie sehr entschieden. »Gar nicht sollen Sie es anstellen. Ich hoffe, Sie verstehen das.«
Die Tante war in die Garderobe zurückgegangen, in der noch Licht brannte. Pattay sah sie drinnen den Mantel umnehmen, sich ein Tuch übers Haar legen, die Flamme über dem Toilettentisch löschen. Sie kümmerte sich um nichts mehr, schien beruhigt, dass ihre Nichte selbst für sich sorgen würde. Dann kam sie wieder heraus und wartete gelassen.
»Gehen Sie nun«, sagte die Sängerin. »Meine Deutlichkeit müssen Sie mir verzeihen. Es ist besser, Sie sehen gleich klar.«
»Das tue ich. Ich sehe vollkommen klar. Ich verwechsle Sie mit nichts und mit niemand. Beweisen lässt sich so etwas freilich nicht.«
»Nein, nicht wahr«, sagte sie mit einem geringschätzigen Lächeln, »beweisen lässt es sich nicht.«
»Vielleicht ist es ein Beweis, ein ganz kleiner, wenn jemand seine Nächte im Zug verbringt und nie mehr ordentlich schläft, um Sie singen zu hören.« Und er nannte das Städtchen, aus dem er kam.
»Es ist einer von diesen Ulanen, Kind«, sagte die Tante. Da sie das Ganze für erledigt hielt, ging sie langsam voraus, der Treppe zu. Recha schickte sich an, ihr zu folgen.
Rasch sprach er weiter. »Ich komme nur immer zum Ende zurecht. Sie tragen wundervoll vor. Aber doch ist es jedes Mal eine Qual.«
»Sie sollten das aufgeben.«
»Es ist nichts, was man aufgeben kann.«
Zum ersten Mal lächelte sie. Sie blickte ihn flüchtig an, sah gleich wieder weg und war errötet.
»Sie werden schon wieder schlafen. In zehn Tagen bin ich weit fort, in Warschau. Was machen Sie dann?«
»Dann nehme ich meinen Abschied und folge Ihnen.« Sie sah ihm jetzt gerade ins Gesicht, und ihr Blick leuchtete feindselig.
»Sagen Sie das noch einmal!«
»Ich nehme meinen Abschied und fahre nach Warschau.«
»Sie sollten sich schämen, solchen Unsinn zu reden. Was fällt Ihnen ein! Wahrscheinlich hat man Ihnen gesagt, ich sei schwierig. Da kommen Sie hinter die Bühne gelaufen und fahren Ihr gröbstes Geschütz auf. Jawohl, Sie nehmen den Abschied! Sie fahren nach Warschau! Man wird doch noch zustande kommen mit so einer Jüdin vom Tingeltangel. Wahrscheinlich haben Sie Geld drauf gewettet! Oh, wie ekelhaft und wie dumm!«
Sie musste aufs Blut verwundet sein. Ihre Augen hatten sich mit Zornestränen gefüllt. Sie schwieg. Man hörte in der plötzlichen Stille die Gasflamme singen. Dann kam von unten die Stimme der Tante, die ungeduldig ihren Namen rief.
»Ich liebe Sie«, sagte Pattay. »Sie wissen schon, dass ich nicht lüge. Es zählt sonst nichts mehr für mich.«
IX
Der auffallende Familienname kam von weither. Vor Jahrhunderten hatte in der Stadt Lublin ein Doktor Schalom Schachna gewirkt, Großrabbiner und Oberster Judenrichter, hochberühmt als ein erleuchteter Talmudkenner und Wohltäter, vom polnischen König wertgehalten, in den Akten der Zeit nicht anders genannt als »Doctor Judaeorum Lubliniensium«.
So stolz waren seine Nachkommen auf ihn gewesen, dass sie unter wechselnden Formen seinen gelehrten Titel im Namen beibehielten. Schließlich blieb nur der Titel noch übrig. Aber zu dieser Zeit wussten die Urenkel nichts mehr von Schachna.
Es hatte Ärzte, Rechtskundige und viele Rabbiner unter ihnen gegeben, aber auch das lag zurück. Längst brachten sie sich als kleine Geschäftsleute fort, waren Flickschneider, Schuster, Althändler, Hausierer. Vor dem Hause am Markt, wo der Großrabbi einst residiert hatte, riefen sie hinterm Karren im Singsang ihre schäbigen Waren aus. Die heute übrig waren, wohnten nicht mehr in der Stadt, sondern im Vorort Wieniawa, einer dörflichen Judensiedlung, zu der ein gewundener Pfad zwischen Sümpfen hinausführte.
Straßen gab es hier nicht, nur lehmige Bodenwellen, unordentlich bestanden mit versinkenden Hütten. Seltsam erhob sich auf einem Hügel in schönem, einfachem Umriss die Synagoge, einst Stolz, Trotz und Lebenssinn inmitten schmutziger Armut. Das war dahin. Unterm Altar und unter den Regengüssen war ihr Dach eingebrochen. Man hatte die Thorarollen und silbernen Geräte fortschaffen müssen aus dem durchnässten Bau. In einer kahlen Betstube nahebei fand die Gemeinde sich zusammen zum Gottesdienst. Die Judenschaft von Wieniawa war zu arm, ihren Tempel zu flicken.
Die Familie Doktor bewohnte ein schiefes, ebenerdiges Haus nahe bei einer kleinen Wassermühle, die Tag und Nacht klapperte. Zwischen dem Hinterhof und der Mühle standen zwei kräftige Eschen, schöne Bäume, rötlich blühend im Frühjahr, breitschattend im Sommer. Es waren die einzigen Bäume in Wieniawa.
An jedem Werktagmorgen, sehr früh, nahm der Händler Abram Doktor den Zugriemen um die Brust und brach auf nach der Stadt mit seinem Karren voll Posamenterie – Borten und Bändern, Flicken und Zwirn, Nadeln und Knöpfen. Seine drei Kinder hatten keine Mutter; sie war an der Geburt des kleinen Efraim gestorben, der nun zehnjährig war. Die Schwester der Verstorbenen, Chana, besorgte den Haushalt.
Der ältere Sohn, Józef geheißen, hatte sich mit seinem siebzehnten Jahr selbständig gemacht. In einem Lädchen nahe beim Krakauer Tor, einem Loch in der Mauer eigentlich nur, saß er, die Brille vor den zwinkernden Augen, und studierte in der feuchten Dämmerung seine hebräischen und jiddischen Schriften, die ihm niemand abkaufen wollte.
Das Mädchen aber, die zweitgeborene Recha, kam fast niemals zur Stadt. Die Tante Chana ließ sie nicht aus ihren wachsamen Augen. Im Sommer rückten sie sich ein Bänkchen unter einen der Bäume und arbeiteten da beim Mühlengeklapper an den Borten und Bändern, schnitten zurecht, säumten und putzten. Sie war ein zartes, empfindliches Kind, noch scheuer geworden durch die rechthaberische Ängstlichkeit, mit der sie behütet wurde. Denn Chana, früh Witwe geworden, tüchtig und eher hart von Natur, wandte alles, was sie an Liebesfähigkeit besaß, auf die kleine Ziehtochter. Ihr teilte sie auch ihr Misstrauen mit, eine fast besessene Furcht vor allem, was nicht jüdisch war. Der Vater warnte davor, mit Besorgnis und Spott.
»Nicht alle Christen sind Teufel, Chana. Das Kind zittert ja, wenn es den Briefträger sieht.«
Aber die Schwägerin gab ihm gar keine Antwort. Sie sollte sich auf furchtbare Art gerechtfertigt sehen.
Damals, in den Jahren vor dem Krieg mit Japan, erzitterte das russische Reich unter den Vorkämpfen einer Revolution. Und die alte Übung trat in ihr Recht: die Zarenregierung leitete den Groll ihrer Völker auf die Fremdlinge ab, die da in unheimlicher Absonderung, aufreizend unterschieden, gedrückt und hochmütig zugleich, unter ihnen wohnten. Alle die alten Blutmärchen sprangen auf. Die Zeitungen schrieben nach empfangenem Geheiß. In den Kasernen gab es Extraschnaps. Es kam ein Tag im November, da auch in Lublin die Händler und Handwerker hinter geschlossenen Läden lauschend im Dunkel saßen, den Gebetsmantel um die Schultern geschlungen. Und dann brach es los in der Stadt.
Die Juden im Vorort hielten sich zu Hause. Hier draußen wohnten sie unter sich, keine christliche Bevölkerung war da, die man aufwiegeln konnte. Aber sie hatten den Unternehmungsgeist der Soldaten selbst unterschätzt.
Eine Abteilung Kosaken kam den gewundenen Pfad zwischen den Sümpfen herangesprengt. Am Ortseingang saßen sie ab. Das Häuschen der Doktors lag etwas abseits. Aber sie fanden es. Sie fanden es leider spät, nachdem in den anderen Elendshütten ihre Habgier enttäuscht worden war. Deren Bewohner waren mit Fußtritten weggekommen. Aber hier, an den letzten, rächten sie sich. Vielleicht waren die zwei hohen, kahlen Bäume das Unglück. Sie legten den Gedanken zu nahe, die beiden Männer, Vater und Sohn, an ihren waagerechten Ästen aufzuhängen. Und das geschah denn, unter Gebrüll und Gelächter.
Der kleine Efraim war schreiend davongelaufen aufs Feld, und sie ließen ihn laufen. Sie schlossen Chana in einer Kammer ein und fingen an, sich mit dem vierzehnjährigen Mädchen zu beschäftigen, hinten auf dem Hof, im Angesicht der zwei schwarzen Gestalten, die da von den Eschen schwankten.
Das Kind war wenig entwickelt für sein Alter. Die Soldaten ließen sich Zeit. Laut stritten sie erst ein wenig um die unreife Beute. Dann losten sie, und der Gewinner machte sich lachend bereit.
Sie wurde gerettet durch eine Stimme, die vom Dorfe russische Worte herüberschrie. Dort hatten sie in der Betstube die silbernen Ritualgeräte entdeckt. Die waren eine stärkere Lockung als das magere Vergnügen hier. Der Hof wurde leer. Die kleine Recha öffnete die Augen und stand nicht auf.
Die Tante Chana pflegte sie während der langen Krankheit. Ein schweres Lähmungssymptom löste das andere ab. Drei Wochen lang schien es, als habe sie ihre Sprache verloren. Als sich ihr Zustand besserte, war sie so leicht, dass Chana sie auf einem Arm trug wie einen Säugling.
Am Tag nach dem Überfall wurde der Pogrom abgeblasen. Die Regierung veranstaltete sogar einen Scheinprozess gegen einige Schuldige. Es war ein bescheidener Pogrom gewesen, er hatte kaum fünfzig Leben gekostet.
Abram Doktor und sein bücherliebender Sohn lagen auf dem verwahrlosten Friedhof von Wieniawa, unter Ziegelscherben und krankem Gras. Der kleine Efraim war auch nicht wiedergekommen. In der Verwirrung der ersten Tage suchte niemand nach ihm. Später fand man ihn nicht.
X
Grünbaums bewohnten in der Nähe des Spittelmarkts in Berlin ein dreistöckiges Haus, das etwas schmalbrüstig mit seiner Zweifensterfassade, aber sonst ebenbürtig in der Front der übrigen lag. Das Erdgeschoss, dessen Hinterräume recht dunkel waren, enthielt die Pelzhandlung; in den beiden Oberstöcken war mehr Raum vorhanden, als die vierköpfige Familie in Anspruch nahm. Fast alle Juden, die aus Polen nach Berlin kamen, pflegten am Ostrande der Hauptstadt haltzumachen, so als wären sie von der Reise erschöpft und könnten nun keinen Schritt weiter. So hatten es auch die Grünbaums gehalten, als sie vor einem Menschenalter herwanderten. Zwei Jahrzehnte hatten sie hier unter armen Glaubensgefährten gelebt, nicht viel anders als einst in ihrem polnischen Städtchen. Nun aber, mit wachsendem Wohlstand und Sicherheitsgefühl, waren sie der Stadtmitte nahegerückt, und schon richtete sich ihr Blick auf die Bezirke im Westen, wo die ganz Arrivierten parkumgebene Villen besaßen, Offiziere und Staatsbeamte bei sich zu Gast sahen und die vorgeschrittenen Künste protegierten. Schon wussten sie es nicht mehr anders, als dass sie vollbürtige Bürger seien im Lande, jetzt und für immer. Selten gingen sie mehr zum Gottesdienst, hielten mechanisch noch fest an einzelnen Bräuchen und Speisevorschriften und hatten so ziemlich vergessen, woher sie kamen.





























