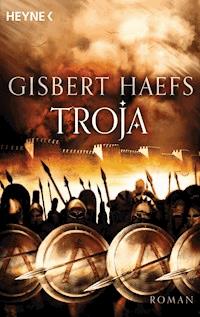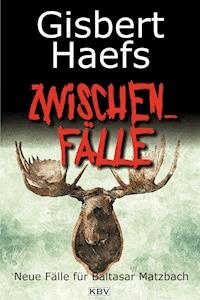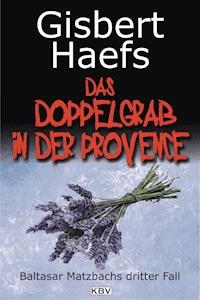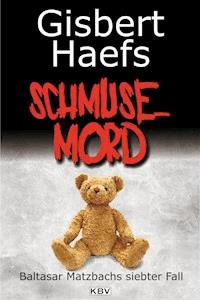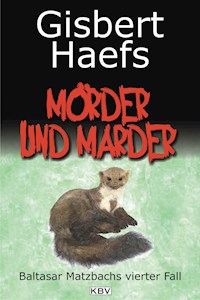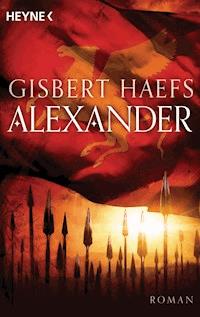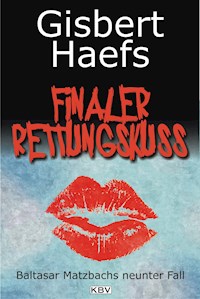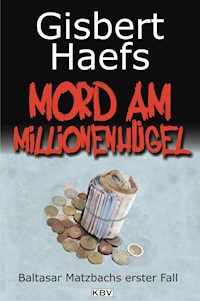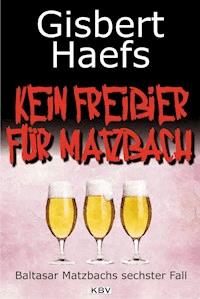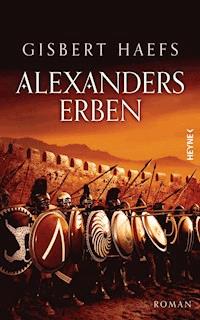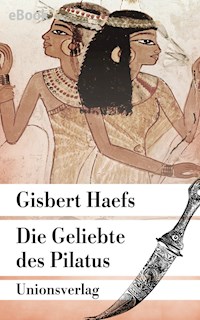
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine pharaonische Schönheit, ein römischer Offizier, ein nubischer Fürstensohn, ein indischer Schankwirt: Sie alle ziehen in der bunt zusammengewürfelten Karawane des Händlers Demetrios von der südarabischen Weihrauchküste in Richtung Mittelmeer. Doch was ist der wahre Zweck ihrer Reise? Welche Geheimnisse tragen sie mit sich? Alle scheinen insgeheim ganz eigene Pläne und Ziele zu verfolgen. Der gewaltsame Tod zweier Mitreisender ist nur der Anfang einer Kette von Verrat, Überfällen und Intrigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Eine pharaonische Schönheit, ein römischer Offizier, ein nubischer Fürstensohn, ein indischer Schankwirt: Sie alle ziehen in der Karawane des Händlers Demetrios von der südarabischen Weihrauchküste in Richtung Mittelmeer. Der gewaltsame Tod zweier Mitreisender ist nur der Anfang einer Kette von Verrat, Überfällen und Intrigen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Gisbert Haefs (*1950) ist Autor und Übersetzer. Er hat u. a. die Erfolgsromane Alexander und Hannibal verfasst und ist Übersetzer der Werke von Rudyard Kipling, Ambrose Bierce, Jorge Luis Borges, Sir Arthur Conan Doyle u. a. Zudem ist er Autor von Funkfeatures, Hörspielen und Kriminalromanen.
Zur Webseite von Gisbert Haefs.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Gisbert Haefs
Die Geliebte des Pilatus
Historischer Roman
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Erstausgabe erschien 2004 im btb-Verlag in der Verlagsgruppe Random House, München.
© by Gisbert Haefs 2004
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Frauen - Detail aus dem Grab des Nacht, Heritage Image Partnership Ltd (Alamy); Dolch - imageBROKER (Alamy)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31077-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 08:18h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE GELIEBTE DES PILATUS
Die Fürstin und der KriegerAn der WeihrauchküsteEin Spiel in der WüsteKamele und SänftenBrief des Sohnes an den VaterHandel und HändelBrief der Schwester an den BruderDie Karawane bricht aufAfers Taten und TräumeSpuren im SandDie Reinheit der AbsichtenPferch und VerliesJehoschuaIm KerkerDas Spiel beginntDer Weg nach JerusalemBelhadads GefangenePontius PilatusBeratung und RatlosigkeitIn Ao HidisLichte NachtVerfahren und VerlusteEin FluchtversuchBlutige OaseDie BeschwichtigungMehr über dieses Buch
Über Gisbert Haefs
Gisbert Haefs: »Mehr als ein plausibles Bild ist nicht möglich, weder für Historiker noch für Autoren historischer Romane.«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Gisbert Haefs
Zum Thema Ägypten
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Religion
Zum Thema Abenteuer
Die Fürstin und der Krieger
Ein Gesetz verbot es Männern, sich durch seidene Gewänder zu schänden.
Gaius Cornelius Tacitus
… im seidenen Kleidchen zeigt sie sich dir, fast nackt …
Quintus Horatius Flaccus
Duftende Salbe, das Gefühl kühler Seide auf gekühlter Haut, und die Gewissheit, sich beides nicht mehr lange leisten zu können. Der Vorrat an Goldmünzen war beinahe aufgebraucht. Aber in das Bedauern mischte sich die Überzeugung, Gold, Salbe und Seide wieder beschaffen zu können. Solange die Haut und der Körper nicht verfielen.
Nach dem ersten Mann, mit dreizehn, hatte sie befürchtet, mit zwanzig werde sie so verbraucht und mit fünfundzwanzig so runzlig sein wie die Frauen aus den Bauerndörfern. Nun war sie sechsundzwanzig, die Befürchtungen hatten sich verflüchtigt, und im Augenblick bedauerte sie nur, dass es hier kein richtiges Bad gab. Ein römisches Bad, mit Becken für heißes, laues und kaltes Wasser, und mit Badesklaven, die reiben und striegeln, und üppige Mengen Salbe …
»Ist es recht so, Herrin?«
Kleopatra ließ die mit glänzendem Silber belegte Bronzescheibe sinken. Der aufgetürmte Schopf erinnerte ein wenig an eine Pyramide – eine schlanke dunkle Pyramide, mit den edelsteinbesetzten Spangen als Leitern. Aber Pyramiden hatten gewöhnlich eine Oberfläche aus Stufen; wer brauchte da Leitern? Und wer, außer arabischen Läusen, sollte ihren aufgetürmten Schopf erklimmen wollen?
»Es ist gut. Du kannst gehen.«
Glauke neigte den Kopf. Geräuschlos glitt sie von dem breiten Schemel, auf dem sie gekniet hatte, und ging zur Tür. Vor dem schweren Ledervorhang, der Kleopatras Raum von dem ihrer drei Begleiterinnen trennte, blieb sie stehen und wandte sich um.
»Hast du Wünsche, Fürstin, oder kann ich eine Weile an den Hafen gehen?«
»Thais wird gleich hier sein. Wenn ich dich brauche, wird sie dich holen. Geh nur.«
Nicht, dass sie verstünde, was Glauke zum Hafen zog. Kleopatra misstraute dem Meer. Gleich welchem. Roms Meer im Norden, das Rote Meer, das sie überquert hatten, oder dieser Teil des großen Meeres, das zwischen Arabien und Indien lag – drei Ansichten des gleichen Ungeheuers. Es fraß Schiffe und Männer und Geld; wogen essbare Fische, Muscheln und Krebse das auf? Vielleicht der Handel … Aber es war nicht die Zeit, sich solch sinnlosen Gedanken hinzugeben.
Sie erhob sich aus dem beschnitzten Scherensessel und ging zum Fenster. Nicht ganz; nur so weit, dass sie im Schatten stehend, von außen unsichtbar, selbst alles sehen konnte, was auf dem Platz geschah.
Nicht viel, dachte sie. Mit Bedacht hatte sie diese Zeit gewählt, den frühen Nachmittag, da die meisten Leute des Orts sich in den Häusern aufhielten. Der Römer würde bemerkt werden, aber nicht von vielen. Man würde darüber reden – tuscheln, und Getuschel konnte Unwichtiges bedeutend machen.
Thais würde nicht gleich hier sein. Glauke war am Hafen, Arsinoë bei der Gattin des Handelsherrn Baschama, der die wenigsten Vorbehalte gegen Fremde zu haben schien. Thais hatte den Auftrag, sich bei den Frauen der Fischer und Seeleute an der langen nördlichen Bucht umzuhören, ob jemand etwas über Boote wusste, die ins Rote Meer fahren könnten, nach Norden.
»Aber da kommen wir doch her«, hatte Thais gesagt.
»Was nicht heißt, dass wir ewig hier bleiben müssen, oder?«
Kleopatra presste die Lippen aufeinander. Thais und Arsinoë wussten, dass sie weggeschickt worden waren, und sie würden sich wie angewiesen bemühen, früh und überraschend genug zurückzukommen, um zu sehen. Glauke, am Hafen, würde den Römer ohnehin sehen, wenn er das Gasthaus betrat. Ihrem Gesicht war deutlich zu entnehmen gewesen, dass sie sich fragte, für wen die Fürstin mitten am Tag ihre Haare gelegt, gerollt, getürmt haben wollte.
»Für mich«, murmelte sie. »Für wen denn sonst?«
Dort kam der Römer. Vor dem Haus der Händler – ah nein, vor dem Tempel des Regengottes blieb er stehen und betrachtete die Rückseite des Gasthauses. Sie war sicher, dass er sie hier oben nicht sehen konnte; dennoch trat sie einen Schritt zurück.
Im Geiste ging sie noch einmal alles durch. Was sie wollte; was sie ihm sagen würde; was sie verschweigen musste; was sie sich scheinbar widerstrebend würde entlocken lassen …
Männer sind so leicht zu foppen, sagte sie sich. Aber sie durfte nicht den Fehler machen, diesen Valerius Rufus zu unterschätzen. Er mochte einer Nebenlinie angehören, aber die Valerii waren alt und reich und wichtig. Rufus schien gebildet zu sein, hatte Witz, und kein Präfekt des Reichs schickte einen Trottel an eine so wichtige wiewohl abgelegene Stelle, wo er mit drei Dutzend Kriegern die Anliegen des Imperiums fördern oder verderben konnte. Kein Trottel; und gewiss kein einfacher Centurio.
Es klopfte an der Holztür, die den vorderen Raum von der düsteren Treppe trennte. Kleopatra schob den Ledervorhang beiseite und rief: »Wer ist da?«
Die Tür wurde halb geöffnet; der Kopf des Wirts erschien.
»Herrin – ein Römer will dich sprechen.«
Kleopatra verbiss sich das Lachen. Der Besitzer des Gasthauses klang beinahe unterwürfig; wie er »Römer« gesagt hatte, hätte er auch »Seeungeheuer« sagen können; außerdem war der Anblick des mit gelbem Tuch umwickelten Kopfs, der in der Türöffnung zu schweben schien, seltsam genug, auch ohne die Hand, die aus dem dunklen Nichts der Treppe kam und im Bart wühlte.
»Zeig ihm den Weg – sei so gut«, sagte sie. Dabei dachte sie an ihre Ankunft, vor einem Mond; damals war der Wirt keineswegs unterwürfig gewesen. Er hatte auf die Vorzüge seines Hauses verwiesen, auf das ehrwürdige Alter, auf die Beliebtheit bei weit gereisten Händlern – all dies zweifellos Vorspiel zur Verkündung hoher Preise. Sie hatte eine Goldmünze hochgehalten – einen römischen Aureus – und gesagt, diesen werde sie lieber woanders ausgeben. Ein Haus, das zweihundert Jahre alt sei, könne jederzeit einstürzen, und sie wolle Ruhe, nicht die Gesellschaft zahlloser Inder, Perser und Araber. Das Haus sei durchaus standfest und werde nicht in den Hafen rutschen, hatte er darauf behauptet, und weit gereiste lärmende Gäste gebe es zurzeit kaum. »Dann«, hatte Kleopatra gesagt, »wirst du dich hoffentlich freuen, wenigstens uns zu sehen und uns zwei Räume zu überlassen, für einen Mond, gegen diese Münze.«
Nach einigem Gezeter einigten sie sich auf einen Aureus für elf Tage. Männer sind so leicht zu foppen, sagte sie sich noch einmal, und sie erinnerte sich mit Vergnügen an das grimmige Gesicht der Frau des Wirts, während sie schon die kräftigen Schritte des Römers im Treppenhaus hörte.
»Rom zu Füßen der edlen Herrin«, sagte er, als er eintrat. Statt eines Fußfalls deutete er jedoch lediglich eine Neigung des Kopfs an; eher ein Nicken.
»Rom darf sich aus dieser unbequemen Haltung erheben.« Sie wandte sich ab und ging ins andere Zimmer zurück.
Rufus folgte; als er sich dem Scherensessel näherte, in dem sie wieder Platz genommen hatte, sah sie die schnellen Blicke, mit denen er die bunten Wandbehänge, die schweren dunklen Bohlen, die Truhen aus schwarzem Holz musterte. Und das Bett. Auf dem lederbespannten Gestell lagen Decken und Felle; sie lagen nicht sehr ordentlich, weil Kleopatra sie absichtlich zerwühlt hatte.
»Du kannst dich hierhin setzen.« Mit dem Fuß wies sie auf einen Schemel. »Oder dorthin« – mit dem Kinn deutete sie auf einen zweiten – »oder auf das Bett.«
Valerius Rufus lächelte. »Der Krieger, dem eine Fürstin ihr Bett anbietet, sollte den Helm fester schnallen und den Schwertgriff in die Hand nehmen.« Ohne sie aus den Augen zu lassen, zog er mit dem rechten Fuß einen der Schemel heran und setzte sich.
»Meine Begleiterinnen sind nicht da, deshalb kann ich dir nichts zu trinken bieten.«
»Ich bin gekommen, mich an deinen Worten zu laben.« Er stützte die Ellenbogen auf die Oberschenkel und bettete das Kinn auf die verschränkten Finger. »Weshalb hast du mich hergebeten?«
»Zwei Untertanen des Augustus Tiberius, am Ende der Welt gewissermaßen, sollten sich vielleicht verständigen.«
»Verständigen?« Diesmal war Rufus’ Lächeln schräg. Fast zweideutig. »Wie Edle in der Fremde? Wie Diebe in der Nacht?«
»Sagen wir, wie Edle, die von Räubern zu unterscheiden möglicherweise nicht ganz einfach ist.«
Er schwieg ein paar Atemzüge lang. »Worauf läuft das hinaus?«, sagte er dann. »Haben wir gemeinsame Ziele?«
Kleopatra unterdrückte jede Regung, die sich auf ihrem Gesicht hätte zeigen können. Triumph, zum Beispiel, weil sie schneller als erwartet – und leichter als erhofft – an diese Stelle gelangt war. Sie senkte den Blick.
»Kann ich mich dir ausliefern?« Sie fand ihre Stimme überzeugend: ein wenig verzagt, dennoch nicht demütig. Die Fürstin, die Hilfe sucht, aber nicht darum bittet.
»Versuch es«, sagte Rufus. »Ich kann dir nichts versprechen, außer, in gewisser Menge, Ehrlichkeit.«
»Ehrlichkeit und Redlichkeit, Tugenden eines römischen Kriegers?«
»Jemand hat einmal gesagt, Tugend sei nichts, was hemmt, sondern fördert. Fühl dich also gefördert.«
Sie tat, als ob sie zögerte; dann holte sie Luft und gab sich einen sichtbaren Ruck. »Nun denn. Ich brauche Hilfe, für die ich vielleicht erst zahlen kann, wenn sie mir geholfen hat, das Ziel zu erreichen.«
Rufus lehnte sich ein wenig zurück und verschränkte die Arme.
Sie wartete; als er nichts sagte, sprach sie weiter. »Es gibt etwas, das mir genommen wurde. Ich will es wiederbeschaffen; danach werde ich jede Hilfe belohnen können, die ich erhalten habe, und nie wieder neue Hilfe benötigen.«
»Wir sind nicht hergeschickt worden, um verlorene Gegenstände zu suchen«, sagte Rufus. »Wir schützen den Frieden des Imperiums. Und den Handel.«
»Ich weiß. Aber als ich neulich in eurem Lager war, habe ich etwas gehört. Etwas, das mich auf gemeinsame Ziele hoffen lässt.«
»Und zwar?«
»Dass ihr bald Adane verlassen und nach Norden gehen werdet.«
»Ah.« Rufus verzog das Gesicht. »Hat da wieder jemand nicht den Mund halten können?«
»Sei ihm nicht böse. Und mir auch nicht.« Kleopatra lächelte. »Du weißt, wie schwer es einsamen Kriegern fällt, schönen Frauen gegenüber zu schweigen.«
»Hat also jemand einer deiner Begleiterinnen etwas gesagt? Du warst ja die ganze Zeit mit mir zusammen.«
»Was sich verlängern und ausschmücken ließe.« Eigentlich hatte sie an dieser Stelle den gewaltigen Augenaufschlag vorgesehen, den Großen Blick; sie sagte sich aber, dass Rufus schon ausreichend geködert war und einer Darstellung der Kuhäugigen Aphrodite nicht bedurfte. Vielleicht wüsste er sie auch nicht zu würdigen. Und in dem Spiel von Anziehungen und Abstoßungen, das sie entwarf, durfte sie nichts übertreiben.
»Verlängern und ausschmücken?« Rufus deutete ein schräges Lächeln an, blickte zum Bett, dann wieder in ihr Gesicht. »Sag mir doch einfach, was du willst.«
»Das ist nicht einfach. Es ist – mehrfach.«
Rufus nickte. »Mehrfach ist immer gut. Sprich.«
»Ich will versuchen, es so schlicht wie möglich zu sagen. Ein Teil der Geschichte betrifft den Präfekten von Judäa.«
»Pontius Pilatus?« Rufus hob die Brauen. »Was hat er … aber sprich einfach weiter; ich lausche.«
»Auf dem Weg von Rom nach Judäa hat er sich eine Weile in Alexandria aufgehalten. Wie du sicher weißt. Dabei haben wir« – sie blinzelte – »angenehme Stunden miteinander verbracht. Im vorletzten Winter kam er von Caesarea aus noch einmal nach Alexandria; so haben wir uns wiedergesehen.« Sie machte eine Pause.
Rufus schloss die Augen; mit einer Stimme, die für Kleopatra künstlich gelangweilt klang, sagte er: »Gehört die Wiederholung von Liebschaften zu den Dingen, die ein Centurio zu fördern hat?«
»Hör mich an, dann wirst du wissen, dass es um mehr geht. Viel mehr. Pilatus bat mich, die Ohren offen zu halten. Falls ich etwas höre, das ihn betreffen könnte, sollte ich es ihm weitergeben. Die Juden von Alexandria sind einflussreich, wie alle wissen, und einige sind im ganzen Imperium bekannt.«
»Meinst du Philo?«
»Den auch, aber neben Schreibern und Denkern gibt es andere. Gleichviel; ich habe etwas über eine Verschwörung gehört.«
»In Alexandria?«
»Zwischen Jerusalem und Alexandria, gegen Pilatus. Es geht um Tempelgeld und eine Wasserleitung.«
Rufus lachte, aber es klang freudlos. »Er hat das Richtige getan, sage ich. Unverzeihliche Blasphemie, sagen die Juden.«
Kleopatra hob die Hand. »Ich weiß nicht genug darüber, und vielleicht sollten wir nicht urteilen.«
»Nein? Der Präfekt muss urteilen. Jerusalem mit frischem Wasser zu versorgen, gehört zu seinen Aufgaben; dass er die Leitung mit dem Geld hat bauen lassen, das Juden aus aller Welt zum Tempel schicken?« Er grinste. »Gerissen von ihm, unverzeihlich in den Augen der Juden. Aber sag, wie willst du, ohne zu urteilen, das Imperium verwalten?«
»Ich will es gar nicht. Dafür seid ihr zuständig.«
Er knurrte leise. »Weiter«, sagte er dann.
»Als ich diese Dinge hörte, war ich auf dem Weg nach Koptos, zu meinen Besitzungen. Ich bin wohl leichtsinnig gewesen und habe auf dem Nil, auf dem Schiff, ein falsches Wort gesagt. Bevor ich noch an Pilatus hatte schreiben können.«
»Derlei kommt vor, sogar bei Fürstinnen.«
Sie erzählte weiter, schnell, erfindungsreich und gesammelt: über den römischen Händler, einen »Neuen Reichen«, der seit Langem ihre Länder und Häuser begehrt und sich nun mit einem jüdischen Geschäftsfreund zusammengetan habe, um sie zu berauben und zugleich zum Schweigen zu bringen; über bestochene Männer in der Verwaltung des Gaus von Theben; über die hastige Flucht durch die Wüste nach Berenike; über die nahenden Verfolger, vor denen sie sich auf ein auslaufendes Schiff gerettet habe.
»Und nun, da ich höre, dass ihr bald nach Norden geht«, sagte sie schließlich, »bitte ich darum, mit euch reisen zu dürfen. Vier Frauen allein, du weißt …«
Rufus nickte. »Ich nehme an, du willst Pilatus warnen und ihn außerdem bitten, dir zu deinen Gütern zu verhelfen?«
»Beides. Und noch etwas.«
»Noch mehr? Was denn noch?«
»Der verlorene Gegenstand.«
Rufus seufzte.
»Vielleicht kostbarer«, sagte Kleopatra langsam, »als all das, was diese beiden Händler mir genommen haben.« Sie erhob sich aus dem Scherensessel und ging zum Fenster.
»Löse das Rätsel und meine Spannung, Herrin.« Aber seine Stimme, fand sie, klang keineswegs gespannt.
Arsinoë stand vor dem Tempel des Regengottes und schien zwei Männer zu beobachten, die sich mit einem störrischen Esel abmühten. Als Kleopatra eine Hand auf den Sims legte, nickte Arsinoë und setzte sich mit kleinen Schritten in Bewegung. Kleopatra wandte sich um und ging zu dem Römer.
»Kostbarer«, sagte sie leise, mit belegter Stimme, »als Gold oder teure Salben.« Dabei bewegte sie sich so, dass der Duft ihres Körpers Rufus erreichen musste.
Er hob die Hand; einen Augenblick dachte sie, er werde gleich den Arm um ihre Hüfte legen.
»Kostbarer Duft, fürwahr«, sagte er. »Erzähl mir von dem Gegenstand.« Er blickte zu ihr auf und kratzte sich im Nacken.
»Eine Fundstätte. Smaragde.«
Rufus pfiff leise. »Was ist damit? Wie kann eine Fundstätte von Smaragden verloren gehen?«
»Sie befindet sich in einem Felsental, in der Wüste. Als die Römer … als Augustus Ägypten eroberte, wurden alle Zugänge verschlossen, die Schächte zugeschüttet. Der Weg und ein paar Hinweise darauf, wie alles wieder zu öffnen wäre, sind verzeichnet.«
»Warte bitte.« Rufus hob die Hand. »Smaragde … Ich erinnere mich daran, etwas gehört zu haben. Alte Fundstätten in den steinigen Wüstentälern nördlich von Berenike?«
»Linien«, sagte sie. »Zum Auffinden unvorstellbarer Schätze. Linien wie die einer Hand. Zeig mir deine Hand, Römer.« Sie ergriff Rufus’ Rechte und beugte sich darüber.
»Die Stätten nördlich von Berenike«, sagte er mit belegter Stimme; dabei näherte er den Kopf, berührte mit der Nasenspitze Kleopatras aufgetürmtes Haar und atmete laut ein. Es klang beinahe wie ein Ächzen.
»Linien«, murmelte sie. »Gute Linien. Hier, die …«
In diesem Augenblick erschien Arsinoë. Sie blieb im Durchgang zwischen den Räumen stehen, schnalzte, sagte: »Um Vergebung, Herrin«, schnalzte abermals und ging wieder hinaus.
Sie würde bezeugen, dachte Kleopatra, dass der Römer sie an der Hand gepackt hatte. Falls es nötig wäre. Oder dass sie und Rufus vorbereitende Berührungen ausgetauscht hatten. Falls das nötig sein sollte.
»Deine Begleiterin«, sagte Rufus. Er räusperte sich. »Was …«
»Nur zur Sicherheit.« Kleopatra ließ seine Hand los und setzte sich wieder auf den Scherenstuhl.
»Zur Sicherheit?«
»Sie schaut in Abständen nach mir. Um zu sehen, ob ich etwas brauche.«
»Ah.«
Wenn es je ein zweifelndes Ah gegeben hatte, dachte Kleopatra, dann war es dieses. Sie verkniff sich ein Lächeln.
»Der Weg, sagte ich eben, und Hinweise auf die Schächte sind zweifach verzeichnet.«
»Warte bitte. Deine Begleiterin … ach, lassen wir das. Aber die Smaragde bei Berenike.« Er kniff die Augen zu Schlitzen und sah sie starr an.
»Was ist damit?«
»Sie gehörten den Königen. Zuletzt der Königin, deren Namen du trägst.«
»Und?«
»Wie können sie dann dir, oder deiner Familie, deinen Vorfahren gehört haben?«
»Es gibt … Verwandtschaft.«
»Bist du mit ihr verwandt?« Nun riss der Römer die Augen weit auf. »Oder erzählst du Lügengeschichten?«
»Die Fürstin lügt nicht«, sagte Kleopatra mit harter Stimme. »Willst du die Geschichte hören oder nicht?«
Er nickte wortlos.
»An zwei Stellen verzeichnet, sagte ich. Auf … nein, unter dem Sockel einer Statue des Gottes Anubis. Und auf der unteren Seite des Steins in einem Siegelring.«
»Wo sind diese Wegweiser?«
»Ich mag es nicht laut sagen«, flüsterte Kleopatra. »Manchmal haben Wände Ohren. Komm, lass es mich in dein Ohr flüstern.«
Rufus stöhnte leise, erhob sich dann aber von seinem Schemel und kniete vor ihr nieder, sodass sein rechtes Ohr in Höhe ihres Mundes war.
»Das Götterbild«, hauchte sie.
Dann brach sie ab, denn Thais, die geräuschlos das vordere Zimmer betreten hatte, erschien im Durchgang und sagte: »Fürstin?«
Kleopatra hob die Linke und winkte ab. »Stör mich nicht; geh zu den anderen. Wenn wir hier fertig sind, komme ich hinunter.«
Thais neigte den Kopf, wandte sich ab und ging.
Sie würde bezeugen, dass der Römer vor ihr gekniet hatte; falls dies nötig sein sollte. Und, dachte Kleopatra, wie Arsinoë hätte sie mir helfen können, wenn anderes nötig gewesen wäre.
»Was ist mit dem Götterbild?« Rufus kniete noch immer.
»Es wurde gestohlen«, flüsterte Kleopatra. »Ich weiß, wo es ist. Ich kann es finden. Auch der Ring wurde gestohlen, aber von ihm weiß ich nichts.«
»Wo ist das Bildnis?«
»In einer Oasenstadt, östlich der Straße von Petra nach Damaskus.«
Sie war nicht sicher, hatte aber das Gefühl, dass Rufus ein klein wenig zusammenzuckte.
Langsam, fast lautlos sagte er: »Redest du etwa von Ao Hidis?«
Sie legte die Hände auf seine Schultern, schob ihn ein wenig zurück und sah ihm in die Augen. Sie war verblüfft und bemühte sich nicht, es zu verbergen. »Was weißt du von Ao Hidis?«
Er hob die Schultern. »Dort gibt es einen Fürsten, der Rom hin und wieder ein wenig verärgert. Aber sag, wie kommt die Statue dorthin?«
»Vor sechzig Jahren hielt der Vater des Fürsten sich in einem der Paläste Kleopatras auf. Er war ein Freund und Bewunderer von Marcus Antonius und hatte einige mutige Reiter mitgebracht, um gegen die Feinde von Marcus und Kleopatra zu kämpfen. Als alles zusammenbrach …« Sie hob die Schultern.
»Hat er zusammengerafft, was er gerade finden konnte, und hat es mitgenommen, gewissermaßen als Sold?«, sagte Rufus. Er grinste. »Sieht dem Fürsten, dem heutigen, meine ich, so ähnlich, dass ich keine Mühe habe, es zu glauben.«
»Der Ring befand sich an Kleopatras Hand, als sie den Kuss der Schlange suchte. Es war nicht der Siegelring des Reichs der Ptolemaier, deshalb hat Augustus, der damals noch Octavianus war, ihn nicht für sich behalten. Er hat ihn einem verdienten Mann gegeben, einem Ägypter.«
»Ägypter oder Makedone?«
»Ägypter. Einer, der den Römern geholfen hat. Der Mann ist später nach Arabien gereist und umgekommen. Niemand weiß, was aus dem Ring wurde.«
Rufus kehrte zu seinem Schemel zurück. »Deine Geschichte hat Mängel.« Einen Atemzug lang entblößte er die Zähne.
»Ach ja?«
»Wenn die Hinweise auf die Smaragdstätten beim Zusammenbruch eingeritzt wurden, können sie nicht vorher schon auf dem Ring und dem Anubis gewesen sein.«
Kleopatra lächelte. »Scharfsinniger Mann«, sagte sie. Sie beugte sich vor und tätschelte Rufus’ Wange. »Es waren die ergiebigsten und besten Fundstätten. Sie waren geheim. Keiner, der dort arbeitete, hat das Tal je lebend verlassen. Die Ritzungen waren lange vorher angebracht worden – falls einmal niemand mehr den Weg weiß.«
Rufus schwieg eine Weile; schließlich sagte er: »Meine Leute und ich sollen dich nun also nach Judäa geleiten, damit Pilatus deinen Klagen lauschen, eine Verschwörung bekämpfen und dir helfen kann, verlorene Güter zurückzuerhalten. Und auf dem Weg dorthin sollen wir Ao Hidis besuchen, um dort den Sockel eines Anubisbildnisses zu untersuchen?«
»Es wäre sehr freundlich, ja.«
»Wenn ich denn nun beschlösse, ohne dich diesen Anubis zu betasten, die Ritzung in seinem Sockel abzumalen?«
»Es würde dir nichts nützen, Rufus. Um die Zeichen deuten zu können, sind gewisse Kenntnisse nötig. Die Linien beschreiben den Weg von einer bestimmten Stelle zu den Smaragden. Ich weiß, wo diese Stelle ist – du weißt es nicht und kannst sie nicht finden.«
Er nickte; die Auskunft schien ihn nicht weiter zu verblüffen. »Also Palästina und Arabien?«
»So ist es.«
»Und die Belohnung, von der du gesprochen hast?«
»Gold, sobald ich die Güter wieder besitze. Oder sobald mir jemand, vielleicht Pontius Pilatus, etwas vorstreckt. Smaragde, sobald ich Zugang zu den Fundstätten habe.«
»Chimären«, knurrte Rufus. »Aber es soll schon greifbare Chimären gegeben haben.«
»Außerdem ist es eine lange Reise.« Sie glitt aus dem Scherensessel und kniete vor dem Römer. »Auf einem langen Weg könnte man einander näherkommen. Ich glaube, meine Begleiterinnen mögen römische Offiziere, solang diese jung sind und gut aussehen. Und ich …« Sie schwieg.
»Du?« Er lachte. »Der Duft, der dich umhüllt, reizt dazu, nach dem Quell allen Duftes zu suchen. Dem Quell all deiner Düfte. Aber Pilatus ist ein wichtiger Mann.«
»Er hat eine römische Gemahlin. Ich war keine Jungfrau, als ich ihm begegnete, und ich habe nicht vor, wieder zur Jungfrau zu werden.«
»Trotzdem.« Rufus legte die Handflächen an ihre Wangen. Es war nicht schwer, die Gier in seinen Augen zu sehen. »Römische Offiziere sollten nicht im Gehege von Vorgesetzten wildern.«
»Das kommt darauf an.«
»Worauf?«
»Wer der Wilderer ist. Wer das Gehege angelegt hat. Ein langer Weg, wie gesagt.«
Er hielt immer noch ihr Gesicht mit beiden Händen fest. Nun beugte er sich vor und streifte ihre Lippen mit dem Mund.
»Ein köstliches Gehege, fürwahr.«
Sie lachte. »Reden wir von der Reise«, sagte sie. Dabei griff sie nach seinen Handgelenken und entfernte die Hände von ihren Wangen; nicht ohne die Innenfläche der rechten Hand des Römers mit der Zungenspitze zu berühren. »Wie und wann willst du reisen?«
»Wir haben die Weisung erhalten, etwa zur Tagundnachtgleiche des Frühjahrs in Judäa zu sein. Es bleibt einige Zeit. Vielleicht bricht bis dahin eine Karawane auf, der wir uns anschließen können. Oder wir stellen selbst eine zusammen. Oder« – er zuckte mit den Schultern – »wir erhalten neue Befehle, die uns anspornen oder zügeln.«
»Also Aufbruch irgendwann im Lauf des nächsten Mondes?« Sie kehrte zum Sessel zurück.
»So etwa.« Plötzlich lachte er.
»Warum lachst du?«
»Deine Begleiterinnen sind nicht zufällig hereingekommen. Damit du, falls wir uns streiten, einem römischen Präfekten sagen kannst, sie hätten gesehen, wie ich zudringlich wurde?«
Kleopatra lächelte kühl. »Jeder Präfekt würde mir auch ohne die Worte meiner Begleiterinnen glauben.«
»Mag sein. Es hat auch keine Bedeutung. Ich habe nicht vor, mich mit dir zu streiten. Du solltest aber noch etwas bedenken.«
Sie hob die Brauen und sah ihn an.
»Meine Männer. Sie sind ausgesuchte Krieger. Wenn du willst, dass sie dich und deine Frauen schützen, solltest du etwas für sie tun.«
»Wie meinst du das?«
»Sagen wir, eine gewisse Vertrautheit herstellen. Sie werden zuverlässiger und umgänglicher sein, wenn sie das Gefühl haben, dass es nicht um irgendeine Fürstin mit beliebigen Begleiterinnen geht, sondern um Frauen, die sie näher kennen.«
Kleopatra verzog den Mund. »Du willst nicht etwa vorschlagen, dass …«
Er hob die Hand. »Keine Sorge; wie kannst du derlei denken? Sie sollen euch schätzen und achten, nicht gering schätzen.«
»Was soll ich tun?«
Rufus kicherte. »Demnächst wird es einen kleinen Wettbewerb geben. Ah, deine Wände haben Ohren, sagtest du? Komm, ich will es dir ins Ohr flüstern.«
Kleopatra beugte sich vor und lauschte.
»Nett«, sagte sie, als er fertig war. »Das gefällt mir.« Dann klatschte sie in die Hände und lachte laut.
An der Weihrauchküste
Das Gewürzland zerlegt man in vier Teile. Von den Gewürzen sollen der Weihrauch und die Myrrhe von Bäumen kommen, die Kassia aber auch von Sträuchern; einige aber sagen, die Kassia komme aus Indien und der beste Weihrauch sei der in Persien. Nach einer anderen Einteilung zerlegt man das ganze Glückliche Arabien in fünf Königreiche, von welchen das eine die Krieger und Vorkämpfer aller, ein zweites die Ackerbauer, von denen das Getreide den Übrigen zugeführt wird, ein drittes die Handwerker enthält; dazu noch das Myrrhen- und das Weihrauchland. Diese beiden tragen auch die Kassia, den Zimt und die Narde. Die Beschäftigungen aber gehen nicht von dem einen zum anderen über, sondern ein jeder bleibt bei der des Vaters. Der meiste Wein kommt von Palmen. Brüder sind geehrter als Kinder.
Strabo
Mit dem, was die sesshaften Gelehrten wissen, käme kein Händler oder Seefahrer je irgendwo an.
Antigonos Karchedonios
Eigentlich, sagte sich Demetrios später, sollte man keine nutzlosen alten Sklaven erwerben, aber manchmal muss man eine Ausnahme machen. Man sollte auch nicht blindlings Geld bei einem Rennen verwetten; der Verlust ist berechenbar, aber man weiß nie, welche Folgen es haben kann, wenn man gewinnt. Das war jedoch viel später.
Er bemerkte den Greis, weil dieser sich nicht bewegte: ein regloser Fleck inmitten des Tosens. Seit Verlassen des Roten Meeres hatten sie gegen den Südostwind rudern müssen, der Wellen türmte und Gischtflocken trug, die Palmen in der Bucht von Adane zauste und das Tauwerk singen ließ. Wolkenfetzen eilten nordwärts nach Arabien, Windfetzen jaulten und zappelten im gerefften Segel, Wasserfetzen benetzten die Männer mit salziger Frische. Alle waren zu erschöpft – oder zu vorsichtig –, um die felsige Küste der Halbinsel zu umrunden und in den östlichen Hafen zu fahren, unter dem Krater. Dorthin, wo die Schiffe aus Indien lagen, geschützt von der Insel vor der Einfahrt ins Becken. Mit letzter Kraft ruderten sie stattdessen in die weite westliche Bucht, dann die Nordseite der Halbinsel entlang zum kleinen Hafen vor der Landzunge. Dort standen Wohn- und Lagerhäuser unter den Palmen, und an einem rauhen Stamm saß der alte Mann.
Aber zuerst sah Demetrios nur diesen erstaunlich ruhigen Fleck. Und vergaß ihn. Der Steg, an dem sie anlegten, hob und senkte sich zwischen den Pfosten, an denen Bronzeringe eine scheußlich schrappende Musik machten. An der Nordseite der Bucht, wo Männer mit Stangen und Brettern herumliefen, wühlte der Wind Sandschleier auf, und ein paar Kamele auf der Landzunge schienen rückwärtsgehen zu wollen, um keinen Sand in die Augen zu bekommen.
»Wohlgetan, Herr«, sagte der Schiffer. Er ließ die Arme baumeln, um die Muskeln zu entspannen. »Eigentlich hast du uns ja nicht bezahlt, um dann selber zu rudern.«
»Der kluge Händler legt lieber Hand an, als untätig Opfer der Winde zu werden.« Demetrios lächelte ein wenig mühsam. Seine Sohlen waren rauh von Salz und wund von den Planken, vom Stemmen und Rutschen und neuem Stemmen.
Einer der Seeleute legte die Tauschlinge über den Pfosten am Steg. Der Schiffer prüfte die Bänder der Ledertasche, die das linke Heckruder vom Steg fernhalten sollte; dann wandte er sich wieder an Demetrios.
»Wie lange willst du bleiben?«
»Ich weiß es nicht. Das hängt von den Geschäften ab. Wenn sie gut sind, werden wir eine Karawane zusammenstellen und den Landweg nehmen; wenn sie schlecht sind, werde ich dich vielleicht nicht für die Rückfahrt bezahlen können.« Er zwinkerte. »Wie lange bleibst du?«
»Auch ich weiß es nicht.« Der Schiffer bleckte die Zähne. »Das hängt von den Geschäften ab. Ich muss ein paar Schreiben aushändigen, und danach? Vielleicht will jemand gegen den Wind Fracht nach Kane befördern lassen; vielleicht hat jemand Güter ins Rote Meer zu bringen. Man wird sehen.«
»Wenn ich schnell mit dem edlen Kharkhair einig werde«, sagte Demetrios, »lasse ich es dich wissen. – Kommt.« Er winkte den vier anderen, die ihn von Ägypten herbegleitet hatten. Sie schienen nicht traurig zu sein, das tanzende Schiff verlassen zu können.
Erst jetzt, als sie mit ihren Beuteln über den Steg zum Land gingen, sah Demetrios, dass der reglose Fleck an der Palme ein Mann war. Ein alter Mann. Er trug nichts als einen Leibschurz. Der Rücken musste gefühllos sein, sonst hätte er nicht am schroffen Palmenstamm lehnen können. Brust und Schultern waren mit Narben bedeckt, wie die Fußsohlen mit Schwielen. Er hatte nur eine Hand; über den Stumpf, der einmal das linke Handgelenk gewesen war, krochen zwei Fliegen.
»Eine Gabe, Herr, zur Versöhnung der Götter? Als Dank an Neptunus?« Er hielt dem Händler die Handfläche hin, wie einen rissigen Napf.
Latein war nicht Demetrios’ liebste Sprache, aber hier am Südrand Arabiens klang es für ihn beinahe heimatlich.
»Römer?« Demetrios blieb stehen und sah auf den Alten hinab. »Hier – und so?« Dabei legte er den Zeigefinger an seinen Hals: dorthin, wo bei dem Alten das bläulich schimmernde Eisenband verlief, mit dem manche Wohlhabenden ihre Sklaven zeichneten.
»So, Herr. Damit der Fährmann mich festhalten kann, wenn ich versuchen sollte, in den Styx zu springen.« Er grinste, und Demetrios sah drei traurig vereinsamte Zähne.
Hinter ihm räusperte sich Meleagros. »Sollten wir nicht lieber eine Unterkunft suchen?« Er klang nicht gerade unwirsch, aber so missbilligend, wie es einem erfahrenen Karawanenmann seinem Herrn gegenüber gerade noch zusteht.
Demetrios wandte sich seinen Begleitern zu. Meleagros hatte die Stirn gerunzelt; mit der Rechten zerrte er an einem der Tragriemen des großen Reisebeutels, der vom Nacken bis zu seinem Gesäß reichte. Prexaspes stand breitbeinig neben ihm; das Gesicht des Persers zeigte – außer Reiseschmutz und Müdigkeit – allenfalls gemessene Erheiterung. Der hagere Leonidas trat von einem Bein aufs andere, und Mikines machte Anstalten, seinen schweren Beutel abzusetzen.
»Geht voraus«, sagte Demetrios. »Kurz vor dem Krater, nicht weit vom Ende der Landzunge, steht Ravis Gasthaus. Grüßt ihn von Demetrios dem Unzeitigen und seht zu, dass ihr zwei Räume für uns bekommt. Ich folge bald.«
»Demetrios der Unzeitige? Du wirst uns hoffentlich eine schöne Lügengeschichte darüber erzählen, wie dir dieser Beiname zugefallen ist, Herr.« Meleagros hob die Hand und winkte den anderen.
Demetrios sah ihnen ein paar Atemzüge lang nach. Es war Nachmittag, und hier am Nordrand der Halbinsel, im Schutz der schartigen Felshaufen und Gebäude, staute sich die Hitze. Nur weiter oben zauste der kräftige Wind die Palmwedel. Zwischen der Uferkante und den Gebäuden saßen hier und da Männer, die redeten oder dösten. Ein riesiger Neger schlenderte vorüber, in die gleiche Richtung wie Demetrios’ Gefährten. Er trug nur einen ledernen Leibschurz und über der linken Schulter einen Ziegenbalg, aus dem er eben Wasser in die hohle Hand rinnen ließ. Er schlürfte es auf, mit wahrlich prunkvoller Lautstärke; als er Demetrios angrinste, sah dieser, dass der Schwarze spitz zugefeilte Eckzähne besaß. Und dass sein Haar rot gefärbt war. Dann stolperte der Mann über etwas – Luft oder die eigenen Füße – und schlug lang hin. Als er sich aufgerappelt hatte, schwenkte er mit einem triumphierenden Lächeln den unversehrten Ziegenbalg.
»Nubo der Rote Trottel«, sagte der alte Sklave. »Angeblich Sohn eines Fürsten irgendwo in Kusch. Und Demetrios der Unzeitige. Ein Geschäftsfreund des ebenso reichen wie rauhen Handelsherrn Kharkhair, nicht wahr?«
Der Greis konnte nicht gehört haben, dass Demetrios diesen Namen an Bord des Schiffes genannt hatte.
»Woher weißt du das?«
»Du bist vor einigen Jahren schon einmal hier gewesen. Du wirst mich nicht gesehen haben, Herr, aber ich dich.«
Demetrios musterte das zerfurchte Gesicht des Alten; eine von der Sonne gedörrte und verwüstete Lehmfläche mochte lange nach dem letzten Regen so ähnlich aussehen.
»Erzähl mir deine Geschichte«, sagte Demetrios. »Wenn sie gut ist, gehört das dir.« Aus dem Gürtel zog er eine silberne Halbdrachme und hielt sie hoch.
»Der Tageslohn eines Freien. So gut soll die Geschichte sein?«
Demetrios hockte sich auf die Fersen und sah ihn an. »Wie kommt ein Römer als Sklave nach Adane? Warum muss ein Sklave betteln? Was, außer meinem Namen und dem Besuch bei Kharkhair, hast du dir sonst noch gemerkt?«
Der Bettler schloss die Augen; mit monotoner Stimme sagte er: »Ich bin dreiundsiebzig. Vor fünfundfünfzig Jahren war ich einer der Krieger, mit denen Aelius Gallus Arabien erkunden wollte; und ich war einer von denen, die nicht zurückgekehrt sind. Ich wurde verwundet« – er hob den linken Arm – »und gefangen; seitdem bin ich Sklave. Hier, da und dort. Seit zwanzig Jahren in Adane, Sklave des Karawanenherrn Mukhtar, in den letzten Monden der seines Sohnes.«
Demetrios unterbrach. »Ist der alte Mukhtar denn gestorben? Wann?«
»Im späten Frühjahr.«
»Früher oder später verlangen die Götter nach unserer Gesellschaft in der Unterwelt«, sagte Demetrios. »Man fragt sich nur, wozu. Aber sprich weiter.«
»Mukhtar dem Jüngeren habe ich gesagt, dass er zwar den Namen und den Reichtum seines Vaters geerbt habe, dass dessen Klugheit jedoch bei ihm zu Dummheit verkehrt wurde. Dafür muss ich nun um meine Nahrung betteln. Falls ich genug zusammentrage, kann ich mich freikaufen. Wenn nicht, wird er mich köpfen. Es sei denn, ich wäre bis dahin verhungert.«
»Bis wann sollst du dich freikaufen, um nicht geköpft zu werden?«
»Bis zum Ende des Mondes.«
»Das ist übermorgen?«
Der Alte nickte.
»Und der Preis?«
»Billig, Herr Demetrios. Ein guter Arbeitssklave kostet in Adane zurzeit eineinhalb bis zwei Minen – zweihundert Drachmen. Mukhtars Sohn verlangt nur hundert Drachmen. Hundertfach zu viel für einen nutzlosen Greis.« Endlich öffnete er die Augen, die scharf und dunkel blickten. Mit einem spöttischen Zwinkern fuhr er fort – auf Griechisch. »Ein nutzloser Greis, der sich allerdings vieles gemerkt hat: Wege durch die Wüste, alle Brunnen zwischen Adane und dem Land der Nabatäer, die Preise aller Handelsgüter, die Gesichter aller wichtigen Händler und Räuber. Und der alle Zungen spricht, die zwischen Adane und Syrien gebräuchlich sind.«
Demetrios warf ihm die Halbdrachme in den Schoß und stand auf. »Wie heißt du?«
»Opiter Perperna.«
»O ihr Götter! Der Name allein ist Grund genug, dessen Träger zu köpfen. Sind denn keine Römer in der Nähe, die dich freikaufen könnten?«
»Doch, aber wozu sollten sie das tun?« Er deutete ein Lächeln an. »Bei dem Namen.«
»Ich werde ein wenig nachdenken und mich über dich erkundigen. Beeil dich nicht allzu sehr mit dem Verhungern, hörst du?«
»Ich will gründlich zaudern.«
Als Demetrios sich zum Gehen wandte, fiel sein Blick auf das jenseitige Ufer. Er deutete auf die Gestalten, die dort rätselhafte Dinge mit Stangen, Pfosten und Brettern taten. »Was machen die da?«, sagte er.
Opiter Perperna hob die Schultern – eine ob seiner sonstigen Reglosigkeit beinahe ungestüme Bewegung. »Sie bereiten die Rennbahn vor.«
»Was für eine Rennbahn?«
»Kurz vor Sonnenuntergang wird dort ein Sänftenrennen ausgetragen. Meine Landsleute« – er blickte zum westlichen Ende der Bucht – »bestehen darauf, mitzumachen, damit die Araber zur Abwechslung über Römer lachen dürfen, statt weinen zu müssen.«
»Dass du nach Westen blickst, heißt vermutlich, dass alle hiesigen Römer dort wohnen, weit außerhalb der Stadt?«
»Wer möchte schon römische Krieger in der Stadt?«
»Krieger?«
»Du klingst erstaunt. Kennst du denn diesseits von Indien einen Ort ohne römische Krieger?«
Demetrios nickte. »Ich kenne einige, und ich war sicher, Adane gehöre dazu.«
Perperna stieß eine Art Glucksen aus. »Vertrauen ist gut, Aufsicht ist besser; am besten ist misstrauische Aufsicht nach vorheriger Zerstörung.«
Demetrios brach Richtung Landzunge auf; über die Schulter sagte er: »Deine Landsleute, nicht meine. Und wer hat etwas davon?«
Ravi stammte aus der großen Hafenstadt Muziris an der Westküste Indiens; er war vor dreißig Jahren in Adane an Land gegangen, um ein Gasthaus für Händler und Seeleute einzurichten. Die Wirte von Adane hatten dafür gesorgt, dass er sein Haus nicht am Hafen bauen durfte. Deshalb war er nun einer der reichsten Männer, denn er hatte nordwestlich vom Hafen und vom Krater, in dem der Kern der Stadt lag, eine Schenke unter den Palmen gebaut – dort, wo die Landzunge endete, über die Händler kamen und gingen. Sein Haus war das erste, das sie sahen; es war das für den Landhandel am besten zu erreichende, und neben Raum für Stallungen besaß Ravi dreierlei, das ihn über die anderen Schankwirte erhob: einen vorzüglichen Koch, der ebenfalls aus Indien stammte, die schönsten Mädchen aus allen möglichen Gegenden – und frisches Wasser.
Auf der Halbinsel Adane gab es Zisternen und drei nicht besonders ergiebige Quellen; ehe Ravi in einer Felskammer unter seinem Haus nach langem Hacken und Bohren auf Wasser stieß, hatte er täglich mehrere gefüllte Ziegenbälge von den Eselmännern des nördlichen Hinterlandes kaufen müssen.
Das eigentliche Gasthaus bestand aus einem unteren Geschoss, gemauert aus mit Mörtel verfugten Bruchsteinen; über der Balkendecke, die in zweifacher Mannshöhe den Schankraum abschloss, lagen die Schlafräume. Für die Mauern und Trennwände des zweiten Stocks hatte man Lehmziegel verwendet. Unten bildeten beschnitzte Tragbalken zwei Säulenreihen, zwischen denen man, wie ein weit gereister hispanischer Händler bei Demetrios’ letztem Aufenthalt gesagt hatte, der Entschlackung der Seele oblag; die Gelasse für Reinlichkeit und Entleerung lagen links dahinter, Küche und Vorratskammern rechts.
Prexaspes lehnte an einem Tragbalken. In einer Hand hielt er einen großen Tonbecher, mit der anderen machte er seltsame Bewegungen. Vor ihm stand eine junge Frau, eine von Ravis Schankdirnen. Sie mochte knapp zwanzig sein, trug eine Art kurzen Chiton aus hellem Leinen und um die Hüften eine blassrote Schärpe. Ihre Gesichtszüge erinnerten Demetrios eher an Darstellungen persischer Fürstinnen als an arabische Hetären.
»Sie ist von daheim«, sagte Prexaspes. »Fast, jedenfalls. Aus den Bergen östlich von Babylonien.«
Wieder verrenkte er die Finger der Rechten; die Frau lächelte und benutzte beide Hände, um zu antworten.
»Ist sie stumm?«
»Taubstumm, Herr. Und, wie sie sagt, sehr gelenkig. Zum Ausgleich.«
»Ich wusste nicht, dass du mit den Fingern reden kannst.«
Prexaspes hob die Schultern. »Man lernt so dies und das.«
In diesem Augenblick tauchte Ravi aus den Tiefen der hinteren Gemächer auf, stieß eine Reihe unverständlicher Laute aus und stürzte sich auf ihn.
»Tausend Jahre«, sagte er, als sie die Umarmung beendet hatten, »musste ich deinen Anblick entbehren. Ich dachte schon, du kämst nicht mehr, ehe ich dies Gewerbe aufgebe.«
Demetrios musterte das Gesicht des Inders. »Du bist älter geworden, wie wir alle«, sagte er. »Und hässlicher.«
»Wie wir alle.«
»Aber du siehst nicht so aus, als ob dir nach Scherzen zumute wäre. Was soll das heißen – ›ehe ich dies Gewerbe aufgebe‹?«
»Lass uns sitzen und trinken, ehe wir über ernste Dinge reden. Komm.«
Demetrios folgte ihm zum Schankverschlag. Im übrigen Raum standen kaum kniehohe Tische, umgeben von ledernen Sitzpolstern; neben dem Durchgang zur Küche gab es höhere Tische, Schemel und ein paar Scherenstühle für Gäste mit anderen Sitzgewohnheiten.
Ravi beugte sich über den Schankverschlag; als er zwei Krüge und zwei Tonbecher auf den Tisch gestellt hatte, blickte er in Demetrios’ Augen.
»Adane ist tot, mein Freund«, sagte er. »Lange und langsam gestorben, während wir gehofft hatten, es würde sich erholen.«
Demetrios schwieg ein paar Atemzüge lang. »Ich habe wohl bemerkt«, sagte er dann, »dass kaum Schiffe in der Bucht sind. Aber ich hatte angenommen, sie lägen im östlichen Hafen.«
»Eine Handvoll, vielleicht zwei Hände; mehr nicht.«
»Und die Karawanen aus dem Hinterland?«
»Was sollen sie hier?« Ravi breitete die Arme aus. »Waren holen, die keiner gebracht hat? Waren bringen, die keiner holen wird?«
Demetrios betrachtete das zerfurchte Gesicht des Mannes, den er schon so lange kannte.
»Zähl nicht die Jahre«, sagte Ravi, als ob er die Gedanken des Griechen gelesen hätte. »Jedenfalls nicht diese, unsere. Zähl die Jahre des Sterbens und sag mir, wohin ich gehen soll.«
»Dorthin, wo dein karma sich sammeln oder zerstreuen mag.« Demetrios lächelte. »Die Ägypter würden ka sagen oder ba. Aber das ist gleich. Fast.«
»Und wie nennst du es? Ihr?«
»Meinst du uns Griechen oder die Herren der Welt?«
»Haben die solche Gedanken?« Ravi schnaubte. »Und passende Wörter?«
»Anima«, sagte Demetrios. »Oder animus. Seit wann sind römische Krieger hier?«
»Seit nicht ganz einem Jahr.«
»Wozu?«
»Wozu wohl? Zur Aufsicht. Aber reden wir nicht von ihnen, sondern von uns.«
»Wohin zieht es dich?«
»Heim?« Ravi schüttelte den Kopf. »Ich bin zu lange fort. Wenn man das Leben als Wanderung zu einem Ziel betrachtet, sollte man nicht umkehren.«
»Kennst du das Ziel?«
»Dann hätte ich es erreicht und könnte umkehren.« Ravi verzog das Gesicht und langte nach dem Weinkrug.
Demetrios leerte seinen Becher und bedeckte ihn mit der Hand, als der Inder nachfüllen wollte.
»Noch nicht; ich brauche noch einen klaren Kopf. Später will ich dir gern helfen, den schwarzen Saft der Schwermut durch Wein zu verdünnen.«
»Geschäfte?« Ravi kniff die Augen zu Schlitzen. »Welche Geschäfte willst du in Adane noch machen? Es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt nicht einmal etwas zu verlieren.«
»Doch.« Demetrios verschränkte die Arme. »Das Leben.«
»Billige Ware. Wer würde den Verlust bemerken?«
»Jeder, der irgendetwas von dir will. Wie geht es dem alten Kharkhair?«
Ravi schob die Unterlippe vor. »Nicht, dass er mich je durch seinen Besuch ehrte; aber soviel ich weiß, leidet er wie alle anderen unter dem Niedergang.«
»Gut. Dann lassen sich vielleicht einträgliche Geschäfte mit ihm machen.«
»Noch einmal – welche Geschäfte willst du machen in dieser Stadt der lebenden Toten?«
Demetrios blickte zum Eingang, wo zwei Männer erschienen waren. Sie schauten in den Schankraum, tauschten Blicke miteinander und verschwanden wieder.
»Das ist einfach so. So ist das einfach. So einfach ist das.« Ravi hatte sich vorgebeugt, als wolle er aufstehen. Nun ließ er sich wieder zurücksinken. »Du und deine Leute, ihr seid die ersten Gäste seit fünf Tagen. Abgesehen von Nubo, der nicht zählt.«
»Der große Schwarze? Wieso zählt er nicht? Unangenehm?«
»Ein lieber Gast. Harmloser Narr. Aber er ist schon so lange hier, dass er fast zur Einrichtung gehört. Und außer ihm?« Ravi drehte die leere Handfläche nach oben.
»Ich höre es ungern, mein Freund. Aber zu den Geschäften. Du weißt, die Herren der Welt haben zuweilen seltsame Bedürfnisse.«
»Wie zum Beispiel die Zerstörung von Adane durch die Flotte vor – wie viel? Fünfundzwanzig Jahren?«
»Das war kein Bedürfnis, sondern Notwendigkeit.«
»Ha.« Ravi hieb auf den Tisch, dass Demetrios’ leerer Becher tanzte. »Notwendigkeit? Was war daran notwendig?«
Demetrios hob eine Braue. »Was hättest du anstelle von Augustus getan?«
»Hätte es denn nicht genügt, Adane zu besetzen?«
Demetrios zwinkerte. »Und jedes Jahr einen Aufstand niederschlagen zu müssen? Viel Geld für immer neue Truppen und immer neue Kriegsschiffe auszugeben?«
Ravi knurrte etwas Unverständliches.
»Ich weiß zu wenig. Ich weiß nicht einmal, wie viele Krieger sie da draußen am Westrand der Bucht haben.«
»Zwei Dutzend? Drei?« Ravi zuckte mit den Schultern.
»Ich nehme an«, sagte Demetrios, »sie unterstehen dem Präfekten von Ägypten und werden demnächst ausgetauscht. Wahrscheinlich besteht ihre Aufgabe darin, sich einfach blicken zu lassen. Wenn man weiß, dass sie da sind, vergisst man nicht, dass jederzeit Weitere kommen könnten.«
»Wer hat hier die Aufsicht?« Ravi grinste. »Meinst du das?«
»Das auch. Vor allem meine ich, die Fürsten, Priester und Handelsherren hier haben einen furchtbaren Fehler gemacht. Kein Verbrechen, sondern schlimmer: eine Dummheit. Sagen wir mal so.« Demetrios zögerte und suchte nach den richtigen Worten. »Sie haben den Fehler gemacht, den Handel nur sich selbst zuzugestehen. Sie durften als Einzige mit Gewürzen handeln. Mit Schiffen und Kamelen Weihrauch und Myrrhe, Zimt, Kassia, Pfeffer, Seide, edle Steine und all die anderen Dinge befördern. Davon haben vielleicht tausend Leute gelebt. Vielleicht mehr. Wenn sie fremde Händler beteiligt hätten, wäre hier einiges verloren gegangen, es wäre aber mehr dazugekommen. Fremde Händler, fremde Schiffe, fremde Karawanen, alle bringen neue Waren und neues Geld, alle brauchen Unterkunft, Essen, Futter, Wasser; hundert fremde Schiffe geben den Stauern und Zimmerleuten und Segelmachern und Tauschlägern viel mehr Arbeit als die fünfzig eigenen.«
»Schon recht. Aber es ist ein Vorrecht der Menschen, die Zukunft nicht zu bedenken und die Gegenwart mit Fehlern zu füllen.« Ravi seufzte leise.
»Lassen wir derlei Spitzfindigkeiten; sie führen zu nichts. Sprechen wir lieber über deine Wünsche und meine Absichten.«
»Deine Absichten? Bah. Du willst Geschäfte machen; du hast mir aber noch immer nicht gesagt, welcher Art die sein sollen.« Ravi fuhr sich mit dem Handrücken der Linken über die Nase. »Ihr seid – fünf, nicht wahr? Mit einem Schiff aus Berenike hergekommen. Wenn es dein Schiff wäre, hättest du das erwähnt, und dann hättet ihr nicht euer Gepäck hergeschleppt.« Mit dem Fuß stieß er an Demetrios’ Beutel, der neben einem Tischbein stand. Dann nickte er und pfiff leise durch die Zähne.
»Was pfeifst du?«
»Der Beutel ist schwer; er gibt nicht nach, wenn man ihn tritt.«
»Das unterscheidet Beutel von Menschen. Und?«
»Schwere Beutel bedeuten schwere Inhalte. Was wird darin sein? Ein Chiton aus Blei? Wohl kaum. Eher wohl Münzen. Viele Münzen.«
»Vollkommen wertlos.« Demetrios kniff ein Auge zu. »Bleidrachmen. Steindenare.«
»Du hast vermutlich nichts Kostbares zu verkaufen, sonst würdest du auf dem Schiff nächtigen. Du bist also mit einigen vertrauenswürdigen Männern unterwegs, um etwas zu kaufen. Was?«
»Wie ich schon sagte, haben die Herren der Welt …«
»… zu denen du gehörst …«
»… manchmal seltsame Wünsche. Übrigens gehöre ich nicht zu ihnen.«
»Der Nachdruck, mit dem du das sagst, beweist das Gegenteil.« Ravi deutete ein Lächeln an. »Wenn du nicht zu ihnen gehören willst, meinethalben; aber dann gehörst du ihnen. Wie die halbe Welt.«
Demetrios knurrte leise. »Da mein Vater mir das Bürgerrecht vererbt hat, wurde ich als römischer Bürger geboren. Wie ich mit meinen Augen und Fingern und Zehen geboren wurde. Ich kann es nicht ändern. Aber lassen wir dies Geplänkel.«
In einer Art Laufschritt betrat Nubo das Gasthaus. Er sang etwas, tanzte durch den Schankraum, warf den Balg an die Decke, klatschte in die Hände, fing den Balg wieder auf und pfiff.
»Etwas zu feiern?«, sagte Demetrios.
»Nein, nur so.« Nubo nickte, als hätte jemand etwas gesagt, was Zustimmung verdiente, und verschwand treppauf.
Ravi seufzte. »Ob die Einfalt der Narren größer ist als die Klugheit der Weisen? Aber kommen wir zurück zu den Römern. Welche seltsamen Wünsche haben sie, außer der Beherrschung der Welt?«
»Schwelgereien«, sagte Demetrios. »Üppige und minder üppige. Die edlen und reichen Männer, aber vor allem die unedlen Reichen ergeben sich dem Sammeln sinnloser Dinge, wenn sie nichts Wichtiges mehr zu erledigen haben.«
»Ah. Sinnloses? Zweckloses? Bloß Erbauliches?«
»Manchmal sogar bloß Unerbauliches. Ich kenne einen Mann, dessen Glück es ist, sich mit überwältigend hässlichen Dingen zu umgeben. Andere sammeln Schönes – Bildwerke, zum Beispiel, oder Schnitzereien. Steine, die zwar nicht edel oder kostbar sind, in denen sich aber seltsame alte Tiere verkrochen haben, um den Tod zu überleben. Gegenstände, die mit einer wahren oder erfundenen, aber jedenfalls fesselnden Geschichte verbunden sind.«
Ravi klatschte in die Hände. »Ich bin begeistert.«
»Wieso begeistert?«
»Es spricht für eine gewisse Verfeinerung der Gepflogenheiten, derlei zu tun. Vielleicht führt das mit der Zeit dazu, dass auch andere Gepflogenheiten ihre Grobschlächtigkeit verlieren.«
»Rechne lieber nicht damit.« Demetrios langte nach dem Wasserkrug und füllte seinen Becher. »Dass jemand in Rom Geld dafür ausgibt, seine Gäste mit dem größten jemals gebratenen Wildschwein zu verblüffen, heißt nicht, dass Rom davon absähe, alle Gegenden zu erobern, in denen essbare Wildschweine vorkommen.«
»Du willst aber nicht versuchen, deine Kunden damit zu verblüffen, dass du ihnen Wildschweine aus Adane lieferst, oder? Hier gibt es nämlich keine.«
»Es wäre ein wunderbarer Erfolg, ein Wildschwein aus einer Gegend zu liefern, in der es keine gibt. Dieses Unschwein wäre erheblich wertvoller als alle anderen Tiere.«
Ravi nickte. »Ich sehe dich schon in Rom auf einem Markt stehen und deine Waren anpreisen. ›Zwei Chimären, edle Herren, und wer beide kauft, kriegt als Dreingabe noch diesen entzückenden kleinen Phönix‹, ja?«
»Ich sehe, du begreifst, worauf ich hinauswill. Aber vergiss nicht, mir endlich zu sagen, was du tun willst.«
Der Inder schwieg eine Weile; schließlich sagte er, fast zögernd: »Willst du jetzt ernsthaft reden? Dazu ist es eigentlich noch zu früh. Ernsthafte Reden sollte man ins Gewand der Nacht hüllen, dass nicht grelles Licht ihre Lückenhaftigkeit entblöße.«
Demetrios beugte sich vor und legte eine Hand auf Ravis Arm. »Ich will später auf die andere Seite wandern und sehen, was es bei einem Sänftenträgerrennen zu sehen gibt. Es ist immer angenehm, etwas Neues zu betrachten. Dazu möchte ich geradeaus schauen können; deshalb jetzt keine üppigen Trinkereien. Die eigentlichen Geschäfte haben zu warten. Morgen hoffe ich, von Kharkhair und vielleicht ein paar anderen empfangen zu werden. Aber bevor ich gehe, sag mir endlich, was du tun willst.«
Ravi leerte abermals seinen Becher; diesmal füllte er nicht nach. »Es ist aus, Freund«, sagte er mit beinahe tonloser Stimme. »Die alten Händlersippen werden vielleicht noch ein Weilchen überleben; einige von ihnen haben ja Geschäfte, Lager und Leute in Kane und Mariaba. Alle anderen werden sterben, es sei denn, sie begnügten sich mit Fischfang oder dem Sammeln von Harzen. Kein Platz mehr für alte Inder.«
»Was willst du machen?«
»Ich weiß es nicht. Nicht so recht. Ich habe ein wenig Geld, aus den guten Zeiten. Brauchst du vielleicht jemanden, der dich auf deinen Reisen begleitet?«
Ein Spiel in der Wüste
Eine glaubwürdige Unmöglichkeit ist einer unglaubwürdigen Möglichkeit immer vorzuziehen.
Aristoteles
Mehr als sichtbare gilt unsichtbare Harmonie.
Herakleitos
Von Kaphar Nahum war er nach Nordosten geritten. Er hatte den Jordan überquert, die Golan-Höhen, und von Sonnenuntergang bis kurz nach Mitternacht gerastet. Vom Rastplatz, einem kaum ergiebigen Brunnen unweit eines namenlosen Dorfs, führte der Weg zwischen Kies- und Steinrücken (später Dünen) nach Südosten.
Gegen Mittag hatte er den vereinbarten Treffpunkt erreicht: ein Tal im Niemandsland. Die Kartografen mochten das anders sehen und diese Gegend den Nabatäern im Süden zuschlagen oder dem Reich des Tetrarchen Philippos, wie die übrigen Gebiete westlich der alten Handelsstraße von Tadmor nach Petra. Zweifellos gab es in Rom kluge Männer, die das Land »Auranitis« oder »Hauran« nannten. Aber es gehörte nur sich selbst: Wind und Sand, darüber glühende Sonne und eisige Sterne, darin arabische Nomaden. Ein paar Städte gab es auch, aber sie waren kaum mehr als Namen für ein Rudel Hütten: Kanatha, Astharoth …
Es gehörte zu seinen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass es ein Niemandsland blieb; dafür war er so weit geritten. Dafür, dass es weiter den Nomaden gehörte, ein paar Löwen und vielen Skorpionen. Er gönnte es ihnen, dieses Land; wie er auch Kaphar Nahum den dortigen Bewohnern gönnte, ob sie nun dem König anhingen oder den Schriftgelehrten oder diesem neuen Prediger, der eine Vorliebe für Gleichnisse und Fische hatte.
Der Gedanke an Fische und Wasser ließ ihn das steinige Tal noch karger empfinden. Er nahm den Lederhut ab, füllte ihn aus dem Schlauch und ließ die Pferde trinken. Zwei Pferde; es war sinnvoll, sich vorzusehen. Ein Reittier mochte sich in der Einöde ein Bein brechen; was würde dann aus dem Reiter? Er setzte sich in den Schatten, trank selbst ein paar Schlucke und sah zu, wie die Pferde versuchten, staubige Blätter von einem Krüppelgesträuch zu rupfen.
Er schloss die Augen, um ein wenig zu dösen – mit geschärften Sinnen, die jeden fernen Hufschlag, das Scharren eines Skorpions oder das Kratzen einer Kralle sofort bemerken würden. Seine Gedanken ritten den Weg zurück, zu den Fischen, den Fischern, den Handwerkern. Den Nachbarn in Kaphar Nahum – Nachbarn, seit er nicht mehr in der Festung lebte, sondern in einem Haus am Ortsrand, wie es einem Centurio der Söldnertruppe des Herodes Antipas zustand.
Centurio … Er schnaubte leise. Tertius Agabianus Afer, Centurio im Dienst eines jüdischen Königs. Vor vier Jahren hatten sie ihn bei den Hilfstruppen in Mauretanien angesprochen; allerdings wusste er noch immer nicht, ob »sie« Männer des Augustus Tiberius gewesen waren oder Leute des allmächtigen Sejanus, Präfekt der Prätorianer. Es hatte auch keine Bedeutung; wichtig war nur, dass sie ihm diese Möglichkeit anboten: sieben Jahre bei den Söldnern eines jüdischen Fürsten, mit gewissen Nebenaufgaben, danach das Bürgerrecht und Übernahme in eine besondere Einheit. Vielleicht in Rom, vielleicht in der Provinz.
Immer, wenn er in Gedanken an diese Stelle gelangte, verfluchte er seinen Vater, der gestorben war, ohne das Ziel zu erreichen. Er hätte als Pferdezüchter punischer Herkunft mit Namen Abdsapon in Agbia bleiben und dem Sohn ein blühendes Gestüt hinterlassen sollen, oder als Saponius Agbianus Afer wichtige Dinge für das Imperium tun und Häuser, Reichtum, das Bürgerrecht erwerben können. Der Vater hatte das eine aufgegeben und das andere nicht erreicht; nicht einmal der »Tertius« war echt – drittes Kind, ja, aber einziger Sohn. Keine Aussichten, im Reich etwas zu werden, außer auf Umwegen. Zu den Umwegen gehörte das eingeschobene A im Namen, damit nicht jeder sofort auf ein entlegenes Nest in der Africa Proconsularis kam.
Und dieser andere Umweg nach Galiläa.
Seine Nachbarn hielten ihn für etwas einfältig – welcher Römer ginge denn freiwillig zu den Söldnern des Herodes Antipas? Er wusste, was man von ihm hielt, und es störte ihn nicht. Vielleicht war es besser so, vielleicht war es ihm sogar lieb.
Wie der König, wie die Vorgesetzten durften die wichtigen Leute des Orts nichts von seiner eigentlichen Aufgabe wissen; aber schon seine offenkundige Tätigkeit war ihnen verhasst. Unter den unwichtigen Leuten hatte er ein paar Bekannte. Freundschaft konnte es nicht geben. Nicht zwischen einem heidnischen Centurio und jüdischen Städtern oder Bauern. Oder Fischern. Oder Handwerkern.
Er und die anderen Söldner dienten dem König, aber man betrachtete sie als Besatzer. Sie hatten Gesetz und Ordnung zu hüten, die Zöllner und Steuereinnehmer (Juden, Diener eines jüdischen Königs, der »Freund« des Kaisers war) zu beschützen, manchmal Straßen zu bauen, immer Straßen zu sichern, Räuber zu bekämpfen, die Grenze zum Reich des Philippos zu bewachen … lauter abscheuliche Dinge. Verhasste fremdsprachige Besatzer in einem Land, dessen Bewohner Aramäisch sprachen – die alte Verwaltungssprache der persischen Besatzer – und meist auch ganz geläufig Griechisch – Sprache der Truppen Alexanders, dann der Seleukiden, Besatzer nach den Persern. Hin und wieder ließen sie halb vergessene Brocken ihrer eigenen Sprache einfließen, aber das Hebräisch der alten Schriften war eigentlich keine Sprache mehr, nur ein ritueller Rest; auch die Schriftgelehrten äußerten ihre verwickelten Gedanken auf Aramäisch.
Jedenfalls die meisten. Es gab Eiferer, Erneuerer des Alten, die alte Gesetze und alte Gebräuche wieder einführen und mit der Macht des jüdischen Stammesgottes und seiner Worte alle Besatzer verjagen wollten: die Römer aus Judäa, die Söldner aus Galiläa. Sie waren nicht zahlreich; aber auch jene, die dies nicht wollten, weil sie wussten, dass Auslegungen der Äußerungen des Stammesgottes unverständlich und ohnmächtig wären in einer unverstandenen Sprache – auch diese Vernünftigen waren Teil des Erwählten Volkes und durften sich nicht durch engen Umgang mit anderen besudeln.
Der Schriftgelehrte, den er vor Räubern gerettet hatte, durfte weder mit dankendem Druck die Hand um seinen Unterarm legen noch Afers Haus betreten, noch ihn in seinem Haus empfangen. Er hatte ihm und seinen Leuten ein Festmahl ausrichten lassen – im Garten, mit besonderen Speisen und Getränken in besonderen Gefäßen, die nach dem Fest nicht gesäubert, sondern zertrümmert wurden.
Es gab andere Menschen, die gewöhnlichen Juden, die nicht viel von den strengen Vorschriften hielten. Sie betraten sein Haus oder die Festung, wenn es sein musste, duldeten ihn und seinen Atem in ihren Häusern. Gewöhnliche Menschen, arbeitsam und ohne Dünkel; er mochte sie, weil sie aus dem gleichen Stoff waren wie er, seine Träume und seine Befürchtungen. Aber natürlich war er auch für sie ein fremder Büttel.
Afer blinzelte ins grelle Mittagslicht. Ein Pferd hob den Kopf und schnaubte leise. Hufschlag näherte sich, wurde lauter, ein paar Steine kullerten; dann bog der Reiter um den Felsvorsprung.
Der Centurio nahm die Hand vom Schwertgriff und stand auf. »War dein Weg leicht?« Er sagte es auf Aramäisch.
Der Araber glitt von seinem dunklen Hengst. »Du ehrst mich – du bist selbst gekommen!« Er lächelte, führte die Hand an Stirn, Mund und Brust und setzte hinzu: »Ich dachte, ich müsste einem deiner Männer schwierige Dinge auseinandersetzen.«
»Hoffentlich nicht zu schwierig für mich.«
»Wir werden sehen.«
Der Araber tränkte sein Pferd, band dessen Vorderbeine zusammen und ließ sich im Schatten nieder.
Afer wartete geduldig, bis der Mann getrunken und getrocknete Datteln und ein Stück Brot gegessen hatte. Dann sagte er: »Sprich, Numan. Wie stehen die Dinge in Ao Hidis?«
»Gut für jene, denen die alte Lage der Dinge missfällt; und schlecht für die Verweser des Herkömmlichen.« Der Araber entblößte in einem breiten Lächeln seine Zähne.
»Das heißt, alles geht wie erhofft.«
»Wenn dies deine Hoffnung war.«
Afer seufzte. »Spiel keine dummen Spiele mit mir, Freund. Unser Bewerber macht sich also gut?«
»Besser als erwartet.«
»Und die übrigen Männer?«
»Werden ihm wohl folgen. Wenn es so weit ist. In zwei oder drei Monden – sagen wir, kurz nach dem Frühjahrsfest.«
Der Centurio nickte. »Dann ist es gut. Aber berichte ein wenig mehr.«