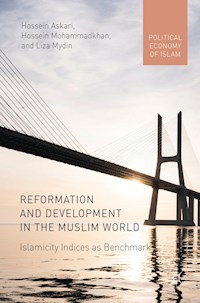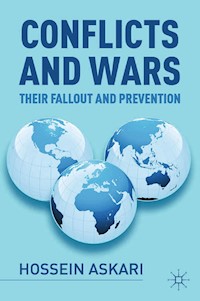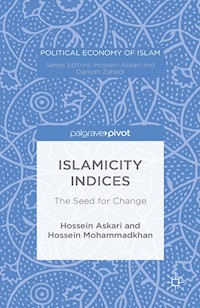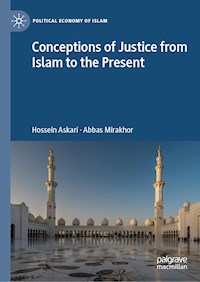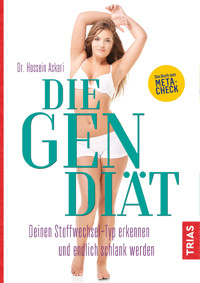
19,99 €
Mehr erfahren.
Jeder Mensch ist einzigartig: Ihre DNA. Ihre Diät. Kennen Sie das: Ihre Freundin ist trotz täglichem Kuchenstück rank und schlank, während Sie trotz magerer Diätkost nicht abnehmen? Wie ungerecht - oder doch nicht? Denn die Erklärung ist so verblüffend neu wie einfach: Ihre Gene bestimmen Ihren ganz individuellen Stoffwechseltyp und legen damit fest, wie Sie Lebensmittel verarbeiten und welche Ernährungsform für Sie die richtige ist. Denn was Ihrer Freundin zur Bikinifigur verhilft, macht Sie lange noch nicht schlank. - Die neue wissenschaftliche Entwicklung: Im Meta-Check werden ihre Gene analysiert. Das Ergebnis: Ihr individueller Meta-Typ, der Ihnen sagt, wie ihre ideale Ernährung aussehen sollte - die endlich zum dauerhaften Abnehmerfolg führt. - Alles zur neuen Methode Meta-Check: Was sich dahinter verbirgt, wie sie wirkt. - Essen Sie sich schlank: Die optimale Ernährung für jeden der 4 Meta-Typen. - Bewegung, die zu Ihnen passt: Welcher Sport wem wirklich hilft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die Gen-Diät
Ihren Stoffwechsel-Typ erkennen und endlich schlank werden
Hossein Askari
1. Auflage 2018
50 Abbildungen
Danksagung
Die Entwicklung und Verbreitung des MetaChecks wäre ohne die Mitarbeit vieler begeisterter Menschen nicht möglich gewesen. Heute ist der MetaCheck in mehreren Tausend Arztpraxen, Apotheken, Ernährungsberatungsstellen und Fitness-Studios in Deutschland verfügbar. Ich danke allen beteiligten Personen und insbesondere meinen tollen Kolleginnen und Kollegen vom CoGAP-Team ganz herzlich.
Zu diesem Buch
Wenn es für jeden Menschen so einfach wäre, sein Wunschgewicht zu erreichen, wie die ganzen Diäten behaupten, hätten Sie dieses Buch nicht in der Hand. Es gibt jede Menge Ernährungskonzepte, die alle für sich in Anspruch nehmen, super einfach beim Abnehmen zu helfen. Auffällig ist, dass jede Diät alle Menschen schlank machen will. Bei der einen darf man kaum Fett, bei der anderen dagegen jede Menge Fett essen. Genauso gibt es Diäten, die Proteine (Eiweiß) oder Kohlenhydrate verteufeln oder hochjubeln. Das macht stutzig. Da kann doch irgendetwas nicht stimmen!
Und da stimmt auch was nicht. Jede dieser Diäten, die besonders auf einen der Hauptenergieträger – Fett, Eiweiß oder Kohlenhydrate – setzt, kann tatsächlich beachtliche Abnehmerfolge bei einigen Menschen, die dann werbewirksam in Szene gesetzt werden, vorweisen. Aber keine dieser einseitigen Diäten funktioniert bei allen Menschen! Gesund und nachhaltig sind sie auch nicht: Wenn man Jahre später schaut, ist von den Anfangserfolgen meist nichts mehr zu sehen.
Es sind tatsächlich die drei Makronährstoffe, deren Anpassung beim Abnehmen helfen kann. Aber wem was hilft, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das erklärt, warum einige jeweils mit LowCarb oder HighCarb, LowFat oder HighFat usw. abnehmen können und andere nicht. Aber woher weiß ich, wie ich meine Pfunde endlich loswerde? Die Antwort darauf ist so simpel wie genial. Sie liegt in unseren Genen!
Unsere Gene bestimmen, welche Ernährung uns dick macht und welche nicht. Sie weisen den Weg zu einer individuell angepassten Diät, die uns tatsächlich dabei hilft, das Wunschgewicht zu erreichen und es dann auch langfristig zu behalten: die Gen-Diät MetaCheck. Bei diesem Ernährungskonzept werden die relevanten Stoffwechselgene mit der MetaCheck-Analyse bestimmt. Hierfür genügt ein Abstrich der Wangenschleimhaut. Die Analyse ergibt einen bestimmten Stoffwechseltyp – den Meta-Typ. Kennen Sie Ihren Meta-Typ, verschwinden alle Gewichtsfragezeichen im Diäten-Dschungel und die Türen für eine Ernährung, mit der Sie gesund und nachhaltig abnehmen, stehen Ihnen offen. Alles, was Sie dafür wissen müssen, lesen Sie in diesem Buch.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine spannende Lektüre!
Dr. Hossein Askari Köln im Herbst 2017
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Zu diesem Buch
Teil I Endlich abnehmen!
1 Wenn das Gewicht zur Last wird
1.1 Viele Diäten versprechen schnelle Erfolge
1.2 Warum Fasten nicht beim Abnehmen hilft
1.3 Ernährung ist zu einer Glaubensfrage geworden
1.3.1 Vegane Ernährung
1.3.2 Steinzeit-Diät oder Paleo-Ernährung
1.4 Bin ich zu dick?
1.5 Was besagt der BMI?
1.6 Wie hoch ist der Anteil an Körperfett?
1.6.1 Körperfett bestimmen
1.6.2 Das Taillen-Hüft-Verhältnis
1.7 Wie entsteht Übergewicht?
1.8 Warum Sport allein nicht ausreicht
1.9 Die Anti-Gewichtsverlust-Mechanismen
1.9.1 Hungerzeiten drosseln den Grundumsatz
1.9.2 Erhöhte Anzahl an Fettzellen
1.9.3 Hormonelle Strategien der Fettzellen
1.10 Wie schädlich ist Übergewicht?
1.11 Durch Übergewicht sinkt die Lebenserwartung enorm
1.12 Übergewicht ist mit mindestens 13 Krebsarten verknüpft
2 Sind die Gene schuld?
2.1 Wie haben sich unsere Vorfahren ernährt?
2.2 Es gab auch vegetarische Neandertaler
2.3 Vom Jäger und Sammler zum Ackerbauer
2.4 Wie die unterschiedlichen Meta-Typen entstanden sind
2.4.1 Die Gene bestimmen den Meta-Typ
2.5 Studie belegt: allgemeine Diät-Empfehlungen sind sinnlos
2.6 Die Gene verraten, wie Sie am leichtesten abnehmen
2.7 Die Entwicklung der Gen-Diät MetaCheck
2.8 Das Geheimnis der Meta-Typen
2.8.1 Es gibt vier Meta-Typen
Teil II Jetzt will ich es wissen!
3 Der MetaCheck stellt sich vor
3.1 Das menschliche Erbgut ist entschlüsselt
3.1.1 Personalisierte Medizin
3.2 Was untersucht der MetaCheck?
3.2.1 Die Bestimmung der Meta-Typen
3.3 Beim MetaCheck werden Stoffwechselgene analysiert
3.3.1 ApoA2
3.3.2 FABP2
3.3.3 FTO
3.3.4 ADRB2
3.3.5 ADRB3
3.3.6 PPARγ
3.3.7 IL-6
3.4 Das Gewichtskontrollsystem
3.5 Es gibt zwei Sport-Typen
4 Der MetaCheck in der Praxis
4.1 Wo gibt es den MetaCheck?
4.2 Wie läuft der MetaCheck ab?
4.2.1 Abstrichprobe
4.2.2 Was passiert mit der Probe?
4.2.3 MetaCheck-Analyse und Ergebnis
4.3 Es gibt 4 Meta-Typen und 2 Sportvarianten
4.4 Alpha: der Protein-Typ
4.5 Beta: der Protein+Fett-Typ
4.6 Gamma: der Kohlenhydrat-Typ
4.7 Delta: der Kohlenhydrat+Fett-Typ
4.8 Sport-Typen: Ausdauer oder Schnellkraft?
4.9 Ausdauervariante: Typ E (Endurance)
4.10 Schnellkraftvariante: Typ S (Speed)
4.11 Schonender Einstieg in den Sport
Teil III Meta-Typ-gerechte Ernährung
5 Effektiv und nachhaltig abnehmen
5.1 Ausgewogen ernähren
5.2 Wie viel wollen Sie abnehmen?
5.3 Wie hoch ist Ihr Energiebedarf?
5.3.1 Grundumsatz
5.3.2 Leistungsumsatz
5.4 Die ersten 4 Wochen
5.5 Der MetaCheck-Genussplan
5.6 Das CoGAP-Ernährungsportal
5.7 Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten
5.8 Denken Sie auch an die Bewegung
6 So nimmt der Alpha-Typ leicht ab
6.1 Das 4-Wochen-Start-Programm
6.2 Lebensmittelauswahl für den Alpha-Typ
6.3 Wie wird der Bedarf bestimmt?
6.3.1 Beispielberechnung
6.4 Kohlenhydrate sind Ihre »Dickmacher«
6.5 Proteine sind Ihre Schlankmacher
6.6 Beim Alpha-Typ setzt Fett schnell an
6.7 Reichlich Ballaststoffe aufnehmen
6.8 So hält der Alpha-Typ sein erreichtes Gewicht
6.9 Alpha-Typ: Abnehmen und schlank bleiben
6.9.1 Während der Abnehmphase
6.9.2 Langfristige Ernährung, um das Gewicht zu halten
7 Geeignete Diät-Arten für den Beta-Typ
7.1 Das 4-Wochen-Start-Programm
7.2 Den Anteil der Makronährstoffe bestimmen
7.3 Vorsicht bei Kohlenhydraten
7.3.1 Gemüse und Hülsenfrüchte
7.4 Proteine sind Ihr »Treibstoff«
7.4.1 Geeignete proteinreiche Nahrungsmittel für den Beta-Typ
7.5 Der Beta-Typ hat mit Fetten kein Problem
7.6 Die langfristige Ernährung des Beta-Typs
7.7 Beta-Typ: Abnehmen und schlank bleiben
7.7.1 Während der Abnehmphase
7.7.2 Langfristige Ernährung, um das Gewicht zu halten
8 Gewichtsreduktion beim Gamma-Typ
8.1 Die Verteilung der Makronährstoffe nachvollziehen
8.2 Her mit den Kohlenhydraten!
8.3 Obacht bei den Fleisch- und Fischportionen
8.4 Achten Sie auch auf die Fettmenge
8.5 Das Gewicht halten
8.6 Gamma-Typ: Abnehmen und schlank bleiben
8.6.1 Während der Abnehmphase
8.6.2 Langfristige Ernährung, um das Gewicht zu halten
9 Einfaches Abnehmen beim Delta-Typ
9.1 Ein detailliertes Beispiel
9.1.1 Brot, Nudeln oder Kartoffeln verbrennen Sie im Nu
9.1.2 Sie sind kein »Steak-Typ« ...
9.1.3 ... sondern ein »Pasta-Typ«
9.1.4 Langfristig schlank bleiben
9.1.5 Delta-Typ: Abnehmen und schlank bleiben
9.1.6 So essen die vier Meta-Typen – einige Rezeptbeispiele
Teil IV Rezepte für die vier Meta-Typen
10 Frühstück
11 Mittagessen
12 Abendessen
13 Literatur
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
Holger Münch, Stuttgart |
Teil I Endlich abnehmen!
1 Wenn das Gewicht zur Last wird
2 Sind die Gene schuld?
Jeder Zweite kämpft mit Gewichtsproblemen. Sie sind also in guter Gesellschaft. Lassen Sie uns schauen, woran das liegt und welche Wege aus der Gewichtsfalle herausführen.
1 Wenn das Gewicht zur Last wird
Warum kämpfen so viele Menschen mit Übergewicht? Weshalb funktionieren Diäten häufig nicht? Wie schädlich ist Übergewicht? Wann ist man zu dick? Gewichtige Fragen ...
Eine Freundin schwärmt Ihnen von einer tollen Diät vor, mit der sie spielend abgenommen hat. Es ist tatsächlich unverkennbar, dass sie wesentlich schlanker geworden ist. Und weil sie sich gleich neue Klamotten gekauft hat, »die alten waren mir ja viel zu weit!«, sieht sie jetzt beneidenswert gut aus. Die Diät muss also funktionieren, Ihre Freundin ist der lebende Beweis – sie ist schlank geworden und auch geblieben. Deshalb wagen Sie auch noch einmal einen Versuch, obwohl Sie schon einiges unternommen haben und Ihr Gewicht langfristig dabei immer mehr nach oben als noch unten gegangen ist.
Sie probieren die »Wunder-Diät« Ihrer Freundin, haben sich ein entsprechendes Buch gekauft, alles genau so, wie es beschrieben wurde, durchgezogen, waren diszipliniert und haben sich keine Ausrutscher erlaubt – und dennoch blieb der durchschlagende Abnehmerfolg aus. Es fühlte sich nicht so an, als ob die Pfunde mühelos purzeln, sondern eher wie ein zähes Ringen. Sie sind frustriert und enttäuscht. Warum hat es nicht funktioniert? Lag es am Konzept, schließlich durfte man sich immer satt essen? Aber bei Ihrer Freundin hat es doch geklappt! Lag es an Ihnen? Können Sie vielleicht einfach nicht abnehmen und müssen sich Ihrem Schicksal fügen?
Mit diesen Fragen stehen Sie nicht allein da. Sehr viele Menschen versuchen vergeblich, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen; und im Endeffekt nehmen sie mit jedem neuen Diätversuch eher noch mehr zu. Und weil das ein riesengroßes Problem ist, gibt es auch jede Menge Diät-Programme.
1.1 Viele Diäten versprechen schnelle Erfolge
Diese arbeiten mit extremer Kalorienreduktion und/oder sehr einseitiger Ernährung; meist nimmt man in der Diät-Zeit, die einem mehr oder minder harte Einschränkungen auferlegt, tatsächlich ab. Doch die Erfolge bleiben einem nicht lange erhalten. Sobald das Alltagsleben und damit das normale Ess- und Trinkverhalten zurückkehrt, klettert auch die Anzeige der Waage wieder nach oben. Die mühsam errungenen Gewichtsverluste sind im Handumdrehen dahin. Hoppla hopp heften sich die überflüssigen Pfunde wieder an ihren ursprünglichen Platz und bringen gleich noch ein paar Freunde mit. Und obwohl dieser Jo-Jo-Effekt allseits bekannt ist, nimmt die Vielfalt an Diäten nicht ab. Täglich beginnen unzählige Menschen eine Diät, um je nach persönlicher Willensstärke nach zwei, drei oder weiteren Wochen wieder in die alten Muster zurückzufallen.
Die Basis jeder Diät ist natürlich, weniger Nahrungsenergie zuzuführen als man braucht, um den Körper zu zwingen, seine im Fettgewebe gespeicherten Energiereserven anzuknabbern. Dies wird als negative Energiebilanz bezeichnet. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, unterscheidet sich allerdings von Diät zu Diät stark.
1.2 Warum Fasten nicht beim Abnehmen hilft
Am extremsten ist das Fasten; hierbei wird für eine Weile gar keine feste Nahrung mehr gegessen. Der Körper schaltet nach einer gewissen Anpassungszeit tatsächlich auf die Verwertung der gespeicherten Fette um und ernährt sich von seinen Reserven. Diese Stoffwechselumstellung auf den Fasten-Modus funktioniert prinzipiell bei jedem Menschen; es ist unser biologisches Erbe, dass wir mit Hungerzeiten – die in der Menschheitsgeschichte sehr häufig auftraten – zurechtkommen. Früher gab es auch noch nicht an jeder Ecke einen Supermarkt. Hat sich die Umstellung auf den Fasten-Modus vollzogen, hat man sogar auch keinen Hunger mehr. Prima, könnte man jetzt denken, dann faste ich einfach so lange, bis ich mein Idealgewicht habe, und dann esse ich wieder.
Wie Sie sich sicher schon gedacht haben, hat die Sache aber mehr als einen Haken. Das erste Problem: Ihr Stoffwechsel ist durch das Fasten in den Spar-Modus gegangen; will sagen, Ihr Körper kommt jetzt mit wesentlich weniger Nahrungsenergie aus als vorher. Wie ein Eichhörnchen, das Nüsse für den Winter sammelt, wird Ihr Körper jetzt jede Kalorie horten – also im Fettgewebe speichern. Für Menschen, die gut und gern essen, ist Fasten daher absolut ungeeignet zur Gewichtsreduktion. Das zweite Problem beim Fasten ist, dass die erforderliche Ernährungsumstellung – von viel zu reichlichen Mahlzeiten auf eher bescheidene Portionen – nicht eingeübt wird. Beim Fasten essen Sie gar nicht, die Gefahr, danach über kurz oder lang wieder richtig zuzuschlagen, ist extrem groß.
Bei Diäten, die mit extremer Kalorienrestriktion arbeiten, indem man beispielsweise nur ein Viertel der Energie, die man täglich verbraucht, über die Nahrung zu sich nimmt, ist der Abnehmerfolg während der Diät meist auch beachtlich. Es tritt jedoch danach häufig ein ähnlicher Effekt wie nach dem Fasten ein: Das Körpergewicht schnellt nach oben, wenn man nicht bei der kargen Kost bleibt. Das auf Dauer zu halten, ist unmöglich, und gesund ist es auch nicht.
1.3 Ernährung ist zu einer Glaubensfrage geworden
Doch auch wenn man gerade keine Diät macht, sondern sich »nur« gesund ernähren will, ist das Angebot an Ernährungsweisen ähnlich unübersichtlich wie der Diät-Dschungel. Die richtige Ernährung ist längst nicht mehr nur die Domäne weniger Diätassistenten oder Ernährungsberater, sondern eine Frage, die breit und auch sehr kontrovers in sämtlichen Medien dargestellt und diskutiert wird. Schauen wir uns einige der Trends einmal an.
1.3.1 Vegane Ernährung
Sich vegan zu ernähren, bedeutet zunächst einmal nur, keinerlei tierische Produkte zu verwenden, also sowohl auf Fleisch, Wurstwaren, alle Fischprodukte und auf Eier zu verzichten. Aber auch alles, was aus Milch hergestellt wird, ist tabu, sprich: Käse, Jogurt, Sahne, Quark usw. Weil die Milch eben auch ein tierisches Produkt der Kuh, der Ziege oder des Schafes ist. Viele Veganer verzichten auf diese Lebensmittel, weil sie keine Tiere essen und die Massentierhaltung nicht unterstützen wollen. Zur Eiweißversorgung dienen pflanzliche Quellen wie Sojabohnen und andere Hülsenfrüchte. Die Lebensmittelindustrie hat auf diesen Trend reagiert, indem sie jede Menge Fleisch- und Wurstersatzprodukte kreiert hat. Als Veganer kann man also statt Schweinschnitzel, Tofu- oder Seitanschnitzel essen. Um die Frage, ob vegane Ernährung besser oder gesünder ist, wird heftig gestritten. Zucker- und fetthaltiges Fast-Food ist jedenfalls auch vegan möglich. Vertreter einer vollwertigen, veganen Küche behaupten, damit würde man wie von selbst abnehmen und auch diverse Erkrankungen wie Rheuma oder Gicht erfolgreich behandeln können.
1.3.2 Steinzeit-Diät oder Paleo-Ernährung
Jede Menge Fleisch, Fisch und Eier kommen bei Menschen auf den Tisch, die sich wie unsere Vorfahren ernähren wollen. ▶ Steinzeit- oder Paleo-Ernährung heißt der Trend, der das Frischkornmüsli und das Dinkelvollkornbrot der veganen Vollwertkost verpönt. Das sei grundfalsch, so Paleo-Experten, der Mensch sei nicht zum Getreideverzehr gemacht. Als Pflanzenkost werden nur Gemüse, Salate, etwas Obst und Nüsse akzeptiert, also nur die Nahrungsmittel, die es auch schon gab, als unsere Vorfahren mit Fell um die Hüfte durch Wald und Wiese streiften. Die große Palette der Getreideerzeugnisse – angefangen von Brot, Toast, Brötchen über Kuchen, Torten und Kekse – kommen bei der Steinzeit-Ernährung nicht auf den Teller. Auch alles, was aus Milch hergestellt wird, ist bei dieser Ernährungsform ein No-Go. Grund: In der Steinzeit gab es keine Milchviehhaltung und Milchprodukte seien für den Menschen unverträglich. Die vielen Betroffenen mit Laktoseintoleranz sprächen eine deutliche Sprache. Interessant ist, dass auch die Steinzeit-Ernährung – bei der in weiten Teilen genau das gegessen wird, was bei Veganern verboten ist – für sich in Anspruch nimmt, entzündliche Erkrankungen zu bekämpfen und für eine schlanke Linie zu sorgen.
Weitere Ernährungstrends sind:
Clean Eating: Hierbei kommen nur frische und unverarbeitete Lebensmittel, die selbst zubereitet werden, in den Topf. Alle industriellen Nahrungsmittel – ein Großteil dessen, was es im Supermarkt zu kaufen gibt – und Fast-Food jeglicher Couleur sind für Clean Eater ungeeignet.
Instant-Food: Natürlich gibt es auf den Gegentrend zum Clean Eating: Die Ernährung aus der Tüte, bei der man sich morgens, mittags und abends nur ein Pulver mit Wasser anrühren muss. Der Fix-und-fertig-Drink enthält alle Nährstoffe, die der menschliche Körper braucht, so heißt es – was soll man sich da lange mit Gemüseschnippeln und -kochen aufhalten, wenn es doch auch viel einfacher geht.
Intervall-Fasten: In Zeiten des Nahrungsüberflusses und -überangebots von Snacks und Fast-Food an jeder Ecke seien bewusste Zeiten der Nahrungskarenz wichtiger denn je, lautet das Postulat für Intervall-Fasten. Dahinter verbergen sich unterschiedliche Ansätze, denen allen gemein ist, dass man regelmäßig einzelne Mahlzeiten (z. B. Dinner-Cancelling) ausfallen lässt oder auch tageweise fastet (z. B. einmal pro Woche).
Alle vorgestellten Ernährungskonzepte behaupten, gesund zu sein und Übergewicht zu vermeiden. Da stellt sich dann die berechtigte Frage, warum es so viele Übergewichtige gibt. Und – was ist überhaupt Übergewicht? Wer bestimmt, ob und wann ich zu dick bin?
Warum Diäten langfristig oft nichts bringen
Das Problem, dass einige Menschen trotz Diät-Plänen von Experten auf lange Sicht kaum an Gewicht verlieren, wurde sogar wissenschaftlich untersucht. Die Studie von Shai und Kollegen testete mehrere Diätarten über einen Zeitraum von zwei Jahren. In der Anfangsphase war bei allen Diätarten ein Gewichtsverlust zu erkennen. Mit der Zeit stieg das Gewicht aller Probanden jedoch wieder und näherte sich erneut dem Ursprungsgewicht an. Insgesamt konnten die Studienteilnehmer, unabhängig von der Diätart, ihr Gewicht lediglich um 2–4 kg in zwei Jahren reduzieren.
Im Anschluss wollten die Forscher herausfinden, wie lange die Probanden ihr neues Gewicht halten konnten. Dazu wurden die Studienteilnehmer nach weiteren vier Jahren erneut untersucht. Es zeigte sich, dass nach insgesamt sechs Jahren Diät nur noch ein sehr geringer Gewichtsverlust von 0,5–3 kg bei den Probanden erkennbar war. Je länger also die Diät untersucht wurde, umso geringer war der Abnehmerfolg.
1.4 Bin ich zu dick?
Die Vorstellung darüber, wie füllig oder schlank ein Mensch sein sollte, um dem Ideal zu entsprechen, hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder gewandelt. Auch in der heutigen Zeit ist es längst nicht so, dass in allen Gesellschaften und Kulturen »super-schlank« als gängiges Schönheitsideal gilt, auch wenn es sich in den westlichen Industrienationen so anfühlt, als ob Modelmaße als unbedingt erstrebenswert anerkannt wären. Eklatant ist auch der Unterschied zwischen dem vermeintlichen Idealgewicht und dem tatsächlichen Körpergewicht der Bevölkerungsmehrheit. Wenn man Laufstegschönheiten als Maß aller Dinge sieht, sind fast alle »normalen« Menschen zu dick. Tatsächlich fühlen sich auch – vor allem Frauen – häufig zu dick, obwohl sie aus medizinischer Sicht eigentlich normalgewichtig sind. Auf der anderen Seite gibt es auch den Trend, dass Menschen, bei denen die Waage fast verzweifelt, sich dennoch als »fröhliche Dicke« definieren, die nun einmal gern essen und/oder eben genetisch bedingt einfach schnell ansetzen. Ernsthaft abzunehmen kommt für diese Menschen gar nicht infrage, auch wenn es aus ärztlicher Sicht dringend geraten wäre.
1.5 Was besagt der BMI?
Einen guten Anhaltspunkt, um das Körpergewicht etwas objektiver zu beurteilen, bietet die Einteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dazu wird der sogenannte »Body-Mass-Index« (BMI) herangezogen: Er ergibt sich aus dem Quotienten aus Gewicht und Körpergröße zum Quadrat (kg/m²).
Angenommen Sie sind 1,70 m groß und wiegen 70 kg, dann hätten Sie einen BMI von 24,2 kg/m², wären also normalgewichtig.
Würden Sie bei einer Größe von 1,70 m dagegen 80 kg wiegen, dann entspräche das einem BMI von 27,7 kg/m², der in die Kategorie Übergewicht fällt.
Bei 90 kg und einer Körpergröße von 1,70 beträgt der BMI 31,1 kg/m², was gemäß WHO-Einteilung der Kategorie Adipositas bzw. krankhaftes Übergewicht entspricht.
Diese Einteilung ist weitgehend akzeptiert und Ärzte oder Ernährungsberater orientieren sich daran.
WHO-Gewichtseinteilung bei Erwachsenen anhand des BMI
Kategorie
BMI [kg/m²]
Untergewicht
< 18,5
Normalgewicht
18,5 – 24,9
Übergewicht
≥ 25,0
Adipositas
≥ 30,0
Allerdings wird das Normalgewicht auch noch in Beziehung zum Alter gesetzt. Verschiedene Studien hatten nämlich gezeigt, dass der BMI mit dem Alter ansteigt. Daher ist eine altersabhängige Einteilung der BMI-Idealwerte sinnvoll, wie sie vom National Research Council im Jahr 1989 veröffentlicht wurde. Laut dieser altersabhängigen Einteilung gelten junge Erwachsene mit einem BMI von 25 kg/m² bereits als übergewichtig, während ab einem Alter von 25 Jahren und älter ein BMI von 25 kg/m² im Bereich des Normalgewichts liegt. Wenn Sie in jungen Jahren normalgewichtig sind und im Laufe des Lebens nur wenig zunehmen, bleiben Sie dennoch im normalgewichtigen Bereich, weil das »zulässige Gewicht« mit dem Alter steigt.
Altersabhängige Einteilung des idealen BMI (gemäß US National Research Council)
Alter (Jahre)
BMI-Idealwert (kg/m²)
19–24
19–24
25–34
20–25
35–44
21–26
45–54
22–27
55–64
23–28
> 64
24–29
Der BMI ist ein brauchbarer Anhaltspunkt für Unter-, Normal- oder Übergewicht, allerdings reicht der BMI allein zur Beurteilung des Körpergewichts nicht aus. Denn es ist natürlich ein großer Unterschied, ob es in erster Linie Muskelpakete oder überwiegend Speckröllchen sind, die zum Plus an Körpergewicht beitragen. Daher wird zur Beurteilung des Körpergewichts heutzutage neben dem Geschlecht auch die Körperzusammensetzung mit einbezogen. Dabei unterscheidet man die Komponenten: Fettmasse, Muskelmasse, extrazelluläres Wasser und Knochenmasse.
1.6 Wie hoch ist der Anteil an Körperfett?
Wie der BMI steigt auch der ideale Fettanteil mit zunehmendem Alter an. Die Normwerte für den Fettanteil hängen dabei von Alter, Geschlecht und Körperbau ab. Frauen haben im Allgemeinen einen höheren Körperfettanteil als Männer. Beispielsweise weisen 20-jährige Männer im Durchschnitt einen Körperfettanteil von 18 %, junge Frauen einen Anteil von 25 % auf.
Die Körperzusammensetzung unterscheidet sich nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch von Mensch zu Mensch. Bei gleichem Gewicht und gleicher Körpergröße können daher ein muskulöser Athlet (z. B. ein Bodybuilder) ohne große Fettspeicher und eine eher unsportliche Person mit einem hohen Fettanteil denselben BMI aufweisen.
1.6.1 Körperfett bestimmen
Der Körperfettanteil lässt sich mit der sogenannten bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) bestimmen. Diese Messmethode macht sich die Tatsache zunutze, dass Körpergewebe mit einem hohen Wassergehalt (wie Muskeln, Blutgefäße, Knochen) elektrischen Strom sehr gut leitet, während Fett keine Leitfähigkeit hat. Bei der Bestimmung wird ein ganz schwacher – gar nicht spürbarer – Strom durch den Körper geschickt und der elektrische Widerstand gemessen, womit der Körperfettanteil berechnet wird. Um abzuschätzen, wie viel Fett man tatsächlich mit sich herumträgt, reichen herkömmliche Körperwaagen mit dieser Zusatzfunktion gewöhnlich aus. Eine genauere und ausführlichere Analyse kann mit professionellen Geräten in Arztpraxen oder medizinischen Fitnessstudios durchgeführt werden.
1.6.2 Das Taillen-Hüft-Verhältnis
Aber auch ohne Bioimpedanzanalyse gibt es eine einfache Methode, um den Fettgehalt, und hier insbesondere das als ungünstig geltende Bauchfett, abzuschätzen. Dazu können Sie Ihr Taillen-Hüft-Verhältnis ermitteln. Sie brauchen nur ein Maßband, das Sie sich einmal um Taille und einmal um die Hüften schlingen, und die jeweiligen Werte abzulesen.
Bei einem Taillen-Hüft-Verhältnis über 1,0 bei Männern und über 0,85 bei Frauen spricht man von einer »androiden Fettverteilung«. Diese Form der Fettverteilung wird auch »Apfeltyp« genannt und kennzeichnet sich durch eine Fettansammlung im Bereich des Bauches. Liegen die Werte unter 1,0 bzw. 0,85 spricht man vom sogenannten »Birnentyp«. Dieser weist vor allem eine Fetteinlagerung im Bereich der Hüften und der Oberschenkel auf. Diese Form der Fettverteilung wird »gynoide Fettverteilung« genannt. Im Allgemeinen weist eine androide Fettverteilung ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Dieses Risiko ist für den Birnentyp vergleichsweise gering.
Zellulär gesehen entsprechen Übergewicht und Adipositas einer Zunahme der Fettspeicher und damit des Fettgewebes. Diese Körperfettzunahme ist eine Folge der Vergrößerung der Fettzellen oder eine Kombination aus Vergrößerung und Vermehrung der Fettzellenzahl.
Um zu beurteilen, ob Sie sich nur subjektiv zu dick fühlen oder ob es sich tatsächlich um Übergewicht oder Adipositas handelt, bestimmen Sie am besten Ihren BMI und schauen dann in den Tabellen ( ▶ Seite 15 und ▶ 16) nach. Die Körperzusammensetzung, und hier insbesondere den Körperfettanteil, können Sie entweder mit einer entsprechenden Bioimpedanzwaage bestimmen bzw. das Fettverteilungsmuster mit dem Taillen-Hüft-Verhältnis. Ausgeprägtes Bauchfett gilt auch dann als gesundheitsschädlich, wenn kein starkes Übergewicht vorliegt.
Frauen haben mehr Körperfett als Männer und ältere Menschen mehr als jüngere.
1.7 Wie entsteht Übergewicht?
Die Entstehung von Übergewicht wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst und zählt zu einem der komplexesten Phänomene in der Medizin. Um das vielschichtige Geschehen von Übergewicht und Adipositas deutlich zu machen, haben Forscher der Justus-Liebig-Universität Gießen ein Ursache-Wirkungs-Modell entwickelt, das die vielen Einflüsse auf Übergewicht und Adipositas sowie deren Auswirkungen darstellt. In diesem Modell gibt es extrem viele Einflüsse, die untereinander stark vernetzt sind, sich also gegenseitig beeinflussen. Die Forscher haben dabei zwischen direkten und indirekten Faktoren unterschieden. Das Ernährungsverhalten beispielsweise zählt zu den indirekten Einflüssen, denn es bestimmt u. a., welche Nahrungsmittel ausgewählt werden und damit auch das Essverhalten