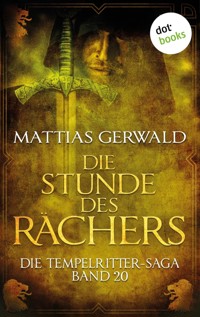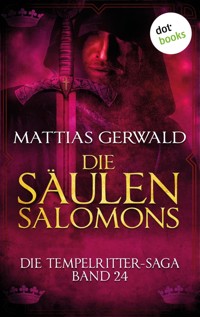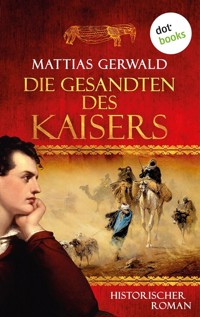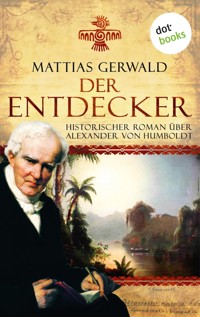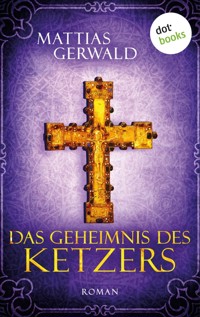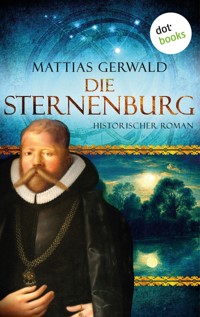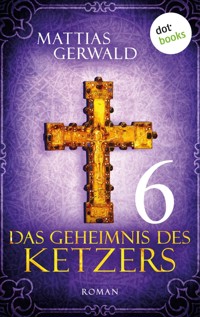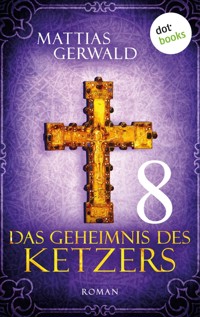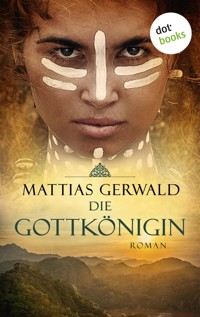
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die geheimnisvolle Welt der Mayas: "Die Gottkönigin" von Mattias Gerwald jetzt als eBook bei dotbooks. Spanien im 15. Jahrhundert: die abenteuerliche Zeit der Konquistadoren. Auch den jungen Chirurg Juan zieht die Abenteuerlust in ferne Länder. Seine Reise führt ihn über die kanarischen Inseln bis nach Südamerika. Auf diesem wilden und fremden Kontinent begegnet er Surum, der Tochter des Gottkönigs eines geheimnisvollen, alten Volkes. Juan ist fasziniert von der exotischen Schönheit – und ahnt noch nicht, welches Schicksal ihnen bevorsteht. Denn schon bald müssen die beiden vor Krieg und Feinden fliehen. Eine Flucht, die sie bis ans andere Ende der Welt führt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Gottkönigin" von Mattias Gerwald. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 828
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Spanien im 15. Jahrhundert: die abenteuerliche Zeit der Konquistadoren. Auch den jungen Chirurg Juan zieht die Abenteuerlust in ferne Länder. Seine Reise führt ihn über die kanarischen Inseln bis nach Südamerika. Auf diesem wilden und fremden Kontinent begegnet er Surum, der Tochter des Gottkönigs eines geheimnisvollen, alten Volkes. Juan ist fasziniert von der exotischen Schönheit – und ahnt noch nicht, welches Schicksal ihnen bevorsteht. Denn schon bald müssen die beiden vor Krieg und Feinden fliehen. Eine Flucht, die sie bis ans andere Ende der Welt führt …
Über den Autor:
Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheint: Novembermord, Engelmord, Regenmord und Frühjahrsmord. Er lebt in Frankfurt am Main und in Nordhessen.
Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald folgende Bände:
Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach VinetaDie Tempelritter-Saga – Band 8: Das Grabtuch ChristiDie Tempelritter-Saga – Band 9: Der Kreuzzug der KinderDie Tempelritter-Saga – Band 18: Das Grab des HeiligenDie Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des RächersDie Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons
***
Neuausgabe April 2016
Copyright © der Originalausgabe 2002 Pendo Verlag GmbH, Zürich
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Zolotareva Elina
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-488-7
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Gottkönigin an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Mattias Gerwald
Die Gottkönigin
Roman
dotbooks.
»Wir waren zu lange blindlings befangen in der Vorstellung, dass alles mit uns begann. In Wirklichkeit endeten viele große Zivilisationen rund um die Welt mit unserer Ankunft.«
PROLOG
Alles war bereit. Der Arzt mit den rot gefärbten Haaren und den lang herabgezogenen Ohren streckte die schlanken Hände von sich, um sie von dem weißhäutigen Mädchen waschen zu lassen. Der mit Hanfseilen unbarmherzig gebundene Kranke lag ohne Regung, von Tüchern bedeckt, auf dem von vier Gehilfen in bodenlangen grünen Gewändern umstandenen Tisch, weiße, jetzt mit feuchten Flecken bedeckte Binden verbargen sein Gesicht vom Hals bis über die Augen, nur Mund und Nasenöffnung blieben frei. Sein kahl geschorener Schädel war mit der roten Farbe aus der Wurzel des Tainastebaumes vollständig eingerieben und leuchtete unangemessen im verstärkten Licht der durch ein Fensterglas von geschliffenen Muscheln einfallenden Vormittagssonne. Der Blick des Arztes fiel auf seine einzigartigen, mit Tierköpfen verzierten Instrumente, die nebeneinander auf einem mit Ornamenten versehenen Tuch in einem aufgeklappten Reisebehältnis aus Horn lagen. Er verlangte ein Obsidianmesser und zertrennte schnell die Kopfhaut. Dann verlangte er den Krontrepan und setzte ihn an.
Die sägeartigen Zähne am unteren Rand des Metallzylinders lagen nun auf dem Schädelknochen. Ein herausnehmbarer Dorn markierte durch einen leichten Schlag den Trepan in der Mitte der befallenen Stelle. Nach weiteren vorsichtigen Schlägen fassten die Zähne im Knochen, und das Gerät saß fest.
»Kolophonbogen«, verlangte nun der Arzt, nahm das wie einen Geigenbogen aussehende Gerät, wegen dem er schon von den Inseln hierher geflohen war, in die Linke, blickte seine Gehilfen reihum an und begann mit der verbotenen Arbeit. Die Bogensaite legte sich um den Bohrtrepan, gleichmäßig bewegt, drehte er sich unter immer stärkerem Druck hin und her. Leichter Knochenstaub schob sich an den Seiten heraus, er wurde von den aufmerksamen Händen der Gehilfen abgetupft. Allmählich fräste sich der Trepan in den Schädelknochen hinein.
»Wasser«, verlangte der Arzt, und ungeduldiger: »Mehr Wasser!« Der schon heiße Trepan fräste sich tiefer, das Geräusch war gleichmäßig, es war außer dem Atmen der sieben Anwesenden in dem weiß gekalkten Saal, in dem nur die hässlich verzerrte Totenmaske über dem Operationstisch verstörend ins Auge fiel, das Einzige. Dann kam noch ein anderes dazu, ein schwaches Stöhnen des Behandelten, der aber nur im tiefen Tal der betäubenden Gifte ohne Schmerzen träumte.
Der Arzt hielt an. Mit den Fingerspitzen bewegte er jetzt den Knochenzylinder und hob ihn schließlich mit einer stumpfen yantra ab. Er prüfte mit einer besonders fein gearbeiteten Sonde den Zustand des Knochens, trug mit einer anderen ein Ätzmittel auf und nickte befriedigt wie im Gespräch mit sich selbst.
»Ich mache weiter«, sagte er und ließ sich den Schweiß von der Stirn tupfen. »Jetzt den sastra!«
Sofort lag das Spezialmesser aus Obsidian zum Schneiden und Meißeln in seiner Rechten, und er begann, die durch den Trepan umzirkelte entzündete Stelle des Schädels abzutragen. Wieder prüfte er mit einer Sonde aus Tierhorn. Immer vorsichtiger schnitt und meißelte er weiter. Schließlich taten feine Pinzetten ihren Dienst und entfernten weiße Splitter. Ein saugendes, glucksendes Geräusch kündigte dem Arzt die erfolgreiche Durchbohrung an, das runde Schädelstück konnte nach leichten, ruckartigen Bewegungen und seitlichen Drehungen herausgezogen werden. In die entstandene Öffnung führten die Gehilfen ein hauchdünnes und münzgroßes Bronzeplättchen zum Schutz der Hirnhaut ein. Inzwischen schabte der Arzt das herausgenommene Stück an der inneren Schädeldecke sauber ab und entfernte Gewebefäden und blutige Reste des Geschwürs mit einer schwarzen Salbe, die er aus Harzen, Shisastrekräutern und dem Schlamm aufgelöster Schwalbennester gemischt hatte.
Das Geschehen wirkte, entgegen den Anschuldigungen, nicht wie eine kultische Handlung. Alles war zweckbezogen, jeder Handgriff saß. Und doch ließen die Mienen der Beteiligten etwas anderes erkennen als nüchternes ärztliches Bemühen. Wenn bei den Operationen der Chirurgen und Wundärzte sonst Gelassenheit und Selbstsicherheit die blutige Handlung erträglich machten und ihr einen tieferen, praktischen Sinn verliehen, verbreitete sich um den verloren stöhnenden Kranken auf dem niedrigen Tisch und die ihn angespannt und geduckt umstehenden Helfer etwas anderes. Es waren Angst und Schuldbewusstsein.
In diesem Moment hielt vor dem Gebäude betont langsam, als wolle es die Handlung nicht stören, ein mit schwarzen Tüchern verhängtes Gefährt.
BUCH EINS: Fester Boden
»Alles, was geschehen soll, das geschieht.Alles, was nicht geschieht, das wird geschehen.«
Omen der Reidan-Völker
Erster Teil: Der Junge
Moguer.Palos de la Frontera.Santa Cruz de Tenerife.
1492-1493
AM HAFEN
»Juan! Juan!!«
Die Rufe hallten bedrohlich im Kopf des Jungen nach, und er war im ersten Moment versucht umzukehren. Aber dann nahm er allen Mut zusammen und rannte weiter. Er wusste, wenn er erst mal den Ort hinter sich gelassen hatte, waren es nur noch drei Kilometer bis zum Meer. Es gab kein Zurück.
Während er mit fliegendem Atem hinunterlief und schon die Plaza überquerte, die gepflastert war, weil dort die Patrone und der Pfaffe wohnten, schielte er aus den Augenwinkeln nach Osten. Bei Sonnenaufgang musste er dort sein. Wie unter Zwang wiederholte er stumm den Satz: Nur nicht zu spät kommen!
Die Rufe vom oberen Ortsende her wurden schwächer, dann hörten sie auf. Juan ärgerte sich, dass der Vater überhaupt seinen Aufbruch bemerkt hatte. Sein Misstrauen hatte ihn gewarnt, obwohl Juan alles getan hatte, es zu zerstreuen. Er war mit ihnen bis zwei Uhr früh flussaufwärts auf dem Rio Tinto gewesen und hatte besonders hart gearbeitet, die prüfenden Blicke des Vaters und der beiden Brüder im Rücken. Zu Hause angekommen, blieb er wach, obwohl er genauso wie sie vor Erschöpfung wie betäubt war. Er hatte sich mit dem Vorwand, wegen der Hitze unter freiem Himmel schlafen zu wollen, auf das Dach des einstöckigen Hauses gelegt, den Sternenhimmel im Blick. Den Himmelsblick hatten ihn die schmutzigen Jungs aus den Erdbeerfeldern in der Ebene gelehrt. Als der Halbmond waagerecht wie ein glänzendes Schilfboot auf dem Himmelsdunkel lag und die allererste Ahnung des noch verborgenen Sonnenlichts für einen Wimpernschlag über Orion und Endanus wischte, die im Hitzemonat als hellste Abendsterne im Winkel zueinander stehen, war er in sein fleckiges rotes Baumwollhemd und die kurze gelbe Hose geschlüpft und war trotz seiner Müdigkeit losgestürzt.
Nach der ersten, verbissenen Anstrengung fiel Juan in einen gleichmäßigen Trab, so als würde er auf dem Ballspielplatz allmählich in Stellung laufen, um die Angreifer zu ärgern. Noch zwei Kilometer. Wieder wendete Juan den Kopf mit dem unordentlich kurz geschnittenen schwarzen Haar und sah mit vor Aufregung weit aufgerissenen Augen nach Osten. Noch immer war alles dunkel, aber er wusste genau, dass die Sonne schon hinter dem Horizont lauerte. Er stellte sich vor, jemand sei hinter ihm her, und begann, schneller zu laufen, gleichmäßig klatschten seine dünnen Sandalen aus Ziegenleder auf den Sand. Er war zäh, konnte wie ein Rochen schwimmen, aber vier Kilometer waren vier Kilometer.
Die Landschaft war nur schemenhaft zu erkennen. Juan lief an unzähligen hellen, im Gras hingeduckten Buckeln vorbei. Das mussten schlafende Schafe sein, ihr vertrauter Geruch stieg ihm in die Nase. Wenig später drang aus dem gegenüberliegenden Buschwerk ein anderer, schärferer Geruch. Juan lief unwillkürlich noch schneller, denn dies waren unverkennbar die Ausdünstungen einer Großkatze auf Raubzug. Als er einmal den Blick von dem unebenen Weg hob, sah er zu seiner Erleichterung, dass die Senke in Sicht kam, in der Palos zum Meer hinunterstürzte, als wäre der Ort eines stürmischen Tages von der Höhe abgerutscht. Den breiten Rio Tinto zur Rechten, auf dem er noch vor ein paar Stunden gefischt hatte, konnte Juan nur ahnen. Obwohl sich seine scharfen Augen inzwischen an das matte Licht von Sternen und Mondsichel gewöhnt hatten, stolperte er plötzlich, fiel hin und schlug sich die nackten Knie auf. Mit hässlichen maurischen Flüchen auf den Lippen, die er von den dunklen Fischerjungen vom Hafen gelernt hatte, rannte er weiter. Er spürte, wie etwas Feuchtes an seinen Kniescheiben herunterlief. Dann stand er am Abhang, roch das Meer und sah hinunter nach Puerto Palos. Das Bild ließ ihn erschauern.
Licht von hunderten von Fackeln leuchtete, eine vielköpfige Menge stand unbeweglich und, wie es ihm schien, völlig lautlos und stumm unter ihm und bildete eine Gasse zwischen den zinnengekrönten Mauern der Stadtbefestigung und dem Pier, und weiter hinten am Ankerplatz lagen die drei Schiffe wie dunkle gedrungene Tiere und bewegten sich unruhig. Juan konnte sich nur schwer satt sehen an diesem Bild, das er so herbeigesehnt hatte. Aber er riss sich los und sprang wie ein hinkender Derwisch den Berg hinab, rutschte erneut aus und kam zusammen mit kollernden Felsbröckchen unten in Höhe der gepflasterten Mole an. Er sah einen der Pinzon-Brüder, den, der hier blieb. Dann erkannte er einige seiner Spielgefährten aus Palos, die halb nackt und vor Kälte zitternd dastanden und sich manchmal etwas zubrüllten, wofür sie sich Kopfnüsse der hinter ihnen stehenden Erwachsenen einhandelten. Auch einige andere Bewohner von Palos erkannte Juan, die Fischer sowieso, den fetten Besitzer der Loncha, ein paar knochige Mulitreiber und Ziegenhirten, afrikanische Plantagenarbeiter. Aus Moguer war niemand zu sehen, obwohl allein elf Matrosen aus seiner Heimatstadt zu den neunzig Männern gehörten, die auf die große Reise gingen. Als die Kirchenglocken dumpf zu dröhnen begannen, löste ihr Hallen ein Frösteln im Körper des Jungen aus.
Juan mischte sich unter die Menge. Da er mit seinen sechzehn Jahren fast so groß und schlank wie ein Erwachsener war, überblickte er das meiste. Wenn er den Kopf reckte, konnte er bis zur Kathedrale sehen, die erleuchtet war und aus deren offenem Maul merkwürdige Geräusche kamen. Es war ein Sirren und Summen wie bei einem Bienenstock. Dann sah er den Grund. Die gerade heraustretenden Gestalten, die sich in der Dämmerung wie Einbildungen vor dem Weiß und Gelb des Kirchenbaus abhoben, drehten Rasseln in ihren Händen.
Um noch besser sehen zu können, wechselte Juan die Seite. Er trat in die gegenüberstehende Menschenkette und handelte sich gemeine Ellenbogenstöße ein, weil er einem Mann auf den Fuß trat und anderen dahinter die Sicht nahm. Juan wünschte dem Fluchenden die Pest und scherte sich nicht um die anderen. Begierig sog er mit Blicken ein, was sich vor ihm abspielte, er wollte auf keinen Fall irgendeine Einzelheit verpassen.
Die Menschenschlange wand sich langsam den Weg hinunter, vorbei an bizarren Korkeichen und Zypressen, Rauch stieg auf, erregte Pferde wieherten. Vor den Kostümierten mit den Rasseln gingen der Priester, ein Novize, der seinen goldverzierten Stab trug, und vier Franziskaner aus dem Kloster. Sie trugen die kleine Statue der Patrona von Palos mit dem kuppelförmigen Baldachin aus Silberplättchen auf ihren Schultern und murmelten ein Gebet. »Nuestra Senora de los Milagros, bete für uns Sünder!« Dann folgte ein einzelner Mann, hoch gewachsen, bärtig, mit der flachen Kopfbedeckung eines jüdischen Würdenträgers, es war Santangel, der Goldminister der Krone. Die Männer dahinter mussten die Kapitäne sein, Juan erkannte einen an seinen langen, schwarzen Haaren, er umfasste die Hand eines kleinen Jungen. Die Seefahrer hielten, im Gegensatz zu den Kirchenmännern, die Köpfe gesenkt, als bedrücke sie ein Leid. Juans Blicke tanzten über die Gruppe hinweg, aber er konnte ihn, den er besonders sehnsüchtig erwartete, nicht entdecken.
»Verdammt!«, rief er unbeherrscht. »Wo ist der Mann! Ich habe ein Recht, ihn zu sehen!«
Hinter ihm zischten die anderen. »Willst du wohl die Zeremonie nicht stören, verfluchter Bengel!« Eine Stimme bellte: »Stopft dem da vorn bloß das Maul!«
Juan drehte den Kopf nach hinten und spuckte aus. Er erntete empörtes Geschrei und einen Faustschlag, der ihn seitlich am Kopf traf. Es war ihm egal. Denn die Spitze der langen Menschenschlange befand sich nun schon auf seiner Höhe.
»Da! Da ist er!« Ein Seufzen ging durch die Menge. Einige Frauen fielen auf die Knie. Männer begannen zu beten. Pack, dachte Juan, Ziegenscheiße. Er machte unwillkürlich einen Schritt nach vorn, als zöge die Prozession ihn mit einer unwiderstehlichen Kraft an. Jetzt nahm er die Gestalt wahr, die allein aus der Kirchenpforte getreten war, gefolgt von Juan Perez, dem Abt des Klosters, den Juan kannte, er hatte dem Seefahrer wohl die Beichte abgenommen. Ihn hatte er gesucht. Genauso hatten ihn die Mönche beschrieben.
Der Seefahrer musste um die vierzig sein, für Juan ein unvorstellbares Alter. Aber er ging noch immer aufrecht, ein gut gebauter Mann von mehr als durchschnittlicher Größe, sein braunes, von einzelnen Silberfäden durchzogenes Haar quoll unter seiner Kopfbedeckung hervor und fiel bis auf die kräftigen Schultern. Sein längliches Gesicht mit den hervortretenden Backenknochen und dem festen Kinn war bleich. Auffallend war die scharfe Adlernase. Seine hellen Augen blickten wach, aber eine Spur von Traurigkeit lag jetzt, da er den Kopf hob und prüfend in Richtung der Schiffe sah, in seinem Blick. Ja, das war der Admiral der Ozeanischen Meere und zukünftige Gouverneur der Westindischen Inseln, ein echter Vizekönig in seinem prächtigen, mit Medaillons behängten Hermelinumhang.
Juan verspürte den Wunsch, sich ihm in den Weg zu stellen und stolz seine Dienste anzubieten, aber selbst einem wilden, jähzornigen Burschen wie ihm, der sich alles traute und den anderen Angst einjagte, der keiner Eingebung als seiner eigenen folgte, sagte eine innere Stimme, dass der Admiral ihn nicht brauchte. Das erfüllte ihn einen Moment lang mit jäher Wut, aber er blieb stehen und blickte den Männern mit halb geöffnetem Mund entgegen. Dass er dabei wie immer, wenn er ungeduldig war, mit dem rechten Fuß einen wilden Takt stampfte, fiel ihm nicht auf.
Der Admiral war jetzt auf seiner Höhe, und Juan verstand einen Satz, den er zu dem neben ihm hergehenden Santangel sagte. »Nein, ich habe zu lange dafür gekämpft, ich will über alle Meere reisen, ich möchte hinter das Wetter gelangen, versteht Ihr!« Der andere schwieg. Die Prozession zog vorbei. Erst jetzt hörte Juan, dass einige Gestalten einen inbrünstigen Gesang angestimmt hatten. In die Zuschauer kam Bewegung. Die Reihen lösten sich auf, man ging schwatzend den Männern hinterher, hinunter zu den beiden Caravellen und dem Frachtschiff, der Santa Maria. Juan balgte sich kurz mit einem seiner Feinde, dem achtzehnjährigen Sohn eines Schnapsbudenbesitzers an der Saline, der ihm heimtückisch ein Bein gestellt hatte. Er schlug dem vierschrötigen Kerl gegen die Gurgel, dann ging er schnell weiter, überholte die anderen mit einem kurzen Spurt und wartete am Kai.
Die Plankenschiffe rollten auf der leichten Dünung. Juan bewunderte die schnellen schwarzbraunen Caravellen, zwei fünfundzwanzig Meter lange 100-Tonnen-Schiffe, deren Masten noch ohne Takelage waren. Sie trugen seitlich am hochgereckten Bugsteven bunte Wappen der Stadt Palos und sämtlicher Schiffseigner, achtern liefen die Boote in flachen Formen aus. Vor allem der Olivenbaum und ein gekrönter Löwe mit Schwert auf blau-rot gestreiftem Grund kamen auf den nach unten abgerundeten Wappenschildern immer wieder vor. Auch am Mast des dritten Schiffes, einer gedrungenen Nao, knatterten die Fahnen.
In diesem Moment hellte im Osten der Himmel auf. Ein breiter Streifen Orangerot tastete wie ein Zeigefinger über das Meer. Erst jetzt bemerkte Juan, wie viele Fischerboote jenseits der Schiffe auf dem Meer lagen. Überall leuchteten Fackeln, die glatte See schien sich aufzulösen in flackernde Feuer. Jetzt ertönten Kommandos. Fast gleichzeitig rauschte gelbes Segeltuch mit dem blutroten Kreuz Kastiliens an den Mastbäumen herab. Nun entfalteten sich auch die bunten Fähnchen Andalusiens und Aragons. Juan hörte die Matrosen schreien und sah, wie sie an Deck herumrannten.
Die Prozession überquerte die letzten fünfzig Meter des ins Wasser gebauten hölzernen Landungsstegs, an dessen Spitze Kienfeuer Hitze verbreiteten. Juan war von dem Schauspiel so erregt, dass er sich beinahe in die Hose gepinkelt hätte. Das Bild vor ihm zog ihn magisch an. Er sog die frische Nachtluft ein und wurde langsam etwas ruhiger. Wenn er nur mitfahren könnte! Wie konnte er es anstellen, an Bord zu kommen! Es hätte ihn nicht gereut, alles hinter sich zu lassen, nur um auf den unendlichen Ozean hinausfahren zu dürfen!
Wie auf ein geheimes Kommando hin kam jetzt Wind auf, die Wellen des Atlantiks rauschten in langer Dünung an den Sandstrand von Palos. Stärker flatterten die Fahnen, blähten sich die Segel, flackerten die Feuer. Und noch immer kamen vereinzelt Menschen aus der Kirche, die Schlange reichte bis hinunter zur Landungsbrücke, wo Juan stand und wie alle anderen von Wachposten mit Hellebarden und Spießen am Weitergehen gehindert wurde. Nur die Würdenträger durften passieren. Als der Admiral als Letzter die Brücke betrat – Juan schien sein fester Schritt in Lederstiefeln besonders laut und energisch widerzuhallen –, stockten die Zuschauer. »Zurück, Leute! Wollt ihr euch wohl trollen!«, taten sich die Soldaten wichtig und brachten die Waffen in Anschlag. Die Menge blieb widerwillig wie ein Raubtier, das man am Fressen hinderte, stehen.
Juan drehte sich um. In Richtung Palos war noch alles dunkel, die mächtige Stadtmauer mit ihren durch Zugbrücken gesicherten Eingangstoren war gerade noch zu erkennen, der Rauch der vielen Feuer und Fackeln tat ein Übriges, um die Sicht zu vernebeln. Ein Vogelschwarm zog plötzlich ein V-Zeichen dicht über die Bucht hinweg hinaus aufs offene Meer, Kinder schrien, die Gesänge der Menge wurden wieder lauter. Von den Caravellen her ertönte die feierlich laute Stimme des Priesters, Juan verstand Satzfetzen und unterschied Namen, es waren die der Matrosen. »... ein Marinero aus Puerto de Santa Maria, ein Marinero aus Vejer, aus Ronda ein Velidor, aus Montilla ein Marinero, zwei Matrosen aus Cordoba, zwei Matrosen aus Devar, einer aus Antonnia ...!« Juan hätte die Liste fortsetzen können, er kannte sie im Schlaf: zwei aus Lepe, aus Ayamonte und aus Vavida, aus Palos zwei Capitanos und ein Maestre und ein Piloto und zwei Contramaestres aus Huelva, weitere aus Sastre, aus Paje, aus Grumetes ...
Erneut ertönten Befehle, aus dem Bauch der Schiffe drang, so als brannten die Zwischendecks, eine rötliche Helligkeit. Wenn Juan sich auf die Zehenspitzen stellte, sah er die Abschiedsszenen. Die Seefahrer standen eng mit ihren Frauen und Kindern zusammen. Er, den er besonders mit Blicken suchte, hatte die Stirn an die Stirn einer Frau mit langen, roten Haaren gelegt, er schien ihre Hände zu küssen. In der Nähe stand ein hoch gewachsener Junge in brauner Mönchskutte aus dem Kloster, den Juan schon einmal gesehen hatte, der Name fiel ihm nicht ein. Der Seefahrer beugte sich zu einem Kind hinab, das eine leuchtend gelbe Kappe trug, er küsste den Jungen. Juan fiel ein, dass er noch nie geküsst worden war, schon gar nicht von seinem Vater, dessen bitteres, zerfurchtes Gesicht mit dem harten Blick er vor sich sah.
Angesichts der innigen Bilder überfiel Juan wilder Zorn. Er dachte: Nein, ich habe keinen Vater, ich bin allein, ich bin niemand verantwortlich, ich habe mich selbst hervorgebracht. Aber er hätte alles darum gegeben, in diesem Moment an Stelle des Kleinen zu sein und die Liebe des Seefahrers zu spüren. Jetzt riss der Admiral irgendetwas von seinem Hals ab, Juan konnte es nicht erkennen, außerdem rannten in diesem Moment einige Schlingel auf den Landungssteg, mussten von den Soldaten vertrieben werden, und Juan sah nichts mehr. Als der Seefahrer wieder in seinem Blickfeld war, umarmte er gerade den großen jungen Mönch, dann gab er dem hoch gewachsenen Bärtigen mit der jüdischen Kopfbedeckung und dem lilafarbenen Kaftan die Hand, und danach löste er sich von allem und ging mit schweren Schritten, aber seltsam geduckt an Bord der Santa Maria.
Gleich darauf legte die Nina ab. Es folgten die Pinta und die schwere Santa Maria. Die jeweils sechs bunten Fahnentücher an den Mastspitzen knatterten jetzt heftig im aufgemachten Wind. Die drei gedrungenen Schiffskörper bildeten eine wunderschöne Einheit, und wie sie auf das jetzt silbern in der Morgensonne schimmernde Meer hinausfuhren, schnitten sie einen schwarzen Umriss in den Himmel, der ganz oben feuerrot leuchtete und zum Horizont hin in Orange und Grün auslief.
Juan weinte, ohne es zu merken, erst als die salzigen Tränen ihm in die Mundwinkel liefen, wischte er sie ab. Allmählich leerte sich die Landungsbrücke, die Menschen zerstreuten sich über die Wiesen und Hügel in alle Himmelsrichtungen oder kehrten nach Palos zurück, um ihr hartes Tagewerk zu beginnen, die Männer auf den Feldern unter einer unbarmherzigen Sonne, die Weiber in den Häusern oder in den stinkenden Gerbereien und Flachsereien, die Kinder und die Mauren in den Erdbeerplantagen und Weinbergen. Die Umrisse der Caravellen wurden kleiner und kleiner, sie waren, getragen vom frischen Wind, schon weit draußen. Und kurz darauf sah Juan sie nicht mehr. Sie waren hinter dem Horizont, vielleicht schon hinter dem Wetter.
Juan ließ sich dort, wo er stand, auf die Erde nieder. Jetzt bemerkte er, dass er immer noch weinte, und sah sich schnell nach Zeugen um, die ihn auslachen könnten. Aber er war allein, die eben noch lärmende Menge hatten die Mauern der Stadt geschluckt. Juan wischte sich das Gesicht mit den nackten Armen ab.
Er erinnerte sich, dass er seit gestern einen Granatapfel in der Hosentasche hatte, und fischte ihn heraus. Bevor er ihn aufbrechen konnte, fiel ihm plötzlich dessen Form auf. Rund wie ein Pelote-Ball. Sah die Erde wirklich genauso aus? Der Admiral hatte es behauptet. Jedenfalls hatte Juan das von einem Mönch aus La Rabida gehört, der ein Gespräch mit dem Seefahrer belauscht hatte, in dem dieser behauptete, er wolle nach Westen fahren, um im Osten herauszukommen. Aber wie sollte das gehen, warum fielen die Menschen dann nicht von dem Ball herunter und flogen davon? Und wenn sich dieser Ball noch drehte? Es war Unsinn! Und doch, dachte Juan, wie kommt es sonst, dass die drei Schiffe jetzt nicht mehr zu sehen sind, müssen sie nicht tatsächlich am Horizont einen Berg hinuntergefahren sein? Wenn er doch nur einmal mit dem Fischerboot des Vaters so weit hinausfahren könnte! Dann brauchte er niemand mehr zu fragen und würde selbst die Antwort kennen.
Juan blieb auf einer grob aufgeschichteten Mauer sitzen und ließ die Beine baumeln. Nach dem Treiben von eben kam er sich seltsam verlassen vor, er sah sich um, in seiner Nähe war niemand mehr zu sehen. Es kam ihm in den Sinn, dass er nach Hause zurück müsse, denn spätestens jetzt würde der Vater sicher beschließen, ihm jemanden hinterherzuschicken, und das würde ihn noch jähzorniger machen, denn niemand war bei der Arbeit entbehrlich. Ach was, beruhigte sich Juan, der Vater würde sowieso wissen, wohin er gerannt war, und einfach auf seine Rückkehr warten. Das Problem war die Rückkehr. Sicher lag der Ochsenziemer schon bereit.
Und wenn er nicht mehr zurückging? Der Gedanke erregte den Jungen. Wenn er einfach weiterzog, die Küste entlang Richtung Cadiz, um irgendwo ein paar Maravedis zu verdienen? Er konnte fischen, sogar jagen, und zur Not würde er sich auch auf den Erdbeerfeldern verdingen. Wozu zurück? Er brauchte niemanden, nicht einmal seine Mutter oder die drei Geschwister. Ich bin stark genug, ,ich will mein eigener Herr sein, dachte er. Zu Hause bin ich immer nur der Jüngste, dem man die Flausen austreiben will.
Hinter ihm rief jemand: »Pico! He, Pico!«
Erst nach einem Augenblick begriff Juan, dass er gemeint war, seine Brüder nannten ihn Pico, weil seine Fragen wie spitze Spieße sein konnten. Er drehte sich um, es war Miguel, mit dem er nachts das Strohlager teilte.
»Was ist? Was willst du?«
»Vater sucht dich!«
»Na und? Soll ich mir deswegen in die Hosen machen?«
»Er sagt, er schlägt dich halb tot, wenn du nicht bis Mittag zurück bist, um deine Arbeit zu tun.«
»Und du bist der Köter, der Vaters Worte hinausbellt?«
»Pico, bleib ruhig. Du weißt, wie zornig er sein kann. Du hast schon genug Schläge eingesteckt. Komm mit nach Hause.«
»Ich gehe vielleicht nie mehr zurück.«
»Erzähl keinen Quatsch.«
»Ich verschwinde von hier.«
»Willst du, dass Mutter weint?«
»Pah! Mutter weint sowieso, egal, ob ich gehe oder bleibe, sie heult immer.«
»Und wir? Was wird aus uns?«
»Ich bin nicht fürs Fischen bestimmt.«
»Marsil und Jiménez, die auch so dachten, sind tot, hast du das vergessen?«
»Gar nichts habe ich vergessen«, schrie Juan, »ich vergesse überhaupt nie was. Ich habe unsere Brüder ebenso geliebt wie du. Aber ich will auch nicht wie Pedro enden, der hineinsprang, um den Tunfischen die Augen herauszuschlagen, sie haben sich auf ihn gestürzt, weil sie ihn draußen nicht bekamen. Ich vergesse nicht, wie sein Blut und ihr Blut nicht mehr zu unterscheiden waren. Ich vergesse gar nichts.«
»Aber das sind doch Ausreden, Kindergeplapper!«
Juan wurde ruhiger. »Ich muss weg hier, sonst geh ich zugrunde. Verstehst du das nicht?«
»Nein.«
»Dann geh nach Hause und sag ihm, ich komme. Ich komme, wenn ich es will!«
Nachdem Miguel wortlos umgekehrt war, dachte Juan höhnisch: Ich bin der Einzige, der von hier wegwill, alle anderen wollen bleiben, selbst wenn Pinzon mit den Caravellen aufbricht, schauen sie ihm geringschätzig nach und sagen: Er bringt keinen Fisch nach Hause, er fährt nur spazieren. Und ich frage sie: Und? Ist er nicht selbst der größte Fisch, einer, der alle auffrisst? Aber sie schauen nur blöde und wissen keine Antwort. Ich war lange genug draußen, um zu wissen, dass Fischfang nichts für mich ist. Obwohl ich mich gut auskenne. In der Loncha kann ich jeden Fisch bestimmen, und wenn sie da herumzappeln und mich anglotzen, weiß ich sogar, was sie fühlen, denn fühlen tun sie, das ist klar. Aber nur ich weiß das. Schau einem Fisch doch mal aufs aufgerissene Maul, dann spürst du genau, was sie fühlen, und das ist zuallererst Hass. Wenn sie groß genug sind und du da draußen mit ihnen allein zu tun hast, im Morgengrauen auf dem Meer, dann zahlen sie es dir heim. Nein, fischen ist nichts für mich. Und das hat nichts mit Angst zu tun. Warum können sie das zu Hause nicht begreifen!
Juan sprach oft mit sich selbst. Manchmal schrieb er seine Gedanken auch auf. Er konnte schreiben und lesen, das lernte er seit zwei Jahren von einem Novizen aus La Rabida, seine Gefährten zogen ihn damit auf, schon so mancher Stein war ihm dafür an den Kopf geflogen. »Lesen ist nur wegen der Bibel! Bibelleser, Bibelleser!«, schrien sie. Und er las wirklich dauernd in der Bibel, ein anderes Buch gab es nicht.
Juan fluchte hilflos. In dieser Gegend war für ihn wirklich nichts zu holen. Er überlegte kurz und beschloss dann, zum Kloster hinüberzurennen. Dort gab es immer was zu essen, und er kannte die jüngeren Mönche, die spannende Geschichten zu erzählen hatten.
***
Das Kloster von La Rabida mit seinen drei Türmen, dem ziegelroten Dach und den meterdicken weißen Mauern, die nur unterbrochen wurden von roten und gelben Mosaiken aus maurischer Zeit, duckte sich auf der einen Seite gegen das friedliche Fischerdorf Palos und auf der anderen Seite gegen die wütenden Wellen des Atlantiks. Es stand seit dem 6. Jahrhundert am Meer wie ein Fanal der Christenheit im Endstadium der Reconquista. Franziskaner hatten sich dorthin zurückgezogen, die düstere, schwarze Wolken am Rand des Jahrhunderts heraufziehen sahen. Aber davon verstand Juan nichts.
Zu seiner Überraschung kam ihm eine Abordnung entgegen. Sechs Träger schwarz-weißer Kutten hatten eben die Klosterpforte mit der übergroßen Glocke darüber verlassen und zogen auf dem steinigen Weg eine Staubfahne hinter sich her. Aber die Mönche wollten nichts von ihm, gingen zum Gruß nickend vorbei und verschwanden nach einer Wegbiegung hinter den Felsen. Juan blickte ihnen neugierig nach und ging dann zum Kloster. Er kam öfter hierher, setzte sich einfach irgendwo in den nach Blumen und Kräutern duftenden Schatten und hörte den verschlungenen, auf- und absteigenden Gesängen der frommen Männer zu. Diesmal war nur das Geblöke von Schafen zu hören, die zum Grundbesitz des Klosters gehörten, im Inneren des Klostergartens, dessen Schubkarren, Hacken und Schaufeln von gärtnerischer Arbeit zeugten, herrschte Ruhe.
Die Sonne stand jetzt schon so hoch, dass es heiß wurde, und Juan überlegte, wo er sich hinsetzen konnte, da fiel ihm die Kirche ein. Dort gab es eine kleine Madonna, die ihm gefiel, weil sie nur ihm zuzulächeln schien. Juan ging durch die schwere Eichentür, über der sich ein stilisierter, sichelförmiger Bogen und das Auge Gottes befanden. Er achtete weder auf die kunstvoll gearbeiteten Säulen zu beiden Seiten noch auf die zwei prächtigen almohadischen Skulpturen rechts und links des Eingangs. Für ihn gab es keine zurückliegende, maurische Zeit. Juan kannte nur die eigene Zeit, bis zum Rand angefüllt mit seinen Dingen.
Und so nahm er auch die leuchtenden Fresken eines moriskischen Meisters in dem Raum seitlich des Eingangs nicht bewusst wahr, die von der bewegten Geschichte des Klosters erzählten. Irgendwie mussten diese Dinge aber doch einen Eindruck auf ihn machen, denn warum sonst trieb es ihn immer wieder hierher in das Kloster. Juan musste den südlichen Teil des Kreuzgangs überqueren, in dem einige gedeckte Tische verwaist herumstanden, als wäre eine Gemeinschaft gerade überstürzt aufgebrochen. Er schnappte sich ein paar Trauben, Brot, eine Feige und stopfte sich alles in die Hosentaschen.
Es war ungewöhnlich, dass sich keiner der Mönche blicken ließ. Den Grund dafür verstand er, als er die kleine Klosterkirche betrat. Drinnen rumorte es. Die Klosterbrüder hatten sich um ihren Abt Perez versammelt, und in ihrer Mitte hielten sich fremde Männer in bunten Gewändern und Uniformen auf. Juan schlich sich hinein. Er fragte einen Novizen und bekam eine geflüsterte Antwort. Sie wollten die Predigt von Fray Antonio de Montesino hören, der wegen seiner frechen Reden berüchtigt war. Der Bruder war noch vor kurzem Beichtvater von Königin Isabella gewesen, bevor ihn der Inquisitor Talavera ablöste.
Juan suchte nach einem freien Platz und blickte sich in dem vertrauten einschiffigen Mudéjar-Bau um. Schließlich zog er sich an die roh gekalkte rückwärtige Wand zurück und ließ seinen Blick neugierig über die versammelten Padres, Granden, Hidalgos und Notabeln wandern, die unter der niedrigen Eichendecke und inmitten der einfachen, klobigen Einrichtung saßen. Hier ist was los, frohlockte er. Einige Fremde schienen Siedler zu sein. Er nahm abenteuerliche Gestalten mit rohen, oft vernarbten Gesichtern, pöbelhafter Haltung und finsterer Miene wahr, die nicht recht in die kleine, rundum bemalte, für Juan weiblich wirkende Kirche passten. Alle trugen Waffen.
Trotz des Andrangs herrschte Totenstille. Offensichtlich wartete die Versammlung auf Bruder Antonio, der in diesem Moment auch eintrat und vor der schneeweißen Alabasterfigur der kleinen Jungfrau, die Juan gemeint hatte, sein Kreuz schlug. Juan dachte, dass auch der Admiral hier die letzte Nacht verbracht und sein Kreuz geschlagen hatte. Er bewegte den Kopf und blickte nach links durch ein kleines, oben rund auslaufendes Fenster, durch das nur spärliches Licht eintrat, er sah das Meer. Dort, weit draußen, war jetzt der Admiral und fuhr auf die unbeschreiblichen Schätze der fernen Erdteile zu – oder, wenn er sich getäuscht hatte, auf die bodenlose Leere hinter dem Rand der Erdscheibe.
Juan verstand nicht viel von dem nun folgenden Disput, bemühte sich aber zuzuhören. Es ging um die Verteilung von Reichtümern in neuen Kolonien. Der bärtige Mönch mit dem schmalen, durchgeistigten Gesicht, der Stirnglatze und dem seitlichen Haarkranz hielt seine Rede von der Kanzel herab, die manchmal von unterdrücktem Gemurmel der Versammlung unterbrochen wurde. Kein lautes Wort kam auf, aber es war, als ob die Anwesenden den Atem anhielten, um später desto lauter in Wut und Protest auszubrechen.
Plötzlich lachte jemand höhnisch, und Eisen klirrte, Juan reckte den Kopf. Es war ein Geharnischter mittleren Alters mit einem weißen Federbusch auf dem Haupt, der sich bemerkbar machte. Die Kirchenglocke schlug, und der Redner rief mit donnernder Stimme: »Euer Glaube, Ihr Herren in den reichen Gewändern, Ihr geschmückten Herren, Ihr hochwohlgeborenen Herren, Euer Glaube, wenn Ihr Euch nicht wandelt, ist tot. Vielleicht ist er nie zum Leben erwacht!«
Einige bekreuzigten sich. Der Geharnischte erhob sich plötzlich. Er schrie mit rotem Kopf: »Ich bin der Kommandant von Navarra! Ich habe die wichtige Messe in Medina del Campo geleitet und das Handelstribunal von Compostela gegründet. Seitdem ich während der Reconquista in Militärdienste getreten bin und einen Sitz im Cortes besitze, fühle ich mich mit Recht als bedeutender Träger kastilischer Interessen. Ich und meinesgleichen, wir sind der Mittelpunkt des Lebens in diesem Land. Und wir werden in den neuen Kolonien ebenso herrschen, wie es uns hier zu herrschen gefällt! Ihr Franziskaner werdet schon noch in Eure Schranken verwiesen, es wird Euch wie den Mauren und Juden ergehen!«
Juan hielt den Atem an. Solche Töne hatte er hier noch nie gehört. Was würde der Mönch antworten? Fray Antonio sagte äußerlich unbeeindruckt: »Ich bin die Stimme Christi in der Wüste. Diese Stimme sagt, dass Ihr zukünftigen Kolonialherren im Stand der Todsünde sein werdet, wenn Ihr Euch nicht an die Gebote der Nächstenliebe haltet!«
Der Kommandant schwankte für einen Moment, als stünde er in einem schweren Sturm vor der Küste Tarifas. Er rückte seinen Federbusch zurecht. Schließlich wandte er sich wortlos ab, stolperte durch die Reihe der Sitzenden und verließ mit polternden Schritten die Kirche.
Juan lehnte sich gegen die kühle Kirchenwand zurück. Der Mönch wartete, bis der erzürnte Grande die schwere Kirchentür zugeschlagen hatte. Dann rückte er seine bodenlange Kutte aus grober schwarzer Wolle zurecht, fuhr sich wie erleichtert über das schüttere Haar und sprach weiter. Juan merkte, dass seine Müdigkeit stieg. Er wehrte sich nicht dagegen und vernahm die Stimme des Mönchs bald aus größerer Ferne.
»... Manche nennen sich Christen. Im letzten Augenblick ihres Lebens, kurz vor dem Exitus, verlangen sie Beichte und Absolution – und sie erhalten sie. Dann ist ihr Sprung in den Himmel gesichert und der Antichrist besiegt – glauben sie. Aber das ist eine abscheuliche Apostasie ...«
Ein Grande mit dem Wappen aus Jaen sprang mit hochrotem Kopf auf und fuchtelte theatralisch. »Verrat!«, schrie er. Juan war eingedöst und schreckte auf. »Ich bin Panfilo de Narvaez, der Vorsitzende der Mesta, unserer mächtigen Genossenschaft der Viehbesitzer Kastiliens. Ihr verleumdet Beichte und Absolution, seid Ihr Euch dessen überhaupt bewusst! Ihr ...«
Erneut fielen Juan die Augen zu. Was gingen ihn die Händel der Welt an, wenn er den versäumten Schlaf nachzuholen hatte. Die Bilder der Nacht und des Morgens zogen vor seinen geschlossenen Augen vorbei, er hörte die Musik einer Vihuela, sah noch einmal die glänzenden Lichter der Caravellen. Sah die Fahnen im Wind. Eines Tages würde er an Bord sein und mitfahren ...
Wieder riss ihn nach einer Weile ein Heißsporn in die Wirklichkeit zurück. »Ihr wendet Euch gegen die Siedler, gegen getaufte Christen!«, brüllte ein junger Hidalgo ganz in Schwarz, dessen Degen an der Seite funkelte. Seine Gesichtszüge verrieten, dass er kampferprobt war. »Ihr wendet Euch gegen getaufte Christen! Seid Ihr des Teufels!«
»Aber Exzellenzen, wir befinden uns in einer Kirche unseres Herrn!«, warf ein Bruder verschüchtert ein.
Juan schielte zum Rednerpult. Der Mönch dort war eine Spur bleicher geworden, aber er sagte trotzig: »Geht es Euch wirklich um den Glauben oder nicht eher um den Besitz? Habt Ihr Euch wirklich um das Seelenheil der Ungläubigen gekümmert oder um die Arbeit in den Goldbrüchen? Habt Ihr verdient, dass wir Euch loben?«
Der Hidalgo spuckte Gift und Galle, fand aber nicht gleich die richtigen Worte. Dann holte er tief Luft und sagte: »Hölle und Verdammnis! Der Schlag soll den treffen, der im Ernst so redet ...«
Fray Antonio erwiderte: »Ich sage in dieser Predigt nichts anderes, als der vom König bestallte Regens des Colegio San Gregorio in Valladolid, unser Dominikaner-Bruder Marias de Paz, schon vor Wochen gesagt hat. Wir alle müssen zur Verantwortung vor Gott zurückfinden. Und auch in Sevilla, in Cordoba und in Granada haben zu Pasqua unsere Brüder so gepredigt.«
»Geht zum Teufel!«, schrie der Hidalgo. »Ihr seid doch nicht besser als all die Häretiker, und man sollte Euch im Inquisitionsgefängnis ...«
»Bruder, sagt mir Euren Namen! Sagt mir, wer Ihr seid, dass Ihr so gegen uns wütet!«
»Mein Name«, giftete der Heißsporn zurück, »wird bald in goldenen Lettern geschrieben auf den Inseln prangen, man wird diesen Namenszug aus den Schätzen der Bergwerke in der südlichen Hemisphäre schmelzen, die unter meinem Kommando stehen werden. Mein Name? Francisco de Bobadilla, und dieser Name wird alle in Bälde so sehr in Schrecken versetzen, dass sie ...«
Fray Antonio stand unbewegt auf der Kanzel. Dann sagte er mit einer Stimme, die so leise war, dass sein Gegenüber im Auditorium verstummen musste, um sie zu verstehen: »Wir werden niemanden, der nicht von seinem Hochmut ablassen will, zur Beichte zulassen – so wenig wie einen unbußfertigen Straßenräuber.«
Fassungslos starrte der Hidalgo den Mönch an. Im ersten Impuls wollte er seinen Degen ziehen. Doch plötzlich fasste er sich an den Hals und gab ein gurgelndes Geräusch von sich. Dann stürmte er hinaus, gefolgt von den anderen aus den Hauptstädten des Landes angereisten Haudegen. Danach erhoben sich auch die Mönche und verließen die Kirche. Juan seufzte. Endlich konnte er in Ruhe einschlafen.
Er hatte es sich gerade bequem gemacht, als die Kirchentür erneut aufgerissen wurde. »He, Junge! Was machst du da! Es ist heller Tag, hast du nichts zu tun?«
Juan kehrte in den Wachzustand zurück. Er hatte schon einen gemeinen Fluch auf den Lippen, da erkannte er rechtzeitig, wo er war und wer ihn angesprochen hatte. Er gähnte mit weit aufgerissenem Mund. »Pater Abbo, Ihr seid es. Ich weiß, ich müsste nach Hause, aber ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und bin müde.«
»Na, dann schlaf eben ein Stündchen.«
Aber jetzt war Juan schon wach. »Was sollte dieses Geschrei? Ich habe kein Wort verstanden.«
»Das macht nichts«, lachte der Mönch, der ihn aus kleinen, geröteten Schweinsäuglein ansah. »Hauptsache die, die es betraf, haben verstanden. Sie teilen die neuen Kontinente schon unter sich auf, noch bevor sie entdeckt worden sind. Weißt du, sie glauben, die Welt gehört den Hidalgos und Granden.«
»Pfft!«, machte Juan mit einer wegwerfenden Handbewegung. »So ist es ja auch.«
»Was versteht unser kleiner Fischerjunge von der Weltpolitik!«, meinte der Mönch und blinzelte milde.
»Ist mir egal. Aber ich weiß, dass ich auch bald über die Meere auf die Inseln hinter dem Wetter fahren werde.«
»Die Inseln hinter dem Wetter?«
»Er hat es selbst gesagt – dort will er hin!«
»Wer?«
»Der Admiral der Ozeane natürlich, wer sonst?«
»Mein Junge«, sagte der Mönch und kraulte sich den brustlangen, grauen Bart, »jetzt will ich dir mal was erzählen. Bleib lieber daheim in Moguer. Denn ob der Admiral und die anderen jemals dort ankommen werden, wo sie angeblich hinwollen, das liegt ganz in Gottes Hand. Und wenn du mich fragst, ich wage es zu bezweifeln.«
»Warum?«, wollte Juan verwundert wissen.
»Weil es diese neuen Kontinente mit ihren heidnischen Bewohnern, über die unsere Konquistadoren schon im Geist herrschen, womöglich gar nicht gibt. Nein, die Seefahrer werden nirgendwo ankommen. Eines Tages gelangen sie nämlich an den Rand der Welt, und was dahinter ist, davon sollte man lieber gar nicht reden.«
»Wieso? Was ist dahinter? Immer tut Ihr so geheimnisvoll!«, wollte Juan auffahrend wissen.
»Dahinter ist die Gegenwelt der Schatten, mein Junge ...«
»Ja, das habe ich schon gehört, das sagen alle«, unterbrach ihn Juan, scheinbar gelangweilt. In Wirklichkeit interessierte ihn die Sache brennend.
»... die Zone, in der Leben unmöglich ist. Dort werden die Schiffe in geronnenem Wasser festgehalten und überfallen von gefährlichen Ungeheuern und Fabelwesen wie Kopflose, Brustgesichter und Hundsköpfige. Augustinus lehrt uns das, und Isidor von Sevilla hat ihn ebenso bestätigt wie der alte Ptolemäus.«
»Und das ist wahr?«, fragte Juan mit stockendem Atem.
»Unterhalb des Äquators und am Rand der Welt hängen die Wesen kopfunter, als Spiegelbild unserer christlichen Welt. Alle Entdeckungsreisenden haben uns davon berichtet, sogar die weit gereisten Portugiesen, die vor fast sechzig Jahren an der afrikanischen Küste Kap um Kap für die christliche Seefahrt zu erobern begannen und schließlich Kap Bojador umrundeten. Sie müssen es genauso wissen wie die Kartografen und Kosmografen, die es aufgezeichnet haben. Die Expedition wird also nirgendwo ankommen. Selbst ob sie jemals zurückkehrt, ist zweifelhaft.«
Juan wusste nicht, was er sagen sollte. Stattdessen fing er zu pfeifen an. Dann sagte er trotzig: »Und ich werde trotzdem beim nächsten Mal mit dabei sein, das schwöre ich.«
»Dann sei Gott mit dir, mein Junge. Und jetzt? Willst du nicht erst mal nach Hause gehen? Deine Eltern machen sich gewiss schon Sorgen.«
Und was für Sorgen, dachte Juan höhnisch. Aber er überlegte und sagte dann: »Ja, jetzt gehe ich erst mal nach Hause. Aber Ihr werdet sehen, bei der nächsten Expedition bin ich mit an Bord!«
»Leb wohl!«, sagte der alte Mönch, zwinkerte ihm zu und verließ ihn.
Juan rappelte sich auf und trat in die Tageshitze hinaus. Die Sonne stand jetzt hoch am Himmel, und er machte sich auf den beschwerlichen Nachhauseweg. Zuerst ging er langsam und nachdenklich, die Worte des alten Mönchs kreisten in seinem Kopf, dann verfiel er in Trab. Als die ersten weißen Häuser Moguers in Sicht kamen, verfiel er wieder ins Schlendern. Er steckte die Fäuste in die Hosentaschen, senkte den Kopf und stieg den mit Unrat bedeckten Lehmboden des Ortes hinauf, bis ganz nach oben ins Viertel der Pescadores, wo das einstöckige, unverputzte Haus der Santels stand.
Die Mutter empfing ihn. Sie sagte kein Wort und sah ihn nur mit einem vorwurfsvollen Blick an, ihre Kopfbewegung bedeutete: Er ist im Patio. Juan ging in den schattigen Innenhof, in dem Hibiskus blühte, Rosmarin und Bärenklau dufteten und ein Bananenbaum wuchs, der sein ganzer Stolz war, denn er hatte ihn vor vier Jahren gepflanzt. Die Geschwister standen nebeneinander an der Wand und sahen ihm entgegen. Der Vater war eingenickt und saß unter den ausladenden Stauden. Juan sagte nichts und setzte sich ihm gegenüber auf den Boden.
Er sah den Vater unverwandt an. Plötzlich kam ihm der kleine Mann in dem halb geöffneten, verblichenen Hemd mit den dünnen Beinen, auf denen sich blaue Äderchen abzeichneten, der gebräunten, verbrauchten Haut und dem harten, stoppeligen Gesicht wie ein Fremder vor. Tiefe Furchen durchzogen seine Wangen, das schwarze Haar war schon gelichtet, die Schirmmütze zur Seite verrutscht. Er schnarchte plötzlich laut auf und erwachte davon.
»Ich bin zurück«, sagte Juan unsicher, aber mit desto festerer Stimme.
Der Vater wollte aufbrausen, aber dann blieb er sitzen und starrte den Sohn an. »Wo warst du?«
»In Palos. Bei der Abfahrt.«
In das Gesicht des Vaters zog etwas, das Juan noch nie gesehen hatte. »Ich wusste, dass du nicht zu halten sein würdest. Ich habe es die ganzen letzten Tage gewusst.«
Jetzt erkannte Juan, dass es Hilflosigkeit und Trauer waren, die seinen Vater befielen, weil er wusste, dass der Sohn ihm entglitt. Juan spürte plötzlich Mitleid, dann verhärtete er sich jedoch wieder und sagte stolz: »Ich werde bald fortgehen!«
Wieder wollte der Vater aufbrausen. Er sprang auf und hob den Arm zum Schlag, aber dann blieb er stehen und wandte sich schließlich ab, um die Vergeblichkeit seines Zorns zu bemänteln, und ging in dem kleinen Innenhof hin und her. Er hinkte dabei und schüttelte das linke Bein, es war ihm eingeschlafen. Juan empfand ein Gefühl von Macht. Er hatte keine Angst, er hatte den Punkt erreicht, wo der Vater keine Gewalt mehr über ihn besaß. Und als er das begriff, wurde er ganz weich. »Aber jetzt bleibe ich erst mal hier«, sagte er leise.
Und der Vater blieb stehen, sah ihn an und nickte, ohne lächeln zu können.
DER ZWEITE MORGEN
Diesmal hatte sich Juan besser vorbereitet. Und dazu gehörte auch, dass er sich von seiner Familie verabschiedete.
Am Abend vorher nach dem Essen, Mama hatte eine besonders leckere Urta in Ysop, Salbei und Lorbeer zubereitet, umarmte er der Reihe nach alle aus seiner armen, ratlosen Familie, auch den Vater, griff sich wortlos sein Bündel und verließ das Elternhaus – für immer, wie er dachte.
Er wollte nicht, dass ihn jemand begleitete, er fühlte überhaupt nichts. Später empfand er eine dumpfe Befriedigung. Weit nach Sonnenuntergang kam er in Palos an, sprang in einer kleinen, felsigen Bucht, zweihundert Meter vom streng bewachten Landungssteg entfernt, ins Wasser, schwamm hinüber zum Hafen, wobei er seinen Beutel aus Ziegenleder über dem Kopf balancierte, und turnte auf der dem Ufer abgewendeten Seite eines der siebzehn Schiffe, die in Palos de la Frontera auf den Morgen warteten, an der mit Algen verschmierten Ankerwinde empor auf die Teresa.
Niemand außer der Deckwache, die sich in diesem Augenblick am Bugsteven aufhielt, war an Bord, das wusste er. Die Mannschaft feierte Abschied in den Tavernen von Palos. Juan, im ganzen zurückliegenden Jahr noch ein Stück kräftiger, aber kaum größer geworden, schlich, nass wie ein Biber, übers Deck. Er nahm den Umriss des hoch aufgeschossenen Matrosen am Bug wahr, der unbeweglich zum Land hinüberschaute und etwas vom Lärm der feiernden Kameraden mitkriegen wollte.
Auf dem Schiff herrschte nur ein diffuses Licht, das von den flackernden Flammen in den eisernen Feuerrosten und Pechpfannen kam. Juan verlor deshalb schnell seine Angst, die frischen Wasserspuren auf den Planken könnten ihn verraten. Er kletterte lautlos wie ein Affe über die Treppenleiter nach unten in das Zwischendeck, in dem von achtern her der mit starken Tauen befestigte, sechseckige Ruderschaft hereinragte, überall verstreut lagen Handwerkszeug und Seile herum. Juan roch Tiere und bemerkte in einer Ecke einen mit Stroh ausgelegten Kral, in dem sich Schweine, Rinder und sogar ein Esel befanden. Die Tiere schienen stehend zu schlafen. Juan huschte weiter nach unten und befand sich nun im Bauch der Teresa, hier war der Laderaum, in dem er sich zu verstecken gedachte.
Er tastete im Dunkeln herum, trat auf etwas Weiches, das quiekend davonhuschte, schob sich an dickleibigen Fässern, Kästen und Paketen, Säcken und gefüllten Körben vorbei und stieß gegen einen massiven Holzsparren. In der hintersten Ecke zwängte er sich zwischen aufgeschichteten Ballen mit einem sich warm anfühlenden, flaumigen Stoff hindurch und ließ sich zu Boden gleiten. Er hielt den Atem an und lauschte. Nichts war zu hören außer einem hin und wieder ertönenden entfernten Scharren und Trappeln von Hufen.
Langsam wurde er ruhiger. Es hatte geklappt! Er war tatsächlich an Bord!
Juan versuchte, sich etwas mehr Platz zu verschaffen. Das gelang ihm allmählich, sodass er parallel zu den nach Meersalz und Pech riechenden Schiffsplanken sitzend die Beine ausstrecken und sich zur Not sogar hinlegen konnte. Als er so dasaß und in die Dunkelheit starrte, beschlich ihn plötzlich Unbehagen. Erst jetzt wurde er sich seiner Lage richtig bewusst.
Er würde wochenlang in diesem Laderaum zubringen, in Dunkelheit, stickiger Luft und umgeben von Ungeziefer. Wenn man ihn entdeckte, hatte man das Seemannsrecht, ihn als unerwünschten Eindringling einfach über Bord zu werfen. Entdeckte man ihn nicht, war es nicht sicher, ob er überlebte, bis man jenseits des Ozeans im Westen Land fand. Vielleicht würden Matrosen Wochen nach der Anlandung auf der anderen Seite der Welt bei der Reinigung des Schiffs seinen verschrumpelten Leichnam finden. Nein, dachte er, sie würden mich früher finden, denn ich würde stinken wie ein verfaulter Hering. Er schüttelte sich bei dieser Vorstellung. War es nicht Wahnsinn, was er sich in den Kopf gesetzt hatte? Juan versuchte, sich zu beruhigen. Er hatte es so gewollt, jetzt musste er es durchstehen.
Nahrung gab es hier unten vermutlich genug, schon beim Herumtasten hatte er ein paar Bananenstauden gefühlt, außerdem befanden sich Speck, harte Eier und Brot in seinem Beutel. Und wo sollte er seine Notdurft verrichten? Keine Angst, ich finde schon einen Platz, beschwichtigte er sich. Das Unterdeck ist groß genug, bestimmt zwölf mal dreißig Meter, und ich muss mich nur verstecken, wenn jemand kommt, um etwas zu holen, ansonsten kann ich mich bewegen. Ich werde dann schon sehen, von welchen Schätzen ich umgeben bin.
Allmählich fand er es sogar ganz behaglich. Die Luft war zwar stickig und verbraucht, aber es roch auch nach vertrauten Dingen, nach Teer, Fisch, Salzwasser, Leder und Holz. Er glaubte sogar, Branntwein riechen zu können, ein vertrauter Geruch aus Papas Nähe. Da sich seine Augen langsam in der Dunkelheit zurechtfanden, sah er plötzlich, dass von der Decke des niedrigen Unterdecks herab an Haken getrocknete Fische und sogar Hasen, Gänse und Fasanen hingen! Sein Herz hüpfte vor Freude, zur Not konnte er sich mühelos mit rohem Fleisch und Stockfisch über Wasser halten. Diese Einsicht war so beruhigend, dass Juan die Augen schloss und versuchte, es sich bequem zu machen. So vergingen einige Stunden. Schließlich schlief er ein.
Er wachte davon auf, dass jemand ihn trat. Aufschreckend merkte er aber, dass es nicht ein Jemand war, sondern ein Sack mit Walnüssen, der auf ihn herabgefallen war. Fluchend befreite sich Juan davon und wollte sich wieder beruhigt hinsetzen. Da erschrak er erneut heftig. Schläge erschütterten das Schiff, und von oben drangen laute Stimmen zu ihm herunter. Sie kamen näher! Juan duckte sich hinter den Ballen und Fässern. Als nichts weiter geschah, hob er vorsichtig den Kopf. Die Stimmen hatten sich wieder entfernt, und jetzt merkte er, dass es nicht mehr so war wie zuvor. Und dann begriff er – das Schiff bewegte sich! Es fuhr! Deutlich merkte er jetzt das Schwanken des Rumpfes und hörte knarrende Geräusche von der Ladung im Unterdeck.
Es überfiel ihn siedend heiß. Jetzt war es also so weit, das große Abenteuer begann. Er hatte es gewagt und war an Bord gegangen! Mächtiger Stolz erfüllte ihn, und er stand auf, reckte seinen noch jungenhaften, aber schon muskulösen Körper und spürte seine Kraft. Er krabbelte auf allen vieren über die Ladung nach vorn, griff sich zwei Bananen von einer Staude und verzog sich wieder in sein Versteck. Mit Genuss verzehrte er die noch grünen Früchte, sie schmeckten süß wie alle Wunder der fernen Kontinente. Fast so süß wie der Kuss des Mädchens, das unter den tausenden von märchenhaften Wunderwesen, die jenseits des Meeres gewiss warteten, für ihn bestimmt war.
Wenig später begann die Höhle, in der er lag, kräftiger zu schwanken. Juan wurde es mulmig. Zwar war er Seegang gewöhnt, aber im Mündungsgebiet des Rio Tinto erreichten die Wellen des Atlantiks nie große Gewalt. Das war jetzt auf offenem Meer natürlich anders. Juan wurde allmählich übel, aber er kämpfte dagegen an, sich übergeben zu müssen. Seitdem Fischer ihn nach seiner ersten Fahrt einmal mit Branntwein abgefüllt hatten und ihm danach tagelang zum Sterben zu Mute gewesen war, hasste er es zutiefst, zu erbrechen. Außerdem hätte der Geruch ihn womöglich verraten. So konzentrierte er sich, während der Schiffsbauch immer beängstigender unter ihm wegglitt, und er befürchtete, ins Leere abzusinken, in seine Erinnerungen, die er von den Tagen und Nächten auf dem Rio Tinto hatte. Er wusste, es war wichtig, bei Übelkeit auf See Horizont und Wellen vor Augen zu haben. Also stellte er sich beides vor und klammerte sich an seine Fantasie.
So saß er eine Weile verkrampft da, die Arme über dem Bauch verschränkt, und versuchte, gleichmäßig zu atmen. Er redete sich ein, wie sehr die Luft an Unterdeck nach Meer roch und wie erfrischend der Wind über ihn hinwegfächelte. Das Schiff schlingerte weiter, und die Ladung ächzte und stöhnte, als sei sie ebenfalls seekrank geworden. Kleine, liegende Fässer rollten auf großen, stehenden hin und her, Kisten stießen gegeneinander. Schließlich schlief Juan erneut ein.
Als er wieder erwachte, hatte sich nichts verändert. Es war stockdunkel, niemand ließ sich blicken. Seine Übelkeit war geringer geworden. Juan schluckte schwer. So oder ähnlich würde es ihm von jetzt an tagelang, wochenlang gehen. Er starrte in das Dunkel und spürte, wie sich eine Schlinge um seine Kehle zog und Tränen in seine Augen stiegen. Unwillkürlich schluchzte er auf, doch gleich beschimpfte er sich innerlich, nannte sich ein Muttersöhnchen und einen elenden Angsthasen, der nur zum Sardellenfang taugte. Er biss sich auf die Knöchel seiner Fäuste. Das half. Fuhr er etwa nicht über den Atlantik? Na also, das war die Hauptsache! Palos, Moguer und das ganze elende Festland mit seinen Plagen blieben endgültig zurück. Jetzt zählte nur eins, es ging Richtung Westen!
Die nächste Zeit verging in Ereignislosigkeit und Langeweile. Einmal kam jemand mit einer Fackel herunter, blieb jedoch auf der anderen Seite des Decks und schaffte einige Säcke nach oben. Durch die offene Luke fiel während seines Hantierens matte Helligkeit ein. Ein flüchtiger Geruch nach gebratenem Fleisch, Zwiebeln und Knoblauch reizte Juans Sinne. Er hörte Stimmen und Lachen. In der anschließenden Dunkelheit verlor Juan bald jegliches Gefühl für die Zeit, für Tag und Nacht. Wie lange waren sie schon unterwegs? Er wusste es nicht. Er versuchte, sich hin und wieder zu bewegen, um die erstarrten Glieder zu entlasten und das Blut zirkulieren zu lassen, machte rudernde Armbewegungen, holte sich Bananen und geräucherten kalten Speck und setzte sich wieder in seinen Winkel. Nach einer Weile meldete sich ein neues Gefühl, es war Durst. Und ein Gedanke stieg erst vage, dann wie ein Donnergrollen in ihm auf, er traf ihn plötzlich wie eine Explosion mit Funkenregen und allem Drum und Dran.
Er hatte nichts zu trinken!
Juan wollte es nicht glauben. Er schlug ein paarmal wütend mit dem Kopf gegen die Planken. Wie hatte er das übersehen können! Panik machte sich sofort in ihm breit. Er überlegte. Wie kam er an etwas Trinkbares? Fest stand, dass sich zwischen der Ladung Fässer auch Lederschläuche oder Schweinsblasen mit Trinkwasser befinden mussten, schließlich waren die Matrosen in der gleichen Lage wie er. Beruhige dich, redete er sich zu, ich werde Wasser auftreiben. Gleichzeitig schalt er sich erneut einen Narren und hätte voller Wut laut aufschreien können.
Mit neuem Mut begann er, das Unterdeck zu erkunden. Er war weitgehend angewiesen auf seine Hände, die Fässer mit einem Spundloch oder prall gefüllte Schläuche ertasten mussten. Mit den Augen nahm er nur eine dunkle Ansammlung unförmiger Dinge wahr, die ihren Inhalt nicht verrieten. Nachdem er eine Weile herumgekrochen war, meldete sich der Durst stärker. Und mit ihm die Angst. Wie, wenn jedes einzelne der siebzehn Schiffe nur bestimmte Dinge geladen hatte, die von Schiff zu Schiff ausgetauscht wurden? Dieses beispielsweise nur Nüsse, salzigen Stockfisch oder gepökeltes Geflügel? Dann würde er verdursten, oder er musste sich der Besatzung ausliefern.
Juan spürte kalten Schweiß im Gesicht und auf dem Rücken. Hektisch suchte er weiter und musste sich bald eingestehen, dass es an Unterdeck tatsächlich kein Trinkwasser gab. Offensichtlich bezog die Teresa das Wasser von den anderen Schiffen, wie sie diesen vielleicht im Austausch Getreide für Brotfladen lieferte, die an Deck zubereitet wurden.
Er kauerte sich in seiner Ecke zusammen und umklammerte seine Knie. Der Durst wurde immer unerträglicher. Wie lang hält man es ohne Wasser aus?, überlegte Juan. Er hatte einmal gehört, nicht so lange wie ohne Essen. Er riss sich zusammen und überlegte noch einmal, was er tun sollte, kam aber auf keine Lösung, allmählich verlor sein Verstand auch die Kraft, das Problem scharf und nüchtern zu sehen. Juan suchte noch einmal den Laderaum ab. Nichts. Da kam ihm ein Einfall. Er konnte ja das Blut der geschlachteten Tiere trinken. Schnell holte er aus seiner Ecke das Klappmesser und schnitt einer Gans in den Hals. Wie enttäuscht war er, als das Blut des Tieres nicht herausfloss, es war dick und stockig.
Juan begriff, dass er an Deck musste. Der Gedanke entsetzte ihn und beflügelte ihn gleichzeitig. Er konnte etwas tun, um der Langeweile und Einsamkeit zu entgehen! Unverzüglich setzte er seine Absicht in die Tat um und schlich über die Treppe zur Ladeluke, öffnete sie und lugte vorsichtig nach allen Seiten.
Es schien Tag zu sein, denn im Zwischendeck war nur der Rudergänger zu sehen, der den schweren, auch jetzt noch zu beiden Seiten mit Seilen gesicherten Ruderschaft in der Armbeuge hielt und durch ein Guckloch der mit Teer abgedichteten Ruderöffnung nach draußen sah. Hin und wieder bestätigte er einen Befehl, den er von der Brücke erhalten hatte.
Juan sah sich um und schlich zur anderen Seite, dort standen etliche Fässer. Und er hätte einen Luftsprung machen können, es waren Trinkwasserfässer! Bevor er eines am Spund öffnen konnte, sah er einen hölzernen Bottich, halb voll gefüllt mit der köstlichen Flüssigkeit. Juan stürzte sich darauf und schöpfte mit dem großen Löffel so viel von der Leben spendenden Flüssigkeit heraus, wie der Holzlöffel fasste. Seine Hände zitterten derart, dass er die Hälfte verschüttete.
Er hatte gerade drei kräftige Schlucke getrunken, als ihn von hinten starke Anne umfassten. Juan ließ, zu Tode erschrocken, den Schöpflöffel fallen und versuchte, sich zu befreien. »Sieh mal an, wen haben wir denn da!«, drang eine höhnische Stimme an sein Ohr.
»Lass doch los!«, keuchte Juan und warf sich hin und her, doch der Griff war aus Eisen.
»Ei, ei, dich kennen wir ja gar nicht. Handelt es sich dabei wohl um einen blinden Passagier? Ist doch nicht zu fassen.«
»Loslassen, Mensch!«, fluchte Juan. Er wehrte sich verbissen, aber der Angreifer besaß Bärenkräfte, seine langen Arme lagen wie ein Seemannsknoten um Juans Brust.
»Wirst du mir versprechen, dass du nicht wegläufst, Kleiner?«
Juan schluckte schwer. »Wohin sollte ich wohl flüchten?«
»Da hast du Recht, haha!«, lachte der andere und ließ ihn los. »Wohin solltest du wohl flüchten, was? Nun lass mal sehen, um wen es sich hier handelt.«
Juan drehte sich um und stand einem bulligen jungen Burschen im groben Leinenrock des Schiffsjungen gegenüber, der ihn unter seinem verwegen aufgesetzten Käppi aus bösartigen Augen anblitzte. Juan fielen sowohl die überaus kräftige Statur des Burschen auf, der kaum älter war als er, als auch die leuchtend rote, noch frische Narbe auf seiner rechten Wange.
»Ei, wer bist du also?«, wollte der andere wissen. »In Palos an Bord geschlichen, nein?«
Juan hatte gar keine Wahl, er musste gute Miene zum bösen Spiel machen. »Juan Santel, ich will mit in die Neue Welt, und ich nehme hier an Bord niemandem Platz weg.«
»Kennst du die. Gesetze der christlichen Seefahrt, Kleiner? Wir werfen blinde Passagiere mir nichts, dir nichts über Bord wie Abfall.«
»Ich kann arbeiten.«
»Wir brauchen niemanden.«
Dem Schiffsjungen schien eine Idee zu kommen. Er schielte zu dem Rudergänger hinüber, der jedoch nichts bemerkt zu haben schien, so sehr war er nach draußen orientiert. »Du hast dich unten zwischen der Ladung versteckt, richtig? Ganz schlau. Also komm, wir gehen runter.«
Misstrauisch sagte Juan: »Wieso? Ich denke, du willst mich über Bord werfen?«
»Frag nicht so viel, Mensch! Dafür ist immer noch Zeit. Vielleicht finden wir vorerst eine andere Verwendung für dich.«
Der Schiffsjunge stieß Juan die Treppe hinunter. Wütend wollte Juan sich wehren, ließ das aber. Damit konnte er nichts erreichen. Welchen Vorteil konnte sich der andere davon versprechen, seine Entdeckung vor der Mannschaft geheim zu halten? Juan traute dem Kerl nicht.
Unten angekommen, ließ sich der Schiffsjunge, der eine Fackel mitgenommen hatte, Juans Versteck zeigen. »Sieh an, sieh an, welch hübsches Nest«, faselte er mit einer näselnden Stimme und galizischem Dialekt, beides stand im lächerlichen Gegensatz zu seinem tumben Äußeren. »Setz dich!«, befahl er dann scharf. »Wir wollen uns unterhalten. Auf dem Kahn hier ist es sowieso langweilig, nur Säufer und Schläger. Du kannst mich ein bisschen ablenken.«
Was will er von mir, dachte Juan. Er beschloss, den Kerl bei der erstbesten Gelegenheit niederzuschlagen. Damit gewann er zwar nichts, aber er konnte sich den Burschen vom Leib halten.