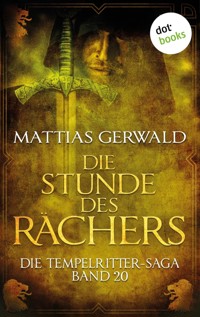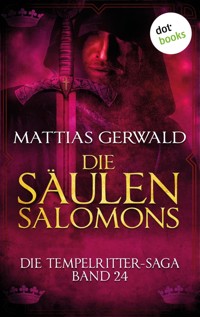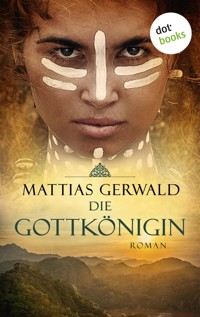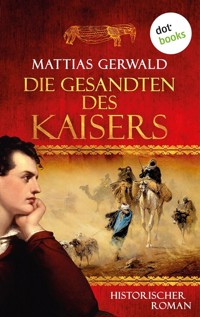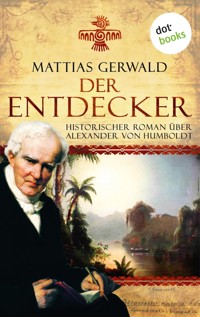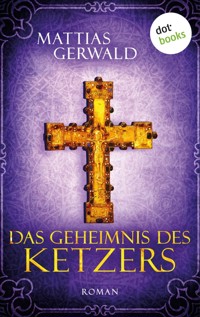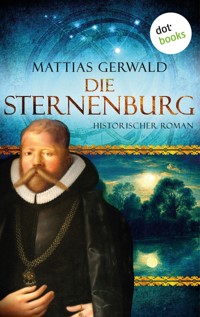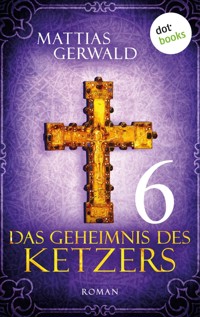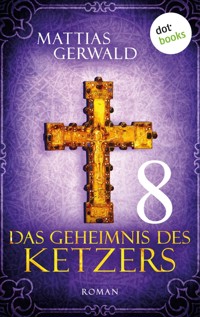Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tempelritter-Saga
- Sprache: Deutsch
"Er verstand die Evangelien als Heilsbotschaft, die in eine Welt der Schatten das Licht brachten.": "Die Tempelritter-Saga" – als eBook bei dotbooks. Ein dunkler Schatten liegt auf dem Leben des Tempelritters Henri de Roslin: Er wurde Opfer einer Verschwörung, was ihn tief verletzt hat. Deshalb reist er mit seinen Gefährten nach Zypern zum Grab des Heiligen Barnabas. Er erhofft sich Trost und Rat an dieser Ruhestätte, um sein eigenes Unglück zu vergessen. Doch als ein mysteriöses Schriftstück auftaucht, muss sich Henri die Frage stellen, ob sein bisheriger Lebensweg auf einer Lüge basiert: Angeblich handelt es sich um ein neues Evangelium, das der Apostel Barnabas vor seinem Tod verfasst hat. Um herauszufinden, was wirklich dahinter steckt, müssen Henri und seine Weggefährten eine harte Prüfung bestehen … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein dunkler Schatten liegt auf dem Leben des Tempelritters Henri de Roslin: Er wurde Opfer einer Verschwörung, was ihn tief verletzt hat. Deshalb reist er mit seinen Gefährten nach Zypern zum Grab des Heiligen Barnabas. Er erhofft sich Trost und Rat an dieser Ruhestätte, um sein eigenes Unglück zu vergessen. Doch als ein mysteriöses Schriftstück auftaucht, muss sich Henri die Frage stellen, ob sein bisheriger Lebensweg auf einer Lüge basiert: Angeblich handelt es sich um ein neues Evangelium, das der Apostel Barnabas vor seinem Tod verfasst hat. Um herauszufinden, was wirklich dahinter steckt, müssen Henri und seine Weggefährten eine harte Prüfung bestehen …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheint: »Novembermord«, »Engelmord«, »Regenmord« und »Frühjahrsmord«. Er lebt in Frankfurt am Main und in Nordhessen.
Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.
Bei dotbooks erschienen »Die Geliebte des Propheten«, »Das Geheimnis des Ketzers«, »Der Entdecker«, »Die Sternenburg«, »Die Gottkönigin«, »Die Gesandten des Kaisers« und »Die Hetzjagd«.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald auch folgende Bände:
»Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach Vineta«
»Die Tempelritter-Saga – Band 8: Das Grabtuch Christi«
»Die Tempelritter-Saga – Band 9: Der Kreuzzug der Kinder«
»Die Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des Rächers«
»Die Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2016
Dieses Buch erschien bereits 2006 unter dem Titel »Das neue Evangelium« bei Pabel-Moewig Verlag
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2015 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/LjubodragG und Kiselev Andrey Valerevich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-829-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Grab des Heiligen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elias Aimery
Das Grab des Heiligen
Die Tempelritter-Saga
Band 18
dotbooks.
ERSTER TEIL
1
Februar 1320. Im sicheren Hafen
Das mächtige Schiff lief in den Hafen von Lapethos ein. Es war voll beladen, im Frachtraum standen Fässer, Säcke und Karren dicht an dicht, darüber befand sich der Boden für die mitgeführten Pferde. Die Gäule hingen in Tragegurten, ihre Hufe berührten gerade noch die Bodenplanken. Die Leinen wurden ausgeworfen, dann kam der zitternde Schiffsleib zur Ruhe. Im gleichen Augenblick gingen Schwärme von Möwen auf Reling und Deck nieder. Die Matrosen schlugen mit langen Peitschen nach ihnen, und kreischend erhoben sich die Vögel wieder in die Luft und sprenkelten den strahlend blauen Frühlingshimmel.
Henri de Roslin stand mit seinen Gefährten Sean of Ardchatten, Uthman ibn Umar und Joshua ben Shimon an der Reling. Madeleine kam vom Unterdeck herauf, wo sie sich um eine kranke Reisende gekümmert hatte.
Die Gefährten schauten sich neugierig um, jede Ankunft hatte ihren eigenen Reiz. Kein Hafen glich einem anderen. Der hiesige zeichnete sich durch eine lange Mole aus, an der entlang schwarze, knarrende Holzkräne, die von Männern in Lauftrommeln angetrieben wurden, ihre Entladearbeit verrichteten. Am Ufer sahen die Freunde einen breiten Festungsbau aus dunklen Quadern, die kleine, uralte Stadt Lapethos duckte sich zu Füßen des dahinter aufragenden Gebirges, das rot leuchtete.
Die Gefährten hegten unterschiedliche Gefühle, während sie die Landschaft und das bunte Treiben am Hafen bestaunten. Was erwartete sie in Zypern? Decá tremer, das europäische Abendland, war weit, im Osten lag das Heilige Land, von den Christen Frankreichs auch Outremer genannt, die Provinz jenseits des Meeres. Zypern war noch immer ein Knotenpunkt zwischen den Kulturen, Religionen und Kontinenten.
Uthman und Henri waren beide schon auf Zypern gewesen. Joshua wollte von hier aus in den Nordosten der Insel reisen, wo es, wie er gehört hatte, eine versprengte jüdische Kolonie geben sollte. Außerdem war ihm der Besuch des Barnabas-Klosters, wonach Henri der Sinn stand, nicht geheuer, denn der Heilige sollte nach seiner Ankunft von zypriotischen Juden erschlagen worden sein. Uthman, Sean und Madeleine wollten hingegen bei Henri bleiben.
Der schottische Tempelritter hatte sich während der Überfahrt entschlossen, zum Grab des Apostels Barnabas zu pilgern und sich einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen.
Henri fühlte sich Barnabas im Geiste verbunden. Der Apostel war nach Christi Tod von Paulus verstoßen worden – wie die Templer von ihrem geistigen Vater, dem Papst. Barnabas wurde aus der Stadt gejagt, denn er war das Opfer einer Verschwörung geworden. Und als solches fühlte sich auch Henri. Wie Barnabas trug er die tiefe Wunde der Ungerechtigkeit in seinem Herzen. Am Grab des unglücklichen Apostels wollte er Trost und Rat suchen und sein eigenes Unglück vergessen. Danach würde er sich vielleicht in der Lage sehen, zu entscheiden, wie es in seinem Leben weitergehen sollte.
»Wir treffen uns auf der Karpasia-Halbinsel wieder«, sagte Joshua. »Dort gibt es ein Kloster, das dem heiligen Andreas geweiht ist und wo der vielleicht berühmteste christliche Kreuzfahrer, Richard Löwenherz, den Isaak Komnenos gefangen – aber das interessiert ja nun niemanden mehr. Ihr werdet mich dort im Kreis meiner jüdischen Brüder finden, wir werden für euch alle beten.«
»Ich denke, wir werden in zwei Monaten bei dir sein, Joshua!«, sagte Henri.
»Wo liegt diese Grabstätte des Barnabas?«
»Das Kloster des Heiligen befindet sich bei Enkomi nahe der Hafenstadt Famagusta, es ist im Osten der Insel. Von dort ist es nicht weit bis zur Nordspitze Zyperns, man muss keine hohen Berge mehr überwinden. Erwarte uns in etwa acht Wochen. In diesen acht Wochen erfüllt sich auf Zypern die alljährliche österliche Freudenzeit, das Pentekoste. Danach werden wir gemeinsam das Pessahfest begehen können.«
»Das wäre großartig!«, sagte Joshua.
»Auch ich freue mich auf das österliche Fest zu Ehren eures wichtigsten Propheten. Danach werde ich euch allerdings verlassen, meine Freunde«, sagte Uthman.
Die Gefährten blickten ihn bestürzt an. Dann sahen sie zu Madeleine hinüber. In ihrem Gesicht stand Trauer über die Unmöglichkeit ihrer Liebe zu Uthman. Es war ihr jeweiliger Glaube, Christentum und Islam, der die beiden unüberbrückbar voneinander trennte. Sie würden jeder ihren eigenen Weg gehen müssen. Madeleine überlegte, ob sie nicht vielleicht auf Zypern bleiben sollte.
»Ich kehre nach Syrien zu meiner Familie zurück, die ich sehr vermisse«, sagte Uthman. »Vielleicht für immer. Vielleicht auch nur vorübergehend. Allah weiß es.«
»So wird Zypern für uns zu einer Windrose werden, die uns vereint und dann in alle Himmelsrichtungen davonträgt?«, fragte Henri. Es hörte sich bekümmert an.
»Wir werden sehen«, entgegnete Uthman. »Wir sind frei, jeder von uns. Wenn wir uns dazu entscheiden, können wir auch zusammenbleiben. Ist es nicht gut, dass wir Herren unseres Willens sind?«
»Wir wandeln auf den Wegen des Herrn«, sagte Joshua leise.
»Ich weiß«, sagte Uthman. »Aber Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. So bleiben wir frei und befolgen doch die Gesetze, die uns gegeben sind.«
»Suchen wir uns erst einmal eine Herberge«, schlug Sean vor. »Beim Abendessen können wir weiterreden. Denn das letzte Wort scheint mir noch nicht gesprochen.«
»Ein kluger Knappe!«, scherzte Madeleine. Man merkte ihr aber an, wie traurig sie war.
*
In der Kirche mit dem frei stehenden Glockenturm hörten Henri, Sean und Madeleine die Messe und dankten dem Herrn für die reibungslose Überfahrt.
Es waren die Tage vor dem Beginn der Passionszeit Estomihi. Henri wusste, dass die byzantinische Ostkirche einen anderen Jahreskreis kannte als die Papstkirche in Rom, der er verpflichtet war. Er bewunderte die goldglänzenden Ikonen an den Wänden und im Altarraum, die von tausend Kerzen beleuchtet wurden. Und er lauschte den Gesängen in der Kirche. Henri unterschied acht kräftige, getragene Stimmen, jeweils in einer anderen Tonart. In diesen acht Kirchentonarten spiegelten sich die Wochen des Zyklus, der gerade begann. Sie vernahmen nun den ersten Ton im Gesang der schwarz gekleideten Priester und Mönche. Für Henri waren das keine fremden Töne. Und er dankte seinem Gott dafür, dass überall auf der Welt der Glaube lebendig war.
Neben sich vernahm Henri plötzlich einige Worte in deutscher Sprache. Als er zur Seite blickte, sah er einen weißhaarigen, aber noch jung wirkenden, drahtigen Mann, der ins Gebet vertieft war. Er hielt den Kopf gesenkt. Als die Gebete beendet und die Gesänge verstummt waren, begab man sich gemeinsam nach draußen, wo man auf Uthman warten wollte.
Der Deutsche war ein Pilger, der auch das Kloster des Barnabas aufsuchen wollte. Er hieß Ludolf von Suchen und kam aus dem Grenzgebiet zu Frankreich, weshalb er auch französisch sprach. Seit drei Monaten befand er sich schon auf Pilgerreise.
»Ich habe von einem neuen Evangelium gehört«, sagte Ludolf mit verschwörerischer Miene. »Ich will es studieren.«
»Ein neues Evangelium?«, fragte Henri verdutzt. »Davon ist mir nichts bekannt.«
»Und doch ist es so! Man hat einen Papyrus gefunden, der aus der Feder des Apostels Barnabas stammt. Von einem Augenzeugen Jesu, versteht ihr?«
»Das ist natürlich aufregend«, gestand Henri.
»Es entstand früher als die vier Evangelien. Barnabas wurde verstoßen, deshalb hat man auch seine Schriften vernichtet, die er hinterlassen hatte. Aber jetzt ist angeblich eine sehr bedeutende Schrift von ihm aufgetaucht. Und darin, meine Freunde, schildert er das Leben unseres Herrn Jesu aus nächster Nähe. Und er scheint ungeheuerliche Dinge aufgeschrieben zu haben. Dinge, die unseren Glauben völlig auf den Kopf stellen können – ja, die ihn sogar für falsch erklären!«
»Wer sagt so etwas?«, fragte Henri.
»Ich hörte es von Priestern in Nikosia. Alle sind beunruhigt, und doch wollen sie die neue Kunde nicht unterdrücken. Wenn es stimmt, was sie sagen, steht uns eine neue Weltzeit des Glaubens bevor. Und ich will unbedingt von Anfang an dabei sein! Ich will Zeuge der neuen Zeit sein!«
»Seid Ihr ein Ketzer, Ludolf?«
»Aber nein! Ich bin ein Wahrheitssucher! Die überlieferte Geschichte unseres Herrn Jesu kam mir immer schon merkwürdig unvollständig vor. Wenn es jetzt einen Bericht aus den Händen seines jüdischen Apostels und Begleiters Barnabas gibt, dann klärt sich sicher vieles auf. Vielleicht bestätigt sich auch alles, was wir bisher angenommen haben. Auch das ist möglich, und ich bin darauf vorbereitet. Ich will es jedenfalls ganz genau wissen.«
»Wir können zusammen reisen, Ludolf, denn auch ich will ins Kloster des Barnabas. Allerdings, von der geheimnisvollen Schrift wusste ich nichts!«
»Das konntest du auch nicht, mein Freund. Sie ist erst vor kurzem entdeckt worden. Die Mönche in Nikosia berichteten davon, aber auch sie kannten sie noch nicht. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass sie hier, auf Zypern, auftaucht. Denn diese Insel ist die vornehmste und reichste Insel, mit den gläubigsten Menschen, nicht zu vergleichen mit anderen Inseln des Meeres, und wegen ihrer Fruchtbarkeit auch nicht zu vergleichen mit anderen Orten rund um das Mittelmeer. Hier konnten sich Traditionen bewahren, weil hierher die größten und besten Geister Zuflucht gesucht und sich gegenseitig befruchtet haben. Die Kämpfe liegen jedenfalls lange zurück.«
»So lange ist das nicht her«, wandte Henri ein. »Nicht einmal eine ganze Generation.«
»Nun, es liegt zumindest weit genug zurück, um vergessen und vergangen zu sein«, sagte Ludolf von Suchen. »Und ich freue mich, dass ich nun Begleiter bekommen habe! Wir können unterwegs noch ausgiebig darüber sprechen, was uns im Kloster des heiligen Barnabas erwartet!«
Henri wusste noch nicht, wie er die Nachricht des Pilgers bewerten sollte. Eine neue Schrift des Apostels, die alles auf den Kopf stellte? War das nicht beängstigend? War es nicht besser, man achtete gar nicht darauf und glaubte an das, was man bisher wusste?
Henri schüttelte den Kopf, er war kein Revolutionär, der alles verändern wollte. Je älter er wurde, desto mehr schätzte er das Beständige. Er wollte festhalten, was ihm blieb.
Der Pilger ahnte, was in ihm vorging. Er fasste ihn am Arm und führte ihn mit sich. »Keine Angst vor der neuen Wahrheit! Sie wird den Ruhm unseres Herrn im Himmel nur stärken! Denn seine Macht ist unendlich! Vielleicht schwächt sie die Macht des irdischen Papstes und seiner ganzen Sippschaft – aber wäre das so schlimm, von Schmarotzern befreit zu werden?«
»Woher kommst du, Ludolf? Und warum interessieren dich diese Dinge?«
Ludolf lächelte breit. »Ich stamme eigentlich aus dem deutschen Westfalen, lebe aber seit zwanzig Jahren an der Grenze zu Frankreich. Zypern besaß für mich schon immer einen ganz besonderen Reiz. Es ist so schön und so reich einzigartig! Einmal hörte ich in der Heimat, dass ein Bürger seine Tochter nach Zypern verlobte. Die Ritter, die sie begleiteten, sagten, dass die Juwelen in ihrem Haarschmuck kostbarer seien als aller Schmuck der Königin von Frankreich. Und dann diese Anekdote: Ein Kaufmann aus Famagusta verkauft an den Sultan ein königliches Golddiadem mit nicht weniger als vier kostbaren Edelsteinen, einem Rubin, einem Smaragd, einem Saphir und einer Perle, für sechzigtausend Florin, doch sogleich bereut er das Geschäft und will das Diadem für einhunderttausend Florin zurückkaufen! Solche Anekdoten hörte ich immer mit Begeisterung. Denn ich liebe reiche Länder und reiche Städte!«
Henri war Reichtum gleichgültig, er verstellte nur den Zugang zum Reichtum des Himmels. Er wollte zu Ludolfs Worten eigentlich schweigen, entgegnete dann aber doch:
»Verzeih, aber für einen Pilger scheinst du ein ungewöhnlich starkes Interesse an irdischen Gütern zu hegen!«
»Aber nein«, wehrte Ludolf ab, »ich selbst besitze gar nichts! Aber ich höre gerne Geschichten vom Reichtum! Dagegen höre ich nichts gern, was mit Not und Armut zu tun hat.«
»Ich verstehe nicht, warum Zypern in den letzten Jahrzehnten derart zu Reichtum gekommen sein soll«, meinte Henri. »Als wir im Jahr des Herrn 1291 hierher kamen, war das Land arm – abgesehen von den prachtvollen Kirchen gab es nichts als unfruchtbaren Boden und viele Schafe.«
»Nun, das kommt daher, dass die Handelsschiffe aus dem Westen nicht mehr wagen, woanders als in Zypern ihre Geschäfte zu tätigen. Auch die Handelsschiffe aus Syrien kommen hierher. So machen die ehemaligen Feinde von gestern heute gute Geschäfte miteinander. Der Heilige Vater selbst drohte nämlich allen Kaufleuten mit der Exkommunikation, wenn sie nicht in Zypern anlegen, damit sollen sie Buße dafür tun, dass sie damals, als Akkon im Heiligen Land fiel, den Überlebenden nicht mit ihrer Flotte geholfen, sondern nur an ihre Geschäfte gedacht haben.«
»Ich weiß, welche Sünden die christlichen Händler damals begangen haben«, sagte Henri. »Ich habe es selbst miterlebt.«
»Weil Syrien, nur getrennt vom Meer, in der Nähe von Famagusta liegt«, erklärte der Pilger weiter, »schickten die islamischen Händler in den letzten Jahren ihre Waren nach Zypern. Um deren Verkauf kümmern sich hier spezielle Agenten. Die Schiffe aus Venedig, Genua, Florenz, Pisa und Katalonien werden nur noch hier beladen und fahren zurück in ihre Heimat.«
»Vielleicht entdeckt mein Gefährte Uthman bekannte Gesichter unter den Syrern«, sagte Henri
»Ist er Syrer?«
»Er war einst ein sarazenischer Krieger. Heute ist er ein Schriftgelehrter aus Cordoba.«
»Ich würde mich freuen, ihn kennen zu lernen. Und auch, seine Meinung zu dem neuen Evangelium zu hören! Denn es ist in arabischer Sprache abgefasst, und ein Araber kann uns sicher am zuverlässigsten sagen, was dort genau steht. Ich erwarte jedenfalls ungeheure Erkenntnisse! Ich spüre, dass die Dinge wieder in Bewegung kommen.«
Henri fühlte sich plötzlich unbehaglich. Was Ludolf ansprach, wollte er nicht wirklich hören. Er hatte keine Lust, seinen Glauben in Zweifel zu ziehen.
Doch dann gab Henri sich einen Ruck. Was veranlasste ihn bloß, so etwas zu denken? Konnte das Evangelium des Barnabas etwas verkünden, was die anderen Evangelisten nicht bereits verkündet hatten?
Wovor hatte er Angst?
Jedenfalls war es ein merkwürdiger Zufall, dass er den Plan gefasst hatte, zum Barnabas-Kloster zu reisen, ohne von der geheimnisvollen Schrift gewusst zu haben.
Henri fühlte sich irritiert – und war darüber sehr beunruhigt.
*
Der Pilger übernachtete am Stadtrand in einem Kloster der Georgsbrüder. Am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang wollten sich die Gefährten mit ihm treffen, um ihre Reise zusammen mit ihm fortzusetzen. Ihr jüdischer Freund Joshua würde sich dann von ihnen verabschieden.
Die Gefährten verbrachten den Abend und die halbe Nacht in angespannter Erwartung. Sie spürten, dass statt der ersehnten ruhigen und erholsamen Zeit auf dieser Mittelmeerinsel ein neues Abenteuer auf sie wartete. Und vielleicht ging es diesmal um etwas, das bedeutender war als alles, was sie bisher erlebt hatten.
Mitten in der Nacht hörten sie Rufe vor ihren Fenstern. Als Henri, der sich mit Sean ein Zimmer teilte, herausschaute und auf die Straße blickte, sah er Ludolf, der von fünf aufgeregten Mönchen begleitet wurde. Henri fragte den Pilger nach dem Grund der späten Störung, doch statt ihm zu antworten, bat Ludolf, hinaufkommen zu dürfen.
»Ich komme hinunter, sonst weckt ihr noch alle Gäste auf«, sagte Henri.
Als er unten stand, stellte ihm Ludolf die Mönche vom Georgsorden vor. Ihr Anführer, ein braun gebrannter, kräftig gewachsener Mann, sprach französisch. Er erklärte Henri, weshalb sie in heller Aufregung waren.
»Wir fragen uns, wer ihr seid! Ihr seid Fremde, und in deiner Begleitung befinden sich ein Ungläubiger und ein Jude! Und du kommst von weit her, um dieses Kloster im Norden aufzusuchen! Und zur gleichen Zeit taucht diese Schrift auf, die alles in Frage stellt, was wir bislang glaubten! Was habt ihr mit dieser Sache zu schaffen?«
Henri schüttelte den Kopf. »Nichts. Ich wusste bis zum heutigen Tag nichts von dieser Schrift, von der ihr sprecht. Ich habe erst durch Ludolf davon erfahren. Fragt ihn! Alles, was ich von der Schrift des Barnabas weiß, weiß ich von ihm.«
»Das sollen wir euch glauben? Ist es nicht vielmehr so, dass ihr aus geheimen Quellen von der Existenz dieser Schrift wisst und sie sehen und anbeten und damit ketzerisch die Kirchenfundamente ins Wanken bringen wollt?«
Henri blickte Ludolf von Suchen an. »Hast du ihnen einen solchen Unsinn erzählt?«
Der Pilger blickte sehr ernst. »Nein, natürlich nicht. Wir sprachen über unverfängliche Dinge, über den Reichtum dieser Insel, über sagenhafte Schätze in den Katakomben der Kirchen und Klöster. Plötzlich kam die Rede auf das Kloster des heiligen Barnabas, und die Mönche gerieten außer sich.«
»Ist das die Wahrheit?«, fragte Henri den Anführer streng.
»Die Wahrheit, die Wahrheit! Was ist die Wahrheit? Wenn Gott, der Herr, die Posaunen zum Jüngsten Gericht blasen lässt, dann erfahren wir die ganze Wahrheit. Vorher nicht.«
»Eine sybillinische Antwort, Mönch«, sagte Henri wütend, »ich schätze es nicht, verdächtigt und angefeindet zu werden. Geht zurück in eure Klosterzellen. Wir sind rechtschaffene Leute und wollen in Ruhe schlafen.«
»So schwört Ihr bei Gott, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Eurer Absicht, das Kloster des unglückseligen Barnabas aufzusuchen, und dem plötzlichen Auftauchen dieser ominösen Schrift?«
»Ich muss mich nicht verteidigen und nichts beschwören«, erwiderte Henri.
»Es würde uns aber beruhigen«, sagte der Mönch. »Und es würde euren weiteren Aufenthalt erleichtern.«
»Wie meint Ihr das? Wir reisen im Morgengrauen ab.«
»Wenn ihr Ketzer seid, die einen Aufruhr gegen die orthodoxe Amtskirche planen, dann seid ihr des Teufels!«, fauchte der Mönch. »Und dann hetze ich euch die Behörden auf den Hals!«
Henri hielt den Atem an. Er ermahnte sich, vorsichtig zu sein, denn er trug die Verantwortung für seine Gefährten. Er blickte auf Ludolf, der einen verlegenen Eindruck machte, und sagte dann mit ruhiger Bestimmtheit:
»Ich habe mit diesem Papyrus nichts zu tun. Wenn dieses neue Evangelium Dinge enthalten sollte, die unseren Glauben in Frage stellen, dann bin ich davon genau so betroffen wie jeder rechtschaffene Christ. Hütet euch davor, Menschen zu verdächtigen, die ihr nicht kennt!«
»Aber versteht doch«, sagte der Mönch beinahe flehentlich. »Wir sind in höchster Sorge. Ein solches Evangelium kann von Satan selbst in die Welt gesetzt worden sein! Und seine bösen Engel bereiten überall den Boden vor für den Umsturz! Schon verdunkelt sich ja der Himmel, und es beginnt zu regnen und zu stürmen! Wir haben Angst! Ist es nicht verständlich, dass wir in euch Boten des Bösen sehen, die gekommen sind, die Lügen des neuen Evangeliums zu verbreiten?«
»Das mag verständlich sein. Aber ich sage euch, wir haben mit diesen Dingen nichts zu tun. Gebt euch damit zufrieden.«
»Das genügt uns nicht!«
Henri holte tief Luft. »Wir reisen mit Ludolf von Suchen, er kann euch erzählen, was es mit diesem neuen Evangelium auf sich hat. Er erfuhr zuerst davon. Was mich betrifft, ich suche im Kloster des Barnabas Ruhe und Frieden. Ich befinde mich auf einer Pilgerreise, denn ich fühle mich diesem Apostel aus verschiedenen Gründen eng verbunden. Das wird euch genügen müssen. Und nun, gute Nacht!«
Henri machte auf dem Absatz kehrt und ließ die Gruppe stehen. Auch Ludolf würdigte er keines Blickes mehr.
Aber Henri fand während der restlichen Nacht nicht mehr in den Schlaf. Er fragte sich ständig, ob seine Ankunft in Zypern zu ebendieser Zeit womöglich kein Zufall war. Hatte Gott, der Herr, oder eine andere Macht – Henri wagte nicht daran zu denken, welche das sein konnte – ihn dazu auserkoren, ein Todesengel zu sein? War er, ohne es zu ahnen, der Bote einer neuen, unheiligen Zeit?
Henri erschauerte. Nein, so hatte er sich seinen Aufenthalt auf Zypern, dem letzten Stützpunkt seines geliebten Tempelordens, nicht vorgestellt.
2
Februar 1320. Auf schwankendem Boden
Als die Gefährten am nächsten Morgen weiterreisen wollten, war die Sonne bereits aufgegangen. Man wartete noch auf Ludolf von Suchen und fragte sich, ob der Pilger vielleicht allein aufgebrochen war, weil er Vorwürfe von Henri fürchtete. Henri schickte den Sohn des Wirtes als Boten ins Kloster, um sich nach Ludolfs Verbleib zu erkundigen. Während sie warteten, besprachen sie noch einmal die Lage. Henri überlegte, ob er auf den Besuch des Klosters nicht verzichten sollte, um weitere Unruhe zu vermeiden. Aber Joshua bestärkte ihn in seiner Absicht.
»Wenn du dich prüfst, dann weißt du in deinem Herzen, dass du mit diesen Dingen um das mysteriöse Evangelium nichts zu tun hast, Henri«, sagte er. »Also lasse dich davon nicht abbringen. Es sähe wie ein Schuldeingeständnis aus.«
»Und ich bin auch sehr neugierig auf das Kloster – ganz gleich, welche Geheimnisse es bergen mag«, gestand Henri. »Immerhin befinde ich mich auf Pilgerschaft.«
Während die Freunde sich unterhielten, ging Uthman hinaus. Er setzte sich auf eine Bank vor das Gasthaus und blinzelte in die Sonne. Er dachte darüber nach, was der Pilger von den syrischen Händlern erzählt hatte. Konnte er Kontakt mit ihnen aufnehmen, damit sie ihn auf ihren Schiffen in die Heimat brachten? Uthman beschloss, es in Famagusta zu versuchen, in dem großen Hafen, der an der Ostküste lag, Syrien am nächsten.
Als Uthman aufblickte, trat ein Fremder auf ihn zu. Uthman kannte ihn nicht. Er war groß und hager, ein weißes Tuch verdeckte Frisur und Stirn.
»Gott zum Gruß!«, sagte der Fremde.
Uthman nickte freundlich und blickte den Mann arglos an.
»Ich sah dich hier sitzen«, sagte dieser.
»Mit Verlaub, das ist keine Kunst, ich genieße die Sonne«, erwiderte Uthman.
»Es ist keine Sünde, durchaus nicht«, sagte der Fremde. »Den Winter über hat sie nicht häufig geschienen.«
»Ja, ja, das Wetter«, sagte Uthman ein wenig spöttisch.
»Du – du siehst so sarazenisch aus«, sagte der Fremde plötzlich mit einem leicht drohenden Unterton in der Stimme.
»Man kann nicht sarazenisch aussehen«, erwiderte Uthman.
»In meinen Augen schon. Du beispielsweise siehst sarazenisch aus.«
»Sarazenen sind keine Rasse, sie gehören einem Stamm an, der seine Heimat in Sinai hat. Nur die Kreuzfahrer konnten sie nicht von allen anderen Arabern unterscheiden. Ebenso wenig könnte ich behaupten, du würdest so abendländisch aussehen.«
»Spitzfindig, mein Freund! Deine Nase ist lang und gekrümmt, deine Augen dunkel, dein Haar wild und schwarz, deine Gestalt sehnig und kräftig. Und in deinem Gürtel steckt ein Krummschwert. Also bist du ein Sarazene.«
»Ihr seid kein besserer Beobachter als ein Kind, mein Freund«, erwiderte Uthman unwillig. »Denn jedes Kind würde diese Beschreibung abgeben. Doch wisst Ihr, wie es in mir aussieht?«
»Warum sollte ich das wissen? Wenn du ein Sarazene bist, dann ist es in dir schwarz wie in einer mondlosen Nacht. Sonst gibt es da drinnen nichts.«
»Ihr wollt mit mir streiten? Ihr sucht Händel?«
»Aber nicht doch. Du sollst lediglich meine Frage beantworten. Ich schätze es nicht, wenn man das nicht tut.«
»Und ich schätze es nicht, von einem Fremden angesprochen zu werden, der sich nicht einmal vorstellt.«
»Mein Name tut nichts zur Sache. Was tust du in Lapethos?«
»Was jeder hier tut – ich atme.«
»Weiter!«
»Ich sehe.«
»Was noch? Was führst du im Schilde?«
»Ich beabsichtige, aufdringliche Fragesteller in fünf Stücke zu hauen – mit meinem sarazenischen Krummschwert, an dem bereits das Blut einhundert anderer Menschen klebt, die nicht wussten, wann der Fragerei ein Ende sein sollte.«
Der Mann stutzte. Dann sagte er: »Du bist frech!«
»Und du kannst mich mal, Fremder!«
Uthman stand auf und ließ den Mann einfach stehen. Er ging in das Gasthaus, dessen Eingang mit einem Vorhang verhängt war. Uthman hatte gesehen, dass in der Ferne Ludolf von Suchen mit seinem Gepäck aufgetaucht war. Uthman wollte den Freunden seine Ankunft melden.
*
Im Palast des französischen Konnetabels von Lapethos ging es hoch her. Der Statthalter Guido von Zypern war an diesem Morgen gezwungen gewesen, einen Vertreter der griechischen Regierung zu maßregeln. Es hatte einen heftigen Streit gegeben, Guido war noch immer erhitzt.
»Sie nennen uns schlichtweg Franzosen, egal, woher unsere Leute kommen, die seit den Kreuzzügen hier geblieben sind!«, rief Guido. »Wir können Franzosen, Venezianer, Genueser, Bretonen oder Provenzalen sein! Aber das schert sie nicht im Geringsten. Sie machen überhaupt keinen Unterschied. Darin drückt sich ihre Geringschätzung aus. Ich werde mir eine solche Behandlung nicht bieten lassen!«
»Konnetabel!«, sagte sein Berater, ein noch junger Mann mit dunkler Haut, »Ihr habt Recht! Und doch schlage ich vor, das auf sich beruhen zu lassen, denn einen Streit mit den einheimischen Behörden kann das Herrscherhaus der Lusignans sich nicht erlauben.«
»Es würde meinem verehrten Bruder, unserem König Heinrich, und seiner hochedlen Gattin Constanze von Aragon gefallen, wenn wir die Macht, die wir besitzen, auch deutlich machen«, sagte der Konnetabel. »Den Lusignans hat es immer gefallen, kraftvoll aufzutreten. Wer Kompromisse sucht, ist immer auf der schwächeren Seite.«
»Aber die Wirkung kann verheerend sein!«, warf der Berater ein. »Außerdem hat Guido von Lusignan Zypern damals nur gekauft, um ein Stück Land zu haben, und seinen Nachfolgern ist gleich, was hier geschieht.«
»Er hat sie von den Templern gekauft, denen Zypern einst gehörte, das ist wahr«, sagte der Konnetabel. »Aber als angeheirateter König von Jerusalem brauchte er einen starken Herrschersitz, und es war ihm nicht egal, welche Verhältnisse er hier vorfand, er hat sie stark geprägt. Und die nachfolgenden Lusignans haben durchaus ein großes Interesse daran, was hier geschieht! Zypern ist inzwischen zum wichtigsten französischen Staat im Osten geworden, und wir sind seine Vertreter! Ich muss mein Haus lenken, Montfort, sonst nichts. Wenn hier alles aus dem Ruder läuft, wird es dem König auch nicht gefallen. Also greife ich lieber durch.«
»Das zu Recht, Herr Guido, denn in Zypern rumort es. Die Zustände hier auf der Insel erinnern mich immer an ein tosendes Meer bei heftigem Gewitter. Nach aufgewühlter See kommen irgendwann Meeresruhe und Windstille, doch auf Zypern vergrößert sich das Unglück mit jedem Tag und nimmt kein Ende. Hierher spült es die unseligsten Existenzen.«
»Ihr redet blumig, mein Montfort! Aber wozu haben wir unsere tausend Büttel auf der Insel, die in unserem Auftrag alles, was es zu wissen gibt, auch wissen? Wir haben alles unter Kontrolle!«
»Ihr gebt mir da ein hervorragendes Stichwort, Herr Guido! Einer unser Zuträger hat uns gestern Seltsames berichtet.«
»Einer mehr, der seltsame Dinge zu berichten weiß. Manchmal habe ich den Eindruck, Zypern wird tatsächlich zu einer Art Hexenküche, in der jeder einen heißen Brei kocht! So viele Begehrlichkeiten …«
»Dieser Mann berichtet, im Hafen seien vier seltsame Gestalten von Bord gegangen.«
»Die vier Evangelisten im neuen Gewand!« Guido lachte über seinen eigenen Scherz.
»Es war auch eine Frau dabei, Herr Guido.«
Der Konnetabel leckte sich die Lippen. »Das ist natürlich immer interessant. Woher kamen sie?«
»Aus Westen. Die Nef hat ihren Heimathafen in Genua.«
»Aus Italien also. Ein Handelsschiff, nehme ich an.«
»Es brachte Öl, Wein, Getreide, Salz und Tuche. Und es fährt in zwei Tagen zurück mit Gewürzen, Seide, Teppichen, Parfüm, Johannisbrot und Weihrauch.«
»Die üblichen Frachten. Und was ist das Seltsame an der Ankunft dieser Leute?«
»Nun, erstens – sie bleiben. Zweitens kennt ihr die Nachrichten aus unserer Heimat, Konnetabel! Dort hat man sich des Problems längst entledigt. Doch auf Zypern ist das Andenken an diese Brut noch immer höchst lebendig. Ihr wisst, was ich meine.«
»Ihr meint die Templer?«
»So ist es!«
»Gebt Euch nicht so geheimnisvoll! Was ist mit den Templern?«
»Ihr wisst, dass der Orden seinen Hauptstützpunkt auf Zypern hatte, hier war die letzte Bastion nach dem schrecklichen Verlust des Heiligen Landes.«
»Ja und?«
»Die Krone hat früher mit den Templern sympathisiert. Im Heiligen Land war sie sogar eng mit dem Orden verbunden, ich erinnere nur an Euren weitläufigen Verwandten, König Guido von Lusignan und den Tempelgroßmeister Gerard von Ridefort – sie waren ein Herz und eine Seele. Beide trafen in Jerusalem im Schatzraum des Heiligen Grabes öfter zusammen als der Kronrat. Nur Guido, der Patriarch, und der Großmeister des Tempelordens besaßen die Schlüssel zu diesem legendären Schatz!«
»Jaja, das weiß ich doch alles! Es steht in unserer Familienchronik. Worauf wollt Ihr hinaus? Kommt endlich zur Sache!«
»Einen Moment Geduld, Herr Guido! Ich bin gleich am entscheidenden Punkt angelangt. Was ich sagen will, ist Folgendes: Das Herrscherhaus der Lusignans war immer mit dem Großorden vom Tempel verbunden. Jetzt, nach der Zerschlagung des Ordens, müssen wir mit diesem Kapitel unserer Vergangenheit behutsam umgehen. Die Templer gelten nun als Verräter und Königsmörder, ja sogar Papstmörder. Sie sind wahre Teufel!«
»Ja und?«
»Kurz und gut – die vier Männer, die von der Nef an Land gingen, könnten die Königsmörder sein!«
»Was?«
»Ja. Auf ihren Anführer, einen großen bärtigen Mann mit dunkler Stimme, passt die Beschreibung ebenso wie auf seine beiden erwachsenen Begleiter. Der eine ist offensichtlich sarazenischer Herkunft, der andere ein Jude. Die beiden anderen spielen keine Rolle, ein Junge und eine junge Frau.«
»Von wem kommen diese Informationen? Ist es ein Mann, dem wir trauen können?«
»Der Hafenmeister, Ihr kennt ihn, Herr Guido.«
»Voltero, er irrt sich nicht.«
»Eben.«
»Wie hießen diese Männer doch gleich, die in Frankreich zu Ungeheuern geworden und der gerechten Strafe nur mit Unterstützung des Teufels entkommen sind?«
»Henri de Roslin, schottischer Tempelritter, der letzte Überlebende des Ordens, von dem wir Kenntnis haben. Uthman ibn Umar, sarazenischer Kämpfer und Schriftgelehrter aus Cordoba. Und Joshua ben Shimon, jüdischer Schriftgelehrter, der in letzter Zeit oft in Toledo gesehen wurde.«
»Mein Gott, wenn sie es wirklich wären!«
»Die Frage ist: Was machen sie in Zypern? Was haben sie vor?«
»Schickt einen fähigen Büttel! Wir müssen es unbedingt herausfinden! Und wir müssen ihnen auf Schritt und Tritt folgen! Ich kann mir nicht leisten, dass es hier auch nur die geringste Unruhe gibt! Andererseits wäre es ein enormer Erfolg für uns, wenn wir diese gesuchten Verbrecher zur Strecke bringen könnten!«
In das Gesicht des Beraters zog ein feines Lächeln. Er verbeugte sich tief und zog sich rasch zurück. Als er den Empfangsraum des Konnetabels verlassen hatte, stand er einen Moment wie erstarrt.
Schließlich fluchte er leise vor sich hin und spuckte aus.
*
Als Ludolf endlich eingetroffen war, konnten die Gefährten ihr restliches Gepäck verstauen. Ihre Pferde hatten sie bei einem Stallbesitzer gegen gedrungenere, kräftigere Tiere eingetauscht, die für die Anforderungen, die die hiesige Landschaft stellte, besser geeignet waren. Die neuen Pferde glichen eher zähen Maultieren, denen auch das Steigen auf Felsenhöhen nichts ausmachte.
Uthman erzählte den anderen von dem Mann, der ihn vor dem Gasthof angesprochen hatte. Er lungerte noch immer dort herum. Im Moment stand er im Schatten einer Palme und starrte zu den Freunden herüber.
»Soll ich mich näher mit ihm befassen?«, fragte Uthman.
»Hältst du ihn für gefährlich?«, wollte Henri wissen.
»Ich traue ihm nicht. Es war nicht nur Neugier, die ihn bewogen hat, mich anzusprechen. Vielleicht handelt er in irgendjemandes Auftrag.«
»Oder er ist ein Büttel der Regierung. Ich denke, wir sollten ihn ignorieren. Wir machen uns einfach auf den Weg aus den Augen, aus dem Sinn!«
»Aufsitzen! Es geht los!«, rief Sean übermütig. »Endlich sind wir wieder unterwegs!«
Die Gefährten ließen ihre Pferde antraben. Als sie an dem mysteriösen Fremden vorüberritten, senkte dieser den Blick und wandte sich ab. Uthman grüßte ihn mit ausladender Geste, dann stieß er einen Schrei aus und gab seinem Tier die Hacken. Der Fremde blieb zunächst bei der Palme stehen, doch als sich die Gefährten nach einer Weile umblickten, sahen sie ihn nicht mehr.
Sie passierten die Stadttore von Lapethos, und kurze Zeit später ritten sie durch die weite Landschaft jenseits der Hafenstadt.
Henri hatte geplant, die Küste entlang nach Osten zu reiten. In der Nähe des Klosters von Antiponitis, wo es bei Kalogräa eine Senke gab, würden sie sich südlich halten, um die beiden Gebirgshälften von Pentadaktylos zu umgehen. Bei der Halbinsel von Karpasia würde sich Joshua dann von ihnen trennen. Die anderen würden weiterreiten, bis sie das Gebirge von Messaoria erreichten, das sie durchqueren mussten. Von dort ging es geradewegs nach Osten, in Richtung Enkomi und Salamis, den alten Stätten der Antike. In Salamis war Barnabas gesteinigt worden.
Es zeigte sich, dass ihre neuen Pferde den landschaftlichen Verhältnissen hervorragend angepasst waren. Und das war gut so, denn der Boden war karstig, von Steinen übersät, Flechten und festes Buschwerk erschwerten das Vorankommen. Dann erreichten sie einen Pfad, der von Kaufmannszügen genutzt wurde. Das Meer zur Linken, das Gebirge zur Rechten, trabten sie dahin.
An den Hängen des Gebirges erblickten sie imposante Klöster, von denen einige von zypriotischen Juden erbaut worden waren. Joshua betrachtete die Bauten neugierig. Henri wollte aber nicht anhalten. Sie hatten einen weiten Weg vor sich.
Ludolf sprach von der Pilgerschaft im Allgemeinen und erzählte von den hiesigen Mönchsorden. Zypern schien geistliche Orden geradezu anzuziehen. Unter der Herrschaft des Hauses Lusignan waren zuerst die Augustiner nach Zypern gekommen, danach die Prämonstratenser, deren Ordensregel großen Einfluss ausübte. Sie besaßen das vom König verliehene Privileg, außerhalb ihrer Klöster zu Pferd ein goldenes Schwert und goldene Sporen zu tragen.
»Das klingt nicht nach Askese!«, rief Uthman. »Ich dachte immer, die französischen Mönche seien mönchischer als alle anderen.«
»Diese hier nicht! Man beklagt sich sogar darüber, dass sie ihre Messen nicht mehr halten, dass Frauen mit ihnen im Kloster leben und dass die Einkünfte solcher Klöster für ihre Kinder bestimmt sind.«
»Dann werden die Klöster weder nach griechischen noch nach lateinischen Regeln geführt«, sagte Henri, »sondern eher nach türkischen oder arabischen!«
»Ein Mönch erzählte mir einmal, einige Brüder besäßen drei Frauen«, bestätigte Ludolf.
»Eine weniger, als ein Muslim besitzen darf, wenn er alle gleich behandelt und für sie aufkommen kann«, warf Uthman ein.
Sie ritten weiter. Ludolf war ein angenehmer Begleiter. Er konnte unterhaltsam plaudern und erzählte interessante Geschichten. So verging der erste Tag wie im Flug. Als sie am Abend einen Rastplatz aufsuchten, von dem aus sie über das silbern funkelnde Meer blicken konnten, erzählte Ludolf auch von seiner eigenen Pilgerschaft.
»Ich bin auch schon nach Spanien gepilgert, nach Compostella, wo die Gebeine von Jakobus dem Älteren gezeigt werden. In Jerusalem errichteten sie ihm zu Ehren eine Kirche. In Spanien stand der Bruder des Apostels Johannes, der als Jünger Jesu zu dessen innerem Kreis gehörte, lange im Schatten des heiligen Georg, aber jetzt verehren sie ihn alle. Ich war auch in Rom und in Jerusalem, wo ich das Pessahfest feierte.«
»Hast du dort auch das Mazzot gefeiert, Ludolf?«, fragte Joshua.
»Nein. Was ist das?«
»Im Unterschied zum Pessah, das die ganze Familie feiert, ist Mazzot ein Wallfahrtsfest. Alle Männer sind verpflichtet, einmal im Jahr zur Gerstenernte zu ihrem Heiligtum zu pilgern. Für uns Juden war der Tempel von Jerusalem das Urheiligtum, heute sind wir in alle Welt verstreut, und wir haben in allen Ländern heilige Stätten.«
»Ich pilgere zum Barnabas-Kloster, weil ich dort Trost für mich erhoffe«, bekannte Henri. »Ich erfülle damit keinen Auftrag. Ich verurteile die übertriebene Verehrung von Reliquien, wenn dadurch der Blick auf den wahren Glauben zu Gott verstellt wird.«
»Aber die Reliquien der Heiligen sind Überreste von Vorbildern, die zur Imitatio anregen«, sagte Ludolf. »Die Heiligen gelten in besonderer Weise als Freunde Gottes, von ihm erwählt und zu lebendigen Zeichen und Zeugen seiner Gnade berufen – wir wollen diesen Reliquien der Heiligen natürlich nahe sein, weil wir damit dem Herrn nahe sind.«
»Man soll die Heiligen ruhig anrufen und um ihre Fürsprache bitten«, meinte Henri. »Aber es darf nicht geschehen, dass die Fürsprecher bei Gott zu Helfern werden, die insgeheim Macht ausüben. Ich habe schon oft extreme Auswüchse der Reliquienverehrung erlebt. Man sammelte wahllos Knochen, die für viel Geld an naive Pilger verkauft wurden, und unaufhörlich wurden irgendwelche Feste gefeiert. Heiligenkulte können seltsame Blüten treiben. Oder nehmen wir den Ablasshandel. Wo bleibt da Gott?«
»Das sind wirklich unangenehme Auswüchse«, gab Ludolf zu. »Heiligenfeste und Reliquienverehrung dürfen selbstverständlich nicht überhand nehmen und die eigentlichen christlichen Feste verdrängen. Aber manchmal hilft der schlichte Glaube, damit die Wallfahrer sich besser fühlen. Ich werde bald die Reliquien des Apostels und Märtyrers Barnabas schauen und mich ihm nahe fühlen, das ist doch wunderbar!«
Doch Henri überhörte diesen Einwand. »Mich stören auch die falschen Propheten, die sich überall breit machen«, sagte er stur. »Mir sind schon zu viele davon begegnet. Vor allem in Verbindung mit Aufrufen zu neuen Kreuzzügen sprießen immer wieder Propheten wie Pilze aus dem Boden. Sie predigen Ehre und meinen eigentlich nur Ruhm und Reichtum, sie prophezeien himmlischen Lohn, meinen aber irdischen, und wer ihnen unbequem wird, den bekämpfen sie.«
»Das haben wir tatsächlich ein paar Mal erlebt«, bestätigte Madeleine, »und ich denke mit Schrecken daran zurück.«
»Auch ich habe solche Männer schon predigen hören«, meinte Ludolf, »und, wie ich gestehe, sie haben mich zutiefst bewegt.«
»Ergriffenheit ist nützlich«, meinte Henri. »Aber sie macht mir auch Angst. Wie in Avignon, wo der Papst zum Kreuzzug aufrief und Tausende wie aus einem Mund Deus le volt brüllten, Gott will es! Ein gigantisches Schwert schien durch die Luft zu sausen. Man umdrängte den Papst und bat kniend um seine Einwilligung, am ›heiligen Krieg< teilnehmen zu dürfen. Ein ebenfalls auf die Knie gesunkener Kardinal betete im Namen der versammelten Menge das Confiteor, das Schuldbekenntnis, und alle sprachen ihm die Worte unter Tränen oder von Zuckungen geschüttelt nach. Auch Kinder waren dabei. Ich habe einen Kinderkreuzzug begleitet, der von Marseille aus ins Heilige Land führte und in einer Katastrophe endete. Ich bin geheilt von tiefer Ergriffenheit, wenn Menschen sie erzeugen. Ergriffen bin ich allein von der Gegenwart Gottes.«
»Nun ja, man glaubt bei solchen Anlässen natürlich an die Gegenwart Gottes!«, sagte Ludolf. »Wenn Prediger reden, dann glauben die Leute nicht selten, Gott zu vernehmen, und wenn es nur sein Flüstern ist.«
»Ich sah einen Prediger mit langen weißen Haaren und einem ebensolchen Bart, bei dessen Auftreten sich die Menge sogar um ein Haar seines Esels raufte, um es als heiligen Schatz aufzubewahren«, erinnerte sich Joshua.
»Andere zeigten Briefe vor, die angeblich Gott persönlich geschrieben hatte«, sagte Henri. »Und Städte bekriegten sich um den Besitz der besten Knochen irgendeines Märtyrers. Das ist keine gute Entwicklung.«
»So lasst uns nicht zum Kloster des heiligen Barnabas pilgern, meine Freunde«, sagte Ludolf. »Sonst geraten wir vielleicht tatsächlich auf einen Irrweg.«
Henri lachte. »Gut gesprochen! Aber dorthin reisen wir eben nicht, um ihn anzubeten, sondern um in seiner Nähe zu sein und zu lauschen, ob Gott, der Herr, auch anwesend ist.«
»Und auch, um das neue Evangelium zu sehen und seinen Inhalt zu erfahren. Vielleicht handelt es sich gar um die Verkündigung einer neuen Weltordnung!«
»Gott stehe uns bei!«, sagte Henri und schlug ein Kreuz.
»Ich werde euch dieses neue Evangelium übersetzen«, sagte Uthman. »Und ich verspreche, dabei keinen Fehler zu machen.«
*
Der Hafenmeister hatte Recht, dachte der Mann. Sie verhalten sich äußerst auffällig. Wer sich so verhält, der neigt auch dazu, die Gesetze zu missachten. Er stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Er sucht das Heil in sich selbst! Welch ein Frevel!
Und hatte nicht der Herr durch Jesaja verkünden lassen: Siehe, ich breite aus den Frieden wie einen Strom, ihr sollt auf dem Arme getragen werden; und auf den Knien wird man euch freundlich halten, ich will euch wie ein Vater trösten, wie eine Mutter, ja ihr sollt durch mich ergötzet werden? So hatte Jesaja gepredigt, nur im Herrn lag das Recht auf Frieden, warum hielten sich die Fremden nicht daran?
Sie gingen frech herum, besahen alles mit unverschämten Blicken, fassten es mit Ketzerhänden an! Und der eine war offensichtlich ein Heide, ein Vogelfreier, ein Ausbund Satans, der gewiss ein Bocksbein besaß. Er hätte ihn auf der Stelle erschlagen sollen!
Aber er musste abwarten, er hatte seinen Auftrag. Alle Ketzer mussten sterben.
Aber selbst der Judas, der am Abend zu ihm gekommen war und die Fremden verraten hatte, weil er eine Belohnung haben wollte, war ihm frevelhaft vorgekommen, unverschämt, irgendwie voller sündhafter Eitelkeit. Er hätte ihm dieses lächerliche weiße Piratentuch vom Haupt reißen sollen. War es zu fassen, dass jemand vor ihm das Haupt beugte und dabei eine Kopfbedeckung aufbehielt?
Der Mann ging quer durch den Ort, vom Hafen auf den Stadtpalast des Konnetabels zu. Seine Gedanken kreisten seit dem Morgen unablässig um Kampf, Rache und unbedingte Pflichterfüllung.