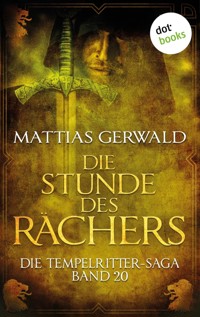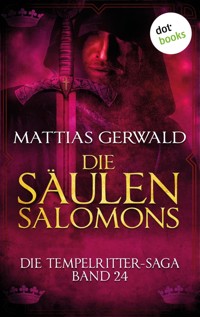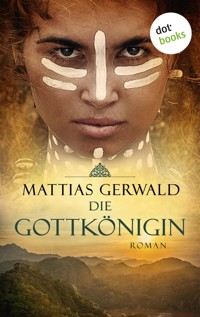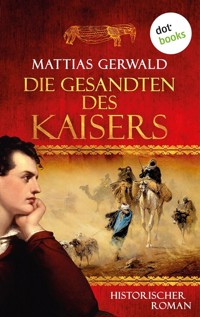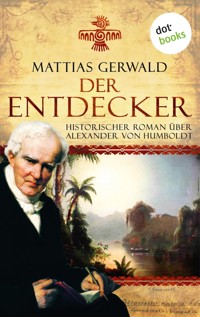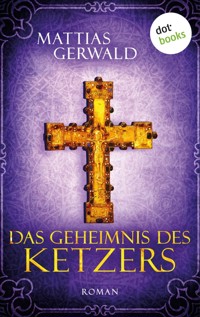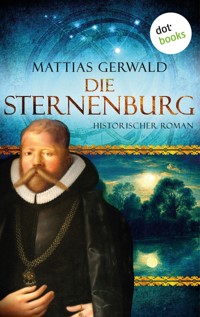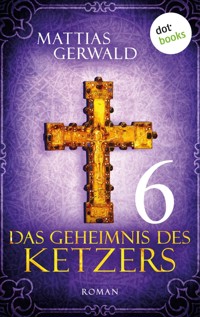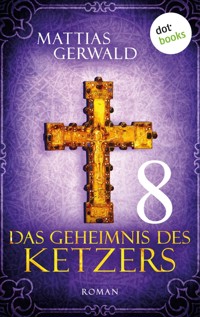Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tempelritter-Saga
- Sprache: Deutsch
"Sollte das Tuch echt sein, dann ist es ein Heiligtum. Der Herr Jesus ist darin gegenwärtig. Und auch der Heilige Gott. Ich sage: Nur ein sündiger Krämer macht damit Geschäfte!" Ist das Linnen mit dem Bildnis des gekreuzigten Jesus tatsächlich das Grabtuch Christi? Oder handelt es sich um eine Fälschung? Auf diese Frage will Geoffroy de Charney, Nachfahre des letzten Präzeptors der Tempelritter, unbedingt eine Antwort – und beauftragt den schottischen Templer Henri de Roslin. Als dieser einwilligt und seine Nachforschungen beginnt, ahnt er jedoch nicht, in welche Gefahr er sich damit begibt. Denn hinter dem Auftrag steckt mehr, als es den Anschein hat. Plötzlich ist Henri der Mittelpunkt in einem mörderischen Spiel um Geld und Macht … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ist das Linnen mit dem Bildnis des gekreuzigten Jesus tatsächlich das Grabtuch Christi? Oder handelt es sich um eine Fälschung? Auf diese Frage will Geoffroy de Charney, Nachfahre des letzten Präzeptors der Tempelritter, unbedingt eine Antwort – und beauftragt den schottischen Templer Henri de Roslin. Als dieser einwilligt und seine Nachforschungen beginnt, ahnt er jedoch nicht, in welche Gefahr er sich damit begibt. Denn hinter dem Auftrag steckt mehr, als es den Anschein hat. Plötzlich ist Henri der Mittelpunkt in einem mörderischen Spiel um Geld und Macht …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheint: »Novembermord«, »Engelmord«, »Regenmord« und »Frühjahrsmord«. Er lebt in Frankfurt am Main und in Nordhessen.
Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.
Bei dotbooks erschienen »Die Geliebte des Propheten«, »Das Geheimnis des Ketzers«, »Der Entdecker«, »Die Sternenburg«, »Die Gottkönigin«, »Die Gesandten des Kaisers« und »Die Hetzjagd«.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald auch folgende Bände:
»Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach Vineta«
»Die Tempelritter-Saga – Band 9: Der Kreuzzug der Kinder«
»Die Tempelritter-Saga – Band 18: Das Grab des Heiligen«
»Die Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des Rächers«
»Die Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2006 bei Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2014 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Andrey Kuzmin und Kiselev Andrey Valerevich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-785-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Grabtuch Christi« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Mattias Gerwald
Das Grabtuch Christi
Die Tempelritter-Saga
Band 8
dotbooks.
1
Herbst 1316, die Botschaft
Es waren die Tage des Abschieds. Henri de Roslin hatte sich umgeblickt und in der Runde ratlose, haltlose Gesichter gesehen. Sie drückten keinen Widerstand gegen seinen Plan aus.
»Wir werden abreisen«, sagte Henri. »Vielleicht waren wir ohnehin schon zu lange hier. Die Tage in Quimper sind jedenfalls ohne Rest verbraucht.«
Sean of Ardchatten war über diese Entscheidung erleichtert gewesen, obwohl sein eigener Abschied von seiner Geliebten Angelique am schwersten wog.
»Lass uns diese kalte Stadt noch heute verlassen, Henri«, sagte er. »Sie ist mir leid – mit allem, was hier geschehen ist.«
Die Steincalvaires direkt am Ufer schienen an diesem Tag wie Riesenspielzeuge auf dem Wasser zu schweben. In einer langen Linie schob sich die hingestreckte Linie des Pointe du Raz in das endlose Wasser vor. Wie weit würde es von hier aus noch sein, bis ein Suchender an den Rand der Erdenscheibe stieß? Die Freunde sahen Meer und Heide, Grün und Grau, auf der einen Seite zum Land hin Mühlen ohne Flügel, lang gestreckte Waschhäuser und Muschelbänke, steingraue Dörfer wie in aufgeschlagene Falten der Landschaft eingebettet. Auf der anderen Seite die große Geste des freien Ozeans.
An diesem Morgen, der mit Wind und Wolken heraufzog, mussten sie nicht mehr wählen, sie hatten sich entschieden. Das Meer zog sie magisch an. Auf dem Meer würde es keine Nachstellungen von Feinden geben. Auf dem Meer würde es keine Denunzianten, Attentäter, Inquisitoren und Menschenfeinde geben.
Henri de Roslin blickte die Küstenlinie außerhalb von Quimper entlang und sagte: »In drei Tagen segeln wir in Sichtweite der Küste nach Süden, bis wir das Mittelländische Meer und die Mündung der Petit Rhone erreicht haben. Dort werden uns Wärme und Heiterkeit erwarten. Wir werden die Zeit in Quimper mit ihren Geschehnissen vergessen können und innere Ruhe finden.«
Uthman sagte: »Hätten wir nicht ein Handelsschiff finden können, das früher ablegt? Irgendeine Hulk oder Kogge? Mich zieht es genauso fort wie Sean. Wenn eine Sache einmal erledigt ist, sollte man sich sofort verabschieden.«
»Nur noch ein wenig Geduld, feuriger Sarazene«, meinte Henri, »dann habe ich hier alles geregelt. Ich will sicher sein, dass mich kein heimlicher oder öffentlicher Feind des Tempels verfolgt. Nach meiner Rede vor den Anklägern des Gerichtes will ich sehen, ob ich nicht schlafende Hunde geweckt habe. Ich kann mir keine Nachstellung erlauben, niemanden, der sich heimlich an meine Fersen heftet. Außerdem will ich den Bischof Josselin Rohan noch einmal aufsuchen und ihm für sein mutiges Auftreten gegen den städtischen Inquisitor danken. Drei Tage Aufenthalt geben mir Gelegenheit, meinen Nachfolger in der Offizin am Mont Frugy einzuweisen.«
Sean stand jetzt bei seiner Angelique. Er sagte: »Du wirst mir gestatten, hin und wieder nach Quimper zurückzukehren, nicht wahr, Herr Henri?«
»Wenn Angelique dich dann noch haben will.«
Angelique strich sich ihre widerspenstigen blonden Haare zurück. »Ich habe gelernt, dass man nur das bekommen kann, was der andere freiwillig gibt. Ich werde damit zufrieden sein und mich freuen, wenn Sean mich besucht.«
Sean blickte sie verliebt an. In seinem jugendlichen Überschwang fiel ihm der Abschied am schwersten, obwohl der Tatendrang ihn gleichzeitig fortriss. Aber er wusste, dass es richtig war, abzureisen. Auch die Liebe war nur eine Schule des Lebens, mit deren Lektionen man erwachsen umgehen musste. Diesen Gedanken hatte er sich in der Nacht zurechtgelegt.
Joshua sagte: »Dann gehen wir nach Hause und packen ein, bevor es sich die Häscher anders überlegen und dich doch noch verhaften, Henri. Wenn ich daran denke, was dir hätte widerfahren können, als du dich ihrem Gericht ausgeliefert hast, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Wenn du nicht so viel Mut und Geschick bewiesen hättest, könntest du jetzt in irgendeinem Verlies schmachten.«
»Oder tot sein!«, ergänzte Uthman.
»Ich musste mich stellen«, sagte Henri. »Ich habe in dieser Stadt einmal verleugnet, dass ich ein Templer bin, und das musste ich unbedingt wieder ungeschehen machen. Versteht ihr das, meine Freunde?«
Die Angesprochenen nickten zögernd, und Joshua sagte: »Aus dieser Stadt werde ich nur wenig mitnehmen, das meiste von dem, was wir hier vorgefunden haben, ist es nicht wert, uns zu begleiten.«
*
Am Abend vor ihrer geplanten Abreise erreichte ein reitender Bote die Stadt Quimper. Die kleine Stadt versank gerade wieder in einen Dämmerschlaf. Nach den gewaltigen Pilgerströmen zur Kreuzerhöhung zwischen St. Locmaria und St. Corentin blieb das Leben nur auf den Marktplätzen und am Hafen zurück, wo man lautstark über die Einführung der neuen Gabelle, der Salzsteuer, diskutierte. Die ersten großen Herbststürme kündeten sich mit düsterer Stimmung an und trieben die Einwohner in ihre flachen Fachwerkhäuser. Sie erneuerten den Torf und das Lehmflechtwerk an ihren Hauswänden, überstrichen das Ständerholz gegen den Regen und besserten ihre Schilfdächer aus.
Der reitende Bote trug ein Banner mit einem Wappen, das ein schwarzes Balkenkreuz auf rotem Grund zeigte. Es flatterte im böigen Abendwind. Der Reiter lenkte seinen Rappen, der vom schnellen und langen Ritt mit weißem Schweiß bedeckt war und heftig schnaubte, zum Mont Frugy. Hier, zu Füßen des Stadtberges, befand sich die Offizin Henri de Roslins. Vor dem schmalen, hohen Eingangstor, das mit dem Wappen der Kaufleute geschmückt war, band er sein Reittier an, holte Wasser aus einem unweit entfernt stehenden Brunnen mit hölzernem Dach und Schöpfrad und ließ sein Pferd saufen. Dann betrat er die Offizin.
Henri de Roslin wollte keinem neuen Kunden Tuch verkaufen und winkte gleich ab. Aber der Mann im roten Mantel kramte aus seiner ledernen Umhängetasche eine Briefrolle aus gelbem Pergament heraus und überreichte sie Henri.
»Wenn Ihr Henri de Roslin seid, dann ist dieser Brief für Euch. Meinem hohen Herrn ist zu Ohren gekommen, dass Ihr in Quimper eine gestohlene Reliquie wiederbeschafft habt, und entbietet Euch seine Grüße.«
»Wer ist Euer Herr?«
»Geoffroy de Charney.«
Henri stutzte. »Geoffroy de Charney? Das ist ein schlechter Scherz. Der Präzeptor des Tempelordens der Normandie ist tot. Die Häscher des Königs verbrannten ihn im März des Jahres 1314 auf dem Scheiterhaufen in Paris an der Seite des Großmeisters Jacques de Molay.«
»Ihr kennt Euch gut aus, Henri de Roslin!«
»Dieses Datum sollte niemand in Frankreich je vergessen! Zwei Männer wurden im Angesicht der Kathedrale von Notre Dame ermordet, die das hohe Ideal christlicher Werte wie keine anderen verkörperten.«
Der Bote blickte verwundert. »Nun, mein Herr Geoffrey ist ein Großenkel dieses Präzeptors. Aber er teilte die Auffassung seines Großonkels, des Tempelritters de Charney, niemals.«
»Was will er von mir?«
»Lest bitte selbst.«
Henri überflog die Botschaft. Der Brief war kurz, aber leider wenig präzise. Es ging um »eine christliche Angelegenheit von hohen Graden«. Henri senkte das Pergament, dann blickte er noch einmal auf das Wappen des Absenders. Kein Zweifel, er stammte aus der Familie der Charneys. Henri fühlte sofort, dass er sich der Bitte eines solchen Mannes nicht verschließen durfte. Das war er seinem ehemaligen Präzeptor schuldig. Auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, wie er dessen Großenkel helfen sollte – und in welcher Angelegenheit!
Ratlos blickte Henri den Boten an. Der Mann schwieg aber und wartete ab.
»Ich kann nicht zusagen, bevor ich mit meinen Gefährten gesprochen habe. Denn eigentlich bin ich gerade dabei, nach Süden abzureisen. Quartiert Euch in Quimper ein. Ich lasse Euch wissen, wie meine Entscheidung lauten wird.«
»Gut, Herr. Ich danke Euch.«
Henri überlegte. Er ahnte, dass er seine Gefährten nicht zu einem erneuten Abenteuer im Auftrag eines christlichen Herrn überreden konnte. Sie wollten abreisen. Auch er hatte sich innerlich längst dafür entschieden, nach Süden aufzubrechen, um an der Mündung des Flusses Rhone und in Aigues-Mortes, der Stadt der Kreuzfahrer, über ihr weiteres Vorgehen nachzudenken.
Henri hatte erkannt, dass seine Absicht, den zerstörten Tempelorden wieder aufzurichten, ihn im Augenblick überfordern würde. Er fühlte sich müde. Nach all den Strapazen und Gefahren der letzten Monate auch mutlos. Überall lauerten die Feinde! Kaum hatte er einen abgeschüttelt, stand ein anderer vor ihm. Jeden Tag ging die Saat aus Hass und Missgunst auf.
Henri brauchte eine innere Stärkung und hatte heimlich mit dem Gedanken gespielt, vom südfranzösischen Aigues-Mortes aus nach Jerusalem aufzubrechen. In der Heiligen Stadt, die jetzt wieder in der Hand der Muslime war, würde er untertauchen können. Er konnte beten und innere Stärke zurückgewinnen. Auch seine beiden Gefährten würden in ihrem Jerusalem Kraft im Gebet gewinnen. Diese Stadt gehörte ja allen drei Religionen.
Aber die Vorstellung, mit einem Großneffen seines geliebten Präzeptors zusammenzutreffen und vielleicht sein Banner zu tragen, an seiner Seite zu kämpfen, überwältigte ihn. Er dachte an die tieftraurigen Tage auf der Pariser Seineinsel, als die Scheiterhaufen brannten, und fühlte sich einen Herzschlag lang wie ein Kind, das nach langer Zeit seinen vermissten Vater wieder sieht.
Henri de Roslin schloss die Offizin. Er holte sein Pferd aus dem öffentlichen Stall am Fluss Odet und ritt zur Herberge von Angelique, wo seine drei Gefährten Uthman, Joshua und Sean sich jetzt einquartiert hatten, um bis zur Abreise zusammen zu sein.
Quimper lag verlassen. Jenseits des Nordtores begann die Fernstraße nach Brest, an der Angeliques Herberge lag. Als das flache Gebäude in der Landschaft auftauchte, ritt Henri unwillkürlich schneller. Er sprang noch während des Trabes aus dem Sattel, ließ das Pferd unangepflockt stehen und stürmte ins Haus.
Drinnen waren Geräusche aus der Küche vernehmbar, das Klopfen von Fleischstücken, das Klappern von Geschirr und Töpfen, das Prasseln der Feuerstelle. Jemand rief nach der Meisterin. Henri durchquerte den Gastraum mit der tonnenförmigen Holzdecke und fand seine Gefährten zusammen mit der jungen Wirtin Angelique im Garten. Sie berieten über Dung und Wintersaat. Joshua gab den Ton an, er kannte die Gesetze des Nutz- und des Kräutergartens aus den Schriften. Sean erblickte Henri als Erster.
»Meister! Endlich! Jetzt geht es los!«
Henri lachte. »Noch ein wenig Geduld, mein Sean! Ich muss mit euch allen reden. Es gilt, eine Entscheidung zu treffen.«
Uthman blickte misstrauisch. »Wir haben entschieden, Henri. Wir reisen nach Aigues-Mortes!«
»Es sind neue Umstände eingetreten ...«
»Oh, nein!« Uthman sank in gespieltem Schmerz in sich zusammen. »Was für neue Umstände könnten es sein, die unseren feierlichen Entschluss ins Wanken bringen?«
Angelique sagte hoffnungsvoll: »So reist ihr alle doch nicht ab, und mein Sean bleibt mir erhalten?«
»Lasst uns ins Haus gehen«, sagte Henri. »Wir müssen es in Ruhe besprechen.«
Angelique führte sie in einen Trakt der Herberge, der von den anderen Zimmern abgetrennt war. Hier quartierte sie gewöhnlich die Gäste ein, die völlig unter sich bleiben wollten, wie die Ritter zum Schutz Mariens, deren Ordensregel absolutes Stillschweigen über alle ihre Beratungen und Beschlüsse vorsah.
Die Gefährten blickten Henri gespannt an.
»Mich erreichte eben ein Bote eines Ritters aus der Champagne. Sein Name ist Geoffrey de Charney. Er ist ein Großenkel des hingerichteten Präzeptors des Tempelordens. Er ersucht mich, ihm in einer Angelegenheit zu helfen, die wohl für einen christlichen Herrn von einiger Wichtigkeit ist. Vielleicht hat er Informationen für mich, die mir in der Absicht helfen, den Tempel neu zu organisieren. Ich weiß es nicht. Er drückte sich unklar aus. Aber versteht – einem solchen Hilferuf kann ich mich nicht verschließen, was immer auch dahinter steckt.«
Joshua sagte düster: »Man kann ihn nicht einen Moment lang allein lassen, schon verstrickt er sich wieder hoffnungslos in neue Abenteuer.«
Sean sagte griesgrämig: »Und was wird aus unserer gemeinsamen Reise?«
»Sean!«, warf Angelique ein. »Wir könnten zusammenbleiben. Oder zumindest in der Nähe. Das wäre doch wunderbar !«
»Aber dieser Großenkel«, sagte Uthman. »Was ist das für einer? Kennst du ihn denn, Henri?«
»Nein. Ich weiß nur, dass er ein hochchristlicher Ritter der Champagne ist. Sein Schloss befindet sich in Lirey, einem Städtchen in der Diözese Troyes. Wir müssten also, um dorthin zu gelangen, quer durch Frankreich und auch an Paris und Fontainebleau vorbeireiten. Das ist natürlich keine angenehme Vorstellung, denn überall warten die Feinde des Tempels darauf, sich an mir zu rächen. Aber wir würden verdeckt und ausreichend getarnt reisen. Wenn wir es geschickt anstellen, ist die Gefahr gering, dass wir erkannt werden.«
»Ich habe keine Angst vor Entdeckung«, sagte Uthman. »Wer entdeckt wird, hat Gelegenheit, seine Verteidigungsstrategie darzustellen. Aber was mir nicht behagt, das ist die Tatsache, dass dieser Herr ein christlicher Ritter ist. Er tritt also sicher für Werte ein, die nicht die meinen sind.«
»Und sicher auch nicht die meinen«, warf Joshua ein.
»Noch wissen wir nicht, was er von uns will«, sagte Henri. »Wir könnten es herausfinden. Und dann entscheiden wir, ob wir ihm helfen oder nicht.«
Sean sagte: »Ich bleibe jedenfalls an deiner Seite, Meister Henri! Mir ist es egal, wohin wir reiten, wenn nur ein Abenteuer damit verbunden ist.«
Der Knappe Sean schien die Schrecken von Quimper rasch überwunden zu haben, wo er nur knapp dem tödlichen Attentat entkommen war. Henri nahm es mit Genugtuung zur Kenntnis. Jugend ist das beste Heilmittel, dachte er.
Er blickte die beiden Freunde an. Dann sagte er: »Entscheidet euch frei, meine Brüder. Ich will euch nicht überreden. Tut, was ihr für richtig haltet.«
Uthman sagte: »Ich werde nicht mit dir kommen, Henri. Nicht etwa, weil wir es vor Tagen anders beschlossen haben und ich darauf beharre. Sondern mich zieht es mit Macht an das Südmeer, wo ich meiner Heimat näher bin. Wer weiß, vielleicht breche ich von dort aus noch einmal ins Gelobte Land auf! Nach Jerusalem, von wo mein Muhammad, der letzte Prophet der Menschen, Friede sei mit ihm, seine Reise in den Himmel antrat! Ich habe Sehnsucht nach Jerusalem. Diese Stadt ist erfüllt von Stimmen, die nach Gott rufen, weil sie ihn lieben und brauchen. Und das höre ich hier nirgendwo – trotz aller Pilgerscharen! Vielleicht habe ich auch Sehnsucht nach meinem eigenen Propheten, dem ich in Jerusalem näher wäre.«
»Joshua?«
»Mir geht es ähnlich, Henri. Auch ich will nach Aigues-Mortes, an die Rhonemündung. Ich will das warme Meer sehen, nachdem wir hier zu lange in das kalte Meer gestarrt haben. Eine Reise nach Jerusalem? Obwohl ich nicht weiß, wie die Verhältnisse in der Stadt sind und was uns erwartet, wäre das großartig! Vor allem dann, wenn wir die Reise alle zusammen antreten würden.«
Henri lächelte. »Auch ich habe schon daran gedacht und es für mich behalten. Es ist schön, dass unsere Gedanken und Sehnsüchte sich nicht entfernen. So bleiben wir uns nahe, auch wenn wir an unterschiedlichen Orten sind.«
Sean warf ein: »Also, was beschließt ihr Herren? Damit ich es Angelique sagen kann.«
Henri sagte: »Ich bin zu neugierig, um dem Ruf dieses Ritters aus der Champagne nicht zu folgen. Die Herren der Champagne führten den ersten Kreuzzug an und gehören zu den bevorzugten Familien. Ich breche also in zwei Tagen nach Troyes auf.«
Joshua sagte: »Es bleibt dabei. Ich werde mit Uthman zusammen nach Aigues-Mortes reisen. Dann müssen wir die gekauften Schiffsplätze nur um die Hälfte reduzieren. Es ist eine beschwerliche Schifffahrt um das Kap von Gibraltar herum, aber ich werde Sonne, Wind und Meer ausreichend genießen.«
Uthman nickte zustimmend.
Sean sagte: »Dann bleibt es also dabei – wir reisen alle ab, wenn auch mit unterschiedlichen Zielen!«
Henri stimmte zu. »Auch der Zeitplan bleibt der gleiche. Und da alles in Gottes Hand liegt, wird alles gut, und wir sehen uns bald am Mittelländischen Meer wieder.«
»Wann wirst du nachkommen?«
»In einigen Wochen. Ich denke, die Sache in Troyes wird schnell erledigt sein. Sollte sich herausstellen, dass Geoffroy einen großen Auftrag für mich vorgesehen hat, der mich von meinen eigenen Zielen fern hält, dann lehne ich ab. Ich werde auf jeden Fall von Troyes aus den Weg über Land antreten. Wir sehen uns an der Mündung der Petit Rhone in Aigues-Mortes wieder, meine Freunde!«
»Gott sei mit dir, Henri!«, sagte Joshua und umarmte Henri und Sean.
Uthman sagte: »Allah – Friede sei mit ihm – ist groß! Er schütze euch auf euren Wegen! Ich freue mich schon jetzt darauf, dass wir uns wieder sehen!«
Auch er umarmte die Freunde und küsste sie auf beide Wangen.
»Soll ich mit dir kommen, Meister?«, fragte Sean.
»Nein. Bleib bei Angelique und tröste sie. Sie wird es nötig haben, denn ihr werdet euch längere Zeit nicht sehen. Wenn ich alles getan habe, hole ich dich. Vermutlich wird es übermorgen sein. Bis dahin habe ich die passenden Reittiere und Packpferde eingekauft. Es ist Herbst geworden, und ich will auch dafür gerüstet sein.«
*
Angelique weinte nicht. Die junge Löwin schritt nur mit etwas längeren und noch energischeren Schritten aus, um ihre Traurigkeit zu verbergen. Noch konnte sie sich nicht wirklich vorstellen, wie es ohne Sean sein würde. Aber sie ahnte, wie viel ihr fehlen würde. Die Tage würden lang werden. Und die Nächte endlos.
Als sie am Abend mit Sean am Kaminfeuer saß, erinnerte sie sich an ein passendes Abschiedsgeschenk.
Sie holte es. Dazu musste sie nicht lange suchen, sie hatte es an ihrem Bett aufgehängt. Ihr Vater hatte es ein halbes Jahr vor seinem Tod gemalt. Es stellte seine Tochter dar. Ihren Kopf mit den blonden, widerspenstigen Haaren, ihre großen braunen Augen, die gerade Nase, den frechen Mund. Vater Maxime hatte es mit leuchtenden Wasserfarben und einem Schuss Öl auf ein Stück weißes Leinen gemalt, das die Größe eines Schnupftuches hatte.
»Du kannst es jedes Mal ansehen, wenn du hineinniesen musst, Sean«, sagte Angelique gespielt heiter. »Dann hast du mich ganz vor Augen, und ich bin dir sehr nahe. Und das Gute ist, ich nütze dir sogar noch.«
»Was für ein schönes Geschenk, Angelique«, sagte Sean beschämt. »Und ich habe gar nichts für dich! Aber ich werde es natürlich nicht als Schnupftuch verwenden! Ich falte es in meinem Hosensack zusammen und schaue es mir jeden Tag an. Es ist schön – wie ein Heiligentuch! Ich verehre dich auch genauso!«
Angelique hielt Sean umarmt. Sie wiegten sich in den Armen. »Schöne Worte, Sean, die du sicher ganz ehrlich meinst. Aber was ist in einem halben Jahr? Du wirst dich zwar noch an mich erinnern. Aber nicht mehr mit Leidenschaft. Die Zeit und die Entfernung werden mich immer blasser machen.«
»Aber nein, Angelique! Wie töricht du redest!«
»Doch, doch! Lass nur! Du weißt ja, ich bin immer ehrlich. Genauso wird es sein.«
»Aber auch du wirst nicht mehr an mich denken, nicht wahr? Es gibt andere Männer. Männer, die in deiner Nähe sind! Sie werden nach dir greifen.«
»Ich schlage ihnen schon jetzt kräftig auf die Finger. Ich gehöre nur dir!«
»Es tut mir Leid, dass ich dir das antun muss, meine Liebste! Aber ich spüre, dass ich mit Meister Henri ziehen muss. Ich kann mich noch nicht sesshaft machen. Wenn ich eines Tages als Mann zurückkomme, dann wirst auch du einsehen, dass es besser war, aufeinander zu warten. Dann heiraten wir, und du bekommst einen gereiften Menschen.«
»Ich bin schon reif, mein Sean, vergiss nicht, dass ich sechs Jahre älter bin als du!«
»Das ist nicht viel! Du bist noch jung!«
Angelique beruhigte sich. »Aber ich will nicht bitter sein. Und ich gebe dir keine Schuld! Du würdest nicht glücklich werden, wenn ich dich überrede, hier zu bleiben. Das weiß ich ganz genau. Deshalb reite mit deinem Ritter, der ein wunderbarer Mensch ist. Aber vergiss mich nicht. Und ich will dich nicht vergessen. Und bewahre in diesem Tuch das Andenken an mich.«
»Das will ich tun, meine Liebste!«
2
Herbst 1316, Tage der Apostel
Über Land zu reiten brachte die Möglichkeit mit sich, nachzudenken. Die Landschaft im Norden Frankreichs blieb eintönig, das Wetter herbstlich grau. Schwer legte sich manchmal der weiße Nebel auf die Wiesen und Wälder und drang auch in die Herzen der beiden Reiter ein. Henri de Roslin und Sean of Ardchatten sprachen viel miteinander über die zurückliegende Zeit. Doch als sie in Höhe von Laval in der Provinz Mayenne durch ausgedehnte Wälder ritten, wurden die Pfade so eng, dass sie nur hintereinander reiten konnten. Manchmal hatten sie das Gefühl, die Äste und Zweige der Nadelbäume griffen nach ihnen, tasteten nach ihrem Gesicht, als wollten sie die Eindringlinge erkennen.
Henri empfand in freier Natur die Gegenwart des Schöpfers immer besonders stark. War es das Spiel von Gleichmäßigkeit und schnellem Wechsel, in dem die Zeit zu erkennen war, die den Menschen gegeben ist? Was war Zeit? War sie das Einatmen und das Ausatmen der Schöpfung? Henri zählte, während sie immer tiefer in den Wald hineinritten, die Schläge seines Herzens, atmete tief ein und aus, zählte bis zur Zahl eintausend.
Danach lichtete sich der Wald wieder. Ein Sonnenstrahl drang durch den Nebel. Henri dachte: Alles vergeht, alles ist Zeit. Hell und Dunkel ebenso wie Wachen und Schlafen, Hunger und Sättigung, Tag und Nacht. Und auch die Schritte des Pferdes, das seine Hufe mit einem dumpfen Klang in den weichen Sandboden setzt. Plötzlich kam die Sonne ganz hervor und vertrieb den Nebel. Die Helligkeit blendete Henri, er musste einen Herzschlag lang die Augen schließen. Als er sie wieder öffnete, hatte sich der Wald zu einer großen Lichtung geöffnet. Und hinter ihm rief Sean, der lange geschwiegen hatte: »Meister Henri, lass uns einen Moment anhalten! Ich muss meine Notdurft verrichten.«
Ja, dachte Henri, Zeit ist auch die Abfolge von Banalem und Ernsthaftem, von Großem und von Kleinem. Die Menschen wandern von hehren Gefühlen zu niedrigen. Oft liegt nur ein Herzschlag dazwischen. Er verhielt sein Pferd, ließ die Zügel hängen und wartete bewegungslos, bis Sean wieder aus dem Wald aufgetaucht war.
»Jetzt ist mir leichter! In meinem Magen sitzt ein Tier und grummelt ständig!«
Henri hatte sich nicht aus seinen Gedanken reißen lassen, er blieb in vergrübelter Stimmung, nickte Sean nur zu und trabte wieder an. Alles Leben ist eine Erscheinungsweise der göttlichen Zeit, dachte er. Und der Tod, das Ende aller Lebenszeit, ist auch nur ein neuer Anfang, es wiederholt sich alles – und ist doch etwas ganz Neues. Er wusste, dass das biblische Israel seine großen Feste zuerst am Ablauf des natürlichen Jahres ausgerichtet hatte. Später erst bezog Israel seine Feste auf die Geschichte der Verkündigung. Seitdem stand für alle Gläubigen die Heilsgeschichte im Vordergrund ihres Denkens. Und gerade jetzt näherten sich die Aposteltage. Wieder würde auch für Henri de Roslin der Bund zu feiern sein, den Gott mit dem Volk, den Menschen, geschlossen hatte.
Henri wollte am Abend in der Kirche von Vaiges beten. Er kannte die besonders schöne Kirche von einer früheren Durchreise und wusste, das der Apostel Lukas, den die Christen an diesem Tag feierten, ihr Schutzheiliger war. Henri wollte den Apostel anrufen. Denn dieser Abschnitt ihrer Reise in die Champagne war auch der gefährlichste.
Rund um Tours saßen viele seiner Feinde, auch sein Hauptfeind Ferrand. Aber er war dem Judenhasser lange nicht begegnet und wusste nicht, ob Ferrand sich noch hier aufhielt. Vielleicht hatte sein unbändiger Hass ihm auch ein unbotmäßiges Schicksal beschert.
Die Landschaft änderte sich jetzt. Sandige Hügel erhoben sich aus der Ebene, der Wald verschwand beinahe ganz. Kleine Weiler und Ansiedlungen duckten sich in den flachen Tälern. Der Himmel wurde weiter.
Sie ritten wieder nebeneinanderher. Sean erzählte gedankenlos von diesem und jenem. Seine Angelique tauchte in seinem Redestrom auf, unvermittelt begann er, ein wehmütiges Lied zu singen. Henri ließ ihn gewähren. Auch er befand sich jetzt in einer schwebenden Stimmung zwischen Wehmut und heiterer Gelassenheit. Manchmal brachte Sean ihn zum Lachen.
Am frühen Abend kamen sie in Vaiges an. Als sie durch den Ort ritten, fielen ihnen die zahlreichen Kinder auf, die in Grüppchen spielten oder herumsaßen, als warteten sie auf etwas. Sean stieg einmal ab und trank durstig aus einem Laufbrunnen, das Wasser schmeckte stark nach Schwefel. Sie hielten direkt vor der ländlichen, mit rotem Fachwerk versehenen Kirche, deren Glocke ruhig bimmelte.
Drinnen war es voll, warm und roch abgestanden. Sie suchten sich einen Platz an der Seite. Die Messe hatte gerade begonnen.
Der Priester begann zu predigen. Die beiden Neuankömmlinge verstanden ihn nur schwer, denn sein Dialekt klang flandrisch, dann bretonisch. Er predigte vom segensreichen Wirken des Erlösers und davon, wie sich die Feste der Apostel mit der Verehrung der Märtyrer und anderer Heiliger entwickelt hatten. »Auch sie sind bekehrt worden«, sagte er, »wie wir alle bekehrt werden müssen. Gedenket Lukas, der als Heide im syrischen Antiochien geboren wurde und im hohen Alter als heiliger Evangelist in Böotien starb. Er schenkte uns die Apostelgeschichte, nach der wir heute feiern. Und so, wie er den Paulus begleitete, so begleitet uns Heutige die Kirche auf allen unseren Wegen. Amen.«
Henri versenkte sich noch eine Weile länger in die inbrünstige Stimmung an diesem vertrauten Ort. Er feierte sein eigenes kleines Hochfest mit Gedanken an die treuen Gefährten, von denen er jetzt getrennt war, und er betete zum Apostel, er möge Uthman und Joshua auf ihrem Weg nach Aigues-Mortes beschützen. Als er zu Sean hinübersah, der neben ihm kniete, bemerkte er, dass dessen Augen gerötet waren.
»Was ist dir?«, murmelte Henri.
»Angelique«, flüsterte Sean mit erstickter Stimme.
Henri legte ihm tröstend die Hand auf den Kopf. Dann versenkte er sich wieder ins Gebet.
Die Kirche hatte sich geleert. Als sie sich erhoben, waren sie die einzigen Gläubigen, auch der Priester war in die Sakristei verschwunden. Sie erhoben sich und gingen nach draußen, wo die herbstliche Kühle sie daran erinnerte, dass sie sich ein Quartier suchen mussten.
Sie fanden bald einen einfachen Gasthof, in dem sie von einem Wirt mit fauligen Zähnen, der nach jedem zweiten Satz breit lachte, zu essen und trinken bekamen, aber nur gemeinsam mit vier anderen Gästen auf dem Boden rund um die Feuerstelle schlafen konnten. Als sie ihr Nachtlager aufschlugen, begann Ungeziefer unter ihre Kleidung zu kriechen und sie zu stechen. Sean breitete das Tuch mit dem Kopf von Angelique neben sich aus und starrte auf der Seite liegend darauf, aber das half nur gegen seine Sehnsucht, nicht gegen die Flöhe und Wanzen. Die beiden wälzten sich die ganze Nacht unruhig auf ihren Strohmatten herum.
Henri und Sean schliefen erst im Morgengrauen ein. Sie erwachten vom Geruch frisch gebackenen Anisbrots und warmen Pflaumenmus'. Sie griffen wie die anderen Gäste zu. Es schmeckte herrlich und ließ sie die Nacht mit ihren Quälgeistern vergessen. Und wenig später waren sie bereits wieder auf ihren Pferden und ritten nach Osten.
In diesem Teil des Landes war der Boden von purpurfarbenem Heidekraut übersät, das nur langsam die Farbe verlor, ein stetiger Wind ließ die Wacholderbüsche erschauern. Sie mussten einen Fluss überqueren, suchten eine Furt und fanden sie dort, wo ein Schäfer seine Herde hinübertrieb. Er suchte ein Winterlager weiter südwestlich. Henri ließ der Herde den Vortritt, dann folgten sie durch das seichte Wasser, in dem Barsche und Karpfen zu sehen waren, die wie große Schatten dahinglitten. Das Wetter besserte sich langsam. Es wurde wärmer, und die Luft füllte sich mit den würzigen Düften der letzten Blumen dieses Jahres.
Spät am Nachmittag erspähte Sean einen weißen Wolf. Es war ungewöhnlich, ein solches Tier außerhalb seines Rudels zu sehen. Ein Einzelgänger. Der Wolf verfolgte sie eine Zeit lang, dann war er plötzlich verschwunden. Die Reiter verzehrten ihre Vorräte an Trockenfisch und gebratenem Rinderfleisch im Sattel, sie stiegen nur ab, wenn sie eine Quelle erreichten. So kamen sie gut voran, und die Reise verlief ohne Zwischenfälle.
Nach fünf Tagen kam Pithiviers in Sicht. Jetzt war die längste Wegstrecke zurückgelegt. Die beiden einsamen Reiter ließen ihre Pferde in einen schnelleren Trab fallen und fanden in der Stadt der Schuhmessen eine Unterkunft am Rathaus. Ein Gast erzählte davon, dass die ganze Gegend von Bettelmönchen unsicher gemacht wurde, die vom Bischof von Orleans wegen ihrer heidnischen Ansichten exkommuniziert worden waren und sich nun rächten. Man riet Henri, Obacht zu geben.
Am Morgen ritten sie weiter. Sie überquerten den ruhigen, flachen Fluss Yonne, auf dem Flößer in Richtung auf Paris zuhielten. Und noch bevor es Abend wurde und dabei schon empfindlich kalt, erreichten sie das Dorf Estissac.
Henri überlegte, ob sie die Gastfreundschaft eines Klosters in Anspruch nehmen sollten. Aber dann sahen sie eine Schildwirtschaft, die sauberer war als manche der vorangegangenen. Dafür erzählte ihnen ein reisender Kaufmann, der von Troyes nach Orleans zog, dass er östlich des Ortes von einer Diebesbande überfallen worden war.
»Waren es Bettelmönche?«, wollte Henri wissen.
»Nein. Es waren marodierende Aussätzige aus einem Siechenhaus im Norden, die ausgebrochen sind.«
Henri ließ sich die Sache genau erzählen. Der Kaufmann riet ihnen, einen Umweg nach Süden in Richtung Sens zu machen. Aber ein anderer Gast, ein kleiner Bauhandwerker mit krausen Haaren, aus Sens lachte ihn aus. Und da die Berge des Foret d'Othe auf dem Weg liegen würden, beschloss Henri, trotz der Warnung direkt auf Troyes zuzuhalten. Er wollte keine Zeit verlieren.
Sean zog sein Tuch mit dem Antlitz von Angelique aus der Tasche und zeigte es den anderen mit der Bemerkung, es würde ihnen Schutz gewähren. Ehrfürchtig starrten es alle an.
Und so brachen sie am Morgen schon vor Sonnenaufgang auf und waren wachsam.
Die Wege, über die sie jetzt reiten mussten, waren aufgewühlt. Die Ansiedlungen waren ärmlich und manche so klein, dass sie keinen Namen besaßen. Die Bauern konnten ihnen nichts verkaufen. Später begegnete ihnen eine Pferdekarawane, die zu einer Messe nach Chalon zog. Die Händler wussten nichts von Überfällen und sangen sorglos. Als sie verschwunden waren, machten Henri und Sean Rast an einem See. Sie wuschen sich. Sean legte wieder das Tuch Angeliques vor sich aus und starrte es an, während er sich Gesicht und Hände an seinem Sacktuch trocknete.
Und plötzlich brachen aus dem Unterholz zwei Männer und lenkten ihre Pferde im gestreckten Galopp auf sie zu.
Henri blieb wie vom Blitz getroffen stehen. Obwohl er stets mit allem Möglichen gerechnet hatte, war er überrascht, dass er einen der Männer kannte. Es war ein kleiner Mann mit wirren Haaren und einem breiten Mund. Er war einer der Gäste aus der letzten Herberge, ein Handwerker aus Sens. Sein Begleiter war durch ein schwarzes Halstuch vor dem Gesicht unkenntlich.
Der Mann sprang vor Sean ab und stürzte sich auf ihn. Er hielt ihm das Messer an die Kehle und knurrte: »Du gibst mir das Tuch da! Mein Kumpel weiß, dass es eine Reliquie ist. Und dann gibst du mir noch dein Geld. Und das von dem da! Ich weiß, ihr habt Penunse in Hülle und Fülle! Also wird's bald?«
Sean blickte hilflos auf Henri. Der stand zu weit von seiner Kleidung und seinem Kurzschwert entfernt, um handeln zu können. Außerdem umkreiste ihn jetzt das Pferd des Kumpanen im gemessenen Galopp. Henri sah, dass der Reiter Augen hatte, deren Lidränder vom Aussatz zerfressen waren. Er schrie etwas Unverständliches mit einer krächzenden Stimme.
»Gib ihm das Tuch, Sean«, sagte Henri. »Wir holen es uns später wieder!«
Der Angreifer lachte. Dann brüllte er: »Her mit dem Fetzen! Und alle Wertsachen und Geld gefälligst in den Sand fallen lassen! Na, wird's bald?«
Henri und Sean taten, wie er befahl.
»Einsammeln! Ins Tuch legen!«
Sean nahm die Münzen und einen Ring, den er am Finger getragen hatte, und legte alles in das Tuch. Angeliques Gesicht verschwand langsam unter den Silberstücken.
»Auf die Erde legen. Und nun geht ihr schön langsam bis zum Wasser – und hinein! Aber schnell!«
Henri und Sean gingen Schritt für Schritt bis zum See. Der Kleine mit den wirren Haaren beugte sich geschickt aus dem Sattel und griff hastig nach dem Tuch. Aber er fasste es nicht richtig an allen Ecken, und die Münzen fielen in den Sand.
»Verflucht noch mal! Los, Kleiner, beweg dich hierher! Und aufsammeln!«
Sean rannte wieder ans Ufer. Er sammelte die Münzen ein, stopfte sie erneut in das Tuch und reichte sie dem Kerl. Der Mann hatte plötzlich einen Knüppel in der Hand. Henri sah es vom Wasser her. Er wollte den Knappen warnen, aber sein Ruf blieb ihm in der Kehle stecken Ehe Sean begriff, was geschah, hatte der Verbrecher ausgeholt und ihm wuchtig gegen die Stirn geschlagen. Es gab einen hässlichen Laut. Sean fiel in sich zusammen.
Der Wegelagerer lachte. »Eure Pferde nehmen wir auch mit, wenn's recht ist! Hahaha! Einen schönen Spaziergang noch!«
Die Aussätzige krächzte seinen Kommentar dazu. Die beiden Räuber verschwanden im Dickicht.
Henri rannte auf Sean zu. Seine nassen Stiefel trommelten in den Sand. Er kam bei dem Jungen an und sah, wie aus der aufgeplatzten Wunde Blut und eine wässrige Flüssigkeit austraten. Seans Augen waren geschlossen, seine Lippen zitterten, weiße Bläschen traten aus seinem Mund. Er gab einen leisen, wimmernden Laut von sich, der Henri ins Herz schnitt.
»Sean! Junge! Kannst du mich hören?«
Sean reagierte nicht. Henri sah, wie in seiner rechten Schläfe das Blut pochte, als säße ein kleines Tier unter der Haut, das herauswollte. Henri holte ein sauberes Tuch aus seinem Umhang und begann, Seans Stirn vorsichtig zu säubern. Er rannte zum Wasser und tränkte das Tuch darin. Er legte es dem Knappen auf die Schläfen. Noch immer trat Blut aus der Wunde.
Oh, Gott, dachte Henri, lass ihn nicht ernsthaft verletzt sein!
Nach einer Weile trocknete das Blut aus Seans Stirn. Er kam wieder zu sich und schlug die Augen auf.
»Was . . .!«
»Sei still, Sean. Es ist alles gut. Bleib nur liegen. Ich bin froh, dass du wieder erwacht bist.«
»Sie haben uns überfallen!«
»Ja, und sie sind mit unseren Sachen verschwunden. Aber sie sind viel zu selbstsicher. Sie rechnen nicht damit, dass wir Widerstand leisten könnten. In Troyes werde ich sie stellen. Dann hole ich zurück, was uns gehört.«
»Ja, Herr Henri.«
Sean versuchte, sich vorsichtig aufzurichten. Er stöhnte, aber es gelang ihm. Er tastete nach seiner Stirn.
»Blut! «
»Hast du Schmerzen?«
»Mein Kopf dröhnt. Aber ich glaube, ich kann aufstehen und gehen.«
»Versuche es, aber langsam.«
Sean stellte sich auf die Beine. Erst schwankte er, aber er erholte sich rasch. Nachdem er ein paar Mal den Kopf hin und her geschwenkt hatte, machte er ein paar Schritte im Kreis.
»Es geht.«
»Der nächste Ort ist nicht mehr weit«, sagte Henri. »Schaffst du es bis dorthin?«
»Ja, ja, lass uns gehen. Ich will so schnell wie möglich mein Andenken an Angelique zurückhaben.«
Nachdem sie ihre Fassung wiedergewonnen hatten, machten sie sich zu Fuß auf den Weg. Henri musste Sean beruhigen, der plötzlich haltlos zu schluchzen begann, als hätten die Wegelagerer mit dem Tuch auch seine Angelique entführt.
»Sie kommen nicht weit«, versprach Henri. »Wir besorgen uns im nächsten Ort Pferde und holen uns das Tuch und das Geld wieder, beruhige dich also, mein Sean!«
In Richtung der Stadt Troyes, vor der noch ein Dorf lag, sahen sie von einem Hügel herab in der Ferne die Staubwolke der vier Pferde, die immer kleiner wurden. Henri spürte Wut in sich aufsteigen. Er war sich sicher, dass er die Diebe in Troyes wieder sehen würde. Er konnte es gar nicht erwarten, sie unter günstigeren Umständen in die Finger zu bekommen.
Sie stapften den Sandweg entlang. Henri stützte Sean, der manchmal stolperte. Aber er ließ keinen Schmerzenslaut mehr hören. Plötzlich blieb er stehen und begann zu würgen. Dann musste er sich übergeben. Er spuckte und hustete und fiel auf die Knie. Henri hielt ihm den Nacken. Der Junge keuchte, das Würgen hörte erst nach einer Weile auf. Nachdem Sean sich wieder erholt hatte, säuberte er sich mit Moos. Henri war besorgt und stützte ihn wieder, und sie konnten langsam weitergehen.
Im Ort gelang es Henri, einen Pferdestall zu finden. Sie feilschten mit dem Bauern. Aber erst, als Henri ihm einen Goldlivre gab, den er in einem kleinen Beutel um den Hals trug und den Dieben verheimlicht hatte, kam das Geschäft zustande. Die Pferde waren plump und langsam, eher Zugtiere als Reittiere. Der Bauer schien froh zu sein und gab ihnen Zaumzeug und eine Satteldecke obendrein. Jetzt konnten sie reiten.
Henri spürte seine innere Unruhe wachsen. Wenn es schon so beginnt, dachte er, bevor wir die Stadt erreichen, dann kann noch so manches passieren.
Was mochte Troyes für eine Stadt sein? Henri war nie dort gewesen. Eine gewalttätige Stadt? Eine gerechte Stadt? Sicher eine mächtige und reiche Stadt. Er hatte gehört, dass man dort schon beinahe sechzig Jahre lang an einer riesigen Kathedrale baute. Sie sollte immer noch höher und prächtiger werden. Die Bischöfe waren nie zufrieden gewesen.
Sean hielt durch, so erreichten sie Troyes noch am gleichen Abend. Die Räuber waren von der Straße verschwunden, der staubige und mit Abfällen übersäte Weg, der in die Stadt hineinführte, lag leer und verlassen vor ihnen.
Erst kurz vor der Stadtmauer tauchten von Norden her mehrere Fuhrwerke auf. Als sie die Stadttore gleichzeitig mit den Wagen passierten, deren große Speichenräder mit Getöse über die hölzerne Brücke rumpelten, war ihnen sogleich klar, wie schwer es sein würde, die Wegelagerer zu finden. Denn in der Stadt schien eine Warenmesse im Gange zu sein. Die Straßen waren überfüllt von Menschen, teils zu Fuß, teils zu Pferde. Vor allem Kaufleute und Handwerker in Gildekleidung sowie Weinschröter mit ihren Karren gaben den Ton an. Es waren fast ausschließlich Männer zu sehen.
Henri befragte einen der Zollsoldaten des Bischofs von Troyes, die am Stadttor Dienst taten, nach den beiden Wegelagerern. Der Soldat bohrte in der Nase und schüttelte den Kopf. Er hatte sie nicht gesehen.
Nun, das konnte heißen, dass sie tatsächlich vor der Stadt abgebogen waren. Oder aber durch ein anderes Tor eingeritten. Vielleicht verkauften sie auch die Pferde an einen Bauern außerhalb der Stadtmauern, der dafür sicher viel bieten würde. Oder der Zollsoldat hatte einfach nicht aufgepasst.
Sie ritten über die lehmigen Straßen. Schon von weitem erblickten sie die mächtige Kathedrale, die von Baugerüsten umgeben war und wie ein Untier aussah mit all den Holzkränen, die wie Hörner und Tentakel aus den Dächern ragten.
Henri überlegte, ob sie zuerst zur Kathedrale reiten sollten, wo er Ritter Geoffroy zu treffen hoffte, der, wie er von seinem Boten erfahren hatte, ein wichtiger Geldgeber der Bauhütte war, die den Ausbau besorgte, oder ob er versuchen sollte, die Räuber zu stellen. Seans Blicke schienen eindeutig zu sagen: Fasse die Schweinehunde! Henris eigener Zorn stimmte dem zu. Aber eine andere Stimme in ihm sagte, er solle die Räuber laufen lassen. Mein ist die Rache, spricht der Herr! Hatten sie nicht nur Seans Tuch und ein paar Münzen gestohlen? Aber dann machte er sich klar, dass Sean durch den Schlag hätte schwer verletzt werden können! Nein, diesen Burschen musste er das Handwerk legen!
»Beschaffe uns fürs Erste eine Unterkunft«, sagte Henri zu Sean. »Ich habe schon gesehen, dass es in Troyes Schildwirtschaften genug gibt. Suche zwei ruhige Zimmer, wo nicht die ganze Nacht gezecht oder gespielt wird. Ich werde versuchen, die Spur der Räuber zu finden. Wir treffen uns um Mitternacht am Hauptportal der Kathedrale. Auf ein Abendessen müssen wir verzichten, denn ich habe kein Geld mehr.«
Sie trennten sich. Henri ritt durch die engen Gassen, die im Rund um die Kathedrale angelegt waren, dicht an dicht standen die Holzhäuser, manchmal drei Stockwerke hoch, ungewöhnlich für eine Landstadt.
Vor den Türen hatten Händler Verkaufsstände aufgestellt. Henri verspürte beim Anblick von gebratenen Vögeln, gekochten Eiern, frisch gebackenem Brot und Trauben gewaltigen Hunger. Und er kam sich plötzlich ganz arm und überflüssig vor. Wie ein Landstreicher, dessen Taschen löchrig sind. Zum ersten Mal konnte er sich all die kleinen Köstlichkeiten des Überlebens nicht leisten, und auch für Sean konnte er nicht sorgen. Er dachte: So geht es den meisten Menschen Tag um Tag, und ich habe es bisher nur nicht gewusst.
Er fragte sich durch und musste manchmal schreien, denn es war laut in Troyes. Obwohl es schon acht Uhr abends war, drang noch Lärm aus den Werkstätten, die Händler schrien, und manchmal schrien auch die Reiter, die rücksichtslos durch die Straßen voller Menschen preschten. Besonders ein Reiter fiel Henri auf. Er trug ein schwarzes Rittergewand mit einer roten Kokarde, einen Federbusch auf den langen braunen Locken, und an seiner Seite steckte ein gebogener glänzender Säbel. Sein schwarzes Schlachtross besaß ein Zaumzeug, das mit Schwanenfedern geschmückt war. Der Ritter war jung, vielleicht zwanzig Jahre alt, und in seinem Gesicht stand nur Hochmut. Entsetzt sprangen Fußgänger zur Seite, als er vorbeipreschte, als legte er es darauf an, jemanden zu verletzen. Dann kam er wieder zurück – und verschwand.
Henri wollte ihm schon in die Parade fahren, aber dann erinnerte er sich, warum er hier war. Er fragte einen Posamentierer, der mit überkreuzten Beinen auf einer Decke saß, ob es in der Stadt ein Siechenhaus gab. Der Handwerker verneinte.
»Draußen, in Richtung auf die großen Lacs, gibt es eins, an der Straße nach Lusigny.«
»Ich suche einen Kranken mit zerfressenen Augenlidern.«
»Dann sucht im Siechenhaus. Dort gibt es Dutzende von der Sorte.«
»Er läuft aber frei herum.«
»Hier in der Stadt?«
»Ich traf ihn draußen im Westen vor der Stadt. Aber dann ritt er nach Troyes.«
»Ihr saht sein Gesicht?«
»Nein. Ich sah nur seine Augen. Sein Gesicht verdeckte er mit einem schwarzen Halstuch.«
»Oh, dann meint Ihr sicher Atabeg. Er hält sich an keine der Auflagen. Er zieht gerade durch Troyes, obwohl man ihn hier nicht haben will und schon mehrmals ausgewiesen hat.«
»Atabeg? Wo finde ich ihn?«
»Sicher in den einschlägigen Spelunken. Es gibt leider viel zu viele davon in dieser Stadt. Schildwirtschaften, in denen nur gefragt wird, ob man zahlen kann – Seuchengefahr hin oder her. Dort trifft sich das Gesindel. Aussätzige, Ausgestoßene, Ungläubige. Oder fragt nach Neville, seinem Kumpanen, mit dem ist er meistens zusammen. Er verkehrt als Tagelöhner auch auf den Bauplätzen der Stadt. Zwielichtiges Gesindel!«
»Neville? Ein kleiner, stämmiger Mann aus Sens mit krausen Haaren und einem auffallend breiten Mund?«
»Ihr kennt ihn? Was fragt Ihr dann! Trollt Euch, ich habe zu tun!«
»Wo sind die einschlägigen Schildwirtschaften?«
»Der Herr schenke Euch ein langes Leben! Genießt es, und benutzt Eure Zeit nicht, um Euch Fragen auszudenken, mit denen Ihr Eure Mitmenschen belästigt, sondern um zu schauen und zu hören. Die Kneipen, in denen Atabeg und Neville verkehren, befinden sich gleich dort drüben. Im Schatten der Kathedrale – wie es sich gehört.«
Henri führte sein Reittier am Zügel durch die Gassen, die jetzt nicht breiter waren als Fuhrwerke. Je näher er der Kathedrale kam, desto höher, aber auch schmaler und baufälliger wurden die Häuser. Es stank nach menschlichem und tierischem Unrat. Dann erreichte er den umfriedeten Teil rund um die Kathedrale.
Auch hier wurde noch emsig gearbeitet. Die Bauhütten kannten keine begrenzten Arbeitszeiten. Überall schlugen Steinmetze und Maurer mit Eisenwerkzeugen die Steinblöcke zurecht, die den Dom noch höher in die Wolken treiben sollten. Ist es nicht frevelhaft, dachte Henri, Kirchen zu bauen, die dem Schöpfer geradewegs in die Augen stechen? Sollten nicht Kirchen bescheidene Flachbauten sein, um die Höhe allein dem Herrn zu überlassen?
Henri sah aus der Schmiede hellen Feuerschein aufsteigen, dort fertigte man wahrscheinlich die ganze Nacht hindurch neue Werkzeuge an. Und er sah, wie die Steinhucker, abenteuerlich vermummte Gestalten in staubgrauen Uniformen, ihre Quader auf dem Rücken über die Steigleitern emporwuchteten.