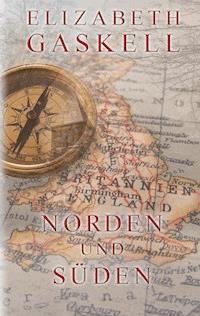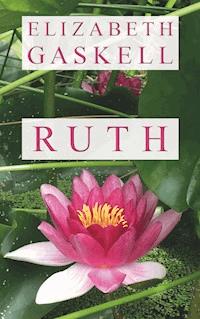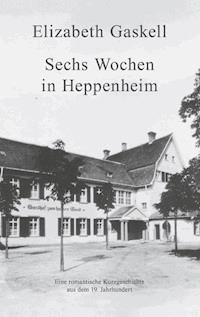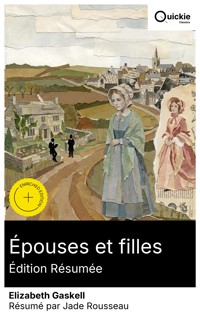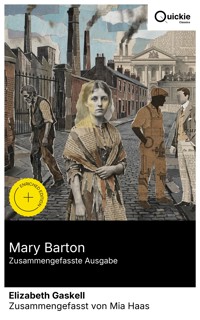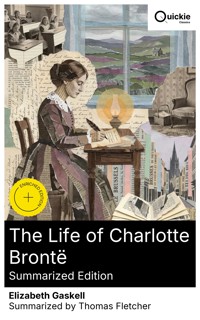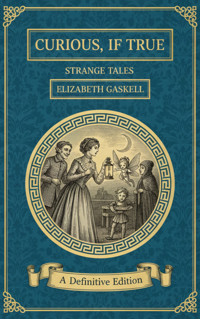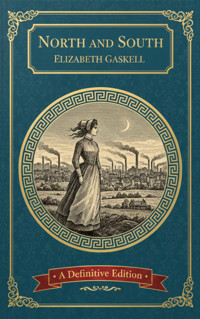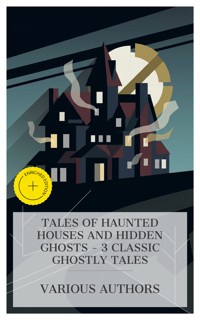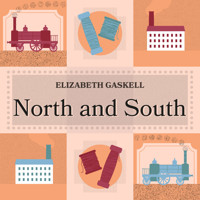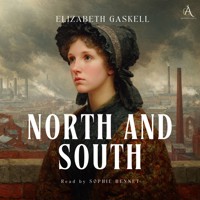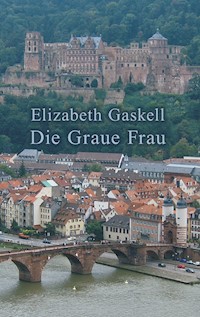
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anna kommt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Tochter eines Heidelberger Müllers zur Welt. Ihr beschauliches Leben erfährt mehrere unerwartete Wendungen, nachdem sie ihre Freundin Sophie in Karlsruhe besucht. - Die Kurzgeschichte "Die Graue Frau" von Elizabeth Gaskell gehört dem in der Viktorianischen Ära so beliebten Genre der "Gothic Fiction" an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elizabeth Gaskell (1810 – 1865) war eine englische Schriftstellerin der Viktorianischen Ära. Sie schrieb fünf Romane, eine Reihe von Kurzgeschichten und eine Biografie ihrer Freundin Charlotte Brontë. Während sie mit ihren Romanen in erster Linie zur Lösung sozialer Probleme beitragen wollte, dienen einige ihrer Kurzgeschichten hauptsächlich der Unterhaltung des Lesers. In Großbritannien erfreuen sich ihre Werke nach wie vor großer Beliebtheit, und einige davon wurden von der BBC verfilmt.
Christina Neth ist eine Übersetzerin mit Zusatzausbildung im Multimediabereich. Von Elizabeth Gaskell übersetzte sie bisher die Romane »North and South« (»Norden und Süden«) und »Ruth« sowie die Kurzgeschichte »Six Weeks at Heppenheim« (»Sechs Wochen in Heppenheim«) ins Deutsche. Ihr erstes selbst verfasstes Buch erschien unter dem Titel »Öl im Getriebe – Basiswissen für Führungskräfte« ebenfalls bei Books on Demand.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Graue Frau
Teil I
Teil II
Teil III
Nachwort
Verzeichnis der Anmerkungen
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten meine Übersetzung von Elizabeth Gaskells Schauergeschichte »The Grey Woman« in Händen. Das Genre der »Gothic Novel« erfreute sich im viktorianischen England großer Beliebtheit. Dass sich auch Gaskell daran versuchte, belegt die Tatsache, dass diese Autorin nicht nur schrieb, um Gesellschaftskritik zu üben, sondern dass sie durchaus schriftstellerisch ambitioniert war.
Nun spielt diese Erzählung aber nicht in Manchester oder London, sondern in Deutschland und Frankreich. Der Grund dafür liegt in Gaskells ausgesprochener Reiselust und ihrer Begeisterung für fremde Länder und Kulturen. Zudem sind die hier beschriebenen, von wilder Natur geprägten Gegenden sehr gut als Schauplätze einer Handlung geeignet, die den Leser frösteln lassen soll.
Um dieses Buch voll und ganz zu genießen, lesen Sie es am besten nach Einbruch der Dämmerung bei Kerzenschein. Tauchen Sie ein in die Lebensgeschichte der Müllerstochter Anna aus Heidelberg, einer jungen Frau, die gegen ihren Willen in einen Wirbel von Ereignissen hineingezogen wird!
Eine schaurig-schöne Lektüre
wünscht Ihnen
Christina Neth
Die Graue Frau
TEIL I
Am Neckarufer steht eine Mühle, zu der sich viele Leute begeben, um – gemäß der in fast ganz Deutschland verbreiteten Sitte – Kaffee zu trinken. Die Lage dieser Mühle ist nicht besonders reizvoll; sie befindet sich auf der (ebenen und unromantischen) Mannheimer Seite von Heidelberg. Der Fluss dreht das Mühlrad mit dem Geräusch von reichlich strömendem Wasser; die Nebengebäude und das Wohnhaus des Müllers bilden ein gut gepflegtes, staubiges Viereck. Wiederum weiter vom Fluss entfernt liegt ein Garten voller Weiden und Lauben und Blumenbeete, die nicht gut gepflegt sind, aber sehr üppig bewachsen mit Blumen und dichten Kletterpflanzen, welche die Gartenlauben miteinander verschlingen und verknüpfen. In jeder dieser Lauben befindet sich ein feststehender Tisch aus weiß gestrichenem Holz und leichte, bewegliche Stühle von derselben Farbe und aus demselben Material.
Ich ging 18411 dort hin, um mit einigen Freunden Kaffee zu trinken. Der stattliche, alte Müller kam heraus, um uns zu begrüßen, da er einige aus unserer Gruppe von früher her kannte. Er war ein Mann von großer Statur, und seine laute, melodische Stimme mit ihrem freundlichen und ungezwungenen Klang, sein brausendes Lachen zur Begrüßung passten gut zu den wachen, leuchtenden Augen, dem feinen Stoff seines Mantels und dem Eindruck der Wohlhabenheit, den das Anwesen insgesamt machte. Es wimmelte von allen möglichen Geflügelarten im Innenhof der Mühle, wo genügend Futter für sie auf dem Boden verstreut lag; doch damit noch nicht zufrieden, nahm der Müller mehrere Handvoll Getreide aus den Säcken und warf sie großzügig den Hähnen und Hennen hin, die ihm in ihrer Gier fast unter die Füße liefen. Und während er das – gleichsam gewohnheitsmäßig – tat, redete er mit uns und rief zwischendurch seiner Tochter und den Dienstmägden die Bitte zu, sie sollten den Kaffee, den wir bestellt hatten, rasch herbeibringen. Er folgte uns zu einer Gartenlaube und sah zu, dass wir zu seiner Zufriedenheit das Beste von allem, was wir uns wünschen konnten, vorgesetzt bekamen; dann verließ er uns, um von einer Laube zur anderen zu gehen und dafür zu sorgen, dass jede Gruppe ordentlich bedient wurde; und auf seinem Weg pfiff dieser große, vermögende, glücklich wirkende Mann leise eine der wehmütigsten Weisen, die ich je gehört habe.
»Seine Familie ist schon seit der alten Zeit der Kurpfalz im Besitz dieser Mühle; oder vielleicht sollte ich eher sagen: besitzt schon seit damals das Anwesen, denn zwei ihrer Mühlen wurden nacheinander von den Franzosen in Schutt und Asche gelegt. Wenn Sie Scherer wütend erleben wollen, sprechen Sie ihn einfach auf die Möglichkeit einer französischen Invasion an.«
Doch in diesem Moment sahen wir den Müller, der immer noch jene schwermütige Weise pfiff, die Stufen hinuntergehen, die von dem etwas erhöht liegenden Garten in den Innenhof der Mühle hinunterführten; und so schien ich meine Chance, ihn wütend zu machen, verloren zu haben.
Wir waren fast fertig mit unserem Kaffee und unserem »Ku-cken«2 und unserem Zimtgebäck, als große Tropfen auf unser dichtes Blätterdach fielen; immer rascher folgten sie aufeinander und kamen durch die zarten Blätter, als rissen sie sie entzwei; all die Leute im Garten stellten sich eilends irgendwo unter oder suchten ihre Kutschen auf, die draußen standen. Mit einem purpurroten Regenschirm, der groß genug war, um allen im Garten Verbliebenen Schutz zu bieten, kam der Müller die Stufen heraufgeeilt, gefolgt von seiner Tochter und ein oder zwei Mägden, von denen jede einen Schirm trug.
»Kommen Sie ins Haus – kommen Sie hinein, sage ich. Es ist ein Sommergewitter und wird diesen Ort für ein oder zwei Stunden unter Wasser setzen, bis der Fluss es fortträgt. Hier, hier!«
Und wir folgten ihm zu seinem eigenen Haus zurück. Zuerst gingen wir in die Küche. Eine solche Anordnung blankgeputzter Kupfer- und Zinngefäße hatte ich noch nie gesehen; und alle hölzernen Sachen waren genauso gründlich geschrubbt. Der rot geflieste Boden war makellos sauber, als wir hineingingen, doch nach zwei Minuten waren vom Herumlaufen vieler Füße überall Wasser- und Schmutzflecken, denn die Küche war voll, und immer noch brachte der wackere Müller unter seinem großen, tiefroten Regenschirm weitere Leute nach drinnen. Er rief sogar die Hunde herein und hieß sie sich unter die Tische legen.
Seine Tochter sagte etwas auf Deutsch zu ihm, und er schüttelte fröhlich den Kopf. Alle lachten.
»Was hat er gesagt?« fragte ich.
»Sie hat ihm gesagt, er solle als Nächstes die Enten hereinbringen; aber wenn noch mehr Leute kommen, werden wir hier tatsächlich ersticken. Bei diesem schwülen Wetter und dem Herd und all den dampfenden Kleidern glaube ich wirklich, dass wir darum bitten müssen, weitergehen zu dürfen. Vielleicht können wir hineingehen und Frau Scherer einen Besuch abstatten.«
Meine Freundin bat die Tochter des Hauses um die Erlaubnis, ein Zimmer im Innern betreten und ihre Mutter besuchen zu dürfen. Die Erlaubnis wurde erteilt, und wir gingen in eine Art Salon mit Blick auf den Neckar – sehr klein, sehr hell und sehr eng. Der Boden war rutschig von Bohnerwachs; lange, schmale Spiegel an den Wänden reflektierten die ständige Bewegung des gegenüberliegenden Flusses – ein weißer Porzellanofen mit ein paar altmodischen Messingornamenten – ein mit Utrechter Samt bezogenes Sofa, ein Tisch davor und ein gestickter Läufer darunter – eine Vase mit künstlichen Blumen – und zu guter Letzt ein Alkoven mit einem Bett darin, auf dem die gelähmte Frau des guten Müllers lag und eifrig strickte, bildeten die Einrichtung. Meine Aufzählung klingt, als ob dies alles gewesen wäre, was in dem Zimmer zu sehen war; doch als ich still dasaß, während sich meine Freundin lebhaft in einer Sprache unterhielt, die ich nur halb verstand, fiel mein Blick auf ein Gemälde in einer dunklen Ecke des Raums, und ich stand auf, um es näher zu betrachten.
Es war das Bildnis eines jungen Mädchens von äußerster Schönheit und offenbar mittlerem Rang. Das Gesicht wies eine vornehme Sensibilität auf, als ob die junge Frau beinahe vor dem eindringlichen Blick zurückwiche, den der Maler notwendigerweise auf sie gerichtet haben musste. Es war nicht übermäßig gut gemalt, doch aufgrund dieses starken Eindrucks besonderer Natur, den ich gerade zu beschreiben versucht habe, hatte ich das Gefühl, dass die Porträtierte gut getroffen sein musste. Anhand der Kleidung schätzte ich, dass es in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gemalt worden war. Und später hörte ich, dass ich damit richtig lag.
Es entstand eine kleine Pause in der Unterhaltung.
»Würdest du Frau Scherer fragen, wer das ist?«
Meine Freundin wiederholte die Frage auf Deutsch und erhielt eine lange Antwort. Dann drehte sie sich zu mir um und übersetzte sie mir.
»Es ist das Bildnis einer Großtante ihres Ehemanns.« (Meine Freundin stand neben mir und besah sich das Bild mit teilnahmsvoller Neugier.) »Schau! Hier steht der Name auf der aufgeschlagenen Seite dieser Bibel: ›Anna Scherer, 1778‹. Frau Scherer sagt, in der Familie sei die Geschichte überliefert, dass dieses hübsche Mädchen mit seinem an Rosen und Lilien erinnernden Teint seine Farbe durch Furcht so vollständig verloren habe, dass es unter dem Namen ›die Graue Frau‹ bekannt geworden sei. Sie spricht davon, dass diese Anna Scherer in einem Zustand lebenslanger Todesangst gelebt habe. Aber sie kennt keine Details und verweist mich diesbezüglich an ihren Mann. Sie glaubt, er besitze einige Schriftstücke, die das Original dieses Gemäldes für seine Tochter aufzeichnete, welche in eben diesem Haus starb, nicht lange, nachdem unsere Freundin hier heiratete. Wir können Herrn Scherer nach der ganzen Geschichte fragen, wenn du möchtest.«
»Oh ja, bitte tu das!« sagte ich. Und da unser Gastgeber in diesem Moment hereinkam, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen und um uns mitzuteilen, dass er aus Heidelberg Kutschen kommen lasse, die uns heimbringen sollten, weil er keine Hoffnung auf ein Nachlassen des Regens habe, ging meine Freundin, nachdem sie sich bei ihm bedankt hatte, zu meiner Bitte über.
»Ah!« sagte er, wobei sich sein Gesichtsausdruck veränderte. »Die Tante Anna hatte eine traurige Lebensgeschichte. Und alles nur wegen eines dieser verwünschten Franzosen; und ihre Tochter hatte darunter zu leiden – Cousine Ursula, wie wir alle sie nannten, als ich ein Kind war. Natürlich war die gute Cousine Ursula ebenso sein Kind. Die Kinder werden von den Sünden ihrer Väter heimgesucht. Die Dame wüsste gern alles darüber, nicht wahr? Tja, es existiert ein Schriftstück – eine Art Entschuldigung, die Tante Anna für die Auflösung des Verlöbnisses ihrer Tochter verfasste – oder eher Tatsachen, die sie enthüllte und die Cousine Ursula davon abhielten, den Mann, den sie liebte, zu heiraten; und so wollte sie nie irgendeinen anderen guten Burschen haben, sonst – so habe ich sagen hören – wäre mein Vater dankbar dafür gewesen, sie zur Frau nehmen zu können.« Die ganze Zeit über suchte er etwas in der Schublade eines altmodischen Sekretärs, und jetzt drehte er sich zu uns um, in der Hand ein Bündel vergilbter, von Hand beschriebener Papiere, die er meiner Freundin mit den Worten überreichte: »Nehmen Sie sie ruhig mit nach Hause, und wenn Ihnen daran gelegen ist, unsere unleserliche deutsche Schrift zu entziffern, können Sie sie behalten, solange Sie möchten, und sie in aller Ruhe lesen. Ich muss sie nur wiederhaben, wenn Sie mit ihnen fertig sind – das ist alles.«
Und so gelangten wir in den Besitz des folgenden handgeschriebenen Briefs, den zu übersetzen und an einigen Stellen zu kürzen unsere Beschäftigung an so manchem langen Abend im darauffolgenden Winter wurde. Am Anfang bezog sich der Brief auf den Schmerz, den sie ihrer Tochter bereits zugefügt hatte, indem sie sich ohne eine Erklärung ihren Heiratsplänen entgegengestellt hatte; aber ich bezweifle, dass wir ohne den Hinweis, den uns der gute Müller gegeben hatte, auch nur dies aus den leidenschaftlichen, gebrochenen Sätzen hätten herauslesen können, die uns zu der Vorstellung brachten, dass sich eine Szene zwischen der Mutter und der Tochter – und möglicherweise einer dritten Person – zugetragen hatte, kurz bevor die Mutter angefangen hatte zu schreiben.
*****
»Du liebst deine Tochter nicht, Mutter! Es ist dir gleich, ob ihr das Herz bricht!« Oh, Gott! Das sind die Worte meiner innig geliebten Ursula, die mir in den Ohren klingen, als würde mir ihr Klang noch die Ohren füllen, wenn ich im Sterben liege. Und ihr armes verweintes Gesicht steht zwischen mir und dem Rest der Welt. Mein Kind! Herzen brechen nicht. Das Leben ist sehr hart und auch recht schrecklich. Aber ich werde nicht für Dich entscheiden. Ich werde Dir alles erzählen; und Du sollst die Last der Entscheidung tragen. Ich mag mich irren; von meinem Verstand ist nicht viel übrig, und ich hatte nie viel davon, glaube ich; aber ein Instinkt dient mir anstelle eines Urteilsvermögens, und dieser Instinkt sagt mir, dass Du und Dein Henri nie heiraten dürft. Doch ich mag falsch liegen. Ich würde mein Kind gern glücklich machen. Lege diesen Brief dem guten Pfarrer von Schriesheim vor, falls Du nach dem Durchlesen Zweifel hast, die Dich unsicher machen. Aber ich werde Dir jetzt alles erzählen unter der Bedingung, dass zwischen uns nie ein Wort über das Thema fallen wird. Es würde mich umbringen, wenn ich dazu befragt werden würde. Es würde mir zwangsläufig alles wieder vor Augen führen.
Mein Vater besaß, wie Du weißt, die Mühle am Neckar, in der Dein vor Kurzem gefundener Oheim, Onkel Scherer, jetzt lebt. Du erinnerst Dich an die Überraschung, mit der wir dort ein Jahr vor der letzten Weinlese empfangen wurden. Daran, wie Dein Onkel mir nicht glaubte, als ich sagte, ich sei seine Schwester Anna, die er lange für tot gehalten hatte, und wie ich Dich unter das Bild führen musste, das vor langer Zeit von mir gemalt worden war, und ich für jeden einzelnen Gesichtszug die Ähnlichkeit zwischen dem Gemälde und Dir aufzeigen musste; und wie ich, während ich redete, die Einzelheiten aus der Zeit, zu der es angefertigt worden war, zuerst mir und dann mit Worten ihm ins Gedächtnis rief: die fröhlichen Gespräche, die wir – ein glücklicher Junge und ein glückliches Mädchen – damals führten; die Anordnung der Möbel im Zimmer; die Gewohnheiten unseres Vaters; den inzwischen gefällten Kirschbaum, dessen Schatten auf mein Schlafzimmerfenster fiel, durch welches sich mein Bruder immer wieder einmal zwängte, um auf den höchsten Ast zu springen, der sein Gewicht trug, und mir von dort aus seine mit Früchten beladene Mütze zur Fensterbank zurück zu reichen, auf der ich saß, zu krank vor Angst um ihn, um mir viel aus dem Kirschenessen zu machen.
Und schließlich gab Fritz nach und glaubte mir, dass ich seine Schwester Anna sei, wie wenn ich von den Toten auferstanden wäre. Und Du erinnerst Dich daran, wie er seine Frau hereinholte und ihr sagte, dass ich nicht tot sei, sondern noch einmal zu meinem alten Zuhause zurückgekehrt sei, so sehr ich mich auch verändert hätte. Und sie glaubte ihm kaum und musterte mich mit einem kalten, misstrauischen Blick, bis ich schließlich – denn ich kannte sie von früher als Babette Müller – sagte, dass ich wohlhabend sei und mich nicht an Freunde wenden müsse, um etwas von ihnen zu bekommen. Und dann fragte sie – nicht mich, sondern ihren Mann – warum ich so lange nichts von mir habe hören lassen und alle – Vater, Bruder, jeden, der mich in meinem eigenen trauten Heim liebte – in dem Glauben gelassen hätte, dass ich tot sei. Und dann sagte Dein Onkel (erinnerst Du Dich?), dass er nicht mehr