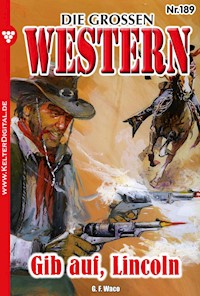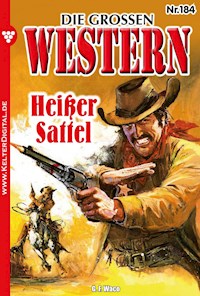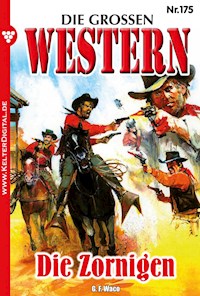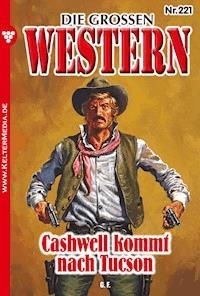Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). »Hast du mich verstanden?« fragt Duncan Osborn ganz ruhig. »Hörst du, mich, Bellman?« Josh Bellman liegt am Boden und hört Osborns Stimme wie aus weiter Ferne. »Duncan, eines Tages wirst du über deinen eigenen Schatten fallen«, antwortet Bellman mit dem zähen Widerwillen, der ihm die Behandlung eingebracht hat. »Eines Tages, Duncan, dann liegst du so wie ich im Dreck. Und niemand wird dich bemitleiden oder es bedauern.« »Er hat immer noch nicht genug«, meldet sich Gene Haward, Osborns Vormann, mit seiner tiefen und brummenden Stimme. »Boß, er ist renitent wie diese ganze verdammte Stadt.« Osborn sieht die Blicke seiner Reiter auf sich liegen. Er sieht seine Männer, alles harte und rauhe Burschen, die er selber aussuchte und die jeden seiner Befehle ausführen werden, was es auch immer ist. »Halt das Maul«, sagt Osborn scharf und sieht seinen Vormann so an, als wenn Haward ein kleines Kind ist und gesagt bekommen muß, was es falsch macht. »Soweit ist es also, Josh. Ich habe euch nicht geraten, diesen Irrsinn zu begehen. Ich habe euch gewarnt. Ihr wählt meinen Mann zum Sheriff und damit fertig. Jonas ist zu alt, das weiß jeder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 271–
Das Aufgebot
G.F. Waco
»Hast du mich verstanden?« fragt Duncan Osborn ganz ruhig. »Hörst du, mich, Bellman?«
Josh Bellman liegt am Boden und hört Osborns Stimme wie aus weiter Ferne.
»Duncan, eines Tages wirst du über deinen eigenen Schatten fallen«, antwortet Bellman mit dem zähen Widerwillen, der ihm die Behandlung eingebracht hat. »Eines Tages, Duncan, dann liegst du so wie ich im Dreck. Und niemand wird dich bemitleiden oder es bedauern.«
»Er hat immer noch nicht genug«, meldet sich Gene Haward, Osborns Vormann, mit seiner tiefen und brummenden Stimme. »Boß, er ist renitent wie diese ganze verdammte Stadt.«
Osborn sieht die Blicke seiner Reiter auf sich liegen. Er sieht seine Männer, alles harte und rauhe Burschen, die er selber aussuchte und die jeden seiner Befehle ausführen werden, was es auch immer ist.
»Halt das Maul«, sagt Osborn scharf und sieht seinen Vormann so an, als wenn Haward ein kleines Kind ist und gesagt bekommen muß, was es falsch macht.
»Soweit ist es also, Josh. Ich habe euch nicht geraten, diesen Irrsinn zu begehen. Ich habe euch gewarnt. Ihr wählt meinen Mann zum Sheriff und damit fertig. Jonas ist zu alt, das weiß jeder. Hast du gehört, du Narr?«
Josh Bellman ist wahrhaftig nicht klein. Er ist Schmied und hat Muskeln wie ein Bär, aber gegen sechs Mann war er machtlos. Drei kamen vorn herein, drei hinten. Er sah nur die Männer vorn durch das große Tor kommen, das war sein Fehler.
Jetzt liegt er da, denn schon der erste Schlag des Mexikaners, der ihm den Revolver zwischen die Ohren knallte, reichte aus, um ihn fertigzumachen. Dann fielen die anderen über ihn her und spielten Fangball mit ihm. Es dauerte keine fünf Minuten, dann lag er am Boden.
»Oh, wie groß bist du eigentlich, Duncan?« fragt er heiser und fühlt beim Sprechen die Spannung der Unterlippe, wie ihn auch die Haut über den Wangenknochen schmerzt.
»Duncan, in diesem Land hast nicht nur du recht, auch wir haben unsere Rechte. Wir wählen den Mann, den wir wollen. Das wirst du sehen. In einer Woche ist die Wahl. Dann wirst du deine Antwort bekommen.«
»Du meinst, ich bin nicht mehr der alte Osborn, was«, faucht Duncan Osborn wild. »Diese Schollenbrecher, diese Hungerleider und Viehdiebe stehlen und betrügen. Du hilfst ihnen auch noch. Der Store von Jenkins verdient an ihnen, die anderen Leute hier verdienen an ihnen. Und daß ihr einmal an mir verdient habt, das zählt nicht mehr, wie? Ich werde euch zum Teufel jagen, verstanden?«
Er bekommt es fertig zu lachen, obwohl er sicher ist, daß der Alte jetzt verrückt werden wird. Aber Josh Bellman hat keine Furcht vor Osborn.
»Duncan, du bist noch immer groß, vor dir ducken sich alle, aber du hast etwas vergessen«, sagt er grimmig lachend. »Du hast das Gesetz vergessen. Wegen dieser Prügelei werde ich mich nicht aufregen, denn du bist ein Narr, dem man das nicht übelnehmen kann. Ich arbeite für jeden Mann, der fähig ist, zu bezahlen. Ganz gleich, ob er ein Schollenbrecher ist oder ein Rancher. Versuch nur, uns in die Hölle zu schicken, dann wirst du selber in ihr stecken. Und jetzt verschwinde aus diesem Bau, das sage ich dir. Gleich habe ich genug, dann wirst du…«
Osborn starrt ihn an. Die ganzen Jahre haben sie sich vor ihm geduckt, die ganzen Jahre wagte es niemand, ihm nicht zu gehorchen. Es ist wie eine Seuche, die ausgebrochen ist und die die Stadt vergiftet hat. Die Bürger der Stadt machen ihre Geschäfte mit den Siedlern und mit ihm. Und diese Geschäfte mit den verhaßten Schollenbrechern sind größer, als es jemals die mit ihm waren.
»Ihr Geldsäcke«, sagt er wild. »Bekommt ihr nicht genug in euren Sparstrumpf? Ich werde euch die Kredite kündigen, und…«
»Gar nichts, mein Freund«, erwidert Bellman heiser. »Du hast einen Fehler gemacht, als du deinen Jungen nicht angebunden hast, Duncan. Von dir waren wir einige Dinge gewohnt, aber von einem grünen Jungen schlucken wir nichts, gar nichts. Diese Stadt hat genug von den Osborns. Nicht so sehr von dir, mein Freund. Aber bedanke dich bei deinem Sohn und seinem Rudel Wölfe. Dort suche deinen Ärger. Wir werden Jonas Bradford wählen. Ich werde es tun, die anderen auch. Und Haward kann zum Teufel gehen. Du feiger Nackenschläger, wenn ich dich mal allein erwische und du nimmst nicht deine Kanone, dann versuche es nochmal.«
Haward starrt auf ihn hinunter. Er ist ein zäher und etwas düster wirkender Mann, der einen Rindermann abgibt, wie man sich keinen besseren wünschen kann. Er ist hart, zäh, ausdauernd und schnell mit seinen beiden Revolvern. Seine Größe beträgt fast einen Meter und neunzig Zentimeter, er ist die rechte Hand Osborns und als Revolverschießer gefürchtet. Und er deckt Clay-Boy immer.
»Boß, ich denke, er wird es lernen müssen«, sagt Haward giftig. »Laß mich nur machen, er lernt es jetzt und hier.«
Osborn ist so wütend wie nie. Sie wollen Jonas Bradford, den alten Sheriff, der seine achtundfünfzig Jahre auf dem Buckel hat und fast mit Osborn zugleich in das Land südwestlich des Pecos kam, für ein weiteres Jahr wählen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, es aufzuhalten.
Eine Sekunde zaudert der alte Riese, dann dreht er sich scharf um und geht zum Amboß.
Dort bleibt er stehen und verschränkt die Arme über der Brust.
»Macht weiter«, sagt er halsstarrig. »Und hört nicht eher auf, bis er fertig ist. Das ist ein Befehl.«
Sie fallen wie ein Rudel Wölfe über ihn her. Als er zerschlagen am Boden liegt, reiten sie aus der Stadt.
*
Sheriff Bradford verläßt sein Office und geht langsam die Straße herunter, bis er an die Frachtwagenstation kommt. Der Hof ist bis auf drei Wagen leer. Kein Mann zu sehen, der hier arbeitet. Die beiden großen Ställe, der Wagenschuppen und das Warengebäude liegen unter dem Schein der heißen Sonne wie ausgestorben da.
Einen Augenblick bleibt Bradford stehen und zieht die Luft ein. Er sieht aus dem Schornstein des Hauses die Rauchfahne steigen und riecht den Bratenduft.
Die drei Wagen stehen am Stall. Bradford geht weiter und kommt an den Wagen vorbei. Links von ihm ist die Haustür, dort geht es zum Büro der Gesellschaft, die Joel eingestellt hat. Joel versieht keine andere Arbeit hier, als die Pferde zu versorgen, die Warenlisten zu führen und sich um die Ladungen der Wagen zu kümmern.
Als Bradford in der Tür ist, sieht er den niedrigen und vom Rauch geschwärzten Raum vor sich leer liegen. Auf dem Herd steht noch eine Pfanne, in ihr knistert noch leise das Fett, aber Joel McRead ist nicht da.
Der Sheriff macht einen Schritt, als jemand rechts von ihm leise lacht.
Starr und steif bleibt Bradford stehen, sieht sich halb um und kann Joel, den Zinnteller auf den Knien, das Messer in der einen und das Stück Bratenfleisch in der anderen Hand, auf der Bank sitzen sehen.
Joel McRead sitzt so hinter den Wagen auf der Bank am Haus verborgen, daß Bradford ihn wirklich nicht entdecken konnte.
McRead hängen die schwarzen Haare wirr in die Stirn, die Brandyflasche steht neben ihm auf der Bank, und Bradford dreht sich nun ganz um. Er geht die wenigen Schritte bis zum ersten Wagen, zwängt sich durch die Lücke und bleibt mit hängenden Armen vor McRead stehen.
»Nun, Indianer, du siehst müde aus«, sagt McRead langsam. »Du hebst die krummen Beine nicht mehr weit genug an und starrst vor dich hin. Hast du Ärger?«
Natürlich wird er längst wissen, was beim Schmied passierte. Aber es ist seine Eigenart, sich aus allem Streit herauszuhalten.
»Du sitzt hier ganz gut, wie? Du hast Brandy und ein Essen. Und alles andere geht dich nichts an, wie?«
»Ja«, murmelt Joel McRead heiser. »Wie genau du das weißt. Ich würde an deiner Stelle auch einen ruhigen Platz suchen, mit einer Flasche Brandy und einem Stück Fleisch.«
Das sagt er so, als wenn er über das Wetter redet.
»Es wird Ärger geben«, brummt Bradford gallig. »Ich bin noch nie davongelaufen, Joel. Hast du verstanden?«
Joel McRead lächelt sanft und wischt sich mit der Hand über den Mund, ehe er die Brandyflasche nimmt und einen Schluck dem Braten folgen läßt.
»Nur ein Narr bleibt stehen, wenn er drei Bären sieht und keine Waffe bei sich hat«, sagt er dann und sieht den Sheriff mit leichtem Spott an. »Du bist ein tapferer Mann, alle Achtung, Jo. Aber auch tapfere Männer sind oft Narren.«
Bradford sieht auf Joels Hand, die die Flasche wegstellt. Und diese Hand zittert leicht.
»Du würdest an meiner Stelle auch nicht weglaufen, Freund Joel«, sagt er dann ganz ruhig. »Ich denke, du weißt, wie es ist, wenn ein Mann erst einmal beginnt, vor etwas wegzulaufen. Er kann nicht mehr stehenbleiben, so schwach ist er dann.«
Joel McRead hebt mit einem Ruck den Kopf und macht eine Bewegung, als wenn er aufstehen will. Dann jedoch sinkt er wieder auf die Bank zurück und greift wieder zur Flasche.
Der Hieb hat ihn getroffen. Er weiß genau, was Bradford meint und sieht düster zu Boden.
»Du bist nicht ich«, erwidert er spröde. »Gut, ich laufe weg. Es ist etwas anderes, ob du einen Mann erschießt oder ein Kind, Jo. Willst du mich aufstacheln, dir zu helfen? Dann laß dir gesagt sein, daß mir niemand helfen kann und ich keine Treiberpeitsche brauche. Ich will noch hundert Tage hier sitzen und einen ruhigen Tag haben. Ist das klar?«
»Ja, es ist klar«, murmelt Bradford. »Du brauchst mir nicht zu sagen, daß du langsam geworden bist und nicht mehr Mut genug hast, deinen Colt zu nehmen. Lauf nur immer weiter weg, Joel, eines Tages fällst du in einen Abgrund. Das wird dann sein, wenn diese Stadt Duncan gehört. Dann fahren eure Wagen nicht mehr für die Siedler. Ihr werdet keine Arbeit mehr haben. Und dann…«
»Dann gehe ich weiter«, unterbricht ihn McRead kühl. »Es gibt nicht überall Osborns. Laß mich in Ruhe, Jo.«
»Du hattest im Del-Rio-Streifen an der Grenze einen Namen, aber du bist dort weggelaufen, nachdem das Kind tot war«, sagt der Sheriff bitter. »Es war nur ein dummer Zufall, Joel, ich frage mich, wie lange die Feigheit eines Mannes anhalten kann? Bei dir dauert sie schon drei Jahre, und…«
»Halte den Mund, du Narr«, knurrt Joel McRead. »Ich kann nicht mehr schießen. Ich kann nicht einmal mehr einen Revolver auf jemand anschlagen. Ich sehe immer das Gesicht des Kindes vor mir und keinen Mann. Soll ich dir sagen, daß ich zu zittern beginne, wenn ich meine Hand an einen Revolver bringe? Scher dich weg, du hast keine Hilfe an mir. Ich bin ein Feigling, aber sage es mir nicht wieder. Schlagen kann ich immer noch.«
»Du trägst nie einen Revolver«, antwortet Bradford. »Du hast alles, was ein Mann haben kann, aber du bist ein Narr. Eines Tages wird es hier Veränderungen geben. Dein Boß wird nicht mehr Jingler heißen, sondern Osborn. Mach nur so weiter. Der Mann, der es mit einem ganzen Rudel Banditen allein aufnahm, der Mann, der eine Zeit den Orden eines Townmarshals trug, der Mann taugt nicht einmal mehr dazu, ein Rind zu erschießen. Du bist ein Feigling, Joel.«
Joel McRead ist kreidebleich und schluckt, aber er beherrscht sich eisern. Dann steht er doch auf und macht einen großen Bogen um die Wagen. Er hat die Flasche unter dem Arm und die Fleischbrocken auf dem Teller in der Hand. Es sieht aus, als wenn ein Hund um einen wilden Wolf aus Furcht einen Bogen macht. Bradford dreht sich mit, lehnt sich neben die Tür und sieht ihn von der Seite an.
»Haward lacht sich krank, er lacht immer noch seit dem Tag vor einem Jahr«, sagt Bradford, als McRead in die Tür tritt und ihn nicht ansieht. »Jemand warf dir einen Revolver zu, nachdem er dich gefordert hatte, wie? Ich sehe es heute noch vor mir, Joel. Es war ein ziemlicher Spaß, dich wie einen Hund aus der Bodega schleichen zu sehen. Es war ein mächtiger Spaß, der große Joel McRead läuft vor einem Wichtigtuer davon und kneift. Und die Stadt sieht zu. Sie lacht sich tot über einen Mann.«
»Du Narr«, sagt McRead wild und wirbelt herum. »Du Narr, ich sollte…«
Und seine Hand hat den Blechteller hochgenommen, als wenn er ihn dem Sheriff an den Kopf werfen will. Dann sinkt die Hand herab und McRead sagt tonlos: »Verschwinde, geh aus der Stadt, ich helfe dir nicht. Ich will nicht, verstehst du? Ich kann nicht einmal mehr, wenn ich auch wollte. Geh zum Teufel, Sheriff.«
Er macht zwei lange Schritte, verschwindet hinter der Tür und wirft sie krachend hinter sich zu.
Draußen bleibt Bradford stehen und sieht auf die geschlossene Tür. Er hört innen den Blechteller klirren und einen wilden Fluch. Dann dreht er sich um und geht schlurfend los. Seine Hoffnung, Joel McRead als Deputy zu bekommen, hat sich zerschlagen.
Zurück bleibt der Frachtwagenhof und ein Mann, der in einem rauchgeschwärzten Raum steht und auf den verbogenen Teller in der Herdecke starrt. »Der Narr«, sagt McRead bitter und wirft die Flasche in das Feuer, daß die Splitter herumfliegen. »Der Narr, selbst wenn ich wollte, ich kann nicht. Damals, dieser verdammte Haward. Ich habe es geschluckt und mich selber beinahe aufgefressen. Ich war ein Feigling, wie es keinen größeren Feigling geben kann. Und sie haben gelacht, daß es in meinen Ohren gellte. Ich werde noch verrückt.«
Er geht los und steigt eine Treppe hoch. Auf dem Boden ist ein Verschlag, in dem sein Bett steht. Unter dem Bett ist eine Kiste und darin liegen seine beiden Revolver, die er seit drei Jahren nicht mehr getragen hat.
Joel McRead macht die Kiste auf, nimmt den Gurt und starrt auf die beiden Revolver. Als er den Gurt umlegt und die Revolverkolben berührt, zittern seine Hände.
»So ist das«, sagt er stockheiser. »So ist das. Und ich konnte einmal alles, was ich wollte. Heute kann ich gar nichts mehr, nicht einmal die Hände ruhig halten.«
Er versucht es zweimal, dreimal, aber er zuckt jedesmal von den Kolben zurück, als wenn er sich verbrannt hat. Schließlich hockt er sich auf das Bett und stützt den Kopf in beide Hände.
»Ich kann nicht«, sagt er dumpf. »Ich will, aber ich kann es einfach nicht. Die Hölle, ich bin ein verdammter Schwächling.«
Als er aus dem Fenster blickt, sieht er die leere Straße vor sich.
*
Einsam geht Bradford in der Dunkelheit seine Runde. Er kommt bis zum Patio der Bodega, den er über die Mauer hinweg gerade einsehen kann und lehnt sich an den Adobelehmklotz des Tores.
In der Bodega spielt Ramon Nanchez mit seinem Bruder schwermütige Mexikanerlieder, und die Girls sitzen traurig herum. Es ist nichts los in der Stadt. Aus dem Sägewerk ist niemand da, Bellman, der öfter herkommt, hat heute wohl keine Lust und die anderen Männer sind auch zu Hause geblieben.
Langsam stößt sich Bradford von der Wand ab und geht unter den Ranken, die mit ihren Blüten ein Dach über dem Eingang der Bodega bilden, hinein.
Bei seinem Eintritt wendet alles die Köpfe, denn die Schwingtür klappt laut. Hinter dem Tresen steht Largo Montero. An einem Tisch sitzen zwei Handelsreisende und Ben Fieldman, der Schuhmacher des Ortes, der sonst immer mächtig lustig ist und seine Frau, die ihm durchgebrannt ist, beim Wein und Tequila vergessen will.
»Hallo, Jo«, sagt Largo, und sein schmales Gesicht mit dem schwarzen Haar, das ölig glänzt, verzieht sich freundlich. »Nimm deinen Drink, Amigo.«
»Ja, du sollst auch einen nehmen«, murmelt Bradford ruhig. »Nichts los bei dir.«
»Schlechte Zeiten, Jo«, lächelt der Mexikaner. »Nicht nur für mich, sí?«
»Aha«, sagt Bradford, trinkt sein Glas Tequila und lächelt den Girls zu. »Keine Siedler hier, keine Cowboys. Ich werde euch bedauern, Muchachas, wenn ich Zeit habe.«
»Vielleicht hast du bald sehr viel Zeit, Amigo«, murmelt Largo heiser.
»Jo, meine Freunde und ich denken, solange du hier warst, war alles ruhig und jeder konnte verdienen. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich vielleicht welche besorgen.«
Jo Bradford nickt langsam und denkt einen Augenblick an Largos Freunde. Nicht, daß Largo ein schlechter Mensch ist, aber seine Freunde kommen und gehen und niemand weiß, woher und wohin. Es sind Mexikaner, ein paar Amerikaner und Cape Folliard ist auch dabei.
»Vielen Dank, Largo, aber ich glaube, ich helfe mir lieber selber«, sagt Bradford freundlich. »Ich will deine Freunde nicht schlecht machen, aber ich weiß nicht, was sie eigentlich arbeiten. Ist Manuela nicht hier?«
»Sie ist zu ihrer Tante am Rio Conchos gefahren, Jo. Wolltest du sie sprechen?«
»No, mir fällt nur auf, daß sie nicht hier ist. Largo, bestell deinen Freunden, ich bin immer mit allem allein fertig geworden, ich werde es auch jetzt. Hallo, wer kommt denn da?«
In die Bodega kommt Neal Jacobus.
Mit einem Schlag ist es totenstill geworden.
Neal Jacobus starrt genauso verstört auf den lächelnden Sheriff wie Largo Montero. Wenn Bradford nicht alles täuscht, ist Jacobus nicht von der Straße gekommen, sondern muß sein Pferd von hinten auf den Hof gelenkt haben.
»Bueno«, sagt Largo stockheiser in die gespenstische Stille hinein. »Bueno, Jo, ich möchte keinen Krach in meiner Bodega, escapito? Neal, wenn du Streit suchst, werde ich dir nicht helfen. Hast du verstanden?«
Das Halbblut schielt den Sheriff tückisch an. »Er ist ja noch Sheriff, ich will keinen Ärger mit ihm machen. Ist Felipe nicht hier?«
»No, wollte er kommen?« fragt Largo erstaunt. »Setz dich doch hin, Neal, du kannst hier warten. Tequila…?«
Er packt ihn am Arm, zieht ihn mit in die Ecke und drückt ihn auf die Bank.
Brummend hockt sich Jacobus hin, sieht starr an Bradford vorbei und Jo nimmt den Hut hoch.
»Adios, Largo, Señoritas«, sagt der Sheriff lächelnd. »Und einen schönen Abend noch.«
Er geht hinaus, die Tür klappt hinter ihm zu, und die Nacht umfängt ihn.
Rechts von ihm ist das Hoffenster der Bodega offen. Bradford steht in der Ecke und hört Jacobus heiser sagen: »He, Largo, gib mir eine ganze Flasche. Ich habe Durst.«
Largo Montero brummelt irgend etwas, was Bradford nicht verstehen kann. Dann klirrt ein Glas, und innen lacht jemand hell.
Eins der Girls muß wohl zu Jacobus kommen, dann sagt er heiser: »Scher dich weg, ich kann meinen Tequila allein trinken. He, Juana, tanz lieber.«
Das Gitarrenspiel innen wird lauter, Tische werden gerückt und Stühle poltern. Dann spielt Ramon Nanchez mit seinem Partner zum Tanz auf. Die Kastagnetten klappern, die Absätze von Juana Alierte tacken laut, und die Zuschauer klatschen den Takt zur Musik.